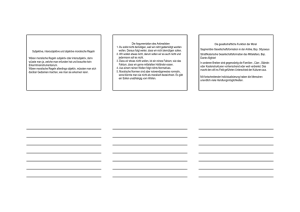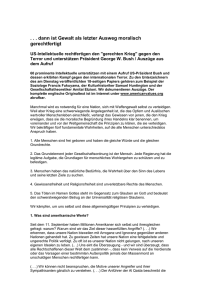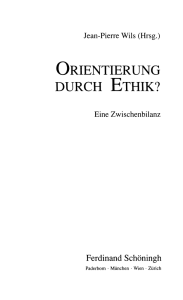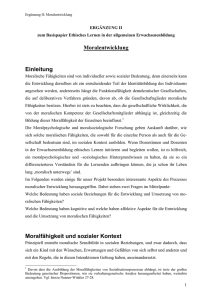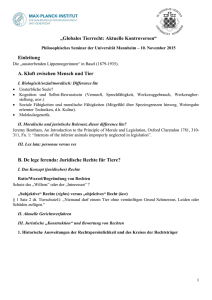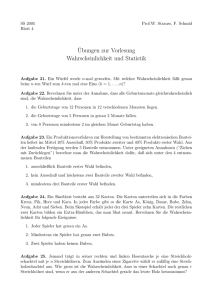Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren
Werbung

Klaus Peter Rippe, Karlsruhe Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren Im Folgenden sollen allgemeine ethische Grundsätze ermittelt werden, die im Umgang mit Risiken zu beachten sind. In Risikosituationen müssen Handelnde davon ausgehen, dass ein negativ zu beurteilendes Ereignis mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Gegenbegriff zum Begriff „Risiko“ ist der Begriff der Chance, wo es um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintretende positiv zu beurteilende Ereignisse oder Zustände geht. Risiken sind immer durch zwei Faktoren gekennzeichnet: die Wahrscheinlichkeit, mit der das negative Ereignis eintritt, und das zu erwartende Schadensausmaß. Viele, ja die meisten Risikosituationen sind durch Unsicherheiten über die Eintrittswahrscheinlichkeit oder Unsicherheiten bezüglich des Schadensausmaßes gekennzeichnet, teilweise auch durch beides. Oft sind bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit nur qualitative Angaben möglich, die auf groben Einschätzungen beruhen. Solche Situationen, in denen eine numerische Bezifferung der Wahrscheinlichkeit nicht möglich ist, betrachte ich im Folgenden als eine Unterklasse von Risiken. Situationen, wo über die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens überhaupt nichts gesagt, also nicht einmal grobe Schätzungen vorgenommen werden können, dürfen dagegen nicht als Risiken bezeichnet werden. Hier hätten wir eine Situation der Ungewissheit vor uns. Auch die Schadenshöhe muss nicht immer eindeutig bestimmbar sein. Aber wiederum sind Risiken dadurch gekennzeichnet, dass man das Schadenspotential zumindest grob abschätzen kann. Ethische Fragen stellen sich sowohl in Situationen, wo eine Person oder Institution ein für andere bestehendes Risiko minimieren kann, wie dann, wenn eine Person oder Institution sich selbst oder andere Risiken aussetzt. Die Anwendung riskanter Technologien, die oftmals im Zentrum ethischer Diskussionen steht, ist nur eines von vielen Beispielen des zweiten Themenfelds, in dem andere einem Risiko ausgesetzt werden. Wenn im Folgenden von Risikoexpositionen die Rede ist, wird sich dies nur auf diesen zweiten Bereich beziehen. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 518 Klaus Peter Rippe In Risikodebatten wird die Schadenskomponente in der Regel auf das „für einen selbst Schlechte“ bezogen, auf Einkommens- oder Wohlstandsverluste, Leid, körperliche Verletzungen, Erkrankungen oder den Tod. Allerdings ist die Fokussierung auf einen solchen prudentiellen Schadensbegriff irreführend. Eine der Thesen dieses Aufsatzes ist, dass der Bereich dessen, was man als private Risiken bezeichnet, nur dann zu bestimmen ist, wenn man zusätzlich zu einem solchen prudentiellen Schadensbegriff moralische Rechte und Pflichten in Betracht zieht. Geht es um die ethische Klärung von Risikoexpositionen, sollte man, dies die zweite These, auf der Anwendungsebene gänzlich von einer prudentiellen Schadenstheorie Abstand nehmen. Für das Feld der Risikoexpositionen, wo eine Person andere einem Risiko aussetzt, werde ich, dies wird die dritte These sein, für ein Abwehrrecht gegen unzumutbare Risiken votieren und erörtern, was es konkret heißt, dass ein Risiko zumutbar bzw. unzumutbar ist. Allenfalls am Rande streifen werde ich die Frage, ob spezifische Personen oder Institutionen verpflichtet sind, unfreiwillige Risiken anderer auf ein zumutbares Maß zu reduzieren. Der Aufsatz konzentriert sich auf private Risiken und Risikoexpositionen. Obgleich diese Überlegungen Konsequenzen für die Diskussion um riskante Technologien haben, werden diese nicht im Einzelnen ausgemalt. Ausklammern werde ich im Folgenden Risiken für nicht-menschliche Wesen, für Tiere, die Umwelt, juristische Personen, sowie Risiken für künftige Generationen. Auch nur einen dieser Themenkomplexe aufzugreifen, würde den Rahmen eines Aufsatzes sprengen. 1. Handeln in Risikosituationen: Der Gegenstand moralischer Urteile Beginnen wir mit einem Gedankenexperiment: Fünf Frauen, allesamt passionierte Raucherinnen, die jeden Tag jeweils eine Packung Zigaretten rauchen, heiraten fünf Nicht-Raucher. Keines der Paare hat Kinder, und keine Frau verzichtet darauf, in der eigenen Wohnung zu rauchen. Die Zeit, in denen die fünf Männer täglich dem Passivrauchen ausgesetzt sind, ist ungefähr gleich; und auch ihre Wohnungen sind nahezu identisch geschnitten. In keiner Familie eines Ehemanns gibt es eine auffällige Häufigkeit von Krebserkrankungen, und kein Ehemann hat eine besondere medizinische Vorgeschichte. Nach zwanzig Jahren erkrankt einer der Ehemänner an Krebs und stirbt innert kürzester Zeit. Wie ist Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren519 das Handeln der fünf Frauen im Vergleich zueinander moralisch zu beurteilen?1 Eine erste Sichtweise wäre, dass wir nur bei jener Frau, deren Mann an Krebs starb, zu fragen haben, ob sie etwas moralisch Falsches getan hat. Alle anderen hatten moralisches Glück.2 Der Gegenstand, auf den sich moralische Urteile beziehen, ist damit von äußeren Umständen abhängig, von einem Geschehen, das nicht in der Macht des Handelnden steht. Diese Position wird etwa von Bernard Williams eingenommen. Die Witwe, deren Mann auf Grund einer raucherbedingten Ursache starb, wird die Tat seiner Auffassung nach insofern bedauern, als sie wünscht, anders gehandelt zu haben; und ihr Bedauern als Täterin unterscheidet sich in einem relevanten Sinne von jenem von Familiemitgliedern oder unbeteiligten Zuschauern. Die Kosten dafür, dass etwas geschehen ist, seien im Falle des toten Passivrauchers, um eine seiner Formulierungen zu verwenden, „auf das eigene Konto zu verbuchen.“ (Williams 1998, 38) Die anderen Ehefrauen haben dann, bleibt man bei dieser Metapher, nichts auf ihr Konto zu verbuchen. Sie werden nicht bedauern, ihrem Mann dem Passivrauchen ausgesetzt zu haben, und sie haben es nicht zu bedauern. Die zweite Sicht ist, dass wir das Handeln aller fünf Frauen moralisch gleich zu beurteilen haben. Alle setzten ihre Männer Risiken aus; was heißt: jede tat etwas, das die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass ihr Mann einen Schaden erleidet. Die Frauen hätten wissen können, dass ein solches Risiko besteht. Alle hatten den gleichen Zugang zu statistischen Daten und alle hätten ihren Mann bitten und drängen können, eine individuelle Risikoabklärung vorzunehmen. Diesbezüglich handelten aber alle insofern gleich, als sie auf weitere Informationen verzichteten und alle ihren Mann dem Passivrauchen aussetzten. Im geschilderten Beispiel ist auch die Exposition für alle fünf Männer dieselbe. Die Frauen rauchen gleich viel und die Männer sind über dieselbe Dauer und in 1 Diese Frage wird – bezogen auf Handlungen mit kleinen Eintrittswahrscheinlichkeiten – diskutiert in Thompson 1986. Da in Thompsons Überlegungen moralische Intuitionen eine zentrale Rolle spielen, gehe ich in in diesem Aufsatz, in dem moralischen Intuitionen keine Begründungsfunktion zugesprochen wird, nicht auf diesen Ansatz ein. 2 Die Diskussion um moralischen Zufall überschneidet sich mit der risikoethischen Problematik, ist aber insgesamt breiter angelegt, da es nicht nur um Risikosituationen geht, sondern u. a. auch darum, dass man durch Zufall an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit geboren wurde. Zur Diskussion um moralischen Zufall sei insb. verwiesen auf Card 1996 sowie Hurley 2003, Ch. 4. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 520 Klaus Peter Rippe ungefähr den gleichen Räumlichkeiten dem Rauch ausgesetzt. Da es um die gleichen Handlungen geht, sind alle fünf, so die zweite Sicht, moralisch gleich zu beurteilen. Dabei ist irrelevant, dass die Handlungen der fünf Frauen auf Grund von externen Effekten, auf die sie keinen Einfluss hatten, unterschiedliche Folgen hatten. Entweder haben alle fünf richtig oder alle fünf falsch gehandelt. Gegenstand der moralischen Beurteilung ist die ex ante-Situation. Dies gilt sowohl für Selbstkritik (also etwa Schuldgefühle) wie für Kritik anderer. Die zweite Sicht ist die Richtige, denn in der moralischen Beurteilung geht es nur um die ex ante-Situation. Auch wenn eine Person einer anderen ex post betrachtet geschadet hat, kann sie ex ante moralisch richtig gehandelt haben. Es gibt zwei moraltheoretische Gründe, wieso diese Beschränkung auf die ex ante-Situation für die ethische Beurteilung wesentlich ist. Zum einen geht es in der moralischen Beurteilung darum, wofür eine Person verantwortlich ist und welche Handlungsfolgen ihr selbst zugerechnet werden können. Dies sind aber nur die Folgen, die sie in der Situation der Handlung selbst vorhersehen kann, oder genauer, die sie hätte vorhersehen müssen. Geschieht etwas gänzlich Unerwartetes, dürfen wir dies der Person nicht zuschreiben. Zum anderen hat Ethik immer zu berücksichtigen, dass Moral eine handlungsorientierende Funktion hat. Beurteilten wir eine Tat aber ex post, kann eine Person vor oder während einer Handlung selbst nie wissen, ob sie richtig oder falsch handelt. Es erweist sich erst im Nachhinein, ob die Handlung falsch war oder nicht. Die Orientierungsfunktion der Moral ginge also verloren. Der Handelnde muss zum Zeitpunkt des Handelns wissen können, ob die geplante Handlung richtig oder falsch ist. Daher muss es um voraussichtliche und absehbare Folgen gehen, nicht um die tatsächlich eintretenden.3 2. Private Risiken Aus dem bisher Gesagten folgt nur, dass alle fünf Witwen moralisch gleich, aber noch nicht, wie sie zu beurteilen sind. Um hier einen Schritt weiter zu kommen, ist es zunächst sinnvoll, bei privaten Risiken einzusetzen. 3 Die Frage der moralischen Schuld ist damit loszulösen von jener der Verpflichtung zu Schadensersatz und Wiedergutmachung. Letztere setzen den Schadenseintritt voraus. Diese Unterscheidung spiegelt die rechtliche Differenz zwischen Strafe und Schadensersatz. Vgl. zu letzterem Punkt: Hoerster 2012, 25 f. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren521 Würde sich die Schadenskomponente allein auf das prudentiell, also für ein Wesen selbst Gute beziehen, gäbe es wohl kaum eine Handlung, bei der allein der Handelnde mit einer Schädigung zu rechnen hat bzw. nur ihm Risiken drohen. Fast immer können anderen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ebenfalls Nachteile erwachsen. Aktutilitaristen müssen, sofern sie sich auf eine prudentielle Schadenstheorie stützen, die zu erwartenden Auswirkungen für alle Betroffenen in Betracht ziehen. Schon bei regelutilitaristischen Theorien sieht es anders aus, und auch Deontologien unterscheiden zwischen moralisch relevanten und irrelevanten Auswirkungen auf andere. Vertritt man eine dieser Theorien oder sucht man sich auf die Alltagsmoral abzustützen, so wird man sowohl für Risikosituationen wie bei Anwendung des Nicht-Schadensprinzips sagen: Auf Grund des Handelns von A kann etwas für B prudentiell Schlechtes geschehen, ohne dass dieser Schaden moralisch relevant ist. Diese Position kann man an Beispielen wie den Folgenden erläutern: Sagt eine Frau einem Verliebten höflich und bestimmt, dass sie nichts mit ihm nichts zu tun haben will, ist dies schlecht für ihn, aber ihr kann dennoch nichts moralisch vorgeworfen werden. Die Frau bleibt hier voll in ihrem Recht. Gibt eine Dozentin einer Studierenden eine schlechte Note, kann dies schlecht für die Studentin sein. Aber es handelte sich nur dann um einen moralisch relevanten Schaden, wenn eine ungerechte Bewertung vorläge, wenn also ein Recht der Studierenden missachtet würde oder die Dozentin gegen eine moralische Pflicht verstieße. Moralisch relevant sind Auswirkungen dann und nur dann, wenn Rechte Dritter betroffen oder Pflichten gegenüber anderen zu beachten sind. Eine Risikoexposition liegt im moralisch relevanten Sinne erst dann vor, wenn durch eine Handlung einer Person mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein moralisches Recht anderer missachtet wird. Damit ergibt sich eine sinnvolle Deutung des Begriffs privater Risiken. Diese liegen dann vor, wenn Personen durch ihr Tun oder Unterlassen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihnen etwas für sie selbst prudentiell Schlechtes widerfährt und dies, ohne dass sie mit ihrem Tun oder Unterlassen Rechte anderer oder Pflichten gegenüber anderen missachten. Nach dieser Definition ist durchaus möglich, dass Handlungen Konsequenzen für Dritte haben und dennoch als private Risiken zu beurteilen sind. Ohne dies hier ausführlich begründen zu können, gehe ich davon aus, dass Personen das Recht haben, frei über sich selbst und ihren Körper Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 522 Klaus Peter Rippe zu verfügen, sofern sie damit nicht in Rechte anderer eingreifen oder Pflichten gegenüber anderen missachten. Dann wäre die Inkaufnahme privater Risiken prinzipiell moralisch zulässig. Voraussetzung ist allein, dass es sich um urteilsfähige Personen handelt, sie also fähig sind, sich zu informieren, die Situation zu verstehen und frei von inneren und äußeren Zwängen zu entscheiden. Fürsorgehandlungen anderer beziehen sich im Falle von privaten Risiken auf die Bereitstellung von Informationen sowie auf die Überprüfung, dass die Bedingungen autonomen Handelns im Einzelfall vorliegen. Dies ist heute im Allgemeinen unstrittig, nicht jedoch in zwei Fällen: für Risiken, bei denen eine große Selbstschädigung denkbar ist, und solche, welche der Allgemeinheit Kosten auferlegen. Dass in Situationen, in denen eine hohe Selbstschädigungsgefahr besteht, besonders hohe Anforderungen an die Bedingung der Urteilsfähigkeit gestellt werden müssen, folgt aus dem Charakter der Urteilsfähigkeitsbeurteilung. Komplexere Situationen stellen in der Regel höhere Anforderungen an die Kompetenz des Einzelnen. In vielen Fällen werden Personen, die sich hochriskanten Situationen aussetzen, kaum die Kompetenz haben, die weitreichenden Folgen ihrer Handlung zu bedenken. Hier haben andere die Pflicht, urteilsunfähige Personen vor Risiken zu schützen. Wenn aber Urteilsfähigkeit vorliegt, haben Personen die Freiheit, riskante Handlungen auszuführen. Lehnt man den Suizid nicht als grundsätzlich moralisch unzulässig ab, muss man auch hohe Selbstschädigungen als moralisch zulässig ansehen, und dies unabhängig davon, dass man sie bedauert. Entscheidet sich eine urteilsfähige Person trotz Warnungen, lebensgefährliche Risiken einzugehen, ist dies moralisch zulässig. Der für die heutige Diskussion weit wichtigere Punkt ist, ob eventuell entstehende Kosten für die Allgemeinheit es erlauben, private Risiken einzudämmen. Spätestens seit der Einführung der Gurtpflicht ist dies auf politischer und rechtlicher Ebene die herrschende Ansicht, und im Bereich der Public Health-Ethik haben wir hier das wohl wirkmächtig­ ste Argument für die Regulierung riskanter Lebensweisen. Um die Stabilität der Sozial- und Krankenversicherungen zu stützen und sie vor der Gefahr der Überlastung zu schützen, sei es erforderlich, private Risiken zu regulieren. Voraussetzung ist nur, dass Eingriffe in private Risiken verhältnismäßig, also geeignet, alternativlos und angemessen sind. Natürlich müsste man auch hinterfragen, ob hier wirklich stets Kosten reduziert werden. Wenn politische Maßnahmen Leben verlängern, ist dies Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren523 auch ein beträchtlicher Kostenfaktor für das Sozial- und Rentensystem und nicht nur ein Einsparungspotenzial. Aber gehen wir davon aus, dass eine Nettoeinsparung erfolgt, dann stellt sich das ethisch bedeutsamere Problem, inwiefern hier Kostenüberlegungen ins Spiel gebracht werden dürfen. Das heutige Sozialversicherungssystem geht in den meisten europäischen Ländern von im Recht verankerten moralischen Anspruchsrechten aus, welche Menschen zukommen und die weder verloren noch verwirkt werden können. Geht es um moralische Rechte, die an keine weiteren Bedingungen geknüpft sind, so können private Risiken zwar Folgen für die Sozialversicherungen haben, aber der Betroffene nimmt etwas in Anspruch, auf das er moralisch ein Recht hat. Die Allgemeinheit – und jeder Einzelne – ist dann verpflichtet, ihm zu helfen. Wer moralische und rechtliche Pflichten aber zu erfüllen hat, kann nicht darauf verweisen, ihm entstehen dadurch zu hohe finanzielle Kosten. Natürlich könnte man überlegen, ob es eine Solidarpflicht jedes einzelnen Bürgers gibt, keine unnötigen Kosten zu verursachen. In diesem Falle könnte das Recht auf Sozial- oder Krankenversicherungsleistungen an gewisse Bedingungen geknüpft werden, wie jene, keine unverantwortlichen Risiken einzugehen. Für letztere müsste dann der Bürger selbst haften und müsste sich, sofern möglich, privat versichern. Für welche privaten Risiken dies gilt, müsste dann separat diskutiert werden. Es reicht hier, mögliche Kandidaten zu nennen wie etwa, sich fahrlässig in Bergnot zu bringen, Risikosportarten auszuüben oder zu viel Fast Food zu essen. Würde man dies aber tun, könnte man auch nicht davon sprechen, dass Personen, die privat Risiken eingehen, der Allgemeinheit Kosten auferlegen. Denn wenn es sich um unverantwortliche Risiken handelt, müsste die Allgemeinheit ja gerade nicht zahlen. Der Verweis auf Kosten für die Allgemeinheit darf also nicht vorgebracht werden, wenn sich diese Kosten daraus ergeben, moralische und juridische Rechte von Bürgern zu erfüllen. Zudem könnte diese Einschränkung privater Risiken einfach dadurch ausgehebelt werden, dass man sich für ein Gesundheitswesen einsetzt, das auf höhere Eigenverantwortung setzt. Müssen sich Personen privat versichern und haften sie selbst für Rettungsmaßnahmen, entfallen die Kosten für die Allgemeinheit. Umwandlung von Risikoexpositionen in private Risiken: Stimmt eine Person einer Risikoexposition zu, geht sie ein privates Risiko ein. Diese Handlungen sind wie private Risiken zu beurteilen. Wiederum sind hier gewisse normative Bedingungen zu beachten, die bei der erfolgten Zustimmung vorliegen müssen: das Vorliegen der Urteilsfähigkeit, die Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 524 Klaus Peter Rippe Verfügbarkeit von Informationen über das Risiko und mögliche Vorsorgemaßnahmen sowie aber auch, dass keine Partei auf Grund einer Notsituation ausgebeutet wird. Sind diese Bedingungen erfüllt, wandelt sich die Risikoexposition in ein privates Risiko um. Wir können hier zwei Fälle unterscheiden: – die Übernahme eines Risikos durch die explizite Zustimmung der betroffenen urteilsfähigen Person: Hierher gehört unter anderem die vertragliche Zustimmung. Wären gewisse normative Bedingungen bei allen Geschäftsabschlüssen erfüllt (vgl. Rippe 2010: Kap. 6), würden wir im Feld der Wirtschaft nur private Risiken vor uns haben. Da in der konkreten Wirtschaft aber diese normativen Bedingungen der Zustimmung nicht immer erfüllt sind, liegen hier sehr wohl Risikoexpositionen vor. Man denke nur an Leiharbeiter, die Risiken an ihren zeitweiligen Arbeitsplätzen ausgesetzt sind. (vgl. Kampshoff 2012: Kap. 4) Weder können sie sich über die Risiken ihrer wechselnden Arbeitsplätze informieren, noch kann man so einfach sagen, dass sie ihren Arbeitsplatz frei wählen. – die Übernahme eines Risikos durch implizite Zustimmung einer betroffenen urteilsfähigen Person. Implizite Zustimmung liegt dann vor, wenn eine Handlungsweise einer Person nur dadurch plausibel erklärt werden kann, dass sie sich freiwillig der Risikoexposition aussetzt. Implizite Zustimmung liegt vor, wenn eine urteilsfähige Person, obwohl sie Informationen über ein Risiko hat, der Situation der Risikoexposition nicht ausweicht oder sich bewusst in sie hineinbegibt. Wer als Nichtraucher freiwillig (und nüchtern) eine verrauchte Bar betritt und sich dort über längere Zeit aufhält, geht ein privates Risiko ein. Dasselbe gilt für Personen, die sich zunächst im Nichtraucherbereich wähnten, nun aber bemerken, dass sie in der Raucherzone sind, diesen Bereich aber dennoch nicht verlassen. Im oben geschilderten Beispiel hätten die fünf Ehemänner die Möglichkeit gehabt, gegen die Risikoexposition durch ihre Frauen Einspruch zu erheben. Dass sie die Risiken des Passivrauchens nicht kannten oder nicht kennen konnten, kann angesichts breiter Public Health-Kampagnen ausgeschlossen werden. Setzen wir voraus, dass Eheleute einander umstimmen können, muss man das Verhalten der fünf Ehemänner als implizite Zustimmung deuten. Die fünf Männer sind private Risiken eingegangen; und alle Frauen haben moralisch zulässig gehandelt. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren525 Die Beurteilung des Rauchens in der Wohnung ändert sich, wenn Kinder ins Spiel kommen. Dann würden wir uns wieder in der Klasse der Risikoexpositionen bewegen, die aufgrund fehlender expliziter oder impliziter Zustimmung nicht in private Risiken umgewandelt werden können. Gehen wir zu diesen über. 3. Andere einem Risiko aussetzen In vielen Diskussionen, etwa jener um Gentechnik, Nanotechnologie oder Synthetische Biologie, wird immer wieder wie selbstverständlich angenommen, dass man bei der ethischen Beurteilung niemals allein auf die Risiken blicken dürfe, sondern immer auch die Chancen in den Blick zu nehmen habe. Chancen und Risiken werden dabei wiederum mit einer prudentiellen Theorie des Guten gemessen. Dass es für jeden Einzelnen klug ist, beim individuellen Handeln die sich eröffnenden Chancen wie die möglichen Risiken zu berücksichtigen, ist unstrittig. Aber wir sind hier nicht im Feld privater Risiken, sondern in jenem der Risikoexposition. Bei Risikoexpositionen sind zudem unterschiedliche Verteilungen von Chancen und Risiken zu beachten. Die risikoexponierende Person kann Chancen haben, der oder die Exponierte nur Risiken; beide können Risiken und Chancen haben, zudem mögen einigen Personen, die einem Risiko ausgesetzt werden, keinerlei Chancen erwachsen, anderen aber, welche demselben Risiko ausgesetzt sind, durchaus. Hier darf nicht zu schnell angenommen werden, der ethisch Urteilende dürfe einen archimedischen Standpunkt einnehmen, von dem aus er für alle Betroffenen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen hat. Meine These ist: Geht es um die Beurteilung einer Risikoexposition, so entscheidet über die moralische Zulässigkeit der Risikoexposition prima facie die Höhe des Risikos für jeden einzelnen Betroffenen. Ein Kalkül, das alle Einzelrisiken zu einem Gesamtrisiko addiert, darf nicht vorgenommen werden. Ich lehne also die utilitaristische oder allgemein konsequentialistische Zugangsweise ab, von einem unparteiischen Standpunkt aus alle zu erwartenden Folgen zu erfassen und in einem Gesamtkalkül zu bewerten. Dies liegt nicht daran, dass eine solche Theorie kontraintuitive Konsequenzen hat. Man will in der Philosophie nicht eine Antwort auf die Frage, was Personen vortheoretisch für richtig halten, sondern eine Antwort darauf, was richtig ist. Das Problem ist vielmehr, dass der Utilitarismus nicht begründen kann, wieso man Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 526 Klaus Peter Rippe von einer individuellen Entscheidungstheorie zu einem unparteiischen Interessenkalkül übergehen muss und wieso Einzelne verpflichtet sein sollen, erstens die Interessen aller zu berücksichtigen und zweitens das Gesamtwohl auch noch zu maximieren. Wie sieht die Alternative aus?4 Ich gehe im Folgenden von einer Theorie aus, nach welcher es im Interesse jeder Person ist, dass bestimmte Interessen durch moralische Rechte geschützt werden und dass andere Personen, dies die Kehrseite, moralische Pflichten haben, diese moralischen Rechte zu beachten.5 Wenn man von diesem oder auch irgendeinem anderen Ansatz, der moralische Rechte kennt, ausgeht, darf man die Frage, ob das moralische Recht einer anderen Person missachtet wird, nicht erst mit Blick darauf beantworten, ob auch Rechte anderer betroffen sind. Wenn ich meinem Nachbarn einen Finger breche, verstoße ich gegen ein moralisches Recht. Diese Missachtung eines spezifischen Rechts wird aber nicht dadurch größer, dass ich das Recht einer anderen Person ebenso missachte und auch dieser einen Finger breche. Kann ein Recht auf Unversehrtheit begründet werden, ist dieses moralische Abwehrrecht unabhängig davon zu achten, ob bei anderen dieses Recht ebenso missachtet wird. Der Umstand, dass jemand Rechte unterschiedlicher Personen missachtet, ist bei Bemessung der Höhe des moralischen Vergehens und bei der Zumessung einer moralischen Sanktion relevant, aber nicht für die Frage, ob ein moralisches Recht missachtet wurde. Genauso wenig wird die Missachtung eines Rechts aufgehoben, wenn ich dadurch eine noch schwerwiegendere Verletzung eines Rechts Dritter verhindere. Vielmehr haben wir dann die Situation eines moralischen Konflikts, in dem zu prüfen ist, ob die Missachtung eines der Rechte wirklich erforderlich, verhältnismäßig und gerechtfertigt ist. Die Missachtung moralischer Rechte kann allenfalls unter Berufung auf andere 4 Ich lasse hier bewusst eine kantianische Position außen vor, welche für die Risikoethik von Cranor 2007 skizziert wird. Da ich das Begründungsproblem – Wieso kommt Autonomie ein absoluter Wert zu – für nicht gelöst ansehe, sehe ich diesen kantianischen Ansatz nicht als begehbare Alternative, zumal der Verweis auf moralische Intuitionen von mir nicht als Argument angesehen wird. Auf Anwendungsebene besteht in etlichen Hinsicht Übereinstimmung zu Cranor, der ebenfalls gegen den konsequentialistisch bestimmten risikoethischen Mainstream argumentiert. Für Cranor entscheidet sich die Zulässigkeit einer Risikoexposition darin, ob sie vor jeder Person gerechtfertigt werden kann (ebd. 48 – 51). Differenzen bestehen auch auf Anwendungsebene bezüglich der Frage, was ein zumutbares Risiko ist. 5 Eine solche interessenbasierte Ethik wird auch in Hoerster 2003 und Stemmer 2000 vertreten. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren527 moralische Abwehr- oder Anspruchsrechte6 gerechtfertigt werden, nicht aber durch den Verweis auf Interessen. Denn der Schutz dieses Rechts würde wiederum erlöschen, wenn Dritte nur genügend starke Eigeninteressen zu nennen brauchten, um einen Rechtsbruch zu rechtfertigen. Dasselbe gälte, wenn der Verweis auf Interessen anderer ausreichte, moralische Rechte zu missachten. Die Schutzfunktion moralischer Rechte besteht nur dann, wenn allein eine Abwägung gegen andere Rechte zulässig ist. Gibt es ein Abwehrrecht gegen Risiken, dürften wir bei Risikoexpositionen nicht einfach die Einzelrisiken der Betroffenen in irgendein Kalkül einführen, um erst in einer Abwägung mit anderen Risiken und Chancen zu einem Urteil zu gelangen. Wir müssten prüfen, ob das Recht irgendeines Betroffenen hier verletzt wird. Ist dies der Fall, wäre die Handlung prima facie moralisch unzulässig. Eine Missachtung könnte allenfalls gerechtfertigt werden, wenn dies zur Sicherung eines moralisch höherrangigen Rechts erforderlich ist. Ein solches Abwehrrecht gegen Risikoexpositionen kann sehr wohl begründet werden. Es ist im Interesse jedes einzelnen, dass der Bereich der Risikoexpositionen durch klare und eindeutige Normen geregelt wird. Ansonsten würden schutzwürdige Interessen wie die auf Leben oder körperliche Unversehrtheit nur gegen mit Sicherheit zu erwartende Eingriffe anderer geschützt sein, aber eben nicht gegen solche, in denen eine Missachtung mehr oder weniger wahrscheinlich ist. Personen müssten zudem alle Vorsorgemaßnahmen selber tragen, dürften sie doch nicht erwarten und einfordern, dass andere bei Risikoexpositionen Rücksicht auf sie nehmen. Da Personen nicht immer wissen können, welche Risiken ihnen andere zumuten, könnten sie solche Vorsorgemaßnahmen in vielen Fällen nicht einmal treffen. Sie sind darauf angewiesen, dass jeder Handelnde selbst Risiken für Dritte ermittelt und sofern vorhanden zu minimieren sucht. Geht man vom moraltheoretischen Ansatz einer interessenbasierten Ethik aus, so spielt das prudentiell Gute auf Begründungsebene eine zentrale Rolle. Bestimmte Interessen des einzelnen sollen durch moralische Rechte geschützt werden. Zentrale Interessen wie zum Beispiel jene, nicht ohne eigene Zustimmung von anderen getötet, verletzt oder gedemütigt zu werden, können durch moralische Rechte aber nur dann geschützt wer6 Wenn im Folgenden von moralischen Rechten gesprochen wird, geht es nur um diese beiden Typen, nicht aber um Freiheitsrechte. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 528 Klaus Peter Rippe den, wenn auf Anwendungsebene anderen nicht mehr einfach erlaubt ist, zu fragen, ob eine konkrete Handlung gut oder schlecht für den Betroffenen ist. Auch wenn jemand nie davon erfährt, dass ihm etwas gestohlen wurde, und der Diebstahl damit keine Auswirkung auf sein prudentielles Gut hat, liegt dennoch eine Missachtung eines seiner moralischen Rechte vor. Auf der anderen Seite kann es – wie oben ausgeführt – sein, dass das Handeln anderer Auswirkungen auf eine Person hat, die schlecht für sie sind, ohne dass ein moralisches Recht missachtet wurde. Wir haben also hier den oben bereits angesprochenen Punkt, dass einem im prudentiellen Sinne geschädigt wird, dies aber dennoch moralisch irrelevant ist. Wird B durch eine Handlung von A etwas prudentiell Schlechtes zugefügt, so ist es – wie oben ausgeführt – nur dann moralisch unzulässig, wenn B ein moralisches Recht hat, das ihn gegen eine solche Handlung schützt. Auch wenn es im Interesse jedes einzelnen ist, dass sich der Schutzbereich moralischer Rechte auch auf deren wahrscheinliche Missachtung ausdehnt, ist es nicht im Interesse eines jeden, wenn jede Risikoexposition als Missachtung eines moralischen Rechts aufgefasst würde. Dadurch würden zu viele Handlungen als moralisch falsch verboten; denn zu oft sind Eingriffe in Rechte anderer möglich und zu oft ist die Wahrscheinlichkeit eben doch grob abzuschätzen. Da Moral zumindest auch die Funktion hat, gemeinsames Handeln zu regeln, wäre es auch nicht ratsam, würde man diese Handlungen nur dann erlauben, wenn explizite oder implizite Zustimmung vorliegt. Das Kriterium der expliziten Zustimmung ist, wie leicht gezeigt werden kann, zu restriktiv, das der impliziten dagegen zu unscharf. Würde man versuchen, das explizite Zustimmungskriterium als allgemeines Kriterium für die Risikoexposition einzuführen, würde moralisch richtiges Handeln in einer Vielzahl von Lebenssituationen nahezu unmöglich. Selbst wenn man zu Fuß durch die Stadt geht, setzt dies andere Personen Risiken aus, wie zum Beispiel andere Fußgänger oder Fahrradfahrer, denen man in den Weg laufen könnte. Jeden um Erlaubnis zu fragen, verunmöglichte die Durchführung der Handlung. Die explizite Zustimmung hat eine risikoethische Relevanz, da sie ja Risikoexpositionen in private Risiken umwandelt. Aber es bedarf zusätzlicher Kriterien. Wie sähe es bei der impliziten Zustimmung aus? In vielen Fällen wird kaum möglich sein, eine klare Aussage zu machen, ob eine implizite Zustimmung zu einer bestimmten Handlungsweise vorliegt. Der Umstand, dass sich auch die anderen am Verkehr beteiligen, kann beispielsweise nicht als implizite Zustimmung zu einem bestimmten VerkehrsverhalZeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren529 ten gedeutet werden. Wenn überhaupt, handeln Verkehrsteilnehmer auf Grund einer indirekten Zustimmung. Sie stimmen Risikoexpositionen im Straßenverkehr zu, sofern sich alle Handelnde an gewisse Regeln halten, denen man wiederum zustimmt oder zumindest vernünftigerweise zustimmen kann. Dasselbe kann für andere Lebenssituationen gesagt werden. Die Frage ist nur, um welche Regeln es sich handelt. Mit Blick auf unsere Alltagsmoral bieten sich weitere mögliche Normen an, die zu prüfen sind. Dabei ist vor allem an Sorgfaltspflichten zu denken, mit denen Risiken minimiert werden. Beispiele wären etwa, regelmäßig die Sicherheit der eigenen Gaszuleitung zu kontrollieren, Hunde an der Leine zu führen oder den Tigerkäfig abzuschließen. Teil dieser Sorgfaltspflichten ist, dass die risikoexponierende Person in der Pflicht steht, Risiken für andere zu erkennen, angemessene Vorsorgemaßnahmen zu treffen und Warnungen auszusprechen. Die Frage, ob diese Sorgfaltspflichten ethisch begründet werden können, hängt davon ab, wie weit Risiken zu minimieren sind. Vielleicht wird man einfordern wollen, sie müssten letztlich auf Null reduziert werden. Handlungen wären nur dann auszuführen, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit Null ist oder eine implizite oder explizite Zustimmung vorliegt. Aber auch hier würde die Moral eine Norm etablieren, welche in der Praxis kein Mensch einhalten kann. Trotz größter Sorgfalt und Behutsamkeit wird fast immer ein letztes Risiko bleiben: die Möglichkeit eines Schadens, der mit kleinster Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Wollte jemand moralisch handeln, müsste er einen Großteil seiner Ressourcen, Zeit und Energie dazu einsetzen, dass er andere keinem Risiko aussetzt. Dies ist sicher nicht im Interesse jedes Einzelnen. Wir dürfen also nicht von Maximalforderungen an die Sorgfalt anderer ausgehen, sondern brauchen ein anderes Kriterium. Der Vorschlag, den ich im Folgenden unterbreiten will, ist, dass bei der moralischen Beurteilung von Risikoexpositionen der Begriff der Zumutbarkeit eine zentrale Rolle spielt. Wird von Zumutbarkeit gesprochen, ist darin enthalten, dass der Person etwas auferlegt wird, was sie vermeiden will, es aber von ihr zu teilende rationale Gründe gibt, dies dennoch anzunehmen. Man könnte also auch von Akzeptabilität sprechen. Auf normativer Ebene sind beide Begriffe synonym. Ist etwas zumutbar, ist es auch akzeptabel. Im Falle von Risikoexpositionen ziehe ich freilich den Begriff des Zumutbaren vor. Die zu teilenden rationalen Gründe sind hier letztlich, dass gewisse Risiken hinzunehmen sind, da man ansonsten auch selbst andere keinerlei Risiko aussetzen darf. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 530 Klaus Peter Rippe Es geht in zweierlei Hinsicht um Zumutbarkeit. Zum einen ist das Befolgen von Sorgfaltspflichten mit einem Aufwand an Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen verbunden. Risikoexponierenden dürfen unter Umständen Sorgfaltspflichten aufgebürdet werden, dass ein moralisch zulässiges Verfolgen ihrer Vorhaben nahezu unmöglich wird. Zum anderen sind Risikoexponierte aufgefordert, gewisse Risiken hinzunehmen. Dies ist daher zumutbar, weil sie reziprok selbst die moralische Erlaubnis haben, anderen gewisse Risiken zuzumuten. Jeder darf anderen gewisse Risiken zumuten, muss aber bereit sein, genau diese Risiken selbst hinzunehmen. Jene Risiken, die man anderen zumuten darf, bezeichne ich als zumutbare Risiken. Insgesamt begründet die Überlegung ein moralisches Abwehrrecht wie auch moralische Pflichten. Sie begründet einerseits ein moralisches Recht, keinen unzumutbaren Risiken ausgesetzt zu werden. Zum anderen begründet sie eine moralische Pflicht, dass man in Situationen, in denen man davon ausgehen muss, dass Rechte anderer wahrscheinlich mißachtet werden, ausreichende Sorgfaltsmaßnahmen ergreifen muss, um sie keinen unzumutbaren Risiken auszusetzen. Übersteigt das Risiko trotz aller Sorgfaltsbemühungen die Grenze des Zumutbaren, so bedarf es der Zustimmung aller Betroffenen, um die Handlung dennoch vollziehen zu dürfen. Liegt diese nicht vor, hat der Handelnde die moralische Pflicht, die risikoexponierende Handlung zu unterlassen. Konkret bedeutet dies, dass es einen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen ein Risiko zumutbar und damit auch zulässig ist, und unzulässig, wenn es ihn übersteigt. Es ist natürlich denkbar, dass Personen einer solchen ansonsten unzulässigen Risikoexposition explizit oder implizit zustimmen, aber eine Handlung muss unterbleiben, sofern keine Zustimmung aller Exponierten vorliegt. Wenn diese Sorgfaltspflichten praktisch eingehalten bzw. umgesetzt werden und wenn das Risiko daher unterhalb des Schwellenwerts liegt, ist die entsprechende Risikoexposition zulässig – selbst wenn in der Folge ein Schaden eintreten sollte. Der Gedanke, dass bei Risikoexpositionen zwischen zumutbaren und unzumutbaren Risiken zu unterscheiden ist, kann nur dann zu klaren moralischen Antworten führen, wenn es um sogenannt objektive, nicht um subjektive Risikoeinschätzungen geht. Es muss intersubjektiv verbindliche Standards geben, wie mögliche Rechtsverletzungen oder Eintrittswahrscheinlichkeiten ermittelt werden können. Wenn obige Ausführungen korrekt sind, sprechen zwei Gründe für den notwendigen Rückgriff auf objektive Risiken. Erstens ist zentrales Element der Sorgfaltspflichten, dass sich die risikoexponierende Person über das VorZeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren531 liegen eines Risikos informiert und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreift, das Risiko für andere zu reduzieren. Damit Dritte aber beurteilen können, ob diese Pflichten erfüllt wurden oder nicht, bedarf es intersubjektiver Standards, wie man sich zu informieren hat, was als angemessene Information gilt und welche technischen Maßnahmen als effizient gelten. Zweitens muss der Risikoexponent wissen können, ob konkrete Risiken anderen zugemutet werden dürfen. Müsste er stets nach der subjektiven Risikoeinschätzung des anderen fragen, wären wir bei jenen Problemen, bei denen sich auch schon das Kriterium der expliziten Zustimmung als ungeeignet erwies. In vielen Lebenskontexten wären Personen nicht fähig, moralisch zulässig zu handeln. Die Konzeption eines Schwellenwertes enthält ferner notwendig eine Konsistenzforderung. Gilt ein Risiko als zumutbar, so ist ein bezüglich Schadensausmaß und Wahrscheinlichkeit gleiches Risiko ebenfalls als zumutbar anzusehen. Dabei dürfen private Risiken und Risikoexpositionen nicht miteinander vermischt werden. Es ist eine Sache, dass man ein Risiko als privates Risiko akzeptiert, und eine andere, dass es einem von anderen zugemutet wird. Der Verweis, dass eine Person raucht, ist also kein Argument dafür, dass ihm ein vergleichbares Risiko von anderen zugemutet werden darf. Zudem geht es natürlich auch nicht darum, was Personen in ihrem Alltagsverhalten akzeptieren, sondern darum, was sie rational als akzeptabel bzw. zumutbar ansehen müssen.7 Zumutbarkeit als Kriterium für Risikoexpositionen zu wählen, ist damit nicht mit Sozialakzeptanz zu verwechseln. Es bedarf noch einer Ergänzung. Mit welcher Wahrscheinlichkeit das Recht eines anderen missachtet wird, hängt in einigen Fällen nicht allein vom Handelnden ab, sondern auch vom Verhalten des anderen. Geht ein Fußgänger bei Rot über die Kreuzung, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Autofahrer ihn verletzt oder tötet. Wir brauchen also nicht nur einen Maßstab für die Sorgfalt des Handelnden, sondern auch einen dafür, mit welchem Verhalten des anderen er zu rechnen hat. Hier könnte man davon ausgehen, dass man bei Risikoexpositionen gegenüber Nicht-Urteilsfähigen den Schwellenwert für zumutbare Risiken tiefer anzusetzen hat als bei Urteilsfähigen. Letztere könnte eine Pflicht zukommen, selbst mit einer gewissen Umsicht vorzugehen und etwaige Risiken zu erkennen. Aber der Fußgänger, der bei Rot über die Straße geht, ist nicht nur einem Risiko ausgesetzt; 7 Das Konsistenzkriterium wird insbesondere von Gethmann (1993, 42 – 51) betont. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 532 Klaus Peter Rippe dies dürfte er in eigener Verantwortung eingehen. Er setzt auch andere einem Risiko aus. In allen anderen Fällen, wo die Rollen von Risikoexpositeur und -exponierten klar getrennt sind, hat ersterer davon auszugehen, dass der andere im Moment eben nicht aufmerksam ist und nichts von der Risikoexposition weiß. Wann ist ein Risiko aber als unzumutbar zu betrachten? Um den Schwellenwert zu bestimmen, gibt es auf Begründungsebene zwei ernsthaft zu prüfende Ausgangsoptionen. Erstere geht davon aus, dass Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe zu berücksichtigen sind, letztere, dass nur die Eintrittswahrscheinlichkeit den Ausschlag gibt. Der Gedanke, dass nur die Schadenshöhe zu berücksichtigen ist, muss dagegen kaum ernsthaft geprüft werden. Dann wiederum würde ein solches Kriterium zu viele Handlungen als moralisch unzulässig erweisen. Durch das Anzünden eines sorgfältig eingebauten und mehrmals technisch überwachten Gasherds wird, wenn auch mit minimaler Wahrscheinlichkeit, das Leben mehrerer Personen gefährdet. Wenn man an Katastrophen denkt, in denen Hunderte, Tausende, ja mehr umkommen könnten, scheint der Ansatz naheliegend, der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß in den Blick nimmt. Ein Schiffsunglück wie das der Titanic sollte doch mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden als eine Knöchelverstauchung, welche dadurch entsteht, dass man einem anderen seinen Trolley vor die Füße rollt. Allerdings müssen wir hier vorsichtig sein. Ob eine Schädigung für eine Person zumutbar ist, kann auch nicht davon abhängen, wie viele andere denselben Schaden erleiden. Wenn mich jemand durch den Umgang mit seinen Giftschlangen einem Risiko aussetzt, dieses Risiko aber alles in allem zumutbar ist, wird seine Tierhaltung für mich nicht weniger zumutbar, wenn auch andere diesem Risiko ausgesetzt sind. Der Begriff des Zumutbaren bezieht sich immer auf die Folgen für jedes betroffene Individuum. Etwas muss jedem Einzelnen zugemutet werden dürfen. Für die Frage, ob der Lärm eines Rasenmähers zumutbar ist, ist daher irrelevant, wie viele Personen dem Lärm ausgesetzt sind, relevant ist allein, ob Individuen an bestimmten Tagen und zu bestimmten Tageszeiten einen bestimmten Geräuschpegel hinnehmen müssen. Läge der Geräuschpegel im zumutbaren Bereich, hätten ihn Personen zu dulden, und dies auch dann, wenn es sehr viele sind. Eintrittswahrscheinlichkeit wie Schadenshöhe könnten weiterhin eine Rolle spielen, wenn es um die Ermittlung eines Schwellenwertes geht, Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren533 aber eben bezüglich des Risikos für die jeweils betroffenen Individuen. Man würde dann zum Beispiel annehmen, dass eine schwere Schädigung eines Menschen, die mit kleiner Wahrscheinlichkeit eintritt, weniger zumutbar ist, als eine sehr kleine Schädigung, die mit derselben Wahrscheinlichkeit eintritt. Sollte man beim Begriff des Zumutbaren aber so vorgehen? Sicher gibt es eine starke moralische Intuition, dass man weit größere Sorgfalt walten lassen sollte, um jemanden vor dem Tod zu schützen, als ihn vor ein paar blauen Flecken zu bewahren. Aber es bedarf einer Begründung dieser Position. Auch wenn sich die Schadenskomponente bei Risikoexpositionen auf Anwendungsebene nicht auf Eingriffe in das Wohlergehen, sondern auf Missachtung moralischer Rechte bezieht, geht es auf Begründungsebene um das prudentiell Gute. Einige Rechte schützen relativ betrachtet bedeutendere Interessen und müssen damit höher gewichtet werden. Ist dies so, muss man für jedes einzelne Recht eine spezifische Wahrscheinlichkeit definieren. Eine Wahrscheinlichkeit von 1:x ist zu klein, um als zumutbares Risiko bezüglich des Rechts auf Leben zu gelten, aber mehr als ausreichend, wenn ein Eigentumsrecht auf dem Spiel steht. Man mag einwenden, dass dies nicht nur für Rechte untereinander gelten muss, sondern auch für ein und dasselbe Recht, etwa das auf körperliche Unversehrtheit. Der Schaden ist nicht nur die Rechtsmissachtung per se, sondern die damit verbundenen Auswirkungen für den einzelnen Betroffenen; es ist nun mal schlimmer, ob mir drei Knochen gebrochen werden oder nur einer. Wäre es dreimal schlimmer, drei Knochenbrüche zu erleiden als einen und könnte man alle konkreten Interessen allgemein kardinal anordnen, wäre es denkbar, einen einzelnen Schwellenwert zu formulieren, der sich auf das Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe ausrichtet. In diesem Falle gäbe dann doch auf Anwendungsebene eine prudentielle Schadenstheorie den Ausschlag. Unabhängig von allen Schwierigkeiten, wie wir im konkreten Einzelfall Wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe ermitteln wollen, stellt sich freilich bereits auf Begründungsebene das Problem, dass eine solche kardinale Anordnung aller Interessen kaum möglich ist. Allenfalls grobe Rangordnungen von Interessentypen liegen nahe wie der Vorrang des Interesses auf Leben gegenüber dem auf Eigentum. Es ist daher ratsamer, sich in der Anwendungsebene auf Rechte zu beziehen. Das Abwehrrecht gegen Risiken würde dann missachtet, wenn die Risikoexpositon über einer für das konkrete Recht spezifischen Eintrittswahrscheinlichkeit Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 534 Klaus Peter Rippe liegt.8 Können negative Auswirkungen auf andere erwartet werden, hat der Handelnde zu prüfen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er überhaupt das Recht irgendeiner Person missachtet und wenn ja, ob es sich um eine zumutbare Risikoexposition handelt. Die Zulässigkeit des Handelns lässt sich damit stets mit Blick auf jene Betroffenen prüfen, welche mit höchster Wahrscheinlichkeit in ihrem Recht gefährdet werden. Um welche Eintrittswahrscheinlichkeit geht es dann aber? Da Rechte besonders wichtige Interessen schützen, ist klar, dass deren Schutz Vorrang hat vor dem Interesse, möglichst wenig Sorgfalt walten zu lassen und möglichst frei handeln zu können. Die Abwehrfunktion des Rechts wird sogar nur dann wirklich bewahrt, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Missachtung möglichst gering ist. Sie darf freilich auch nicht so gering sein, dass dadurch kaum möglich ist, moralisch zulässig zu handeln. Wir brauchen also eine Eintrittswahrscheinlichkeit, bei der wir das Eintreffen des Schadensfalls als, je nach moralischem Recht, unwahrscheinlich bis sehr unwahrscheinlich erachten, sie aber eben doch nicht auf Null zugeht. Dies sind allerdings sehr vage Aussagen, und unterschiedliche Personen mögen etwas ganz Unterschiedliches unter „sehr unwahrscheinlich“ verstehen. Auch wenn es uns als Handelnde überfordern würde, Wahrscheinlichkeiten stets mathematisch zu berechnen, und dies auch nicht in allen Situationen möglich ist, bedarf es doch eines gemeinsamen Verständnisses, was als unwahrscheinlich zu betrachten ist. Dies wird allerdings kaum möglich sein, ohne auf numerische Wahrscheinlichkeitsaussagen zurückzugreifen. Zudem müssen diese numerischen Angaben auch so ausfallen, dass sich jeder etwas unter den Größenangaben vorstellen kann. Aber eine solche intersubjektive Verständigung ist durchaus möglich, wie man an Beispielen wie dem Folgenden illustrieren kann. Wird eine Fahrradbremse hergestellt, bei der die Verantwortlichen damit rechnen, dass sie in einem von 200 Bremsversuchen versagt, wird man das Versagen im Einzelfall nicht für unwahrscheinlich halten. Wenn man einen Ausfall in 20.000 Versuchen erwarten muss, wird man ein Bremsversagen im Einzelfall als eher unwahrscheinlich bezeichnen. Doch erst bei einem Versagen in 100.000 oder 200.000 Fällen wird man anfangen, davon zu sprechen, dass ein Bremsversagen im Einzelfall unwahrscheinlich ist. Von sehr unwahrscheinlich wird man aber erst dann sprechen, wenn die Bremse in einem von einer Million 8 Sicher gibt es zudem leichte, mittelschwere und schwere Eingriffe in bestimmte Rechte. Diese Option lasse ich im Folgenden außen vor und spreche der Einfachheit halber nur von Rechtsmissachtungen. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren535 Versuchen nicht funktioniert. Nimmt man dieses Beispiel als Ausgangspunkt, wäre die Missachtung eines Rechts dann sehr unwahrscheinlich, wenn die Wahrscheinlichkeit bei 1:1 Million liegt, und unwahrscheinlich, wenn sie bei 1:100 000 liegt. Mitunter wird man freilich überhaupt nichts darüber sagen können wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist.9 Bei neuartigen Technologien und bisher unbekannten Stoffen oder Naturphänomenen kann dies der Fall sein. Unbefriedigend wäre, wenn man solche Handlungen unter Ungewissheit solange zulässt, bis die ersten Schadensfälle eingetreten sind, oder man gar so lange abwartet, bis man die Eintrittswahrscheinlichkeit über statistische Häufigkeitsanalysen ermitteln kann. Ist auf Grund einer Folgenabschätzung denkbar, dass ein Recht anderer missachtet wird, muss dieses Recht geschützt werden. Um ein willkürliches Vetorecht gegen Neuerungen zu unterbinden, kann „denkbar“ nicht einfach heißen, dass jedes beliebige Schadenszenario relevant ist; eine mögliche Missachtung von Rechten muss plausibel dargelegt werden. Was ist, wenn diese Plausibilität vorliegt? Um von einer zumutbaren Gefährdung eines Rechts sprechen zu können, muss es für den Einzelnen rational sein, einer Risikoaussetzung zuzustimmen. Kann noch keine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit getroffen werden, ist dies natürlich nicht möglich. Die Risikoexposition bleibt damit solange unzulässig, bis der Risikoexponent nachweisen kann, dass das Risiko zumutbar ist. Um dies tun zu können, muss er freilich nachweisen können, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Rechtsmissachtung ist. Würde man ihm diese Möglichkeit nicht einräumen, wären nahezu alle Neuerungen prinzipiell moralisch verboten. Der Risikoexpositeur hat zwei in der Praxis meist miteinander verwobene Optionen. Er kann Sorgfaltsmaßnahmen vorschlagen und erproben, welche den Schadenseintritt verhindern oder ihn unwahrscheinlich werden lassen. Zudem kann er seine Neuerung in eingegrenzten Szenarien erproben, welche eine Missachtung von Rechten ausschließt, aber doch neues Wissen über die Eintrittswahrscheinlichkeit in größeren Szenarien generiert. Schritt für Schritt darf er also seine Neuerung erproben und hat auf diesem Wege zu ermitteln, ob das Risiko anderen zumutbar ist oder nicht. Je nach technischer Anwendung sind unterschiedliche 9 Hier haben wir das Feld der Ungewissheit. Die im Folgenden erörterten Punkte werden in der Diskussion auch als Anwendung des Vorsorgeprinzips (Precautionary Principle) aufgefasst. Vgl. hierzu auch Rath 2011, 119 – 124 sowie allgemein Harremoeës et al. 2002. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 536 Klaus Peter Rippe Schritte zu bedenken, bei grüner Gentechnik etwa der Weg von toxikologischen Tests im Labor über das Gewächshaus bis hin zu Freisetzungsversuchen. Die Frage, ob ein Schritt weitergegangen werden darf, kann nur durch Antworten auf eine Frage entschieden werden: Im jeweiligen Experiment muss nachgewiesen werden, dass die Missachtung eines moralischen Rechts auszuschließen ist oder zumindest im oben genannten Sinne als sehr unwahrscheinlich zu betrachten ist. Letztlich gelingt dies nur, wenn in jedem einzelnen Schritt die Hypothese geprüft wird, dass ein Schadenseintritt wahrscheinlich ist. Ein solch schrittweises Vorgehen ist auch aus der Medikamentenprüfung bekannt. Allerdings gibt es einen zentralen Unterschied. Die hier eingeforderte Risikoforschung befasst sich ausschließlich mit der Risikoexposition, die Medikamentenforschung sucht erwünschte wie unerwünschte Wirkungen zu ermitteln. Dies hat einen einfachen Grund: Sei es, ob Medikamente in informierter Zustimmung, gemäß dem mutmaßlichen Willen oder in stellvertretender Einwilligung genommen werden, es liegt stets eine Umwandlung in ein privates Risiko vor. Genau dies geschieht aber immer in einer Chancen-Risiken-Analyse. Stellvertretend haben etwa Eltern zu entscheiden, ob die Chancen eines neuen Krebsmittels die damit verbundenen Risiken übersteigen. Wir können dies noch allgemeiner formulieren: Besteht eine Fürsorgebeziehung, so hat der Fürsorgende das für den anderen Gute zu intendieren. Dies schließt ein, dass die Zufügung auch hoher Risiken gerechtfertigt werden kann, wenn dem Objekt der Fürsorge dadurch noch höhere Chancen eröffnet werden. Wichtig ist jedoch, dass selbst die Verantwortung von Eltern nicht einfach in der Art beschrieben werden darf, dass Eltern einen unparteiischen Standpunkt einzunehmen haben, in dem sie das Gesamtwohl ihrer Kinder zu maximieren haben. Schon gar nicht gilt dies für Situationen, in denen außerhalb von Fürsorgebeziehungen andere einem Risiko ausgesetzt werden. Hier verbieten Autonomie- und Freiheitsrechte sogar, bilateral das für den anderen Gute zu erzwingen. Nicht Chancen für andere, sondern allein die Risiken sind in den Blick zu nehmen. Risikoexponierendes Handeln ist nicht prinzipiell untersagt. Es ist aber auch nicht an Zustimmung gebunden. Vielmehr dürfen prima facie andere Personen ohne ihre Zustimmung einem Risiko ausgesetzt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Entscheidend für die Zulässigkeit einer Risikoexposition ist, dass allgemeine Sorgfaltsgesichtspunkte berücksichtigt werden. So müssen die möglichen Auswirkungen Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4 Risiko, Ethik und die Frage des Zumutbaren537 bedacht, mögliche Gefahrenquellen weitgehend entschärft, Warnungen ausgesprochen oder Gefahren umgangen werden. Und zugleich muss jene besondere Sorgfalt an den Tag gelegt werden, die dem jeweiligen Risiko angemessen ist, d. h. die dafür sorgt, dass es auf ein zumutbares Maß verringert wird. Dies ist der Fall, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ein Recht missachtet wird, durch das Ergreifen von entsprechenden Risikominderungsmaßnahmen unter eine für das jeweilige Recht spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit zu liegen kommt. Literatur Card, Claudia 1996: The Unnatural Lottery, Character and Moral Luck, Philadelpia. Cranor, Carl F. 2007: Toward a Non-Consequentialist Approach to Acceptable Risiks, in: Lewers, Tim (Hrsg.), Risk. Philosophical Perspectives, London, 36 – 53. Gethmann, Cal Friedrich 1993: Zur Ethik des Handelns unter Risiko im Umweltstaat, in: Gethmann, Carl Friedrich & Kloepfer, M., Handeln unter Risiko im Umweltstaat, Berlin, 1 – 54. Harremoeës, Paul et al. (Hrsg), 2002: The Precautionary Principle in the 20th Century, Late Lessons form early Warnings, London. Hoerster, Norbert 2003: Ethik und Interesse, Stuttgart. –2012: Muss Strafe sein? Positionen der Philosophie, München. Hurley, Susan L. 2003: Justice, Luck, and Knowledge, Cambridge. Kampshoff, Klemens 2012: Berufsbedingte Gesundheitsgefahren und Ethik des Risikos: Kriterien für die vertretbare Zumutung von Gesundheitsrisiken des beruflichen Umgangs mit Kanzerogenen, Aachen. Rath, Benjamin 2011: Entscheidungstheorien der Risikoethik. Eine Diskussion etablierter Entscheidungstheorien und Grundzüge eines prozeduralen libertären Risikoethischen Kontraktualismus, Marburg. Rippe, Klaus Peter 2010: Ethik in der Wirtschaft, Paderborn. Stemmer, Peter 2000: Handeln zugunsten anderer, Eine moralphilosophische Untersuchung, Berlin. Thompson, Judith 1986: Imposing Risks, in: dies., Rights, Restitution, and Risk, Essays in Moral Theory, Cambridge, 173 – 191. Williams, Bernard 1984: Ethischer Zufall, Aufsätze 1973 – 1980, Frankfurt. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 67 (2013), 4