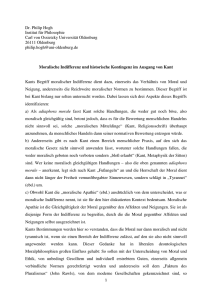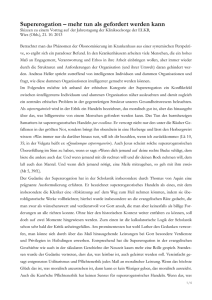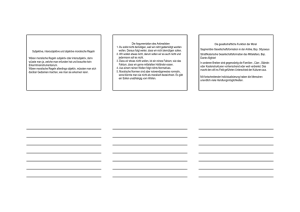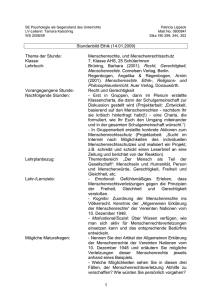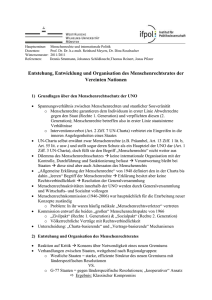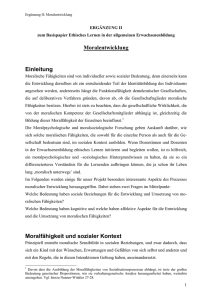Empirismus und Rationalismus in der Moraltheorie
Werbung

Empirismus und Rationalismus in der Moraltheorie Michael Nagler Angesichts der aktuell bestehenden globalen Problemlagen in Politik, Wirtschaft, Umwelt scheint mir die grundlegende Frage erlaubt, wie weit man mit empiristischen oder rationalistischen Überlegungen im moralischen Denken kommt? Aufklärung lässt sich hier am ehesten wohl bei den Archetypen dieser Theorieformen, nämlich Hume und Kant erzielen. Allerdings tun sich sogar moderne Humeaner oder Kantianer oft schwer, die Argumente der Gegenseite auch nur zu verstehen, geschweige denn im rechten Licht zu gewichten. Die offen oder verdeckt angesprochene Gegnerschaft zwischen beiden Lagern halte ich im Hinblick auf die vor uns liegenden globalen Herausforderungen für übertrieben und werde zeigen, inwieweit sich beide Theorieströmungen nicht widersprechen, sondern mit dem Moralischen den gleichen Gegenstand nur aus unterschiedlichen Perspektiven analysieren, bewerten und schließlich auch eine Synthese aus Humeschen und Kantischem Moralvorstellungen versuchen. Die Frontlinien sind bekannt: Hume hält jegliches Handeln nur auf emotionaler Basis überhaupt für möglich, während Kant glaubt, nur vernunftbasiertes Handeln sei moralisch anerkennbar. Beides kann in der vorgetragenen Rigorosität nicht gleichermaßen zutreffen. Noch vor einer transzendentalen Analyse unserer Moralvorstellungen lassen sich im direkten Vergleich zwischen Humes und Kants Moralmodellen systemimmanente Stärken und Schwächen aufdecken: Der augenfälligste Unterschied besteht zunächst einmal in den der Moraltheorie vorausgehenden anthropologischen Grundannahmen, namentlich der Bedeutung von Vernunft. Während Hume Vernunft als 'Sklaven der Leidenschaften', als Erfüllungsgehilfen unserer Bedürfnisbefriedigung (im Sinne von Lustvermehrung und Schmerzvermeidung) sieht, nimmt Kant als 'wahre Bestimmung' unserer Vernunft an, den Menschen zu moralischem Handeln (zur moralischen 'Autonomie') zu verhelfen. Hume vermag im Rahmen seines empiristisch-hedonistischen Ansatzes recht plausibel darzulegen, warum Menschen überhaupt handeln und inwiefern sie einen Anreiz zu moralischem Handeln haben, nämlich wenn sie hierdurch ihre Chancen auf kurz-, mittel- und langfristige Bedürfnisbefriedigung verbessern. Vor allem aus erkenntnistheoretischer Sicht bleibt jedoch ungeklärt, wie sich der einzelne Mensch von seinen eigenen Bedürfnissen ausgehend den Weg zu intersubjektiv gültigen Moralvorstellungen bahnen soll? Diese Genese gelingt nicht über den von Hume im 'moral point of view' vorgeschlagenen Weg der vollständigen Ausblendung eigener Interessen, weil dann überhaupt jegliche Grundlagen für Induktionsverfahren und Abstraktionsleistungen fehlen, durch die ein Vergleich eigener Bedürfnisse mit den aller anderen Menschen in allgemein verbindlichen Moralvorschriften münden könnten. In der Begründung der Geltung moralischer Normen liegt hingegen die Stärke Kantischer Moralvorstellungen. Der eigentliche normative Sinn intersubjektiver moralischen Geltung scheint mir allerding besser im Zustimmungsprinzip, als in seinem Kategorischen Imperativ aufgehoben, denn wenn meine Maxime (durch ihre Universalisierung) nicht als allgemeines Gesetz taugt, sich aber wohl mit den Maximen aller anderen Menschen verträgt, ist meine Maxime durchaus moralisch rechtfertigbar. Unabhängig zunächst davon, ob man die Funktion von Vernunft im Humeschen Sinne hedonistisch oder Kantisch idealistisch deutet, gelangt man anhand des von mir so genannten 'Zustimmungsprinzips'1 zum Ergebnis, dass sich ein bestimmtes Verhalten nur dann als moralisch oder unmoralisch qualifiziert, wenn es von jedem Menschen als solches akzeptiert werden kann. Nun darf man getrost annehmen, dass die meisten Menschen im (kurzfristigen) Eigeninteresse handeln - wie von Hume vermutet - sich dabei aber auch (zumindest teilweise) von (langfristigen) vernünftigen Motiven leiten lassen wie von Kant gefordert. Insofern sich Normen finden lassen, die aus Eigeninteresse und im Allgemeininteresse begründbar sind, genügt man beiden Theorietypen, deckt beide Vernunftbegriffe ab, erfasst alle sinnvollen kurzfristigen und langfristigen möglichen Handlungsoptionen eines jeden Menschen. Allerdings liegt mit dem Zustimmungsprinzip explizit noch keine (konkrete) Norm, sondern erst ein (abstraktes) Normgenerierungsverfahren (ähnlich Kants Kategorischem Imperativ) vor. Deshalb sind wir noch keineswegs der Frage enthoben, was nun abstrakt oder konkret inhaltlich moralisch oder unmoralisch sein mag? Das zur Abgrenzung von Hume und Kant letztendlich entscheidende transzendentale moraltheoretische Problem besteht darin, ob sich durch Verstand und Vernunft überhaupt grundlegend neue moralische Normen, Werte, Prinzipien schaffen und (hinreichend) begründen lassen, deren Voraussetzungen nicht bereits in der menschlichen Gefühlswelt angelegt sind oder anders gesagt, ob sinnvolle moralische Normen, Gesetze und Prinzipien nicht eigentlich nur als Derivate, Komplikationen, Abstraktionen von Gefühlszuständen angemessen interpretierbar sind? Wenn sich Humes Einschätzung über die Gefühlsbasiertheit unseres Denkens, Wollens und Handelns als zutreffend erweisen sollte - wofür auch neuere psychologische sowie neurologische Befunde sprechen - dann müssten sich die Kantische und mit ihr alle Moraltheorien des rationalistischen Typs (Rawls, Habermas) den Vorwurf gefallen lassen, schief angelegt zu sein. Eine von Kant verworfene, aber von mir für möglich gehaltene und durchgeführte transzendentale Analyse legt den Schluss nahe, dass sich alle unseren auch noch so elaborierten sinnvollen Moralvorstellungen auf die Herbeiführung angenehmer und die Vermeidung unangenehmer Gefühlszustände zurückführen lassen. Dies gilt exemplarisch für zentrale moralische Normen, die den Schutz der Handlungsfreiheit gewährleisten und natürlich damit elementar ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit beinhalten. Der wesentliche Vorteil einer empiristischen Herangehensweise an die Moral gegenüber einer rationalistischen nach Kantischer Manier scheint einfach der zu sein, dass man noch vor einem spezifisch moralischen Begründungszusammenhang ganz allgemein untersucht, was Menschen überhaupt zum Handeln treibt, was sie erreichen und vermeiden möchten. Am Beginn einer empiristischen Moraltheorie kann mit anderen Worten eine Motivations- und Handlungstheorie stehen. Im Gegensatz dazu scheint eine rationalistisch angelegte Moraltheorie darauf angewiesen, vernünftige Normgebungsverfahren zu formulieren, um daraus erst moralische Werte und Zielvorstellungen zu entwickeln. Die große Gefahr liegt hierbei offenkundig darin, solche Vorstellungen zu formulieren, die im Alltag kaum einen Menschen direkt tangieren, die selten einen Menschen unmittelbar zum Handeln bewegen. Rationalistische normative Zielvorstellungen (wie Freiheit oder Gleichheit) müssen deshalb regelmäßig anhand bestimmter Gesichtspunkte, Regeln, Kriterien (inhaltlich) konkretisiert werden, um sie einerseits handhabbar, anwendbar zu machen und andererseits jedem Menschen ausreichend Motivationsgründe für ihre Beachtung zu geben. Dafür sind jedoch fundierte empirische Anleihen erforderlich, die auf rationalistischer Grundlage eben gerade fehlen, weil diese Ebene (mit welcher 'Begründung' auch immer) methodisch zunächst übersprungen wurde. Bei Kant gewinnt man daher öfters den Eindruck, seine moralischen Konkretisierungsebenen hingen kaum oder gar nicht mit der moralischen Prinzipienebene zusammen (wie etwa beim 'absoluten' Lügenverbot, dem Verbot des Selbstmords oder der strikten Ablehnung eines Widerstandsrechts), als komme hier eher Kants konservative Meinung als 1 Vgl. Kant (GMS) S. 429; Kant (KpV) S. 106f. durchaus loyaler preußischer Staatsbürger zum Ausdruck, als eine aus der Systematik seiner Moraltheorie erschließbare wissenschaftlich begründete Haltung. Insofern bietet er zwar vielfach plausible moralische (rationalistische) Zielvorstellungen, aber kaum überzeugende (empirische) Wege, sie zu konkretisieren oder gar zu verwirklichen. Aber warum nun sollte ich das Urteil anderer Menschen darüber, was sie für gut oder schlecht befinden, in meinem Urteil, was mir selbst nützlich oder schädlich scheint, berücksichtigen? Die einfache (Humesche) Antwort lautet: Weil sie sonst Anlass haben, meine Ansichten über gut oder schlecht nicht zu respektieren, weil sie sonst einen (moralischen) Grund haben, meine Handlungsabsichten zu behindern oder gar zu verhindern und weil überdies die Verfolgung gemeinsamer Handlungsziele im Konsens mit anderen Menschen durch Kooperation größere Erfolgschancen für deren Realisierung bietet. Ohne einen globalen Konsens etwa zum Klimaschutz, zum Artenerhalt, zum Schutz der Privatsphäre werden diese Bemühungen kaum erfolgreich sein. Alle Menschen würden sich rationalerweise für das ethische Nutzengebot und das rechtliche Schadensverbot als Moralprinzipien aussprechen, weil sich beide Prinzipien emotional, verstandes- und vernunftbasiert rechtfertigen lassen, weil sie allen Menschen sichere Kooperationsvorteile bieten. Unterhalb dieser relativ abstrakten Prinzipienebene besteht mit den Menschenrechten - wie sie etwa von der UN in der AEMR 1948 niedergelegt und seither im 'Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte' sowie im 'Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte' seit 1966 weltweit ratifiziert worden sind - ein bereits etabliertes und weithin anerkanntes Normensystem, das sowohl den emotionalen, prudentiellen, als auch vernunftbasierten Anforderungen der Prinzipienebene weitgehend entspricht - durch die Menschenrechte werden die für den Menschen wichtigsten Interessen am meisten geschützt. Ein Handeln gemäß dieser Normen kann deshalb von allen Menschen akzeptiert und auch allgemein gefordert werden. Allerdings reicht es nicht aus, die Bedeutung der Menschenrechte als bloße Abwehrrechte (etwa wie Freiheits- oder Gleichheitsrechte im klassischen Sinne) oder schlichte soziale Anspruchsrechte (etwa wie Gewährleistungsansprüche für ein Existenzminimum, Kleidung, Nahrung, Arbeit, Wohnung) lediglich dem Staat gegenüber zu verengen, sondern es scheint mir unumgänglich, die darin niedergelegten Werte und Normen als allgemeine rechtliche und ethische Zielvorstellungen zu interpretieren, deren Verwirklichung letztendlich jedem Menschen obliegt. Insofern hätten neben allen Staatsgewalten auch jeder Privatmann und jedes Unternehmen die Verpflichtung nicht nur mitzuhelfen, Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden, sondern darüber hinaus die Aufgabe, eine allgemeine Realisierung der Menschenrechte zu befördern. Mit gemeinsam geteilten Werten über alle kulturellen, religiösen, sozialen Schranken hinweg korrespondiert allerdings erst die normative Seite einer Globalmoral, denn die bereits bestehenden Menschenrechte werden tagtäglich verletzt, obwohl sie von nahezu allen Staaten dieser Welt anerkannt sind. Zur Durchsetzung einer die Menschenrechte beinhaltenden Globalmoral brauchen wir darüber hinaus geeignete internationale institutionelle Rahmenbedingungen. In vielen Regionen dieser Welt sind jedoch bereits die zu überwindenden Hürden auf dem Weg in den Nationalstaat mit großen Anstrengungen verbunden gewesen. Heute erscheint es abwegig, dass Bayern und Brandenburg (so geschehen 1866) oder sogar die Bayreuther gegen die Nürnberger (in 1553) einen Krieg führen könnten. Dennoch führt der aktuelle Trend zur Verstetigung bestehender nationalstaatlicher Strukturen, weil sie viele Bürger in der trügerischen Sicherheit wiegen, ihre Interessen in einer sich schnell, stetig und umfassend verändernden Welt dauerhaft konservieren zu können. Damit sich menschenrechtskonformes Verhalten weltweit dauerhaft etablieren kann, muss es allen Menschen Vorteile bieten, sich ganz einfach 'lohnen'. Unter dem wachsenden Bevöl- kerungsdruck, dem Kampf um knapper werdende Ressourcen, dem durch die Globalisierung ausgelösten wirtschaftlichen Konkurrenzdruck zwischen den Nationalstaaten besteht jedoch für viele staatliche und nicht-staatliche Akteure ein großer Anreiz, kurzfristige eigene (unmoralische) Interessen höher zu bewerten, als das (moralische) Interesse der ganzen Menschheit. Die Entwicklung vorwiegend ökonomisch motivierter Bündnisse im europäischen, asiatischen, aber auch im amerikanischen Raum (EU, ASEAN, NAFTA) sind zu einem guten Teil dem sich verschärfenden globalen wirtschaftlichen Wettbewerb geschuldet. Verschiedene Regionen dieser Welt versuchen durch einen ökonomisch ausgerichteten Zusammenschluss ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu erhöhen. Dabei geraten sie durch die Konkurrenz zwischen den Einzelstaaten und Konföderationen um Investitionen und daraus resultierender Arbeitsplätze in einen Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen, der andere Ziele, wie Umweltschutz und Sozialpolitik ins Hintertreffen geraten lässt. Weltweit entsteht ein 'race-to-the-buttom' Effekt bei Umwelt- und Sozialstandards. Solche gravierenden globalen Fehlentwicklungen entsprechen weder dem erweiterten Menschenrechtsgedanken, noch dem hier entwickelten globalen Moralprinzip. Das entscheidende Argument für eine Weltregierung, für einen föderal aufgebauten Weltstaat und Kontinentalstaaten liegt folgerichtig darin, dass unter den bislang herrschenden, überwiegend nationalstaatlichen normativen und institutionellen Bedingungen die (erweiterten) Menschenrechte gar nicht (mehr) angemessen realisierbar sind, weil die Vorteile der Globalisierung vorwiegend relativ wenigen internationalen Unternehmen nutzen, während die Nachteile alle Menschen tragen müssen. Nur mit Hilfe weltweit operierender staatlicher Institutionen dürften rechtliche und ethische Normen zur Realisierung der Menschenrechte auch global durchsetzbar sein. Aufgabe eines Weltstaates wäre es zuvorderst, menschenrechtsfördernde Normen etwa beim Klimaschutz oder dem Welthandel aufzustellen und deren Einhaltung zu überwachen. Menschenrechtskonformes Handeln wird sich dann durchsetzten, wenn alle Menschen einsehen, dass sie zumindest mittel- und langfristig davon deutlich mehr Vorteile, als Nachteile haben. Klimawandel, Artensterben, Überbevölkerung schaden auf Dauer allen Menschen mehr, als sie ihnen nutzen. Ohne ein strenges Regime von Kontrollen, Gratifikationen und Sanktionen können multilaterale Abkommen jedoch ebensowenig dauerhaft wirksam sein, wie die bisherigen Bemühungen zur Verwirklichung der Menschenrechte. Für eine angemessenen Bewältigung dieser gewaltigen Aufgabe benötigen wir nicht nur Rechtsgerichte, sondern auch Ethikgerichte. Die erweiterten Menschenrechte - Umweltschutz, soziales Wirtschaften, ressourcenschonender Umgang mit der Natur - können nicht auf Grundlage eines neoliberalen, frühkapitalistisch anmutenden Wirtschaftsmodells gedeihen, das eben diesen Zielen oft diametral entgegensteht, weil es die Starken bevorzugt und die Schwachen benachteiligt. Alle Menschen würden sich deshalb für ein System sozialer Marktwirtschaft entscheiden, das soziale Ungleichheiten nicht noch verstärkt, sondern ausgleicht, das nicht vorrangig global agierenden Unternehmen und einer relativ kleinen Oberschicht nutzt. Mit der gegenwärtig vorherrschenden neoliberalen Weltwirtschaftsordnung verfestigt und vergrößert sich jedoch strukturelle Ungerechtigkeit, die alle Menschen dieser Erde politisch und moralisch motivieren sollte, einen Weltstaat zu gründen. Um eine optimale Realisierung der Menschenrechte zu ermöglichen, um ungerechtfertigte Bevorzugungen oder Benachteiligungen zu vermeiden, würden sich alle Menschen für Obergrenzen bei Einkommen und Vermögen aussprechen. Ferner würden sie sich für einen gerechten Welthandel einsetzen, um Armutsmigration zu verhindern. Alle Menschen würden auch das Subsidiaritätsprinzip befürworten: Eine Aufgabe soll möglichst von der Institution erfüllt werden, die sie am besten und effektivsten erledigen kann. Deshalb wirkt es ratsam, zwischen weiterhin bestehenden Nationalstaaten und Weltstaat Kontinentalstaaten (Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika, Europa mit Russland) mit Kontinentalregierungen und Kontinental- parlamenten zu etablieren. Ansätze für solche neuen institutionellen Strukturen existieren bereits (EU, UN, Afrikanischer Rat). Die Gründung der Kontinentalregierungen und der Weltregierung sollte soweit als irgend möglich auf der Basis bereits bestehender Nationalstaaten und Konföderationen im Rahmen der UN erfolgen, um weitestgehend mögliche Stabilität und Kontinuität zu erhalten. Die nationalen, kontinentalen und globalen gouvernalen Strukturen sind so einfach, übersichtlich und effizient wie möglich zu gestalten (ein besonders negatives Bild bietet hier die EU) und sollten durch Kontinentalverfassungen und Weltverfassung lediglich Kontinentalregierungen und Weltregierung, Kontinentalparlamente und Weltparlament, kontinentale und globale Exekutiven sowie Rechts- und Ethikgerichte zulassen.