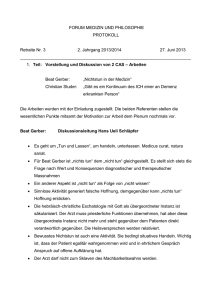Paradigmen in Sport und Sportwissenschaft
Werbung

LSB (Sankt Augustin) 44(2003)2, 161-173 Volker Schürmann Zur besorgten Sportethik, die alles beim Alten belässt – aus Anlass zweier Neuerscheinungen Drexel, G. (2002): Paradigmen in Sport und Sportwissenschaft. Schorndorf: Hofmann. ISBN 3-7780-6791-5 Pawlenka, C. (2002): Utilitarismus und Sportethik. Paderborn: mentis. ISBN 3-89785-268-3 Für eine utilitaristische Sportethik Die Dissertation von Claudia Pawlenka ist ein engagiertes und eindringliches Plädoyer für den Utilitarismus in der Sportethik. Sie diagnostiziert eine bis dato nur unzureichende Auseinandersetzung mit diesem Konzept, insbesondere mit den utilitaristischen Klassikern Bentham, Mill und Sidgwick. Bereits rein quantitativ liege hier „ein Forschungsdesiderat“ in der Sportwissenschaft vor, häufig gar begleitet von Missverständnissen oder Fehlurteilen. Demgegenüber möchte das Buch aufzeigen, dass gerade eine utilitaristische Position die Potenz habe, eine konsistente Grundkonzeption von Sportethik abzugeben. Durchaus ambitioniert und nicht ohne Lust an subtiler Provokation ist explizit von einem „Heilmittel“ zur Lösung brennender Probleme des Sports und der Sportwissenschaft die Rede (127). Diese Potenz wird vor allem gegen eine kantische, gelegentlich auch gegen eine aristotelische Konzeption von Ethik profiliert. Der entscheidende Maßstab ist die praktische Konkretheit und empirische Sättigung, dem gemäß die utilitaristische Konzeption gegenüber ihren Alternativen ausgezeichnet sei. Darin liegt zwar die Gefahr eines schlechten Zirkels, denn es verblüfft durchaus nicht, dass eine Konzeption, die sich wie der Utilitarismus an Handlungsfolgen und am Nutzen orientiert, gewisse Vorteile hat, wenn man den Nutzen für die Praxis seinerseits zu ihrem Beurteilungsmaßstab macht. Aber zweifellos müssen sich andere Konzeptionen mindestens die Frage nach praktischen Konsequenzen gefallen lassen. 161 Der vorgelegte Ansatz hat mindestens zwei systematische Pointen und damit Herausforderungen. Die eine ist die Hauptthese des Buches, nämlich die „der gegenseitigen Affinität von Utilitarismus und Spitzensport“ (Kap. 6). Zweifellos hat der Utilitarismus immanente Begründungsprobleme – seine Lindenblätter sozusagen (oder Achillesfersen, wem das lieber ist), die in traditionellen Einwänden bereits aufgedeckt wurden. Der Witz der genannten These liegt nun darin, eine besondere strukturelle und kontextuelle Eigenart des Sports zu reklamieren, die gerade von der Art sei, dass dort jene traditionellen Probleme des Utilitarismus entfallen. Der Utilitarismus sei in den eigenen vier Wänden der Sportethik ein Heilmittel ohne jegliche Tücken (127). Man kann es dort nehmen und es macht nichts, sozusagen. Falls es nicht ein Placebo ist, ist es aus der Serie von „Du darfst!“ Bereits ein „Legalize it!“ würde Wirkungen unterstellen, die gar nicht gegeben sind. Damit ist schon klar, dass eine zweite systematische Pointe in Anspruch genommen worden ist: keine konkrete Sportethik sei zu haben ohne das Konstitutionsproblem von Sport. So oder so gehe in jede Sportethik eine These zu dem ein, was Sport spezifisch ausmacht. Eine zusätzliche Leistung des Buches liegt darin, dass dort drei verschiedene Dimensionen dessen, was „Konstitution“ heißt, unterschieden werden. Den Witz jener Hauptthese nun ausführlich auszuplaudern, gehört sich nicht. Es ist auch gar nicht nötig, denn Pawlenka macht keinerlei Geheimnis daraus. Das Buch besticht durch Klarheit der Aufgabenstellung, Transparenz im Aufbau und durch Stringenz in der Durchführung. Niemals muss man rätseln, an welchem Ort der Argumentation man sich gerade befindet. Das ist erfreulich für die, die dieses Buch lesen müssen; wer an einer Ethik des Sports interessiert ist, kann dieses Buch nicht auslassen. Wenn man etwas mäkeln möchte, dann kann man erwähnen, dass wieder einmal diejenigen bestraft werden, die noch ganze Bücher lesen. Dass man so manche Ausführung, gar wörtlich, und so manches Zitat doppelt lesen muss, ist störend bis ärgerlich. Plädoyer für Ethik!? Bei aller Güte des Buches im Einzelnen und bei allem Respekt vor der Leistung und der dort dokumentierten Position: Was soll das Buch als solches bzw. genauer: was soll Ethik? Hier ist eine Position dokumentiert, der es ganz selbstverständlich ist, dass gewisse Problemlagen von Sport und Sportwissenschaft einer ethischen Debatte und Beurteilung bedürfen, um einer Lösung näher zu kommen. Das Anliegen der folgenden Ausführungen ist, diese Selbstverständlichkeit madig zu machen. Ich möchte nachdrücklich betonen, dass das keine Kritik an dem Buch von Pawlenka ist, sondern eine aus Anlass dieses Textes. Der Anlass ist zwar keinesfalls beliebig, weil Güte und Konsequenz der Durchführung dieser Position beispielhaft ist. Dennoch kann es keine Kritik an dem Text sein, denn der ist in einer Traditionslinie verankert, die dezidiert ethisch argumentiert und der die Ethik als solche nicht fraglich geworden ist. Zwar bleibt 162 es ein wenig irritierend, wie es einer ganzen Traditionslinie gelingt, so wenig irritiert von Nietzsche sein und bleiben zu können, aber dennoch oder gerade deshalb ist es schlicht zu viel verlangt, in einem einzigen Buch zugleich den utilitaristischen Ansatz vorzustellen, hinsichtlich des Sports weiter zu entwickeln und ihn auch noch rein als solchen einzuklammern. Bekanntlich gibt es beinahe überall im Leben Ketzer. Ein Vorzeige-Ketzer in der Sportwissenschaft, in Sonderheit in Sachen Ethik, ist Eugen König. Mit dem für akademische Diskursspielchen nötigen Gespür für Dramaturgien beginnt Pawlenka die Einleitung mit einem Zitat von König. Die eigentliche Pointe von König ist dann aber überhaupt nicht Gegenstand der Debatte. Die von König formulierten prinzipiellen Vorbehalte gegen jegliche ethische Argumentation werden weichgespült zu Einwänden gegen eine noch nicht genügend gute Durchführung. König aber wollte die Ethik nicht reparieren, sondern ethische Debatten in der Sportwissenschaft abschaffen. Im ganzen Buch erfährt man nicht ein einziges Wort dazu, warum denn König dieser kuriosen Meinung sein kann, Ethik gehöre als ‚vermeintlicher Problemlöser selbst zum Problem‘ (vgl. 16; nochmals 166 f.). Aber was leistet Ethik denn nun? Es wird ernsthaft – also nicht als ghostwriting für Harald Schmidt – folgendes Beispiel verhandelt: „Angenommen, Brasilien spielt bei der Fußball-WM gegen Malta. Es steht 0:0, und Brasilien benötigt einen Sieg, um nicht auszuscheiden. Ein Sieg Brasiliens würde 250 Millionen Brasilianer glücklich und 2 Millionen Malteser unglücklich machen bzw., es wäre den Maltesern egal, weil Malta bereits ausgeschieden ist. In der 90. Minute schlägt ein Brasilianer den Ball absichtlich mit der Hand ins Tor. Der Schiedsrichter ist überzeugter Utilitarist. Soll er das Tor anerkennen oder nicht?“ (89) Dieses Beispiel sei eine „utilitaristische Denksportaufgabe“ (ebd., FN 114). Ethik, Recht und gelebte Sitte Was aber soll man ernsthaft zu Leuten sagen, die noch nicht wissen, dass man andere Menschen einfach nicht umzubringen hat, sondern die erst noch ein ‚gutes‘ ethisches Argument hören wollen, um nicht zu morden (vgl. 139 f.)? Da kann man doch nur sagen, dass es glücklicherweise das Recht gibt, das solcherart Debatten schlicht beendet. Und so auch hier: Es ist im Fußball schlicht nicht erlaubt, den Ball mit der Hand zu spielen. Ende der Durchsage. Bei Pawlenka jedoch dient dieses Beispiel ernsthaft als Beleg dafür, dass utilitaristische Ethik sich in ihren „Entscheidungen primär an den für den sportlichen Wettkampf konstitutiven Bedingungen auszurichten [hat]“ (90). Ethik kommt hier also überhaupt nur dadurch ins Spiel, dass offenbar noch ein Diskussionsbedarf unterstellt wird, ob man solch irregulär erzielten Tore unter Umständen anerkennen soll. Genau das aber zerstört den Witz einer Spielregel. Es gibt genau darüber, was jene utilitaristische Denksportaufgabe noch als verhandelbar behauptet, eben aufgrund geltender Regeln keinerlei Diskussionsbedarf mehr. Diskussionen entstehen, ob jenes Handspiel ein Fall der Regel ist; aber falls klar 163 ist, dass es ein absichtliches Handspiel ist, ist die Debatte beendet, ob das Tor anzuerkennen ist. Weil die Regeln so sind wie sie sind, gibt es an dieser Stelle keinerlei Ethikbedarf. In absolut widersinniger Weise wird diese Situation von Pawlenka auf den Kopf gestellt, wenn sie a) hier überhaupt noch Ethikbedarf unterstellt, um dann b) auch noch die Selbstverständlichkeit, dass die Logik des sportlichen Spiels zu beachten ist, als besonderes Argument für die Angemessenheit gerade des Utilitarismus ins Feld führt.1 Das angeführte Beispiel ist ein hervorragendes Beispiel für einen Fall, in dem eine ethische Debatte gerade ausgeschlossen werden soll. Der Fall ist bereits durch die geltenden Regeln geregelt, und der Schiedsrichter hat schlicht die Rolle, die Einhaltung dieser Regeln zu gewährleisten. Es ist schlechterdings nicht relevant und nicht interessant, ob er im privaten Leben überzeugter Utilitarist ist. Bei manchen Merkwürdigkeiten des Schiedsrichters Merk kann und sollte man sich eventuell fragen, ob man im richtigen Leben genügend Vertrauen aufbringen könnte, den Zahnarzt Merk zu konsultieren, aber selbst solche Fan-Animositäten sind während des laufenden Spiels genau so wenig ausschlaggebend wie es ausschlaggebend ist, ob der Schiedsrichter überzeugter Christ ist, wenn Maradonna die berühmte Hand Gottes bemüht. Will sagen: Es ist gerade die Aufgabe, um nicht zu sagen: der Vorzug und der zivilisatorische Fortschritt des Rechts, bestimmte Debatten darüber, wie man sich verhalten solle, schlicht zu beenden und verbindlich zu regeln. Exakt (auch) diese Funktion erfüllen die Regeln eines Sportspiels: sie erübrigen eine ethische Diskussion.2 Nun ist zum Glück nicht alles rechtlich reguliert. Zum Glück sind z. B. bestimmte Regeln des Anstands noch nicht per Strafgesetz geregelt; es droht nicht gleich eine Strafanzeige, wenn ich in einer engagierten Debatte mein Gegenüber nicht ausreden lasse, sondern ihm unhöflicherweise ins Wort falle. Solcherart Regularitäten gewinnen ihre Geltung von woanders her: es sei bei uns so „Sitte“, den anderen ausreden zu lassen, wie man so sagt. Geltung und Legitimität solcher sittlichen Regularitäten sind insofern in eigentümlicher Weise prekär. Ändern sich die Zeiten, so ändern sich die herrschenden Sitten – und was waren das für Zeiten, in denen man uns Kindern noch beibrachte, das „feine Händchen“ zu geben. Werden solche Sitten, aus welchen Gründen auch immer, allzu brüchig, dann gibt es eben rechtlichen Regelungsbedarf, wie etwa im Falle jener Äpfel, 1 Freilich tut sie das nicht ungeschützt; sie kann Bette/Schimank zitieren (90), die auch gesagt haben, dass es sich nicht mehr um Sport handelt, wenn über den sportlichen Sieg nicht sportlich entschieden wird (der zitierte Wortlaut ist etwas komplizierter, aber ich glaube, ich übersetze korrekt). 2 Ich vereinfache hier natürlich das Verhältnis von Recht und Spielregeln. Aber in der hier wichtigen Hinsicht scheint mir eine hinreichende Analogie zwischen (Spiel-) Regeln und (z. B.) der Straßenverkehrsordnung gegeben zu sein. 164 die eigentlich auf unserem Baum wachsen, aber im Laufe der Zeit dann doch auch in Nachbars Garten hängen.3 Der entscheidende Punkt scheint mir zu sein, dass Recht und Sittlichkeit (gelebte Sitte) zusammen den Modus des menschlichen Miteinander konstituieren. Recht ist gleichsam geronnene Sittlichkeit, d.h. insbesondere: Sittlichkeit ist nicht auf Recht reduzierbar, und geronnenes Recht ist nichts Statisches, weil es in einer es umgreifenden Sittlichkeit gleichsam lebt oder zu Hause ist. Für das Sportspiel heißt das analog: die geschriebenen und die so genannten „ungeschriebenen“ Regeln, also die codifizierten und die üblicherweise praktizierten Regularitäten machen zusammen die „Spielidee“ aus. Es wäre absolut widersinnig, ein Fußballspiel als ein (ausschließlich) durch geschriebene Regeln (dann eben nicht geregeltes, sondern) vollzogenes Geschehen zu beschreiben. Mit den geschriebenen Regeln wäre z.B. absolut vereinbar, wenn 20 Spieler auf dem Platz spazieren gehen und zwei Spieler sich 90 Minuten lang den Ball hin und her spielen. Ersichtlich geht das aber gegen den „Geist“ des Fußballspiels. Sein Witz hätte sich in Luft aufgelöst, die Atmosphäre im (vollen) Stadion wäre tot und sehr bald sehr giftig. Falls einer der beiden Anteile der Spielidee überhaupt entbehrlich ist, dann der der geschriebenen Regeln, aber keinesfalls der der ungeschriebenen. Man kann ggf. den Geist des Fußballspiels zelebrieren ohne geschriebene Regeln. Als wir damals noch auf der Straße kickten, genügten ein paar wenige ad hoc eingerichtete Regeln – zwei Trainingsjacken, möglichst entweder Puma oder adidas, ‚machten‘ die Torpfosten – und der Rest war schon ‚klar‘. Aber man kann nicht umgekehrt den Geist des Fußballspiels ohne Rest in Regeln gießen. Das ist beim Fußballspiel nicht anders als im richtigen Leben. Auch dort gibt es aufgrund der Unverzichtbarkeit beider Anteile nach wie vor – analog – eine intensive Debatte um das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit. Man kann das positive Recht als einen ungeheuren Fortschritt in der Geschichte der Menschheit feiern ohne deshalb Rechtspositivist werden zu müssen. Wer sich also in freier Entscheidung auf ein Spiel einlässt, der hat sich damit entschieden, die Idee des Spiels zu akzeptieren. Und das heißt: er oder sie hat sich an die geschriebenen Regeln zu halten und er oder sie akzeptiert den Geist des Spiels und hat so zu handeln, diesen Geist nicht zu töten. Auch das ist keine freiwillige Leistung oder ein besonderes moralisches Verdienst; es liegt gerade nicht im „persönlichen Ermessen jedes einzelnen“ (264). Es macht ein 3 Ist solche Brüchigkeit erst einmal eingetreten, sind Stilblüten geradezu unvermeidlich. Wer nicht mehr ‚weiß‘, dass man den anderen in der Regel ausreden lässt, der benötigt vielleicht eine ethische Anweisung, die da sagt, dass das Ausreden-Lassen zu den „Konstituentien“ eines „Dialogs“ gehöre, und dass also jemand, der in einen Dialog eintritt, solche wesensnotwendigen oder pragmatisch unverzichtbaren „Konstitutionsbedingungen“ akzeptieren solle oder, besonders spitzfindig, „immer schon“ anerkannt habe. Wenn nicht, begehe man einen performativen Selbstwiderspruch, und eines solchen geziehen zu werden, das ist z. Zt. die philosophische Höchststrafe. 165 Spiel aus, auf den Geist des Spiels verpflichtet werden zu können. Freilich kann man gegen geschriebene Regeln ganz anders verstoßen als gegen ungeschriebene, und also kann man auf sie auch in ganz unterschiedlicher Weise verpflichtet werden. Aber das ändert nichts daran, dass man sich an beide zu halten hat, falls man sich freiwillig auf das Spiel eingelassen hat. Die Unterscheidung zwischen Recht und Sittlichkeit liegt absolut quer zu der Unterscheidung – und das richtet sich gegen die Gesamtargumentation des 7. Kapitels, die bezeichnender Weise an einer kantischen, und nicht an einer hegelschen Unterscheidung orientiert ist −, dass die Befolgung der geschriebenen Regeln das „Mindestmaß“, die Befolgung der ungeschriebenen Regeln dagegen ein moralisch verdienstvolles „Mehr“ sei (268). Wer so argumentiert, der sagt eben, dass man das Spiel zur Not auch dann spielen könnte, wenn alle nur das „Mindestmaß“ gewährleisten, sprich: wenn alle den geschriebenen Regeln folgen. Das öffentliche Spiel wäre der Vollzug der geschriebenen Regeln – ein geistvolles und in diesem Sinne gutes Spiel wäre privat-moralisch beizusteuernde bzw. zu garantierende Zugabe. Eben das ist eine Variante der Reduktion der Spielidee auf die geschriebenen Regeln; das ist Regelpositivismus, der bestreitet, dass positive Regeln nur positive Regeln sind, wenn sie die Atmosphäre eines guten Geistes atmen. Die hier vertretene, und auch von König in Anspruch genommene Gegenposition bestreitet demgegenüber, dass Geist (spirit; not: mind, um der angelsächsischen Tradition verständlich zu bleiben) dadurch zustande kommt, dass sich möglichst viele Einzelne moralisch aufblasen. Besorgte Sportethik Die sportethische Debatte im Sinne Pawlenkas verdoppelt schlicht den Sachverhalt unter dem und im Namen der Ethik. Genau dadurch führt sie eine Stellvertreterdiskussion, die besorgt um die Moralität tut, um angesichts des primären Sachverhalts nicht eingreifen zu müssen. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Zu bestimmten Zeiten war der Fußballspieler Andreas Möller, vom Publikum liebevoll „Heulsuse“ oder auch „Heintje“ genannt, bekannt für seine provoziert-geschundenen Elfmeter, im Fachjargon „Schwalben“ genannt. Das ist nach allen Regeln der Kunst schlicht nicht erlaubt, und also bedarf es keiner zusätzlichen ethischen Debatte, ob ein Spieler sich an die Regeln halten „soll“ oder in welchen Fällen er sich eventuell, unter gewissen Umständen, mit vielen Wenns und Abers, einmal ausnahmsweise doch ganz vielleicht, wenn man es nur bis zu Ende sorgfältig abwägt, doch nicht daran zu halten braucht. Dass die Regeln für Herrn Möller gelten, ist dadurch festgelegt, dass Herr Möller „im medienrelevanten Leistungssport“ mitspielt. Dass er das tut, ist durchaus Ausdruck seiner Freiheit; letztlich nimmt ihm niemand diese Entscheidung ab, selbst wenn Mama weiter für ihn kocht, und also steht er auch (nur) selbst dafür gerade. Aber falls er sich gerade diese Freiheit genommen hat – aus welchen Gründen auch immer − dann steht es ihm nicht mehr frei, sich an die Regeln zu halten. Es ist dann keine besondere moralische Leistung, sich an die Regeln zu 166 halten, und seine private Moral, warum er sich an die Regeln zu halten hat, ist völlig uninteressant. Gegebenenfalls macht die Regel selbst einen Unterschied zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Handspiel, zwischen einfachem Foul und Tätlichkeit etc., aber auch dann ist das Problem ausschließlich, welcher Fall der Regel vorliegt und das Problem ist nicht, was einen Spieler privatmoralisch treibt, in einer solchen Situation absichtlich Hand zu spielen. Der Schiedsrichter hat nicht die Aufgabe, die Gesinnung der Spielenden zu prüfen, sondern ein Spiel zu leiten. Und das ist eine zivilisatorische Errungenschaft und kein Mangel. Ethiker argumentieren an vergleichbaren Orten explizit und entschieden anders (vgl. 100 f.). Sie halten nachdrücklich fest, dass der Hinweis, dass Regeln im Spiel befolgt werden müssen, die „ethisch relevante Frage“ gerade offen lasse. Im Rahmen ihrer ausführlichen Diskussion (Kap. 7) kritisiert Pawlenka ausdrücklich, dass „nicht jede verdienstvolle, d.h. informell faire Handlung zwangsläufig Ausdruck von Moralität“ sei und also noch ein Moralproblem übrig bleibe selbst dann, wenn sich Spielende formell an die Regeln halten (265). Doch wenn sie meint, die Tatsache, dass ein Spieler vielleicht nur aus ‚niederen‘ Beweggründen seinem Gegner gratuliert, nicht aber aus hoher moralischer Überzeugung (ebd.), im Hinblick auf eine vermeintlich notwendige Ethik meint ausbeuten zu sollen, dann ist das eben schief. Es dokumentiert lediglich eine bestimmte Privatmoral derjenigen, die solcherart höhere Moralität einfordern. Der für den Geist des Spiels relevante Sachverhalt ist der Akt der Gratulation – was immer sich die Beteiligten sonst noch dabei denken. Was bleibt dann von der Ethik? Dort, wo es rechtliche Regeln gibt, ist sie gerade ausgeschlossen worden. Dort, wo es ungeschriebene Regeln der Sittlichkeit gibt, gibt es zwei Fälle. Entweder sind solche Regeln fraglos gültig – dann gibt es auch keine ethische Diskussion um sie − oder aber ihre Geltung und Legitimität ist fragwürdig geworden. Dann gibt es u.a. ethische (aber z.B. auch kulturpessimistische) Debatten als eine Art Krisenseismograph. Normalerweise indiziert eine solche Debatte, dass ein bis dato fragloses Funktionieren nunmehr nach einer ausdrücklichen (rechtlichen) Regelung verlangt. Eine andauernde ethische Debatte ist in solchen Normalfällen ein Indikator dafür, dass noch keine Lösung gefunden wurde – sei es als rechtliche Regelung, sei es als wieder hergestellte Fraglosigkeit. Werden solch ethische Debatten gar in Ethikkommissionen auf Dauer gestellt, ist der Verdacht geradezu aufdringlich, dass es sich um die Arbeitsteilung von Sonntagsreden handelt: während die entscheidenden Instanzen ihr Schäfchen ins Trockene bringen, palavern die Stellvertreter. Es bleibt zu hoffen, dass es faktische Ausnahmen von dieser Regel gibt. Im Prinzip ist es sicher möglich, wenn auch extrem unwahrscheinlich, dass eine auf Dauer gestellte Debatte darüber, welche Einwanderungsgesetzgebung gelten soll und wie wir bei uns mit den Fremden umgehen wollen, ein Modus dokumentierter offener Gastfreundschaft ist. Die hier anhand des Buches von Pawlenka exemplarisch vorgestellte Fraglosigkeit der Notwendigkeit einer ethischen Debatte macht mindestens zwei grundle167 gende Voraussetzungen, die keinesfalls fraglos sind. Das ist zum einen die Voraussetzung einer im engeren Sinne moralphilosophischen Position, die meint, eine Individualethik betreiben zu sollen. Dort wird das Spielgeschehen de facto in irgendwie relevanter Hinsicht als Umsetzung privater Gesinnungen interpretiert. Allerspätestens seit und mit Hegel ist die Alternative denkbar, individuelle Entscheidungsfreiheit als freie Abweichung von vorgelebter Sitte zu begreifen. Freiheit ist dann ein freies Sich-Verhalten zu Üblichkeiten, und nicht eine autarke creatio. Die zweite Voraussetzung ist die Konzeption des Menschseins als Vermögen, die sich üblicherweise in Handlungstheorien niederschlägt. Solcherart Handlungstheorie, wie sie paradigmatisch von Gehlen formuliert ist, lässt die Menschen nicht handeln, weil und insofern sie Menschen sind. Einer solchen Handlungstheorie ist das Handeln gerade nicht fraglos, sondern sie braucht noch eigens Handlungsgründe, um Handeln diagnostizieren zu können; anderenfalls läge nämlich bloßes Verhalten vor. Ganz entsprechend braucht es moralische Gründe, um moralisch zu handeln. Das mag man so sehen. Aber 4 das ist, um das mindeste zu sagen, nicht alternativlos. Aber wenn man es so sieht, dann muss man auch Spott ertragen können. Gut wäre sogar, wenn man ihn schon kennen würde und auf ihn reagiert. Schon Marx und Engels spotteten: so sei das eben mit Bentham, dessen Nase erst ein Interesse haben müsse, ehe sie sich zum Riechen entschließe (MEW 3, 194). Was davon abhängt Was bei all dem – bei der Frage: soll man eine Ethik in dem Sinne, wie Pawlenka sie exemplarisch vorlegt, formulieren oder nicht – auf dem Spiel steht, ist durchaus nicht lustig. Wer das Hohelied der empirischen Sättigung singt, der muss sich mindestens die Frage gefallen lassen, wofür denn konkret und praktisch im Hier und Jetzt die ganze ethische Debatte steht. Und dann kann man erwarten – argumentiere ich jetzt bereits moralisch oder nehme ich lediglich das Selbstverständnis wissenschaftlichen Arbeitens in Anspruch? − dass mit dem ideologiekritischen Verdacht der puren Stellvertreterdebatte mindestens umgegangen wird. Ist es etwa weit verbreitet nicht so, dass genau diejenigen, die nicht schärfere Dopingkontrollen durchsetzen, das Doping stattdessen moralisch verurteilen!? Aber weitaus ungemütlicher wird es diesseits solcher Ideologiekritik. Die Moral von der Geschichte, die Ethik-Konzepte erzählen, ist nämlich eine sehr besondere. Eine (Sport-) Ethik ist erklärtermaßen dazu da, eine bestimmte Moralsorte, nämlich eine universelle, verbindlich zu begründen. 4 Die Gegenposition ist mit großer Vehemenz von Herder vertreten worden. Das Perfide liegt darin, dass Gehlen das Gegenteil vertritt, sich aber wirkmächtig auf Herder berufen und ihn damit erfolgreich eingemeindet und stillgestellt hat; vgl. ausführlicher Volker Schürmann, Kultur als Mittel oder Medium. Zur systematischen Differenz der Modelle ‘Gehlen’ und ‘Plessner’. In: B. Ränsch-Trill (Hrsg.), Natürlichkeit und Künstlichkeit. Philosophische Diskussionsgrundlagen zum Problem der Körper-Inszenierung, Hamburg 2000, 57-66. 168 Pawlenka zitiert zustimmend, gar als Motto eines ganzen Abschnittes, die folgende – und ich lese sie als paradigmatische – Forderung: „Die Moral muss so begründet sein, dass jeder – nach genügender Instruktion – einsieht, dass er so handeln müßte und dann auch aus Einsicht so handelt. Grundlage der Moral ist die Einigkeit und Sensibilität aller.“ (Heringer, zit. n. 139) Die so formulierte Forderung ist doch in allen Hinsichten ein einziger Skandal. Wo, bitteschön, bleibt die Empörung der Ethiker? Es ist ein Skandal in alltagsweltlicher Hinsicht: Diejenigen Situationen, die (meine) Moral überhaupt fraglich werden lassen, also nach Begründungen verlangen, sind in aller Regel moralische Konflikte. Ich habe dann für mehrere Optionen gleich gute bzw. gleich schlechte Gründe. Soll ich meinen Freund moralisch verurteilen, nur weil er eine andere, moralisch gleich problematische Option wählt als ich es tue (‚jeder nach Instruktion einsieht, dass er so handeln müsste‘)? Es ist ein ästhetischer Skandal: jede gute Tragödie bringt einen moralischen Konflikt auf die Bühne. Es wäre eine absolut jämmerliche Vorstellung, wenn man tatsächlich sagen könnte, dass der Held diesen Konflikt so und nur so auflösen muss, um moralisch sauber zu bleiben. Die ganze Kunst besteht darin, ein moralisches Dilemma aufzuführen und dieses nicht aufzulösen. Es ist ein logischer Skandal: Einmal angenommen, jene Moral sei gut begründet. Dann kann als Ergebnis der Instruktion dennoch ausschließlich eine konditionale Struktur herausspringen: Falls du dich auf diese Moral einlässt und falls du konsistent/ wohl begründet handeln willst, dann musst du dies und nicht jenes tun. Welche Metamoral zwingt mich, auf diese beiden Prämissen einzugehen? Welche Logik besagt, dass es eine und nur eine in sich gut begründete Moral gibt? Die so unschuldig daherkommende Forderung nach verbindlicher Begründung der Moral hat somit zwei Dimensionen. Einmal zugestanden, Moral müsse überhaupt begründet werden, dann besagt Verbindlichkeit der Begründung dort zweierlei: zum einen ist eine ‚gute‘, in sich konsistente Begründung verlangt, der man bruchlos folgen können kann. Das ist eine Trivialität, weil das bereits analytisch in Begründung enthalten ist. Zum anderen aber klagt „Verbindlichkeit“ dort die Eineindeutigkeit des so begründeten Handelns ein. Und das ist der politische Skandal: wer immer nun gegen diese Moral dieses Ethikers verstößt, verstößt vermeintlich gegen ‚die‘ Moral ‚der‘ Menschheit – und ist folglich ein moralisches Untier. Geradezu prototypisch kommen im Buch von Pawlenka die beiden Bestimmungen zum Vorschein, die mir konstitutiv für Moral (und für Ethik als philosophische Begründung von Moral) zu sein scheinen. Gesellschaftliche, also überindividuelle Phänomene werden in relevanter Hinsicht als Resultat der Verwirklichung individueller Gesinnungen aufgefasst – und gerade nicht als Medien, 169 innerhalb dessen Individuen sich allererst individuieren. Zum zweiten gilt korrektes Verhalten als ein solches, dem alle Menschen in gleicher Weise entsprechen können müssten – auch noch normative Konflikte können auf dieser Basis nicht als Konflikte gelebt und ausgehalten werden, sondern wären derart, dass sie in eindeutiger Weise moralisch sauber aufgelöst werden können und müssen. In der praktischen Regel versagen dann normale Erdenbürger an dieser moralischen Heroik, was gerade auch Judith Butler hat nachdenklich werden lassen und zum etwas martialischen Titel Kritik der ethischen Gewalt geführt hat. Konfligierende Interessen und unterschiedliche, gleichwohl in sich konsistente Normen tauchen in solcherart Ethik systematisch nicht auf bzw. werden in einer verheißenen Universalmoral vernebelt. Beide Bestimmungen zusammen machen aus, alles beim Alten zu lassen, denn sie lassen systematisch die gesellschaftlichen Strukturen in Ruhe. Beispiel einer überindividuellen Ethik Die Pointe und das besondere Anliegen von DREXEL (2002) ist zunächst ganz unabhängig von einer ethischen Erörterung. Zwar gibt es ein eigenes Kapitel (I.3) „zur Ethik des wettkampfsportlichen Kulturspiels“, aber die „agonale Logik und die dazugehörige Gewinn-Moral des Wettkampfsports“ ist erklärtermaßen ein „Beispiel“ eines allgemeineren Sachverhalts (9), der den Hauptgegenstand des Buches ausmacht. Dieser Gegenstand ist die Frage, wie man denn (die Spezifik von) Sport und Sportwissenschaft bestimmen könne oder solle, wenn man sie denn bestimmt. Das eigene Anliegen ist dabei zunächst negativ bestimmt. Es richtet sich gegen alle anderen: „Die Sportwissenschaft [...] ging bisher davon aus, dass ihr Gegenstandsbereich ‚interdisziplinär‘ oder ‚integrativ‘ bearbeitet werden könne und solle.“ (9) Genau das bestreitet Drexel; mindestens bedürfe es des „kritischen Überdenkens“ angesichts der praktizierten Vielfalt des Handelns im Sport einerseits und „nicht zu vereinbarender wissenschaftlicher Paradigmen“ in der (Sport-) Wissenschaft andererseits. Das Ergebnis dieser Prüfung ist, dass die Sportwissenschaft als eine „Paradigmen-Wissenschaft“ zu verstehen sei, deren Autonomie und Authentizität „nicht in einer gegenstandsfundierten Einheit, sondern in einer paradigmenfundierten Vielheit“ zu suchen sei (254). Was dann passiert, ist sonnenklar: Das vorgelegte Konzept „bezieht sich nicht mehr auf ‚das Ganze‘ dieser Komplex-Disziplin, auf ‚die‘ Sportwissenschaft [...]. Ihm kann es also schon im Grundsatz nicht um eine umfassende Unifikation, z. B. um das ‚eine‘ Paradigma der ‚einen‘ Sportwissenschaft gehen.“ (254) Damit könnte schon alles vorbei sein, denn dieses Konzept gibt es ja nur, weil ‚die‘ Sportwissenschaft bis dato alles ganz anders gesehen hatte. Zum Glück wird das allein dem Buch bei weitem nicht gerecht. Die sachliche These des Buches, dass das, was Sportwissenschaft spezifisch ausmacht, nicht in und durch die Einheit eines Gegenstandes verbürgt ist, weil es paradigmen170 freie (Zugänge zu) Gegenstände(n) gar nicht gebe, ist als solche klar, verständlich, streitbar. Möglicherweise ist sie sogar zu selbstverständlich, um gut verständlich zu sein. Es wäre beispielsweise eine eigene, in dem Band partiell auch durchgeführte, Aufgabe zu zeigen, dass diese These nicht äquivalent ist zur These der prinzipiellen Methodenabhängigkeit wissenschaftlicher Gegenstände; es wäre eigens zu zeigen, dass letztere bei aller Vielheit von Methoden implizit oder explizit dennoch eine Einheit eines Gegenstandes in Anspruch nimmt. Gelänge das nicht, bricht die Frontstellung etwa gegen Willimczik schlicht in sich zusammen.5 Diese These so zugespitzt zu formulieren, in der Sache auszuführen, an Beispielen zu konkretisieren und gegen andere Konzepte zu profilieren, darin liegt zweifellos die Stärke und eben besondere Pointe des Buches. Das alleinige Vorrechnen von Selbstwidersprüchlichkeiten dient allein dazu, sich auf diese These nicht einlassen zu müssen. Gleichwohl sind die logischen Ungereimtheiten kein bloßer Zierrat schlechter Durchführung. Sie machen sich durchaus handfest bemerkbar. Man kann zweifellos sinnvoll prüfen wollen, ob die praktizierte Disziplin, die landläufig Sportwissenschaft heißt, durch einen, interdisziplinär konstituierten Gegenstand zusammengehalten wird, oder nicht vielmehr durch eine Vielheit von bestimmten Paradigmen. Das ist offenkundig ein Streit zwischen zwei Meta-Paradigmen. Diese Perspektive auf den Streit nimmt Drexel aber nicht ein; er argumentiert vielmehr mit dem materialen Gehalt des einen Meta-Paradigmas gegen das andere. Die Argumentation ist im Kern: Wenn man Wittgenstein und Kuhn folgt, und wenn man deren Paradigmen-Konzept geringfügig im Hinblick auf den Sport modifiziert, dann ist die Sportwissenschaft eine Paradigmen-Wissenschaft. Nun ist es natürlich nicht sonderlich überraschend, dass im Rahmen des Paradigmas der Paradigmenabhängigkeit die (Sport-) Wissenschaft nicht durch einen einheitlichen Gegenstand zusammengehalten wird. Zu erfahren, was passiert, falls man dieses Konzept auf den Sport bezieht, ist das eine. Man wollte aber gerne etwas darüber erfahren, dass und warum es möglich und sachlich angemessen ist, eben dieses Meta-Paradigma zugrunde zu legen. Aufgrund dieser nicht aufgelösten Doppeldeutigkeit von ‚Paradigma‘ – also aufgrund dessen, dass die These der Paradigmenabhängigkeit nicht selbst als Paradigma thematisiert wird − kommt es folgerichtig zu der Kuriosität, dass ein Verfechter der Vielheit von Paradigmen um die Gewissheit des einen, und nur dieses einen, Meta-Paradigmas weiß. Das manifestiert sich dann sogar gelegentlich als schlechter Stil. Paradigmenrelativ sind immer nur die anderen; man selbst gibt nur Selbstverständlichkeiten zu Protokoll, die den Anderen in deren „Abbildungsimpotenzen“ und „Konstruktionsdefizite[n]“ (71) bis dato entgangen sind. Aber selbst, wenn man solche Ungereimtheiten nicht unter den Teppich kehrt, bleibt genug Klares vom Teppich sichtbar. So gibt es durchaus auch ‚guten‘ Stil, 5 Und das ist bereits auf der Oberfläche wahrlich nicht unwahrscheinlich, denn beide beziehen sich wesentlich auf Wittgensteins Konzept der Familienähnlichkeit. 171 wo ausdrücklich die Relativität der eigenen Konzeption benannt wird (69 f., 129 f., 141), so wie überhaupt die Prämissen des eigenen Ansatzes offen gelegt werden. Eines der wichtigsten Ergebnisse scheint mir darin zu bestehen, dass die selbstverständliche, und wohl von niemandem bezweifelte Eingebundenheit sportlichen Geschehens in einen kulturellen Kontext, nicht als Abhängigkeit von kulturellen Bedingungen gedeutet wird, sondern als konstitutive Einheit. Sportliches Geschehen wird nicht gedeutet als (individuelles) Handeln, was sich de facto immer unter kulturellen Bedingungen vollzieht, sondern sportliches Geschehen ist Handeln-in-konkretem-kulturellen-Kontext. Mit Bezug auf Searle spricht Drexel von „institutionellen Tatsachen“ (87 f.). „Wird mit Hilfe eines Fußtritts ein Ball über eine bestimmte Linie befördert“, so ist das noch lange kein Tor; ein solches ist das erst im Rahmen einer bestimmten ‚Institution‘, z.B. eines geregelten Fußballspiels (88). Konkretisiert man das vorgelegte Konzept im Hinblick auf eine Ethik, dann hat das eine wichtige und eigens hervorzuhebende Konsequenz: Selbst und gerade dann, wenn man den Ausgang vom Individuum nimmt, ist nunmehr ein individualistisches Ethik-Konzept ausgeschlossen. Und so hält Drexel (105) auch nachdrücklich fest, dass ein moralisches Problem nicht durch die Person rein als solche, sondern durch die Person in ihrer „Verwobenheit in die Struktur eines Lebensspiels“ konstituiert ist. Und diese „Verwobenheit“ hat dann ihrerseits Konsequenzen. Nimmt man nämlich tatsächlich ernst, dass der kulturelle Kontext nunmehr konstitutiv ist, und gerade nicht ein Gemengelage von Bedingungen, die ein als solches allgemeineres Phänomen einschränkt, dann ist die Idee einer ‚Anwendung‘ allgemeinerer ethischer Prinzipien auf die besondere Welt des Wettkampfsports ausgeschlossen. Das Allgemeine bedeutet nunmehr in dem je spezifischen Kontext etwas anderes. Es ist nunmehr beispielsweise nicht mehr möglich, ein allgemein-menschliches Konzept von Gerechtigkeit zu entwickeln, um dann zu fragen, wie sich ein solches Konzept unter den „Bedingungen“ des Sports „konkretisiert“. Falls es überhaupt Sinn macht, im Sport von Gerechtigkeit zu reden, dann wird sie nunmehr als sportliche Gerechtigkeit eine andere sein. Das Medium des Sports konstituiert nunmehr (also bei der Grundannahme der Verwobenheit sportlichen Geschehens in ein Lebensspiel) einen spezifischen Modus von Gerechtigkeit, allgemeiner: einer ethischen Konzeption. Und dieser Modus ist der ethischen Sache keine additive Zugabe, sondern man kann gar nicht sagen, was die ethische Sache des Sports denn sei ohne diesen Modus zu thematisieren. Bei Drexel nimmt das im Ergebnis die Gestalt an, dass er gewisse traditionelle und vielen lieb gewordene ethische Grundsätze des Sports verwirft, weil sie der Spezifik des Wettkampfsports nicht gerecht würden. Beispielsweise gehört zur traditionellen Idee von „Sportlichkeit“ der ethische Grundsatz, dass die ‚Haltung wichtiger als der Sieg‘ sei (Diem, nach 107). Dagegen setzt Drexel wohl völlig zu recht, dass das ein hehrer allgemein-menschlicher Grundsatz sein mag, aber mit dem, was spezifisch im Wettkampfsport geschieht, nichts zu tun habe. In einem Wettkampf komme es nun einmal darauf an, eine Asymmetrie von Sieg 172 und Niederlage herzustellen, und insofern können Wettkämpfende „dann und nur dann moralisch gut und richtig handeln, wenn sie in einem wohlverstandenen Sinne egoistisch handeln“ (105). Die Geschichte vom ethisch neutralen Sport Dieses ethische Konzept eines „sportiven Egoismus“ mag man sachlich überzeugend finden oder auch nicht. Ideologiekritisch mag man überzeugend finden, dass es sehr wirksam gegen weit verbreiteten Idealismus in der Sportethik ätzt, oder man mag betonen, dass es kein Zufall sein kann, dass der „Egoismus“ gerade dann und dort entdeckt wird, wo sich in ökonomischen Dingen der Neoliberalismus gerne als alternativlos gebärdet. Das alles sind wichtige und notwendige Debatten. Aber sie ändern nichts daran, dass auch bei Drexel ein zentraler Ausgangspunkt als völlig unstrittig und nicht eigens der Diskussion wert gilt: dass Ethik überhaupt Not tut. So wichtig und überzeugend die Betonung der Verwobenheit der Person in einen Kontext ist, so ändert das nichts daran, dass Drexel darin lediglich eine Korrektur einer Grundposition sieht, die er nachdrücklich z. B. mit Gerhardt teilt: „Es wird dabei eine ethische Perspektive eingenommen, welche den Gebrauch von Handlungszügen im wettkampfsportlichen Kulturspiel in das Blickfeld rückt und nicht den Wettkampfsport in einem allgemeinen Sinn. Mieth hat das in bezug auf den gesamten Sport wie folgt begründet: ‚Sport ist ein nichtsittlicher Wert; über seine sittliche Relevanz entscheidet der Gebrauch‘. Der ‚Gebrauch‘ im moralischen Sinne setzt grundsätzlich die Entstehung eines entsprechenden Problems in einer zur sittlichen Selbstreflexion fähigen und willigen Person in einem Handlungsspiel voraus.“ (105) Oder wie Gerhardt formuliert, was Drexel, wie gesagt, nicht bestreitet, sondern im Hinblick auf die Verwobenheit korrigieren will: „Ein moralisches Problem entsteht jedem, der handeln muss oder handeln will, sich jedoch erst zu vergewissern hat, als was er sich eigentlich versteht.“ (nach 105 f.) Erklärtermaßen gibt es dort eine theoretisch und praktisch relevante Unterscheidung zwischen Sport und dem Gebrauch von Sport. Der Sport als solches sei ein nicht-ethisches Phänomen, das erst im Gebrauch zu einem ethischen werde. Das ist analog zu derjenigen Idee, dass Technologien rein als solche wertneutral seien, und sich erst bei der Anwendung von Technologien ein Verantwortungsproblem ergibt. Das erweckt einen Eindruck von hoher Plausibilität – was soll an der Existenz eines PCs, eines Autos etc. rein als solcher normativ relevant sein? −, aber es ist immerhin nicht selbstverständlich. Es ist eine sehr bestimmte, und keineswegs alternativlose Konzeption, gesamtgesellschaftlich auf den Individualverkehr zu setzen, und dann den Individuen die moralische Last der Vielfahrerei und der Industrie die moralische (!?) Last der Entwicklung eines sog. 3-Liter-Motors aufzubürden. Was sollte an der Entscheidung für den Individualverkehr normativ neutral sein? 173 Und analog und zugespitzt: was soll denn das sein, ein wettkampfsportliches Kulturspiel, wenn nicht der Vollzug von Handlungszügen in einem bestimmten, nämlich dem wettkampfsportlichen Rahmen? Was soll das sein, was dort erst noch „gebraucht“ werden muss, um sportlicher Wettkampf zu sein? Was soll das sein: ein nicht-ethischer Sport, der seine ethische Unschuld erst (!?) verliert, wenn er ausgeübt wird? Wer den Unterschied von Sache als solcher und ihrem Gebrauch kennt, und wer dieses Modell erklärtermaßen auf den Wettkampfsport bezieht, der kennt damit eine Sache ‚Wettkampfsport‘ vor seiner Ausübung, die noch eigens viele Spieler als Täter braucht, um ein real stattfindendes Wettkampfspiel zu sein. Ein „nicht-normativer Sport“ als eine Art generativer Grammatik eines real stattfindenden Sports. Und da ist sie dann wieder: die Nase Benthams, die erst noch ein Interesse haben muss, um sich zum Riechen zu entschließen. Nichts aber zwingt zu dieser Annahme; nichts zwingt zu der Annahme, dass ein wettkampfsportliches Geschehen nicht der Vollzug von Handlungen ist; nichts zwingt zu der Annahme, dass sich die Frage der Normativität eines Wettkampfspiels erst dadurch stellt, dass man den mitspielenden Individuen moralische Entscheidungslasten aufbürdet. Wer jemanden anderen umbringt, mag individuell ein moralisches Problem haben. Aber ganz unabhängig davon, ist ein solcher Fall im Rahmen unserer Kultur und Rechtsordnung geregelt und schlicht verboten. Weil es nicht ganz so simpel ist, ist unsere Rechtsordnung im Laufe der Zeit umfänglicher und differenzierter geworden als die ehemals 10 Gebotstafeln. Jemanden umbringen ist noch lange nicht umbringen, sondern kann und muss unterschieden werden in totschlagen und morden, in Notwehr und Nothilfe, in Töten-im-Krieg, in staatlich ausgeführte Todesstrafe und einiges mehr. Unsere Rechtskultur wäre eine andere, wenn das Morden von anderen Menschen signifikant häufig als Kavaliersdelikt durchgehen würde. Aber das ist kein moralisches Versagen der Mörder, sondern eine gesellschaftlich andere Regelung, und, wenn man denn will, ein Versagen der Rechtsordnung. Wer jemanden anderen im Spiel foult, der verstößt gegen die Regeln. Wenn dies signifikant häufig ohne Ahndung geschieht, dann gehört das, wie wir ja auch so sagen, „zum Spiel dazu“. Wir spielen dann heute de facto ein anderes Spiel als zu Zeiten von Sepp Herberger – aber alles andere wäre auch verblüffend. Falls wir das Spiel so nicht wollen, müssen wir die Regeln und die Verfahren der Durchsetzung ändern, und nicht denen eine moralische Last aufbürden, die lediglich das tun, was z.Zt. eben in der Welt des Sports als Fußballspiel gilt. Wer in einem Fußballspiel den Ball nicht ins Aus spielt, wenn ein Spieler verletzt am Boden liegt, der verstößt heutzutage gegen eine ungeschriebene Spielregel. Ein solcher Verstoß kann nicht vom Schiedsrichter geahndet werden, aber de facto wird er vom Publikum geahndet, wenn auch in einem weicheren Verständnis von Ahndung. Der Status einer ungeschriebenen Regel liegt darin, dass sich ein Spieler nicht recht leisten kann, dagegen zu verstoßen, weil durch die Mitspieler, das Publikum, die Medien etc. ein Klima hergestellt und aufrechterhalten wird, das solche Verstöße ‚verurteilt‘. Die ‚Strafen‘ und der Zwang zur Einhal174 tung ist bei ungeschriebenen Regeln von gänzlich anderem Härtegrad als bei kodifizierten Regeln; das Grundprinzip bleibt dennoch erhalten: es ist einfach nicht relevant, warum Spieler sich an die Regeln halten. Es gehört sich einfach, den Ball in jener Situation ins Aus zu spielen, und falls es so ist, dass ein Spieler sich daran hält, weil er es sich nicht anders ‚leisten‘ kann, dann funktioniert das Spiel ganz unabhängig davon, ob er individuell diese Regel einsichtig findet oder nicht, ob er sie akzeptiert oder nicht, ob und wie viel er darüber nachdenkt, gegen sie zu verstoßen etc. „Ethik ist bis ins Unendliche erweiterte Verantwortung“ – mit dieser Weisheit Albert Schweitzers wirbt UTB im Dezember 2003 für seine Ethik-Bücher. Verantwortung, die sich ins Unendliche erweitert, können endliche Wesen nicht anders als je endlich zu verfehlen. Solcherart Verantwortung verliert sich folglich in den inneren Tiefen, im ‚schlechten‘ Gewissen des Individuums. Es ist jene von Hegel geziehene „sehr falsche christliche Demut und Bescheidenheit, durch seine Jämmerlichkeit vortrefflich (zu) sein“ (TW 20, 362). Utopie eines guten Miteinander wäre, politisch-konkrete Verantwortung endlich-begrenzt sein zu lassen und in den zu Tage liegenden Wirrungen des praktischen Tuns spürbar zu übernehmen. Verfasser Volker Schürmann, HDoz. Dr. habil., Institut für Sportpsychologie und Sportpädagogik, Sportwissenschaftliche Fakultät, Universität Leipzig 175