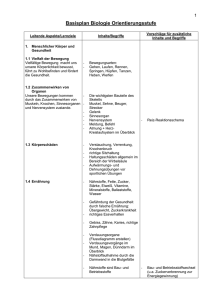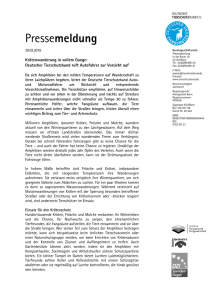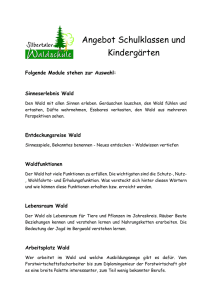2009 - Universität Wien
Werbung

Marchegg ’09 Skriptum zur Lehrveranstaltung Freilanddidaktik in Lehramt Biologie und Umweltkunde SS 2009 E. Ursprung, C. Kasper, P. Pany 1 E. Eder & (Eds.) Die Teilnehmer – Kurs 1 (14.-18. April 2009) Studis: 1 Eva Edelmann, 2 Sabrina Walentich, 3 Klaus Tscherner, 4 Daniel Kirby, 5 Stefanie Bruns, 6 Michaela Urbauer, 7 Christoph Eichhorn, 8 Elisabeth Köberl, 9 Karin Windsteig, 10 Klaudia Wendl, 11 Eva-Maria Hoschof, 12 Sabine Putz, 13 Barbara Zauner, 14 Peter Lampert, 15 David Blum, 16 Florian Etl, 17 Elisabeth Ofner, 18 Tim Padayhag. Lehrende: 19 Erich Eder, 20 Eva Ursprung, 21 Christian Kasper, 22 Peter Pany 21 1 19 2 8 3 9 4 5 12 10 6 7 13 22 11 16 20 14 17 18 15 2 Die Teilnehmer – Kurs 2 (25.-29. April 2009) 1 Studis: 1 Ulrike Derks, 13 Sarah Merschitz, 2 Pia Edelmann, 3 Michael Lins, 7 Daniel Esletzpichler, 8 Carina Lenotti, 5 Martin Pöcksteiner, 9 Reinhard Turetschek, 12 Leni Reidinger, 4 Miriam Schiebel, 6 Tatjana Rinas, Philipp Wiatschka. Lehrende: Erich Eder, 10 Eva Ursprung, 11 Christian Kasper 2 3 4 13 12 5 11 10 6 9 7 8 3 Inhalt Pflanzen der Au (E. Ofner & K. Tscherner, Kurs 1)……………………………………………………………………………………………5 Blütenökologie – Denken wie ein Insekt (T. Padayhag & P. Lampert, Kurs 1)……………………………………………………………13 Blütenökologie (D. Esletzbichler & C. Lenotti, Kurs 2)………………………………………………………………………………28 Abwehrmechanismen der Pflanzen (M. Urbauer & B. Zauner, Kurs 1)…………………………………………………………41 Abwehrstrategien der Pflanzen (U. Derks & S. Merschitz, Kurs 2)………49 Der Baum als Lebensraum (K. Wendl & K. Windsteig, Kurs 1)…54 Totholz (E. Hoschof & E. Köberl, Kurs 1)……………………67 Tierspuren (S. Bruns & F. Etl, Kurs 1)………………………79 Tierspuren (T. Rinas & P. Wiatschka, Kurs 2……………90 Evertebraten (D. Kirby & C. Eichhorn, Kurs 1)…………100 Evertebraten (M. Pöcksteiner & R. Turetschek, Kurs 2)…116 Amphibien (E. Edelmann, S. Walentich, Kurs 1)………126 Checkpoint Amphibien (P.Edelmann & M.Lins, K.2)...139 Reptilien (S. Putz & D. Blum, Kurs 1)………………151 Reptilien (MM. Reidinger & M. Schiebel, Kurs 2)…157 Feedback………………………………167 Eva Hoschof 4 (rechts) mit . Feldgrille (Gryllus campestris) Pflanzen der Au Welche Eigenschaften machen eine Pflanze im Lebensraum Au erfolgreich? Wieso stammen viele Nutzpflanzen aus der Au? von Klaus Tscherner & Elisabeth Ofner Fachliche Einführung Bei einer Au handelt es sich um einen sehr dynamischen Lebensraum, der in ständiger Wechselwirkung mit dem begleitenden Fluss steht. Dies betrifft sowohl das Grundwasser, dessen Stand in der Au von der Spiegelhöhe des Flusses abhängt und in weiter Folge auch das Oberflächenwasser, dessen Wechselwirkung sich in Form periodischer Hochwässer auswirkt. Die durchschnittliche Reichweite dieser Hochwässer legt zugleich die äußere Grenze der Au fest, an der letztendlich die ökologischen Auswirkungen von Nährstoffeintrag und Störwirkung enden (vgl. REICHHOLF und STEINBACH, 1993, 149ff.). Im Gebiet von Marchegg tritt die March, welche im Norden Mährens auf einer Seehöhe von 1275m entspringt und einige Kilometer flussabwärts nach 344 km Lauflänge in Hainburg in die Donau mündet (vgl. FINK, 1999, 15), gleich zwei mal im Jahr, im März / April sowie im Juli /August über die Ufer. Im Frühjahr führt die Schneeschmelze in den Sudeten zu einem erhöhten Wasserstand der March, die schlussendlich über die Ufer tritt und die Uferzone überschwemmt. Dabei „können die Auen auf österreichischer Seite bis zu zwei Kilometer breit unter Wasser stehen“ (ZUNA-KRATKY, 1999, 103), der Rückgang des Wassers kann sich mehrere Wochen hinziehen und verhindert unter anderem die Entwicklung von Frühjahrsgeophyten. Im Sommer verursacht der Rückstau der unteren March an der Mündung zur Donau, die während der Sommermonate durch die Schneeschmelze in höheren Regionen der Alpen eine erhöhte Wasserführung aufweist, das zweite Hochwasser in Marchegg. Die ökologischen Auswirkungen dieser Hochwasserdynamik sind sehr vielfältig und umfassen die Bildung bzw. Zerstörung neuer Pionierstandorte durch Sedimentation und Erosion, die Schaffung temporärer Biotopsituationen, verursacht durch die periodischen Wasserstandschwankungen, die Beeinflussung der Artenzusammensetzung aufgrund der unterschiedlichen Stresstoleranzen und Anpassung, sowie Veränderungen im Ressourcenbudget. Letzteres bezieht sich vor allem auf die sehr nähr- und mineralstoffreichen Schlammschichten, die durch den ständigen Eintrag von Feinsedimenten während der Hochwasserphasen (Hochwassermarken vgl. Abb. 1)) abgelagert werden und der Vegetation direkt und mittelbar zur Verfügung Elisabeth Ofner, Klaus Tscherner: Pflanzen der Au stehen (vgl. ZULKA und LAZOWSKI, 1999, 41 f). Auf dieser überdurchschnittlich hohen Mineralstoff- und Wasserzufuhr beruht auch das enorme Produktionspotential mancher Pflanzen an diesem Standort, wie etwa der echte Hopfen (Humulus lupulus) beweist, der mehrere Zentimeter pro Tag wachsen kann. Innerhalb der March-Auen lassen sich infolge des räumlich unterschiedlich ausgeprägten Einflusses von Hochwässern folgende zwei Zonierungen erkennen: In unmittelbarer Flussnähe und im stärksten Einzugsgebiet der Hochwasser bzw. bei mäandrierenden Flüssen an den Gleitufern mit vorgelagerten kahlen oder krautigen Pioniergesellschaften, befindet sich der Weichholz Auwald. Dieser ist im Unterschied zum sogenannten Hartholz Auwald, der in einem geringeren Ausmaß dem Hochwasserstress ausgesetzt ist, wie es in etwas höher gelegenen Waldbereichen oder im Prallhang von mäandrierenden Flüssen der Fall ist, flächenmäßig bedeutend kleiner und zudem artenärmer, da nur vergleichsweise wenige Pflanzenarten mit der hohen Dynamik (Erosion/Sedimentation), ausgelöst durch die zum Teil beträchtlichen Wassermenge, während und nach der Überflutung, dem hohen Grundwasserspiegel und der resultierenden Staunässe, zurecht kommen. Daraus ergibt sich eine charakteristische Flora für beide Zonen die in weitere Folge getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Hartholz Auen nehmen mit einem Anteil von 90% an den Auwäldern von March und Thaya, die weitaus größeren Waldflächen ein (vgl. LAZOWSKI, 1999, 139). Der Boden in diesem Bereich ist bereits wesentlich tiefgründiger und mit zahlreichen Wurzeln durchsetzt, die auf die üppige Vegetation in diesem Bereich zurückzuführen sind. Die Pflanzen profitieren zwar auch hier vor von den in periodischen bzw. episodischen Abständen stattfindenden Nähr- und Mineralstoffeintrag durch Hochwässer, sind aber nicht in dem Ausmaß mit den Problemen des Wasserüberschusses und der Staunässe konfrontiert. Bezüglich der Artenzusammensetzung herrschen in der Harten Au edelholzreiche Mischwälder mit Eschen, Eichen und Ulmen, deren hartes und schweres Stammholz gleichzeitig diesem Waldtyp den Namen verleiht, in der Strauchschicht der Weißdorn (Crataegus spp.), sowie eine wesentlich ausgeprägtere Krautschicht mit Nutzpflanzen, wie etwa dem echten Hopfen (Humulus lupulus) und Bär-Lauch (Allium ursinum) vor (vgl. LAZOWSKI, 1999, 139). In der Weichen Au dominieren vor allem namensgebende Weichholzarten wie Silber-Weiden (Salix alba) und SchwarzPappeln (Populus nigra), die sich durch ihr zerstreutporiges, weiches und leichtes Holz auszeichnen und aufgrund ihrer fehlenden Verkernung leicht zersetzt und letztendlich hohl werden. Den baumförmigen Arten in dieser Zone sind somit hinsichtlich ihres Lebensalters Grenzen gesetzt, was wiederum die Kehrseite der höchst produktiven Jugend dieser Arten darstellt. In dieser erweisen sich Weiden und Pappeln als wahre Pioniere, insbesonders in ihrer Wachstumsgeschwindigkeit und in der Art und Weise ihrer Verjüngung. Die Samen werden durch ihren Haarschopf weit verbreitet, wodurch neu entstandene Uferstandorte meist noch im selben Jahr besiedelt werden können, wobei die „Erstbesiedlung“ den Weiden vorbehalten ist. Die Pappelarten etablieren sich erst nachdem der Boden durch die Weidenarten vorbereitet wurde, können Erstere allerdings schneller übergipfeln, da ihr Holz etwas widerstandsfähiger ist und ihre Blätter im Vergleich zu den schmalblättrigen Weiden wesentlich großflächiger sind und dadurch 6 Elisabeth Ofner, Klaus Tscherner: Pflanzen der Au mehr Photosynthese betreiben können (vgl. REICHHOLF und STEINBACH, 1993, 149ff). Weiters zeigen Weiden eine Reihe von Anpassungen an die Flussdynamik. So lassen sich etwa angeschwemmte Zweige, welche durch die enorme mechanische Beanspruchung während eines Hochwassers der Strömungsgeschwindigkeit, trotz hoher Elastizität, nicht mehr standhalten können und abbrechen, leicht bewurzeln und ermöglichen vielen Weidenarten eine vegetative Vermehrung über Stecklinge. Aber auch umgestürzte Bäume können über Stammausschläge neu austreiben und Adventivwurzeln ausbilden, oder es wird über Verletzungen oder Zweigbruch eine zweite Blüte induziert, wodurch eine neuerliche generative Vermehrung ermöglicht wird. Weiden finden mit ihren stromlinienförmigen Blättern und elastischen Zweigen allerdings auch Eingang in der Ingenieurbiologie, in der sie, durch ihrer hervorragende Fähigkeit als Sedimentfänger, auch als „lebende Bürsten“ bezeichnet werden (vgl. LAZOWSKI, 1999, 135). Übergangsbereich zwischen Weicher und Harter Au, nahe Zoologischer Station Marchegg, Mitte April 2009: Im Vordergrund von trockenen Sedimentablagerungen grau gefärbte Vegetation der Weichen Au. Dahinter die höher gelegene Harte Au mit ausgeprägter Krautschicht. Rechts unten bis Mitte Wasserreste vom Hochwasser in der Weichen Au. Diese sind in der Harten Au zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden. Um dem Mineralsalz- und Sauerstoffmangel im Wurzelbereich bei anhaltender Staunässe und erhöhtem Wasserspiegel entgegenzuwirken, ist die Borke mit zahlreichen Lentizellen ausgestattet oder bei längeren Überschwemmungen auch ein Austrieb von neuen Wurzeln an der Wasserlinse möglich, die sich bei Rückgang des Wassers z.T. meterhoch über dem Boden befinden können (Luftwurzeln). Weiters weisen Weiden, aber auch Pappeln infolge der erhöhten Strahlenwirkung durch die Rückstrahlung der Wasseroberfläche eine äußerst rissige Borke, sowie an der Unterseite mancher Arten eine dichte Verfilzung (durch die eingeschlossene Luft silbrig glänzend) als Schutz vor übermäßiger Erhitzung und zu starker Verdunstung auf (sehr schön an der Silberweide Salix alba zu sehen) (vgl. REICHHOLF und STEINBACH, 1993, 149ff.). Die Krautschicht in der weichen Au ist wesentlich artenärmer, wobei der Schwerpunkt ihrer 7 Elisabeth Ofner, Klaus Tscherner: Pflanzen der Au Überlebensstrategie auf schnelle Wiederbesiedlung frei gewordener Flächen und rasche Bestandentwicklung abzielt (r-Strategen), was sehr schön am Beispiel der Brennessel Urtica sp. zu erkennen ist. Eine Strauchschicht ist oft wegen der langandauernden Überflutung nicht entwickelt. Die Pflanzen im Lebensraum Au besitzen zahlreiche Strategien um mit dem übermäßigen Wasserangebot und der oftmals daraus resultierenden Staunässe im Wurzelbereich umzugehen. Verbunden mit der Fülle an Nähr- und Mineralstoffen durch den Sedimenteintrag ergibt sich eine äußerst hohe Produktivität, da bei ausreichendem Wasser und Nährstoffangebot ein Höchstmaß an Energie in organischer Masse fixiert werden kann. Die Pflanzen reagieren somit auf eine umfassende Bewässerung und Düngung nicht mit Fäulnis und Überdüngung wie viele andere Pflanzen (vgl. mit Zimmerpflanzen), sondern mit schnellem Wachstum und Produktion, weshalb auch der Mensch zahlreiche Nutzpflanzen aus der Au kultiviert(e). beide erstmals die Gelegenheit mit Kindern im Freien zu arbeiten. Weiters würden wir die Klassen nur für dieses eine Mal betreuen, was zur Folge hatte, dass von unserer Seite her keine zwingende Leistungsbeurteilung in darauf folgenden Einheiten stattfinden würde, wodurch uns ein gewisser Freiraum zum Experimentieren gegeben wurde. Da dies auch den Druck der sonst in leistungsbezogenem Unterricht auf den Schülern lastet reduziert, Fachdidaktik Das Ziel unserer Aupflanzen-Station war, den SchülerInnen die Besonderheiten des Lebensraumes Au zu vermitteln. Eigentlich hatten wir hierfür zuerst ein wesentlich konventionelleres Konzept mit Arbeitsblättern und Protokollen geplant. Im Zuge der Vorbereitungen, entschieden wir uns allerdings für einen anderen Weg, da die Unterrichtssituation im Freiland für uns aus vielerlei Hinsicht eine Besonderheit darstellte: Zum einen bot sich für uns 8 Elisabeth Ofner, Klaus Tscherner: Pflanzen der Au entschlossen wir uns zu einem etwas experimentelleren Zugang bei dem wir bewusst auf jegliche für die Schüler auszufüllenden Arbeitsblätter verzichten wollten. Wir planten daher, den Schülern die Besonderheiten des Lebensraumes Auwald durch Erklärungen unsererseits theoretisch näher zu bringen sowie praktische Aktivitäten zu dem jeweils besprochenen Theoriepunkt durchzuführen. Da unsere Station nur von jeder zweiten SchülerIn nengruppe besucht wurde, konnten wir unsere Wartezeit dazu nutzen unseren Gruppen etwas entgegenzugehen und mit ihnen den Weg zu unserem Standort auf der Insel gemeinsam zu bestreiten. Um den Pioniercharakter dieser Insel zu verdeutlichen verwendeten wir eine provisorische Fahne aus einem Haselnussstrauch und einem Halstuch (begrenzte Ressourcen in Marchegg), die ein Schüler oder eine Schülerin zur Insel tragen und dort in den Sand stecken durfte. Weiters hatte der gemeinsame Weg den Vorteil, bereits vor unserer regulären Stationszeit eine Beziehung zu der Gruppe aufzubauen, nach dem Namen zu fragen (dessen Wissen sich als sehr nützlich erwies), den geographischen Gesichtspunkt etwas einfließen zu lassen (March als Grenzfluss zur Slowakei, Zugstrecke nach Bratislava) und sich bei den SchülerInnen nach ihrem Wissensstand über unsere Thematik zu erkundigen (Stichwort die SchülerInnenorientierung). Der Standort auf der Insel bot, mit seinem zum Teil sehr hoch stehenden Wasser in den Pfützen, die bis zum zweiten Tag vollständig austrockneten, viele Möglichkeiten die Anpassungen an die Gunst und Ungunstfaktoren der Pflanzen näherzubringen. Wir entschieden uns dabei den SchülerInnen Spatenstiche durchzuführen zu lassen, wobei sie die Erde selbst angreifen sollten, diese hinsichtlich Bewurzelung, Körnung und Feuchtigkeit beschreiben mussten und anschließend mit einem zweiten Spatenstich in der etwas höher gelegenen harten Au im Waldbereich abseits der Insel vergleichen konnten. Dies hatte den Zweck, die SchülerInnen gleich zu Beginn auf die Bedingungen denen Aupflanzen ausgesetzt sind aufmerksam zu machen und sie darauf hinzuweisen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Pflanzen mit den dabei auftretenden Probleme, wie Staunässe und Hochwasser umgehen können (Vergleich mit Zimmerpflanzen bzw. Pflanzen in den Gärten). Weiters wiesen wir die SchülerInnen auf die vielen Eigenschaften der Aupflanzen, wie Strömungsanpassung (Blattform der Weiden, Elastizität), weiches Holz, Strahlungsanpassung von Weidenblättern, sowie die Stecklingsvermehrung hin, wobei die SchülerInnen bei letzterem Punkt selbst Stecklinge der Weide schneiden und ihre „eigene“ Weide in der Au pflanzen durften, indem sie die Stecklinge ins Wasser der March warfen bzw. ihn vor Ort in den Boden steckten. An unserem zweiten Standort in der harten Au konnten noch einmal wesentliche Eigenschaften der Au bzw. die Unterscheide zwischen der harten und weichen Au, vor allem im Hintergrund der Spatenstiche, erarbeitet werden, bevor wir an unserem letzten Standort unter der Brücke die SchülerInnen eine Wachstumsmessung beim Hopfen durchführen lassen wollten. Da dieser aufgrund des hohen Nährstoffangebots mehrere cm pro Tag wächst, ließ sich ein Vergleich mit unseren Messungen vom Vortag leicht anstellen, wobei die Höhen zur besseren Verdeutlichung von den SchülerInnen mit einer Kreide (bzw. Ziegelstein) am Brückenpfeiler markiert wurden. 9 Elisabeth Ofner, Klaus Tscherner: Pflanzen der Au Zuletzt wollten wir noch das Pflanzengewebe einer typischen Aupflanze (Brennessel) und einem Gras vom Weg vergleichen, wobei die SchülerInnen auf den Weg zwischen den Standorten aufgefordert wurden, sowohl die Pflanzen vom Trockenstandort (Gras), als auch Brennsessel (Coolnessfaktor durch richtiges Angreifen der Pflanze) zu sammeln und mitzunehmen, um sie anschließend unter der Brücke vergleichen zu können. Die permanente Verfügbarkeit von Wasser bei der Brennnessel macht sich dabei unter anderem in der Stützfunktion der Pflanzen bemerkbar, die durch die Turgeszenz der Zellen übernommen wird, wodurch die Pflanze aufgrund ihrer sehr dünnen Zellwand und des fehlenden Wassers sehr schnell welkt. Abschließend begleiteten wir die Gruppe zur nächsten, wiederum etwas weiter entfernten Station, wobei wir auch hier den Weg nutzen konnten, die wesentlichen Punkte unsere Station zu wiederholen bzw. noch in Ruhe noch einige Fragen zu besprechen. Im Wesentlichen hat unser anfängliches Konzept recht gut funktioniert. Lediglich bei den ersten beiden Gruppen hatten wir aufgrund des doch etwas zu flexiblen Programms Schwierigkeiten, die Informationen strukturiert zu vermitteln. Zwar hatten wir uns vorab abgesprochen wer zu welchem Zeitpunkt welche Theoriepunkte bespricht, doch in der Praxis mussten wir feststellen, dass unser vorab lose abgesprochenes Gerüst doch noch zu unsicher war. Auch wichen wir aufgrund des für uns erfreulichen Interesses an der Hochwasserdynamik der SchülerInnen etwas zu weit von unserem eigentlichen Thema ab, wodurch weniger Zeit für die übrigen Programmpunkte blieb. Diese anfänglichen Unsicherheiten konnten wir mit der zweiten Gruppe bereits einigermaßen reduzieren, doch noch immer war das Hauptproblem die Unstrukturiertheit des Ablaufes, diesmal gepaart mit einer generell etwas aktiveren und unaufmerksamen Schülern, wobei wir bei dieser Gruppe bei einigen Punkten eine Zweiteilung der Gruppe durchführten, um die Aufmerksamkeit der Burschen zu erhöhen und individueller auf sie eingehen zu können. Ab der dritten Gruppe wussten wir bereits etwas besser abzuschätzen wie lange wir in etwa für die jeweiligen Programmpunkte veranschlagen mussten, wer welche Informationen vortragen sollte und wie wichtig es ist die SchülerInnen gleich vorab aufzufordern die Materialien, wie Spaten und Gartenschere, beiseite zu legen, weshalb sich ab diesem Zeitpunkt keine nennenswerten didaktischen Schwierigkeiten mehr ergaben. Zudem sollte noch 10 Elisabeth Ofner, Klaus Tscherner: Pflanzen der Au erwähnt werden, dass die SchülerInnen bis auf wenige Ausnahmen wirklich interessiert an unseren Aktivitäten teilgenommen haben und dem Konzept unserer Station generell positiv gege nüberstanden. Was uns insbesonders bei jenen Gruppen sehr positiv überraschte, die bereits zu Beginn bekräftigten wie „grausig“ die Biologie sei und wie blöd sie die Pflanzen fänden bzw. dass sie diese hassen würden und lieber gleich zu der Gruppe der Tierspuren gehen wollten. Besonders die praktischen Aktivitäten, wie die Spatenstiche und die Stecklinge, aber auch interessante Theoriepunkte wie etwa die Lentizellen der Weiden oder die Staunässe die die Pflanzen erdulden, wurden von ihnen gut angenommen. Auch wenn die Flexibilität unseres Programmes es für uns zum Teil etwas schwierig machte alle Punkte im Kopf zu behalten und nichts Wesentliches auszulassen, hatte es den entscheidenden Vorteil individuell auf die Interessen der SchülerInnen eingehen zu können und sie von ihren Erzählungen am Weg zur Insel und von ihrem Wissen ausgehend zu unserer Thematik hinzuführen. Unsere Lehrziele waren, den SchülerInnen die ökologischen Besonderheiten der Botanik des March-Auwaldes zu vermitteln, ihnen dabei einige für den Standort typische Pflanzenarten vorzustellen sowie eine Verbindung zwischen der Verwendung und dem natürlichem Vorkommen ihnen bereits bekannter Nutzpflanzen zu schaffen. Diese Ziele wollten wir durch theoretische Erklärungen unsererseits sowie oben beschriebene Eigenaktivitäten auf Seiten der Schüler erreichen. Zurückblickend können wir feststellen, dass wir diese Ziele bei vier der sechs von uns betreuten Gruppen sicher erreichen konnten. Lediglich bei den ersten beiden Gruppen war unser Konzept noch unausgewogen und das Lehrziel für die SchülerInnen wohl nicht deutlich erkennbar. Als Orientierung dienten uns hauptsächlich gezielte Rückfragen die wir während des Unterrichtens an die Schüler stellten sowie das Feedback das wir während (Anmerkung an die Redaktion: hier sind wir allerdings etwas vernachlässigt worden ;-) ) oder nach dem Stationenbetrieb von den Verantwortlichen mitgeteilt bekamen. Abschließend können wir ehrlich behaupten viel dazugelernt zu haben und wenn auch nicht alles „perfekt“ oder einwandfrei gelaufen ist, so müssen sie doch zugeben, dass wir sicherlich am besten Weg sind gute Lehrkräfte zu werden ;-). Literatur: FINK, M. (1999): Zur Geographie des unteren March-ThayaGebietes. In: Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen. Umweltbundesamt, Wien: 15-24. LAZOWSKI, W. (1999): Auwald. In: Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen. Umweltbundesamt, Wien: 129-153. REICHHOLF, J. und STEINBACH, G. (1993). Die große Bertelsmann Lexikothek – Naturenzyklopädie der Welt Band 12 Lebensräume, Naturlandschaften, Ökologie. Mosaik Verlag TURIC, K. und PANY, P. (2007): Die Pflanzen der Au – einige didaktische Vorschläge. Verfügbar in: http://aeccbio.univie.ac.at/ fileadmin/user_upload/kompetenzzentrum_aeccb/Symposium/Abstr actvolume_outdoortag.pdf [30.5.2009] 11 Elisabeth Ofner, Klaus Tscherner: Pflanzen der Au ZULKA, K, P. und LAZOWSKI, W. (1999): Hydrologie. In: Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen. Umweltbundesamt, Wien: 24-51. ZUNA-KRATKY, T. (1999): Übersicht über die Lebensräume. In: Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen. Umweltbundesamt, Wien: 103-109. 12 Blütenökologie Denken wie ein Insekt 1. Welche unterschiedlichen Blüten gibt es? 2. Welche unterschiedlichen Bestäuber gibt es? 3. WARUM gibt es diese? von Timothy Padayhag & Peter Lampert Theoretische Vorbereitung Am Beginn der Auseinandersetzung mit dem Thema „Blütenökologie“ stellt sich die grundlegende Frage, was darunter genau zu verstehen ist. Wie der Begriff „Ökologie“ bereits verrät, geht es nicht allein um Blüten und ihren Aufbau, sondern viel mehr um das Zusammenspiel von Blüten mit ihren Bestäubern. Dabei bezeichnet Bestäubung (=Pollination) die Übertragung des Pollens auf die Narbe. Da etwa 80% der heimischen Blütenpflanzen tierbestäubt sind, und nur bei etwa 20% die Bestäubung durch Wind erfolgt, gingen wir vor allem auf die Tierbestäubung ein. Bei der Vorbereitung stellten sich uns folgende drei Fragen, denen wir nachgehen wollten: Im Folgenden wollen zusammenfassen. wir unsere „Antwortversuche“ kurz 1. Welche unterschiedlichen Blüten gibt es? Bei einem Blick auf eine Blumenwiese oder bei der Betrachtung blühender Bäume, fällt einem sofort das Spektrum der verschiedenen Farben und Formen der Blumen bzw. Blüten auf. In unseren Breitengraden überwiegen die Farben gelb, blau, weiß, sowie die unterschiedlichsten lila – violett Töne. Überlegt man sich, welche Funktion Blüten haben, lässt sich das Rätsel der Farbenvielfalt leicht lösen. Die bunten Blüten tierbestäubter Arten dienen der Anlockung potentieller Bestäuber. In Europa sind dies fast ausschließlich Insekten (Siehe Frage 2) Da die Insekten vor allem auf optische Reize reagieren, heben sich auffällig gefärbte Blüten besonders gut vom grünen Hintergrund (der für Insekten gräulich wirkt) ab. Deshalb sind Farben und Musterungen, die von Insekten gut wahrgenommen werden können (gelb, lila, UV-Muster) besonders häufig, während hingegen reines Rot, das von den Insekten nicht gesehen werden kann, nur äußerst selten bei unseren Blüten vorkommt. Eine Ausnahme stellt hier etwa der Mohn dar, der allerdings ein für uns unsichtbares UV-Muster besitzt, welches die Insekten anzieht. In den Tropen gibt es hingegen auch vielfach rote 13 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Blüten, da auch Vögel (z.B. Kolibris) oder Fledermäuse als Bestäuber dienen. Neben der Farbe verstärken oft charakteristische Düfte die Anlockungsfunktion. So sollen süßliche („blumige“) Düfte Schmetterlinge, Bienen und Hummeln anlocken. Andererseits gibt es wiederum Blüten, die einen Aasgeruch besitzen um so Fliegen anzuziehen, welche die Bestäubung vornehmen. Zudem kommen besonders auf die unterschiedlichen Blüten- bzw. Blumenformen eine für die Bestäubung entscheidende Bedeutung zu (siehe Fragen 2 & 3). Im Alltagsgebrauch werden die Begriffe „Blüte“ und „Blume“ häufig synonym verwendet. Da diese Begriffe im Folgenden häufig vorkommen, wollen wir nochmals den Unterschied erwähnen. Genau genommen handelt es sich bei einer Blüte um einen Kurzspross dessen Blätter der Bestäubung dienen, während der Begriff Blume die gesamte Bestäubungseinheit bezeichnet. So können mehrere Blüten eine Blume bilden, man spricht dann von einem so genannten Pseudanthium (siehe z.B. Asteraceae) Um einen Überblick über die diversen Blumenformen zu bekommen, wählten wir folgende, stark vereinfachte Einteilung, die sich auch im Aufbau unserer Station widerspiegelte (siehe Didaktische Reduktion) Einige wichtige Blumenformen: ¬ Scheibenförmig o Einfacher Aufbau (ähnlich zum Blütengrundbauplan) o Nektar bzw. Pollen leicht zugänglich o Können von verschiedenen Bestäubern genutzt werden ¬ Korbförmig (bei Familie der Asteraceae = Korbblütler) o Viele Blüten sind in einem Korb zusammengefasst und bilden eine „Blume“ o Durch den Korb wird die Schauwirkung vergrößert o Viele Samen pro Blume o Landeplatz für Insekten o Ebenfalls von verschiedenen Bestäubern nutzbar ¬ Röhrenförmig o Kronblätter zu Röhre verwachsen o Nektar meist am Grund, mit Rüssel zugänglich (Schmetterlinge, Hummeln, Bienen,...) Neben diesen bei unserer Station vorgestellten Blütenformen, gibt es verschiedenste weitere Formen. Besonders Orchideen zeigen zum Teil sehr komplexe Anpassungen an ihre Bestäuber und weisen sehr spezialisierte Bestäubungsmechanismen auf. Die Formenvielfalt ist geprägt durch die gegenseitige Anpassung gemeinsam mit den jeweiligen Bestäubern (Co-Evolution, siehe unten) Wie oben bereits erwähnt, lag unser Fokus auf den tierbestäubten Arten und ihren Bestäubungsmechanismen. Obligat windbestäubte Arten besitzen keine auffälligen Schauorgane, da sie keine Insekten anlocken müssen. 2. Welche unterschiedlichen Bestäuber gibt es? In unseren Breitengraden wird die Pollination nahezu ausschließlich von Insekten übernommen. In den Tropen gibt es auch Vögel und Fledermäuse, die als Bestäuber fungieren. 14 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Doch nicht alle Insekten tragen in gleichem Maße zur Bestäubung bei. Die wichtigsten Ordnungen hierbei sind die der Hautflügler (Hymenoptera), Zweiflügler (Diptera), Käfer (Coleoptera) und der Schmetterlinge (Lepidoptera). Im Folgenden wollen wir ein paar interessante Fakten und Details zu diesen Ordnungen zusammenfassen: ¬ Hymenoptera = Hautflügler (Bienen, Hummeln,...) (Anteil an Gesamtbestäubung: ca. 47%) o Wichtigste Bestäubergruppe (v.a. Honigbiene) o Oft Staatenbildend (Honigbiene bis zu 50000 Individuen pro Volk) o Mundwerkzeuge mit rel. kurzem Rüssel (bei Bienen kürzer als bei Hummeln) und können sowohl Pollen als auch Nektar verarbeiten o Dichtes „Haarkleid“ – Pollen bleibt hängen o Sowohl Larven als auch erwachsene Tiere ernähren sich von Nektar/Pollen o Honigbienen sammeln Wintervorrat, da das Volk überwintert o Nahezu vollständige Blütenstetigkeit bei Bienen, d. h. sie fliegen nicht von einer Art zu einer Anderen, sondern bleiben einer Art treu, dadurch kommt es zu einer „zielgerichteten“ Bestäubung. Bei Hummeln beträgt die Blütenstetigkeit immer noch hohe 50 – 60 Prozent. Neben verschiedenen Wildbienen, von denen es in Europa über 500 Arten gibt, nehmen besonders Hummeln und die Honigbiene (als wichtigster Bestäuber) eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung ein. Wildbienen sind häufig auf wenige Pflanzenarten spezialisiert, wohingegen Hummeln und Honigbienen ein breites Spektrum an Blüten besuchen. Hummeln zeichnen sich aus durch eine geringere Temperaturempfindlichkeit und eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Da Hummeln aber nur kleinere Sommerstaaten bilden, muss kein Vorrat für den Winter angesammelt werden. Dies ist auch der Hauptgrund, warum die Honigbiene eine so entscheidende Rolle einnimmt. Da ein großer Teil des Bienenstaates überwintert, müssen die Arbeiterinnen einen großen Wintervorrat anlegen. Was das bedeutet wird augenscheinlich, wenn man bedenkt, dass ein durchschnittliches Honigbienenvolk jährlich etwa 50 kg produziert, und um ein Kilo Honig zu produzieren etwa 7,5 Millionen Rapsblüten besucht werden müssen. Andere Hautflügler wie Wespen oder Hornissen sind als Bestäuber weniger bedeutend, da sie sich und die eigene Brut vor allem von anderem tierischem Material, wie Insekten ernähren, und der Nektar nur als „Treibstoff“ für längere Flüge dient. Aufgrund der weniger dichten „Behaarung“ sind sie für die Bestäubung nur bedingt geeignet. ¬ Diptera = Zweiflügler (Schwebefliegen, Wollschweber,...) (ca. 26%) o Imitieren Bienen (Schwebefliegen) bzw. Hummeln (Wollschweber) zur Abschreckung von Fressfeinden (Mimikry), besitzen aber keinen Stachel o Erkennbar am schwebenden Flug und plötzlichen ruckartigen Vorstößen 15 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt o Längere Rüssel als Hautflügler o Sammeln keine Vorräte, da sie nicht überwintern o Nur erwachsene Tiere nutzen Blüten als Nahrungsquelle Die geringere Bedeutung für die Bestäubung liegt vor allem daran, dass keine Staaten überwintern. Außerdem wird im Gegensatz etwa zur Honigbiene, die Brut nicht mit Pollen bzw. Nektar versorgt, da die Larven parasitisch leben. Blütenökologisch interessant ist, dass sie nicht unbedingt einen Landeplatz benötigen, sondern auch freischwebend Nektar bzw. Pollen sammeln können. ¬ Coleoptera = Käfer (ca. 15%) o Artenreichste Insektenordnung, dennoch weniger bedeutend als Bestäuber o Mundwerkzeuge sehr ursprünglich – kaum an Blüten angepasst o Häufig werden Blüten „verwüstet“ – zerbissen um an Nektar bzw. Pollen zu gelangen o Kein „Haarkleid“, d. h. Pollen kann nicht gut transportiert werden o Können nur leicht zugängliche Blüten nutzen o Brauchen Blüten, die Möglichkeit zum Festhalten bieten (z.B. Korbblütler) Obwohl Käfer vermutlich die ältesten Blütengäste darstellen, sind sie trotz ihrer extrem hohen Artenzahl (ca. 8000 Arten in Europa) für die Bestäubung weniger bedeutend. Es lassen sich kaum Anpassungen an die Nutzung von Blüten erkennen, da sich die Käfer nur selten ausschließlich von den Blütenprodukten ernähren. Da ihnen ein Saugrüssel fehlt, nutzen sie entweder leicht zugängliche Blüten oder agieren als „Nektardiebe“. Das bedeutet, dass sie beispielsweise tiefe Röhrenblüten, die eigentlich nicht genutzt werden können, einfach zerstören (Aufbeißen der Röhre) um an den Nektar zu gelangen. Durch den „Diebstahl“ erfolgt jedoch keine Bestäubung. ¬ Lepidoptera = Schmetterlinge (tag- und nachtaktive Falter) (ca. 10%) o Am stärksten spezialisiert auf den Blütenbesuch o Langer, einrollbarer Saugrüssel o Können auch tiefe Nektarblüten nutzen o Ausschließlich Nektar wird genützt, da keine beißenden Werkzeuge für Pollenverarbeitung vorhanden sind o Pollen kann am Saugrüssel oder am übrigen Körper haften bleiben Bei Schmetterlingen und den von ihnen besuchten Blüten lassen sich die stärksten wechselseitigen Anpassungen beobachten. So gibt es Blüten mit langen Röhren, welche ausschließlich von bestimmten 16 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Schmetterlingsarten mit langem Rüssel genutzt werden können. Dass durch die fehlenden Beißwerkzeuge nur der Nektar genutzt werden kann, stellt für die Pflanzen einen großen Vorteil dar, worauf wir bei der folgenden Frage noch genauer eingehen. 3. Warum gibt es die Vielfalt an Blüten und Bestäubern? Um diese Frage zu beantworten betrachten wir zum Einstieg, welchen Nutzen die beiden „Parteien“ aus dem ökologischen Zusammenspiel ziehen. Vorteile für die Pflanze: Aufgrund des deutlich höheren Anteils an tierbestäubten Arten, muss diese Bestäubungsform einen klaren Vorteil gegenüber der Windbestäubung haben! Durch Entwicklung von auffälligen Schauorganen, Angebot von Nektar bzw. Pollen als Futter für die Bestäuber, kann Bestäubung zielgerichteter erfolgen als durch Verbreitung durch den Wind (Pollen landet zufällig). Um eine zielgerichtete Übertragung des Pollens auf eine Narbe derselben Art zu fördern, muss eine Blütenstetigkeit der Bestäuber erreicht werden. Ist ein Insekt von einer Blüte „überzeugt“, so bleibt es dieser treu und besucht mehrere Blüten dieser Art, dadurch wird der Pollen wahrscheinlicher auf die richtige Narbe übertragen. Aus diesen Gründen „lohnt“ es sich für die Pflanze Energie in auffällige Schauorgane, die Produktion von Nektar, etc. zu investieren. Vorteile für den Bestäuber: Der Bestäuber profitiert von der energiereichen Nahrung, die die Pflanzen in Form von Nektar bzw. Pollen anbieten. Ein Punkt, der häufig falsch gedeutet wird, betrifft die Beweggründe der Bestäuber. Sie sind prinzipiell nicht an der Bestäubung interessiert und erledigen diesen Dienst nicht aus sozialen Hilfsgründen. Sie kommen nur aufgrund des Nahrungsangebots! Die Bestäubung passiert sozusagen nebenbei. Für den Bestäuber gilt es, den Blütenbesuch und somit die Aufnahme des Pollens bzw. Nektars möglichst effizient zu gestalten. Die Form der Mundwerkzeuge, Sinnesorgane, Uhrzeiten des Ausfliegens und verschiedenste Spezialisierungen tragen hierzu bei. Gegenseitige Anpassung – Co-Evoulution: Nach dem grundlegenden Prinzip der Evolution, werden besser angepasste Individuen (sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren) wahrscheinlich mehr Nachkommen hinterlassen. In Folge werden die gut Angepassten im Laufe der Zeit häufiger. Bei dem Zusammenspiel von Blüten und ihren Bestäubern lässt sich das äußerst gut beobachten. Insekten, die Blüten effizient nutzen können werden erfolgreicher sein als welche, die viel Energie benötigen um an den Pollen/Nektar zu kommen. Das Wirken der Selektion wird bei bestäubenden Insekten besonders in folgenden Punkten sichtbar: ¬ Anpassungen der Mundwerkzeuge – führt zu effizienterer Nutzung des Pollens bzw. Nektars; zum Teil äußerst spezialisiert ¬ „Haarkleid“ – Durch die Ausstülpungen der Cuticula bleibt der Pollen besser haften ¬ Verbesserungen der Sinnesorgane – Potentielle Nahrungsquellen können leichter erkannt und gefunden bzw. von „schlechteren“ Blüten unterschieden werden 17 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt ¬ Uhrzeiten des Ausfliegens – Insekten (bes. Honigbienen) besuchen verschiedene Blüten bevorzugt zu Zeiten der stärksten Pollen- bzw. Nektarproduktion ¬ Blütenstetigkeit – Die Nutzung einer Blüte ist mit einem Lernaufwand verbunden (Wie gelange ich zum Pollen / Nektar etc.) Deshalb wäre es ineffizient, ständig eine andere Art zu besuchen und den Mechanismus neu zu erlernen. Durch häufigen Besuch der selben Art wird die Effizienz erhöht Umgekehrt gelingt die Bestäubung für eine Blume leichter, wenn die Bestäuber regelmäßig zu Besuch kommen. Hier werden ebenfalls diejenigen erfolgreicher sein, die eine gewisse Energie investieren um die Insekten anzulocken bzw. zu füttern und sich an die Bestäuber anpassen. Die Evolution lässt sich in folgenden Bereichen am deutlichsten erkennen: ¬ Nektarblüten: Die ursprüngliche Form ist die reine Pollenblüte. Da Pollen für die Pflanze sehr kostbar ist (hoher Gehalt an Eiweiß; Geschlechtszellen) ist es ein Selektionsvorteil, ein verhältnismäßig „günstiges“ Ersatzfutter in Form von Nektar zur Verfügung zu stellen (gibt hier auch viele Ausnahmen z.B. Orchideen) ¬ Spezialisierte Blütenformen: Nur bestimmte Insekten sind in der Lage an die Nahrung zu gelangen und führen zu einer gerichteten Übertragung des Pollens. ¬ Komplexe Bestäubungsmechanismen – z. B. Hebelmechanismen (siehe unten Wiesensalbei) oder Nachahmung weiblicher Insekten um Männchen zur „Kopulation“ zu verführen. Effizienz der Pollination wird dadurch gesteigert. ¬ Erhöhung der Schauwirkung: Durch besonders auffällige Farben, Muster oder Vereinigung von mehreren kleinen Einzelblüten zu einem Pseudanthium (z.B. Asteraceae) 18 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Die angeführten Beispiele stellen nur einen kleinen Teil der Anpassungen dar und unterscheiden sich in ihrer Ausprägung von Art zu Art. So gibt es sowohl bei Pflanzen, als auch bei den Bestäubern neben einigen hoch spezialisierten Arten auch relativ ursprüngliche. Diese Anpassungen stellen eine ständige Gratwanderung zwischen sinnvoller Energieinvestition und „Vergeudung“ kostbarer Ressourcen dar. Für dieses Problem gibt es in der Natur eine Unzahl an völlig differenten Lösungen, wie der Blick auf eine Blumenwiese zeigt. Didaktische Reduktion oder „Ein Männerbastelnachmittag auf dem Balkon“ Nach der inhaltlichen Vorbereitung stellte sich die Frage, wie wir unsere Lehrziele an die Schüler vermitteln sollten und die Schüler dazu bringen könnten, wie ein Insekt zu denken. Da unser „Zielpublikum“ eine 1. und eine 2. Klasse Unterstufe war, versuchten wir das Thema so kindgerecht wie möglich aufzuarbeiten. Unsere Lehrziele waren: ¬ „Denken wie ein Insekt“ ¬ Blütenvielfalt erkennen und verstehen ¬ Kennenlernen der wichtigsten Bestäuber Um diese Ziele zu erreichen, legten wir ein grobes Schema über den Ablauf der Station fest. Als Einstieg wollten wir eine kurze Wiederholungseinheit mit den Schülern machen. Dabei sollten grundlegende Begriffe, wie etwa Bestäubung, Befruchtung etc. wiederholt und der Grundbauplan einer Zwitterblüte besprochen werden. Dieser Punkt sollte dazu dienen, dass sich die Schüler in Erinnerung rufen, wie die Bestäubung abläuft, woher der Pollen kommt, wo dieser landet etc. Damit dieser eher theoretische Einstieg trotzdem für die Schüler interessant gestaltet werden kann, entschlossen wir uns, künstlerisch aktiv zu werden und ein Plakat zu erstellen. Zu diesem Zweck fanden wir uns zu einem Bastelnachmittag auf dem Balkon zusammen und entwarfen ein Plakat, auf welchem das Grundschema einer Zwitterblüte aufgezeichnet war. Zudem fertigten wir laminierte Kärtchen mit blütenmorphologischen Begriffen, wie etwa Kronblatt, Staubblatt, u. ä. an. Außerdem erstellten wir Kärtchen, auf welchen die Funktionen der Organe festgehalten waren (z.B. Schaufunktion – Anlockung von Insekten usw.) Die Idee dahinter war, dass die Schüler zu den einzelnen Blütenorganen die richtigen Kärtchen zuordnen und vor allem die entsprechenden Funktionen verstehen. Nach diesem Wiederholungsteil wollten wir den Schülern die Vielfalt an verschiedenen Blütentypen und Bestäubern zeigen, und den Schülern das Prinzip der Bestäubung verständlich machen. Hier stellte sich die Frage, wie wir dieses interessante Thema (was mein Stationskollege zu diesem Zeitpunkt noch anders sah) den Schülern auch spannend vermitteln können. Das Analysieren von echten Blüten erschien uns zu diesem frühen Zeitpunkt als nicht geeignet, 19 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt da die Analyse der relativ kleinen Blüten für die Schüler eine Schwierigkeit darstellt. Organe, wie etwa Staubblatt, Narbe etc. sind nur schlecht sichtbar und bei der Arbeit mit dem Binokular kann sich niemals die gesamte Gruppe aktiv beteiligen. Wir erkannten also, dass dieser Weg eher zu einer Frustration oder zumindest zu einer furchtbaren Langeweile seitens der Schüler führt. Da Schüler allgemein weniger begeistert sind von Pflanzen, wollten wir einen aktiveren, frecheren Zugang wählen, durch welchen die Schüler das Thema Bestäubung selbst erfahren. Da Peter bereits gute Erfahrungen mit einem Korbblütenmodell gemacht hatte, kam uns der Gedanke mehrere Blütenmodelle herzustellen. Anhand dieser bunten Kartonmodelle wollten wir die in natura schwer sichtbaren Unterschiede im Blütenbau und unterschiedliche Bestäubungsmechanismen illustrieren. Die Schüler sollten dann selber als Insekten (Schmetterling, Biene, Hummel, Käfer) aktiv werden und so die Bestäubung hautnah erleben. Die Idee war geboren, so schritten wir zur praktischen Umsetzung unserer kreativen Pläne. Wir setzten unseren Bastelnachmittag fort und begannen vier verschiedene Typen von Blüten bzw. Blumen zu basteln. Neben dem bereits vorhandenen Korbblütler fertigten wir kleine, einfache Scheibenblumen, sowie Röhrenblumen mit unterschiedlich langen Röhren an. Zudem kreierten wir noch eine relativ komplexe Salbeiblüte mit Hebelmechanismus. Die Scheibenblüten fertigten wir aus Flaschendeckeln und buntem Papier für die Kronblätter. Für die Röhrenblüten verwendeten wir Pappbecher in unterschiedlichen Größen (die uns von einer amerikanischen Fastfoodkette für den Spottpreis von 50 Cent zur Verfügung gestellt wurden) und wiederum buntes Papier für die Kronblätter. Am Becherrand befestigten wir Strohhalme an deren Spitzen wir jeweils einen Wattebausch klebten. Die Intention war, in diese „Röhrenblüten“ etwas Saft einzufüllen und die „Insekten“ sollten versuchen diesen „Nektar“ herauszubekommen. Hierzu schnitten wir Strohhalme unterschiedlich lang zu, damit jedes Insekt einen entsprechend langen (Schmetterlinge) bzw. kurzen (Bienen bzw. Hummeln) Rüssel bekommt. Die Wattebäusche wollten wir mit Curry-Pulver (=Pollen) bestreuen, damit beim Versuch des Nektarholens der Pollen im Gesicht der Kinder bleibt. Unser „Korbblüttler“ bestand aus einem Brotkorb und vielen kleineren Einzelblüten aus Papier, die darin befestigt waren, um den „Korb voller Blüten“ leibhaftig zu präsentieren. Im Korb verstreut lag der Pollen bzw. der Nektar in Form von Bonbons vor. 20 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Mit dem Modell der Salbeiblüte stellten wir den Hebelmechanismus, der bei der Bestäubung des Wiesensalbeis auftritt, nach. Beim Versuch an das Zuckerl im Sporn zu gelangen, betätigten die Insekten einen Hebelmechanismus und der Handrücken wurde durch den herabkommenden Wattebausch mit Pollen versehen. Mit diesem Modell wollten wir exemplarisch zeigen, welch komplexe und interessante Bestäubungsmechanismen es gibt. Die Gesamtintention hinter diesen Modellen war, kleine Blüten im großen Stil greifbar zu machen. Um den Ablauf der Bestäubung zu verstehen, wollten wir die Schüler selber in die Rolle eines Insekts schlüpfen lassen. Wie richtige Insekten sollten sie beim Aufsuchen der Nahrung in Form von Pollen bzw. Nektar, die Bestäubung nebenbei ausführen. Außerdem wollten wir zeigen, dass verschiedene Blüten nur von bestimmten Blütengästen erfolgreich besucht werden können. So sollte nur der Schmetterling mit dem langen Rüssel an den „Nektar“ am Grunde der großen Röhrenblüte gelangen, während beim Korbblütler hingegen alle Insekten erwünscht sind. Der Vergleich der Modelle sollte auch die erhöhte Schauwirkung des Pseudanthiums im Falle des Korbblütlers demonstrieren. Die Einteilung der Kinder in verschiedene Insekten, dient zudem dazu, den Schülern die Charakteristika dieser Insekten vorzuführen (Mundwerkzeuge etc) Die „echten“ Mundwerkzeuge wollten wir anhand von Schautafeln vorführen, was sich allerdings vor Ort anders ergeben hat (siehe Arbeit vor Ort) Nach dem Kennenlernen der unterschiedlichen Blütenund Bestäubungsformen, sowie der Bestäuber, planten wir, die Kinder selbst Blüten untersuchen zu lassen. Wir wollten die Schüler weiterhin in ihrer Insektenrolle belassen, damit sie sich (als denkende Insekten) auf die Suche nach Blüten machen. Uns war jedoch wichtig, dass ihre Eigenaktivität geleitet stattfindet. Deshalb erstellten wir ein kurzes Arbeitsblatt, welches die Kinder dazu anhalten sollte, die ausgesuchte Blume bzw. Blüte genau zu betrachten und sich über mögliche Formen der Bestäubung Gedanken zu machen (siehe ANHANG) 21 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Nachdem wir unser didaktisches Konzept so grundlegend fertiggestellt hatten, stand der Fahrt nach Marchegg nichts mehr im Wege. „Arbeit vor Ort“ oder „Die Jagd nach dem Zitronenfalter“ Kurz nach unserer Ankunft haben wir mit der gesamten Marchegggruppe einen kleinen Rundgang gemacht, um unsere nähere Umgebung besser kennen zu lernen. Wir merkten uns gleich die einzelnen Standorte der blühenden Pflanzen, damit wir sie auch später wiederfinden und genauer betrachten konnten.Schließlich mussten wir unsere Blütenstation an einem Platz aufbauen, wo auch Blüten vorzufinden sind. Nach der Gruppentour haben wir Blütenökologen uns selbstständig gemacht und weiter nach Pflanzen gesucht, die eigentlich zu der Jahreszeit blühen sollten. Dabei fanden wir den perfekten Ort, wo wir unsere Station aufbauen konnten. In einem kleinen Radius um einen Brückenpfeiler waren viele unterschiedliche Blütenpflanzen zu finden, die auch gut zu unseren vorbereiteten Blütenmodellen passten. Darunter waren ¬ Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.): Passte als auffälliger und bekannter Vertreter der Asteraceae gut zu unserem Korbblütlermodell ¬ Vogelmiere (Stellaria media): kleine, weiße Blüten – wir planten damit, die erhöhte Schauwirkung des Pseudanthiums im Vergleich zu dieser unauffälligen „Scheibenblume“ hervorzuheben ¬ Schlehdorn (Prunus spinosa) – als Beispiel für eine „einfache“ und dem Grundbauplan ähnliche Blüte ¬ Taubnessel (Lamium sp.) – typisches Beispiel für eine tiefröhrige Blüte, die nur für langrüsslige Blütengäste geeignet ist. Blütenaufbau sehr ähnlich zum Salbeimodell (ohne Hebelmechanismus) ¬ Gundelrebe (Glechoma hederacea) – weitere Lamiaceae, die besonders aufrgrund ihrer Saftmale erwähnenswert ist Den Pfeiler selbst konnten wir dazu verwenden um unser Plakat daran zu befestigen. Das Einzige was uns für die Station noch fehlte, war ein Tisch auf den wir unsere Modelle stellen können. 22 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Nachdem wir uns auf einen Standort geeinigt hatten, mussten wir noch die laminierten Kärtchen ausschneiden, die die Schüler auf das Blütenplakat kleben sollten. Danach hatten wir fast den ganzen Nachmittag vor uns, aber nichts mehr vorzubereiten. Also gingen wir unseren Ablauf noch drei Mal durch, doch auch das war schnell getan. Weitere Versuche uns produktiv zu beschäftigen scheiterten kläglich. Wir beobachteten die anderen Gruppen dabei, wie sie Jagd auf ihre Tiere waren, und schließlich kam der Aufschrei: „Geh’ ma keschern!“ Der didaktische Aspekt lag zu dem Zeitpunkt noch im Hintergrund, der Spaßfaktor überwog klar. Wir schnappten uns also die Schmetterlingskescher und ließen uns von Peter Pany in die altehrwürdige Kunst des Schmetterlingsfangs unterweisen. Dabei begnügten wir uns nicht nur mit Schmetterlingen, sondern fingen außerdem andere Blütengäste wie Solitärbienen, Hummeln, Käfer oder Wollschweber. Auch konnten wir eine Hornissenkönigin einfangen, die zu der Jahreszeit zahlreich unterwegs waren, und auch geschickt in die kommenden Vorträge einbauen. Wir verbrachten den restlichen Nachmittag also damit, diverse Insekten zu fangen und wurden immer ehrgeiziger und wollten unbedingt diie bekanntesten (und für uns am schwersten einzufangen) Falter, nämlich das Tagpfauenauge und den Zitronenfalter, erwischen. Wir waren nach einer Weile schon so angespannt, dass wir bei der bloßen Erwähnung eines Zitronenfalters heftig um uns blickten, um sie unserer Sammlung hinzuzufügen. Deswegen verbrachten wir den zweiten Tag ebenfalls damit, unsere Kollektion zu vervollständigen und auch zu bestimmen. Denn wir hatten eigentlich nicht geplant, so vertiefend auf die einzelnen 23 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Blütengäste einzugehen, sondern nur anhand von Bildern wenige Beispiele vorzustellen. Doch mit den vielen eingefangenen Insekten war es uns möglich, die Vielfalt der Bestäuber besser zu veranschaulichen. Am dritten Tag begannen wir mit dem Stationsaufbau. Leider sind uns die anderen dabei zuvorgekommen und wir konnten keinen Tisch mehr ergattern. Darum mussten wir uns mit einer Bank begnügen, um darauf unsere Modelle zu befestigen. Im Nachhinein war es Glück im Unglück, denn wir konnten die Bank mühelos je nach Wetterbedingung verstellen und die Modelle waren auch vor dem starken Wind einigermaßen sicher. Unsere gefangenen Insekten gaben wir in Becherlupen, damit die Schüler sie auch in die Hand nehmen und unter dem Vergrößerungsglas beobachten konnten. Wir durften nur die Hälfte der Schülergruppen an unserer Station begrüßen, da wir uns vorher kollektiv dazu entschlossen hatten, dass nur die Highlights (Amphipien, Reptilien, Urzeitkrebse) von allen Gruppen besucht werden sollten. Einerseits war es natürlich schade, andererseits erlaubte es uns eine kurze Verschnaufpause einzulegen und unsere Fehler auszubessern und unsere Station wieder aufzubauen (Plakat herrichten; Blütenmodelle,...) Den exakten Stationsablauf hatten wir im Vorhinein nur grob geplant um flexibel zu bleiben und Platz für Spontaneität zu lassen. Wir haben stets mit dem Plakat und den Namenskärtchen angefangen, um einen kurzen Überblick über das Vorwissen der Schüler zu erhalten, und sie dann nach den häufigsten Bestäubern gefragt. Hier konnten wir ihnen dann unsere Kollektion an Blütengästen präsentieren und auch gleich aufklären, wieso Wespen (und Hornissen) nicht gut als Bestäuber geeignet sind. Sie konnten auch die tote Hummel und die eingegangene Hornissenkönigin in die Hand nehmen, um das Haarkleid spüren zu können. Es wurden auch die unterschiedlichen Mundwerkzeuge diskutiert, die wir dann anhand der Blütenmodelle veranschaulichen konnten. Anschließend gingen wir zu unseren Blütenmodellen (siehe didaktische Reduktion) über. Hierzu teilten wir die Schüler in die verschiedenen Insektenrollen ein (Schmetterling, Biene, Hummel, Käfer), die dann auch die jeweiligen „Mundwerkzeuge“ erhielten. Die meisten Kinder meldeten sich freudig bei der Rollenverteilung, da sie unbedingt die Modelle ausprobieren wollten. Eine Mädchengruppe war allerdings äußerst zurückhaltend und so mussten wir eine unfreiwillig Freiwillige zum Schmetterling küren und auch die anderen Insekten waren schnell eingeteilt. Lustigerweise wollte bei einer Gruppe die Begleitlehrerin selber den Schmetterling mimen, was die Absicht unseres didaktischen Konzeptes nicht ganz traf. (Funktionsweise der Blütenmodelle siehe didaktische Reduktion) Nach den Modellen kam der Auftrag, als „denkendes Insekt“ blühende Pflanzen ausfindig zu machen, den ausgegebenen Arbeitszettel (siehe ANHANG) auszufüllen und dann die gefundene Pflanze den anderen „Insekten“ vorzustellen. Leider konnte die gegenseitige Vorstellung aufgrund des knappen Zeitfensters nicht in dieser Form durchgeführt werden. Bei der Eigenarbeit hätten wir uns etwas stärker zurücknehmen sollen, worauf wir leider erst nach der vorletzten Gruppe hingewiesen wurden. Bei der letzten Gruppe 24 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt (die auch mehr Zeit zur Verfügung hatte) klappte die Blütensuche bestens. Interessanterweise wählten die Schüler fast ausschließlich den Löwenzahn oder die Taubnessel. Nur ein Junge wagte sich an die Gundelrebe als Untersuchungsobjekt. Man kann den „denkenden Insekten“ hier aber keinerlei Vorwürfe machen, wer kann einem Pseudanthium, wie dem des Löwenzahns, schon widerstehen. Gesamtreflexion: Es war eine interessante Erfahrung einen Themenbereich theoretisch zu erforschen, für Kinder aufzuarbeiten und abschließend die Station mit den Schülern durchzuführen. Eine besondere Herausforderung war es dabei ein eher „fades“ Thema (aus Sicht der Schüler und auch meines Stationskollegen) so zu gestalten, dass die Schüler trotzdem Spaß daran haben und die Inhalte gerne aufnehmen. Dass die Kinder Insekten spielen durften und anhand der Modelle die Bestäubung erleben konnten, kam unserer Meinung nach bei den Kindern ebenfalls gut an. Unser anfängliches Grundkonzept konnten wir im Großen und Ganzen gut umsetzen, wobei unser Roter Faden sehr locker gehalten war und wir von Gruppe zu Gruppe sehr stark variierten. Die Spontaneität gewann in der direkten Vorbereitung in Marchegg, sowie bei der Durchführung der Station deutlich die Überhand über das in Wien vorbereitete Ablaufschema. So war es eine spontane Idee (aus mangelnder Beschäftigung an den beiden Vorbereitungstagen in Marchegg) Insekten zu fangen, und somit stärker auf die Bestäuber einzugehen als ursprünglich geplant. Wir hatten auch kein vorgefertigtes Redeskript, sondern erzählten den Gruppen, was uns gerade einfiel und am besten zur Situation bzw. zu ihren Interessen und Fragen passend schien. Dadurch kam es zu einem sehr persönlichen Stationsablauf, der auf die jeweilige Kleingruppe zugeschnitten war. Allerdings vergaßen wir dadurch teilweise auf Dinge, die wir eigentlich zusätzlich noch sagen wollten oder verharrten zu lange beim theoretischen Teil, wodurch das eigenständige Blütenuntersuchen am Schluss oft sehr kurz ausfiel. Allgemein hätten wir uns vielleicht etwas mehr zurücknehmen können, um den Schülern mehr Raum für das selbsterforschende Lernen zu geben. Leider kam diese Anregung erst am letzten Tag, wodurch wir die verstärkte Eigenaktivität nur bei der letzten Gruppe ausprobieren konnten. Selbstreflexion (Peter) Die Entwicklung und Durchführung unserer Station war eine tolle Erfahrung bei der auch der Spaß nicht zu kurz kam. Meiner Empfindung nach konnten wir den Spaßfaktor auch auf die Kinder übertragen, und das Thema Blütenökologie war weniger „fad“ als von manchen erwartet, wozu sicherlich auch der Einsatz der Blütenmodelle (inkl. der enthaltenen Süßigkeiten) beitrug. Wie in der Gesamtreflexion bereits angesprochen, hätten wir für die freie Schlussaktivität ein größeres Zeitfenster einplanen sollen. Da die Zeit meist so knapp war, und wir dennoch wollten, dass der Arbeitsauftrag vollständig erledigt wird, versuchten wir den Schülern bei der Untersuchung der Pflanzen zu helfen, was den Begriff „eigene Schüleraktivität“ eigentlich ad absurdum führt. 25 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt Eventuell hätten wir den theoretischen Wiederholungsteil noch stärker komprimieren können und so mehr Zeit für das selbständige Arbeiten geben können. Wir hatten ursprünglich auch geplant, dass sich die Kinder ihre Pflanzen gegenseitig vorstellen (Siehe Arbeitsauftrag), was aber zeitlich nie in dieser Form möglich war. Da ich sehr gerne improvisiere, hatten wir nur einen groben Roten Faden, was meiner Meinung nach gut funktionierte und wir so wirklich auf jede Gruppe gut eingehen konnten. Mal war die Station stark vom Thema Bestäuber geprägt, ein anderes Mal wieder sehr botanisch. Wir hatten aufgrund der offenen Gestaltung auch keinen fixen Redeablauf, wer wann was sagt. Meinem Gefühl nach, hatte dies von Anfang an bestens geklappt, allerdings sah dies mein Stationskollege Timothy doch etwas anders. Da mir ständig irgendwelche Dinge einfielen, die ich den Schülern unbedingt erzählen wollte, kam es (in ganz vereinzelten Fällen) vor, dass ich Timothy’s Atempausen dazu nützte um einen längeren Monolog zu starten. Ich ließ mich dahingehend auch nicht von seinen Ansätzen, wieder ins Gespräch einzugreifen, irritieren, sondern redete einfach in einer erhöhten Lautstärke weiter. Nachdem ich auf diesen Umstand hingewiesen wurde, versuchte ich mich bei den folgenden Gruppen zurückzunehmen (was mir alles andere als leicht fiel) und so einen ausgewogenen Redeanteil zu erreichen, was im Großen und Ganzen auch geklappt hat. Schade für unsere Station war, dass wir aufgrund der Vielzahl der Stationen nur jeweils drei Gruppen betreuen durften. Allerdings bin ich der Meinung (da ich selber ja maßgeblich an dieser Einteilung beteiligt war) dass es trotzdem die beste Lösung war, da dafür die „Highlights“ (Reptilien, Amphibien, Urzeitkrebse) von allen Schülergruppen besucht werden konnten. Selbstreflexion (Timothy) Anfangs war ich überhaupt nicht vom Thema „Blütenökologie“ begeistert, da ich eher die zoologischen Themen bearbeiten wollte. Außerdem hatte ich keine Ahnung, wie ich es den Schülern präsentieren, geschweige denn interessant gestalten soll, sodass es nicht zu einer Tortur für die Schüler (und für mich) wird. Ich habe mich erst einmal darüber schlau gemacht, was ich unbedingt behandeln muss und was ich eventuell noch einbauen könnte, dabei kam ich langsam auf den Geschmack. Also haben wir uns überlegt und diskutiert, wie wir unsere Station gestalten könnten, und da kam uns Peters Korbblütlermodell in den Sinn. „Wieso sollten wir nicht noch mehr Modelle basteln und dadurch die Diversität der Blütenbauweisen darstellen?“ Und ab dem Zeitpunkt hat es auch mir regelrecht Spaß gemacht, mich durch Botanikbücher zu arbeiten, ausgiebig mit dem Thema „Blütengäste“ zu beschäftigen und die Entwicklung von den ersten Skizzen bis hin zur Herstellung der Modelle war ein amüsanter (und teilweise peinlicher) Weg. Meine und Peters Lehrmethoden sind ganz unterschiedliche: während ich durch Fragen die Schüler dazu animieren möchte, ihre eigenen Gedanken zu machen, bevorzugt Peter die Schüler mit spannendem Wissen zum Zuhören zu gewinnen. Da kann es schon passieren, dass er nicht mehr aufzuhalten ist, sobald er einmal losgelegt hat. Und da lag mein Nachteil: bei unserer ersten Schülergruppe hat er mehr oder weniger einen Monolog gehalten, da ich mich nicht gegen seinen Redefluss durchsetzen konnte. Bei den übrigen Gruppen verlief es schon gleichmäßiger und ich konnte ihn 26 Tim Padayhag & Peter Lampert: Denken wie ein Insekt besser zurückhalten, insbesondere, wenn die bemerkenswerte Zwischenmeldungen eingebracht haben. Schüler Mir war es von Anfang an ein persönliches Anliegen, dass unser Thema mit den Reptilien mithalten konnte und mit diesem Ziel vor Augen haben wir eine Station aufbauen können, die den Schülern hoffentlich auch länger in Erinnerung bleibt. Quellenverzeichnis: AICHELE D. & GOLTE-BECHTLE M. (2005): Was blüht denn da?; 57. unveränderte Auflage – Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart BARTH, F. (1982): Biologie einer Begegnung; 1. Auflage – Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart FISCHER, M. A. et al (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol; 3. Auflage – Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz FISCHER, M. A. (2008): Arbeitsunterlage für die Lehrveranstaltung „Einführung in die botanische Morphologie und Biosystematik sowie die ökologische Floristik für Schulbiologen (mit Pflanzenbestimmungsübungen); 6. Auflage – Institut für Botanik der Universität Wien, Wien HINTERMEIER, H. & HINTERMEIER, M. (2002): Blütenpflanzen und ihre Gäste - Teil 1; 1. Auflage – Obst- und Gartenbauverlag, München KNOLL, F. (1956): Die Biologie der Blüte; 1. Auflage – SpringerVerlag, Berlin 27 Aufbau der Blüte von außen nach innen Blütenhülle Blütenökologie von Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti Fachliches Blüte Definition der Blüte: Eine Blüte ist ein mit Sporophyllen (Fruchtblatt und Staubblatt) und meist noch sterilen Blattorganen (Blütenhüllblätter) besetzter Spross mit extrem gestauchten Internodien und beschränktem Wachstum. Die Blütenhülle sind sterile Blütenorgane, welche im Knospenstadium zum Schutz und bei der geöffneten Blüte als Schauapparat dienen. Es gibt zwei Typen von Blütenhüllblättern: - Perigon: die Blütenhülle besteht aus mehreren ± gleichartigen Strukturen, den Tepalen - Die Blütenhülle ist im Gegensatz zum Perigon in zwei Strukturen, den Kronblättern (Petalen) und den Kelchblättern (Sepalen) gegliedert. Der Kelch (Calyx), bestehend aus den Kelchblättern (Sepalen) ist meist klein, grün, verwachsen oder frei und dient im Knospenstadium als Schutz für die Blüte. Die Krone (Carolla), bestehend aus den Kronblättern (Petalen) ist meist auffällig gefärbt und gestaltet, frei oder verwachsen und dient somit meist als Schauapparat (Anlockung von Bestäubern). Die Blütenhülle kann jedoch auch fehlen, dann spricht man von nackten Blüten, welche vor allem bei Windbestäubten Blüten vorkommen, da kein Schauapparat nötig ist. Staubblatt Die Staubblätter (Stamen) sind die pollenerzeugenden Organe der Blüte und sind in zwei Theken (2), welche jeweils zwei Pollensäcke 28 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie (4) enthalten und in ein Filament, der Staubfaden (1) gegliedert. Die zwei Theken sind über ein steriles Konnektiv (3) verbunden. miteinander verwachsen, so dass eine röhrenförmige Struktur entsteht, an deren Grunde innerhalb des so gebildeten Hohlraums (geschützt durch das eingerollte Fruchtblatt: "bedeckt") die Samenanlagen liegen. Nach dem Grad der Verwachsung des Fruchknotens mit dem Blütenboden unterscheidet man zwischen ober-, halbunter- und unterständigen Fruchtknoten. Die Antheren platzen nach der Reifung auf und können so zu Befruchtung zur Narbe transportiert werden (Z.B.: durch Insektenbestäubung oder Windbestäubung). Die Staubblätter (Andrözeum) werden auch als männlicher Teil der Blüte bezeichnet. Fruchtblatt Den zentralen Teil einer typischen Blüte bildet das aus einem oder mehreren Fruchtblättern (Karpellen) bestehende Gynöceum. Die Fruchtblätter kann man sich als umgerollte Blätter vorstellen, an deren Enden die Samenanlagen sitzen, ihr Blattcharakter ist daher nur noch sehr undeutlich. Das Gynöceum umfasst einen oder mehrere Stempel. Ein typischer Stempel besteht (von unten nach oben) aus dem Fruchtknoten (Samenanlagen enthaltend), dem Griffel und der Narbe (Stigma), dem Aufnahmeorgan (Empfängnisorgan) für Pollenkörner. Narben können sehr variabel strukturiert sein. Oft sind sie knopfförmig und mit Papillen (warzenähnliche Erhebungen) versehen, nicht selten sind sie verzweigt, wobei einzelne Narbenäste erkennbar sind. Der Griffel dient dazu, die Narbe in eine für die Bestäubung günstige Position zu bringen. Bei einem Querschnitt durch den Fruchtknoten kann man den Blattcharakter der Karpelle oft recht gut erkennen. Die beiden Ränder eines Fruchtblattes erscheinen eingerollt und Abbildung der Fruchtknoten Abbildung der Blütenorgane 29 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie Bestäubung Unter Bestäubung versteht man den vielfältigen Weg des Pollentransports von der Anthere zur Narbe. An dieser Stelle sei angeführt, dass dieser Begriff unbedingt von dem der Befruchtung zu trennen ist, da eine Bestäubung (Transport des Pollens zu Narbe) nicht zwangsläufig zu einer erfolgreichen Befruchtung (Verschmelzung der Gameten) führt. Man unterscheidet zwischen Selbst- und Fremdbestäubung (Auto- und Allogamie) Selbstbestäubung (Autogamie) Selbstbestäubung bedeutet, dass die Pflanze ihren eigenen Pollen zu Bestäubung verwendet. Die Selbstbestäubung ist vor allem für Pionierpflanzen oder einjährige Pflanzen, welche an instabilen Standorten wachsen attraktiv. Aufgrund der „sichern“ Selbstbestäubung wird auf die Durchmischung des Erbgutes durch Fremdbestäubung verzichtet. Fremdbestäubung (Allogamie) Die Pflanze wird durch den Pollen einer anderen Pflanze bestäubt. Um eine Durchmischung des Erbgutes zu gewährleisten beziehungsweise eine Selbstbestäubung zu verhindern, wurden bei den Blüten verschiedene Einrichtungen entwickelt. Zeitliche Trennung: Staub und Fruchtblätter reifen zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Dabei unterscheidet man zwischen Proterandrie (Staubblätter reifen und stäuben den Pollen vor der Reifung der Fruchtblätter) und Proterogynie (Die Staubblätter reifen nach dem Gynözeum) Räumliche Trennung: Staub und Fruchtblätter werden innerhalb einer Blüte räumlich getrennt. Staubblätter und Fruchtblätter werden auf verschiedene Blüten aufgeteilt, dabei kann man zwischen monozischen (einhäusigen), das heißt männliche und weibliche Blüten befinden sich auf einer Pflanze und diözischen (zweihäusigen) Pflanzen, das heißt auf einem Individuum ist entweder eine weibliche oder männliche Blüte. Die beiden wichtigsten Faktoren zu Fremdbestäubung sind in Österreich vor allem Insekten und der Wind. Die Blüten habe sich an ihre jeweilige Bestäubung angepasst und sind durch folgende Merkmale charkaterisiert: Windbestäubte Blüten: - kein Schauapparat - kein Nektar - Blüten oft in großer Zahl - Pollenproduktion in großen Mengen - Kleiner und leichter Pollen - Große und oft aufgefiederte Narbe Tierbestäubung - Auffälliger Schauapparat - Oft Muster welche nur im UV-Bereich sichtbar sind - Größe und Form der Blüte ist oft an den/die Bestäuber angepasst - Pollen und Nektar dienen als Lockmittel - Pollenkörner sind groß, haben oft eine raue Oberfläche (Haften an dem Bestäuber), sowie klebrige Pollenkit 30 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie Farbsehen bei Bienen Didaktische Reduktion Die Absorptionsspektren der drei Typen von Photorezeptoren der Biene sind gegenüber dem Menschen zum kurzwelligen Licht hin verschoben: UV- Rezeptoren (max. 340 nm), Blaurezeptoren (440 nm) und Grünrezeptoren (540 nm). Die Biene ist also in der Lage, UV-Licht wahrzunehmen, zeigt aber nur eine geringe Empfindlichkeit für rotes Licht. Aus den drei Spektren kann man einen Eindruck der Farbwahrnehmung der Biene gewinnen. Besprechung der Blütenblätter anhand einer Apfelblüte: (Farbspektrum siehe unten) Merkwürdig ist es, dass Klatschmohn-Blüten für uns Menschen genau das Rot haben, was die Bienen nicht sehen können. Dies lässt sich jedoch so erklären, dass die Blüten Ultraviolettes Licht reflektieren und somit für die Bienen sehr auffällig sind. Am amerikanischen Kontinent und den Tropen gibt es durchaus häufiger rein rote Blüten – diese sind meist Vogelbestäubt, die Rot sehr gut wahrnehmen. Didaktik BEI UNS GEHT’S UM SEX Wenn die einzelnen Blütenblätter in der Gruppe im Gespräch besprochen werden, achteten wir darauf, dass Funktion – Struktur – Name schlüssig aufeinander schließen ließen. Der wesentliche Punkt: Es geht um sexuelle Fortpflanzung, wird dabei besonders betont. O Kelchblätter: Umschließen die Blüte „wie ein Kelch den Wein“, sie dienen vor allem zum Schutz der jungen Blüte – der Knospe O Kronblätter: Sind auffällig „wie die Krone eines Königs“, sie ziehen optisch die Aufmerksamkeit von Bestäubern auf die Blüte (neben dem Duft eines der wichtigsten Arten Tiere anzulocken, auch uns Menschen). O Staubblätter: Die männlichen Blütenblätter, produzieren Pollen – Blütenstaub O Fruchtblätter: Die weiblichen Blütenblätter, aus ihnen entsteht nach Befruchtung mit Pollen die Frucht Suchen und Bearbeitung einer eigenen Blüte Anhand eines vorgetrockneten Herbarbelegs suchen die SchülerInnen in zweier bis dreier Gruppen (bzw. wenn besonders gewünscht/ Bedarf) auch alleine die entsprechende frische Blüte, bestimmen die dort die zuvor besprochenen Blütenstrukturen zuerst unter sich und dann vor den anderen. Außerdem berichten sie wie 31 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie sie diese Blüte gefunden haben (Farbe, genauerer Vergleich etc.), ob es Schwierigkeiten gab und wenn ja welche (Blüten mit ähnlicher Farbe, es war ein Strauch...) und über den Fundstandort. Zielformulierung für die SchülerInnen: Findet anhand der getrockneten Pflanze die entsprechende frische Blüte innerhalb dieses Suchgebietes. Seht euch die vorher besprochenen Strukturen an eurer Blüte an und stellt diese dann vor den anderen vor. Ihr habt dafür 5 Minuten Zeit. „Rotlichtmilieu“ – Schülerversuch In einer Schachtel, deren Deckel durch mehrere Schichten roter PVC-Folie (inklusive einer entfernbaren Zusätzlichen Schichte) ersetzt wurde, simulierten wir die Farbwahrnehmung von Bienen. Auf grünem Untergrund lagen verschieden färbige Buntpapierblumen. Wir besprachen gemeinsam was auffällt, welche Blütenfarben besonders auffällig durch die rote Folie erscheinen und gehen mittels eines Farbspektrums auf die Farbwahrnehmung (siehe unten) der Bienen ein. 32 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie Pantomimische Darstellung der Bestäubung: Ausgewählte Pflanzen: Wir besprechen die mögliche Bestäubung anhand der Apfelblüte bzw. der Nussbaumblüten durch. Die Schülergruppen bekommen den Arbeitsauftrag die mögliche Bestäubung ihrer Blüte pantomimisch darzustellen, die andere Gruppe bzw. sie selbst kommentieren anschließend, während von uns die Bestäubung der Nuss pantomimisch vorgeführt wurde. Die Beiträge wurden gefilmt. Für die Vorstellung von Blütenaufbau und Bestäubung wählten wir Blüten von Pflanzen, die entweder als Nutzpflanzen bekannt sind, oder die häufig vorkommen und von deren Struktur man gut auf Funktion schließen konnte. Zusätzlich achteten wir darauf, dass wir für die erste Vorstellung der Blütenblätter radiärsymmetrische Blüten mit großen Blättern – für eine Vertiefung eine Wiederholung sowie eine Erweiterung mit einer zygomorphen Blüte zu ermöglichen Zielformulierung für die SchülerInnen: Erarbeitet in den nächsten 5 Minuten die pantomimische Darstellung der möglichen Bestäubung eurer vorher gefundenen Blüte. Präsentiert diese dann uns anderen, die jeweils zusehende Gruppe wird anschließend kommentieren. Ihr könnt dafür das zur Verfügung stehende Material (Buntpapier, Klebeband etc.) verwenden, müsst aber nicht. O Malus cf. sylvatica; Apfel, Rosaceae (Rosengewächs): Die frische Blüte diente zur Vorstellung der Blütenblätter sowie zur gedanklichen Verknüpfung: Blüte – Frucht, die auch als Beispiel für Tierverbreitung herangezogen wurde. O Fragaria viridis; Knackerdbeere, Rosaceae (Rosengewächs): Die getrocknete und frische Blüte diente zur Vertiefung in Kleingruppen und Wiederholung der vorher besprochenen Struktur an einer verwandten und somit sehr ähnlichen Pflanze. Eine Verknüpfung zur Systematik erfolgte dadurch wie von selbst (Schüler-Zitat: „das ist vom Aufbau das gleiche wie vorher“) 33 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie O Crataegus cf. laevigata; Weißdorn, Rosaceae (Rosengewächs): aufgrund von Mangel an Erdbeeren wurde auch dieser an ihrer Stelle verwendet, auch wenn das Suchen z. B. aus Zeitgründen schneller gehen sollte. O Lamium maculatum; gefleckte Taubnessel, Lamiaceae (Lippenblütler): Die getrocknete und frische Blüte wurde zur Vertiefung der Blütenstruktur und zur Vorstellung von zygomorphen Blüten. O Symphoticum officinale; Beinwell, Boraginaceae (Raubblattgewächse): siehe Taubnessel O Juglans regia; Walnuss, Juglandaceae (Walnussgewächse); die frischen männlichen und weiblichen Büten(stände) an einem Aststück dienten zur Vorstellung von einhäusigen, windbestäubten Blüten. bestand, zur Vorstellung der Kesselfalle für die Bestäubung. Die Frucht des Vorjahres diente zur Veranschaulichung von unterschiedlichen Verbreitungsformen der Früchte. Außerdem wurde manchmal an einem gefangenen Osterluzeifalter noch die Beziehung des Falters zur Pflanze gezeigt. O Taraxacum officinale agg.; Löwenzahn, Asteraceae (Korbblütler): Diente als bespiel für gelbe Blütenfarbe, sowie zur Fruchtverbreitung durch Wind. Zusätzliche Pflanzen, die bei Bedarf verwendet wurden: O Aristolochia clematitis; Osterluzei, Aristolochiaceae (Osterluzeigewächse): Als Besonderheit dieses Standortes. Die frische Blüte diente, wenn Zeit und Interesse der Schüler 34 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie O Actrium sp.; Kletten, Asteraceae (Korbblütler): Diente als Beispiel für Tierverbreitung der Frucht Schülerreflexion – Stimmungsbarometer Zusätzliches Programm: Bei besonders interessierten Gruppen, bzw. wenn Bedarf im Verlauf des Gesprächs bestand, wurden noch folgende Themen angesprochen: O Fruchtverbreitung (Tier, Wind, Wasser...) O Verschiedene Bestäuber (Biene, Schmetterling, Hummel, Fliegen, Käfer) und entsprechende Blütenformen O Besprechung der Osterluzei, ihrer Bestäubung, ihrer Verbreitung und des Osterluzeifalters O Wiederholung des Unterschiedes zwischen Bestäubung und Verbreitung; Pollen und Samen/ Frucht anhand von Beispielen und Vergleich mit dem Menschen 35 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie Methoden: Kurze Zusammenfassung Lehrziele: O Förderung von Biologischem Denken im Bereich der Blüten- und Bestäubungsökologie ⇒ Schließen von Struktur auf Funktion ⇒ Schließen von Blütenaufbau auf Bestäubung O Vorstellen von einigen wenigen Pflanzen, deren Blütenaufbau und Bestäubungsökologie anhand von wenigen Beispielen O Vermitteln, dass auch Botanik Spaß macht! O Lernen am Objekt O Methodischer Vergleich eines Herbarbelegs mit einer frisch blühenden Pflanze O Bewältigen von Aufgabenstellungen nach klaren Zielformulierungen, die für die Schüler verständlich, zeitlich beschränkt, realisierbar und überprüfbar sind. O Entdecken und Präsentieren in der Gruppe (Suche nach Herbarbeleg und Präsentation) O Schülerversuch - Rotlichtmilieu O Planung und Durchführung einer pantomimischen Darstellung zu Wiederholung und Anwendung des Vorher Besprochenen Inputs O Beim Aufbau unseres Programms achteten wir darauf dass sich ein Spannungsbogen durch die halbe Stunde ziehen ließ. Die von den Schülern in Gruppen zu bewältigten Aufgaben in der Mitte und am Ende des Programms, dienten sowohl der Wiederholung, als auch der Vertiefung. Methodisch im Ablauf waren sie als Auflockerung und zusammenfassender Abschluss gedacht. O Theoretische, methodische, erkundende und kreative Aufgaben wurden in ausgeglichener Weise – auch je nach Anspruch der unterschiedlichen SchülerInnen-Gruppen - gestellt 36 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie Evaluation: Durch die Stimmungsbarometer holten wir uns direkt Feedback von den Schülerinnen selbst und konnten so auch unterschiedliche Gruppen schnell überblicksmäßig vergleichen. Vor allem was den Spaß an der Botanik betraf hatten wir ein grobes Feedback. Das fachliche Feedback diente vorrangig als Überblick, wie der NiveauAnspruch unter den SchülerInnen am Thema war. So konnten wir unseren Input gegebenenfalls, zusätzlich zur direkten Reaktion auf die Einwürfe und fragen der SchülerInnen anpassen. Durch das sofortige bzw. ausführliche Feedback unserer Lehrveranstaltungsbetreuer konnten wir unser Programm gegebenenfalls ebenso anpassen. Außerdem war ein Austausch zwischen uns selbstverständlich und auch wichtig. Selbstreflexion: Die Zusammenarbeit zwischen uns beiden hat immer sehr gut geklappt, sei es während der Vorbereitung, als auch während des Aufenthalts in Marchegg, sowie bei der Nachbereitung der Lehrveranstaltung. In der Vorbereitungsphase haben wir nicht ein striktes Konzept für unseren Unterricht ausgearbeitet, sonder mehrere Ideen und Konzepte erarbeitet. Mehrere Faktoren ließen uns diese Entscheidung treffen, zum Beispiel dass wir die SchülerInnen und deren Wissensstand zum Thema nicht kannten, sowie die genauen Standortsbedingungen nicht kannten und die anzutreffenden (gerade blühenden) Pflanzen nur erahnen konnten. In der finalen Vorbesprechung mit Erich, ließ diese Vorgehensweise bei ihm, zumindest war das unser Empfinden, Skepsis aufkommen. Wir blieben beide jedoch dabei, dass wir den „Feinschliff“ unseres Konzeptes erst vor Ort angehen wollten – auch weil die organisatorischen Dinge in der Großgruppe (SchülerInnenGroßgruppe sowie zur Verfügung stehende Zeit) erst dort abgesprochen werden konnten. Als wir dann schließlich in Marchegg angekommen sind und uns akklimatisiert haben, begannen wir uns einen passenden Standort beziehungsweise passende Pflanzen zu suchen. Die Suche viel uns eigentlich relativ leicht und da wir die meisten Vorbereitungen schon zu Hause getroffen haben, konnten wir in Ruhe und ohne Stress unsere Station aufbauen. Flexibilität und Adaption waren zwei wesentliche Punkte für uns, darum gliederten wir zum Beispiel bei interessierten Gruppen die Osterluzei (Besprechung der Osterluzei, ihrer Bestäubung, ihrer Verbreitung und des Osterluzeifalters) ein (siehe oben). Als wir am Nachmittag bevor die Schulklasse kamen unsere Station den anderen Studierenden präsentieren sollten, gingen wir wieder einen eher unkonventionellen Weg, da wir unsere Station nur kurz beschrieben 37 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie und diese nicht eins zu eins wiedergaben, sondern zwei Pflanze die uns als interessant erschienen den KollegInnen erklärten. Als am Montag dann endlich die erste Schulklasse kam, waren wir beide eigentlich nicht sehr nervös, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir beide schon öfters mit Kindern gearbeitet haben. Was sehr interessant war, dass sich einige Formulierungen, die bei den ersten Gruppen gut angekommen sind, die gesamten beiden Tage verwendet wurden. Zum Beispiel: Kronblätter sind so schön, sie sehen aus wie eine Krone. Kelchblätter umschließen die Blüte wie der Kelch den Wein. Zwischen den einzelnen Gruppen haben wir auch einige Veränderungen vorgenommen – auch auf das direkte Feedback unserer „Beobachter“, das wir als sehr hilfreich empfanden. Ein Beispiel dafür ist der Untergrund unseres Rotlichtmilieus (zuerst weiß, dann grün). Dass das Rotlichtmilieus so gut funktioniert hat, war für uns eigentlich ziemlich überraschend. Wollten wir es zuerst nur bei der ersten Klasse verwenden, kam es aber auch bei der siebten gut an (wir waren auch hier dankbar für die Empfehlung) – und wirkte anschaulicher, als wir es uns Anfangs selbst gedacht hatten. Die Pantomime hat bei den meisten Gruppen sehr gut funktioniert, die Kreationen der SchülerInnen waren teilweise kaberettreif, zum Beispiel die Biene die mit Pollen gedealt hat. Die Pantomime erwies sich nicht nur als lustige Abschluss, welche zur Erheiterung der 38 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie SchülerInnen diente, sondern wir konnten so auch überprüfen, ob die Schülerinnen den Vorgang der Bestäubung verstanden haben. Bei einer Gruppe merkten wir während ihrer Pantomime, dass ein Mädchen die Bestäubung nicht verstanden hat, somit war es uns möglich das Thema noch mal aufzurollen und es ihr zu erklären. Anfangs hatten wir hier jedoch noch ein Zeitproblem, da wir noch nicht genau wussten wie viel zeit dieser teil unseres Programms in Anspruch nehmen würde. Wir bekamen dass aber ab der zweiten Gruppe des ersten Tages gut ins Gefühl und konnten inklusive Adaptionen unser Zeitschema gut einhalten. Bei der ersten Klasse allerdings verzichteten wir bei manchen Gruppen auf die Pantomimische Darstellung, da sie für diese Gruppen wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen hätte – waren sie so schon vom Thema so aufgekratzt, hier wiederholten wir die Inhalte abschließend gemeinsam. Sie hätten zwar wahrscheinlich Spaß daran gehabt und insofern ist es natürlich ein wenig schade dass sie die Möglichkeit nicht gehabt haben, auch weil gerade bei einigen Gruppen der ersten Klasse mehr bewegungsaktivere Einheiten wahrscheinlich von Vorteil gewesen wären. Gerade das PflanzenSuchen kam bei ihnen unserem Eindruck nach gut an – wollten sie sobald wir eine andere Pflanze vorstellten, sie erneut suchen gehen – obwohl sie zB nur am Pflanzenstück die Blüte erkennen sollten (Nuss). Auch wenn wir Teile nicht in der Gruppe sitzend, sondern stehend behandelten wirkten sie ruhiger. So war es aber manchmal schwierig sie konzentriert beim Arbeiten zu behalten. Das Feedback welches wir uns von den SchülerInnen holten war auch sehr hilfreich, da wir ohne großen Aufwand, zusätzlich zu den Kommentaren der Lehrveranstaltungsleiter ein Feedback der SchülerInnen bekamen. Interessant war, dass sich unser Empfinden oft mit dem Feedback der SchülerInnen deckte. Zum Beispiel ist es uns bei Gruppe 2 am Tag 2 nicht sehr gut gegangen, wir waren müde, ausgelaugt... diese Stimmung haben wir anscheinend auf die SchülerInnen übertragen ;) Die Lehrveranstaltung hat uns eigentlich sehr gut gefallen, vor allem die soziale Komponente war wirklich toll, da wir eigentlich den ganzen Tag und auch teilweise die Nacht zusammen verbracht haben ;) Was mit sehr gut gefallen hat, war die Auswahl der Schulklassen, da man so das Arbeiten mit älteren, als auch mit jüngeren Klassen kennenlernt. Dies würde ich unbedingt beibehalten. 39 Daniel Esletzbichler & Carina Lenotti: Blütenökologie Literatur Aichele, D.; Golte-Bechtle, M. (2005): Was blüht denn da?. Kosmos Vlg., Stuittgart. Brillux GmbH & Co. KG (2005): UV statt Rot: Wie Honigbienen Farben sehen. Internet Artikel: www.farbimpulse.de, 19. 4. 2009. Brillux GmbH & Co. KG (2005): Wie aus dem Rot einer Rose das Blau einer Kornblume wird. Internet Artikel: www.farbimpulse.de, 19. 4. 2009. Brillux GmbH & Co. KG (2006): Warum Hummeln auf violette Blüten fliegen. Internet Artikel: www.farbimpulse.de, 19. 4. 2009. Frings, S. (Jan. 2000): Farbensehen. Internet Artikel, http://www.sinnesphysiologie.de/komplex/farbe.htm, 19. 4. 2009. Frings, S. (Jan. 2000): Polarisationssehen. Internet Artikel, http://www.sinnesphysiologie.de/komplex/polar.htm, 19. 4. 2009. Liede, S. (2002): Blütendiagramme, radiärsymmetrische (aktinomorphe) Blüten. Internet Artikel, http://www.biologie.unihamburg.de/b-online/d02/radiaer.htm, 19. 4. 2009. Liede, S. (2002): Blütendiagramme, Blüten mit reduzierten oder fehlenden Blütenkreisen. Internet Artikel, http://www.biologie.unihamburg.de/b-online/d02/reduced.htm, 19. 4. 2009. Liede, S. (2002): Blütendiagramme, eingeschlechtliche Blüten. Internet Artikel, http://www.biologie.uni-hamburg.de/bonline/d02/unisex.htm, 19. 4. 2009. Rothmaler, W.; Eckehart, J.J.; Klaus, W. (2000): Exkursionsflora von Deutschland, Band 3 Gefäßpflanzen: Atlasband. SpektrumAkademischer Vlg., Heidelberg. Rothmaler, W.; Eckehart, J.J.; Klaus, W. (2000): Exkursionsflora von Deutschland, Band 4 Gefäßpflanzen: Kritischer Band. Spektrum-Akademischer Vlg., Heidelberg. Sengenbusch, P. (2003): Blüten. Internet Artikel, http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/d02/02d.htm, 19. 4. 2009. Sitte, P.; Weiler, E.W.; Kadereit, J.W. und Bresinsky, A. (2002): Strasburger: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. SpektrumAkademischer Vlg., Heidelberg 765 – 774. Liede, S. (2002): Blütendiagramme, zygomorphe Blüten. Internet Artikel, http://www.biologie.uni-hamburg.de/bonline/d02/zygom.htm, 19. 4. 2009. 40 Abwehrmechanismen der Pflanzen von Michaela Urbauer und Barbara Zauner Theoretische Vorbereitung Im Gegensatz zu Mensch und Tier können Pflanzen nicht flüchten, wenn sie in Gefahr sind. Wehren müssen sich Pflanzen z.B. gegen Fraßfeinde, aber sie müssen sich auch verteidigen können gegen andere Pflanzen, welche in Konkurrenz mit ihnen stehen. Besondere Bedrohung für die Pflanzen stellen somit Tiere, andere Pflanzen, der Mensch sowie Pilze dar. Man kann die Abwehrmechanismen der Pflanzen generell unterteilen in Mechanische Abwehr Chemische Abwehr Die mechanische Abwehr einer Pflanze kann man erkennen an dem Vorhandensein von Dornen Stacheln Haaren Brennhaaren Dornen sind umgebildete Pflanzenorgane (z.B. Blätter, verholzte Kurztriebe); erkennen kann man sie daran, dass sie relativ schwer abzubrechen sind. Mittels der Dornen kann sich die Pflanze gegen ungewünschte Besucher verteidigen. Beispiele sind der Weißdorn, die Schlehe uvm. Stacheln sind im Vergleich zu den Dornen lediglich Ausstülpungen der Epidermis, wodurch man sie sehr leicht abbrechen kann. Folgende Vertreter verteidigen sich mit Stacheln: z.B. die Brombeere, die Hagebutte, die Robinie, Disteln, die wilde Karde uvm. Auch die Rosen haben Stacheln! Auch durch die Bildung von Haaren kann sich eine Pflanze gegen Feinde schützen. Diese Haare erschweren es den Tieren, an der Pflanze hinaufzuklettern. Außerdem stellen Haare Schutz gegenüber Kälte und Hitze dar. Ein in Marchegg gesehenes Beispiel für die Abwehr mit Haaren ist der Beinwell. Brennhaare sind ein Sonderfall der pflanzlichen Abwehrstrategien, da sie sowohl der mechanischen, als auch der chemischen Abwehr zugerechnet werden können. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Brennnessel (Urtica sp.). Die Brennhaare sind Trichome, deren Spitzen aussehen wie kleine Köpfchen. 41 Michaela Urbauer & Barbara Zauner: Abwehrmechanismen der Pflanzen In diesen Köpfchen befindet sich die chemische Abwehr der Brennnesseln, ein Gemisch aus Ameisensäure, Histamin, Acetylcholin, Serotonin und anderen Bestandteilen. Bei Berührung einer Brennnessel bricht dieses Köpfchen ab, und dieser „Chemie- Cocktail“ wird einem wie mit einer Injektionsnadel injiziert. Abb. 1: Brennhaare einer Brennnessel1 Man muss jedoch erwähnen, dass manche Pflanzen, welche ätherische Öle eingelagert haben, für Tiere zwar ungenießbar sind, jedoch für den Menschen nicht (und umgekehrt). Dieser verwendet einige Pflanzen gerne als Küchenkräuter, oder Gewürze (z.B. Vertreter der Gattung Allium, Bild links: Schnittlauch, rechts: Zwiebel). Die chemische Abwehr einer Pflanze kann man wesentlich schwieriger erkennen, als die mechanische Abwehr, in manchen Fällen (Giftpflanzen, z.B. die Tollkirsche ist wohlschmeckend) von außen gar nicht. Um eine chemische Abwehrstrategie feststellen zu können, muss man die Pflanze gründlich auf Geschmack, Geruch oder einen auffälligen Milchsaft untersuchen. Um den Geruch zu untersuchen, muss man einige Blätter der Pflanze gründlich zerreiben. Als chemische Abwehr bezeichnet man prinzipiell die Einlagerung von gewissen Bitterstoffen, ätherischen Ölen, Gerbstoffen und Giftstoffen in gewisse Pflanzenabschnitte. Die Pflanze wird somit ungenießbar bzw. unattraktiv, ja in manchen Fällen sogar sehr giftig, und die Fraßfeinde lassen daher von ihr ab. 1 http://de.wikipedia.org/wiki/Brennnessel 42 Michaela Urbauer & Barbara Zauner: Abwehrmechanismen der Pflanzen In näherer Umgebung von unserem Standort in Marchegg haben wir folgende besonders prägnante Pflanzen gefunden, und mit den SchülerInnen besprochen: Osterluzei Alle Teile, v.a. die Wurzel und Blätter enthalten die giftigen Aristolochiasäuren; diese schädigen das Verdauungssystem und die Nieren Schöllkraut hat einen gelb- orangen Milchsaft ist giftig enthält Alkaloide ist ein Stickstoffzeiger Schwarzer Holunder die Blätter enthalten ein ätherisches Öl, wodurch der starke Geruch entsteht Echter Kerbel hat einen starken Anis- Geruch, durch die Einlagerung von ätherischen Ölen ist ein Stickstoffanzeiger wird vom Mensch als Suppenkraut und Gewürz verwendet Bär-Lauch enthält ätherische Öle mit stark riechenden SchwefelVerbindungen Löwenzahn enthält in allen Pflanzenteilen einen weißen Milchsaft dieser enthält u.a. Gerbstoffe, Bitterstoffe und Taracoside der Milchsaft ist jedoch nicht giftig, sondern hat einen bitteren Geschmack hat einen hohen Kalium- Gehalt Brennnessel Esels- Wolfsmilch Inhaltsstoffe siehe oben! enthält einen Perlmutt-farbenen Milchsaft dieser ist sehr giftig Garten- Ampfer Hat einen leicht bitteren Geschmack Enthält Oxalsäure, wodurch bei Vergiftungen auftreten können! Fachdidaktik Didaktische Reduktion Da beide Klassen, die zu uns nach Marchegg auf Lehrausgang kamen, Unterstufen- Klassen waren, wollten wir den fachlichen Teil nicht zu stark aufbauen, und viel mehr das Augenmerk darauf legen, die Kinder selbst nach Abwehrmechanismen suchen zu lassen. Davon erwarteten wir uns, dass sie ihre Augen für die Pflanzenwelt öffnen, und begreifen, dass nicht nur Tiere sich wehren müssen, sondern eben auch Pflanzen! Wichtig war für uns das selbstständige, forschende Arbeiten der SchülerInnen. Unsere Station bauten wir hinter dem Haus auf. Wiederkäuern 43 Michaela Urbauer & Barbara Zauner: Abwehrmechanismen der Pflanzen Für den 1. Tag hatten wir folgendes Programm vorbereitet: Der erste Programmpunkt sollte eine kurze theoretische Einleitung sein (nicht länger als 5 min.), in der wir die SchülerInnen auf ihre Suche vorbereiten wollten. Dieses Gespräch begannen wir mit vielen Fragen (z.B. „Warum muss sich eine Pflanze wehren?“ „Und gegen wen?“ „Wie glaubt ihr, kann sie das machen?“, etc.) Unterstützt haben wir diese Einleitung durch Pflanzenbeispiele, die wir schon zuvor in der Umgebung gesucht und bestimmt haben. Anschließend hatten wir uns überlegt, dass die SchülerInnen ca. 7min. in einem markierten Gebiet ausschwärmen sollten. Dafür haben wir „Fahnen“ vorbereitet, mit welchen sie die gefundenen Pflanzen markieren konnten. Am 1. Tag haben wir die SchülerInnen noch in 2 SuchGruppen eingeteilt- und zwar in „chemische Abwehr“ und „mechanische Abwehr“. Im Laufe der Exkursion merkten wir schnell, dass diese Einteilung nicht gut funktioniert, da mechanische Abwehr wesentlich leichter zu entdecken ist! Also haben wir diese Gruppeneinteilung später dann weggelassen. Somit haben wir den SchülerInnen das Handout einfach für den Weg mitgegeben. 44 Michaela Urbauer & Barbara Zauner: Abwehrmechanismen der Pflanzen Der 2.Tag wurde von uns ein wenig umgestaltet. Wir haben den Standort unserer Station ein wenig verlegt, eher zum Kühlraum, da die SchülerInnen unserer Meinung nach, weniger durch die anderen abgelenkt wurden. Den Grundaufbau haben wir beibehalten, jedoch haben wir zusätzlich noch die Brennhaare der Brennnessel unter dem Binokular hergezeigt. Weiters haben wir den SchülerInnen noch den „Zaubertrick“ mit der Brennnessel gezeigt, d.h. dass man eine Brennnessel von unten (Wurzel) nach oben (Blüte/Spitze) angreifen und hinauf gleiten kann ohne sich zu verletzen bzw. ohne sich zu „verbrennen“. Wir haben viele Fragen gestellt und versucht auf alle von den SchülerInnen gefundenen Antworten einzugehen. Die Einführung wurde durch das Zeigen des Zaubertricks und der Brennhaare unter dem Binokular etwas länger. Wir haben den Suchbereich, in dem die SchülerInnen selber Abwehrmechanismen finden sollten etwas verlegt, bzw. verkleinert, da die SchülerInnen an den Grenzen dieses Gebiets, am Vortag, andere SchülerInnen sehen konnten und dadurch abgelenkt wurden. Die SchülerInnen bekamen, wie am Vortag, den Arbeitsauftrag Abwehrmechanismen, jedoch diesmal nicht geteilt in chemische und mechanische Abwehrmechanismen, mit einem Fähnchen zu markieren und später beim Rundgang kurz zu erklären, warum sie diese Pflanze markiert haben. Beim Rundgang ergänzten wir die Pflanzen, die die SchülerInnen nicht gefunden haben und zeigten ihnen bei den „Wildkräutern“, dass man sie essen kann, indem wir sie aßen. Das Handout wurde als Abschluss ausgeteilt, obwohl wir keine Zeit mehr hatten dieses zu besprechen und das Rätsel gemeinsam zu lösen, wir wollten jedoch, dass die SchülerInnen etwas mit nach Wien nehmen. 45 Eva Hoschof (rechts) mit . Feldgrille (Gryllus campestris) 5 Michaela Urbauer & Barbara Zauner: Abwehrmechanismen der Pflanzen Reflexion Unser in Wien erarbeitetes Grundkonzept war sehr flexibel, da wir nur einen groben Aufbau vorgesehen hatten und meinten, alles Weitere können wir erst planen, wenn wir die Situation und die Gegebenheiten vor Ort kennen, deshalb hat unser Grundkonzept recht gut funktioniert. Wir konnten die SchülerInnen, zumindest für 20 Minuten, auf die Natur und die evolutionären Hintergründe, eine Pflanze hat Vorteile durch gut funktionierende Abwehrmechanismen, hinweisen und sie vielleicht dafür sensibilisieren. Wir hatten keine Arbeitsteilung beim Einführungsvortrag , der Betreuung der SchülerInnen während der Erfüllung des Arbeitsauftrags, und dem Rundgang, da wir ein dynamisches Gespräch führen wollten, und uns dadurch gegenseitig ergänzen konnten, sobald die andere etwas vergessen hat. Durch dieses dynamische Gespräch kam es aber hin und wieder dazu, dass wir manche Dinge doppelt erwähnten, oder zumindest teilweise wiederholten. Der uns ideal erscheinende Standort, war durch ein totes Reh kontaminiert, sodass wir uns einen anderen Standort suchen mussten, der trotzdem möglichst viele Pflanzen mit unterschiedlichen Abwehrmechanismen in der näheren Umgebung hatte. Am ersten Tag haben wir es nicht immer geschafft alle SchülerInnen während der Erfüllung des Arbeitsauftrages im Auge zu behalten. Weiters war am ersten Tag die Ablenkung durch andere SchülerInnen sehr groß, da die Gruppen einander sehen konnten, bzw. unser Standort sehr nahe dem Klo war. Wir konnten Die Aufmerksamkeit der SchülerInnen nicht für unser Thema gewinnen, da wir am ersten Tag noch nichts „Spektakuläres“ zu bieten hatten, das besserte sich aber am zweiten Tag durch den „Zaubertrick“ und die Brennhaare unter dem Binokular. kurze Zusammenfassung Durch unsere Unwissenheit in Wien konnten wir nicht viel für diese LV vorbereiten, außer uns selber fachlich möglichst gut einzuarbeiten. Das von uns erstellte Konzept war ein sehr grober Aufbau, der in Marchegg direkt noch verfeinert und aufgefüllt wurde, sobald wir die Gegebenheiten vor Ort kannten. Gleich nach der Ankunft (DI) und dem ersten gemeinsamen Rundgang, machten wir uns mit den Pflanzen der Umgebung vertraut, gingen das gesamte Areal ab und suchten 47 Michaela Urbauer & Barbara Zauner: Abwehrmechanismen der Pflanzen nebenbei auch nach einem geeigneten Standort für unsere Station. Wir versuchten alle Pflanzen mit auffälliger chemischer und mechanischer Abwehr zu finden und zu bestimmen, hier war uns Peter Pany eine große Hilfe. Am zweiten Tag (MI) suchten wir uns unseren Standort endgültig aus, nachdem wir beschlossen hatten dass der Idealstandort in der Nähe des Toten Rehs einfach nicht tragbar ist, ergänzten unser Konzept und bastelten die Fähnchen für die SchülerInnen zum markieren der Pflanzen., aus Ästen der Umgebung und mitgebrachtem Papier. Am Do, der erste Tag mit den SchülerInnen, hatten wir nur jede 2. Gruppe und somit zwischen den Gruppen ca. 20-30 min freie Zeit. Wir waren bei der ersten Gruppe noch nicht eingespielt und versuchten das ganze Konzept durchzuboxen, was zu Hektik und Durcheinander führte, bei den nächsten Gruppen haben wir das Endrätsel und die dessen Besprechung weg gelassen. Nach der Rücksprache mit den unbeteiligten Beobachtern, sie meinten es fehle der Pepp, also irgendetwas Spannendes und Spektakuläres, überlegten wir einige Zeit und beschlossen noch den Zaubertrick der Brennnessel, und die Brennhaare unter dem Binokular dazu zu nehmen, dafür das Suchgebiet der SchülerInnen zu verkleinern. Der Freitag, zweite Tag mit den SchülerInnen, verlief schon um einiges Besser, da wir schon eingespielt waren, zusätzlich etwas Spannendes in unsere Station gebracht hatten, das Suchgebiet verkleinert hatten und den SchülerInnen zeigten, dass der Mensch chemische Abwehrmechanismen auch nutzt als Küchenkräuter (Schnittlauch und Kerbel). Die Besprechung am Abend mit den „critical-friends“ fiel eher besser als am Vortag aus, obwohl ich selber viel mehr verbesserungswürdige Verhaltensweisen an uns bemerkt habe, als sie gesagt habe. Mir sind einige Dinge aufgefallen, die mich selbst gestört haben, die nicht erwähnt wurden, daher nehme ich an, dass sie nicht so schlimm gewesen sein können. Unser Lehrziel war es den SchülerInnen ein wenig Einblick in die Evolution zu vermitteln, anhand einiger leicht zu erkennender Pflanzen. Wir wollten die SchülerInnen darauf aufmerksam machen, dass die Natur nichts macht nur damit es da ist, sondern jede Sache (Brennhaare, Dornen, Stachel, Pflanzeninhaltsstoffe, Ätherische Öle,…) eine oder mehrere Funktionen erfüllt, und nur zum eigenen Vorteil gebildet werden. Die Lernziele waren sehr einfach und niedrig gesteckt, wir wollten, dass die SchülerInnen mit offenen Augen durch die Welt (zumindest durch unser Suchgebiet) gehen und entdecken, dass jede Pflanze Abwehrmechanismen besitzt. Dies haben wir durch unseren Arbeitsauftrag und dessen Erfüllung zumindest zeitweise erreicht. Die Langzeitwirkung unserer Station können wir leider nicht beurteilen, dafür müsste man gleich nach der Station und mit einigem Zeitabstand eine Wissensevaluierung machen. 48 Abwehrstrategien von Pflanzen Sowohl gegen Pflanzen als auch gegen Tiere von Ulrike Derks & Sarah Merschitz Fachlicher Teil Da Pflanzen im Normalfall an ihrem Standort fest verankert sind und somit Fliehen nicht möglich ist, benötigen sie bestimmte Mechanismen, um sich gegen Tierfraß zu wehren und vor dem Zertrampeln zu schützen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen chemischen und mechanischen Abwehrstrategien. Chemische Abwehr beinhaltet sämtliche Zellinhaltsstoffe, die unangenehmen Geschmack oder Geruch hervorbringen und mehr oder weniger giftig sein können. Mechanischer Abwehr liegen umgewandelte Pflanzenorgane und Strukturen zugrunde, die sich als Dornen, Stacheln oder Ähnlichem äußern können. Bei einigen Pflanzen gibt es auch Mischformen von chemischen und mechanischen Abwehrstrategien. Diese Kombination ist beispielsweise bei der Brennnessel (Urtica) anzutreffen. Die Brennhaare (Trichome) sind durch eingelagerte Kieselsäure verhärtet und enthalten neben Ameisensäure Histamin, Serotonin und einige weitere chemische Inhaltsstoffe. Das Köpfchen an der Spitze besitzt eine Sollbruchstelle, das bereits bei leichter Berührung abbricht und eine scharfe Bruchstelle hinterlässt. Bei Kontakt wird der ameisensäurehältige Inhalt in die Wunde injiziert und verursacht brennenden Schmerz und Schwellungen. Beispiele für die chemische Abwehr sind der Bärlauch (Allium ursinum), Echter Kerbel (Anthriscus cerefolius) und die Kleine Taubnessel (Lamium purpureum), die jeweils Zellinhaltsstoffe besitzen, die einen unangenehmen Geruch bzw. Geschmack hervorrufen. Neben ätherischen Ölen gibt es auch zahlreiche Gerbund Bitterstoffe, die beispielsweise im Milchsaft des Löwenzahns (Taraxacum officinale) vorhanden sind. Diese Strategie bewehrt sich zumindest als Fraßschutz im Tierreich. Der Mensch hat jedoch viele dieser ätherischen Öle als wohlschmeckend erkannt, wodurch sie als Gewürze bzw. Kräuter Verwendung finden. Allerdings ist die täglich verträgliche Dosis relativ gering wodurch keine unmittelbare Bedrohung für die Pflanzen entsteht. 49 Ulrike Derks & Sarah Merschitz: Abwehrstrategien von Pflanzen Ein besonderes Beispiel ist die Osterluzei (Aristolochia clematitis). Dabei handelt es sich um eine mehrjährige krautige Pflanze, die einen leicht fruchtigen Duft verströmt. Die giftige Wirkung der Pflanze bezieht sich vor allem auf die Wurzeln, die flüchtige, wasserunlösliche und giftige Aristolochiasäuren enthalten. Jedoch enthalten auch die Samen nicht unbeachtliche Mengen dieser Säure, die krebserregend und nierenschädigend ist. Die Osterluzeifalter (Zerynthia polyxena, im Bild ein Gelege) machen sich diese Giftwirkung zu Nutze indem die Weibchen die Eier auf der Unterseite der Blätter ablegen und die Raupen sich davon ernähren, wodurch die Schmetterlinge selbst durch Giftigkeit vor Fraßfeinden geschützt sind. Bei den mechanischen Abwehrmechanismen sind in erster Linie Stacheln und Dornen zu nennen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden diese beiden Begriffe häufig vertauscht oder synonym verwendet. In manchen Fällen werden sie sogar botanisch falsch verwendet, zum Beispiel, wenn von den „Dornen der Rosen“ die Rede ist. Während es sich bei Stacheln um Emergenzen handelt, die eine Umbildung bzw. Ausstülpung der Epidermis sind, handelt es sich bei Dornen umgebildete Organe und nehmen diesen Stellenwert ein. Beispiele sind die Stacheln der Rosen (Rosa), der Brombeeren (Rubus fruticosus) oder der Himbeere (Rubus idaeus). Dornen findet man hingegen bei Schlehen (Prunus spinosa) und beim Weißdorn (Crataegus) sowie Blattdornen bei der Berberitze (Berberis vulgaris). Neben Stacheln und Dornen dienen auch Haare und Brennhaare als mechanische Abwehrmöglichkeit. Didaktik Aufbereitung Nachdem die Themen verteilt und die Schulstufe bekannt gegeben wurde, war ich gleich in meinem „Bastelfieber“. Ich dachte bei so „Kleinen“ kann man sicher was mit färbigem Papier in allen möglichen Formaten, Uhu und Photos machen. So entstand die Idee eines Forschungsbüchleins. Wir erkundigten uns bei den Skripten der vorigen Kurse und bei Peter nach den dort auffindbaren Pflanzen und begannen so unser Projekt. Nachdem Informationsmaterial aus den angegebenen Büchern und Photos aus dem Internet gesammelt waren, machten wir uns zur Didaktik Gedanken. Dass wir eine fixe Station machen, an der wir das Pflanzenmaterial herzeigen, schlossen wir von Vorhinein aus. Die Professoren wiesen uns darauf hin die Eigenaktivität der Schüler zu fordern und so entstand der Gedanke die Schüler nach Pflanzen suchen zu lassen. Zu Beginn planten wir 5 Minuten ein um die Schüler ans Thema heranzuführen. Das sollte durch Fragen wie „Warum braucht eine Pflanze einen Abwehrmechanismus?“, „Wovor muss sich eine Pflanze überhaupt schützen?“ geschehen. Nach Erklärung der unterschiedlichsten 50 Ulrike Derks & Sarah Merschitz: Abwehrstrategien von Pflanzen Konzept bei beiden Schulstufen anzuwenden und uns überraschen zu lassen. Reflexion Mechanismen sollten dann die Schüler ans Werk. Wir fertigten die Forschungsbüchlein an und druckten Bilder von Pflanzen aus. Die ausgedruckten Photos sollten den Pflanzen beigelegt und somit die Suche erleichtert werden. Nach jeder gefundenen Pflanze sollte dann das Photo eingeklebt und die wichtigsten Erläuterungen hineingeschrieben werden. Nachdem wir alle Pflanzen gesehen hatten sollten sich die Schüler das Trichom des Brennesselhaares im Binokular ansehen. Als Abschluss hatten wir einen Lückentext vorbereitet (im Forschungsbuch eingeklebt), der als Festigung dienen sollte. Dieses Konzept hatten wir eigentlich als ganz gut empfunden bis wir erfahren haben, dass uns am ersten Tag eine 7. Klasse besuchen kommt. Nach längerem Hin und Her beschlossen wir das gleiche In Marchegg angekommen fing Ulli mit der Schneidarbeit der Photos an und ich machte mich auf die Suche der Pflanzen. Hierbei stießen wir gleich auf das erste Problem. Die meisten Pflanzen waren im Umkreis von ein paar Metern zu finden, für den Weißdorn musste man schon ein Stück gehen. Dadurch wir die Bilder schon vorbereitet hatten mussten wir mit den Schülern natürlich die auserwählten Pflanzen bearbeiten. Wir hatten Angst dass die Schüler nach einer längeren Strecke die Aufmerksamkeit verlieren. Für mich war Marchegg die erste Unterrichtserfahrung überhaupt, dementsprechend nervös war ich als die Schüler plötzlich vor uns standen. Wir spulten unseren Auftritt sozusagen herunter und achteten dabei weniger auf Reaktionen der Schülerseite, einfach dadurch weil wir so konzentriert auf unsere Rollen und unser Konzept waren. Das war auch ein Punkt den wir beim Feedback der „Critical Friends“ zu Hören bekamen. Es dauerte eine Zeit lang, bis wir so weit waren den „Unterricht“ für Fragen oder Einbringungen der Schüler zu öffnen. Im Gegensatz zu unseren Erwartungen war das Forschungsbuch nicht zu „kindlich“ für die 7. Klasse. Ohne Beanstandungen schrieben sie mit und machten sich Notizen. Die Bilder ließen wir erst am Schluss einkleben, da es durch das Umhergehen unpraktisch war. Die Schüler 51 Ulrike Derks & Sarah Merschitz: Abwehrstrategien von Pflanzen waren sehr aktiv und machten auch bei den „Verkostungen“ von Löwenzahn, Lauch und Kerbel fast ausnahmslos mit. Bei der umstrittenen Frage ob man die Unterschiede von Stacheln und Dornen nun erarbeiten soll oder nicht, entschieden wir uns dafür nur bei genauerem Nachfragen der Schüler darauf einzugehen. Es ist uns allerdings der Fehler unterlaufen: ein Schüler sagte: „der hat ja Dornen“, wir antworteten darauf: „nein, dass sind Stacheln“ und gaben aber keine weiterführenden Erklärungen. Somit einigten wir uns darauf das nächste Mal einfach mit „Ja“ zu antworten. Ein weiterer Kritikpunkt war, die Coevolution nicht ausreichend erwähnt zu haben – den tieferen Sinn nicht richtig vermittelt zu haben. Das haben wir auch in der Vorbereitung verabsäumt. Bei unseren Vorbereitungen haben wir uns genau mit den Pflanzen auseinandergesetzt, aber die Frage nach dem „Warum“ haben wir uns selbst nicht gestellt. Dieses Vorhaben wurde uns am 2. Tag, durch die Aufnahme der Osterluzei in unser Programm, erleichtert. Anhand dieses Beispiels war die „Geschichte mit der Evolution“ für die Schüler verständlich geworden, und die Giftigkeit kam uns auch zu Gute, denn was gibt es „cooleres“ als Gift?! Bei der ersten Klasse entschlossen wir uns außerdem dazu die Forschungsbücher überhaupt erst am Ende zu bearbeiten. Erstens wieder aus praktischen Gründen und zweitens hatten wir dadurch eine intensivere Festigungsphase. Den Beginn krempelten wir auch total um, da es irgendwie nicht sinnvoll ist von chemischen und mechanischen Mechanismen zu reden ohne ein Beispiel in der Hand zu haben. Somit strichen wir den Einstiegsteil und schickten sie gleich auf Pflanzensuche. Hier allerdings machten wir bei der ersten Gruppe den Fehler ungenaue Angeben gegeben zu haben. Mit „Was fällt euch hier auf“ werden nicht viele Ergebnisse kommen. So griffen wir zu unserem Joker und stahlen Teile des Konzeptes des Vorjahresgruppe. Wir teilten Ihnen Tiere zu und gaben ihnen den Auftrag die Welt mit den Augen z.B.: eines Hasen zu sehen. Wir gaben Ihnen Anreize, wie z.B.: eine Cola Flasche in den Brombeeren. Dieser Schüler wird nicht mehr ohne zu Schauen in ein Gestrüpp greifen. Mit diesen Mitteln hat es dann ganz gut funktioniert und dass sie Pflanzen einfach so kosten können war für sie ein Highlight. Das Brennesselhaar unter dem Binokular war wie auch von den Vorjahren bekannt, ein „Renner“. Die Schüler wollten plötzlich alles Mögliche unter die Binokulare legen und beobachten. Hat es den zeitlichen Rahmen nicht zu sehr gesprengt, haben wir es auch gemacht. Was uns selbst aufgefallen ist, war dass die Unterscheidung mechanisch – chemisch oft nicht klar war. Wir haben das Problem so gelöst, dass wir es nicht mehr erwähnten. Überhaupt haben wir gelernt von den Begrifflichkeiten wegzugehen 52 Ulrike Derks & Sarah Merschitz: Abwehrstrategien von Pflanzen und das Augenmerk auf die momentanen Errungenschaften zu legen. Ulli und ich waren am 2. Tag viel sicherer und somit auch den Schülern gegenüber offener. Dadurch war das Unterrichten viel lebendiger und lustiger als am Vortag. Das Fachwissen muss schon vorhanden sein, aber man kann noch so viel wissen, wenn man nicht weiß wie man es aufbereitet, ist man quasi verloren. Die Hinweise der „Critical Frieds“ waren sehr hilfreich, v.a. jene die direkt danach folgten. Ich habe nach Marchegg im Zuge zweier Praktika Unterrichtsstunden gehalten und mir wesentlich leichter getan als in Marchegg am ersten Tag. An dieser Stelle ein großer Dank an alle Betreuenden für diese lehrreiche Erfahrung. Literatur Harborne, Jeffrey B. (1995): Ökologische Biochemie. Strasburger, E. (Begr.) (1991): Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Düll, R.; Kutzelnigg H. (1994): Botanischökologisches Exkursionstaschenbuch. Roth, Lutz, Daunderer, Max und Kormann, Kurt: Giftpflanzen, Pflanzengifte. Giftpflanzen von A-Z. Notfallhilfe. Allergische und phototoxische Reaktionen. Vorkommen, Wirkung, Therapie. 53 Der Baum als Lebensraum von Klaudia Wendl und Karin Windsteig Fachlicher Teil „Wie kommt das Wasser in die Krone der Bäume?“ Landpflanzen sind – wie alle Lebewesen – auf Wasser angewiesen. Dazu haben die Pflanzen ein Wurzelsystem für die Aufnahme von Wasser aus dem Boden, Spaltöffnungen zur kontrollierten Wasserabgabe über die Blätter, Vakuolen als Speichersystem in den Zellen und ein hoch entwickeltes Leitungssystem, dass den Transport des Wassers in alle Teile der Pflanze ermöglicht, entwickelt. Der Transport wird dabei nicht durch eine Pumpe bzw. Überdruck, sondern durch die Sogwirkung der Transpiration angetrieben. Der Transport des Wassers findet im sogenannten Xylem (Holz) der Pflanzen statt. Tüpfel sind kleine Verbindungen der Leitgefäße (Tracheiden). In Laubbäumen wird die Wasserleitung vor allem durch die Tracheen bewerkstelligt. Diese sind bis zu mehrere Meter lange, aus einzelnen Zellsegmenten zusammengesetzte und ebenfalls über Tüpfel verbundene Röhren. In vielen ringporigen Hölzern sind die größten Tracheen sogar mit dem freien Auge sichtbar. Sowohl bei den Tracheiden als auch bei den Tracheen handelt es sich um bereits abgestorbene Zellen. Die durch die Transpiration erzeugte Zugspannung wird über durchgehende Wasserfäden von den Blättern bis in den Boden übertragen. Durch die besonderen physikalischen Eigenschaften des 54 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Wassers, starke Kohäsions- und Adhäsionskräfte sowie die enorme Oberflächenspannung ist die Flüssigkeitssäule in den Pflanzen so stabil, dass es auch bei großem Sog nicht zu einem Abreißen der Wasserfäden kommt. So ist es möglich, dass Wasser auch in große Höhen – Mammutbäume erreichen über 100 m – ohne Energieaufwand transportiert werden kann. Die Fähigkeit von Bäumen, derart in die Höhe zu wachsen und sich damit Lichtkonkurrenten vom Leibe zu halten ist mit einigen Problemen behaftet bzw. bedarf bestimmter Anforderungen an ihren Vegetationskörper. Wasserkreislauf Der Wasserkreislauf ist eher physikalischer als chemischer Natur, er besteht vorwiegend aus dem Wechsel zwischen flüssiger und gasförmiger Phasen sowie Transportvorgängen. Nur wenig Wasser wird im Ökosystem chemisch verändert. Die wichtigsten Ausnahmen sind die Spaltung des Wassermoleküls in Wasserstoff und Sauerstoff durch den Prozess der Photosynthese sowie die Bildung von Wasser in der Atmungskette (aber beide nur in minimalen Anteilen). Zum Wasser Neben der Transpiration an den Spaltöffnungen der Blätter ist die Physik des Wassers (Kohäsions - und Adhäsionskräfte sowie die Oberflächenspannung) für den Wassertransport in den Leitgefäßen der Bäume ausschlaggebend. Wasserexperimente: „Das Wasser fließt bergauf!“ Material: 2 Gläser/Becher (am besten durchsichtig), Kiste oder Box (als Erhöhung), 1 Strohalm zum Abknicken Durchführung: 1. Fülle ein Glas mit Wasser und stelle es auf die Box. Das andere stellst du auf den Boden, dadurch steht es tiefer als das Glas auf der Box. 2. Halte den Strohhalm in das volle Glas und sauge an ihm. Ist der Strohhalm mit Wasser gefüllt, hältst du das Ende an dem du gesaugt hast mit einem Finger zu. 3. Halte nun den Strohhalm in das noch leere Glas und nimm den Finger von der Öffnung. Was passiert? Das Wasser fließt durch den Strohhalm in das andere Glas. Es fließt bergauf! Wie funktioniert das? Das Gewicht des Wassers im zweiten, etwas längeren Teil des Strohhalms ist ein wenig größer als der Teil des Strohhalms, der im Wasser eingetaucht ist. Das Wasser läuft aus dem längeren Teil ab, weil die Kraft (die sogenannte Kohäsionskraft) 55 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum dafür sorgt, dass das Wasser zusammen bleibt. Die Wasserteilchen im längeren Teil ziehen sozusagen das Wasser aus dem kürzeren Teil hinterher. Daher kann das Wasser auch bergauf fließen, weil oben am Knick das Wasser in dem längeren Strohhalm das Wasser aus dem kürzeren Stück mit auf seine Seite zieht. Variante: Du kannst anstelle des Strohhalms auch ein Handtuch benutzen! „Die schwimmende Büroklammer“ Eigentlich schwimmt Metall nicht – es kommt aber darauf an, wie geschickt man sich anstellt… Was passiert, wenn du eine Büroklammer ins Wasser fallen lässt? – Genau! Sie geht unter und das auch ziemlich schnell. Wenn du es aber schaffst, sie ganz flach auf das Wasser zu legen, dann schwimmt sie. Am besten geht das, indem du sie mit einer zu einem L gebogenen Klammer herunter lässt, oder wenn du sie auf einen Finger legst und dann den Finger samt Klammer ganz langsam untertauchst. Sei aber nicht enttäuscht, wenn es nicht auf Anhieb klappt - es braucht etwas Übung und sehr viel Fingerspitzengefühl. Tipp: Wenn du nicht so viel Fingerspitzengefühl hast und dir die Klammer immer untergeht, dann kannst du sie auch auf ein Stück Löschpapier legen. Wenn du das Papier dann auf die Wasseroberfläche legst, geht das Papier unter, und die Klammer schwimmt. Wie funktioniert das? Warum schwimmt die Klammer? Tja, aus demselben Grund, warum auch Wasserläufer auf dem Wasser gehen können. Der Grund ist die sogenannte Oberflächenspannung des Wassers. Das Wasser scheint so etwas wie eine Haut zu besitzen. Das kann man auch sehen, wenn man sich die schwimmende Büroklammer genauer anschaut. Sie scheint sogar das Wasser einzudrücken. Wo kommt die Oberflächenspannung her? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Das Wasser besteht (wie alle anderen Stoffe auch) aus unvorstellbar winzigen Molekülen, die wiederum aus den einzelnen Atomen zusammengesetzt sind. Aufgrund der besonderen Form der Wassermoleküle ziehen sich diese gegenseitig an. In einem Behälter mit Wasser fällt einem das nicht auf, denn da jedes Molekül von seinem linken und seinem rechten Nachbarn und gleichzeitig von seinem oberen und unteren Nachbarn angezogen wird, gleichen sich die Kräfte wieder aus. Alle Moleküle ziehen schließlich gleich stark. Die obere Schicht der Wassermoleküle hat aber keinen oberen Nachbarn. Also gleichen sich die Kräfte hier nicht aus, und die obere Schicht wird nach innen gezogen. Diesen Effekt bemerkt man zum Beispiel bei einem Wassertropfen. Er hat immer eine kugelrunde Form, da alle äußeren Moleküle stark nach innen gezogen werden. Daher besitzt nun die Wasseroberfläche eine besondere Festigkeit und wirkt fast wie eine Gummihaut. Manche Tiere, wie dieser Wasserläufer, nutzen die Oberflächenspannung, um sich auf der Wasseroberfläche fort zu bewegen. Spülmittel bewirkt nun, dass die Oberflächenspannung zerstört wird. Die Moleküle der Seife oder des Spülmittels oder was auch immer schieben sich sozusagen zwischen die Wassermoleküle, so dass die Festigkeit verloren geht. Diesen Effekt nutzt man beim Abwaschen aus. Das Fett, das man noch am Topf kleben hat, lässt sich ja vom 56 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Wasser nicht wegspülen, weil die Wasseroberfläche einen zu starken Zusammenhalt hat. Wenn nun das Spülmittel diesen Zusammenhalt zerstört, durchmischen sich Wasser und Fett, und man kann das Fett mit dem Wasser wegspülen. „Aus 3 mach 1“ Material: 1 leeren Getränkekarton, 1 spitzen Gegenstand (z.B. Spießchen), Wasser Versuch: 1. Stich an der Seite des Kartons, knapp über dem Boden, mit den Spießchen drei Löcher nebeneinander, die etwa einen halben Zentimeter Abstand voneinander haben. Die Löcher dürfen nicht zu klein sein! 2. Fülle den Karton mit Wasser (Du erhältst 3 Wasserstrahlen) 3. „Zwicke“ die drei Wasserstrahlen mit Daumen und Zeigefinger nahe am Karton zusammen oder fahre mit dem Finger über die Löcher Was passiert? Plötzlich hast du nicht mehr drei einzelne kleine Strahlen, sondern einen einzigen großen, der aus den drei Löchern im Karton kommt. Warum ist das so? Wasser zieht sich selbst wie magisch an. Das liegt an den kleinen Teilchen, aus denen es besteht, den Wassermolekülen. Sie bestehen aus Sauerstoff O und Wasserstoff H. Dass sich die einzelnen Wassermoleküle H2O gegenseitig so stark anziehen, bewirkt die sogenannte Oberflächenspannung des Wassers, die etwa dafür verantwortlich ist, dass Wasser runde Tropfen bildet – am Fenster, auf der Haut, im Waschbecken. Sie sorgt dafür, dass Wasser immer eine Oberfläche bildet, die so klein wie möglich ist. Und genau das passiert in deinem Experiment: Die Oberfläche des gemeinsamen Strahls ist deutlich kleiner als die der drei einzelnen Strahlen zusammen. D der Abstand der Wasserstrahlen in deinem Versuch jedoch zunächst zu groß ist, musst du sie mithilfe deines Fingers erst davon „überzeugen“ zusammenzugehen. Fette Augen: Jede Suppe mit Fettaugen ist ein leckeres und spannendes Labor, um dem Rätsel „Oberflächenspannung“ auf die Spur zu kommen. Auch bei fleißigstem Umrühren bilden sich immer wieder kreisrunde Fettaugen, die sich rasch zu größeren Fettaugen zusammenschließen. Dafür gibt es zwei Ursachen: Zum einen ist die Reibung der Fettaugen auf der Suppe (Wasser) sehr gering, sodass sie sich gut auf der Suppe gleitend hin und her bewegen können. Zum anderen sind sie bemüht, stets die kleinstmögliche Oberfläche anzunehmen. Das ist immer die Kreisform. Das heißt, mehrere kleine Fettaugen, die sich zu einem großen zusammenschließen, haben dann zusammen eine geringere Oberfläche als die einzelnen Augen zusammengenommen. Wo kommt das vor? Beim Brausenkopf der Dusche müssen die Löcher, aus denen das Wasser kommt, einen bestimmten Mindestabstand haben, damit die Strahlen auch getrennt voneinander abstrahlen können. Kommt nur wenig Wasser aus der Brause, kannst du sehen, dass das Wasser aus den Löchern gerne am Duschkopf entlang kriecht und dann gemeinsam herunter rinnt. Erst bei einem höheren Wasserdruck werden die Strahlen in einzelne auseinander gerissen. In der Geschirrspülmaschine sind Wassertropfen unerwünscht, weil sie auf dem Geschirr meist Kalkflecken hinterlassen. Deshalb benutzt man Klarspüler: Er setzt die Oberflächenspannung des Wassers herab, und es bildet sich ein dünner Wasserfilm auf dem Geschirr, der schneller und ohne unansehnliche Spuren trocknet. 57 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Kohäsion der Wasserstoffbrücken: Von einem Blatt verdunstetes Wasser wird sofort durch Wasser aus den Gefäßen in den Blattnerven ersetzt. Die Wassermoleküle, die von dort austreten, üben durch ihre Wasserstoffbrücken einen Zug auf die Moleküle weiter unten im Gefäß aus. Dieser aufwärts gerichtete Sog setzt sich entlang des Gefäßes bis in die Wurzel hinab fort. Die Adhäsion, das Aneinanderheften zweier unterschiedlicher Stoffe, spielt hier ebenfalls eine Rolle, da die Adhäsion von Wasser an die Gefäßwände dazu beiträgt, dem Zug der Schwerkraft nach unten entgegenzuwirken. Verwandt mit der Kohäsion ist die Oberflächenspannung. Diese macht es z.B. möglich, Steine über einen Teich hüpfen zu lassen. „Morgens sind Bäume dicker als abends“ Das Holz ist doch viel zu starr, um dicker zu werden. Verantwortlich für die täglichen Schwankungen ist der Wassergehalt eines Baumes. Tagsüber geben Bäume Feuchtigkeit über die Blätter ab. Dadurch verliert der Baum schneller Wasser, als er durch die Wurzeln aufnehmen kann und „schrumpft“. Nachts dagegen, wenn die Sonne nicht mehr scheint, nimmt der Baum über die Wurzeln soviel Wasser auf, dass er anschwillt und daher früh morgens am dicksten ist. Möglich machen diese Veränderungen der Rinde und die unter ihr liegende Zellschicht, die viel elastischer ist als Holz. Sie dehnen sich durch die Wasseraufnahme aus bzw. ziehen sich wieder zusammen, wenn der Baum Wasser abgibt. Das Holz des Baumes verändert sich dagegen nicht. Jedes Tier und jede Pflanze haben ihren speziellen Lebensraum. Dort fühlen sie sich wohl und finden ausreichend Nahrung. Sie sind an diesen Lebensraum am besten angepasst. Lebensgemeinschaften mit den Bäumen Der Baum bietet einer Vielzahl von Organismen einen Lebensraum. Betrachtet man einen Baum genau, so fällt einen (sic!) sofort auf, dass sich Ameisenstraßen entlang der Bäume ziehen, möglicherweise flieht gerade ein Eichhörnchen über die Äste der Bäume in sein Versteck, während Käfer die Blätter des Baumes anfressen sowie ein Vogel im Schutz der Äste ein Lied trällert. Pilze Pilze bilden heute neben den Tieren und den Pflanzen eine eigene systematische Gruppe. Sie kommen heutzutage größtenteils am Land vor, einige Arten leben im Wasser. Pilze besitzen keine Chloroplasten und sind aus diesem Grund auch nicht zur Photosynthese befähigt. Ihre Zellwände bestehen aus Zellulose (nur bei den Eipilzen) oder Chitin, das auch im Außenskelett der Insekten enthalten ist. Pilze bilden kein echtes Gewebe; sie sind aus einzelnen Fäden aufgebaut, die man Hyphen nennt. Sporen werden bei höheren Pilzen im Fruchtkörper gebildet und durch den Wind verbreitet. Sie ernähren sich entweder saprotroph, parasitisch oder leben in symbiotischen Lebensgemeinschaften. Zu den höheren Pilzen zählen die Töpfchenpilze, Jochpilze, Schlauchpilze sowie die Ständerpilze. Zu den Ständerpilzen gehören jene Arten, die wir als „Schwammerl“ bezeichnen. 58 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Pilze als Holzzerstörer: Das Holz abgestorbener Bäume wird in der Natur durch die Pilze abgebaut. Die Ständerpilze sowie die Schlauchpilze zählen zu den wichtigsten Holzabbauern. Es gibt Holzzerstörer, welche die lebenden Bäume bereits als Parasiten befallen, wie der Wurzelschwamm, der Erreger von Fäulen der Kiefer und Fichte, sowie der Feuerschwamm, der Laubbäume befällt. Es gibt auch Pilze, die primär saprotroph in abgestorbenen Baumstümpfen leben, aber auch auf lebende Bäume übergehen können. Bei parasitischen Gattungen liegt zumeist eine Spezialisierung auf den Wirt vor. Als gefährliche Bauholzzerstörer sind der Kellerschwamm und der Hausschwamm zu nennen. Bei der Holzzerstörung durch Pilze unterscheidet man zwei Arten: die Braun- und die Weißfäule. Bei der Braunfäule wird nur die Zellulose abgebaut, der Ligninanteil bleibt erhalten, bei der Weißfäule wird beides abgebaut, der Ligninsowie der Zelluloseanteil. Andere Pilzarten kommen im Bodenstreu des Waldes vor, die Blätter oder Nadeln abbauen. Sie tragen somit wesentlich zur Humusbildung bei. Pilze als Symbionten: Die wohl wichtigste Lebensgemeinschaften eines Pilzes ist die Symbiose mit der Wurzel einer höheren Pflanze. Diese Symbiose ist vor allem für einige Nadelbäume von großer Bedeutung, aber auch bei Kulturpflanzen ist diese Symbiose, Mykorrhiza genannt, durchaus üblich, wie bei Erdbeere, Tomate oder Erbse. Ein Mantel aus Pilzfäden umschließt die Wurzelspitzen oder Seitenwurzeln der Bäume; einige Pilzarten können sogar in die Wurzel eindringen. Der Pilz erhält von der Pflanze einfache Kohlenhydrate, Vitamine und Wachstumsfaktoren, eben alles, was der Pilz selbst nicht herstellen kann. Im Gegenzug ermöglicht die Pflanze dem Pilz vermehrte Wasseraufnahme durch die Oberflächenvergrößerung, Erhöhung des Stoffwechsels sowie erhöhte Nährstoffaufnahme. Die Pilze leben oft nur mit bestimmten Bäumen in Symbiose. 59 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Flechten Einige Pilzgruppen leben mit Algen zusammen und bilden somit eine eigene morphologische Einheit. Es handelt sich hier um einen gemäßigten Parasitismus, denn der Wirt ist immer kleiner als der Parasit und in dessen Körper integriert. Der Pilz entnimmt der Alge Assimilate und kann ohne die Alge nicht existieren. Auf der anderen Seite ermöglicht der Pilz der Alge die Erschließung neuer Besiedlungsräume, welche die Alge alleine nie bewältigen könnte. Sie sind somit auch widerstandsfähiger gegen Kälte oder Trockenheit. Sie gelten als Bioindikatoren, da sie auf Schadstoffe äußerst empfindlich reagieren. Als Algenpartner treten vor allem die Grünalgen auf, als Pilzpartner sind die Schlauchpilze üblich, selten ebenfalls Ständerpilze. Man teilt Flechten in Krusten-, Laub-, Strauch- oder Bartflechte ein. Krustenflechten finden auf der Oberfläche von Rinde oder Steinen einen neuen Lebensraum. Sie sind fest mit der Unterrinde verwachsen. Laubflechten kommen oft auf der Rinde von Bäumen vor. Diese Flechten können von der Unterlage vorsichtig gelöst werden. Sie reagieren empfindlich gegenüber Luftschadstoffen. Strauchflechten weisen einen strauchartigen Wuchs auf und sind typische Bodenbewohner. Bartflechten haben eine hängende Lebensweise auf den Ästen von Bäumen. Diese Flechten sind besonders empfindlich gegenüber Luftschadstoffen. Algen Algen sind einzellige oder mehrzellige Lebewesen, die im Süß- oder im Meerwasser vorkommen. Die Algen sind zur Photosynthese befähigt. Es gibt aber auch so genannte Luftalgen, die Baumstämme und Gesteinsflächen der Schattenseite besiedeln. Besonders häufig leben Luftalgen auf Blättern in den feuchten Tropengebieten. Bodenalgen sind ebenfalls weit verbreitet, allerdings noch wenig erforscht. Tiere Zahlreiche Kleinlebewesen, die mit freiem Auge kaum sichtbar sind, finden in Ritzen und Klüften der aufgesprungenen Borke ein Zuhause. Dort leben vor allem Springschwänze, Milben oder Bücherskorpione, aber auch Kokons von Schmetterlingen sind dort vorzufinden. Gliederfüßer: Spinnentiere, Krebstiere, Tausendfüßer sowie Insekten zählen zu dem Stamm der Gliederfüßer beziehungsweise Arthropoden. Wie schon der Name sagt, ist ihr Körper gegliedert. Ein besonderes Merkmal der Gliederfüßer ist, dass das Außenskelett aus Chitin ist. Spinnentiere: Die Spinnentiere unterscheiden sich von anderen Tierstämmen durch eine Gliederung in ein Prosoma und Opisthosoma sowie durch den Besitz von vier Beinpaaren. Weiters besitzen Spinnentiere Punktaugen – bei den Spinnen zumeist acht Punktaugen, einzige Ausnahme bildet die Sechsaugenspinne, die folglich nur sechs Augen besitzt – im Gegensatz zu den Insekten, die Facettenaugen besitzen. 60 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Zecken: Zecken gehören zu den Milben. Sie werden circa 2-4 mm groß. Das Weibchen lebt als Blutsauger auf verschiedensten Wirbeltieren. Dabei bedienen sie sich eines Stechapparats mit Widerhaken, die in das Wirtstier eingetrieben werden. Nachdem es mit Blut angesaugt ist, steigt seine Körperlänge auf 10 mm. Das Weibchen verlässt in diesen Zustand dann den Wirt und legt bis zu tausend Eier. Zecken gelten als Überträger gefährlicher Krankheiten wie Hirnhautentzündung und Borelliose, deshalb ist eine Impfung unbedingt wichtig. Sie kommen vor allem in Wäldern vor. Der Befall erfolgt zumeist dann, wenn ein Wirt mit dem Aufenthaltsort der Zecke in Berührung kommt – dazu reicht nur ein kurzes Streifen des Aufenthaltsortes. Insekten: Die Insekten stellen eine mannigfaltige Gruppe innerhalb der Arthropoden dar. Sie zeichnen sich durch den typischen Körperbau aus, der sich in Kopf, Brust und Hinterteil gliedert. Auf den Kopf befinden sich die wichtigsten Sinnesorgane, dazu gehören die Antennen, sowie die zumeist kauend-beißenden Mundwerkzeuge, die aber oft Abwandlungen erfahren, wie zum Beispiel Stechrüssel oder Saugrüssel. Neben Facettenaugen besitzen die Insekten noch Ocellen, die als Lichtsinnesorgane fungieren. Die Brust teilt sich in drei Segmente und dient der Lokomotion. Somit sind sie im Besitz von drei Beinpaaren. Auf den beiden ersten Segmenten sind Flügelpaare vorhanden, entweder zwei oder ein Flügelpaar. Eine Ausnahme innerhalb dieser Klasse bilden die flügellosen Insekten. Man unterscheidet bei den Insekten zwischen hemimetaboler (unvollständiger) und holometaboler (vollständiger) Entwicklung. Bei der hemimetabolen Entwicklung sind verschiedene Larvenstadien vorhanden, die sich schließlich zum erwachsenen Insekt umwandeln, wogegen das Insekt bei der holometabolen Entwicklung Metamorphosen über Larven und Puppen durchläuft, aus dem sich dann das erwachsene Insekt entwickelt. Als typisches Beispiel für eine holometabole Individualentwicklung gelten die Käfer und Schmetterlinge. Käfer: Buchdrucker: Ihre Größe liegt zwischen 4-5 mm. Diese Käfer sind dunkelbraun gefärbt und deutlich behaart. Die Körperform ist zylindrisch und besitzt eine abgestutzte Fläche am Hinterende. Der Buchdrucker gehört zu der am meisten gefürchteten Waldschädlingen. Die Fraßmuster sind leicht sichtbar an geschädigten Bäumen. Sein Vorkommen ist vor allem an Fichten häufig. Üblicherweise befällt er nur abgestorbene Fichten, jedoch kommt es auch immer wieder vor, dass er gesunde Bäume befällt und kann somit hohen Schaden anrichten. Unter der Rinde legen die Weibchen Gänge, von denen seitlich kleine Nischen abgehen, in die sie ihre Eier legen, sowie Luftlöcher, welche eine Verbindung mit der Außenwelt darstellen, an. Wenn die Larven schlüpfen fressen sie einfach weiter. Hirschkäfer: Der Hirschkäfer ist der größte heimische Käfer mit einer Größe von 25-75 mm. Er zeigt eine Färbung von einem dunkel-rotbraunen bis schwarzen Kopf mit einem Halsschild. Der Oberkiefer des Männchens ist zu riesigen, hirschgeweihartigen Zangen geformt. Er kommt sehr oft in Eichenwäldern vor. Durch den mächtigen Oberkiefer kann der Käfer keine Nahrung mehr zerkleinern, das Weibchen kann problemlos Nahrung zerkleinern, da es keinen so großen Oberkiefer aufweist. Hirschkäfer ernähren sich 61 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum durch das Aufsaugen von Pflanzensäften mit ihrer Unterlippe. Oft kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den Männchen, die damit enden, dass ein stärkeres Männchen das schwächere auf den Rücken wirft. Danach erfolgt die Paarung. Das Weibchen legt anschließend die Eier in den Boden. Balkenschröter: Der Balkenschröter ist ein Verwandter des Hirschkäfers und wird bis zu 32 mm groß. Der Kopf des Männchens ist so breit wie das Halsschild und besitzt kräftige, nach innen gebogene Oberkiefer. Der Oberkiefer der Weibchen ist viel schmäler. Sie kommen in feuchten Laubwäldern häufig vor. Die Larve entwickelt sich zumeist im morschen Holz der Laubbäume. Hautflügler: Ameisen: Ameisen stellen eine bedeutsame Überfamilie der Hautflügler dar. Typisch für diese Tiergruppe ist ihre soziale Lebensweise, so ist eine einzelne Ameise alleine nicht überlebensfähig. Ein Ameisenstaat besteht demnach aus einer Königin und ihren direkten Nachkommen. Die Aktivität der Ameisen beschränkt sich auf die Erfüllung der Bedürfnisse des gesamten Staates. Viele Ameisen leben im alten oder auch totem Holz und zerfressen somit das Holzinnere. Neben dem Ökosystem Wald spielen sie auch in anderen Ökosystemen der Erde eine bedeutende Rolle. Viele Ameisenarten sind Allesfresser und Räuber. Überschüssige Nahrung wird von den Ameisen als Nahrungsvorrat angelegt. Die Weibchen sind für kurze Zeit beflügelt und sie sind auch der Grund für das explosive Anwachsen der Populationen. Zudem ermöglichen sie die große Verbreitung dieser Tiere. Schlupfwespe: Die Larven der Schlupfwespe leben als Parasiten in oder an anderen Insekten. Ihre Größe liegt zwischen 0,2 bis 7 cm. Die Weibchen zeichnen sich durch besonders langen Legebohrer aus. Die Nahrung besteht größtenteils aus angestochenen oder angebissenen Wirtstieren, aber auch süße Pflanzensäfte werden gefressen. Die Wirtsfindung findet meist durch das Weibchen statt. Die Eiablage erfolgt zumeist direkt in den Wirt, seltener auch in der Nähe des Wirts. Der Wirt stirbt am Ende. Der Baum stellt für andere Hautflügler ebenfalls einen wichtigen Lebensraum dar, so leben Wildbienen, Grab- und Wegwespen sowie solitäre Faltenwespen auf den Bäumen. Die Wespen tragen gelähmte Blattläuse, Fliegen oder auch Spinnen in ihre Nester auf den Baum, um mit diesen Tieren ihre Larven zu ernähren. Die Tatsache, dass die Tiere nur gelähmt und nicht tot sind, stellt einen Vorteil dar, denn so bleibt das Fressen frisch. Hornissen beißen einen Gang in morsches Holz und überwintern dort oder sie bauen in einer Baumhöhle ein kleines Hornissennest. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass ein kleiner Streit zwischen Waldmaus und Hornisse um eine kleine Höhle im Baum ausbricht, doch die Waldmaus muss sich zumeist dann geschlagen geben. Vögel: Vögel sind Landwirbeltiere, deren gesamter Körper von Federn bedeckt ist. Die Federn dienen als Kälte- und Wärmeschutz. Eine besonders wichtige Rolle spielt das Federkleid beim Balzverhalten dieser Tiere. Sie sind homoiotherme (gleichwarme) Wirbeltiere, das heißt sie besitzen immer eine konstante Körpertemperatur. Besondere Kennzeichen der Vögel sind neben ihren (sic!) 62 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Stimmkopf, Syrinx genannt, der ein Pfeifen erzeugt, die luftgefüllten Knochen. Eine Festigkeit der Knochen ist dennoch gegeben durch eine feste Verwachsung der einzelnen Knochen. Die Vögel besitzen zwei Extremitätenpaare, wobei die vorderen zu Flügeln umgewandelt sind und mit Federn besetzt sind. Somit ermöglichen die Federn den Vögeln, sich problemlos in der Luft fortzubewegen. Die Federn werden regelmäßig in der Mauser neu gebildet. Nach der Befruchtung legen die Vögel Eier, die eine Kalkschale besitzen. Im Normalfall ziehen die Eltern ihre Jungen selbst auf, indem sie die Eier selbst ausbrüten und dann mit Nahrung verpflegen. Eine Ausnahme stellt der Kuckuck dar, der seine Eier in fremde Nester legt und die Aufzucht seiner Jungen anderen Vögel überlässt. Diesen Vorgang des Kuckucks bezeichnet man als Brutparasitismus. Vor allem Vögel nutzen den Lebensraum Baum. So dient der Baum als Nahrung oder auch als Brutplatz. Die Spechte sind auf das Klettern an senkrechten Baumstämmen sowie an das Zimmern von Nisthöhlen perfekt angepasst. Anpassungen an diese Lebensweise sind kräftige Füße mit beweglichen Zehen, zumeist zwei nach hinten gerichtete, scharfe Krallen sowie meißelförmige Schnäbel, was wiederum eine stoßdämpfende Schädelkonstruktion bedingt. Die Spechte ernähren sich von holzbewohnenden Insekten, die mittels einer langen Zunge aus den Gängen hervorgeholt werden. Viele Singvögel besitzen auffällige Stimmen, leben im Wald, Gebüsch oder höherer Vegetation. Ihr Gesang dient der Anlockung der Weibchen oder zur Verteidigung des Reviers. Häufige Singvögel sind Lerchen, Amseln und Pieper. Säugetiere: Bäume bieten auch einer Reihe von Säugetierarten einen wichtigen Lebensraum. Baumhöhlen bieten Siebenschläfern und verschiedenen Fledermausarten ein neues Zuhause. So nutzen die Fledermäuse im Sommer die Baumhöhle für die Aufzucht ihrer Jungen, im Winter dient es als Winterquartier für den Winterschlaf. Nachts dient der Baum den Fledermäusen als Jagdgebiet, von dem aus sie Mücken und andere kleine Insekten mit Hilfe ihrer Ultraschall-Echo-Orientierung orten. Auch Eichhörnchen oder Marder verwenden alte Baumhöhlen als Schlaf- oder Wohnplatz. Das Wurzelgeflecht im Boden bietet vor allem Waldmäusen Sicherheit. Das Eichhörnchen verwendet seinen langen Schwanz als Ausgleich, wenn es auf Nahrungssuche durch die Äste hüpft. Fachdidaktik Didaktische Reduktion 1. Teile Baum Durchführung: „Schau in den Himmel“ Aufgabe: Die Kinder legen sich auf den Rücken in die Wiese und betrachten die Baumwipfel aus einer anderen Perspektive. Anschließend wird der Aufbau/Teile des Baumes erarbeitet. Didaktik: Die Kinder sollen durch genaues Beobachten den Baum erforschen. Dabei sollen uns die Kinder ihre Beobachtungen schildern und vielleicht auch schon etwas über die Funktion erzählen. 2. Arbeitsblatt 63 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Aufgabe: Jedes Kind bekommt ein Arbeitsblatt auf welchem sie die Tiere den richtigen Positionen zuordnen sollen. Didaktik: Die Kinder sollen gleich einmal aktiv werden indem sie ihr bisheriges Wissen einsetzen. Neugierde soll geweckt werden – Habe ich alle Tiere richtig zugeordnet? 3. Überleitung zu den Pilzen und Tieren „Such mich“ Aufgabe: Es werden Bilder (vorbereitete Schilder) ausgeteilt und die Kinder machen sich auf die Suche nach den Pilzen und den Tieren. Haben sie diese gefunden, sollen sie das Bild an den Fundort stellen/stecken. Anschließend sollen die Kinder kurz etwas zu dem Tier oder der Pflanze sagen. Dokumentation am Baum: Die Tiere werden den zugehörigen Stockwerken zugeordnet. Didaktik: Sie sollen lernen, Strategien zu Pilzen und Tieren selbständig zu finden. Wo könnte ich zu suchen beginnen? Wo werde ich mein Beispiel auf keinen Fall finden? Info: Alle Aufgaben werden von uns angeleitet und begleitet. Die SchülerInnen sollen jedoch möglichst selbständig arbeiten. Wir stehen für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung und versuchen die gewonnenen Erfahrungen/ Beobachtungen am Ende jedes Spiels gemeinsam mit den SchülerInnen zusammenzufassen. Begriffe wie Parasitismus und Symbiose werden in diesem Zusammenhang besprochen. 3. Zusammenführen zum Lebensraum Baum Wir wissen, dass der Baum speziell angepassten Tieren und Pflanzen als Nahrung, Unterschlupf/Wohnraum, Brutplatz, Schutz, Jagdrevier … dient. Dazu wird der Baum in verschiedene Stockwerke eingeteilt, welcher jeweils seine Tiere beherbergt. Das diese Unterteilung möglich ist, muss der Baum im Vergleich zu anderen Lebensräumen wie z.B. die Wiese viel höher in den Himmel wachsen. Dadurch sind die Tiere in der Baumkrone geschützt oder können von dort aus besser jagen. Wie schafft es der Baum, dass er so groß wird? Dazu benötig er Sonnenenergie und Wasser (darin befinden sich Nähr- und Mineralstoffe). Reflexion: Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Es besuchten uns in Marchegg zwei Klassen: eine 1. Klasse AHS und eine 2. Klasse AHS. Die Kleingruppen legten unterschiedliches Vorwissen an den Tag und waren auch unterschiedlich lebendig oder still. Die Zeiteinteilung hat gut funktioniert, unsere Schülergruppen waren immer rechtzeitig bei uns. 64 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Zu Beginn wollten wir gemeinsam mit den SchülerInnen die Grundorgane einer Pflanze am Beispiel eines Baumes erarbeiten. Das Problem hierbei war allerdings, dass sich ein Schüler der 1. Klasse weigerte, sich auf den Boden zu legen, auch auf eine Decke wollte er sich nicht setzen. Er stand dann abseits von seiner restlichen Gruppe und er trug selbst auch nicht zu den LehrerSchüler-Gesprächen bei. Auch durch Fragen und Aufforderungen konnten wir ihn nicht motivieren mitzuarbeiten. Alle anderen Schüler und Schülerinnen hatten jedoch keine Probleme damit, sich auf den Boden zu legen. Die Experimente zum Wasserkreislauf des Baumes haben sowohl bei der 1. als auch bei der 2. Klasse sehr gut funktioniert. Die SchülerInnen stellten viele Fragen zu den Experimenten und es kam auch manchmal die Antwort: „Ich weiß, wie das geht, ich hab’ das bei Forscherexpress gesehen.“ Die Folien mit Bildern zu den verschiedensten Tieren, Pflanzen und Pilzen stellten am ersten Tag ein großes Problem dar, da die SchülerInnen, nachdem wir ihnen die Folien ausgeteilt haben, nicht wirklich wussten, was sie nun damit tun sollten oder auf was genau sie schauen sollten, was wohl dadurch zu Stande kam, dass wir ihnen keine klar formulierten Arbeitsaufträge gaben. Aus diesem Grund änderten wir das Konzept am 2. Unterrichtstag und stellten ein Arbeitsblatt zusammen, in dessen Lücken die SchülerInnen verschiedene Tiere einzeichnen sollten. Anschließend haben wir gemeinsam besprochen, wie diese Tiere leben. Dies hat, meiner Meinung nach, wesentlich besser funktioniert als am ersten Unterrichtstag ohne die Arbeitszetteln. Ebenso hatte ich das Gefühl, dass es den meisten SchülerInnen Spaß bereitete, die Tiere einzuzeichnen. Ebenso stellten sie wesentlich mehr Zwischenfragen als die Gruppen am Tag davor. Eine Gruppe aus drei Mädchen, welche bei den anderen Gruppen meistens negativ aufgefallen war, weil sie die ganze Zeit nur laut lachten und kreischten, war bei uns eine sehr aufmerksame Gruppe. Obwohl sie gerade von der Reptilien-Station gekommen sind, konnten wir sie mit unserem Arbeitsblatt und den Experimenten begeistern. Leider unterbrach uns in den letzen fünf Minuten der Regen, wodurch die Aufmerksamkeit der Mädchen dann blitzartig nachgelassen hatte. Ein Fehler von mir war es, die Flechten am ersten Unterrichtstag zu ausführlich zu besprechen, weil die SchülerInnen nicht wussten, was eine Flechte ist und es eher zu einem Vortrag wurde. Aus diesem Grund haben wir die Flechten dann ganz aus unserem Konzept am zweiten Tag herausgenommen. Die Aufteilung der „Sprechzeiten“ hat meiner Meinung auch sehr gut funktioniert, so haben wir uns gegenseitig nur selten bis fast gar nicht unterbrochen. Es ist wichtig auf die Fragen der Schüler und Schülerinnen einzugehen, was uns nicht immer leicht gefallen ist. Im Großen und Ganzen waren wir vor allem nach dem zweiten Tag sehr zufrieden und haben sehr viel dazugelernt. Lehrziele Lehrziele: Symbiose und Parasitismus, „Wie kommt das Wasser in die Krone?“ (Wasserkreislauf) und Aufbau des Baumes 65 Klaudia Wendl & Karin Windsteig: Der Baum als Lebensraum Literaturverzeichnis Braun, Helmut J. (1992): Bau und Leben der Bäume. Verlag Rombach GmbH & Co Verlagshaus KG, Freiburg im Breisgrau Brauns, Adolf (1964): Taschenbuch der Waldinsekten. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, Stuttgart Bresinsky, Andreas/Körner, Christian/u. a. (2008): Strasburger. Lehrbuch der Botanik. Spektrum akademischer Verlag, Heidelberg Hagenstein, Ingrid [Hrsg.] (2000): Alte Bäume – Lebensräume. In: Natur und Land. Zeitschrift des Österreichischen Naturschutzbundes, Wien Kelemen, Julia [Hrsg.] (1999): Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen. Umweltbundesamt, Wien Nultsch, Wilhelm (2001): Allgemeine Botanik. Georg Thieme Verlag, Stuttgart Starý, Bohumil [Hrsg.] (1990): Atlas der nützlichen Forstinsekten. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart Hecker, Joachim (2007). Noch mehr Experimente, Naturwissenschaft zum Ausprobieren (S104-105). Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim http://www.wsl.ch/forschung/forschungsunits/walddynamik/waldins ekten/totholz/insekten/hautfluegler_DE, 22. April 2009, 18:09 www.physikfuerkids.de/lab1/wasser/index.html www.g-buschbacher.de 66 Totholz von Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl Fachliches Lange Zeit wurde totes Holz aufgrund eines übertriebenen Ordnungszwangs und der falschen Meinung, dass Totholz die Schädlingsvermehrung fördert, aus unseren Wäldern entfernt. Dabei bietet totes Holz einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Organismen und hat auch eine wichtige Bedeutung für den Menschen zum Beispiel als Erosionsschutz in gebirgigen Regionen. Weitere wichtige Bedeutungen hat das Totholz als Anwuchshilfe und Mineralstoffspeicher im Gebirgswald. Es dient aber auch der Regulation des Wasserhaushaltes und als KohlenstoffSpeicher bewirkt es langfristig gesehen eine Milderung des Klimawandels. Mittlerweile sieht man die äußerst wichtige Rolle, die Totholz in unseren Wäldern spielt und lässt bei der Forstwirtschaft genügend davon liegen. Von zirka 13.000 Lebewesen, die im Wald leben, sind ungefähr 4.500 an das sowohl stehende als auch liegende Totholz gebunden. Für diese im Holz lebenden Organismen verwendet man den Ausdruck „Xylobionten“ von griechisch: „xylos“ – Holz und griechisch: „bios“ – Leben. Xylobionten leben sowohl auf totem als auch auf noch lebendem Holz und können Pflanzen, Pilze und Tiere sein. Die Xylobionten ernähren sich entweder von Holz, bewohnen es oder benutzen es als Substrat wie zum Beispiel Moose und Flechten. Totholz kann auf verschiedene Arten entstehen, wie durch natürliche Absterbeprozesse, durch Insektenbefall aber auch durch Naturgewalten wie Sturm, Schnee, Blitz oder Feuer. Aber auch durch die Forstwirtschaft entsteht Totholz, denn auch stehen gelassene Baumstrünke oder abgebrochene Äste sind Totholz. Das abgestorbene Holz ist ein unersetzlicher Lebensraum für viele Insekten, die bereits vom Aussterben bedroht sind. Ein Beispiel dafür ist der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo). 67 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz Aber nicht nur für Insekten spielt totes Holz eine große Rolle, auch Wirbeltiere wie Spechte finden dort Nahrung und auch Meisen, Kleiber und andere Vögel bauen in den entstandenen Höhlen ihre Nester und finden Unterschlupf im Totholz. Liegendes Totholz bietet Blindschleichen sowie Molchen und anderen Amphibien Versteck- und Überwinterungsplätze. Von Totholz bis Humus Bis ein Baum vollständig abgebaut ist, kann es hundert Jahre und länger dauern. Der Zerfall des Holzes erfolgt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit je nach Baumart, Holzstärke, Besonnung, Feuchtigkeit und Bodenkontakt. Der Abbau von Holz wird in drei Phasen eingeteilt: 1. Besiedelungs- oder Pionierphase 2. Zersetzungsphase 3. Humifizierungsphase Besiedlungs- oder Pionierphase In dieser ersten Phase wird das frisch abgestorbene Holz von den ersten im Totholz lebenden Organismen besiedelt. Diese Phase dauert ungefähr zwei Jahre. Dabei dringen die primären Xylobionten in das Holz ein und ernähren sich hauptsächlich von der Rinde und dem Splintholz. (Splintholz ist das junge, physiologisch aktive Holz unterhalb des Kambiums im Stamm eines Baumes.) Zu den primären Xylobionten zählen: - Borkenkäfer (Scolytidae) - Bockkäfer (Cerambycidae) - Prachtkäfer (Buprestidae) - Holzwespen (Siricidae) Wir haben in Marchegg die Larven und Puppen verschiedener Bockkäfer und den adulten Weberbock sowie den adulten Eichenbock gefunden. Die Eroberer des frisch abgestorbenen Holzes lösen die Rinde vom Holz und machen durch ihre Bohr- und Fraßtätigkeit Platz für weitere Insekten und Pilze. Ihre Bohrlöcher fördern den Angriff für Pilze und Verwitterung. Das so aufbereitete Material (Bohrmehl, Kot) kann von nachfolgenden Organismen leichter verarbeitet werden. Bereits am Ende dieser ersten Phase beginnt auch der mikrobielle Abbau durch Pilze. Die wichtigsten Pilze für den Holzabbau sind die Pilze, die Braunfäule und die Weißfäule verursachen. Braunfäule Die Braunfäule, auch Destruktionsfäule genannt, ist eine Art der Holzfäule. Bei dem Prozess, der durch holzzerstörende Pilze hervorgerufenen wird, wird vorwiegend 68 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz Zellulose abgebaut, die ein Hauptbestandteil des Holzes ist. Das Holz verliert dadurch seine Festigkeit und Masse und entwickelt den sogenannten „Würfelbruch“, der für das von Braunfäule befallene Holz typisch ist. Das Holz nimmt wenn es von einem Braunfäule verursachenden Pilz befallen ist eine dunkelbraune Farbe an, da das braune Lignin erhalten bleibt, während die helle Zellulose zerstört wird. Das von Braunfäule befallene Holz wird so weit zersetzt, dass es sich zwischen den Fingern zu Pulver zerreiben lässt. Braunfäulepilze befallen sowohl den lebenden Baum als auch den toten Baum. Einen Gegensatz zur Braunfäule stellt die Weißfäule dar, bei der, ebenfalls durch Pilze, in größerem Umfang das Lignin verarbeitet wird. Der wichtigste Vertreter der Braunfäule verursachenden Pilze ist die Familie der Baumschwammartige (Fomitopsidaceae). Weißfäule Die Weißfäule, die auch Korrosionsfäule genannt wird, ist eine Form der Holzfäule, die ebenfalls durch bestimmte Pilze hervorgerufen wird. Die Holzzerstörung kann, genauso wie bei der Braunfäule schon am lebenden Baum auftreten, vor allem an Laubholz. Die Weißfäulepilze zerstören, im Gegensatz zu Braunfäulepilzen als erstes den Ligninanteil des Holzes, können später aber auch den Zelluloseanteil angreifen. Bei einer Weißfäule-Erkrankung wird das Holz heller, leichter, und faseriger. Es entsteht eine gleichmäßige weißlich-graue Verfärbung. Einer der wichtigsten Vertreter der Weißfäulepilze ist der Zunderschwamm (Fomes fomentarius). In Marchegg haben wir folgende Pilze auf unserem Totholz gefunden: - Spaltblättling - Tintling (hat sich innerhalb eines Tages aufgelöst) - Zunderschwamm - Getigerter Knäuling Zersetzungsphase Die Zersetzungsphase ist die zweite Phase im Holzabbau. Bei einem stehend abgestorbenen Baum fallen nun die Äste ab und die Rinde löst sich vom Stamm. Das Pilzgeflecht durchdringt das Holz weiter und es siedeln sich Insekten an, die entweder von den schon gemachten Bohrgängen abhängig sind oder das zum Teil abgebaute Holz brauchen. Das Pilzgeflecht ist eine wichtige Nahrungsquelle für viele Totholzinsekten. In den Bohr- und Larvengängen gibt es auch zahlreiche Insekten, die räuberisch leben. Die Insekten und Pilze die sich in dieser Zersetzungsphase ansiedeln, nennt man sekundäre Xylobionten. 69 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz Die wichtigsten sekundären Xylobionten sind: - Feuerkäfer (Pyrochroidae) - Schröter (Lucanidae) - Schnellkäfer (Elateridae) In Marchegg haben wir auf unserer Suche nach sekundären Xylobionten sowohl die Larven der Feuerkäfer als auch der Schnellkäfer gefunden. Ebenso haben wir den Kopf mit den Mandibeln eines männlichen Hirschkäfers (Lucanus cervus) gefunden. Wie erwartet sind uns auch einige räuberisch lebende Insekten über den Weg gelaufen, am häufigsten waren das verschiedene Arten der Laufkäfer (Carabidae) und verschiedene Arten der Spinnen (Araneae). Humifizierungsphase In der letzten Phase des Holzabbaus geht das bereits zum Mulm (= lockere Holzmasse aus organischem Material) zerfallene Holz letztendlich in Humus (= die Gesamtheit der toten organischen Substanz eines Bodens) über. Dies kann allerdings nur unter Mithilfe von den tertiären Xylobionten geschehen, diese zersetzen in dieser Phase das Lignin und die Zellulose. Solche tertiären Xylobionten sind Bodenlebewesen, wie verschiedene Würmer, Tausendfüßer, Schnecken, sowie Milben und Asseln, die in den Mulm einwandern und die zur weiteren Zersetzung beitragen. Die Exkremente dieser Tiere sind sehr wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Die tertiären Xylobionten, die wir in Marchegg gefunden haben, waren: - Regenwürmer (Lumbricidae) - Schnecken (Gastropoda) - Schnegel (Limacidae) - Hundertfüßer (Chilopoda); Necrophloeophagus und Lithobius - Doppelfüßer (Diplopoda); Julidae - und Polydesmus Asseln (Isopoda) Kurzflügler (Staphylinidae); räuberisch lebend Ameisen (Formicidae); u.a.: Formica Milben (Acari) Wie viel Totholz haben bzw. brauchen wir? Die Menge an stehendem Totholz wird in Österreich anhand einer Inventur festgestellt. Die letzte Inventur wurde im Zeitraum von 2000 bis 2002 durchgeführt und der mittlere Wert, der für den Gesamtwald in Österreich berechnet wurde beträgt 6,1 Vfm/ha (Vorratsfestmeter pro Hektar). Die Menge an totem Holz hängt einerseits von der Waldgesellschaft, der jeweiligen Holzart, dem Alter der Bestände, der Geschwindigkeit der Zersetzung, den standörtlichen Gegebenheiten und andererseits von der forstlichen Bewirtschaftung ab. „Aus naturschutzfachlicher Sicht werden von Ökologen zur Sicherung der Biodiversität in allen Wäldern Totholzmengen 70 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz von durchschnittlich 20 Vfm/ha angestrebt. Für die Mehrzahl der Totholzbewohner ist damit das Überleben gesichert.“ (Fischer; Schwarz, 2008) Totholz - Fachdidaktik Vorbereitung in Wien Bei der Themenvergabe im März wollten wir eigentlich das Thema „Lebensraum Baum“ wählen, da wir dachten, dass dieses Thema sehr umfangreich ist und es deshalb viele Möglichkeiten an Unterrichtsideen bietet. Karin und Klaudia waren schneller als wir und so entschieden wir uns für das Thema „Leben im Totholz“, wobei wir daran zweifelten, ob man dieses Thema spannend für Schüler/innen umsetzen kann. Wir beide hatten im März wenig Zeit und so kam es, dass wir beide, im Nachhinein betrachtet, bei der ersten Vorbesprechung viel zu wenig vorbereitet hatten und uns noch zu wenig mit der Materie auseinander gesetzt hatten. Wir hatten ein wenig im Internet gesucht und viel Material über Bäume und Pilze von Evas Onkel erhalten, von dem wir aber für die Stundenvorbereitung dann nicht Gebrauch machten. Wir setzten uns an einem Nachmittag zusammen und überlegten was wir mit unserem Thema „Leben im Totholz“ in Marchegg anstellen könnten.Wir sahen ein, dass alles davon abhing, was und wie viel wir in Marchegg finden würden und ob genügend Totholz vorhanden sein würde. Bei unserer Umsetzung wollten wir besonderes Augenmerk auf die Schüleraktivität und „Learning by doing“ legen. Darüber hinaus wollten wir mehr mit Anschauungsobjekten und weniger mit trockener Theorie arbeiten. Aus dem Erfahrungsbericht von 2007 entnahmen wir, dass es jedoch nicht so einfach war, die typischen Totholzbewohner aufzustöbern und generell viel zu wenige Tiere im Totholz gefunden wurden. So beschlossen wir nicht nur einen Plan A sondern auch einen Plan B und C zu entwickeln. Wir erarbeiteten also drei Konzepte, in die wir alle unsere Ideen einbauten und die wir auch bei der ersten Vorbesprechung vorstellten. Bei einem Konzept (der Notfallplan) wollten wir, anstatt die Schüler/innen selbst im Totholz nach Tieren suchen zu lassen, Stationen aufbauen, mit Tieren die wir im Vorhinein gefunden hatten. Dieser Notfallplan entstand aus dem Gedanken heraus, dass, falls es wirklich so sein sollte, dass wir selbst im Totholz nur wenige Tiere finden sollten, wir die Schüler/innen nicht selbst suchen lassen wollten, da das lediglich Zeitverschwendung und frustrierend für sie wäre, wenn sie nichts finden würden. 71 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz Bei der Vorstellung unserer Konzepte bei der ersten Vorbesprechung wurde uns aber nahe gelegt, dass wir die Schüler/innen selbst suchen lassen sollen und auch darauf verzichten sollen mit irgendwelchen vorbereiteten Materialen zu arbeiten, wie Arbeitszettel, Schautafeln, usw., sondern mehr vor Ort mit dem „Material“ (also Holz, Tieren und Pilzen) das uns Marchegg bietet. Das war uns natürlich einleuchtend, Arbeitsblätter bekommen die Schüler/innen in der Schule ohnehin genug. Wenn sie dann einmal im Freiland Unterricht haben, kann man darauf verzichten. Darüber hinaus wurden wir von den Professoren darauf hingewiesen, dass wir uns zu sehr auf den Aspekt „Insekten“ spezialisieren und wir uns zu sehr vom Überthema „Leben im Totholz“ wegbewegen. Wir waren zu sehr fixiert auf die Tiere und zu wenig auf Totholz an sich. Vor den Osterferien erhielten wir von Prof. Hödl das Prospekt „Aktiv für Totholz im Wald“ und dieses Heftchen brachte uns schließlich auf die Idee, unser Hauptaugenmerk wirklich auf das Totholz, seine Bedeutung und seinen Abbau, zu richten. Wir beschlossen, uns Fachwissen mithilfe des Prospekts und dem Internet anzueignen, und unser „wirkliches“ Konzept in Marchegg vor Ort zu entwickeln. Eva hatte eine tolle Idee für den Einstieg in unsere Unterrichtssequenz. Und zwar hofften wir einen hohlen Baumstumpf gefüllt mit Mulm zu finden, der voll von Tieren ist. Einer von uns beiden sollte dann vor den Augen der Schüler/innen mit beiden Händen in diesen Mulm greifen, herausnehmen und beispielsweise sagen, dass in den beiden Händen jetzt mehr Lebewesen sind, als heute Menschen in Marchegg. Worüber wir uns aber sicher waren, war, dass wir als Basis für unsere Unterrichtssequenz im Freiland auf den Abbauphasen des Holzes aufbauen und auch der Bedeutung der Pilze Beachtung schenken wollen. Vorbereitung in Marchegg Am ersten Tag begaben wir uns auf Standort-Suche für unsere Station. Wir erkundeten die Gegend und marschierten durch die Weiche Au, wo es eher schattig und feucht war. Wir zogen bei ein paar liegenden Bäumen die Rinde ab, und darunter fanden wir eine Larve, ein paar Tausendfüßler und Asseln, aber keine Käfer. Wir 72 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz hatten entschlossen, am Dienstag noch keine Tiere zu fangen, sondern erst am Mittwoch mit Schaugläsern ausgestattet uns auf die Jagd nach Tieren zu machen. Erich meinte, dass wir auch den toten, noch stehenden Nussbaum in der Nähe des Hauses als Standort wählen könnten. Dieser Nussbaum war innen hohl, er war mit Mulm gefüllt, ein Zunderschwamm befand sich am Stamm und auch um den stehenden Baum herum lag einiges an Totholz, wo wir beispielsweise Tintlinge fanden. Leider war der hohle, mulmgefüllte Teil nicht voll von Tieren, sondern es waren nur einige Waldameisen zu entdecken. Wir entschieden uns nicht sofort für diesen Baum, denn wir hofften noch etwas Idealeres selbst zu finden und so suchten wir noch ein paar Stunden weiter.Am Abend begannen wir dann unser Konzept für Donnerstag anzufertigen. Am zweiten Tag war Tiere Fangen angesagt. Wir fingen Asseln, Hundertfüßer, Doppelfüßer, Ameisen, Spinnen, Regenwürmer, Käferlarven. Leider erwischten wir keinen einzigen Käfer und die Zeit wurde knapp. Peter ist dann mit uns auf die Jagd gegangen und hat uns nach etwa fünf Minuten schon einen Weberbockkäfer eingefangen. Dank ihm hatten wir gegen Ende des Tages auch viele verschiedene Laufkäfer. Klaudia brachte uns darüber hinaus noch einen Eichenbockkäfer. Wir fixierten den hohlen Nussbaum als Standort und unser Konzept. Wir wollten beim Nussbaum beginnen und dann, ein paar Meter weiter, auf einem Heurigentisch unsere gefangenen Tiere und gesammelten Pilze zeigen. Dabei wollten wir die Objekte nach primären, sekundären und tertiären Xylobionten gliedern. Als Anschauungsmaterial hatten wir auch ein Stück Weißfäule befallenes Holz und ein Stück Braunfäule befallenes Holz. Schwerpunkte legten wir auf: - Holzabbau (drei Stufen) - Bedeutung der Pilze für den Holzabbau - Tiere im Totholz und deren Anpassungen an das Leben im Holz Wir beabsichtigten die Schüler/innen etwa die Hälfte der vorhandenen Zeit selbstständig arbeiten zu lassen. Stundenbild - Vorstellung Wer wir sind und bei welcher Station sich die Schüler/innen befinden. - Einführung in das Thema Die Schüler/innen wissen nun, dass sie sich bei der Station „Leben im Totholz“ befinden und sollen sich umsehen, wo sie denn hier (bei unserem Standort) überall Totholz sehen. Um den alten Nussbaum herum, liegt auch eine Menge totes Holz, wie ein liegender Baumstumpf und Äste. Wir fragen die Schüler/innen, woran sie erkennen, dass Holz tot ist und wo sie lebendes Holz sehen. Wir sprechen kurz die Unterschiede an, wie beispielsweise, dass Totholz nicht mehr wächst und nicht mehr mit Wasser und Mineralstoffen versorgt wird. Wir erklären auch, dass es Teile am Baum gibt, die tot sind, wie zum Beispiel tote Äste, aber der Baum kann noch wachsen. Wir fragen die Schüler/innen nach den Gründen, warum ein Baum stirbt. Gründe wären beispielsweise Alter, Blitzeinschlag oder ein Sturm. Wir zeigen auf den hohlen stehenden Nussbaum und lassen jeden Schüler/jede Schülerin hineinsehen in den hohlen Baum. Danach greifen wir in das Bauminnere hinein und holen eine Hand voll 73 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz Mulm heraus, zeigen es den Schüler/innen und erklären ihnen, dass diese lockere, „bröslige“ Masse einmal festes Holz war. Wir erklären den Kreislauf des Holzabbaus kurz. Ein Baum stirbt und das tote Holz durchläuft nun einen Abbauprozess, in dem das Holz schließlich in Humus übergeht. Begriffe wie Humus oder Mulm erklären wir den Schüler/innen. - Erarbeitungsphase a) Lehrer-Schüler-Gespräch mit Lebendobjekten Wir entfernen uns vom Nussbaum und gehen mit den Schüler/innen zu unserem Heurigentisch mit den Tieren. Jedes Stadium des Holzabbaus ist mit verschiedenen Organismen verbunden. 1. Besiedlungsphase Wir zeigen die beiden Bockkäfer und die Bockkäfer-Puppen. Wir nehmen die Tiere aus den Schaugläsern heraus und fragen die Schüler/innen ob sie sie halten möchten. Wir erklären, dass die ersten Besiedler die Vorarbeit für weitere Besiedler leisten, indem sie die Rinde ablösen und Gänge in das Holz bohren. Dazu zeigen wir ein Stück Holz, bei dem man die Fraßgänge von Käferlarven sehr gut sieht. Das Stück Holz geben wir durch, sodass alle Schüler/innen es angreifen und anschauen können. Wir möchten auch immer bei den jeweiligen Tieren den Schüler/innen die Anpassungen an den Lebensraum Totholz herausfinden lassen. Beispielsweise sollen sich die Schüler/innen die Mundwerkzeuge des Bockkäfers genau ansehen. Wir fragen die Schüler/innen auch ob sie wissen was eine Larve ist und ob jemand das vielleicht erklären kann. 2. Zersetzungsphase In dieser Phase siedeln sich Pilze und Bakterien an. Wir erklären, dass die holzbesiedelnden Pilze in Weißfäule- und Braunfäulepilze unterteilt werden. Dann zeigen wir den Schüler/innen die beiden Pilzbefallenen Holzstücke und fragen, was die Braunfäule und was die Weißfäule ist. Aufgrund der Farbe der Holzstücke ist das leicht ersichtlich. Wir erklären in einfachen Worten, was der Unterschied zwischen Braunfäule und Weißfäule ist und lassen die Schüler/innen die Holzstücke aufheben und schätzen welches Stück schwerer ist. Das von der Braunfäule befallene Holz ist schwerer als das von der Weißfäule befallene. Wir zeigen den Schüler/innen auch die Würfelstruktur im Holz, die die Braunfäule bewirkt und die fasrige Struktur, die die Weißfäule bewirkt. Wir wollen auf die wichtige Aufgabe der Pilze hinweisen, dass sie Stoffe abbauen können, welche die Tiere nicht abbauen können. Wir erklären, dass die Tiere in dieser Abbauphase das durchbohrte Holz benötigen. In dieser zweiten Abbauphase leben auch viele räuberische Käfer am Baum. Dazu zeigen wir die Laufkäferarten. Wir fragen die Schüler/innen, was Räuber sind und warum der 74 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz Laufkäfer so heißen könnte. Räuber müssen schneller sein als Pflanzenfresser. 3. Humifizierungsphase Wir erklären dass das Holz, also eigentlich schon der Mulm, in Humus übergeht und weisen nochmals auf die Bedeutung der Pilze hin. Also Holz wird zu Humus und der Humus wird wiederum von anderen Pflanzen gebraucht. Wir erklären den Schüler/innen, dass es auch viele Tiere gibt, die sich von Pilzen und Bakterien ernähren. Asseln, Doppelfüßer, Hundertfüßer, Regenwürmer befinden sich in Schaugläsern. Wir nehmen sie heraus und geben sie den Schüler/innen. Die Schüler/innen und wir erarbeiten gemeinsam Anpassungen der Tiere an den Lebensraum Totholz. b) Erkundungsphase der Schüler/innen Die Schüler/innen dürfen nun etwa 10 bis 15 Minuten selbst nach Totholzbewohnern suchen. Dazu gehen wir mit Schaugläsern ausgerüstet zurück zum Nussbaum, um den herum genug liegendes Totholz vorhanden ist. Jede/r Schüler/in hat ein Schauglas und kann selbstständig im Totholz Tiere fangen. Wir helfen den Schüler/innen beim Suchen und zeigen ihnen, wie und wo man am besten nach Asseln und Tausendfüßern sucht und sie fängt. - Sicherungsphase (Anschauen der gefundenen Tiere) Gegen Ende unserer Einheit gehen wir mit den Schüler/innen zurück zum Heurigentisch und jede/r darf seine gefangenen Tiere herzeigen. Wir sehen uns die gefundenen Tiere gemeinsam an und versuchen noch mal auf ihre Anpassungen hinzuweisen. Ziele, die wir in Wien festgelegt haben: - Keine Angst vorm selbstständigen Arbeiten - Ekel vor Tieren verlieren - Spinnen von Käfern usw. unterscheiden können - Bedeutung von Totholz - Bedeutung und Aufgaben von Pilzen Ziele, für die wir uns in Marchegg entschieden haben: - Bedeutung von Totholz - (Warum soll es gefördert werden?) - Welche Organismen leben im Totholz - Drei Phasen des Holzabbaus (Besiedlung, Zersetzung, Humifizierung) - Bedeutung und Aufgaben von Pilzen „take home message“: Totes Holz ist nicht tot, sondern voller Leben! Methoden - Lehrer-Schüler-Gespräch - Selbstständiges Arbeiten Reflexion Lehr- und Lernziele Unser geplantes Konzept verwendeten wir bei allen Schüler/innen an beiden Tagen. Den 75 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz einzigen Punkt, den wir geändert haben, war die Zeitspanne, in der die Schüler/innen selbstständig nach Xylobionten suchen durften. Die Schüler/innen sollten ein wenig mehr Zeit mit Suchen verbringen (zehn bis fünfzehn Minuten) und der anschließende Vergleich sollte nur kurz sein. Unsere erste Schüler/innengruppe bestand aus vier Mädchen und einem Burschen, der sich eher im Hintergrund aufhielt. Ein Mädchen stach besonders hervor durch viel Interesse und großes Wissen. Die Schüler/innen stellten viele Fragen und Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Hödl machte uns nach der Einheit darauf aufmerksam, dass wir versuchen sollten mehr auf die Schüler/innen zu hören was sie sagen/fragen. Bei den folgenden Schülergruppen beantworteten wir Fragen immer sofort. Als wir den Schüler/innen den Mulm gezeigt haben, sagten sie meistens gleich „Sägespäne“. Ein Junge am zweiten Tag sagte auch dazu, dass das die Tiere gemacht haben. Bezogen auf die Lehr-/Lernziele kann man sagen, dass die Schüler/innen kein Problem damit hatten Spinnen von Käfern zu unterscheiden. Sie erkannten sogar meistens die Tausendfüßler. Die Schüler/innen wussten auch, dass eine Larve ein Stadium in der Entwicklung ist. Die Schüler/innen durften die würfelige Struktur des Braunfäulebefallenen Holzstücks ansehen und durften sich auch ein Stück herunterbrechen. Diesen kleinen Würfel wollten die meisten Schüler/innen mit nach Hause nehmen. Die Schüler/innen stellten wirklich sehr viele Fragen. Einige Beispiele: „Hat der Tausendfüßler wirklich tausend Füße?“ „Warum lebt der Regenwurm unter der Rinde?“ „Kann ein Regenwurm auch so gut hören wie ein Hund?“ „Warum kann die Schnecke die Wand hochkriechen?“ Prinzipiell glauben wir, hat unser Konzept gut funktioniert und dass wir auf den drei Phasen des Abbauprozesses aufgebaut haben war eine gute Idee. Christian hatte auch einen guten Vorschlag wie wir den Schüler/innen veranschaulichen, wie wichtig dieser Abbauprozess des Holzes ist, und zwar sollten sich die Schüler/innen vorstellen wie viele Baumstämme herumliegen würden, wenn jeder umgefallene Baum immer liegen geblieben wäre und nicht abgebaut worden wäre. 76 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz Erfahrungsberichte Lisi Anfangs war ich nervös, da ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Unterrichtserfahrungen gesammelt hatte. Aber sobald die erste Schüler/innen-Gruppe bei unserer Station angekommen war, war jegliche Nervosität verflogen und ich fühlte mich richtig gut beim Gespräch mit den Schüler/innen. Eva und ich hatten uns nicht abgesprochen welche Sequenzen sie unterrichtet und welchen Part ich übernehme, aber die Unterrichtssequenz hat ohne Probleme geklappt, wir haben uns nicht unterbrochen und ich denke die Sprechzeiten waren sehr ausgeglichen bei uns beiden. Sie hat mich ergänzt und ich habe sie ergänzt, was aber keineswegs störend war. Meines Erachtens hat unser team-teaching durchaus gut funktioniert. Bevor die Schulklassen nach Marchegg kamen, hatte ich auch Befürchtungen, dass wir zu wenig fachlich vorbereitet waren. Es gibt tausende Dinge die man als Lehrer/in wissen sollte. Wir hatten uns zwar bezüglich unseres Thema gut erkundigt und Wissen angeeignet, jedoch weiß man im vorhinein nicht, was die Schüler/innen fragen werden und für was sie sich besonders interessieren. Aber auch hier gab es in den Unterrichtssequenzen keine Probleme. Wenn wir eine Frage nicht beantworten konnten, warfen wir einen Blick zu unserem Lehrpersonal oder Tutor, der/die zuschauen war. Die Schüler/innen stellten teilweise Fragen, die ich mir nie stellen würde und oft gar nicht so einfach zu beantworten sind. Einmal kam es, dass ich eine Frage zu kompliziert und mit Fachausdrücken beantwortete, was mir aber selbst beim Aussprechen schon bewusst wurde. Ich entschuldigte mich sofort, und erklärte es dann in einfachen Worten. Ich war sehr verwundert, dass einige Schüler/innen echt total interessiert waren, viele Fragen stellten und darüber hinaus auch viel wussten. Summa summarum hat mir das Unterrichten wirklich Spaß gemacht und das hat mich darin bestärkt, dass das Lehramts-Studium das richtige für mich ist. Die paar Tage in Marchegg waren ein angenehmer Ausgleich zu anderen Lehrveranstaltungen. Wir waren ständig draußen und ich habe so viel gelernt und gesehen - Marchegg war eine tolle Erfahrung. Mein Marchegg-Highlight war, dass ich eine Äskulapnatter gehalten habe, obwohl ich unheimliche Angst vor Schlangen habe. Eva Bei den Vorbereitungen in Wien war ich noch ziemlich 77 Eva-Maria Hoschof & Elisabeth Köberl: Totholz gelassen und habe mich gefreut so viele Schüler/innen einen halben Tag lang begleiten zu dürfen und das erste Mal im Freiland unterrichten zu können. Ich war schon einmal mit einer Schüler/innengruppe in Schönbrunn im Tiergarten und dabei muss ich sagen, hatte ich kaum Probleme sie im Zaum zu halten. Als wir dann in Marchegg ankamen und am ersten Tag kaum Tiere gefunden haben, machte ich mir schon ein wenig Sorgen, ob wir unseren Plan denn auch so umsetzen könnten. Wir haben unser Konzept noch gefühlte tausend Mal geändert und beschlossen im Endeffekt, dass wir sobald die Schüler/innen da sind spontan entscheiden, welches Konzept wir nehmen. Als das beschlossen war und wir eingesehen hatten, dass man sich sowieso nicht 100% auf diese Situation vorbereiten konnte, hatten wir immer noch das Problem, dass wir zu wenige Tiere als Anschauungsmaterial hatten. Wir machten uns am zweiten Tag wieder auf die Suche, blieben aber ohne größere Erfolge. Erst als uns Peter half hatten wir endlich auch primäre Xylobionten und unserem Plan stand nichts mehr im Wege. Am ersten Tag als die Schüler/innen dann kamen war ich etwas müde und konnte mich bei der ersten Gruppe nicht gut konzentrieren, wir sahen aber, dass unser Konzept, auf die Schüler/innen spontan einzugehen gut funktioniert und im Verlauf des Tages wurde ich immer konzentrierter und es machte mir großen Spaß die Schüler/innen zu unterrichten. Am zweiten Tag war ich dann schon voller Vorfreude und konnte es kaum erwarten, mit der ersten Gruppe zu unserem Standort zu gehen. Ich merkte auch, dass ich schon viel lockerer geworden bin und sah dies auch an der Schüler/innenaktivität. Ich muss aber dennoch sagen, dass jede Gruppe ganz anders war und man hätte niemals zweimal genau das Gleiche machen können. Man musste sehr flexibel sein und den Schüler/innen vor allem zuhören. Ich habe mir eigentlich im Vorhinein gedacht, dass die Schüler/innen nicht viel sagen werden, aber ich war sehr überrascht, was sie schon alles gewusst haben. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Schüler/innen wohl gefühlt haben und auch das "selbst suchen" hat ihnen gut gefallen. Ein persönliches Fazit für mich ist, dass man auf jeden Fall beim Unterrichten mehrere Pläne im Ärmel haben muss, man muss flexibel und vor allem fachlich gut vorbereitet sein. Zum Abschluss kann ich sagen, dass mir die Fachdidaktik in Marchegg sehr gut gefallen hat und diese Exkursion hat mich in meiner Berufswahl auf jeden Fall bestärkt. Quellen Augustin, Hannes; Hagenstein, Ingrid: Alte Bäume – Lebensräume. In: Natur und Land 86. Zeitschrift des Österreichischen Naturschutzbundes. Jg. Nr. 1 / 2 , 2000. Fischer, Gerhard; Schwarz, Martin; Österreichische Bundesforste AG (Hg.): Aktiv für Totholz im Wald. Anregungen für Forstleute und Landwirte.- Wien: 2008. Bellmann, Heiko; Honomichl, Klaus: Biologie und Ökologie der Insekten – 4. Auflage; Spektrum Akademischer Verlag. Gerhardt, Ewald: Der große BLV Pilzführer für unterwegs. – München: BLV, 2006. Rietschel, Siegfried: Insekten – München: BLV, 2008 Stichmann, Wilfried: Tiere und Pflanzen. Der große Kosmos Naturführer. – Stuttgart: Kosmos, 2005. www.totholz.ch http://de.wikipedia.org Knoll, F. (1956): Die Biologie der Blüte; 1. Auflage – SpringerVerlag, Berlin 78 Bedeutung der Pflanzen für die Tierwelt am Beispiel der Tierspuren von Stefanie Bruns & Florian Etl Fachlicher Teil Wenn wir durch eine mehr oder weniger naturbelassene Landschaft spazieren und uns fragen ob es hier mehr Tier- oder mehr Pflanzenarten gibt, wird sich der ein oder andere an den Kopf greifen und überlegen. Wenn man sich umsieht könnte man zweifellos meinen, es wären viel mehr Pflanzen als Tiere. Betrachtet man die Biomasse bezogen auf die Gesamtfläche der Erde so liegt man hiermit auch richtig. Unsere Frage bezieht sich jedoch auf die Anzahl der Arten, nicht auf die Masse ihrer Individuen. Hier liegen die Tiere weit vor den Pflanzen. Es gibt ungefähr ZEHNMAL so viele Tierarten wie Pflanzenarten in Österreich. Weltweit leben ungefähr 2 Millionen Arten, 500.000 davon sind Pflanzen. Warum bleiben die meisten Tiere unseren Augen verborgen? Tiere kommen meistens nicht in einer so hohen Artendichte vor wie Pflanzen. Wenn doch, dann sind diese Tiere meistens sehr klein und deshalb wieder schwer zu finden. Viele Tiere sind in ihrem Lebensraum nicht wie wir auf den Erdboden beschränkt. Sie leben im oder am Wasser, in der Erde, im Holz oder fliegen durch die Luft, und bleiben deshalb unseren Augen meist verborgen. Ein weiterer Grund ist, dass sich Tiere gut verstecken können. Sowohl Jäger als auch Gejagte müssen gut getarnt sein, wissen wo man nicht gesehen wird und trotzdem an sein Ziel kommt. Viele Tiere sind deshalb nachtaktiv. Sie nutzen die Dunkelheit um nicht gesehen zu werden. Diese Tiere brauchen dafür unter Tags ein noch besseres Versteck, da dieses leichter gefunden werden kann. Vermutlich waren die meisten Landtiere ursprünglich nachtaktiv, um sich gegen Austrocknung, Sonnenstrahlung und zu hohe Temperaturen zu schützen. Auch heute noch ist ein sehr großer Teil der Tiere nachtaktiv. Beispielsweise sind von den uns so wohlbekannten heimischen Schmetterlingen nur 180 Arten Tagfalter und 3500 Arten Nachtfalter. Auch Säugetiere, die viele von uns mit Vorliebe zu Gesicht bekommen, sind zum Großteil nachtaktiv. 79 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren Wenn man nun wissen will ob ein Tier, welches man selten sieht an einem gewissen Ort war, muss man nach dessen Spuren suchen. Dies ist nicht sehr einfach wenn man nicht weiß, wonach man Ausschau halten muss. Die meisten Leute denken bei dem Wort Tierspuren meist sofort an Fußspuren im Schnee oder im Schlamm. Bei längerem Überlegen kommt aber ein jeder darauf, dass das nicht alles sein kann. Wer kennt keine angebissenen Kirschen, wurmige Äpfel, durchwühlte Blumenbeete und Erdhaufen in Opas englischem Rasen!? Plötzlich fallen einem sehr viele Gegenstände und Orte ein, wo man beobachtet hat, dass ein Tier dort gewesen ist. In unserer modernen Gesellschaft spielen Tierspuren so gut wie keine Rolle mehr. Nur dort wo Tiere einen Schaden anrichten, oder Jagd als Sportart ausgeübt wird, befassen sich die Menschen noch mit Tierspuren. Für Naturvölker aus vergangener und aus heutiger Zeit ist die Kenntnis von Tierspuren lebensnotwendig. Nur wer eine Tierspur kennt, kann ein Tier verfolgen oder einer Verfolgung entgehen. Die häufigsten Arten von Tierspuren sind Fährten, Fraßspuren, Nester und Losungen. Aus der Unmenge an Tierspuren, die in Verbindung mit Pflanzen stehen (oder auch nicht), wurden einige Besonderheiten, die entweder typisch für die Gegend oder generell sehr häufig sind, ausgewählt. Biber (Castor fiber): Der lateinische Name Castor leitet sich vom lat. castrare ab, welches so viel wie schneiden bedeutet und den Biber somit als den „Schneider“ bezeichnet. Der Biber ist ein an Wasser angepasstes Nagetier, ein häufiger Bewohner von Flusssystemen und kommt in den Donau-March-Auen mittlerweile wieder häufig vor. Der Biber wurde wegen seines dichten Felles, wegen seines fetten Fleisches und wegen seines fetten Drüsensekretes („Bibergeil“), mit dem er sein Fell einfettet um es wasserabweisend zu machen, so lange gejagt, bis er schließlich Ende des 19. Jahrhunderts in fast ganz Europa ausstarb. In Österreich wurde der letzte Biber angeblich 1869 erschossen. Durch mehrere Wiederansiedlungsprojekte seit Ende der siebziger Jahre und durch selbständige Rückeinwanderung aus Rückzugsgebieten haben sich die Biberbestände in Österreich und im restlichen Europa wieder erholt. Immer öfter kann man heute wieder in Marchegg auch bei Tags Biber bei ihrer Arbeit beobachten. Noch öfter jedoch begegnet man ihren Spuren. Umgestürzte Bäume mit den gewaltigen Nagespuren eines Bibergebisses sind nicht selten. Ein Baum, der von einem Biber gefällt wurde, weist einige Besonderheiten auf: -) Er steht immer in Flussnähe, an Uferböschungen oder im Verlandungsbereich. Biber entfernen sich sehr selten mehr als 20 Meter vom Wasser. -) Sehr oft werden große Bäume gefällt, meist Weichholz wie Weiden oder Pappeln. -) Eine Sanduhrförmige Nagespur im unteren Stammbereich auf maximal 1 Meter Höhe ist deutlich zu erkennen. -) Der Stamm wurde bereits teilweise entrindet mit charakteristischen Nagespuren an denen man immer 2 Zähne nebeneinander erkennen kann. -) Es wurden kleinere Äste wie mit einem Messer vom Stamm abgeschnitten und anschließend entrindet. 80 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren Biber sind Pflanzenfresser und ernähren sich hauptsächlich von Blättern und jungen Trieben. Da diese meist weiter oben in den Bäumen und Sträuchern zu finden sind, und Biber schlechte Kletterer sind, fällen sie kurzerhand den Baum um an die Leckerbissen zu kommen. Im Winter fressen sie hauptsächlich Rinde und zähren von einem Vorrat, den sie im Sommer und Herbst anlegen. Biber halten keinen echten Winterschlaf, sondern nur eine Winterruhe und müssen deshalb auch in dieser Zeit fressen. Da die Bäume nicht selten direkt ins Wasser stürzen, was vom Biber meist gezielt durch entsprechendes Annagen erreicht wird, werden die Baumstämme auch anderwärtig genutzt. Biber sind gesellig lebende Tiere. Sie bilden Familienverbände und bauen unterirdische Höhlen, deren Eingang immer unter Wasser liegt. Die meist in Uferböschungen liegenden Eingangslöcher drohen bei Niedrigwasserstand an der Luft zu liegen. Dies versucht der Biber durch gezieltes Stauen des Wassers und durch Überdeckung durch Astmaterial zu unterbinden. Die dabei entstehenden Dämme können eine beachtliche Größe erreichen und werden nicht umsonst als Biberburgen bezeichnet. Das Vorhandensein eines oder mehrerer Biber in näherer Umgebung kann durch folgende Spuren gekennzeichnet sein: -) Ein großer Haufen gestautes Astmaterial und Baumstämme mit teilweise sichtbaren Bibernagespuren. -) Mehrere angenagte Bäume von denen manche schon gefällt wurden. -) Basketballgroße Eingangslöcher an Uferböschungen, die bei Niedrigwasserstand sichtbar werden. -) An den Uferböschungen und auch im nicht steilen Uferbereich deutlich erkennbare Biberrutsche. Sie hat ungefähr die Breite einer Kinderrutsche und führt von Land am schnellsten Weg ins Wasser. Oft findet man in der nassen weichen Erde Fußspuren und Rutschspuren. -) Im Uferbereich generell kann man sehr häufig die charakteristischen Fußspuren des Bibers erkennen. Man kann auch den nachgeschliffenen Schwanz im Schlamm oder Sand gut sehen. !-)Es besteht eine Verwechslungsgefahr mit den Fußabdrücken der Bisamratte. Die Biberspur besteht immer aus kleineren Vorderfüßen mit Krallen ohne 81 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren Schwimmhäute, sowie großen Hinterfußabrücken mit Krallen und Schwimmhäuten. Der Vorderfußabdruck des Bibers könnte mit dem Hinterfußabdruck der Bisamratte verwechselt werden. Sie sind sich von der Größe her ähnlich jedoch kann man in Verbindung mit den restlichen Abdrücken und den Abständen zwischen den Abdrücken zu einem richtigen Ergebnis kommen. -) Die Losung des Bibers ist kurz und dick mit einer Andeutung einer Spitze am Ende. Es erinnert an ein übergroßes Hasenkügelchen da der Inhalt ebenso aus großen Pflanzenteilen besteht. Da der Biber stets im Wasser abkotet kann man sie gelegentlich ans Ufer geschwemmt finden. Spechte (Picidae) Spechte sind baumbewohnende Vögel die ihre Nahrung hauptsächlich durch Stochern und Hacken in Bäumen erwerben. Sie suchen in der Regel nach im Holz lebenden Insekten und deren Larven. Spechte haben einen für diesen Zweck perfekt angepassten Körper. Zu erwähnen sind die kurzen Beine mit den kräftigen Krallen, die es dem Specht durch einen speziellen Sehnenapparat im Fuß und eine Gegenüberstellung von jeweils zwei Zehen erlauben auf senkrechten Baumstämmen perfekten Halt zu finden. Weiters haben Spechte einen Schnabel der wie ein Meißel geformt ist und eine lange sehr spezialisierte Zunge. Die Zunge, die bei einigen Arten vorn am Oberschnabel ansetzt hat in der Regel Widerhaken an der Spitze, die bei manchen saftleckenden Arten durch einen Endpinsel ersetzt wurde. Da der Schädel der Spechte beim Hacken starken Erschütterungen ausgesetzt ist, gibt es eine federnde Verbindung zwischen dem kräftigen Schnabel und dem Hirnschädel. Die Schwanzfedern sind oft noch zusätzlich als Stützorgane ausgebildet. Manche Spechte markieren ihr Revier zusätzlich zu Gesang mit Trommelwirbel. Für einige heimische Arten gibt es sehr charakteristische Spuren die sie in Bäumen hinterlassen: Schwarzspecht: Er hackt kleine bis sehr große Fraßlöcher in Bäume, die bis zu einem halben Meter lang und 15 cm breit sein können. Werden Löcher als Eingänge für Nisthöhlen errichtet, so sind diese meist sehr sauber gehackt, während die Fraßlöcher sehr ausgefranst und unregelmäßig sein können. Dreizehenspecht: Dieser Specht meißelt oft lange, schmale meist waagrechte Spuren in den Stamm um an seine Nahrung aus Insekten zu kommen. Großer Buntspecht: Er schlägt Vertiefungen in Äste wo er Tannenzapfen und Nüsse festkeilen kann, um diese anschließend zu bearbeiten. In diesen „Spechtschmieden“ kann man oft noch die zurückgelassenen Reste der Nahrung finden. Man kann Spechte auch des Öfteren dabei beobachten wie sie jüngere Bäume mit ihrem Schnabel ringeln, um nach dem Winter den aufsteigenden Saft aus den Narben zu trinken. Schnecken und Schneckenhäuser: Findet man Fraßspuren in frischen Blättern so kann man davon ausgehen, dass es sich um Schmetterlings- oder Blattwespenraupen sowie um Schnecken handelt. Die Löcher in den Blättern haben ihren Ursprung auch meist mitten im Blatt und nicht am Blattrand. Selten werden die Blattadern auch verzehrt, sodass häufig nur noch 82 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren die Blattadern an das ehemals vorhandene Blatt erinnern. Oft findet man den Übeltäter noch am Tatort sitzend, wobei Schnecken meist in der Nacht ihre Raubzüge durchführen. Häufig findet man auch leere Schneckenhäuser von Weinbergschnecke und kleineren Schnirkelschnecken. Kommen diese gehäuft an einem bestimmten Platz vor, so könnte es sich um eine „Drosselschmiede“ handeln, wo diese ihre gesammelten Schnecken aufhacken und verzehren. Schneckenhäuser können auch nachdem ihr legitimer Bewohner das Zeitliche gesegnet hat noch für andere Tiere als Behausung dienen. Zahlreiche Wildbienen der Gattung Osmia (Mauerbienen) nutzen diese als Brutstätte. Auch gibt es einige Ameisenarten Schneckenhäusern errichten. die ihre Nester in leeren Wildverbiss: Rotwild kann das Wachstum junger Bäume stark beeinflussen. Durch häufiges Abbeißen der Wipfelknospen und junger Triebe werden Bäume so in ihrem Wachstum beeinträchtigt, dass sie eine kugelige kleine Gestalt annehmen. Auch größeren Bäumen können die Hirschartigen noch Schaden zufügen. Einerseits durch das sogenannte „Fegen“, bei dem sie die Rinde mit ihrem Geweih beschädigen, und weiters durch das „Schälen“ der Rinde. Beim Schälen unterscheidet man zwischen der Sommerschälung und der Winterschälung. Bei der Sommerschälung im Frühjahr steigt der Saft in die Bäume und die Rinde lässt sich leicht vom Stamm in langen Streifen abziehen. Ein sehr großer Teil des Stammes kann so freigelegt werden. Bei der Winterschälung liegt die Rinde dicht am Stamm an, und muss regelrecht abgehobelt werden, wobei deutliche Zahnmarken zu erkennen sind. Bäume die einmal geschält wurden sind oft ihr ganzes Leben als solche zu erkennen durch große Narben die im Zuge des sekundären Dickenwachstums immer breiter werden. Fraßspuren an Nüssen, Tannenzapfen und anderen Früchten: Wenn man unter einem Walnuss- oder unter einem Haselnussbaum steht und den Boden untersucht wird man sehr schnell auf leere Nussschalen stoßen. Betrachtet man diese genauer so wird man feststellen, dass nicht alle Nüsse auf die gleiche Weise geöffnet 83 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren wurden. Sie haben zwar alle ein Loch, aber wie dieses Loch entstanden ist erkennt man erst bei näherem Hinsehen: Ohne noch in einem Bestimmungsbuch für Tierspuren nachsehen zu müssen kann man sofort feststellen ob die Nuss von einem Vogelschnabel oder einem Säugetiergebiss geöffnet wurde. Wurde die Schale durch Nagen geöffnet, so sind deutlich Zahnspuren der beiden Vorderzähne zu erkennen. Wurde ein Schnabel durch die Schale geschlagen, so ist auch eine scharfkantige, unregelmäßige Öffnung zu erkennen. Um noch genauer herauszufinden welche Maus oder welcher Vogel am Werk war muss man mit der besagten Literatur und guter Phantasie ausgerüstet mehrere Nüsse vergleichen und kommt vielleicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Auch bei den diversen Zapfen unserer Nadelbäume lässt sich relativ schnell feststellen wer diese in Bearbeitung hatte: Als Beispiel soll hier der Fichtenzapfen dienen, der jedoch in Marchegg vergeblich gesucht wird. Vergleicht man nun die Fraßspuren eines Eichhörnchens mit denen einer Maus, so ist derjenige den die Maus zurück lässt stets sehr sauber Schuppe für Schuppe abgenagt, bis auf ein paar Schuppen an der Spitze. Hingegen der von einem Eichhörnchen abgenagte Fichtenzapfen ist viel mehr zerfranst und unsauberer entschuppt. Auch machen sich Eichhörnchen gerne über unreife grüne Fichtenzapfen her, wo man oft Schuppe für Schuppe von einer hohen Fichte fliegen sieht. Eichhörnchen lassen ihre Zapfen einfach auf den Boden fallen, während Mäuse stets an verborgenen Fraßplätzen dinieren. Findet man Fichtenzapfen, die eher zerfledert als zernagt aussehen so handelt es sich dabei vermutlich um einen vom Specht entkernten Zapfen. Noch schön wirkende Zapfen, bei denen jede Samenschuppe fein säuberlich der Länge nach gespalten wurde, sind ein deutlicher Hinweis auf einen Kreuzschnabel. Eulen und ihr Gewölle: Eulen schlucken Kleinsäuger und andere Beute meist ganz. Die unverdaulichen Teile wie Haare, Knochen, Chitinpanzer und Federn werden in Form von „Gewölle“ genannten Ballen wieder heraufgewürgt. Man findet Gewölle meist unter den Schlafbäumen der Eulen, und dann kann es in sehr großer Menge vorhanden sein. Da die Verdauungssäfte der Eulen auf Knochen nicht einwirken, bleiben diese meist völlig unversehrt erhalten. Man kann durch Gewölleuntersuchungen feststellen welches Tier die Eule kürzlich gefressen hat. Selbst die kleinsten Rippen einer 84 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren Maus kann man noch in einem Gewölle finden, sodass man das komplette Skelett des Beutetiers rekonstruieren kann. Meist sind jedoch die Schulterblätter zertrümmert, weil das die Stelle ist wo die Eule die Maus packt. Um herauszufinden ob das erbeutete Tier eine echte Maus oder ein Vertreter der Insektivoren war, wie die Spitzmaus, genügt ein Blick auf das Gebiss: Sind die Schneidezähne zu Nagern ausgebildet und die Backenzähne dienen dem Mahlen von Getreide, so handelt es sich tatsächlich um eine Maus. Sind die Backenzähne jedoch spitz wie Nägel und die Eckzähne sind stark ausgeprägt, so haben wir einen Insektenfresser vor uns. Literatur: Bang, Preben, Dahlström, Preben: Tierspuren. Fährten, Fraßspuren, Losungen, Gewölle und andere. BLV Bestimmungsbuch Lang, Angelika (2008): Spuren und Fährten unserer Tiere. BLV Buchverlag, München Richarz, Klaus (2006): Tierspuren Erkennen & Bestimmen. Ulmer Naturführer, Stuttgart Fachdidaktik Didaktisches Grundkonzept Unser didaktisches Grundkonzept machte eine ziemliche Wandlung durch. Nachdem in unserem ersten Konzept sehr viel Theorie und vor allem diese typischen Lehrer-SchülerGespräche vorkamen, mussten wir das rasch ändern. Besonders schwierig war dabei, dass wir nicht wirklich wussten welche Tierspuren uns in Marchegg erwarten würden. Deshalb viel es uns vermutlich besonders leicht den theoretischen Teil zu konzipieren, das wir uns sowieso auf alle Spuren vorbereiten mussten. Beim praktischen Teil, der die meiste Zeit einnehmen sollte, waren wir anfangs etwas ideenlos. Immer wieder kam uns die Idee aus dem Fußabdrücken im Boden mit den SchülerInnen gemeinsam Gipsabdrücke von diesen zu machen. Der Vorteil wäre gewesen, dass jeder Schüler etwas zum mit nach Hause nehmen hat. Doch die Nachteile haben dann doch immer 85 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren wieder überwogen: die meisten der SchülerInnen kannten mit Sicherheit Fußspuren und es wäre nichts wirklich Neues. Außerdem wussten wir überhaupt nicht wie wir das zeitlich einordnen sollten. Zwischenzeitlich war der Plan folgender: die SchülerInnen sollten sich, nach einem theoretischen Überblick über Tierspuren, eine davon aussuchen und zum Experten werden. Dabei sollten sie Fragen beantworten wie: Was hat das Tier gemacht? Ist das Tier öfter da? Was hat es gefressen? Doch auch diese Variante erschien uns immer noch zu theoretisch. Schließlich kamen wir zu folgendem Ablauf: zum Einstieg wollten wir sie fragen, ob es mehr Tier- oder Pflanzenarten gibt um dadurch dann auf die Tierspuren zu kommen. Bei einem kurzen Rundgang wollten wir den SchülerInnen möglichst unterschiedliche Spuren (Fußspuren, Fraßspuren, Baue, Kot) zeigen, welches Tier sie gemacht hat und wie man sie einem Tier zuordnen kann. Als großen praktischen Teil wollten wir Gewölle der Waldohreule mitnehmen. Diese sollten von den Kindern zerlegt werden und mit Hilfe von einer Kopie (auf der das Skelett einer Maus beschriftet war) zugeordnet werden und auf schwarzes Naturpapier aufgeklebt werden. Es war geplant, dass währenddessen die andere Hälfte der Gruppe Fraßspuren an Haselnüssen, Walnüssen und Schnecken mit Hilfe von Büchern bestimmt. Um unsere Lehrziele sicherzustellen, wollten wir sie am Ende der Station noch fragen: was man aus Tierspuren alles herauslesen kann und wofür Tiere Pflanzen eigentlich brauchen. Reflexion: Wie schon vorher erwähnt, war unser größtes Problem, dass wir nicht wussten, welche Spuren wir finden werden. Nachdem wir und aber schon im Vorfeld sehr gut in das Thema eingelesen haben, mussten wir in Marchegg nur mehr auf Spurensuche gehen. Relativ rasch hatten wir einen Weg mit diversen Tierspuren gefunden. Unseren Fokus setzten wir dabei vor allem auf die Spuren vom Biber, da unser Weg direkt an der March lag und wir in der näheren Umgebung auch noch andere Spuren fanden. Wir sind unseren Weg immer wieder abgegangen um uns genau zu überlegen wo wir was 86 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren sagen wollen. Schlussendlich haben wir uns einfach vorgestellt, dass die SchülerInnen vor uns stehen und haben das ganze versucht durchzusprechen. Sinn und Zweck dieser Übung war ein möglichst gutes Zeitgefühl zu bekommen um dann mit den Schülern nicht ein allzu große Zeitproblem zu haben. Fazit war, dass wir immer mehr Inhalt kürzten um genug Zeit zum Zerlegen der Gewölle zu haben. Der Einstieg, als die SchülerInnen dann da waren, gestaltete sich dann doch etwas anders als ursprünglich geplant. Nachdem die SchülerInnen nicht alle Stationen besuchten und somit bei dem einen Teil unsere Station die einzige war, die an der March lag, erzählten wir immer ganz kurz was über den Fluss und das Überschwemmungsgebiet. Schon hier wurden wir, vor allem von den Burschen, mit den unterschiedlichsten Fragen konfrontiert. So gut es ging, sind wir auf die meisten Fragen eingegangen. Bei der ersten Schülergruppe hat vor allem Flo das Wort gehabt, was wir aber gleich danach geklärt haben und es so nicht mehr vorkam. Besonders spannend war die Arbeit mit den Gewöllen. Als die Kinder sie sahen und wir ihnen erklärten was das ist, haben sich zuerst ein paar von ihnen davor geekelt. Doch als wir ihnen gezeigt haben, was man daraus machen kann, waren alle begeistert und haben gerne mitgemacht. Das Tempo bei den Gewöllen war sehr unterschiedlich und wir haben dabei immer versucht uns möglichst an den Schülern zu orientieren. Zum bestimmen der Fraßspuren kam es nur äußerst selten, wenn ein paar schon früher fertig waren als die anderen. Eine Gruppe wollte, was uns doch sehr erstaunt hat, ihre Skelettteile erst zu Hause auf das schwarze Papier aufkleben. Die Lage unserer Station war insofern sehr günstig, da der Weg zur nächsten Station sehr weit war bzw. wir die letzte Station vor der Pause waren. So konnten wir die Wegzeit immer nützen um die vorher angesprochenen Fragen zu stellen um unsere Lehrziele nicht aus den Augen zu verlieren. Die letzte Schülergruppe legte eine besonders große Motivation an den Tag. Trotz bereits recht ergiebigem Regen, wollten sie noch unbedingt zur Biberrutsche, weil wir sie zuvor erwähnt hatten. Das hat uns gezeigt, dass man diese durchaus vorhandene Motivation möglichst lange fördern sollte. 87 Stefanie Bruns & Florian Etl: Tierspuren Zusammenfassung Lehrziele: Unsere Ziele waren, dass die SchülerInnen wissen sollen welche Tierspuren es gibt und das es nicht nur Fußspuren gibt. Außerdem, dass man aus Tierspuren vieles herauslesen kann. Als letzten Punkt sollten sie auch wissen wofür die Tiere Pflanzen eigentlich brauchen. Wobei hier kurz zu erwähnen ist, dass wir die Pflanzen und Tiere nie in diesem Verhältnis zueinander erwähnt haben. Trotzdem haben die SchülerInnen die richtigen Antworten gewusst. Wir denken, dass wir unsere Lehrziele erreicht haben. Methode: Auf unserem Weg durch das Augebiet, dominierte das Lehrer-Schüler-Gespräch. Wobei uns schon aufgefallen ist, dass gegen Ende des Weges immer mehr Fragen von den SchülerInnen gekommen sind und sie somit den Spieß umgedreht haben. Den größten Teil der Zeit sollten die Gewölle zerlegt werden. Natürlich kamen hier immer wieder Fragen dazu. Wobei wir sie dann dazu ermutigten noch einmal selbst genau hinzuschauen. Oft hatten wir dabei das Gefühl, dass sie selbst erstaunt waren, als sie etwas entdeckten. Was uns auch noch besonders aufgefallen ist, ist die soziale Komponente die doch einen gewissen Stellenwert eingenommen hat. So war es zum Beispiel so, dass sie Skelettteile, bevorzugt Schädel, getauscht haben, sodass jeder zumindest einen hatte. Die Freude über diese Tauschgeschäfte war immer sehr groß. 88 89 Tierspuren und die Bedeutung der Pflanzen für die Tierwelt von Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka Anfänglich als wir uns für das Thema „Tierspuren und die Bedeutung der Pflanzen für die Tierwelt“ entschieden hatten, waren wir uns noch nicht wirklich bewusst, dass dieses Thema so komplex ist. Denn denkt man an Tierspuren, verbindet man dies meist mit Fährten oder Fraßspuren. Dass hinter diesem Thema aber mehr steckt, ist uns erst im Freiland, direkt an der March, klar geworden. Natürlich war uns schon bewusst, dass die Pflanzen eine wichtige Bedeutung für die Tierwelt aber auch für uns Menschen haben, denn sie betreiben Photosynthese und ermöglichen durch die Umwandlung des CO2 in O2 das Atmen. Uns lag daher am Herzen, dass die Schüler merken, dass Tiere ohne Pflanzen nicht überleben können, da sie Nahrungsquelle und Schutz gleichzeitig darstellen. Um sich als Biologielehrer bei Exkursionen vor Schülern nicht zu blamieren, ist ein gewisses Maß an Kenntnis von Tierspuren von großem Vorteil und kann schon vorweg einen Ausflug, Wandertag o. Ä. zu einem spannenden Erlebnis machen, ob am Weg zum Bus, zur Jausenstation oder zum WC, auf dem Weg durch die Natur kann man die Schüler auf zahlreiche Kleinigkeiten aufmerksam machen. Biologieunterrichts, eine wesentliche Rolle dar. Dabei kann es für einen Biologielehrer von Vorteil sein, sich vor Ausflügen über das Vorkommen von Tieren zu informieren, damit man sich später gegenüber den Schülern nicht blamieren muss. Dabei kann man nicht nur eine Menge über die Lebensweise der Tiere erlernen, sondern auch ein genaues Hinschauen und Aufmerksam-Werden ,auf was sich in Wald und Wiese so alles „versteckt“, zu schulen. Zahlreiche Tiere werden durch die oft aufgesetzten „Scheuklappen“ ganz einfach ignoriert. Durch ein einfaches Bücken, Augen Öffnen, und einen Schritt näher Treten eröffnet eine ganz neue Tierwelt und man kann mitunter zahlreiche Tiere bzw Tierspuren entdecken. Viele Tiere bekommt man nicht zu sehen, da sie vielleicht nachtaktiv oder scheu sind, andere sieht man wegen ihrer Körpergröße nicht. Jedoch bekommt man all diese Tiere oftmals anhand ihrer Spuren zu Gesicht. In den handelsüblichen Lehr- und Bestimmungsbüchern werden Tierspuren in folgende Gruppen zusammengefasst: Fährten, Bauten und Nester, Fraßspuren, Losungen (Kotspuren), Gewölle und Federn. Daneben gibt es natürlich auch noch eine Menge anderer Spuren wie zum Beispiel Skelettreste, akustische sowie Duft- und Sichtmarkierungen des Territoriums, Fegespuren, etc. Ein regelrechtes Sensibilisieren für die Umwelt der oft computergeschädigten Großstadtkinder stellt gerade im Bereich des 90 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren Fachlicher Teil Fährten/Tritte Als Fährte bezeichnet man im eigentlichen Sinne nur die auf dem Erdboden hinterlassenen „Fußabdrücke“ (im Jägerchargon Bodenverwundung) des Schalenwilds. Dies sind Elch-, Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- und Schwarzwild. Anhand dieser Trittsiegel kann man schon sehr viel über Lebensweise, Größe, Art und Vorkommen eines Tieres sagen. Tiere hinterlassen alle möglichen Spuren, seien es nun Trittsiegel, Fraßbilder, Losungen usw. Eine Spur im engeren Sinn ist ein Fußabdruck, den das Tier bei Bewegung auf weichem Grund hinterlässt. Diese Fußabdrücke haben ganz verschiedene Formen, die normalerweise einer bestimmten Fortbewegungsart entsprechen. Die Säugergliedmaßen enden entweder in Pfoten (Tatzen, Branten) oder Hufen (Schalen), alle Vögel treten mit den Zehen auf. […] Die Abdrücke der Pfoten der Säugetiere werden Spuren genannt, beim Schalenwild sind es Fährten oder Tritte, bei den Vögeln wird der Ausdruck „das Geläufe“ oder „der Tritt“ gebraucht. (Der Kosmos – Spurenführer, Spuren und Fährten einheimischer Tiere von M. Bouchner; Frankh´sche Verlagshandlung Stuttgart) Biber-Spuren Da wir wegen des vorangegangenem Hochwassers kaum Fährten/Tritte von huftragenden Tieren vorgefunden haben, jedoch aber eine wunderschöne Biberrutsche, haben wir diese führ die Schüler zu den Fährten gezählt. Die Biberrutsche dient dem Biber, um das Tragen schwerer Lasten zu erleichtern, sowie diese rasch über den Landweg ins Wasser zu bringen. Biberrutsche an der March Der Biber galt in Österreich lange als ausgestorben, wurde nach und nach wieder angezüchtet. Der kanadische Biber lässt sich eindeutig vom europäischen Biber durch seine geringere Chromosomenzahl unterscheiden. Der größte europäische Nager, der Biber (Castor fiber) hält sich vor allem in Auwäldern auf, die von Flüssen oder Bächen durchzogen sind. Er lebt familienweise oder in kleineren Kolonien, die aus mehreren Familien bestehen. Findet ein Biberpärchen ein hinreichend hohes Fluß- oder Bachufer, dann gräbt es darin seinen Bau, dessen Einschlupf unter der Wasseroberfläche ist. Der Bau führt schräg nach oben in die Uferböschung über den Wasserspiegel hinaus und endet in einem kugeligen Wohnkessel. (Der Kosmos – Spurenführer, Spuren und Fährten einheimischer Tiere von M. Bouchner; Frankh´sche Verlagshandlung Stuttgart). 91 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren Der Bau der Wohnstätte hängt eng mit der Nahrungsaufnahme und mit den Nahrungsgewohnheiten zusammen. Das Baumaterial besteht eigentlich aus Speiseüberresten. Um in der Vegetationszeit an die saftigen Kronen des Baumes zu gelangen, fällen sie durch das Annagen der Bäume mit ihren messerscharfen Zähnen Bäume von 40-50cm Stärke mit Leichtigkeit. Normalerweise beginnen sie in einer Höhe von etwa 50cm über dem Boden zu nagen, und beißen mit ihren orangeroten, mächtigen, stecheisenförmigen Nagezähnen unterschiedlich lange Späne heraus, die ein Indiz der Länge und Breite und der Kraft der Zähne und des Gebisses sind. Bauten und Nester einfache Lager oder leichte Vertiefungen direkt am Erdboden, deren Platz sich ständig ändern kann. Hirsche legen sich an geschützten Stellen zur Ruhe. Als zurückbleibende Spur finden wir nur niedergedrückte Vegetation. Rehe scharren Laub, Pflanzen und Zweige zur Seite um sich auf den nackten Erdboden zu legen. Wildschweine haben versteckte Gruben, in denen sie ruhen oder ihre Jungen zur Welt bringen, die man je nach Verwendung Schlaf – oder Wurfkessel nennt. Die Grube der Hasen wir als Sasse bezeichnet, die lediglich eine Bodenvertiefung ist, in der die Tiere getarnt und windgeschützt ruhen können. Ein zentraler Bestandteil jeder Tierart in ihrem Territorium ist eine zeitweise geschaffene Behausung. Diese Bauten und Nester bieten Schutz vor Feinden, der Witterung, dienen der Jungenaufzucht und als Schlafplatz, als Tagesversteck oder der Überwinterung. Kundige Spurenkenner können von der vorgefunden Behausung auf die entsprechende Tierart schließen. Die Wohnstätten unsere Säugetiere unterscheiden sich ganz beträchtlich. Man findet einfache Liegeplätze auf blankem Boden bis hinzu verzweigten und sich zum Teil über mehrere Etagen erstreckende Wohnbauten. Beispiele dafür sind, dass die Jungen von Hirschen, Rehen, Wildschweinen und Hasen bei der Geburt schon „voll“ entwickelt sind. Sie können sich schnell selbständig fortbewegen. Die Jungtiere brauchen keine „schützende“ Kinderstube, somit sind die Wohnplätze dieser Arten Spechthöhle Andere Säugetierarten bringen nackte und blinde Jungentiere zur Welt, die ein wärmendes, vor Feinden geschütztes Versteck benötigen. Dachs, Fuchs, Kaninchen, Murmeltier, Hamster, Maulwurf und verschiedene Mäusearten graben mit vie Aufwand weit verzweigte und über einen langen Zeitraum genutzte Erdbaue. 92 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren Vor allem bei Dachsen und Kaninchen entstehen mehrstöckige Bauten, in denen es über Flure miteinander verbundene Zimmer gibt. Eichhörnchen flechten aus Zweigen, Gräsern, Laub und anderen Materialien Nester in Büschen und Bäumen. Diese Nester können Vogelnestern sehr ähnlich sein. Biber bauen aus Ästen, Zweigen, Steinen und lehmigen Böden riesige Burgen, deren Ein und Ausgänge unterhab des Wasserspiegels liegen. Vögel bauen zur Eiablage und Kükenaufzucht Nester, die wie bei den Säugetieren unterschiedlich aufwändig angefertigt werden. (siehe Seite Fährten/Tritte) Fraßspuren Fraßspuren sind Spuren, die Tiere an Pflanzen oder anderen Tieren hinterlassen, von welchen sie sich ernähren. Je nach Fraßbild lässt sich oft der „Täter“ identifizieren. Durch Unterschiede im Gebiss, der Technik, der bevorzugten Nahrung, etc kann man an einer Fraßspur erkennen, um welches Tier es sich handeln könnte. So kann man beispielsweise an der Art in der eine Nuss geknackt wurde feststellen, welches Tier sich davon ernährt hat. 1) Biberspuren, 2+3) Fraßspuren des Blattkäfers und des Borkenkäfers Losungen und Gewölle Losungen wird der Kot der Säugetiere bezeichnet, der aber eher die Gruppe des festen Kots anspricht. Die Ausscheidungen von Vögeln, die bekanntlich eher flüssig sind, werden nicht als Losung bezeichnet. Gewölle sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, in Form eines ausgewürgten Speiballe ns. Oft haben Vögel einen zu schwachen Magensaft und können ihre Beute, die sie meist ganz verschlingen (z. B. Eulen) nicht verdauen 93 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren und scheiden Gewölle mitsamt Knochen, Fasern und Federn wieder aus. versorgen. Die überflüssigen Inhaltsstoffe werden in Form dieses Schaums abgegeben und dienen der Larve als Schutz, da man sie dadurch kaum sieht. Blattgallen (Cecidien) Blattgallen sind Wucherungen die durch tierische und auch pflanzliche Parasiten auf Blättern entstehen. Oftmals aber sind Gallwespen, Gallfliegen und Gallmücken dafür verantwortlich. Jedoch sich solche Wucherungen für den Wirt nicht schädlich. Schaumzikaden in Blattachseln (Foto: Pflanzengallen.de) Schaumzikaden Ein wichtiges Merkmal der Schaumzikaden ist, dass die Larven in selbst erzeugten Schaumhüllen leben, dem „Kuckucksspeichel“. Man findet die Larven in Blattachseln im Schaum versteckt. Sie saugen den Zellsaft aus den Pflanzen heraus um sich mit Eiweiß und anderen Nährstoffen zu 94 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren Fachdidaktik Von Anfang an war eines unserer Hauptlehrziele, die Schüler zu sensibilisieren und zu fördern, aufmerksamer durch die Natur zu gehen und lernen, die Augen offen zu halten. Uns war es aber auch wichtig, dass die Schüler selbstständig Tierspuren erkennen können und abschließend diese auch in die richtige Kategorie (Fraß, Fährte, etc) einordnen können. Weiters legten wir einen Schwerpunkt darauf, den Schülern zu vermitteln, dass es mehr Tierarten als Pflanzenarten weltweit gibt. Wichtig war uns das selbständige, spielerische Suchen nach Tierspuren und dabei auch einmal einen Stein oder Blatt umzudrehen. Schon auf dem Weg zu unserer Station, machten wir die meisten Gruppen darauf aufmerksam, was Spuren generell sind, natürlich auch, dass Menschen Spuren hinterlassen. Es gibt sozusagen kein Fortbewegen ohne Spuren zu hinterlassen. Bsp aus dem Alltag: Spuren eines Reifens in der weichen Erde, Zigarettenstummel, umgeknicktes Gras, der fallen gelassene Kaugummi uvm. Bei unserer Station hatten wir einige Vorzeigetierspuren vorbereitet, z.B. ein Beutelmeisennest, Fraßspuren des Borkenkäfers, Gewölle, Eierschalenreste der Singdrossel, Federn und Vogelkot auf einem Blatt, Muschelschalen, Schneckenhäuser uvm. Zuerst haben wir uns Mühe gegeben eine theoretische Einführung zu geben, die definitiv nicht wie ein Frontalunterricht „rüberkommen“ sollte, sondern unter Miteinbeziehung der Schüler auf die verschiedenen Tierspuren hinzuführen. Bei manchen Gruppen hat das reibungslos funktioniert, bei anderen Gruppen wieder rum waren wir diejenigen, die eher die Tierspuren erklärt haben. Einige Gruppen waren so interessiert, dass wir unter zu Hilfenahme ihrer zahlreichen Fragen vielen Fragen unsere Theorie erklären konnten. Spielerisch lernen in Form eines Wettbewerbes Als nächste Methode hatten wir einen kleinen Wettbewerb vorbereitet, wobei jeweils 2 Gruppen im Rahmen unserer Station losziehen und selbstständig nach Tierspuren suchen mussten. Als Ansporn versprachen wir der Gruppe, welche die meisten Spuren gefunden hat, einen Preis. Dieses selbstständige Suchen kam sowohl bei den 7. als auch 1. Klässlern erstaunlicherweise gut an und alle waren in höchster Motivation unterwegs, um das Waldstück an der March zu durchforsten. Der Platz, den wir für unsere Tierspurenstation gewählt haben, machte es den Schülern leicht ein Erfolgserlebnis zu haben, da in unmittelbarer Umgebung zahlreiche Tierspuren zu finden waren. Zum Abschluss wurden die gefundenen Spuren jeweils der anderen Gruppe vorgestellt und erklärt, was wiederum die Festigung des Stoffes (des Erlernten) förderte. Auf dem Weg zu unserer Station 95 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren oder beim selbständigen Suchen der Tierspuren hatten wir bei manchen Gruppen durch den Wind leichtes Spiel auf die Schaumzikaden, die das meiste Erstaunen der Schüler hervorgerufen haben, hinzuweisen. Man hat schon die sich bildenden Kreise in der March gesehen oder besser noch sogar die Tropfen auf der eigenen Haut gespürt. Oft hatten wir somit die beste Gelegenheit in unseren Unterricht einzusteigen und sofort für Begeisterung zu sorgen. Reflexion: Philipp Leider konnte ich bei der Feedback und Feedback-Feedback Runde nicht mehr dabei sein, hätte doch so einiges zu berichten gehabt. Die Organisation, das Essen und die Getränke waren einfach *mmmh que rico*! Auch dem/den "Heinzelmännchen" die ständig für Ordnung sorgten, ein herzliches Dankeschön. Zum Abschluss war natürlich jeder Sieger. Feierlich bekamen die Schüler von uns selbst gebastelte „Marchegg´s Tierspurenmeister 09“ Medaille überreicht. Einfach nur geschlaucht 96 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren War ich doch anfangs etwas skeptisch, was wir die durchgehend machen werden, dachte ich zuvor, dass die Vorbereitungen unserer Stationen doch sicherlich nicht die ganze Zeit in Anspruch nehmen werden, war die Sorge groß, von Langeweile erfasst zu werden. Aber ganz im Gegenteil, die spontanen Zwischendurch-Aktionen wie Vogelanlocken, Stationenpräsentationen, Feuermachen, Gelsen töten, usw. rundeten die Tage ab. Von großer Sorge geplagt die 7. Klassen würden "Raudis" und unkooperativ sein, stellten Tatjana und ich rasch fest, dass sie sehr wissbegierung und lustig sind und das Arbeiten mit ihnen richtig Spaß machte. Schon das get2gether und die Gruppeneinteilung nahm einiges an Spannung ab. Der Smalltalk von der Basis zur Station an der March brach dann endgültig das Eis. Zahlreiche euerer Tipps versuchten wir in unsere Stationen mit einzubauen, so hieß es von Anfang an, Schüler selbstständig arbeiten lassen - mussten wir feststellen, dass wir zu Beginn trotz des Vorsatzes die Schüler selbstständig arbeiten zu lassen immer wieder in die Lehrerrolle sowie des "Frontalunterrichtes" fielen. Allmählich besserte sich dies aber und wir nahmen uns selber etwas zurück, was uns doch aber immer wieder etwas schwer fiel. Die sofortigen Einzel-Feedbacks der Beobachter fand ich sehr gut, denn man konnte sich sofort Umstellen und es in der nächsten Gruppe versuchen zu ändern bzw. nicht nur versuchen, sondern sich auch zu ändern, es besser/anders zu machen. Von unserer Gruppeneinteilung mit den doch weit verbreiteten Stationen war die Zeiteinteilung die optimal gewählt, die halbe Stunde "Unterricht" war sehr eng bemessen, und die Wegstrecken zwischen den Stationen kosteten oft wertvolle Zeit. So musste meist bei der nächsten Gruppe die Einführung entweder Tatjana oder ich machen, was jeweils für den Anderen das Einfinden in die neue Gruppe ab und an nicht ganz einfach machte. Die Gruppeneinteilung "selbstständig" 4er Gruppen zu bilden bewies sich, trotz Zweifel es würde nicht funktionieren und es würden sich Unruhepole bilden, als sehr GUT. Ganz anders war es aber dann am Dienstag. Eine 1.Klasse begrüßte uns schon lautstark. Die Gruppeneinteilung erfolgte rasch. Gejammere nicht mit seinem besten Freund in einer Gruppe zu sein ging schnell durch die Runde. Mir schien, manche Schüler wurden regelrecht hinausgemobbt (Nein, mit dir geh ich nicht zusammen)! Hier wäre eine andere Art und Weise der Gruppenbildung angebracht gewesen. Unserer 1. Gruppe war glaub ich die schlimmste von allen, machten andauernd blöde und vor allem störende Bemerkungen. Kaum hat man mit einem Satz angefangen, um etwas zu erklären, fielen sie einem ins Wort. Dies raubte mir sogleich von Anfang an so viel Nerven, dass ich total unmotiviert in die nächsten Gruppen ging. Ich fand leider selber bei mir keine großartige Motivation mehr, dass ich der Meinung bin, dass ich durch meine schlechte Stimmung sicherlich den anderen Gruppen auch spüren ließ. Aber total witzig zu beobachten war, dass man durch kleine "Naturwunder" – z.B. mit den "scheissenden" Schaumzikaden die Aufmerksamkeit an sich ziehen konnte. Hier war es ganz wichtig, detaillierte Aufgabenstellungen zu geben, dann konnte man die Schüler auch in den Bann der Natur und des (Er-) Forschen ziehen. 97 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren Sehr interessant fand ich auch die unterschiede der Persönlichkeiten in der Gruppe und wenn man mit ihnen alleine sprach bzw die unterschiedlichen Gruppen. Von den total interessierten Schülern (ein Schüler hielt so ziemlich alles mit der Digicam fest) bis hin zu jenen, die nicht einmal ein leeres Schneckenhaus angriffen, waren dabei. Die Situation der weiten Wege zwischen den Gruppen und das allgemeine Wissen, dass durch die langen Wegzeiten oft viel Lehrzeit verloren geht, änderte nichts an der weiten Gruppeneinteilung. Eine kleine Änderung erleichterte die Wegzeiten zwischen zwei Gruppen, jedoch nicht bei unserer. aufgedreht und wie wir danach von einem Lehrer erfahren haben, noch dazu Energydrinks getrunken hatten. Eine Gruppe ist mir in bester Erinnerung geblieben, da sie eine Frage nach der anderen gestellt haben. Ich hätte nie gedacht, dass grade diese Gruppe nach der Aufgabenstellung beigeistert losgerannt ist, um selbst zu suchen. Es kamen Fragen wie „ Haben Käfer eigentlich Orgasmen?“, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben und mir bewusst gemacht haben, dass man als Lehrerin ein breites Spektrum an Wissen beherbergen muss und auf Einiges eingestellt sein muss. Mit einem gemischten Gefühl und mit mindestens einem Liter weniger Blut, dafür aber gut genährten Gelsen ;-) verließ ich am Dienstag Marchegg. Die zahlreichen Bilder sprechen für sich! Tatjana Da wir das Glück hatten eine 1. und eine 7. Klasse zu unterrichten, konnten wir klar sehen, dass die Lehrziele zwar grob beibehalten werden konnten, aber man in seiner Weise zu unterrichten variieren musste. Zuerst war die 7. Klasse da, sie waren sehr interessiert und man konnte das Fachwissen der Gruppen vertiefen. Bei der 1. Klasse stand eher das spielerische Suchen im Vordergrund. Da wir von der 7.Klasse, die sehr motiviert war, war der nächste Tag für mich zu Beginn etwas schockierend. Die Schüler waren sehr Tatjana, stehts gut gelaunt 98 Tatjana Rinas & Philipp Wiatschka: Tierspuren Bevor wir in unseren Freilandunterricht gestartet sind, hatte ich schon einen gewissen Plan, wie es ablaufen könnte. Auch die Vorbereitungen, die man macht, auch in Bezug auf Materialien, sind zwar wichtig, aber man merkt schnell, dass man sehr flexibel sein muss, in Hinblick auf die unterschiedlichen Schülerinnen mit unterschiedlichem Wissen, sowie auf z.B. das Wetter und die Umgebung und seine Art Unterricht zu gestalten. Als wichtig empfunden habe ich die 2 Tage Vorbereitungszeit, die uns gegeben worden ist, um unsere Station zu suchen und uns einzugewöhnen. Das Feedback fand ich passend und zwingend notwendig, da wir als angehende Lehrerinnen noch nicht sehr viel Erfahrung haben. Es hat mir sehr geholfen, um gewisse Vorgänge beim Wechsel der Gruppen sofort zu ändern und darauf zu achten, nicht dieselben Fehler zu machen. Natürlich hat jeder seine individuelle Art zu unterrichten, schon aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit, jedoch gibt es einfache Grundsätze, die man beachten muss, um den Schülerinnen das Optimum an Wissen weitergeben zu können, z.B. bei Fragen nicht sofort die Antworten zu geben! Ich selbst bin froh darüber, dass die Exkursion in unseren Studienplan Pflicht ist, da es keine bessere Erfahrung gibt, als selbst im Freiland zu sein und die Natur erleben zu können. Natürlich hat man privat auch die Möglichkeit hinaus zu gehen, jedoch ist man oft so beschäftigt mit anderen zu absolvierenden Prüfungen, dass einfach die Gelegenheiten fehlen. Außerdem fehlt auch bei vorhandenem Interesse einfach auch das Wissen, um bestimmte Dinge zu erkennen. Am Anfang als wir die verschiedenen kleineren Exkursionen gemacht haben, war ich etwas enttäuscht über mich selbst, da ich eigentlich dachte, dass ich im 6. Semester schon etwas Wissen angesammelt hatte, jedoch gemerkt habe, dass ich vieles vergessen habe und das ich noch sehr viel zu lernen habe. Dadurch hat sich definitiv meine Motivation gesteigert, so viel wie möglich mit nach Hause zu nehmen und zu lernen. Es waren spannende Sachen dabei, ob die morgendliche Vogelexkursion, die nächtliche Froschexkursion und die Storchenkolonie. Ich bin meinem Ziel etwas mehr „biologisch zu denken“ auf jeden Fall näher gekommen. Quellenangabe: Eisenreich, Wilhelm: Der BLV-Naturführer für unterwegs, 9. Auflage, BLV; München, 2008 Hecker, Frank: Welche Tierspur ist das?, Kosmos, Stuttgart, 2006 Richarz, Klaus: Tierspuren, Ulmer, Stuttgart, 2006 Ohnesorge, Gerd: Tierspuren und Fährten in Feld und Wald, Naturbuchverlag, Augsburg, 1995 M. Bouchner: Der Kosmos Spurenführer, Frankh´sche Verlagshandlung, Stuttgart K. Brandt – H.Behnke: Fährten und Spurenkunde, 11. Auflage, Paul Parey Verlag, Bang/Dahlström: Tierspuren, BLV-Bestimmungsbuch, 99 Überschwemmungsökologie am Beispiel wasserlebender Evertebraten von Daniel Kirby und Christoph Eichhorn Fachlicher Teil Urzeitkrebse Einführung Die Urzeitkrebse gehören innerhalb der Krebstiere (Crustacea) zu der Klasse der Kiemenfußkrebse (Branchiopoden). Diese ist eine uralte Krebsgruppe. Erste Vertreter wie etwa der in Schweden entdeckte fossile Anostrake Rehbachiella kinnekullensis haben ein Alter von mehr als 500 Mio. Jahren. Ursprünglich traten diese Vertreter noch im Meer auf, durch die sich im Devon ausbreitenden Knochenfische blieben den Groß-Branchiopoden nur die instabilen Lebensräume der temporären Gewässer (Hödl & Eder, 2000). Auch heute sind die Lebensräume der Urzeitkrebse sogenannte „astatische“ Gewässer. Die älteste rezente Art ist Triops cancriformis mit einem Alter von mehr als 220 Millionen Jahren. Damit ist diese Art die älteste noch lebende Tierart der Welt (http://www.urzeitkrebse.at; Zugriff am 02.04.2009). Astatische (temporäre) Gewässer sind Gewässer, die hinsichtlich ihrer Lebenswelt und Umweltbedingungen (Wasserführung, Temperatur, Salzgehalt,...) beträchtliche Schwankungen aufweisen. 100 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Diese Gewässer treten unregelmäßig (in Pfützen) beziehungsweise regelmäßig (etwa nach Überschwemmungen) auf. Solche Überschwemmungstümpel treten zum Beispiel entlang von Flüssen wie der March auf. (Hödl & Eder, 2000) Das Besondere an unserem Standpunkt an der March, der Langen Luß, ist außerdem, dass es einer der wenigen Bereiche entlang der March ist, der nicht durch Hochwasserschutzdämme „verbaut“ wurde. Dadurch gelangt das Wasser bei Hochwasser in relativ weit von der March gelegene Bereiche. Solche „Extremstandorte“ sind auch dafür verantwortlich, dass bei den Urzeitkrebsen physiologische Spezialisierungen entstanden sind. Anpassungen an den Lebensraum Dies ist einerseits die rasche Entwicklung der geschlüpften Naupliuslarve zum geschlechtsreifen Krebs, welche in bis zu 8 Tagen abgeschlossen sein kann (Gottwald & Hödl, 1996). Die wahrscheinlich beeindruckendste Anpassung der Urzeitkrebse ist aber sicherlich die Ausbildung von „Dauereiern“. Hierbei handelt es sich um encystierte Embryonen im Gastrulastadium, welche Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte an Trockenheit überstehen können (Hödl & Eder, 2000). Diese Anpassung an ihren Lebensraum könnte man mit dem Reifen eines Pflanzensamens vergleichen. Solange die Bedingungen ungünstig sind (Trockenheit beziehungsweise oder zu geringe Wassertemperatur) überdauern die „Dauereier“, und wenn es zu einer Verbesserung der Bedingungen kommt (Hochwasser, Steigen der Wassertemperatur) schlüpfen die Naupiluslarven. Gefährdung der Urzeitkrebse Durch die in den letzten Jahrzehnten zunehmenden Flussregulierungen und Zuschüttungen aufgrund der Landwirtschaft sind die Lebensräume der Urzeitkrebse und ihre Artenvielfalt drastisch zurückgegangen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, ist es erforderlich, die Flächen, wo diese Tiere vorkommen, zu schützen und die hydrologische Dynamik der Lebensräume zu erhalten. Die „Tümpelwiese“ in der Nähe des Marchegger Pulverturmes wurde schon 1982 aufgrund des österreichweit einzigen Vorkommen von Chirocephalus shadini (dem westlichsten Vorkommen in Europa) zum Schutzgebiet umgewidmet (Hödl & Eder, 2000). 101 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Der für mich persönlich wichtigste Nutzen der Urzeitkrebse ist die Verwendung der Tiere in der Schule und in der Lehre. Durch ihre lange Überlebensdauer sind sowohl Schüler als auch Studenten doch sehr leicht für Urzeitkrebse zu faszinieren. Neben der Veranschaulichung der ursprünglichen Merkmale der Crustaceen eignen sie sich auch als Beispiel für Anpassungen an extreme Habitate. Es ist sicherlich nicht ohne Grund, dass die „Dauereier“ der Urzeitkrebse immer wieder in diversen Kinder- und Jugendmagazinen beigelegt werden. Selbst Tiere züchten zu können, welche älter als die Dinosaurier sind, hat bei den Kindern und Jugendlichen immer einen besonderen Reiz. Systematik der Urzeitkrebse Innerhalb der Klasse der Kiemenfüßer (Branchiopoda) unterscheidet man fünf Ordnungen: • Feenkrebse (Anostraca) • Rückenschaler (Notostraca) • Laevicaudata • Spinicaudata (früher mit den Laevicaudata als Muschelschaler, Conchostraca, zusammengefasst) • Cladocera (Wasserflöhe, nicht zu den „Urzeitkrebsen“ gezählt) (siehe Stammbaum, aus: Eder & Hödl, 2000) Anostraca (Feenkrebse) Anostraken haben keine Schale. Sie schwimmen mit der Bauchseite nach oben und besitzen 11 Beinpaare, welche 3 unterschiedliche Funktionen haben. Die flachen, blattförmigen Beine dienen nicht nur der Fortbewegung, sondern fungieren auch als Kiemen. Außerdem wird mit Hilfe der Beine Nahrung aus dem Wasser filtriert, wie etwa Algen oder Detritus. Mithilfe der Beine wird die Nahrung dann zum Mund weitertransportiert. Sie haben gestielte Komplexaugen und im Vergleich zu den Rückenschalern fehlt ihnen der Rückenschild. 102 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Sie orientieren sich bei ihrer Fortbewegung nach dem Licht, das heißt sie drehen die Bauchseite immer zum Licht. Dies kann man mit einer Schulklasse auch experimentell nachweisen. Bei den in Österreich vorkommenden Feenkrebsen findet man zumeist gleich viele männliche wie weibliche Tiere. Die Eier werden in einem Brutsack transportiert und werden meist im freien Wasser abgeworfen und sinken dann zu Boden. In Österreich vorkommende Arten: Branchinecta ferox Branchinecta orientalis Branchipus schaefferi Tanymastix stagnalis Chirocephalus carnuntanus Chirocephalus shadini Eubranchibus grubii Streptocephalus torvicornis Bei unserer Exkursion konnten wir Eubranchipus grubii bei unserem Haustümpel und Chirocephalus shadini beim Pulverturm in Marchegg finden. Bei Eubranchipus grubii konnte man sehr gut die Zweiten Antennen der Männchen beobachten, die bei der Paarung verwendet werden, um das Weibchen zu umklammern. Notostraca (Rückenschaler) Namensgebend für den wissenschaftlichen und deutschen Namen dieser Ordnung ist ein großer, unpaarer Rückenschild. Sie bewegen sich mit der Bauchseite nach unten fort, manchmal schwimmen sie aber auch an der Wasseroberfläche mit der Bauchseite nach oben, wenn zum Beispiel Sauerstoffmangel besteht. Hauptsächlich bewegen sie sich entlang des Bodens fort, um dort Nahrung wie etwas Detritus zu finden. Sie ernähren sich aber im Gegensatz zu den Feenkrebsen auch räuberisch von zum Beispiel kleinen Wasserinsekten larven. Tastorgan statt der Antennen ist das mit stark verlängerten Enditen ausgestatte 1.Beinpaar. Drauf folgen mindestens 40 Paar blattartige Beinpaare, die nach hinten kleiner werden. Notostraca haben innere Komplexaugen. Häufig findet man Notostraca und Anostraca gleichzeitig, wodurch die Feenkrebse auch eine gute Nahrungsquelle für die Rückenschaler darstellen. Man findet bei den heimischen Rückenschalern meistens Weibchen. Es ist noch nicht vollständig geklärt, ob die Fortpflanzung über geschlechtliche Vermehrung, Parthenogenese oder Selbstbefruchtung erfolgt. Es existieren jedoch Annahmen dass diverse Mischformen vorkommen. Die reifen Eier werden in zu Bruttaschen umgewandelte Anhänge des 11. Beinpaares getragen. (http://www.urzeitkrebse.at/; Zugriff am 02.04.2009) In Österreich kommen folgende 2 Vertreter vor: Lepidurus apus Triops cancriformis 103 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Diese beiden Arten treten normalerweise jahreszeitlich getrennt voneinander auf, da Lepidurus apus schon früher zu finden ist, da sie schon bei niedrigeren Temperaturen schlüpfen als Triops cancriformis. Wir hatten heuer das Glück, dass in der „Triopssenke“ beide Arten gleichzeitig zu finden waren, was nicht allzu häufig der Fall ist. Man konnte jedoch erkennen, dass Triops cancriformis erst geschlüpft ist, während Lepidurus apus schon voll ausgewachsen war. „Conchostraca“ Muschelschaler sind relativ kleine, von einer zweiklapprigen Schale umhüllte Krebse. Sie liegen zumeist seitlich auf dem Bodengrund und graben sich in den Schlamm ähnlich wie Muscheln ein. Sie bewegen sich mit dem Rücken nach oben fort und filtrieren Nahrung entweder aus dem Wasser oder aus dem Schlamm. Muschelschaler haben eine sehr schnelle Entwicklung, eine Anpassung an den kurzzeitig bestehenden Lebensraum (temporäre Gewässer). In Österreich kommen sechs Arten vor: Spinicaudata Cyzicus tetracerus Eoleptestheria ticinensis Leptestheria dahalacensis Imnadia yeyetta Limnadia lenticularis Laevicaudata Lynceus brachyurus Wasserinsekten Evolution der Wasserinsekten Der Stamm der Arthropoda umfasst Chelicerata (Kieferklauenträger), Crustacea (Krusten-/Krebstiere) und Tracheata (Tracheentiere), sowie der rezent nicht mehr vorkommenden Trilobita. Die Systematik der Arthropoda ist bis heute umstritten. In der klassischen Literatur findet sich die folgende systematische Darstellung, die in erster Linie auf morphologischen Untersuchungen beruht: Arthropoda ┌──N. N. │ ├──Chelicerata │ └──†Trilobita │ └──Mandibulata ├──Crustacea └──Tracheata ├──Hexapoda (-> Insecta) └──Myriapoda Nach neuesten molekularbiologischen Untersuchungen, sowie morphologischen Studien an Remipedien (kleine, augenlose Krebse) dürften Remipedia und Malacostraca („höhere Krebse“) mit den Insekten näher verwandt sein, als mit den „primitiven“ Krebsen, wie 104 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Wasserflöhen oder Ruderfußkrebsen1, was zu folgendem Cladogramm der Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Mandibulata führt: Insekten leben überwiegend an Land und nutzen mit Hilfe des Tracheensystems Luft als Atemmedium. Dies, sowie eine allmähliche Absenkung der cuticulären Permeabilität machte sie zu erfolgreichen Landlebewesen, die eine Vielzahl von Lebensräumen erschließen konnte. Lebensräume für Wasserinsekten Mehr noch als an Land ist der Lebensraum Wasser in eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Kleinstlebensräumen unterteilt, denn es kommen zu den allgegenwärtigen Umweltqualitäten, wie Angebot an Licht, Nahrung und Wärme im Wasser noch weitere dazu, wie etwa Strömungsgeschwindigkeit, Sauerstoffgehalt und der Gehalt an im Wasser gelösten Stoffen. Das geht so weit, dass einige Wasserinsekten sehr eng an spezielle Umweltbedingungen gebunden sind und diese durch ihr Vorkommen anzeigen. Entsprechend vielfältig sind die Ausprägungen der Formen. Unumstritten ist, dass die ursprünglichen Arthropoda im Meer entstanden sind und dass die Hexapoda, die sich aus ihnen entwickelten, in weiterer Folge das Land eroberten, also von einer aquatischen zu einer terrestrischen Lebensweise übergegangen sind. Sekundär haben verschiedene taxonomische Gruppen (polyphyletisch) den Lebensraum Wasser wieder erschlossen. 1 http://www.journalmed.de/newsview.php?id=3864 Insekten haben also mehrfach vom Land aus wieder aquatische Lebensräume besiedelt. Wobei Wasserinsekten selten reine Wassertiere sind. Oft leben nur die Larven im Wasser und die Adultstadien an Land, wie zum Beispiel bei Eintagsfliegen. Die Entwicklung der Insekten läuft so ab, dass jedes Individuum eine Metamorphose durchläuft – je nach Art der Metamorphose unterscheidet man hemimetabole (Ei -> Larve -> Imago) oder holometabole Insekten (Ei -> Larve -> Puppe -> Imago). Bei Insekten, die zumindest ein Entwicklungsstadium terrestrisch verbringen spricht man von amphibischen Lebensweisen. 105 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Anpassungen der Atmungsorgane Die Abbildung zeigt den Wechsel der Lebensräume, im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus und der Entwicklung der Tiere. Atmung ist der Prozess der Sauerstoffaufnahme und der Kohlendioxidabgabe. Die Unterschiede der Atemmedien, also den Medien aus denen der Sauerstoff entnommen wird beeinflussen den Bau und die Funktion der Atemorgane. Während in der Luft Sauerstoff zu 21% vorliegt, sind lediglich 0,5% im Wasser gelöst, das entspricht nur 1/40, d.h. sauerstoffreiches Wasser muss im allgemeinen über Atemorgane ventiliert werden. Aufgrund der höheren Viskosität und Dichte des Wassers ist der Arbeitsaufwand Wasser durch Atemorgane zu bewegen viel größer und es wird mehr Energie verbraucht (z.B. Schlagfrequenz von Kiemen der Eintagsfliegenlarven). Vermutlich war es demnach vorteilhafter für Insekten, bzw. weniger aufwendig, Atemstrategien zu entwickeln, die Luft als Atemmedium beibehielten. Wasserinsekten sind Atmungs- und Bewegungsspezialisten Nachdem im Laufe der Evolution die primären Atemorgane der Vorfahren verlorengegangen waren, entwickelten diese Gruppen andere Organe bzw. bildeten Strukturen um sowie Verhaltensweisen aus um mit den respiratorischen Schwierigkeiten im Medium Wasser zurecht zu kommen. Die einfachste Möglichkeit im Wasser zu atmen ist der Gasaustausch über die Körperoberfläche, wie z.B. bei der Buschelmückenlarve. 106 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Andere Wasserinsekten besitzen entweder ein offenes oder geschlossenes Tracheensystem und nutzen Luft, oder Wasser als Atemmedium. Offene Stigmen, Luft als Atemmedium: Bei einigen Formen mit offenen Stigmen münden diese in einen Schnorchel, der die Wasseroberfläche durchstößt und direkt mit Luft in Verbindung steht, z.B. Wasserskorpion oder Stechmückenlarve. Einige Insekten die ebenfalls an die Oberfläche müssen um Luft zu „tanken“, pumpen diese in äußere Kammern, die mit dem Tracheensystem in Verbindung stehen, z.B. Rückenschwimmer oder Dytiscidae (Luftkammern unter der Flügeldecke). Diese Insekten müssen in regelmäßigen Abständen an die Oberfläche kommen, leben daher meist auch in Oberflächennähe. Sie müssen den zusätzlichen Auftrieb den ihr Luftvorrat darstellt kompensieren und sind dadurch in ihrer Lebensweise eingeschränkt. 107 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Offene Stigmen, Wasser als Atemmedium: Tracheengängen durchzogen. Der Sauerstoff diffundiert in diese feinen Gänge. Z.B. Eintagsfliegenlarven, Libellenlarven Die Tiere bauen ebenfalls eine Lufthülle auf, jedoch diffundiert der im Wasser gelöste Sauerstoff in diese Gashülle hinein, sowie das Kohlendioxid entsprechend eines Gradienten in das umgebende Wasser hinein. Ebenso diffundiert jedoch Stickstoff ins Wasser, wodurch die respiratorische Oberfläche der Lufthülle verkleinert wird und die Blase regelmäßig erneuert werden muss. Diese Art der Atmung nennt man auch „physikalische Kieme“. Geschlossene Stigmen, Wasser als Atemmedium: Bei Tracheenkiemen handelt es sich um eine spezielle Form der Hautatmung. Die blattförmigen Hautausstülpungen sind von feinen 108 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Fachdidaktik Lehrziele Anpassungen der Urzeitkrebse an astatische Gewässer. Folgende Fragen sollten von den Schülern im Anschluss an unsere Station beantwortet werden können: Warum leben hier (in diesem Lebensraum) Urzeitkrebse? Wie konnten die Urzeitkrebse so lange Zeit unverändert überleben? Welche Ordnungen (Arten) von Urzeitkrebsen gibt es und welche kommen in Österreich beziehungsweise in Marchegg vor? Wasserinsekten und ihre Anpassungen an den Lebensraum Wasser. Folgende Fragen sollten von den Schülern beantwortet werden, bzw. sollten ihnen bewusst sein: Im Gegensatz zu Gruppen aus früheren Jahren unterließen wir es, nach diesem Überblick über die Theorie hinter den zu erwartenden Insekten zusätzlich Steckbriefe oder dergleichen über einzelne Tiere bzw. Gattungen auszuarbeiten, da wir abwarten wollten, was wir denn eigentlich alles zu Gesicht bekommen würden, während der Vorbereitung vor Ort. Speziell ich (Christoph) war mir relativ sicher, durch mein Vorstudium gewappnet zu sein, was Artenkunde und Lebensweise betrifft. Als Backup hatten wir ausreichend Bestimmungsliteratur mitgebracht, um uns gegebenenfalls noch das eine oder andere anzueignen oder in Erinnerung zu rufen. Welche Anpassungen an das Wasser haben Wasserinsekten hinsichtlich der Atmung und der Fortbewegung? Wie ernähren sich die verschiedenen Wasserinsekten? Insekten haben zum überwiegenden Teil eine terrestrische Lebensweise. Die Schüler sollten eine Idee davon bekommen, dass sich Lebewesen mit bestimmten Grundbauplan an verschiedene Lebensräume angepasst haben (sowohl konvergent als auch divergent). Insgeheim wollten wir den Schülern auch vermitteln, wie wichtig es in der Biologie ist, zu beobachten und das Gesehene zu beschreiben 109 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten und dass alles, was man sieht, eine Bedeutung hat, sprich Form und Funktion immer in engem Zusammenhang stehen. Methoden Unser Konzept wurde in zwischen den einzelnen Gruppen und speziell zwischen den beiden Tagen fortlaufend verändert beziehungsweise variiert. Vor allem am ersten Tag hatten wir doch sehr mit der begrenzten Zeit zu kämpfen. Ursprünglich war geplant: Kurze Einführung – Warum leben hier Urzeitkrebse; Wie konnten sie so lange überleben, Was für Arten gibt es? Keschern – Die SchülerInnen sollen lernen, richtig zu keschern Selbständiges Beobachten der gefangenen Tiere anhand vorgegebener Beobachtungsleitfragen – Was für Tiere kenne ich schon? Wie schaut das Tier aus? Warum schaut das Tier so aus? Wofür könnten die einzelnen Anpassungen gut sein? Unterstützen durch Binos, Lupen, Lupendosen, Beobachtungsgläser, Bestimmungsbücher (Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher?). Gegebenenfalls Zeichnen der beobachteten Tiere. Nochmalige Vertiefung mit dem eben gelernten / beobachteten durch Zeichnungen beziehungsweise Vorstellen des untersuchten Tieres („Expertenwissen“) in der Gruppe. Hierbei wollten wir spontan entscheiden, für welche Methode wir uns entscheiden würden. Wir überlegten uns vorab, welche Experimente wir durchführen könnten, um den Schülern die von uns behandelten theoretischen Dinge möglichst anschaulich darzustellen – als am wirkungsvollsten hat sich das Mineralwasserexperiment erwiesen, in dem die Urzeitkrebse als Kiemenatmer betäubt wurden, Wasserinsekten, die Luft oder Luftvorräte zum Atmen nutzen, jedoch völlig unbeeindruckt ließen. Sehr wichtig war es uns, den Schülern angemessen viel Zeit zu geben, die Tiere zu beobachten. Zur Evaluation war geplant, sie kurz über die Tiere, die sie sich ausgesucht hatten, oder die ihnen zugewiesen wurden, zu referieren. Dies sollte auch der Wissenssicherung dienen, sowie den anderen Schülern einen Überblick über alle Tiere geben. 110 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Über den Einsatz der jeweiligen Methoden an den einzelnen Tagen gehen wir weiter unten noch genauer ein. Didaktische Reduktion Da wir wussten, dass einmal eine erste und einmal eine zweite Klasse AHS kommen würde, war unser Plan, dass wir wirklich nur mit den Basics arbeiten wollten und unsere Lehrziele möglichst vereinfacht den Schülern näherbringen wollten. Da wir nicht wussten, inwieweit die Schülerinnen schon mit dem von uns behandelten Stoff vertraut waren, mussten wir eine sehr breite Planung vornehmen, um uns dann auf das jeweilige Niveau einzustellen zu können. Da wir uns innerhalb des Kurses darauf einigten, dass die Schüler jeweils eine halbe Stunde Zeit hatten, um die Station zu absolvieren, mussten wir uns ein recht straffes Konzept überlegen, bzw. uns darauf einigen, welches die wichtigsten Themen waren, die wir unbedingt behandeln wollten. Was auch eine gewisse Herausforderung darstellte war, dass wir unser Thema am Tag bevor die erste Klasse kam, den Studenten näher bringen sollten, was natürlich von den Inhalten nur wenig damit zu tun hatte, was wir dann den SchülerInnen näher bringen wollten. Des weiteren wollten wir unbedingt so praxisnah wie möglich arbeiten, das heißt, wir wollten die Schüler so gut wie möglich in die „Wissenserarbeitung“ mit einbauen. Wie weit uns das gelungen ist, schildern wir näher in der Reflexion. Um zu sehen was die Schüler so alles finden würden, machten wir uns vorab daran zu Keschern und möglichst viele verschiedene Organismen bei Bedarf „vorrätig“ zu haben. Reflexion Daniel 1.Tag Als die Klasse ankam, hatte ich gleich das Gefühl, dass diese Klasse sehr interessiert und motiviert war. Gleich die erste Gruppe, welche uns besuchte, war sehr interessiert und war sehr begeisterungsfähig. Alles in allem lief es mit dieser Gruppe sehr gut, außer dass es mit der Zeit sehr knapp wurde und wir eigentlich mitten im Programm abbrechen mussten. Schon da war uns klar, dass wir unser Konzept doch etwas ändern mussten, damit wir mit der Zeit auskamen. Da wir relativ weit weg vom Haus gelegen waren, verloren wir im Durchschnitt immer an die 5 Minuten. So variierten wir eigentlich laufend unser Programm, angefangen dass wir die Einführung zu Beginn komplett wegließen und gleich mit dem Keschern begannen bis einer Verkürzung der Kescherzeit, wo die Schüler aber dafür sich intensiver mit einem gefangenen Tier beschäftigen sollten. Ich wusste prinzipiell, dass unser Konzept nicht so schlecht war, jedoch hatten wir den gesamten ersten Tag damit zu kämpfen, die Prioritäten so zu setzen, dass einerseits ein größtmögliches Interesse bei den Schülern geweckt wird und andererseits wir auch unsere Lehrziele vermitteln konnten. Nach dem ersten Tag und dem (hilfreichen) Feedback überlegte ich mir, was für mich (in der Rolle des Schülers) von den Inhalten, welche wir vermitteln wollten, so interessant waren, dass sie unbedingt erwähnt werden mussten und welche eher „vernachlässigbar“ wären. Darauf hin notierte ich die Fragen, welche den Schülern vermitteln wollte, auf ein Flip-Chart, wodurch meine Ziele auch für die Schüler von Anfang an veranschaulicht wurden. 111 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Des Weiteren wollte ich den „Forschungsanteil“ noch mehr erhöhen, da am ersten Tag nie genug Zeit blieb, dass die SchülerInnen sich wirklich intensiv selbst mit einem von ihnen gefangenen Tier auseinandersetzen. Dafür kürzte ich den Einstieg wirklich auf ein Minimum und auch die Kescherzeit auf zwei Durchgänge. Als Orientierungshilfe für die Schüler erstellte ich noch einen „Beobachtungsleitfaden“, mit dessen Hilfe sie gleich wussten, was sie bei dem gefangenen Tier zu beobachten hatten. Dieser Leitfaden orientierte sich wiederum an die Lehrziele, welche ich vermitteln wollte, also Wie bewegt sich das Tier fort? Wie ist sein Körperbau? Wie atmet das Tier? Hierfür ließ ich die Schüler mit Mineralwasser experimentieren. Urzeitkrebse konnten damit betäubt werden, Rückenschwimmer zum Beispiel nicht. Wie ernährt sich das Tier? Wie schauen die Mundwerkzeuge aus? Zum Abschluss sollten die SchülerInnen ihr erarbeitetes Wissen ihren MitschülerInnen in einem Kurzreferat näher bringen. 2.Tag Mein neues Konzept, welches ich am Vortag erstellt hatte, funktionierte gleich zu Beginn relativ gut, außer dass wieder keine Zeit blieb für die Kurzreferate. Dies führte ich darauf zurück, dass ich jede/n der 4 SchülerInnen ein Tier selbst Beobachten und Erarbeiten ließ, wodurch wir aber auch für die Einzelbetreuung mehr Zeit benötigten. Daher entschieden wir uns im zweiten Durchgang dafür, immer 2 und 2 SchülerInnen ein Tier gemeinsam beobachten zu lassen. So blieb dann ach erstmals auch Zeit für die Kurzreferate der Schüler, wodurch ihr eben „gelerntes“ nochmals wiederholt werden konnte. Als letzten Kritikpunkt bekamen wir noch den Tipp, die SchülerInnen durch Fragen nicht zu sehr „anzuleiten“. Auch das versuchten wir umzusetzen, wobei die erfolgreiche Umsetzung auch immer von der jeweiligen Gruppe abhing. War die Gruppe interessiert, so mussten wir auch nicht wirklich „helfen“. War die Gruppe jedoch eher unmotiviert, so musste man immer dahinter sein, dass die SchülerInnen nicht nur in die Luft schauten. Die vorletzte Gruppe war dann wirklich ein perfekter Abschluss. Die SchülerInnen waren hoch interessiert und richtig „wissbegierig“. So kam es sogar zu der Situation, dass die SchülerInnen nach ihren Kurzreferaten mich noch weiter mit Fragen über Urzeitkrebse löcherten und unbedingt mehr erfahren wollten. So hatte ich es geschafft, dass nicht mehr ich den SchülerInnen 112 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten etwas lernen wollte, sondern dass die SchülerInnen etwas von mir lernen wollten. So konnte ich dann meine (eigentlich eingesparte) Theorie von der Einführung an die SchülerInnen bringen, jedoch mit dem Unterschied, dass sie mich danach fragten und nicht weil ich sie ihnen vermitteln wollte. Das war wirklich eine Erfahrung, wo man spürt, warum man Lehrer werden möchte. Reflexion Christoph 1.Tag Ein paar Dinge vorab... Anfangs zeigte sich gleich, dass der relativ abgelegene Standort die Dinge nicht leichter machen würde und wir sehr straff mit unseren 30 Minuten umgehen mussten. So war es z.B. schon aufgrund der Unterschiedlichen Bereitschaft der Schüler schnell zu gehen nicht immer möglich, die Gruppen rechtzeitig zum Beginn der global startenden „Einheit“ bei der Station zu haben. Gleichfalls bemühten wir uns die Gruppen trotzdem rechtzeitig zu übergeben. Nachdem Daniel mit der Einleitung über die Urzeitkrebse begann, übernahm ich den Part, die Schüler zu ihrer nächsten Station zu bringen, während die zu uns kommenden zu unser von weitem sichtbaren Station gehen konnten. Diese Arbeitsteilung war unbedingt nötig und zeigte deutlich, dass sich „Lehrer sein“ nicht immer nur auf Wissensvermittlung beschränkt, sondern auch oft mit Organisation (von reibungslosen Abläufen). Die Gruppen waren sowohl intern, als auch verglichen miteinander sehr heterogen, was Aufmerksamkeit, Disziplin und Interesse anging, desshalb war keine Gruppe wie die andere, wodurch wir auch laufend gezwungen waren unser Konzept anzupassen, einzelne Teile zu verlängern oder abzukürzen. Dies beeinflusste meiner Meinung nach auch stark die verschiedenen Feedbacks, die wir bekamen. Konkret nun zu den Erfahrungen mit den Schülern: Gleich die erste Gruppe war eigentlich überragend interessiert und nach der kurzen Einleitung und dem Keschern bzw. der Einführung in die Beobachtungskriterien, arbeiteten sie sofort mit und, was für mich sehr angenehm war, stellten viele Fragen. Ich bemühte mich auf alle Fragen einzugehen und lies kurzfristig Konzept Konzept sein, verabschiedete mich davon und versuchte Situationsbeding einfach so viele Fragen wie möglich zu beantworten, wobei ich sehr zufrieden war, dass auch die eigentlichen Gebiete, die wir die Schüler ohnehin erarbeiten lassen wollten ganz von selbst zur Sprache kamen. Speziell diese Gruppe hatte mir gezeigt, dass ich fachlich eigentlich sehr gut vorbereitet war. Nach dieser Gruppe und dem kurzen, durchwegs positiven Feedback von Erich war ich regelrecht euphorisch, was sich jedoch leider schnell wandeln sollte. Die nachfolgenden Gruppen waren teils interessiert, teils weniger, doch sie arbeiteten mit und mit kleinen Anleitungen erledigten Sie ihre Beobachtungsaufgaben, wobei es uns manchmal schwer fiel, die ausreichende Beobachtungszeit zu geben und nicht direkt unser Wissen an den Schüler zu bringen. Schnell wurde jedoch klar, dass wir für die Schulstufe vermutlich zu wenig Anleitung hatten, bzw. nichts woran sich die Schüler „festhalten“ konnten und die Gruppengröße machte es unmöglich sich bei „phlegmatischeren“ Gruppen um alle Schüler gleichzeitig zu kümmern. 113 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten Mir persönlich gefällt es nicht, bei jeder Gelegenheit Arbeitsblätter zu benutzen, da ich die Gefahr sehe, dass sich Schüler zu sehr „am Zettel festhalten“ und die eigentliche Beobachtung hintan stellen, doch wäre es rückblickend gesehen klug gewesen eben gerade für solche Gruppen welche in der Hinterhand zu haben, man kann immer noch davon abrücken, wenn es sich als sinnvoll erweist. Die letzte Gruppe an diesem Tag war leider sehr teilnahmslos und unmotiviert und wir nach 5 Gruppen und Fußweg auch schon etwas erledigt und es war schwer die Schüler zu motivieren. Leider war gerade bei dieser Gruppe Prof. Hödl anwesend, was auch prompt in einem relativ schlechten Feedback endete. Wobei ich es begrüßt hätte, wenn er sich nicht aktiv in die Wissensvermittlung eingeschalten hätte. Später wurde von den Lehrpersonen und Studenten ja auch die übereifrige Begleitlehrerin aufgrund ihrer Einmischung kritisiert. Mit dem abschließenden, sehr wertvollen konstruktiven Feedback das wir nachmittags erhielten, machten wir uns daran uns für den zweiten Tag vorzubereiten. 2. Tag Aus dem Feedback heraus einigten wir uns darauf, die Schüler noch mehr zur Beobachtung hinzuführen und Daniel schrieb eine Plakat mit Fragen und Anhaltspunkten auf die flip-chart, was quasi als unser Arbeitsblattersatz fungierte. Jedoch machten wir bei der Ersten Gruppe den „Fehler“ die Schüler einzeln beobachten zu lassen (also ein Tier pro Schüler), wodurch sich wieder Zeitprobleme ergaben (von 4 Vorstellungen gingen sich nur 2 aus), bzw. die Betreuung erschwerte, denn so war immer ein oder zwei Schüler unbetreut. Darauf reagierten wir prompt bei der nächsten Gruppe und teilten den Schülern in Zweiergruppen Tiere zu und so kamen wir ab der zweiten Gruppe auch gut mit der Zeit zurecht. Es war eine gute Erfahrung, die Verbesserungsvorschläge, die die Betreuer machten, sowie unsere eigenen Ansprüche am zweiten Tag umzusetzen und es klappte insgesamt auch viel besser, was – so denke ich – weitgehend durch die „Beobachter“ bestätigt werden konnte. Ich versuchte außerdem schon am Weg auszuloten, was die Schüler denn schon über Urzeitkrebse wissen und dementsprechend konnten wir relativ hoch oder entsprechend niedrig im Niveau einsteigen. Mein Highlight des Tages war wohl die Gruppe in der anscheinend ausnahmslos Triopszüchter waren, mit denen wir entsprechend hoch im fachlichen Niveau einsteigen konnten. Den Rückweg nutzte ich an diesem Tag für Wiederholungen des Gelernten, quasi als kleine Wissenssicherung durch Wiederholung und zusätzliche Evaluierung. Persönlich hat mir die Lehrveranstaltung gezeigt, dass ich mich noch mehr von meinem Anspruch verabschieden muss, vor allem in solchen Altersstufen, akademisch korrekt Zusammenhänge darstellen zu können und mich noch mehr auf die didaktische Reduktion einzulassen. Andererseits muss ich mich fachlich noch besser vorbereiten, um den relativ freien Unterrichtsstil, der mir eher liegt durchziehen zu können. Achja und merke: Arbeitsblätter beißen nicht... Allgemein bleibt zu sagen, dass ich einige neue Freundschaften geschlossen habe und ausnahmslos nette Menschen getroffen habe. Besonders gut gefiel mir die Möglichkeit sich über die anderen Gruppen zu informieren, sei es bei der „offiziellen“ Vorstellung des 114 Daniel Kirby & Christoph Eichhorn: wasserlebende Evertebraten theoretischen Hintergrundes, als auch „zwischendurch“. Die Verpflegung (ganz wichtig) war hervorragend, da war die ansonsten asketische Lebensweise schnell vergessen. Danke für diese außergewöhnliche Lehrveranstaltung. www.tolweb.org (Tree of Life Project) Literatur Engelhardt, W. (2003). Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher? Pflanzen und Tiere unserer Gewässer. Stuttgart: FranckhKosmosVerlags-GmbH & Co. http://www.urzeitkrebse.at/ Zugriff am 02.04.2009 Campbell, N.A. . (1997), Biologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Hödl, W. & Eder, E. (2000). Urzeitkrebse (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Conchostraca). In: Rote Listen ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs. Urzeitkrebse und Flusskrebse - 1. Fassung 1999. 4-33. St. Pölten, Austria: Amt d. NÖ. Landesregierung. Sauer, F. (1988). Wasserinsekten. Karlsfeld: Fauna Verlag Wichard, W.(1995). Atlas zur Biologie der Wasserinsekten. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag. 115 Überschwemmungsökologie am Beispiel land- und wasserlebender Evertebraten von Martin Pöcksteiner & Reinhard Turetschek Fachliches Der fachliche Teil dieser Arbeit soll sich nicht zu sehr auf die Fakten der Tiere an der March beschränken, als auf die Geschichten und Lebensweisen die zu den Tieren interessant sind. Aber auch die Eindrücke der Kinder zu den jeweiligen Tieren möchten wir hier einbringen. Mollusca (Weichtiere) Zu den Mollusca gehören in unseren heimischen Gewässern Bivalven (Muscheln) und Gastropoda (Schnecken). Da wir uns allerdings nur bei der Triops-Senke aufhielten, bzw. die Anostraken (Feenkrebs) auch in einem astatischen Gewässer nahe der March kescherten, beschäftigten wir uns nicht ausführlicher mit den Bivalven. Die häufigsten Vertreter der Gastropoden in den Marchauen werden im Folgenden behandelt. Gastropoda Die Vorfahren der Süßwasserlungenschnecken waren landlebend und atmeten über Lungen. Diese Atemmethode wurde beim Übergang zum Süßwasser beibehalten und kann auch gute beobachtet werden, wenn sie das Oberflächenhäutchen des Wassers durchstoßen um über das Atemloch ihre Lungen wieder mit Luft zu füllen. Im Winter, oder bei tiefer lebenden Arten wird die Luftatmung durch Hautatmung ersetzt. Hierbei spielen die breiten gut durchbluteten Fühler eine große Rolle. Die Fühler können nicht wie bei den Landlungenschnecken zurückgezogen werden. Die Gehäuse haben keinen Deckel. Die meisten Schnecken sind Weidegänger. D.h. sie schaben mit ihrer Radula den Algenbelag von Wasserpflanzen und Steinen ab. Lymnea stagnalis - Spitzschlammschnecke Lymnea stagnalis gehört zur Familie der Schlammschnecken (Lymnaeidae). Durch die typischen Kontraktionsswellen bewegt sie sich vorwärts. Hauptsächlich ist diese Art Weidegänger, beißt aber mit ihren Kiefern auch weiche Teile höherer Pflanzen ab. Tiefer lebende Formen ernähren sich vorwiegend von Detritus. Aas und Laich verschiedenster Wassertiere und Moostierchen gehören auch zum Nahrungsspektrum. Wie körnerfressende Vögel nehmen auch die Schlammschnecken kleine Steinchen zum Zerreiben von Nahrungsteilchen in ihren Muskelmagen auf. 116 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie Die Spitzschlammschnecke wurde insgesamt nur einmal von einem Schüler als Forschungsobjekt gewählt, was mich in dieser Gruppe aber besonders freute, weil so nicht nur die Krebstiere und Insekten durchgenommen wurden, sondern auch eine vollkommen andere Tiergruppe. Planorbarius corneus – Posthornschnecke Planorbarius corneus ist die größte Art in der Familie der Tellerschnecken. Die Namensgebung kommt vom Gehäuse der Schnecke, welche stark an ein Posthorn erinnert. Sie lebt vorwiegend auf dem Grund und ernährt sich hauptsächlich von Detritus. Die Posthornschnecke hat eine besonders ausgeprägte Rotfärbung die durch Hämoglobin hervorgerufen wird. Den Winter verbringt diese Art im Schlamm eingegraben und hält sozusagen einen „Winterschlaf“. Posthornschnecken wurden bei der TriopsSenke auf Grund ihrer Lebensweise keine gefunden. Groß-Branchiopoden (Kiemenfußkrebse) Die Groß-Branchiopoden gehören den Krebsen an und gliedern sich im Allgemeinen in Anostraca (Kiemenfüßer), Notostraca (Rückenschaler) und Conchostraca (Muschelschaler). Weitaus verbreitetere Vertreter finden sich in der Gruppe der Wasserflöhe. Die Beine dieser Tiere übernehmen gleich mehrere Aufgaben. Zusätzlich zur Fortbewegung dienen die Beine auch als Kiemen und filtrieren zusätzlich noch Nahrungsteilchen wie Detritus und Algen aus dem Wasser. Mit Hilfe von Dauereiern ist der Fortbestand der Art über Trockenperioden und dem Winter gesichert. Diese Dauereier bleiben nicht nur bis zum nächsten Hochwasser lebensfähig, 117 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie sondern können Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte in dieser Form überdauern. Der Lebensraum dieser Tiere ist auf astatische Gewässer beschränkt. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Dies ist zum einen die Anpassung an den extremen Lebensraum Tümpel, welcher im Sommer unter Tags ziemlich hohe Temperaturen aufweist. Der wichtigste Grund ist aber der fehlende Raubdruck im Tümpel, der den Tieren ihre ungestörte Entwicklung erlaubt. Diese passiert innerhalb weniger Wochen, bis der Tümpel wieder austrocknet. Die Eier werden entweder vorher abgeworfen, oder bleiben am Tier und trockenen auch aus. Häufig werden die Eier auch durch den Verzehr der Tiere von Vögeln verbreitet. Limikolen, oder andere Vögel sind aber keine große Bedrohung für diese Tiere und dienen mehr der Verbreitung. Anostraca (Feenkrebse) Der berühmteste Anostrake ist Artemia salina, das kleine Salzkrebschen, das schon in diversen Kinderheften in Eiform beigelegt war und auch in der Fischzucht eine enorme Rolle spielt. Heimische Vertreter finden sich in austrocknenden Tümpeln. Anostraca besitzen kein Rückenschild und schwimmen mit der Bauchseite nach oben. In Österreich kommen sechs Arten vor. Kindern erkannt wurde, weil dies eigentlich ein Prozess ist, der nicht offensichtlich zu beobachten ist. Auf die Frage, wie Sie auf die Idee kommen, dass Eubranchipus grubii seine Nahrung filtriert, antworteten einige: „Naja, der schwimmt die ganze Zeit nur herum, und beißt eigentlich nirgends ab, also muss der doch die Nahrung aus dem Wasser holen.“ Eigentlich logisch. So haben wir uns das bis jetzt noch nicht gedacht. Das beobachten der Kinder hat uns im übrigen auch wieder viel mehr angespornt den Tieren aktiver zuzusehen und nicht gleich immer alles nachzulesen. Ein Vertreter der Anostraca sei noch kurz erwähnt: Chirocephalus shadini. Diesen grün leuchtenden Krebs gibt es in Österreich nur an einem einzigen Standort. Der Tümpel am Pulverturm in Marchegg umgeben von einem Trockenrasen ist seit 1982 auf Antrag von Walter Hödl ein Naturschutzdenkmal. Dieses ist das weltweit erste Schutzgebiet für einen Vertreter der Groß-Branchiopoden. Der an der March am häufigsten vorkommende Anostrake ist Eubranchipus grubii, welcher auch von uns aus einem Tümpel gleich hinter dem Haus gekeschert und von den Kindern beschrieben wurde. Der kleine Feenkrebs ist ein paar Wochen nach seiner Entwicklung gut bei der Paarung zu beobachten. Das Männchen umfasst das Weibchen mit der zweiten Antenne, welche zu einem Greiforgan umgebildet ist. Die Nahrungsaufnahme war bei den Anostraca für die Kinder leichter herauszufinden als bei den Notostraka. Wir waren aber grundsätzlich erstaunt das die Nahrungsaufnahme über die Beine so schnell von den 118 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie Notostraca (Rückenschaler) Die Rückenschaler sind deutlich von den anderen Ordnungen der Groß-Branchiopoden durch ihr Rückenschild zu unterscheiden. Sie wühlen mit der Vorderkante ihres Schildes im Schlamm, wirbeln Nahrung auf und filtrieren diese über ihre Beine. Aber auch vor größerer Beute, wie Würmern, oder kleinen toten Fischen, scheuen sie nicht zurück. Ist der Tümpel gegen Ende schon sauerstoffärmer, so findet man sie oft mit der Bauchseite nach oben schwimmend, um den frischdiffundierten Luftsauerstoff unter der Wasseroberfläche aufzunehmen. In Österreich gibt es nur zwei Vertreter dieser Ordnung. Lepidurus apus und Triops cancriformis (der weitaus berühmtere). Beide Arten sind in ihrem Lebensraum auf die Marchüberschwemmungsgebiete beschränkt. Lepidurus ist bis zur March-Thaya-Mündung nachweisbar. Triops kommt erst ab der Höhe Angern vor. Ihr zeitliches Vorkommen unterscheidet die beiden jedoch stark. Lepidurus bevorzugt eher kältere Gewässer und ist daher schon ab Anfang April zu finden, während Triops wärmere Tümpel bevorzugt und sich erst Mitte bis Ende April zeigt. Wenn Triops im Adulten Stadium auftritt, so haben die Weibchen von Lepidurus meist schon die Eier abgeworfen und ihren Lebenszyklus beendet. eine gute Gelegenheit war, um zu zeigen, dass es hier zwei heimische Vertreter der Rückenschaler gibt. Triops cancriformis Auch dieser Urzeitkrebs wird heute in den verschiedensten Geschäften (hauptsächlich online-stores) angeboten. Mit seiner beachtlichen Größe von bis zu 11cm ist dieser in einer Zucht auch schon ganz ansehnlich. In freier Natura findet man Triops ab Mitte April. Sobald die Temperaturen steigen, beginnen auch die Nauplien zu schlüpfen. Lepidurus apus Der kleinere der beiden Rückenschaler in Österreich, der etwa eine Länge von 7cm erreicht, ist gut an seinem Schuppenschwänzchen, zwischen den beiden Schwanzanhängen erkennbar. Für geübte Beobachter ist Triops und Lepidurus rein durch den Habitus unterscheidbar. Dieser Vertreter kommt, abhängig vom ersten Hochwasser, schon Mitte bis Ende März vor. Als wir Mitte April in Marchegg waren, fanden wir zumeist Lepidurus und nur vereinzelt Triops cancriformis. Viele der SchülerInnen kannten Triops schon und wussten ihn mit dem Namen „Urzeitkrebs“ anzusprechen, was 119 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie Triops cancriformis gilt als lebendes Fossil, was bedeutet, dass sich sein Habitus und seine Lebensweise seit mehr als 220 Mio. Jahren nicht mehr verändert hat (Zumindest nicht nachweislich). Dies wird durch einen fossilen Fund belegt. Er war somit schon Mio. Jahre vor uns perfekt an seinen Lebensraum angepasst. Obwohl Triops c. einen gewissen Berühmtheitsgrad erlangt hat, war es in Österreich bisher noch nicht möglich, den größten heimischen Lebensraum dieser Art, die Triops-Senke, an der wir mit SchülerInnen kescherten, zu schützen. Conchostraca (Muschelschaler) Die Muschelschaler, sind mit fünf heimischen Arten in Österreich vertreten. Ähnlich einer Muschel sind sie von einer zweiklappigen Schale umhüllt. Sie sind eher schlechte Schwimmer und liegen meist etwas eingegraben im schlammigen Boden und filtrieren wie ihre Verwandten Nahrung aus dem Wasser. Ihre Größe beträgt in etwa einen cm. Da wir selbst noch nie einen Conchostracen sahen, glaubte wir an der Triops-Senke auch welche gefunden zu haben. Es handelte sich aber um die viel kleineren Muschelkrebse (Ostracoda). Die Muschelschaler wurden, da keine gefunden wurden, mit den SchülerInnen auch nicht durchgenommen. Insecta Wie fast überall auf unserem Planeten fanden wir in der TriopsSenke auch einige Insekten. Die am häufigsten Herausgekescherten werden hier kurz vorgestellt. Coleoptera (Käfer) Die Käfer sind ja die artenreichste Tiergruppe überhaupt und dementsprechend wurde auch von jeder Kleingruppe der zwei Tage mindestens eine Käferlarve beziehungsweise ein Käfer aus dem Wasser geholt und analysiert. Wichtig ist vor Allem bei den adulten Käfern die Unterscheidung zwischen Wasser- und Schwimmkäfern Dytiscidae (Schwimmkäfer) Schwimmkäfer leben räuberisch und haben einen an den Wasserlebensraum sehr gut angepassten Körper. Ihre Beine sind behaart und werden bei der Fortbewegung gleichzeitig paarweise bewegt. Die langen Schwimmhaare werden dabei abgespreizt was von den Schülern und Schülerinnen immer sehr genau beobachtet werden konnte. Da Schwimmkäfer wie alle Insekten Tracheenatmer sind, müssen sie regelmäßig an die Wasseroberfläche, um ihre physikalische Kieme (Plastron) mit Luft zu füllen. Die Luft wird dabei zwischen Deckflügel und Hinterleib gespeichert, was unter Wasser schön als weißer schillernder Flügelrand sichtbar ist. Der mit Abstand spektakulärste Fang aus dem Tümpel war sicherlich der der Gelbrandkäferlarven (Dytiscus marginalis). Die Larven der Schwimmkäfer leben permanent im Wasser. Erkennbar waren sie an ihrem kräftigen Bau mit flachem Kopf und – sehr schön sichtbar – den zweimal je sechs Punktaugen. Spektakulär waren diese Larven deshalb weil sie sehr gefräßig und aggressiv waren. Innerhalb weniger Minuten zusammen mit anderen Wasserbewohnern im Aquarium fingen sie an jene zu jagen und sich in ihnen zu verkeilen. Über einen längeren Zeitraum im Glasbehälter konnte man sogar gut die ausgesaugten leeren Chitinpanzerhüllen der getöteten anderen Larven und Insekten im Wasser treiben sehen. Weiters wurden auch Exemplare des Furchenschwimmers (Acilius sulcatus) gekeschert. Hydrophilidae (Wasserkäfer) 120 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie Die Wasserkäfer sind mit den Schwimmkäfern die wichtigste und artenreichste Wasserkäferfamilie. Nicht alle Wasserkäfer leben im freien Wasser. Manche Arten findet man in faulenden Stoffen, Dung oder an Gewässerrändern. Im Gegensatz zu ihren räuberischen Larven sind die adulten Wasserkäfer Pflanzenfresser. Ihre Beine sind nur selten behaart und auch deren Paddelbewegung erfolgt nicht – wie bei den Schwimmkäfern – gleichzeitig, sondern links und rechts abwechselnd. Dieses Unterscheidungsmerkmal hat uns in der Praxis am meisten geholfen da es sehr einfach zu beobachten war. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu den Schimmkäfern ist die Atmung die bei den Wasserkäfern nicht über den Hinterleib sondern über die Vorderseite erfolgt. Die Luftspeicherung erfolgt nun auch nicht unter den Deckflügeln sondern an der Bauchunterseite, was auch überaus schön und klar zu beobachten war. Die Larven atmen, wie auch die der Schwimmkäfer, indem sie ihr Hinterleibsende zur Wasseroberfläche heben. geschickte Schwimmer sind, war es für die SchülerInnen und uns sehr unterhaltsam, ihnen im Glasbehälter zuzusehen. Heteroptera (Wanzen) Da Reinhard über das Thema Urzeitkrebse schon in der Lehrveranstaltung „Biologie und Ökologie einheimischer Tiere“ referierte, war er anfangs erfreut, dass er vielleicht wieder die Gelegenheit bekommt mit diesen Tieren zu arbeiten. Er war aber auch nicht abgeneigt, ein anderes Thema zu wählen, um seinen fachlichen Horizont zu erweitern. Schlussendlich fiel die Überschwemmungsökologie doch in unsere Hände und er musste feststellen, dass es noch einiges zu wissen gab über den Tümpel als Lebensraum. Die meisten Tiere waren uns mehr oder weniger schon bekannt, jedoch war uns auch klar, dass allein der Name eines Tieres nichts aussagt. Daher machten wir uns daran sich bei mehreren Treffen über die Lebensweisen der Tiere einzulesen und erzählten uns während dem Lesen oft schon das Interessanteste. Das waren oft Fakten zu den Tieren, die wir noch nicht wussten, die uns dann aber zumeist kurz ins Staunen versetzten. So hatte das den Effekt, dass Hydrocorisae (Echte Wasserwanzen) Sind als Imagines und als Larven Wasserlebewesen und haben wie alle Wanzen einen Saugrüssel. Morphologische Eigenschaften sind behaarte Schwimmbeine und ein unbenetzbarer Körper.Während unseres Aufenthaltes stießen wir selten aber doch auf Ruderwanzen und Rückenschwimmer. Corixidae (Ruderwanzen) Ruderwanzen schwimmen mit Rücken nach oben fressen hauptsächlich Detritus. Die Luftaufnahme erfolgt über den Vorderkörper von wo die Luft entweder an der Bauchunterseite (sehr schön sichtbar) oder unter den Deckflügeln. Da sie sehr Notonectidae (Rückenschwimmer) Der Blaugraue Rücken Rückenschwimmer (Notonecta glauca) war durch seine Art zu schwimmen sehr leicht bestimmbar. Meist bewegt er sich mit dem Rücken nach unten fort. Er frisst hauptsächlich Insekten, die auf der Wasseroberfläche, ob absichtlich oder nicht, gelandet sind. Die Fortbewegung erfolgt über lange Hinterbeine die wieder sehr schön sichtbar mit Schwimmhaaren besetzt sind. Beim Luftholen und auf der Lauer presst er sich mit den Vorderbeinen und dem Hinterleibsende von unten gegen die Wasseroberfläche. Gleichzeitig kann er dabei auch die zwei Luftrillen am Hinterleib mit Atemluft anfüllen. Fachdidaktisch 121 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie der Erzähler sich diese spektakulären Dinge besser merkte und gleichzeitig beim Zuhörer ablesen konnte, ob dass denn auch für andere interessant ist. Wir erfragten aber auch meist vom anderen, ob das denn auch für Kinder interessant sein könnte, oder nur gerade für uns, weil wir schon etwas Vorwissen mitbrachten. Durch diese Treffen ging irrsinnig viel weiter und es türmte sich innerhalb kurzer Zeit „nachhaltiges“ Wissen an. Wenngleich es nicht im Übermaß war, war es beständig. Wir stellten also für uns fest, wie Wissensvermittlung bei uns (Interessierten) wirkt und sollten nun daran gehen den Stoff im Freiland für die Schüler vorzubereiten. a) Didaktische Reduktion Das es unmöglich und auch unsinnig ist alles bisher Gelesene zum Thema in einer halben Stunde den SchülerInnen reinzustopfen war einleuchtend. Wie aber nun nachhaltig vermitteln? Oder zumindest Interesse zu wecken? Die Schüler sollten einen gewissen Freiraum bekommen, was das Interesse der Tiere anbelangt. Und natürlich sollen und können Sie besonders bei unserer Station beim Keschern aktiv werden. Vor der zweiten Vorbesprechung planten wir noch die Tiere den SchülerInnen über einen Bestimmungsschlüssel näher zu bringen. So sollten sie auch die wichtigsten Merkmale der Tiere erkennen. Auf Anraten von Erich und Eva, ließen wir diesen aus unserem Konzept. Wir müssen gestehen, dass wir es anfangs doch etwas bedauerten und dies zumindest gerne ausprobiert hätten. Nachträglich müssen wir aber sagen, dass ein Bestimmungsschlüssel viel zu viel Zeit in Anspruch genommen und höchstwahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt erzielt hätte. Die didaktische Reduktion bestand nun darin, dass wir uns auf die wesentlichsten, überlebensnotwendigen Eigenschaften der Tiere beschränkten; Nämlich Atmung, Fortbewegung, Nahrung. Dies galt es für die Kinder selbst, mit unterstützenden Fragen im „Aquanauten Arbeitsblatt“, zu erforschen. Der Lebensraum Tümpel sollte natürlich auch als solcher von den SchülerInnen begriffen werden. Daher entschieden wir uns, um Zeit für die Arbeit mit den Tieren zu gewinnen, den Tümpel in einem Frage Antwort Gespräch durchzunehmen. b) Reflexion Die Erfahrungen mit den SchülerInnen waren sehr unterschiedlich. Einerseits, da wir am ersten Tag von einer siebten Klasse und am zweiten Tag von einer ersten Klasse besucht wurden, andererseits, weil immer eine andere Gruppendynamik herrschte. Das größte Problem an unserer Station war das Zeitmanagement. Im Laufe der beiden Tage wurde uns immer klarer, dass unsere Station alleine locker zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen würde, wollten wir unsere Lehrziele wirklich erreichen. Allein das Bewusstmachen des extremen Lebensraums Tümpel und das Thema der Urzeitkrebse könnte Stunden füllen. Zusätzlich wollten wir aber auf das Keschern und Analysieren der Tiere nicht verzichten. Unseren Ablauf konnten wir bei der siebten Klasse unter Zeitschwierigkeiten durchbringen, obwohl wir bei fast jeder Gruppe überzogen. Das lag aber auch daran, dass unsere Station am weitesten von den anderen entfernt war. Das gesamte Zeitmanagement aller Stationen kam aber nie ins Trudeln. Mit den anfänglichen Zwischenfragen über den Tümpel war das Interesse der meisten auch ziemlich gut zu wecken. Keschern sowie das Beschreiben der Tiere stießen fast durchwegs auf Begeisterung. Was uns neben dem Zeitmanagment am meisten zu schaffen machte, war das Teamteaching. Wir hatten beide so klare Vorstellungen vom Inhalt, dass wir uns ständig ins Wort fielen um die Informationen so zu präsentieren wie wir es selbst am besten empfanden. Nach Ende 122 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie des ersten Unterrichtstages beredeten wir deshalb ausführlich, was wir anders machen wollten. Um das Zeitmanagement zu verbessern setzten wir uns klare Richtzeiten zu denen wir unsere vier Abschnitte (Lebensraum Tümpel, Keschern, Forschungsarbeit der Kinder, Besprechung) beendet haben mussten. Um unser TeamteachingProblem in den Griff zu bekommen setzten wir uns weiters klare Grenzen wer worüber redet. Der andere hatte dann wirklich ruhig zu sein. Am zweiten Unterrichtstag kam eine erste Klasse. Innerhalb der ersten Minute wurde uns sofort klar, dass wir den theoretischen ersten Teil drastisch reduzieren müssen. Das fünf Minuten Fragen-AntwortGespräch über den Tümpel verlangte von den meisten SchülerInnen noch zu viel Konzentration und weil sie schon ahnten, dass es bald ans Keschern geht, passten viele nicht mehr auf. Deshalb beschlossen wir gleich nach der ersten Gruppe den Input am Anfang auf das Minimalste zu reduzieren und Ihnen dafür mehr Zeit beim Keschern und beim Beobachten zu geben was bei den weiteren Gruppen gut funktionierte. Trotzdem mussten wir uns wieder bemühen, unser Programm durchzubringen. Wäre es nach den Kindern gegangen, hätten sie schon allein eine halbe Stunde nur gekeschert um eine weitere halbe Stunde die Tiere im Aquarium zu beobachten. So mussten wir sie quasi aus dem Wasser „stampern“ um zum Beobachtungsteil zu gelangen. Zurückblickend haben wir auch feststellen müssen, dass unser Fragebogen falsch konzipiert war. Die Schülerinnen und Schüler hatten viel zu wenig Zeit ihn auszufüllen; Und das, obwohl wir sie schon angewiesen hatten, die gesamte linke Spalte (den Teil über den Lebensraum Tümpel), wegzulassen und nur die zoologischen Fragen zu beantworten. Um den Fragebogen vernünftig auszufüllen und das Tier zu zeichnen, hätten die Kinder noch einmal 15 bis 20 Minuten benötigt. Auch das Keschern selbst würden wir beim nächsten Mal etwas anders ausführen. Obwohl Prof. Hödl uns vorschlug Weißschalen zu verwenden, kamen wir auf diese nicht mehr zurück. So beschränkten sich die Tiere, welche beobachtet wurden, doch eher auf die größeren und die Vielfalt ging unter. Reinhard: Am ersten Tag hatte ich mehr Schwierigkeiten Martin zuzuhören, oder diesen nicht auszubessern. Au musste ich mich bemühen die SchülerInnen bei den Forschungsaufgaben alleine zu lassen. Es machten sich aber im Laufe des Tages durchaus Besserungen bemerkbar. 123 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie Mir fiel es doch etwas schwer, die Erklärungen zu den Tieren auf das Niveau der ersten Klasse anzupassen, aber dennoch biologisch richtig zu sprechen. Auch war das Interesse der Erstklassler sehr verschieden. Einmal hatte man es mit Phlegmatikern, ein anderes mal mit kleinen Wissenschaftlern zu tun. Dementsprechend musste man sich auch den Kindern anpassen. Ich wollte aber kein Interesse erzwingen, wenn einfach unüberwindbare Gleichgültigkeit vorherrscht. Wollte aber dennoch weiter versuchen die Station so interessant wie möglich zu gestalten. Gut zu beobachten war in der kleinen Gruppe auch, wie groß der Einfluss einzelner auf die Aktionen anderer war. Am stärksten zeigte sich das beim Angreifen der Tiere. Sobald der erste das Tier gepackt hat, überwand der Nächste auch seinen Ekel um in den Kescher zu fassen. zu erwecken, dass Reini und ich Marchegg als geschiedene Leute verlassen haben sein noch angemerkt, dass wir uns nach wie vor blendend verstehen. Insgesamt empfinde ich unseren Lehrauftritt als nicht wirklich gut was aber gottseindank nur wenig Auswirkungen hatte, da die Urzeitkrebse-Station mit dem selbständigen Keschern so begeisterte, dass die Schülerinnen und Schüler trotzdem beeindruckt weiterzogen. Für die kommenden Marcheggteilnehmer möchte ich die beiden Bücher: Süßwassertiere – Ein ökologisches Bestimmungsbuch (Helmut Schwab) und Atlas zur Biologie der Wasserinsekten (Gustav Fischer) aufs Wärmste empfehlen. c) Zusammenfassung Martin: Was mir persönlich am meisten Probleme bereitete, war die Zeit. Als klar war, dass wir didaktisch reduzieren müssen, konnte ich nicht mehr wirklich frei reden weil permanent der Gedanke: „Wie schaff ich es, nur dass Allernotwendigste zu sagen, ohne dass die Zusammenhänge verlorengehen?“ in meinen Gedanken herumspukte. Teilweise begann ich sogar schneller zu reden. Permanent blickte ich auf die Uhr um unsere Checkpoints nicht zu verpassen. Das Teamteaching verschärfte das Problem weiter weil Reinhard Dinge erwähnte, die ich als unwichtig erachtete und ich mich ärgern musste, dass er mit unwichtigem Detailwissen die doch so wertvolle Zeit verschwendete. Weil dieses Problem ja auf Gegenseitigkeit beruhte war es wirklich hilfreich, dass Reinhard und ich uns gegenseitig Feedback gaben (de facto haben wir uns gegenseitig angesudert ;-) weil wir unsere Station dadurch sicher weiterentwickelt haben. Um jetzt nicht den Eindruck Die Lehrziele waren: • Kenntnisse über die Entstehung eines Hochwassers • Das Überschwemmungsgebiet als Lebensraum wahrnehmen • Anpassung der Tiere an den Lebensraum Wie man an den Lehrzielen erkennt, war es uns wichtig, dass die SchülerInnen begreifen, wie dieser Tümpel entstanden ist und das es sich bei diesem um einen zeitlich begrenzten Lebensraum, oder zumindest um einen sich stark verändernden Lebensraum handelt. Der zweite Schritt war dann, auf Grund der Eigenschaften des Tümpels den SchülerInnen zu zeigen, bzw. Sie selbst erforschen lassen, wie die Tiere es schaffen in diesem Lebensraum zu überleben. Um unsere Lehrziele zu erreichen wurde unsere Methode laufend verändert. Vor Ort behielten wir die endgültige Version allerdings bei und variierten nur mehr zeitlich und inhaltlich. Der Ablauf war: 124 M. Pöcksteiner & R. Turetschek: Überschwemmungsökologie • • • • Einführung in das Thema Überschwemmung und den Lebensraum Tümpel Keschern Individuelles erforschen der Tiere mit Hilfe des Arbeitsblattes Kurze Vorstellung der Tiere Zum Erreichen der Lehrziele ist leider zu sagen, dass wir jene wenig bis gar nicht erreicht haben. Um beim selbständig Forschen den Zeitdruck nicht noch weiter zu erhöhen, kürzten wir den theoretischen Teil für die ersten beiden Lehrziele mit Fortlauf des Tages immer mehr sodass die Kinder gerade noch mitbekamen, dass sie vor einer Lacke stehen, die bald nicht mehr da sein wird. Für die besonderen Herausforderungen, die die Lebewesen dann bestehen müssen um in diesem extremen Lebensraum zu überleben, konnten wir leider wenig bis gar keine Zeit mehr aufbringen weil der praktische Teil einfach interessanter war. Auch die Anpassungen an den Lebensraum gingen somit unter der Forschung an Einzelbeispielen unter. Die Kinder analysierten zwar wirklich gut, wie die Tiere leben, fressen und atmen; was dann aber globaler gesehen die Anpassungen der Landlebewesen Inseken ans Wasser sind, konnte in der vorgegebenen Zeit auch nicht erfahrbar gemacht werden. Das soll jetzt aber nicht den Eindruck vermitteln, unsere Station sei ein kompletter Misserfolg geworden. Anstatt der zuvor bestimmten haben wir sicher andere Ziele erreicht die hier noch angeführt sind: • Bewusstsein dafür schaffen, wie viele Kleinlebewesen in einer scheinbar unbelebten dreckigen Lacke leben können. • Hemmungen abbauen, auf den ersten Blick unappetitliche Tiere (v.A. Larven) anzugreifen und sogar in die Hand zu nehmen • • • Bewusstsein dafür schaffen, wie viele unterschiedliche Ideen die Natur hervorgebracht hat, um Atmung, Fortbewegung und Nahrungsbeschaffung zu ermöglichen. Begeisterung für die Natur entfachen Neugier wecken Hätten wir diese Ziele als unsere Lehrziele a priori definiert, wäre unsere Station in auch in dieser Hinsicht ein voller Erfolg gewesen. Literatur Engelhardt, W. (2008): Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher?, Pflanzen und Tiere unserer Gewässer, Stuttgart Zahradinik, J. (2002): Der Kosmos Insektenführer. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttart Schwab, Helmut (1995): Süßwassertiere. Ernst Klett Schulbuchverlag GmbH, Stuttgart Wichard, Arens, Eisenbeis (1995): Atlas zur Biologie der Wasserinsekten. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 125 Amphibien von Eva Edelmann & Sabrina Walentich Theoretischer Teil Definition Amphib Das Wort Amphibien kommt aus dem griechischen, „amphi“ bedeutet auf beiden Seiten und „bios“ Leben. Amphibien sind Tiere, die meist das Larvenstadium im Wasser verbringen und als Adulttiere an Land leben, wobei sie zur Laichzeit zumWasser zurückkehren. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind ca. 600 beschriebene Arten bekannt. Systematik Stamm: Chordata Unterstamm: Vertabrata = Wirbeltiere Oberklasse: Gnathostomata = Kiefertragende Klasse: Amphibia = Lurche Ordnung: Apoda = Blindwühlen Ordnung: Urodela = Schwanzlurche Ordnung: Anura = Froschlurche Eine kurze Beschreibung der Ordnungen: Apoda: Körper schlauchartig, weder Beine noch Schuppen, stumpfer Schwanz, schwach entwickelte Augen, haifischähnliches Maul mit spitzen Zähnen Urodela: Langer Körper mit Schwanz, 4 ca. gleich lange Beine (Salamander, Molche) Anura: Kurzer Körper ohne Schwanz, 2 Paar Extremitäten (vorne kurz, hinten lang zum Schwimmen und Springen) (Unken, Kröten, Frösche) Verhalten und Kommunikation heimischer Amphibien Wanderverhalten: Im Frühjahr wandern geschlechtsreife Tiere zu Gewässern, den Laichtümpeln. Im Herbst ziehen sie vom Sommer- (ca. von März bis September) ins Winterquartier. Bei vielen Amphibien passiert dies gleich nach der letzten Paarung. Dort graben sie sich dann ein und warten wieder auf warme Tage. Paarungsverhalten: Amphibien legen oft große Strecken zurück. Zur Zeit der Paarung sind ihre Sinnesorgane sehr gut ausgebildet. Zur Kommunikation verwenden sie akustische Signale aber auch olfaktorische (Pheromone). Sie nutzen chemische Stoffe, Licht, Temperatur und 126 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Feuchtigkeit zur räumlichen Orientierung. Ihre Ohren sind empfindlich auf Luftdruckunterschiede sowie auf Schwingungen und Laute innerhalb bestimmter Frequenzen (Paarungsruf). Ihre Fortpflanzungstelle finden sie entweder durch den Geruchssinn oder durch Automatismus. Dies zeigt sich dadurch, dass Kröten sogar zu ihren Laichtümpeln zurückkehren wollen, obwohl diese schon zugeschüttet worden sind. Konkurrenzkampf tritt auf, wenn sich viele Männchen zur gleichen Zeit am Laichgewässer um Weibchen werben. Oft kommt es dabei auch zu Fehlpaarungen, einerseits Männchen-Männchen Klammerungen oder auch mit anderen Arten. Oft werden hierbei die Weibchen getötet. Treffen zwei Männchen aufeinander, umklammern sie sich entweder oder balzen sich gegenseitig an. Die Reaktion ist Abwehrverhalten oder Flucht. Weibchen werden von Männchen bei Fröschen durch angelockt. Trifft ein Männchen auf ein ebenfalls geschlechtsreifes Weibchen umklammert er es zur Paarung. Die Befruchtung findet außerhalb des Körpers statt. Bei Molchen fächelt das Männchen dem Weibchen Duftstoffe (Pheromone) aus der Kloake mit dem Schwanz zu, um es anzulocken. Danach folgt das Weibchen dem Männchen und nimmt das abgelegte Samenpaket auf. Es folgt die Eiablage. Sofort nach dem Ablaichen tritt bei Weibchen ein Abwehrverhalten gegenüber dem Männchen ein. Brutpflege findet man nur bei der Geburtshelferkröte. Die männliche Kröte wickelt sich die Laichschnüre um die Hinterbeine, wo sie sie feucht hält. Nach circa drei Wochen werden die Larven ins Wasser abgesetzt. Laute Der Paarungsruf ist der lauteste Ruf, der Abwehrruf hingegen eher leise. Der Revierruf ist Teil des Sozialverhaltens. Dadurch wird ein Mindestabstand eingehalten und eine Rangordnung festgelegt. Bei Anura treibt ein ranghöheres Tier weiter oben im Wasser und bläht sich auf, rangniedrige ein bisschen tiefer, manchmal fast unter Wasser. Der Schreckruf erfolgt nach einem Angriff 127 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Fortpflanzung Zur Fortpflanzung gehen Amphibien ins Wasser. Dort legen sie den Laich in einer gallertartigen Hülle ab. Die Befruchtung findet meist außerhalb des Körpers statt. Die Larven leben im Wasser (bei Froschlurchen Kaulquappen) und atmen mit Außenkiemen. Das Wasser dient als Verbreitungsmöglichkeit, bietet viel Futter und schützt vor Austrocknung. Während der Metamorphose findet in den Larven eine Umwandlung zu Lungen und einem Skelett statt, damit sie als Adulttier an Land gehen können. Weiters erfolgt eine Rückbildung der Kiemen, eine Entwicklung hin zur Haut- und Lungenatmung, eine Verknöcherung von knorpeliger Substanz, eine Ausbildung von Extremitäten (bei Molchlarven werden erst die vorderen, dann die hinteren Extremitäten entwickelt, bei Kaulquappen umgekehrt), eine Runderschwanzrückbildung bei Froschlurchen und eine Ausbildung von Augenliedern und Trommelfellen. Froschlurche Sie begeben sich im Frühjahr auf Laichwanderung. Die Weibchen werden von den Männchen durch Quaken angelockt (Schallblase als Verstärker). Bei der Paarung klammert sich das meist kleinere Männchen an das größere Weibchen (an Achseln oder Lenden). Das Weibchen legt dann die Eier ab und das Männchen gibt seine Spermien darüber. Der Laich wird einzeln, in Ballen oder Schüren abgelegt und manchmal an Unterwasserpflanzen geheftet. Froschlaich wird in Ballen abgelegt. Krötenlaich wird meist in langen Schnüren abgelegt. 128 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Unkenlaich wird einzeln abgelegt. Schwanzlurche Die Anlockung erfolgt durch Schwanzwedeln der Männchen, in dem sie Duftstoffe aus der Kloake verbreiten. Sie haben eine auffällige Färbung (Prachtkleid bei Männchen). Die Befruchtung erfolgt innerhalb der Körpers. Das Weibchen nimmt mit der Kloake die Spermatophore auf, die das Männchen zuvor abgelegt hat. Es formt dann mit den Hinterbeinen aus einem Unterwasserpflanzenblatt ein U und wickelt jeweils ein Ei in solch ein U ein. Molchleich wird einzeln in ein Blatt eingewickelt. Entwicklung Die Eier werden ins Wasser abgelegt. Nach einigen wenigen Wochen schlüpfen die Larven (bei Froschlurchen Kaulquappen genannt). Sie atmen mit Haut- und Kiemenatmung. Bei Froschlurchen entwickeln sich zuerst die Hinterbeine, dann die Vorderbeine – bei Schwanzlurche ist dies genau umgekehrt. Froschlurche haben unterhalb der Mundöffnung eine Klebdrüse, damit sie sich an Wasserpflanzen festheften können. Der Mund besitzt Hornkiefer zum Raspeln. Sie ernähren sich von abgestorbenen Pflanzen, Algen und Aas. Molchlarven besitzen zwei Haftfäden am Kopf. Sie ernähren sich überwiegend von kleinen Wassertierchen Wenn die Beinpaare fertig ausgebildet sind, beginnt die Metamorphose, die eigentliche Umwandlung zum adulten Tier. Besonders bei den Froschlurchen sind die Veränderungen auffallend, da die Larven den erwachsenen Tieren weniger ähneln als bei den Schwanzlurchen. Morphologische Merkmale Insgesamt gibt es ca. 6,565 (Aug 12, 2009)!!!!!!!! Amphibienarten weltweit. Amphibien sind wechselwarme Tiere (haben keine konstante Körpertemperatur und passen sich der Umgebung an) mit entweder gleich aber meist unterschiedlich langen Gliedmaßenpaaren. Die Hände besitzen je 4 Finger und die Füße 5 Zehen. Fortbewegung erfolgt je nach Art entweder springend, kletternd, kriechend, schwimmend (tauchend) oder auch schreitend. Die Extremitäten sind an den Seiten abgewinkelt. Ihre Haut ist dünn und enthält häufig Schleimdrüsen oder auch Giftdrüsen. Die Haut ist besonders wichtig, da sie eine wesentliche Funktion bei der Atmung 129 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien übernimmt. Außerdem schützt sie vor Infektionen und manchmal vor Feinden (Giftdrüsen) und reguliert den Wasserhaushalt. Das Herz von Amphibien ist dreigeteilt. Das heißt es besteht aus 2 Vorkammern und 1 Hauptkammer ohne Scheidewand. Der Blut und Lungenkreislauf sind nicht vollständig voneinander getrennt. Wichtige Sinnesorgane sind die Augen, obwohl diese unbewegte Dinge kaum wahrnehmen können. Bei den Schwanzlurchen zum Beispiel ist der Geruchssinn sehr gut entwickelt und bei den Froschlurchen spielt das Trommelfell eine wichtige Rolle – akustisches Sinnesorgan. gepresst. Der Sauerstoff kann dann durch die Lungenwand ins Blut diffundieren und schließlich wird die CO2 angereicherte Luft wieder über die Nasenlöcher ausgeatmet. ad 3. Bei der Mundhöhlenatmung wird die Luft, welche durch die Nasenlöcher eingesogen wurde nicht in die Lunge gepresst sondern über die Schleimhäute, welche sich im Mundboden befinden, aufgenommen. Die Hautatmung ist ein besonderes Kennzeichen der Amphibien und sehr wichtig. Über die feuchte, dünne Haut kann der Sauerstoff direkt über diese aufgenommen werden. Atmung Nahrung und Fressfeinde Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Atmung bei Amphibien. Diese sind abhängig von ihrem Entwicklungsstadium. 1. Haut- und Kiemenatmung im Larvenstadium 2. Lungenatmung bei den adulten Tieren 3. Kehl-, Haut-, und Mundhöhlenatmung bei den adulten Tieren Larven der Amphibien: Die Nahrung der Kaulquappen der Froschlurche besteht vor allem aus pflanzlicher Kost wie zum Beispiel Algen und Plankton. Sie ernähren sich aber manchmal auch von kleinen Wasserflöhen und Kleinkrebsen. Vor allem die Molchlarven ernähren sich teilweise auch von kleineren Amphibien und sind somit aktive Jäger. ad 1. Kiemenatmung findet man bei den Kaulquappen und allen wasserbewohnenden Tieren. Kiemen sind Hautausstülpungen die sehr gut durchblutet sind. Amphibien besitzen im Larvenstadium (bis zur Metamorphose) Kiemen. ad 2. Der Mundboden übernimmt eine Pumpfunktion. Dabei wird die Kehlhaut abgesenkt und somit die Luft durch die Nasenlöcher eingesaugt. Danach werden die Nasenlöcher wieder verschlossen und durch Anheben der Kehlhaut wird die Luft in die Lunge Adulte Amphibien: Die Adulten sind ausschließlich Pflanzenfresser und können nur lebende Nahrung verzehren, weil sie tote Tiere nicht erkennen können. Dabei sind sie nicht sehr wählerisch und fressen alles, von Insekten, Larven, Spinnen bis zu Würmern und Schnecken. Froschlurche: Froschlurche besitzen eine Fangzunge welche dann beim Fang der Beute in sekundenschnelle hervorschnellt und mit der klebrigen 130 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Zungenspitze die Beute einfängt. Diese wird dann als Ganzes verzehrt und im Schlund zerquetscht. Schwanzlurche: Diese Tiere besitzen keine Fangzunge, sondern müssen stattdessen ihre Beute mit ihren Kiefern fangen und festhalten. Schwanzlurche fressen vor allem Insekten, Regenwürmer und Schnecken. Feinde: Zu den Feinden zählen unter anderem Iltisse, Krähen, Reiher, Fische, Waschbären, Ratten, Bussarde, Schlangen, Dachse und vor allem der Mensch. Die eigentliche Gefährdung ist der Mensch und mit ihm verbunden Zerstörungen und Fragmentierung der Lebensräume (Laichgewässer, Wanderkorridore, Sommerlebensräume) und Umweltverschmutzungen. Lebensweise Die adulten Tiere treffen sich im Frühling in den Laichgewässer um sich zu paaren. Hier entwickeln sich dann die kiemenatmenden Kaulquappen. Die daraus entstanden Jungtiere wandern dann im Spätsommer in ihre Landlebensräume, wie zum Beispiel Wiesen, Wälder, Gärten und suchen sich dann im späten Herbst einen geeigneten, frostfreien Überwinterungsplatz, welcher sich sowohl im Wasser als auch an Land befinden kann, um die kalte Jahreszeit zu überdauern. Lebensraum Amphibien kommen auf allen Kontinenten vor mit Ausnahme der Antarktis. Durch Abhängigkeit an das Süßwasser wird ihre Verbreitung jedoch ein wenig eingeschränkt. Trockengebiete und Hochgebirge werden in der Regel gemieden. Blindwühlen findet man in den Tropen Afrikas, Asiens und Amerikas und sind daher nicht in Österreich heimisch. Allgemein beliebte Lebensräume sind Flussauen, Tümpel, Weiher, Seen, Wälder (Feuchtbiotope), Moore usw. . Fortpflanzungslebensraum: Alle Froschlurcharten mit Ausnahme einiger Salamanderarten sind bei ihrer Fortpflanzung auf Gewässer angewiesen. Zu den Ausnahmen zählt die Geburtshelferkröte und Salamander Dabei sind fast alle Gewässer geeignet – von Froschlurchen und Molchen werden jedoch stehende Gewässer bevorzugt. Der Salamander hingegen bevorzugt fließende Gewässer. Verschiedene Arten bevorzugen unterschiedliche Gewässer. Tümpel: Gelbbauchunke, Kreuzkröte Größere Feuchtgebiete: Laubfrosch Weiher und Seen: Erdkröte, Seefrosch 131 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Wanderdistanzen Zeitspanne in der die Froschlurche an Gewässern anzutreffen sind Sommerlebensraum: Von Art zu Art verschieden. Wasserfrösche und Gelbbauchunken zum Beispiel verbleiben relativ lange am Gewässer. Bergmolche leben immer ziemlich nahe am Gewässer während Grasfrösche in Wäldern, Wiesen und Gärten anzutreffen sind. Laubfrösche verbringen ihre Zeit vor allem auf Büschen und Bäumen und die Erdkröte begeht Langstreckenwanderungen in Wald, Wiesen, Felder und Gärten. Die Kreuzkröte ist ein „Kulturfolger“ – früher war sie oft an Flüssen anzutreffen, heute hat sie ihren Lebensraum auf Kiesgruben, Waffenplätzen und Baustellen umgestellt. Winterquartier: im Wasser: Der kleine Wasserfrosch, Teichfrosch und Grasfrosch haben ihre Winterquartiere im Wasser, wo sie sich vor allem im Bodenschlamm aufhalten. Dort halten sie keinen Winterschlaf sondern nur eine Winterruhe. Das heißt ihre Aktivität ist nicht komplett eingeschränkt Die Mindesttiefe der Gewässer sollte 50 cm betragen auf Grund der Sauerstoffversorgung. an Land: Andere Amphibien suchen sich frostsichere Verstecke an Land wo sie Temperaturen bis wenige plus Grade überleben können. Manche können sogar einfrieren. Die meisten Amphibien welche an Land überwintern suchen sich Erdhöhlen im Boden, Löcher in Steinhaufen oder Laubhaufen. Die Knoblauchkröte zum Beispiel gräbt sich ihr Versteck selbst. Amphibien vor Ort Donaukammmolch Der männliche Donaukammmolch hat während der Paarungszeit einen prächtigen Kamm ausgebildet, der an 132 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien der Schwanzwurzel eine Vertiefung aufweist. Er ist eher klein und zierlich und hat kurze Extremitäten. Weibchen erreichen eine Länge con 16cm, Männchen von 14cm. Der Rücken ist braun bis schwarz und an den Flanken befinden sich weiße Tüpfel. Weibchen haben eine dunkelgelbe bis dunkelgraue Kehlfärbung mit kleinen weißen Punkten, Männchen hingegen eine tiefschwarze Kehlfärbung mit einer eckig, weißen Musterung. Der Bauch ist orange mit schwarzgrauen, unscharfen Flecken. Ein silberweißes Perlmuttband zeiht sich über den Schanz, der sehr lang ist. Verbreitet ist dieser Molch im Osten Österreichs und westwärts der Donau. Für den Laich bevorzugt er stehende Gewässer, an Land Auwälder. Teichmolch Der Teichmolch ist ein schlanker, feingliedriger Molch, der bis zu 11 cm lang wird. Männchen haben einen hell-dunkel längsgestreiften Kopf. Der Rücken und die Flanken sind braun gefärbt und weisen relativ große dunkle Flecken auf. Die Färbung ist in der Wassertracht wesentlich intensiver. Der Rückenkamm ist vom Kopf bis zum Schwanz ohne Unterbrechung gewellt. Die Unterseite ist weißlich mit orangefarbener Mittelzone, die untere Schwanzkante ist ebenfalls orangerot gefärbt. Weibchen sind lehmfarben und haben kleinere, dunkle Flecken. Die Kehle ist gepunktet. Dieser Molch kommt in Wien, NÖ, OÖ und im Burgenland vor und besitzt eine große Anpassungsfähigkeit. Rotbauchunke Rotbauchunken werden 4 bis 5cm groß. Ihre Oberseite hat dunkle Grau-, Braunbis Grüntöne mit dunklen Flecken. Die Unterseite ist dunkelgrau bis schwarz mit orange-rötlicher Fleckung. In den dunklen Partien sind weißt Flecken zu sehen, die in der Mitte winzige schwarze Punkte haben (Giftdrüsen). Der Körper ist insgesamt flach und die Schnauze ist rundlich. Sie haben eine herzförmige Pupille und keine Ohrdrüsen. Die Rückenhaut ist glatt, jedoch besitzt sie kleine Warzen mit einer Hornkuppe. Männchen besitzen eine innere Schallblase. Rotbauchunken sind in Becken und Tälern von Wien, NÖ, Burgendland, Steiermark und OÖ verbreitet. 133 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Erdkröte Die Erdkröte ist groß und kräftig gebaut. Sie kann eine Länge von 15cm erreichen. Der Rücken ist bräunlich gefärbt, der Bauch hingegen weißgrau und dunkel marmoriert. Sie besitzt eine rötliche Iris mit einer waagrechten Pupille. Das Maul ist kurz. Bei der Fersenprobe reichen die Fersen bis zum Trommelfell. Die Haut ist warzig. Deutlich hervortretende Ohrdrüsen laufen nach hinten seitlich auseinander. Die Weibchen sind meist deutlich größer als die Männchen. Die Iris ist goldgrün bis kupferfarben. Die Erdkröte ist das am weitesten verbreitete Amphib und kommt in allein Bundesländern vor. Wechselkröte Die Wechselkröte ist bis zu 10cm groß und hat ein unverkennbares Muster. Die Oberseite ist hell mit deutlich abgezeichneten, grünen Flecken, wobei in der Rückenmitte eine helle Längslinie verläuft. (vgl. Tarnnetz von Militärfahrzeugen). Weibchen haben an den Seiten oft rötliche Warzen. Die Unterseite ist meist hell. Der Laut der männlichen Wechselkröten ähnelt der Lautäußerung der Maulwurfsgrille. Die Iris ist goldgrün und die Pupille ist waagrecht. Sie besitzt parallel angeordnete Ohrdrüsen. Charakteristisch ist ein Gelenkshöcker auf der Zehenunterseite. Laubfrosch Vorwiegend dämmerungsund nachtaktiver Baumfrosch, dessen Finger- und Zehenspitzen scheibenförmig verbreitert sind. Diese Haftscheiben erlauben dem Frosch das Klettern auf Pflanzen und Bäumen. Laubfrösche sind die einzigen Baum bewohnenden Amphibien Europas. Der Laubfrosch besitzt eine glatte, meist grasgrüne Körperoberseite mit dunklen Flankenstreifen und eine weißen bis gelblichen Bauchseite. Die Kehle der Männchen ist faltig und etwas dunkler gefärbt als bei den Weibchen. Die Kopf-Rumpflänge beträgt in etwa 45 mm. Als Nahrung dienen vor allem alle möglichen Insekten, wie Käfer, Fliegen und Spinnen. Ist in ganz Österreich vorzufinden, vor allem aber in Höhenlagen unter 500m. 134 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Springfrosch Der Springfrosch ist ein hellbraun bis rotgraubrauner Frosch mit wenigen verwaschenen Flecken. Die Größe der Männchen ist in etwa 65 mm und die der Weibchen rund 80mm. Auffallend sind die extrem langen Hinterbeine, denen dieser Frosch auch seinen Namen zu verdanken hat. Der Körperbau ist eher schlank und er hat eine leicht zugespitzte Schnauze. Auf Grund der langen Beine kann diese Froschart bis zu 2m weit springen. Der Springfrosch kommt als Bewohner von trockenen Lebensräumen fast überall im Flachland von Österreich vor und fehlt nur in den Alpen. eine Spur kleiner ist. Die Körperoberseite ist meistens grün, kann aber auch blau – braun gefärbt sein. Außerdem besitzt das Männchen braune und das Weibchen schwarze Flecken, die regelmäßig auf der Oberfläche verteilt sind. Die Iris ist sehr auffallend goldgelb gefärbt. Der kleine Wasserfrosch ist vor allem in kleineren vegetationsreichen Gewässern, in Wäldern oder an Waldrändern zu finden. Kleiner Wasserfrosch Der weibliche Wasserfrosch weist eine Körpergröße von ca. 5565mm auf, während das Männchen mit 45-55mm 135 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien 2. Didaktischer Teil Vorbereitung Bei unserem ersten Treffen begannen wir mit einem Brainstorming zum Thema Amphibien. Schon nach kurzer Zeit stellten wir fest, dass dieses Thema irrsinnig umfangreich war und somit hatten wir Probleme einen konkreten Plan für die Schüler zu entwickeln. Dazu kam, dass wir ja im Vorhinein nicht wissen konnten, auf welche Amphibien wir in Marchegg stoßen würden. Schlussendlich begannen wir uns auf den fachlichen Teil vorzubereiten wie zum Beispiel auf die Atmung, die Fortpflanzung, die Lebensweise, den Lebensraum… Weiters informierten wir uns über die Arten, von denen wir hoffen sie in Marchegg zu finden. Unser zweiter Schritt war es den didaktischen Teil zu erarbeiten. Wir entwarfen zuerst einen groben Plan: Einleitung in das Thema, Hauptteil mit Hauptaugenmerk auf die selbstständige Arbeit der Schüler und Schluss mit Wiederholung und Ergebnissicherung. Zu jedem dieser Punkte machten wir abermals Brainstorming und sammelten so die verschiedensten Ideen Zuletzt einigten wir uns auf folgenden Ablauf: Einleiten wollten wir das Thema, indem wir die Schüler in die Terrarien schauen und selbstständig herausfinden lassen wollten, bei welcher Station sie sich befinden. Danach sollten sie alles aufschreiben, was ihnen zu dem Thema einfällt. Somit wollten wir den Wissenstand der Schüler feststellen. Der Hauptteil sollte aus eigenständiger Arbeit der Schüler bestehen. Zu diesem Zweck hatten wir zwei Optionen parat. Zum einen hatten wir die Idee jedem Schüler ein Tier zuzuteilen und zum Experten werden zu lassen. Das heißt jeder Schüler sollte sich eingehend mit dem Tier beschäftigen und schlussendlich das Amphib der restlichen Gruppe vorstellen. Unsere zweite Option war es die Schüler in kleine Gruppen einzuteilen, sie die Unterschiede zwischen zwei Arten herausfinden zu lassen (z.B.: Frosch-Kröte, MolchRotbauchunke, usw.) um ihre Ergebnisse wiederum der restlichen Gruppe vorzustellen. Der Schluss sollte ein Ratespiel sein. Wir stellten uns vor den Kindern Begriffe zu einem bestimmten Tier zu sagen und dabei immer konkreter zu werden bis eines der Kinder das Tier erraten würde. Als weiter Möglichkeit zu einem Ende zu kommen wäre ein kleines Quiz gewesen. Auf der Suche nach unserem „Material“ In Marchegg angekommen starteten wir mit Gummistiefeln und Keschern bewaffnet sofort in die nahe Umgebung. Voller Optimismus nahmen wir auf unsere Entdeckungsreise viele kleine Behälter mit um unsere Amphibien so aufbewahren zu können. In der ersten Stunde hatten wir das Glück nahe dem Tümpel am Feld einen Laubfrosch zu finden. Stolz brachten wir ihn zum Haus zurück ohne zu wissen, dass dieser Fund unser letzter für eine lange Zeit sein würde. Leider, so schien es, war unser Kurs wohl noch etwas zu früh, denn weitere Amphibien waren weit und breit nicht zu sehen. Eva 136 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien Ursprung kam uns nach einiger Zeit zu Hilfe und war selbst verblüfft, wie rar sich die Frösche und Kröten machten. Sie erzählte uns, dass man die Amphibien, vor allem die Wasserfrösche, bisher jedes Jahr mit der Hand fangen konnte, wenn sie, erschrocken, vom Ufer ins Wasser flüchten wollten. Da wir untertags eben nicht sehr erfolgreich waren, machten wir uns mit Eva in der Nacht erneut auf die Suche. Wir durchforsteten mit Taschenlampen jedes Ufer der nahe gelegenen Tümpel und als wir schon fast aufgeben wollten, fingen wir doch noch eine junge Erdkröte. Am nächsten Morgen begannen wir uns Sorgen zu machen. Wir wussten, dass am nächsten Tag die Schüler kommen würden und hatten bisher genau 2 Amphibien. Deshalb beschlossen wir mit Eva und Erich zum Pulverturm zu fahren. Dort angekommen konnten wir unser Glück kaum fassen. Es gab Unmengen von Rotbauchunken, die man mit bloßer Hand fangen konnte. Motiviert stellten wir uns nun der Herausforderung einen Wasserfrosch zu „jagen“, der immer wieder an der Wasseroberfläche zu sehen war. Mit dieser Aufgabe verbrachten wir die weiteren 2-3 Stunden und blieben aber trotz jeder Taktik, die wir währenddessen entwickelten, erfolglos. Kurz vor der Heimfahrt gelang es uns noch eine Wechselkröte zu fangen. Im Laufe des Tages bekamen wir noch durch die nette Unterstützung von Studienkollegen und Tobi einen Teichmolch, einen Springfrosch und einen Wasserfrosch. Nun waren wir beruhigt und stimmten unseren Plan auf die gefundenen Amphibien ab. Der Tag der Wahrheit In der Früh brachten wir unser benötigtes Material samt Tisch und Bank zu einem Platz hinter dem Haus. Er lag in der Nähe des Haustümpels im Schatten. In der Gruppe hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir mit jeder Schülergruppe 30 Minuten Zeit hatten. Als die erste Gruppe bei uns war, bemerkten wir sofort, dass sich unser Plan zeitlich nicht ausgehen würde. Wir hatten viel zu viel vor und mussten daher unser Programm kürzen. Wir beschlossen das Brainstorming zu Beginn und das Ratespiel wegzulassen, da das gegenseitige Vorstellen der Amphibien von den Schülern sowieso eine Wiederholung darstellen würde Somit lief unsere Einheit folgendermaßen ab: Als Einstieg haben die Schüler geraten, bei welcher Station sie waren. Danach konnte sich jeder ein Tier aussuchen und es sich genau anschauen. Sie mussten sich auf Augen, Haut, Beine, Amtung und Farbe konzentrieren und sich überlegen, wozu dies alles in der Natur dienen könnte. Nicht nur das „Wie schaut das Tier aus?“ war uns wichtig zu beantworten, sondern auch bzw. vor allem „Warum ist dies so?“. Unser Problem war, dass wir ein bisschen ungeduldig waren und die Intention hatten den Schülern die Antwort schon in den Mund zu legen. Wir mussten uns bemühen uns mehr zurückzunehmen um sie selbstständiger arbeiten lassen. Dies funktionierte von Mal zu Mal besser (Pro Tag hatten wir sechs Gruppen.). Die Kinder waren stets leicht zu begeistern und überraschten uns immer wieder mit ihrem vorhandenen Wissen. Manche Schüler wollten gleich zu Beginn 137 Eva Edelmann & Sabrina Walentich: Amphibien jedes Amphib angreifen, andere zeigten sich zurückhaltender. Am Ende jedoch hatten alle Schüler ihre Scheu überwunden. Am zweiten Besuchstag war der Start etwas holprig. Das Wetter war schlecht und zugegebenermaßen war unsere Motivation auch nicht so ausgeprägt wie am ersten Tag, was sich sofort bei der ersten Gruppe widerspiegelte. Zum Glück fingen wir uns jedoch schnell wieder und so verlief alles wieder, wie wir es uns vorgenommen und geplant hatten. Lehrziel Unser oberstes Lehrziel war es, die Schüler Arten in der freien Natur erkennen zu lehren. Sie sollten ein geschulteres Auge für Unterschiede bekommen Das genaue Anschauen und Angreifen sollte ihnen die Scheu vor den Tieren nehmen und sie zusätzlich motivieren selbst auf die Suche nach Amphibien zu gehen. Quellen http://iq.lycos.de/qa/show/726477/Welche-Unterschiede-gibt-es-inder-Entwicklung-zwischen-Froschlurch-und-Schwanzlurch/ http://www.kaulquappe.de/ http://www.herpetofauna.at/ http://www.amphibienschutz.de/amphib/amphibien.htm http://de.wikipedia.org/wiki/Amphibien Diesener, Günter & Reichholf, Josef (1985): Lurche und Kriechtiere. Mosaikverlag, München. Engelhardt, Wolfgang (1985): Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher? Kosmos Naturführer, Stuttgart. Ballasina, Donato (1984): Europäische Amphibien. Benziger, Zürich. Blab, Josef (1986): Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien. Kilda-Verlag, Greven. Coborn, John (1996): Das große Buch der Amphibien. Bede-Verlag, Ruhmannsfelden. 138 Checkpoint Amphibien Gelsensprayfreie Zone von Pia Edelmann & Michael Lins Fachliches Allgemein Alle heimischen Amphibien sind auf Wasser, zwecks Kinderstube, angewiesen. Aufgrund ihrer Entwicklung von juvenil, im Wasser nach adult, an Land, werden Amphibien auch als ursprüngliche Landwirbeltiere angesehen. Weiters sind sie nicht in der Lage ihre Körpertemperatur konstant zu halten (wechselwarme Tiere), weshalb sie auf frostfreie Winterquartiere angewiesen sind (Achtung: es gibt frostresistente Arten, jedoch nicht in Österreich). Haut Ein wichtiges Merkmal der Amphibien ist ihre Haut. Sie ist dünn, bildet keine Schuppen und ist weder von Haaren noch von Federn bedeckt. Dadurch ist sie sehr durchlässig, was Vor- und Nachteile hat. Positiv ist, dass die Atmung zu einem großen Teil über die Haut erfolgen kann. Außerdem müssen Amphibien nicht trinken, ihren Wasserbedarf decken sie ebenfalls über die Haut. Leider nehmen sie so auch Giftstoffe sehr schnell auf, weshalb unsere Station gelsensprayfreie Zone war. Körperbau Die drei Ordnungen innerhalb der Klasse der Amphibien unterscheiden sich in ihrem Körperbau deutlich. Wir haben uns ausschließlich mit der Ordnung der Froschlurche (Anura) beschäftigt. Für sie sind Abgewinkelte Extremitäten typisch, wobei die Hinterbeine größer und kräftiger sind. Ihre Vorderextremitäten haben nur vier Finger, der Daumen ging verloren. Die Beweglichkeit ihres Kopfes ist eingeschränkt, weil sie nur zwei Halswirbel haben. Außerdem besitzen sie nur einen Kreuzbeinwirbel, der eine Verbindung zum Becken hat. Als Anpassung an das Springen wurde die Wirbelsäule auf durchschnittlich 9 Wirbel verkürzt; die gleichzeitige Verbreiterung des Rumpfes bedingt die charakteristische Gestalt. Sinnesorgane Die Augen von Amphibien sind gut an das Leben im Wasser angepasst. Eine durchsichtige Schicht, die bei Bedarf über das Auge geschoben wird, wirkt wie eine Taucherbrille. Außerdem wird so an Land verhindert, dass das Auge austrocknet. Da die akustische Kommunikation vor allem bei der Paarung eine wichtige Rolle spielt, ist der Gehörsinn von großer Bedeutung. Anderes als wir Menschen haben Amphibien keine Ohrmuschel, die den Schall auffängt/verstärkt, und auch keinen Gehörgang. Das Trommelfell liegt in die Haut am Kopf eingebettet und überträgt direkt die Schallwellen. Entwicklung In ihrer Entwicklung sind die Amphibien sehr stark vom Wasser abhängig. Sowohl die Paarung als auch die Eiablage finden in Gewässern statt. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die Kaulquappen. 139 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien Sie haben noch große Ähnlichkeit mit Fischen, atmen mit Kiemen, haben anfangs keine Extremitäten und schwimmen durch Bewegungen ihres Schwanzes. Im Laufe ihrer Entwicklung werden sie den adulten Tieren immer ähnlicher, Lungen bilden sich aus, ihnen wachsen zuerst Hinterdann Vorderbeine und der Schwanz schrumpft. Verteidigung Um sich zu Verteidigen haben Amphibien unterschiedliche Strategien entwickelt. Die z. B. Rotbauchunke kann ein giftiges Sekret produzieren, die Erdkröte pumpt sich bei Gefahr auf und lässt ein bedrohliches Knurren hören. Andere Arten suchen ihr Heil eher im Rückzug und der Flucht: Die Knoblauchkröte kann sich rasch eingraben um der Hitze des Tages und hungrigen Blicken zu entkommen, während der Springfrosch in mächtigen Sätzen davoneilt. Die beste Verteidigung ist es für den Feind unsichtbar zu sein. Im Laufe der Zeit haben sich jene Tiere durchgesetzt, die durch ihre besondere Färbung am besten mit der Umgebung verschmolzen und so ihren Fressfeinden am ehesten entkommen konnten. Gefährdung / Schutz In Österreich sind alle Amphibien zumindest potentiell gefährdet, manche sind sogar stark gefährdet. Das größte Problem stellt die Zerstörung ihrer Lebensräume dar. Da Amphibien zum Laichen normalerweise an ihre Geburtsgewässer zurückkehren, legen sie oft große Strecken zurück. Dabei werden ihren Wanderwege oft von Straßen gekreuzt, was in den meisten Fällen einem Todesurteil gleichkommt. Um die Tiere vor dem Reifentod zu bewahren, wurden an vielen Orten Amphibienzäune oder Untertunnelungen errichtet. Sinn davon ist es, die Tiere an bestimmten Punkten zu sammeln, wo sie dann selbständig oder durch menschliche Hilfe gefahrlos auf die andere Straßenseite gelangen können. „Unsere“ Arten • Laubfrosch Der Laubfrosch (Hyla arboria) ist besonderes gut an das Leben in den Bäumen angepasst. An seinen Fingern und Zehen befinden sich Saugnäpfe, die ihm das Klettern auch auf sehr 140 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien glatten Oberflächen ermöglichen. Zur Paarung verlassen die Männchen ihren angestammten Lebensraum und versammeln sich in einem Teich oder Tümpel, um allabendlich ein lautstarkes Konzert anzustimmen. Mit ihren Paarungsrufen locken sie Weibchen zu sich ans Gewässer. Diese wählen dann anhand der Gesangstonlage/-ausdauer einen Partner, der ihnen geeignet scheint, sein Erbgut an ihre Nachkommen weiter zu geben. So bedeuten zum Beispiel tiefe Töne, dass das Männchen groß ist. Die Lautstärker des Quaken ist von geringerer Relevanz, denn leise Rufe können genauso auch von einem sehr kräftigen Männchen in weiter Entfernung stammen. • Wasserfrosch Anhand des Wasserfrosches (Rana esculenta) zeigten wir den Schülerinnen und Schülern die Anpassung der Amphibien an das Leben im Wasser, denn die Schwimmhäute sind bei ihm besonders deutlich ausgeprägt. Außerdem ist er durch seine Färbung perfekt getarnt. Schwimmt er an der Wasseroberfläche eines Tümpels, ist sein grünlich-graubraun-schwarz gemusterter Rücken von oben (etwa für Vögel) kaum zu erkennen. Seine weißliche Bauchfärbung macht es ihm leicht, eventuelle Bedrohungen unter Wasser zu täuschen und damit zu entkommen (optische Einswerdung mit der hellen Wasseroberfläche). • Springfrosch Der Springfrosch (Rana dalmatina) zeichnet sich durch besonders lange und kräftige Hinterextremitäten aus. Ausgestreckt ist sein Bein länger als der Rest des Körpers und auch die Muskulatur ist sehr deutlich ausgeprägt und gut zu erkennen. Wie alle Braunfrösche haben sie einen dunkelbraunen, etwa dreieckigen Schläfenfleck, in dem auch das Trommelfell liegt. Ihre Färbung ist meist hellbraun ohne kontrastreiche Muster. 141 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien • Wechselkröte Besonders auffällig ist die Färbung der Wechselkröte (Bufo viridis), mit der sie trotzdem gut getarnt ist. Viele, deutlich abgegrenzte, satt olivgrüne Flecken auf hellem Untergrund passen perfekt zu ihrem Lebensraum, auch wenn sie im Terrarium sofort ins Auge stechen. Durch die deutlich fühlbaren Warzen am Rücken und ihre eher trockene Haut ist sie leicht der Familie der Kröten zuzuordnen, in der sie zur Gattung der Echten Kröten. • Knoblauchkröte Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) heißt so, weil die Männchen an den Vorderextremitäten eine Drüse haben, die bei Gefahr ein nach Knoblauch stinkendes Sekret absondert. Weiteres Merkmal sind scharfkantige, verhornte Auswüchse an den Hinterextremitäten, die sie wie eine Grabschaufel benutzen und die es ihnen ermöglicht, sich blitzschnell in lockeres Erdreich einzugraben. Besonderes an der Knoblauchkröte ist, dass sie nicht zur Familie der echten Kröten gehört, sondern zu einer Familie, deren einziger Vertreter sie in Österreich ist. Erkennen kann man dies sehr gut an ihren Augen. Sie hat „Augen wie eine Katze“, die Pupillen stehen also senkrecht, während sie bei allen anderen in heimischen Familien der Froschlurche waagrecht sind. • Rotbauchunke „Drohen“ war das Adjektiv, mit welchem wir die Rotbauchunke (Bombina bombina) bei unserem Zuordnungs-Spiel (siehe Didaktischer Teil) beschrieben. Charakteristisch sind die rötlichorangen Flecken auf ihrer Bauchseite, die als Warnung dienen sollen. Ist Gefahr in Verzug, bildet sie ein extremes Hohlkreuz und stellt ihre abschreckende Farbenpracht zur Schau. Das Gift, welches sie absondert, ist für den Menschen eigentlich nicht gefährlich, da es aber zu allergischen Reaktionen kommen kann, durften die Schülerinnen und Schüler das Tier nicht anfassen. 142 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien Didaktisches Aller Anfang ist schwer… Was machen wir? Und vor allem: Wie machen wir’s? Da ich leider die Vorbesprechung früher verlassen musste, war ich zunächst ehrlich gesagt etwas planlos. Auf meine erste Frage antwortete mein Kollege Michael cool: „Amphibien. Das ist ein super Thema!“. Auf das „Wie“ wusste er zunächst aber auch keine Antwort. Deshalb beschlossen wir, zu Orientierungszwecken zunächst die Homepage zu durchforsten und uns die Protokolle der vergangenen Jahre anzusehen. Gleich hier zu Beginn ein Hoch auf die Technik, denn Internet, E-Mail und Skype erleichterten unsere Arbeit beträchtlich. Nach einigen vorbereitenden Gesprächen über das Chat-Programm beschlossen wir, uns so bald wie möglich zu treffen um einen Plan gegen unsere Planlosigkeit zu entwickeln. Die Beiträge der letzten Jahre boten durchaus Inspiration, allerdings wollten wir unseren Lehrauftritt individuell gestalten und unbedingt neue, eigene Ideen einbringen. Vorläufige Lehrziele und geplante Methoden Kurz nach der ersten ernsten Vorbesprechung, mit Themenvergabe, trafen wir uns also zu einem gehirnerwärmenden Plausch. Zu dem Zeitpunkt waren wir uns bereits bewusst, dass wir zwei Klassen zu betreuen hätten die unterschiedlicher kaum sein könnten: Eine Siebte (m/w) und eine Erste (nur m). Um den Jugendlichen also alterskonform zu begegnen, einigten wir uns darauf zwei verschiedene Konzepte zu erarbeiten. Es sollte so sein, dass sich die ältern Schüler besonders mit • Entwicklung • Paarung (Wanderung, sexuelle Selektion) • Morphologie auseinandersetzen. Erreichen wollten wir dies indem wir die jungen Erwachsenen Kaulquappen fangen lassen und sie anhand derer sich gegenseitig die Entwicklungsstufen bis zum „fertigen“ Tier erklären. Natürlich unterstützt durch uns. Weiters wollten wir sie anregen über sexuelle Selektion (Darwinjahr 2009) nachzudenken, am besten anhand eigener Erfahrungen. Das Schlagwort „Dating-Problem“ sollte ihnen dabei helfen ihre eigenen Probleme bei Partnerwahl/-suche mit denen der Frösche zu vergleichen. Schlussendlich war noch ein kurzer Bestimmungsschlüssel geplant, 143 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien der den Schülern die genauere Auseinandersetzung mit dem Äußeren der Tiere aufzwingen sollte. Den deutlich jüngeren Schülern wollten wir – wir unterstellten den Kindern geringes Vorwissen – unbedingt vermitteln was • das Tier, das aus dem Wasser kommt überhaupt ist • es zum Schwimm- und Springweltmeister macht • Amphibien mit Überlebenskampf und Militär zu tun haben Auch hier sollte uns das lebende Objekt Kaulquappe zur besseren Nachvollziehbarkeit der Entwicklungsstufen dienen. Die Kinder sollten durch den direkten Vergleich zwischen kleiner Larve und großem Tier zu angeregten Diskussionen gebracht werden. Weiters hatten wir geplant einen kleinen Bereich unserer Station zu umzäunen um dort einen Springfrosch herumhüpfen zu lassen. Da die Kinder im Anschluss daran selbst einen Springtest absolvieren sollten, hätte dies den Sinn gehabt den Unterschied zwischen den Sprungleistungen im Verhältnis zur Körperlänge zu verdeutlichen. Um auch bei den Jüngeren das Darwinjahr nicht außer Acht zu lassen, wollten wir noch auf Begriffe wie Tarnung, Amphibienfahrzeug oder Überlebenskampf eingehen und sie durch klassische W-Fragen in einen militärisch korrekten Kampf der Gedanken verwickeln. Unabhängig vom Alter oder Wissensstand der Schüler war noch angedacht, dass alle ihre Beobachtungen zumindest teilweise auf einem Arbeitsblatt niederschreiben, wissen was die wichtigsten Merkmale der Tiere sind und – sofern vorhanden – ihre Berührungsängste zu Amphibien abbauen. Gespräch mit Erich Immer noch nicht ganz zufrieden, aber stolz auf unsere vorläufige Planung trafen wir bei Dr. Eder ein. Eine seiner ersten Fragen betraf unsere Lehrziele. Nachdem wir diese nicht extra aufgeschlüsselt hatten, wurde vorgelesen was geplant war, den Kindern und Jugendlichen beizubringen. Kurz zusammengefasst ließe es sich mit „eigentlich alles“ beschreiben. Da dies aber zu umfangsreich und ungenau war, wurden wir angehalten die Lehrziele noch einmal und konkreter zu definieren, wobei uns didaktische Reduktion ans Herz gelegt wurde. Ein weiterer Punkt, der für Dr. Eder verbesserungswürdig war, war die geplante Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler. Davon war seiner Meinung nach noch zu wenig zu finden. Auch hörte sich für ihn unser Plan an, als würde die erste Klasse weniger „selber machen dürfen“ als die siebente, was von uns eigentlich nicht so gedacht war. Auch meinte er, die beiden Altersklassen wären gar nicht so verschieden wie wir glauben würden, dasselbe Konzept (jeweils nur leicht adaptiert) würde bei beiden funktionieren. Unsere Idee mit dem „Checkpoint Amphibien“ wurde für gut befunden, die geplanten Buttons gelobt und auch der Springtest fand Anklang. Auch machte uns Dr. Eder darauf aufmerksam, dass wir nahe unserer Station Amphibienzäune vorfinden würden, was sich eventuell gut in das Konzept einbauen lassen würde. Abgeraten wurde uns mit einem Bestimmungsschlüssel zu Arbeiten. Die wichtigsten Arten würden sowieso auf den ersten Blick erkannt werden und außerdem würden Jugendliche diese Methode als eher langweilig empfinden, auch weil sie doch eine längere Einführung benötigen würde. Außerdem bekamen wir noch eine Literaturempfehlung mit auf den Weg: „Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen“, ein 144 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien Buch des Umweltbundesamts, das sich genau auf das von uns besuchte Gebiet bezog und in dem ein eigenes Kapitel Amphibien und Reptilien, eben dieses Lebensraumes, gewidmet war . Der „endgültige“ Plan Nach unserem Gespräch mit Erich Eder wussten wir, dass unsere Konzepte noch Feinschliff benötigten. Einerseits wollten wir die starre Differenzierung zwischen sehr jungen und stark fortgeschrittenen Schülern überwinden, andererseits von eher vagen Ideen zu einem sicherheitverleihenden Zeitplan kommen. Dies erfolgte in Form eines „Drehbuchs“. Drehbuch deshalb, weil es Parallelen zu Lehrkonzepten gibt: Das Drehbuch ist erst dann fertig, wenn der Film fertig ist! Unser Konzept war also so ausgelegt, dass das Grundschema zwar vorgegeben und in gewisser Weise auch starr war, neue Ideen oder Anregungen jedoch problemlos ihren Platz im Arbeitskomplex finden sollten. Dieses Grundschema umfasste u. a. ein Arbeitsblatt. Es sollte, trotz einiger Bedenken, der zentrale Teil werden, da wir starke Zweifel hegten ob der Merkfähigkeit der Schüler. Allzu umfassend war das Arbeitsblatt nicht: Es sollten diverse Beobachtungen zu einzelnen Themenkomplexen (sechs Fragen bzw. Notizhilfen) vermerkt werden, mit dem Ziel, dass sich jeder ein Stück „eigenes“ Wissen auf Papier mit nach Hause nimmt. Kurz gefasst hatten wir geplant… Haut Körperbau Sinnesorgane Entwicklung Verteidigung … anhand der Tiere erfahrbar zu machen. Die Schüler (ein Thema pro Schüler) sollten sich, durch konkrete Fragen geleitet, Gedanken zu den einzelnen Themen machen um dann den Kollegen, unterstützt durch uns und die Beobachtungen an den Tieren, ihre Gedankengänge zu schildern. Die Ankunft „Ein schlechtes Amphibienjahr…“ ließ uns Prof. Walter Hödl wissen. Und tatsächlich: Seine Worte hallten schmerzhaft in unseren Ohren, denn bis in die Nacht hatten wir gerade einmal zwei Tiere gesichtet (einen Spring- bzw. Wasserfrosch) und keines davon gefangen. Glücklicherweise wussten alle Kollegen von unserer Problematik und so füllten sich im Laufe der Zeit unsere Terrarien dank tatkräftiger Unterstützung ihrerseits. Bis zum Ende des zweiten Tages konnten wir so zwei Spring-, zwei Wasserfrösche, einen Laubfrosch, eine Wechselkröte, zwei Knoblauchkröten sowie eine Rotbauchunke sammeln. Sehr zu bedauern war, besonders für den männlichen Teil des Amphibienteams, die Abstinenz der Erdkröten. Während des zweiten Tages ging am Horizont der Probleme ein weiterer dunkler Stern auf: Unser favorisiertes Plätzchen für den Bau des „Checkpoint Amphibien“ wurde von der Reptiliengruppe annektiert. Aufgrund des höheren Platzbedarfs seitens der werten Kolleginnen, ließen wir uns auf die Suche nach einem neuen Platz 145 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien ein und wurden am Ende des Bahnhaustümpels (wenige Meter von einer Schotterstraßenkreuzung entfernt) fündig. Nach einigen kleineren, gärtnerischen Umgestaltungen konnten wir mit dem neuen Plätzchen mehr als zufrieden sein. Es würde einen hervorragenden Einblick in den Lebensraum der Tiere bieten. Keine zwei Meter von den Terrarien beginnt der Tümpel, dichtes Unterholz lässt geistige Verknüpfungen zu Braunfröschen zu, lockeres Erdreich ermöglicht es den Knoblauchkröten ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und schattenspendende Bäume erleichtern den Tieren das beengende Eingesperrtsein. Das Management des vorgegebenen Zeitplans verlief glücklicherweise ohne Streitereien. Die Schüler würden in 4er Gruppen aufgeteilt, sich alle eine halbe Stunde pro Station aufhalten und jeweils von einem Teammitglied zur nächsten Station geführt werden. Es schien nun so, als ob keine weiteren dunklen Sterne mehr am Horizont der Probleme aufgehen würden… Die jungen Erwachsenen Unser Drehbuch wurde das erste Mal auf seine Tauglichkeit geprüft. Eingangs konnten wir es uns zu Nutze machen, dass sich praktisch alle Schüler vor Antritt ihrer Marcheggreise mit einem Gelsenmittel eingeschmiert hatten. Ein günstiger Umstand für uns: Schließlich konnten wir so über das Händewaschen einfach und nachvollziehbar auf die Haut der Tiere zu sprechen kommen. Die Schüler sollten dann Kärtchen mit Farbbildern und Artnamen den richtigen Tieren zuordnen, was prompt erledigt wurde. Anschließend sollten alle Schüler selber Hand anlegen. Einerseits um es uns selbst leichter zu machen und andererseits um den Fokus der Schüler auf eine Amphibienart zu lenken, gaben wir immer nur ein Tier aus den Terrarien heraus. Es sollte dadurch erfahrbar werden welche besonderen Merkmale die einzelnen Arten auszeichnen bzw. was alle (von uns gezeigten) Amphibien gemein haben. Die Aufmerksamkeit wollten wir durch gezielte Fragen in die gewünschte Richtung lenken, womit wir zu erreichen suchten unserem Drehbuch möglichst nahe zu kommen. Wie war’s? Teil 1 Die Artfeststellung durch die bebilderten Kärtchen klappte recht gut, hätte aber mehr Denkleistung fördern und fordern sollen: Es fehlte eine etwas tiefer gehende Auseinandersetzung mit den Tieren in den Terrarien. Ein flüchtiger Blick reichte oft schon, um zu wissen welche Karte welchem Tier zuzuordnen ist. Weiters sollte sich im Laufe der ersten Schülergruppe herausstellen, dass die Aufgabenstellungen des Handouts zwar durchgelesen, aufgrund der hohen Attraktivität des lebenden Anschauungsmaterials jedoch kaum bis gar 146 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien nicht beachtet wurden. Einer der Schüler fiel durch fleißiges Mitschreiben auf. Probleme bereitete ihm allerdings das Konzentrieren auf die Tiere und das gleichzeitige Notieren. Nicht zuletzt deshalb, weil auch wir anfangs zu sehr auf eine Mitschrift pochten und so fast aus den Augen verloren, dass sich eigentlich alles um die Amphibien in den Terrarien drehte. Bereits bei der zweiten Gruppe wurde das Handout nur noch als eventuelle, freiwillige Gedächtnisstütze ausgeteilt und ab der dritten ganz weggelassen. Die Einsicht, dass für die Schüler die Nähe zu den Tieren und die dadurch ausgelösten Emotionen wohl wichtiger sein würden als einige flüchtige Notizen, brachte uns zu diesem Entschluss. Auch das Fundament Drehbuch musste durch die Praxis des ersten Schülertages stark verändert werden. Das viele Wissen, welches darin theoretisch von den Schülern erarbeitet werden sollte, stellte sich als viel zu umfangreich heraus. Auch andere Punkte mussten wir aus Zeitgründen bzw. zu spärlichen Vorhandenseins im Tümpel (Stichwort Kaulquappenfischen) ganz streichen. Somit wurde für den nächsten Tag ein neues „Drehkonzept“ erstellt… Das Neue Eckpunkte unseres verbesserten Konzepts waren einerseits die Einsicht, dass nicht immer alles nach Plan verlaufen kann und andererseits einige konstruktive Vorschläge seitens des Betreuerteams. Die Artenkärtchen wollten wir für die nächste Klasse etwas anspruchsvoller gestalten und so wurde auf die Rückseiten jeweils ein Begriff geschrieben, der das jeweilige Tier besonders gut beschreiben würde. Weiters wollten wir den jüngeren Schülern wesentlich mehr abverlangen bzw. sie mehr einbinden, was das Halten und genauere Nachdenken über die Tiere anbelangt. Wir nahmen uns vor, immer min. zwei Amphibien gleichzeitig der Gruppe näherzubringen, da so Unterschiede und Parallelen der Arten wesentlich besser zu verdeutlichen sein würden als nur mit einem Tier. Zudem sollte das neue Programm die Fragen der Kinder in den Mittelpunkt rücken und durch flexible Gegenfragen unsererseits in Richtung… Haut (einfache Unterscheidung Frosch – Kröte) Augen (einfache Unterscheidung Frosch, Kröte, Unke – Knoblauchkröte) Atmung Wechselwärme Tarnung und Naturschutz … lenken – Themen, die die Kinder direkt Vorort an Umwelt und Tier beobachten können und sie nicht durch ein Zuviel an Information überfordern sollten. Die erste Klasse Wie bereits bei der Siebten begannen wir auch hier mit Händewaschen. Es sollte sich herausstellen, dass die Kinder einiges zuvor vom Klassenlehrer erfahren hatten, was uns die Einführung in das Thema Haut erleichterte. Danach erhielten sie sechs Begriffe die sie den jeweiligen Tieren zuordnen sollten. Dadurch mussten sich die Schüler wesentlich intensiver mit dem Aussehen der Tiere bzw. deren Terrarien beschäftigen, da sie weder Artname noch zugehöriges Bild zu sehen bekamen. Erst nach erfolgreicher Begriffsverknüpfung lösten wir das Rätsel der Artnamen und gingen dann dazu über, verschiedene Amphibien zu 147 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien vergleichen. Wichtig war uns dabei, immer einen Frosch und eine Kröte bzw. zwei verschiedene Frösche gleichzeitig umherzureichen. Dadurch konnten wir sehr anschaulich verdeutlichen, welche einfach zu merkenden Unterschiede zwischen den einzelnen Familien bzw. Gattungen bestehen, die durch den direkten Kontakt und den damit verbundenen Emotionen auch längerfristig behalten werden können. Weiters nützten wir die, durch das komplette Weglassen des Handouts, freigesetzte Zeit um einen „Wissens-Check“ knapp vor Ende unserer jeweiligen Einheiten einzuführen. Bei erfolgreichem Abschluss dieses Checks wurden die Kinder mit einem Amphibien-Button sowie einem süßen Fröschchen belohnt. Wie war’s? Teil 2 Die Begriffszuordnung sollte sich als guter Einstieg herausstellen, da die Kinder dadurch zum Nachdenken und Begründen ihrer Vermutungen angeregt wurden. Teilweise entstanden auch Diskussionen, da nicht jeder mit jedem „Idealbegriff“ der Tiere zufrieden war. Dennoch: Sie hatten so recht passende Wörter mit dem Aussehen der Tiere verknüpft, auf die die Kinder immer wieder zurückkamen („… den, der so gut klettern kann, haben wir im Garten!“ od. „… der Grüne kann ja ur-schnell schwimmen!“). 148 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien Durch das flexiblere Eingehen auf die Fragen der Kinder konnten wir auch wesentlich leichter die Themen abgleichen. So konnte es durchaus passieren, dass wir den Springtest (siehe Vorläufige Lehrziele und geplante Methoden) zu Gunsten einer ausführlicheren Behandlung z. B. des Naturschutzes ausfallen lassen mussten. Geschehen etwa, als vor unseren Augen eine Blindschleiche überfahren wurde (Checkpoint Amphibien direkt an Schotterstraße) und die Kinder diesem tragischen Moment entsprechende Aufmerksamkeit widmeten. Wir konnten dann über eine kurze Wiederholung der Reptilien zum Naturschutz gelangen und durch das Händewaschen den Fokus auf die Verletzlichkeit von Amphibien lenken. Auch der Wissenscheck am Schluss sollte sich als nützlich erweisen, da die Kinder mit viel Elan und angestrengtem Nachdenken über das Gelernte der süßen Belohnung entgegenfieberten. Reflexionen Allgemeines zur Lehrveranstaltung Eine Lehrveranstaltung, bei der wir wirklich mit richtigen Schülerinnen und Schülern arbeiten dürfen, ist ja an und für sich schon sehr spannend und -leider- ziemlich einzigartig. Marchegg bietet aber noch mehr als das. Für eine Woche der Zivilisation entfliehen, auf Strom und fließendes Wasser zu verzichten, das klingt für echte Biologen nach einem richtigen Abenteuer. An die Rahmenbedingungen gewöhnten wir uns ziemlich schnell und fehlende Ablenkungen durch Fernsehen, Handy und Co führte dazu, dass die verbleibende Zeit bis zum Eintreffen der Schulklassen sehr intensiv genutzt wurde. Minutenlanges regungslos ins Wasser starren (in der Hoffnung doch noch selbst einen Frosch zu fangen), Diskussionen über den Organisationsrahmen der Unterrichtstage, theoretische Inputs und Lieder am Lagerfeuer boten ein abwechslungsreiches Programm. Als der große Tag gekommen war und die Jugendlichen der siebenten Klasse von uns unterrichtet wurden, wurden wir unsererseits genau beobachtet. Die anwesenden „critical friends“ gaben uns gleich nach jeder Einheit ein kurzes Feedback, auf das wir bei der nächsten Gruppe schon reagieren konnten (oder reagieren hätten können). Diese kurzen Inputs waren eine gute Hilfe, vor allem am zweiten Tagen schafften wir es, die Tipps recht gut umzusetzen. Die umfassende Feedback-Runde am ersten Abend war ziemlich kritisch, durch die sachliche Vortragsweise aber hilfreich und nicht verletzend. Da wir selbst mit unserer Arbeit nicht so ganz zufrieden waren, waren wir froh über konkrete Verbesserungsvorschläge. Dass wir am Abend nach dem zweiten Unterrichtstag ausführlich zu hören bekamen, dass wir uns sehr verbessert hätten, freute uns natürlich besonders. Schlank ist besser… Den Blick geschärft für das Wesentliche! So könnte ich kurz mein Erleben der Marcheggtage beschreiben. Dass ein zu Beginn eher behäbig daherkommendes und stark überladenes Konzept durch einige, schlankmachende Maßnahmen plötzlich so problemlos über die Bühne gehen würde, hätte ich mir nicht gedacht. Der Wandel dazu von „Möglichst viel wissen!“ hin zu „Was kann jeder sehen/spüren/hören?“ wurde bereits dokumentiert. 149 Pia Edelmann & Michael Lins: Amphibien Zu kritisieren ist jedoch noch meine teilweise vorhandene Passivität. So konnte ich während unserer Arbeit bemerken wie ich mich zeitweise wie ein Assistent der etwas redefreudigeren Kollegin verhielt, wobei ich mich dabei keinesfalls übergangen fühlte o. ä.. Solche Phasen glichen mehr einem Abkommen zwischen Wind und Windstille: Es gibt beide, doch ein leiser Wind weht immer. Literaturliste Geduld ist eine Tugend Was habe ich aus dieser Lehrveranstaltung gelernt? Geduld haben, abwarten können, die Kinder selbst denken lassen, auch einmal das Ruder (beziehungsweise stellvertretend dafür den Frosch) abgeben können. Bei der ersten Gruppe hatte ich noch vor, unbedingt alle vorbereiteten Themen durch zu besprechen und ihnen so viel wie möglich bei zu bringen. Unser geplantes Konzept mit den „Expertengruppen“ funktionierte leider nicht, und ich war auch nicht wirklich in der Lage, flexibel darauf zu reagieren und das Ganze etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Außerdem ließ ich den Jugendlichen nicht genug Zeit zum Nachdenken sondern versuchte immer sehr bald, sie durch Impulsfragen zur richtigen Antwort zu führen. Im Laufe der beiden Tage lernte ich aber, das Ganze etwas lockerer anzugehen und die Auswahl, welche Themen wie intensiv behandelt werden spontan und individuell an die Interessen der jeweiligen Schülergruppe anzupassen. Cohen, N. W. & R. C. Stebbins (1995): A natural history of amphibians. Princton: Princton University Press Baumgartner, Ch. u.a. (1999): Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen. Wien: Umweltbundesamt, 224pp Blab, J. (1986): Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien. Bonn: KILDA-Verlag, 118pp Diesener, G. & J. Reichholf (1985): Lurche und Kriechtiere. München: Mosaik Verlag GmbH Dullman, W. E. & L. Trueb (1986): Biologie of Amphibians. New York: McGraw-Hill Book Company Graner, H. P. (2008): Nationalpark Donau - March - Thaya - Auen Eine Dreiländervision. Wien: Christian Brandstätter Verlag Grillitsch, B. & H. (1983): Niederösterreichs. Wien: Facultas Lurche und Kriechtiere Hofrichter, R. (Hrsg.) (1998): Amphibien: Evolution, Anatomie, Physiologie, Ökologie und Verbreitung, Verhalten, Bedrohung und Gefährdung. Augsburg: Naturbuchverlag Nöllert, A. & C. (1992): Die Amphibien Europas. Bestimmung – Gefährdung – Schutz. Stuttgart: Kosmos Verlagp 150 Reptilien von David Blum & Sabine Putz Fachliches Reptilien Reptilien unterscheidet man in die zwei Gruppen, Schildkröten (Testudines) und Schuppenkriechtiere (Squamata), wobei die Schuppenkriechtiere in Echsen und Schlangen unterteilt werden. Reptilien, auch Kriechtiere genannt, sind lungenatmende Wirbeltiere mit ursprünglich zwei paar Gliedmaßen die bei einigen Echsen und Schlangen zurückgebildet wurden. Der Unterkiefer besteht beiderseits aus mehr als einem Knochenelement. Deren Körperoberfläche ist mit einer verhornten Schuppenhaut bedeckt. Um zu wachsen, müssen sie diese Haut als Ganzes oder in Teilen immer wieder abstreifen. Reptilien sind ektotherm, das heißt, ihre Körpertemperatur wird nur von der Außentemperatur beeinflusst und sie sind poikilotherm (wechselwarm), haben also keine konstante Körpertemperatur. Daraus resultieren ein niedriger Stoffwechsel und die hohe Anzahl von Reptilien in wärmeren Gebieten. Schildkröten, Eidechsen und Schlangen sind also bei warmem Wetter aktiv und lebendig, bei kühler oder kalter Witterung eher starr und verstecken sich. Die meisten Reptilien legen hartschalige Eier am Land ab. Die Befruchtung erfolgt innerlich vor der Bildung der Schale. Einige Schlangen und Echsenarten sind vivipar (lebend gebärend). Die meisten Reptilien besitzen kein Außenohr und es gibt keine Paukenhöhle, keine Ohrtrompete und kein Trommelfell. Es gibt nur ein einziges Gehörknöchelchen und sie nehmen feinste Erschütterungen im Boden wahr. Der Geruchssinn ist im Vergleich dazu sehr gut entwickelt. Sie besitzen zur Geruchswahrnehmung zwei Sinnesorgane: Die Schleimhäute und das Jacobson´sche Organ. Mit der fein gegabelten Zunge, die die Schlange schnell aus- und wieder einzieht, nimmt Duftstoffe auf. Reptilien ernähren sich hauptsächlich von tierischer Kost wie kleine Wirbeltiere, Insekten, Spinnen und Würmer Die Marchauen sind ein geeigneter Lebensraum für einige sehr interessante Reptilien, darunter die europäische Sumpfschildkröte, Zauneidechsen, Ringel-, Äskulap-, Würfel- und Schlingnattern sowie Blindschleichen. Die Tiere finden hier von Nahrung, Laichplätzen, Überwinterungsmöglichkeiten, Versteck- und Sonnplätzen alles was sie benötigen. Im Folgenden sind jene Reptilien genauer beschrieben, welche wir gefunden haben und den Schülern präsentieren konnten. Äskulapnatter - Zamenis longissimus Eine wärme liebende, schlanke und kräftige Kletternatter. Sie ist mit bis zu 180 cm. die längste Schlange Österreichs. Sie hat glatt glänzende Rückenschuppen die hellbraun über olivengrün bis grauschwarz sind. Einzelne Schuppen sind mit weißen Schuppenrändern versetzt (Eindruck einer feinen weißen Strichelung). Die Bauchseite ist einfärbig gelblich, bei dunklen Tieren auch blauschwarz. Jungtiere besitzen gelbe Flecken am Hinterkopf. Am Hinterkörper sind die Schuppen leicht gekielt. Der schmale kleine Kopf ist vom Körper abgesetzt. Die Winterruhe dauert fünf bis sechs Monate (etwa von Oktober bis März). 151 David Blum & Sabine Putz: Reptilien Die Paarung erfolg in der ersten Maihälfte, wobei die Männchen Kommentkämpfe ausführen (umschlingen einander mit dem Vorderkörper und drücken den Gegner gegen den Boden). Vor der Paarung erfolgt noch ein ausgiebiges Paarungsspiel. Ende Juli werden 5-10 längliche weiße Eier in Laubhaufen oder Pflanzenmaterial abgelegt. Die Reifung des Eis dauert 6-8 Wochen und die Jungtiere haben eine Länge von bis zu 20cm Zu ihrer Nahrung zählen vorwiegend Kleinsäuger (Mäuse, Maulwürfe), manchmal auch Eidechsen und Jungvögel. Mit 1-2 Körperwindungen erdrosselt sie ihre Beute vor dem Verschlingen. Äskulapnattern kommen in Österreich in allen Bundesländern außer Vorarlberg vor. Europaweit beschränken sie sich auf Mittel- und Südeuropa. Sie lebt vorwiegend am Boden in lichten Laubwäldern mit Buschwerk und Felsen, an Flussufern und Straßenböschungen und im Gebirge bis 1000m. Während der Vogelbrut ist sie meist auf Bäumen zu finden. Auf Grund von landwirtschaftlichen Intensivierungsmaßnahmen, die eine allgemeine Verschlechterung der Lebensräume, weniger Nahrung und knapper werdende Eiablageplätze sowie Überwinterungsquartiere zur Folge haben, ist die Äskulapnatter in Deutschland bereits vom Aussterben bedroht. In Österreich sind die Bestände noch etwas besser, jedoch steht die Äskulapnatter, sowie alle heimischen Schlangen, unter strengem Schutz! Blindschleiche – Anguis fragilis Eine beinlose, ovovivipare (Lebendgeburt aus dem Ei) Echse, die eine Körperlänge bis zu 45cm. erreicht, davon sind 2/3 Schwanz. Sie gehört zur Familie der Schleichen (Anguidae) und hat typische 152 David Blum & Sabine Putz: Reptilien Echsenaugen, die durch bewegliche Lider verschließbar sind. Der Kopf ist nicht vom Körper abgesetzt und sie wiegt zwischen 7 und 45 g. An den Schwanzwirbeln gibt es Sollbruchstellen, an denen der Schwanz abgeworfen werden kann. Auf Grund ihrer beinlosen Gestalt und der schlängelnden Bewegung wird sie oft mit Schlangen verwechselt. Im Vergleich zur Schlange hat die Blindschleiche kein Oberlippenlücke zum züngeln. Die Körperoberseite ist braun bis kupferfarben glänzend, während die Körperunterseite eher dunkelgrau ist. Jungtiere besitzen einen hell goldenen oder silbernen Rücken mit einer dunklen Mittellinie, die oft auch bei erwachsenen Tieren noch erhalten ist. Der deutsche Name „Blindschleiche“ hat nichts mit dem Sehvermögen zu tun, sondern leitet sich vom althochdeutschen „Blintslicho“ ab. Das bedeutet soviel wie „blendender Schleicher“, und bezieht sich auf die schimmernde Körperfärbung. Bei der Paarung wird das Weibchen vom Männchen mit dem Maul am Hinterkopf gepackt. Das Männchen presst seine Kloake an die des Weibchens. Die Tragezeit beträgt ca. 11 - 13 Wochen und im August oder September werden, abhängig von Alter und Größe des Weibchens, 5 - 12 (ausnahmsweise auch über 20) vollständig entwickelten Jungtiere in einer weichen, unverkalkten Eihülle abgesetzt, welche sofort abgestreift wird. Ihre bevorzugte Nahrung sind Nacktschnecken, Insektenlarven und Würmer. Sie ist in ganz Europa mit Ausnahme von Irland, Skandinavien und Südspanien zu finden. In Österreich von April bis September überall mit Ausnahme der hochalpinen Bereiche. Ihr Lebensraum sind Wiesen, Moore, Heidelandschaften, Gärten, Parks. Trockene Biotope werden meist gemieden. Die Blindschleiche lebt sehr versteckt und ist dämmerungs- und nachtaktiv. Sie hält Winterschlaf in frostfreien Unterschlupfen wie Erdhöhlen, Komposthaufen und Wurzelwerk von Bäumen. Gefährdung droht ihr durch Landwirtschaft und Straßenverkehr. Ringelnatter - Natrix natrix Weibliche Ringelnattern sind größer als männliche Exemplare. Sie sind durchschnittlich 70 Zentimeter lang, selten länger als 130 Zentimeter, allerdings gibt es auch Exemplare bis zu 200 Zentimeter. Der ovale Kopf ist deutlich vom Rumpf abgesetzt und die Augen haben eine Runde Pupille. Die Rumpfbeschuppung ist deutlich gekielt. Die Färbung ist sehr variabel, von blaugrün, bläulich, braun über schwarz. Charakteristisch sind 2 halbmondförmige helle Flecken seitlich des Hinterkopfes, die meist durch schwarze Felder begrenzt wird. Sehr selten gibt es Exemplare ohne „Mondflecken“. Die Bauchseite ist hell – dunkel gewürfelt, zum Schwanz hin dunkler werdend. Bei Gefahr reagieren Ringelnattern, so wie alle Wasserschlangen, mit dem Entleeren einer übel riechenden Flüssigkeit aus den Analdrüsen. Hält die Bedrohung an, stellt sich die Ringelnatter tot. Die Paarung findet im April/Mai statt. Daraufhin werden von Juli bis Mitte August 10-40 Eier pro Weibchen in Laub-, Kompost-, Misthaufen oder ähnlichem abgelegt. Die Jungtiere schlüpfen nach 4 -10 Wochen. Teilweise kommt es zu regelrechten Massengelegen. Die tagaktive Ringelnatter gehört zu den Wasser-, oder Schwimmnattern und ist (im Gegensatz zur Würfelnatter, die an Flüssen und Seen lebt) eher an langsam fließenden Bächen sowie Stillgewässern anzutreffen. Jungtiere sind stärker ans Wasser gebunden als adulte Exemplare. 153 David Blum & Sabine Putz: Reptilien Ihre Nahrung sind hauptsächlich Amphibien. Jungtiere fressen größten Teils Kaulquappen und frisch metamorphisierte Lurchen. Adulte Tiere bevorzugen hingegen eher ausgewachsene Schwanzund Froschlurche, Fische und gelegentlich kleine Säugetiere. Die Nahrung wird stets lebend verschlungen, ohne vorher „erdrosselt“ zu werden. Ratten und Ameisen können die Gelege zerstören. Frisch geschlüpfte Nattern werden von Laufkäfern, Seefröschen und Fischen erbeutet. Die etwas größeren Tiere werden von Igeln, Mardern, Reihern, Tauchern, Störchen, Bussarden, Weihen, Schlangenadlern, Rabenvögeln, Würgern und Amseln gefressen. Es wurden sogar schon wiederholt Haussperlinge beim Töten jung geschlüpfter Ringelnattern beobachtet. Sie kommen in ganz Europa mit Ausnahme von Irland und einigen Mittelmeerinseln vor und ist in manchen Gebieten Europas stark gefährdet. Würfelnatter – Natrix tessellata Die Würfelnatter ist eine schlanke Schlange, die in Mitteleuropa selten über 90 Zentimeter lang wird. In Süd- und Osteuropa wird sie bis zu 150 Zentimeter lang. Der Kopf ist lang und schmal und nur sehr wenig vom Hals abgesetzt. Augen- und Nasenöffnungen sind leicht nach oben gerichtet (Anpassung ans Wasser). Die Pupillen sind rund. Die Schuppen sind stark gekielt, die Färbung bräunlich bis gräulich mit vier bis fünfreihiger, gegeneinander versetzter dunkler Würfelzeichnung, der sie ihren Namen verdankt. Gelegentlich fehlt das Muster oder ist leicht abgeändert. Am Nacken befindet sich manchmal ein umgekehrt V-förmiger Fleck. Die Unterseite ist weiß- schwarz gewürfelt. Die Jungtiere sind manchmal noch etwas kontrastreicher als die Adulten. Die Paarung findet von April bis Juni statt. 5 bis 25 Eier werden in lockeres Erdreich, Laub- oder Misthaufen abgelegt. Manchmal kommt es zu Massengelegen. Sie ernährt sich hauptsächlich von Fischen. Zu geringen Teilen stehen auch Amphibien und deren Larven auf dem Speiseplan. Sie ist daher auf fischreiche Uferstrecken in stehenden oder fließenden Gewässern angewiesen, wo sie oft Stundenlang still unter Wasser ausharren kann, um ihrer Beute aufzulauern. Zu ihren Feinden zählen Marder, Wasser- und Greifvögel. Für kleinere Nattern kommen Grünfrösche und Raubfische in Betracht. Sie kommen vom Südlichen Mittel- und Süd-Osteuropa, bis Zentralasien vor. In Österreich ist sie nur in Isolierten Gebieten zu finden. Zauneidechse – Lacerta fragilis Zauneidechsen haben eine gedrungene Gestalt von etwa 20 Zentimeter, mit kurzen Beinen und einem breiten, stumpfschnäuzigen Kopf. Ihre Iris ist rot bis goldfarbig. Ihre Körperfärbung geht von grau bis braun, wobei männliche Zauneidechsen während der Paarungszeit (April/Mai) seitlich eine smaragdgrüne Färbung aufweisen. Sie ernähren sich von Insekten, Spinnen, Asseln, Schnecken kleinen Eidechsen und Eidechseneiern. Zu ihren Feinden zählen Igel, Schlingnattern, Greifvögeln, Krähen, Amseln, Hauskatzen und natürlich der Mensch, der ihren Lebensraum zerstört. 154 David Blum & Sabine Putz: Reptilien In ihrem sonnigen, trockenen bis leicht feuchten Lebensraum sind sie auf zahlreiche Versteckmöglichkeiten angewiesen. Zauneidechsen sind in Mittel- und Osteuropa, von Südskandinavien bis zum nördlichen Griechenland zu finden. Didaktik Lehrziele • • • • Den Kindern die Angst vor Schlangen nehmen Den Schülern die Lebensweise und Lebensraum der Reptilien näher bringen. Äußere Merkmale der Tiere praktisch erarbeiten Gefährdung der Reptilien verdeutlichen Ablauf: Als Einstieg stellten wir den Kindern 2 theoretische Fragen die die Kinder auf das Thema hinführen sollten. „ Welche Reptilien kennt ihr?“ „Was unterscheidet ein Reptil von anderen Tieren?“ Dann wurden eigentlich von den Kindern sofort einige Arten genannt, wobei wir auf falsche Aussagen sofort eingingen. Bei der zweiten Frage gingen wir sofort auf die Äußeren Merkmale der Reptilien ein, die sie dann beim nächsten Teil, der Vorführung der Tiere, auch sofort überprüfen konnten. Zunächst teilten wir die Kinder in zwei Gruppen auf, wobei die eine Gruppe sich die Blindschleiche und die andere Gruppe sich die Ringelnatter näher anschauen sollte. (Augen, Hautschuppen, Länge, Kopf- und Halsform). Wichtig war dass die Kinder die Tiere mit allen Sinnen begreifen. Sie sollten fühlen, riechen, sehen, hören, aber nicht schmecken Dann wurde gewechselt, damit alle Kinder beide Reptilien gesehen hatten. Als nächstes kam der direkte Vergleich der Tiere, wo wir sie nebeneinander den Kindern präsentierten und somit die Unterschiede (Schlange-Echse) nochmals deutlich sichtbar wurden. Dann präsentierten wir den Kindern die Würfelnatter, wo wir wieder auf die Äußeren Merkmale näher eingingen. Ebenfalls haben wir die Nahrung der Würfelnatter besprochen und so konnten die Kinder bereits ihren Lebensraum erahnen. Als nächste Aufgabe sollten die Schüler ein Terrarium artgerecht für die Würfelnatter einrichten. Dabei ließen wir den Kindern soviel Zeit wie sie benötigten. Als letztes Highlight holten wir noch die 1,30m lange Äskulapnatter. Hier waren die mutigsten Kinder gefragt, den Lebensraum dieser Schlange auszutesten. Sie hatten die Möglichkeit zwischen einem mit Wasser gefüllten Terrarium zum Schwimmen, bzw. einem Baum zum Klettern zu wählen. Zum Abschluss haben wir noch über die Gefährdung der Reptilien in Österreich mit ihnen gesprochen und versucht von ihnen zu erfahren warum diese Tiergruppe so gefährdet ist. 155 David Blum & Sabine Putz: Reptilien Ausnahme des Wassers, das wir bereitgestellt hatten) für das Terrarium selbst suchen. Ein spezielles Problem war die Würfelnatter die sehr schnell und gut in Bäumen klettern konnte, und somit den Kindern ein falsches Bild vermittelte, das wir jedoch sofort klärten. Im Großen und Ganzen hat es uns beiden sehr viel Spaß gemacht mit den Schülern dieses Thema zu erarbeiten. Die Schlangensuche war sehr spannend, aber leider auch sehr mühsam. Schlussendlich hatten wir dann doch genügend Tiere um unser Programm durchzuführen. Im Nachhinein betrachtet erscheint es uns als sehr wichtig sich genügend Fachwissen angeeignet zu haben und spontan auf Anregungen, Fragen und auftretende Probleme einzugehen. Reflexion Unser Programm hat sich im Laufe dieser zwei Tage durchaus verändert. Wir hatten keine Vorstellung davon wie viel die Kinder wussten, und es war anfangs eine große Herausforderung, auf die vielen Fragen immer deutlich genug einzugehen. Zum Beispiel gingen wir dazu über, dass wir den Kindern nicht nur den Lebensraum der Äskulapnatter, sondern auch der Ringel-, und Würfelnatter austesten ließen. Die Schwerpunkte waren von Gruppe zu Gruppe verschieden, je nachdem wie interessiert die Kinder waren. In einer Gruppe war die Angst vor den Reptilien anfangs so groß, sodass sie beim ersten Anblick einer 10cm langen Ringelnatter davonliefen, sodass wir hauptsächlich versuchten ihnen diese Angst zu nehmen. In jedem Fall war es uns wichtig dass die Schüler selbst als Forscher tätig sind. Sie konnten sich die Tiere mit Hilfe von Lupen näher ansehen, mit Maßbänder abmessen und die Materialien (mit Literatur Bücher: Martina Bertl: Natur im Herzen Mitteleuropas, 2002 Ulrich Gruber: Amphibien und Reptilien,2002 Hannelore Vogel, Josef Blab: Amphibien und Reptilien erkennen und schützen, 2002 Neil A. Campbell: Biologie, 2006 Cabela Antonia, Grillitsch Heinz, Tiedemann Franz: Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien und Reptilien in Österreich, 2001 Günter Diesener, Josef Reichholf: Lurche und Kriechtiere, 1985 Websites http://www.herpetofauna.at/reptilien/anguis_fragilis.php 156 Reptilien von Miriam Schiebel & Maria-Magdalena Reidinger Fachliches Reptilien Reptilien sind eine Klasse der Wirbeltiere, zu der die Ordnungen Schlangen, Echsen, Schildkröten, Krokodile und Schnabelechsen zählen. Ein wichtiges Kennzeichen der Reptilien ist die Haut, der von Schuppen bedeckt ist. Schlangen und Echsen stoßen diese immer wieder ab. Während die Schlagen ihre Haut im Ganzen häuten, stoßen die Echsen ihre in Fetzen ab. Die Schuppen schützen die Tiere vor dem Austrocknen, und sind ein wichtiges Merkmal der Anpassung an das Landleben. Kriechtiere sind wechselwarm, das bedeutet, dass sie sich ihre Körpertemperatur an die Umgebungstemperatur angleicht. Deshalb müssen sie sich, am Morgen und vor allem nach der Winterstarre, in der Sonne oder auf warmen Untergrund aufwärmen. Die meisten Reptilien sind eierlegend (Oviparie). Die Eier sind dotterreich, dies ermöglicht die vollständige Entwicklung und macht eine Larvenform unnötig. Die Eierschalen sind im Gegensatz zu Vogeleiern ziemlich weich. Das Herz der meisten Reptilien besteht aus drei Herzkammern, zwei Vorhöfen und einer Hauptkammer (Ventrikel). Die Herzkammern sind meist nur unvollständig getrennt, so dass sauerstoffreiches und -armes Blut zusammenfließt. Durch den unterschiedlichen Herzrhythmus vermischt sich das Blut kaum. Reptilien sind Lungenatmer, bei Schlangen und einigen Echsen ist nur ein Lungenflügel funktionstüchtig; bei anderen Reptilien sind dagegen beide Lungenflügel gleichermaßen entwickelt. Brust – und Bauchhöhle sind nicht durch ein Zwerchfell getrennt, das Ein – und Ausatmen erfolgt im Großen und Ganzen durch die Brustmuskeln. Nieren und Gonaden (Keimdrüsen) haben erstmals bei Wirbeltieren getrennte Ausführgänge. Eine Harnblase gibt es nur bei Schildkröten und Echsen. Die meisten Reptilienarten besitzen spezielle Kopulationsorgane, die der inneren Befruchtung dienen. Unterschied zwischen Schlangen und Echsen: Schlangen haben keine Extremitäten. Sie haben einen starren Blick, da ihre Augen nicht geschlossen werden können. Am Bauch besitzen sie eine Reihe von Hornschilden. Die heimischen Schlangen teilt man in 2 Gruppen. Die Nattern haben im Gegensatz zu den Vipern an Kopfoberseite 9 symmetrisch angeordnete Hornschuppen. Sie besitzen runde Pupillen. Beispiele: Ringelnatter, Würfelnatter, Äskulapnatter, Schlingnatter Die Vipern haben an der Kopfseite viele kleine Schilde. Ihre Pupillen sind senkrecht. Beispiele: Kreuzotter, Sandviper Im Gebiet der Marchauen kann man mit viel Glück folgende Arten finden: Sumpfschildkröte; Äskulapnatter; Würfelnatter; Ringelnatter; Zauneidechse; Blindschleiche; Glattnatter. Wir fanden leider nur die Äskulapnatter; Würfelnatter und Blindschleiche. Trotz allem haben wir auch die anderen Tiere im theoretischen Teil angeführt. Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) Die europäische Sumpfschildkröte hat eine Panzerlänge je nach Unterart von unter 12 bis mehr als 20 cm. Der Panzer ist flach und oval. Die Männchen sind meist kleiner als die Weibchen. Die Sumpfschildkröte kann ein Gewicht von 400 bis 700 Gramm erreichen. Sie besitzt 5 Zehen an den Vorderbeinen und 4 Zehen an 167 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien den Hinterbeinen. Alle Zehen sind mit Krallen versehen. Zwischen den Zehen spannen sich Schwimmhäute. Mit diesen Schwimmhäuten können sie sehr gut schwimmen und tauchen. Sie lebt in Gewässern mit gutem Wasserpflanzenbestand und schlammigen Grund. Der Schwanz der Sumpfschildkröte ist ziemlich lang. Ihre Pupillen sind rund. Sie ist tags und nachts anzutreffen, wobei sie sehr scheu ist. Weiters hat sie einen sehr guten Geruchs- und Sehsinn. Die Sumpfschildkröte überwintert am Gewässergrund in einer Winterstarre. Sie frisst Krebstiere, Schnecken, Kaulquappen, tote Fische und Aas, Insektenlarven und vieles mehr, sowie auch pflanzliche Nahrung und kann nur unter Wasser schlucken. Die Geschlechtsreife erlangen sie zwischen 8-10 Jahren. Es werden 9-15 Eier in selbst gegrabene Nestgruben abgelegt. Die Jungtiere schlüpfen im Spätsommer nach ca. 80 bis 120 Tagen. Das Alter der Sumpfschildkröte kann man mit den Wachstumslinien auf dem Panzerschild gezählt werden. Nach der Geschlechtsreife verschwinden diese immer mehr. Daher ist eine Altersbestimmung nur bis 9-12 Jahren möglich. Einige Exemplare wurden bis zu 60 Jahre alt. Die Feinde der Sumpfschildkröte sind z.B. der Reiher, Störche, Seeadler, Fischotter ect. Die europäische Sumpfschildkröte ist fast in ganz Europa anzutreffen. In Österreich ist das einzige reliktartige Vorkommen entlang der Donauauen unterhalb der Wiener Pforte bis zur österreichischen Staatsgrenze. Die Gesamtindividuenzahl beträgt zwischen 400 und 1000 Exemplare. Sie gilt als vom Aussterben bedrohte Art. langgestreckt und schlank. Der Kopf ist schmal und wenig abgesetzt. Ihre Pupillen sind rund. Die Äskulapnatter hat eine gelblich Braune über Olivgrün und Graubraun bis grauschwarze Färbung. Viele der Schuppen sind weiß umrandet. Die Jungtiere haben am Nacken hellgelbe Flecken. Dies ähnelt sehr der Ringelnatter. Der Unterschied liegt jedoch bei der Bauchfärbung. Die Jungtiere der Äskulapnatter haben im Gegensatz zur Ringelnatter eine helle Bauchfärbung. Die Äskulapnatter besitzt 23 Reihen an glatten Rücken- und Seitenschuppen. Die Bauchsuppen sind leicht gekielt. Mit diesen Kielen ist es ihr möglich auf Bäume klettern. Diese Schlange kommt in Österreich im zentralen und östlichen Teil des Landes, nördlich und südlich der Alpen vor. Sie ist in allen Bundesländern außer Vorarlberg verbreitet. Die Äskulapnatter lebt in lichten, sonnigen Laubwäldern, alten Steinbrüchen, Weinbergen, Ruinen ect. Sie kann ein Alter von bis zu 30 Jahren erreichen. In den Wintermonaten verkriecht sich die Natter und hält eine 5 bis 6 monatige Winterruhe. Sie frisst Mäuse, Amphibien (meist Frösche), Eidechsen, Vögel und deren Nestlinge und Eier. Die Paarungszeit ist im Mai. Die Eiablage findet im Juni statt. Es werden meist 5-8 Eier gelegt, die in hohlen Bäumen, Mistoder Laubhaufen abgesetzt werden. Die Jungtiere schlüpfen im September. Diese Natter ist tagaktiv. Ihre Feinde sind Rabenvögel, Mäusebussard, Iltis, Dachs, Baum- und Steinmarder. Bei akuter Bedrohung wehrt sie sich durch einen Abwehrbiss und entleert ein Sekret aus ihrer Analdrüse. Nach unseren Erfahrungen ist diese Äskulapnatter eine ziemlich aggressive Art. Äskulapnatter (Elaphe longissima) Die Äskulapnatter kann eine Gesamtlänge von bis zu 2,2 m erreichen. Sie ist somit die größte Schlangenart in Österreich. Die Männchen sind meist größer als die Weibchen. Ihr Körper ist sehr 158 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien 159 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien Würfelnatter (Natrix tessellata) Die Gesamtlänge der Würfelnatter kann bis zu 1,5 m betragen. Die Weibchen werden meist größer als die Männchen. Der Körper ist mäßig schlank. Der Kopf ist gut abgesetzt. Bei adulten Tieren ist der Kopf nahezu dreieckig. Die Pupillen sind rund. Die Färbung der Oberseite variiert zwischen verschiedenen Grau-, Braun- und Olivtönen und kann sehr hell bis sehr dunkel werden. Die Würfelnatter kommt in Österreich an größeren Flusslandschaften, in klimatisch begünstigten Gebieten des Süd- und Ostösterreichs vor. Sie lebt stets in unmittelbarer Nähe von (Flüssen, Seen und Altarmen) naturnahen Gewässern mit hohen Fischreichtum und Stillwasserzonen, was durch ihren ausgezeichneten Schwimm- und Tauchfähigkeiten zu erklären ist. Auch diese Natter ist tagaktiv. Die Würfelnatter überwintert an Land. Ihr Quartier sucht sie gegen Ende September auf und verlässt es erst wieder Mitte bis Ende April. Die Paarung beginnt im Mai. Es werden regelrechte Paarungsknäuel gebildet. Das Gelege umfasst bis zu 30 Eier. Die Würfelnatter kann bis 15 bis 20 Jahre alte werden. Die Nahrung umfasst überwiegend Fische. Kleine Fische werden im Wasser verzehrt, größere werden an Land gebracht und dort gefressen. Die Feinde der Würfelnatter sind Reiher, Ratten, Hermilien ect. Auch diese Natter verspritzt zur Abwehr einen Analdrüseninhalt. Die Würfelnatter zählt zu den meist gefährdeten Reptilien in Österreich. Ringelnatter (Natrix Natrix) Die Gesamtlänge der Ringelnatter beträgt bis zu 2 m. Die Weibchen sind meist dicker als die Männchen. Der Körper ist schlank bis robust mit deutlich abgesetztem Kopf. Der Schwanz ist spitz ausgezogen. Die Pupillen sind rund. Die Grundfarbe variiert von schiefergrau bis grün- und olivbraun. Das charakteristische Erkennungsmerkmal der Ringelnatter sind die beidseitigen hellgelben Flecken in der Nackenregion. Die Ringelnatter ist fast in ganz Europa verbreitet. In Österreich kommt sie vor allem in den großen Augebieten an der Donau, Mur, March, Salzach und Drau vor. Sie ist auch im Bereich des Neusiedlersees und in den Teichlandschaften des Waldviertels anzutreffen. Die Ringelnatter ist die am weit verbreitetste Schlangenart in Österreich. Die Ringelnatter lebt in Gewässernähe an Fluss- und Seeufern im Bereich von Feuchtwiesen, Mooren und Sümpfen. Sie schwimmt und taucht ausgezeichnet. Sie ist tagaktiv. Den Winter verbringen die Ringelnattern in einer Winterstarre in Komposthaufen, frostfreier Erde oder Laubhaufen. Sie verlässt ihr Versteck im März. Die Paarung Beginnt im April oder Mai. Dabei versammeln sie sich häufig zu großen Paarungsgruppen. Die Eiablage erfolgt im Juli bis August. Sie legen 10 bis 40 Eier. Die Ringelnatter wird bis zu 20 Jahre alt. Sie ernährt sich von Amphibien, Fischen ect. Die Jungtiere fressen Kaulquappen und Regenwürmer. Feinde der Ringelnatter 160 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien sind Greifvögel, Katzen, Igel ect. Zur Abwehr verspritzt sie einen übel riechenden Analdrüseninhalt. Zauneidechse (Lacerta agilis) Die Zauneidechse gehört zur Familie der Lacertidae (Echte Eidechsen), Gattung Lacerta (Halsbandeidechsen) und ist vor allem in Europa und Westasien weit verbreitet, vor allem im Flach – und Hügelland an sonnigen Stellen. Ihr Körper hat eine Gesamtlänge von 20 – 32 cm, ihr Körperbau ist eher gedrungen und wirkt im Gegensatz zu anderen Eidechsenarten ziemlich plump. Der Schwanz ist ca. eineinhalb so lang wie Kopf und Rumpf, solange er noch nicht abgeworfen und neu gebildet wurde, ihre Gliedmaßen sind ziemlich kurz. Im Frühjahr trägt das Männchen die charakteristischen grünen, braun gepunkteten Flanken, und einen gelb – grünen Bauch, dies dient vor allem als Prunkkleid. Die Weibchen sind meist schlichter bräunlich gefärbt. Den Rücken kennzeichnen vor allem schmale Schuppen. Außerdem verläuft an Rücken – und Schwanzmitte ein mittelbraunes, mit dunkelbraunen Flecken gemustertes, Band, welches an beiden Seiten von einem hellerbraunen Streifen begrenzt ist. Auf der Bauchseite trägt die Eidechse trapezförmige Schilder. Das Halsband setzt sich aus sieben bis zwölf Schildern zusammen. Je nach Witterung verlassen diese Eidechsen ca. im März ihr Winterquartier, meist Erdlöcher oder frostfreie Spalten, in dem sie ihre Winterstarre abhalten. Die Ernährung umfasst vielerlei Insekten, wie Heuschrecken, Wanzen, Spinnen, Ameisen, sowie auch Regenwürmer. Zu ihren Feinden gehören unter anderem verschiedene Vögel, Mader, Füchse und einige Schlangenarten. Alle Echte Eidechsen, so auch die Zauneidechse, können bei Gefahr ihren Schwanz abwerfen und so den Feind ablenken. Ab dem sechsten Wirbel hat jeder Schwanzwirbel eine eigene Bruchstelle im Wirbelkörper, Schwächestellen im Bindegewebe und der Muskulatur. Wird der Ringmuskel kräftig zusammengezogen, kann so die entsprechende Schwanzspitze abgeworfen werden. Durch das autonome Nervensystem in diesem Teil, ist es möglich, dass es sich noch weiter bewegt. Meist verwirrt dies die Angreifer und die Tiere können fliehen. Die Balz beginnt einige Wochen nachdem das Winterquartier verlassen wurde. Findet ein Männchen ein Paarungsbereites Weibchen, wird dieses vom Männchen am seitlichen Hinterbeinansatz gepackt. Meist trägt das Weibchen erhebliche Bissspuren mit sich. Das Männchen krümmt seinen Körper, sodass die beiden Kloakenspalten aneinander liegen. Danach wird der Penis (sog. Hemipenis) in diese eingeführt. Meist werden im Mai oder Juni die vier bis zwölf Eier gelegt. Hierzu gräbt das Weibchen eine Erdhöhle. Nach ca. 10 bis 12 Wochen schlüpfen die ersten Jungtiere (5 – 6 cm) und sind sich sofort selbst überlassen. Blindschleiche (Anguis fragilis) Die Blindschleiche gehört zur Familie der Anguidae, der Schleichen. Ihr Artname fragilis bedeutet soviel wie „zerbrechlich“. Dies kommt wahrscheinlich daher, da diese Schleiche extrem schnell ihren Schwanz abwirft, wenn sie sich schon ein wenig bedroht fühlt. Meist findet man sie in unterholzreichen Wäldern oder halbschattigen Wiesen, oder Parkanlagen, da sie eher schattige Orte bevorzugt, ohne jedoch die Sonne ganz zu meiden. Die Jungtiere sind ca. 7 bis 10 cm lang. Ihre Oberseite ist hellgrau, ihr Bauch schwarz. Vom Kopf weg, zieht eine dünne, schwarze Linie den Rücken entlang. Mit zunehmendem Alter dunkelt die 161 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien Rückenseite nach und die Bauchseite wird heller. Sie können 35 – 40 cm lang werden. Der Kopf und auch Schwanz gehen direkt in den Rumpf über. Der Schwanz ist meist Körperlang. Die Schuppen sind rund bis sechseckig und am Kopf befinden sich, wie bei den meisten Eidechsen deutlich größere Schuppen. Ihre Ernährung setzt sich ebenfalls aus verschiedenen Insekten, vor allem aber aus Schnecken, zusammen und zu ihren Feinden gehören zahlreiche Vögel, sowie Fuchs, Dachs, Wildschweine etc. Zum Unterschied zu anderen Eidechsen, legt die Blindschleiche jedoch keine Eier, sondern gebärt nach ca. 14 Wochen Junge, die noch von einer dünnen Eihülle umgeben sind, welche sie durchstoßen müssen (Ovoviviparie). Sie sind bei der Geburt 7 – 10 cm lang. Glattnatter (Coronella austriaca) Die Glattnatter gehört zur Gattung Coronella (Schlingnatter). Sie ist die am weit verbreitestw Schlangenart in Österreich. Schlingnattern haben ihren Namen, weil sie ihre Beute durch schnelles Umschlingen wehrlos machen. Sie sind meist Bodenbewohner, bevorzugt an Waldrändern oder seichten Gebüschen. Sie sind aber meist gut versteckt, daher kennt sie der Großteil der Bevölkerung kaum Die Glattnatter wird ca. 75 cm lang. Die Männchen haben eine braune Oberseite, die Weibchen sind graubraun bis grau und haben auf dem Rücken dunkelbraune Flecken. Außerdem besitzen sie einen charakteristischen braunen Streifen vom Nasenloch, über die Augen zum Mundwinkel. Didaktik Lehrziel Unser wichtigstes Lehrziel war, dass die SchülerInnen die Scheu zu diesen Tieren verlieren. Weiteres sollten sie einige Kenntnisse über Reptilien allgemein, über die einzelnen Arten in unserer Region und über Artenschutz bekommen. Planung Wir sollten eine Methode finden, bei der die SchülerInnen selbst forschen und selbst ihre Erfahrungen mit den Tieren sammeln können. Anfangs war es schwierig, die passende Idee zu finden. Wir lasen uns die Arbeiten aus den Vorjahren durch und überlegten uns, unsere Station. Am Beginn der Station wollten wir zunächst eine allgemeine Einführung zum Thema Reptilien geben und zu diesem Zweck bereiteten wir ein Spiel vor, ähnlich der Fernsehserie „1, 2 oder 3“. Danach wollten wir mit den Kindern im Kreis sitzen, ihnen die einzelnen Arten, je nachdem welche wir fänden, erklären, sie näher beobachten und wer will, auch anfassen lassen. Hierbei sollte es darum gehen, typische Merkmale zu erkennen und die Scheu vor den Reptilien zu verlieren. Wir sollten jedoch unser Konzept noch einmal überdenken, da die SchülerInnen zu wenig selbst forschen und das sollte eines der Hauptziele sein. Außerdem meinte Erich, dass sich die Kinder sofort auf die Tiere stürzen werden und uns kaum mehr folgen würden. Man sollte die Sensation als erstes bringen. Mit diesen Tipps von Erich, setzten wir uns noch einmal zusammen und überlegten erneut. Die Einführung am Beginn wollten wir so belassen. Ein Einblick über die Reptilien stellte für uns den besten Beginn dar. Wir dachten uns, dass wir bei der ersten 162 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien Klasse die wichtigsten Fakten über die Reptilien erzählen. Bei der 7. Klasse wollten wir eine Art Brainstorming durchführen. Uns interessierte, was sich die Schüler für ein Vorwissen haben. Nun galt es den wichtigsten Punkt in unserem Konzept zu planen. Die Jugendlichen sollten die Gelegenheit bekommen, die Reptilien anzufassen und gleichzeitig etwas über sie zu erfahren. Planen konnten wir das aber nicht richtig. Wir entschlossen sich beide, den theoretischen Teil zu lernen und das andere auf uns zukommen zu lassen. Als nächstes sollten die Schüler ein Terrarium einrichten. Die Informationen dafür bekamen sie vorher von uns im theoretischen Teil. Da uns auch wichtig war, dass die Schüler nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, bereiteten wir für die 1. Klasse ein Handout vor. Die 7. Klasse sollte einen Lückentext bekommen, den sie mit ihrem Lehrer in der nächsten Biologiestunde durchgehen sollten. Ans Ende stellten wir das „1, 2 oder 3“ Spiel. Zu diesem Zweck gestalteten wir Plakate, auch wenn das eigentlich nicht erwünscht war. Jedoch gehören die Bilder zum Konzept des Spieles. Wir bereiteten vier Fragen vor, jeweils mit drei Antwortmöglichkeiten. Zu jeder Antwort gestalteten wir ein Plakat aus Karton. Zur Belohnung bzw. bei richtiger Antwort gibt es ein Zuckerl. Wir nahmen uns vor, die Themen für die Beantwortung der Fragen irgendwann im Gespräch zu erwähnen. Somit hätten wir eine Kontrolle, ob uns auch wirklich zu gehört wurde. Fragen 1. Die Schuppen dienen.... -> ... zum Schutz vor Feinden -> ... zum Atmen -> ... zum Fühlen 163 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien 2. Reptilien sind wechselwarm, das bedeutet.... -> ... dass sie ihre Körperwärme selbst halten können -> ... dass sie sich in der Sonne aufwärmen müssen, weil sie selbst ihre Körpertemperatur nicht halten können -> ... dass sie keine Wärme brauchen, sie mögen es lieber kühler 3. Welches ist die größte in Österreich vorkommende Schlangenart? ->... Äskulapnatter ->... Schlingnatter ->... Würfelnatter 4. Welches ist die meist gefährdetste Schlangenart in Österreich? ->...Würfelnatter ->...Schlingnatter ->...Ringelnatter Marchegg An den ersten beiden Tagen in Marchegg sollten wir unsere Station vorbereiten. Hierzu sollten wir einen geeigneten Standort und Material, in unserem Fall Reptilien, finden. Zunächst schauten wir uns im Gelände um und hofften, auf einige Tiere zu stoßen. Jedoch ohne Erfolg. Natürlich fehlte uns auch die Erfahrung, da wir beide noch nie mit diesen Tieren zu tun hatten. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten und mit Hilfe von erfahrenen Kollegen fanden wir dann einige Exemplare: 3 adulte Äskulapnattern, 1 Jungtier; 2 junge Würfelnattern; 2 adulte Blindschleichen. Für unsere Station wählten wir einen Standort nahe am Wasser, um auch auf den Lebensraum einiger Arten aufmerksam zu machen. Für die Terrariengestaltung wurde ebenfalls ein Standort am Wasser benötigt. Bevor die Unterrichtstage begannen, wurde ein Zeitplan und ein „Stationenrad“ für jede Klasse ausgemacht. Wir hatten insgesamt 6 Stationen. Die 7 Klasse teilten wir in 4 Gruppen zu je 45 Leuten. Für jede Gruppe hatten wir ca. 20 min Zeit. Dann musste die jeweilige Gruppe zur nächsten Station gebracht werden. Die 1. Klasse teilten wir in 5 Gruppen zu je 4 Leuten. Auch für sie hatten wir ca. 20 min Unterrichtszeit eingeplant. Sie wurden danach zur nächsten Station gebracht. Am ersten Tag des Unterrichtens kam die 7 .Klasse zu uns. Am zweiten Unterrichtstag bekamen wir eine 1. Klasse. Die erste Gruppe der 7. Klasse war eine kleine Katastrophe. Wir versuchten zuerst unseren theoretischen Teil durch zu machen, stellten zwar immer kurze Zwischenfragen, aber es war einfach zu theoretisch und nicht spontan. Danach holten wir die Tiere aus den Terrarien und zeigten sie den SchülerInnen. Wir erklärten ihnen die wichtigsten Punkte zum jeweiligen Tier. Wir taten uns noch extrem schwer Fragen aufzugreifen und dort gleich weiter anzuknüpfen. Es dauerte auch zu lang, bis die Jugendlichen die Tiere mal in die Hand bekamen. Auch bei der zweiten Gruppe, schafften wir es noch nicht ganz, uns zurück zu nehmen und die SchülerInnen werken zu lassen. Ich denke auch deswegen, weil wir beide noch viel zu viel Respekt vor den Tieren hatten (Stichwort: Handschuh) und deshalb davor zurück schreckten sie gleich den Jugendlichen in die Hand zu geben. Von Gruppe zu Gruppe wurden wir, unserer Meinung nach, besser. Wir versuchten unseren strikten Plan zu durchbrechen und passten unseren Einstiegsvortrag über Reptilien gleich an unsere Tiere an und versuchten immer sofort auf die Arten einzugehen. Im Großen 164 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien und Ganzen hielten wir uns aber immer noch zu fest an unserem strikten Plan und ließen uns nicht wirklich davon abbringen. Es fehlte uns bei den ersten Gruppen schlicht und weg die Erfahrung. Unsere anfänglichen Bedenken, dass das „1, 2 oder 3“ Spiel für die 7 Klasse zu kindisch wäre, stellte sich als falsch heraus. Sie machten brav überall mit, ohne es ins Lächerliche zu ziehen. Leider konnten wir es nicht mit allen Gruppen spielen, da bei einigen die Zeit zu kurz war. Wir hatten ja für die 7. Klasse jeweils einen Lückentext vorbereitet. Bei den ersten beiden Gruppen teilten wir die Lückentexte noch aus. Bei den beiden letzten Gruppen haben wir im Eifer des Gefechts vergessen, ihn auszugeben. Wie sich herausstellte, waren die Lückentexte sinnlos. In der Pause sahen wir, dass die Bögen am Boden herumkullerte und die Schüler ihn nicht wirklich ernst nahmen. Daher beschlossen wir für den nächsten Tag, die Handouts ganz weg zu lassen. Der zweite Tag war vollkommen anders. Natürlich brachte die 1. Klasse ein komplett anderes Temperament mit und es war uns auch gar nicht möglich, unseren vorgefertigten Plan umzusetzen. Sie kamen gleich angestürmt und stürzten sich auf die Tiere. Sie wollten sie meistens gleich anfassen. Wir gingen weg von unserem Einstieg und begannen gleich mal mit den einzelnen Arten. Wie auch schon am Tag zuvor versuchten wir anhand der Blindschleiche und der Würfelnatter den Unterschied zwischen Echsen und Schlangen herauszuarbeiten, dann auf die verschiedenen Merkmale der einzelnen Arten aufmerksam zu machen. Die Kinder, natürlich nur wer wollte, durften die Tiere sofort in die Hand nehmen. Am Zweiten Tag war es auch leichter, auf Fragen einzugehen und diese aufzugreifen. Uns kam es vor, dass wir an diesem Vormittag viel routinierter mit den Tieren umgegangen sind und uns daher mehr mit den Kindern befassen und ihnen mehr zu hören konnten. Der Umgang mit den Schlangen und Echsen waren von uns aus nicht mehr im Mittelpunkt. Trotz manch fachlichen Fehlern, war es ganz gelungen. Dies hörten wir dann auch beim Feedback danach. Auch das „1, 2 oder 3“ Spiel war ein Erfolg bei den Kindern. Wir versuchten es zeitlich so hin zu bekommen, dass alle Gruppen noch spielen konnten. Es machte außerdem den Anschein, als würde ihnen das Terrariumeinrichten sehr viel Spaß machen. Natürlich war das Schlagen anfassen nicht zu toppen. Reflexion Abschließend kann man sagen, dass wir unserer Meinung nach, eine positive Entwicklung durchgemacht haben. Bei den ersten Gruppen waren wir sehr unsicher. Wir glaubten, alles genau nach Plan durchführen zu müssen. Mit der 7 Klasse erfuhren wir schnell, dass man nicht alles planen kann. Wichtig ist, dass man gutes Fachwissen über die einzelnen Tiere besitzt. Beim Unterrichten selbst, muss man aber sehr flexible sein und spontan reagieren können. Wichtig ist auch, dass man auf jede Frage der Schüler eingeht, zumindest aufgreift, auch wenn man sie nicht 100% beantworten kann. Wir haben auch gelernt, den SchülerInnen Zeit zum Beantworten von Fragen zu geben. Man neigt als Student immer dazu, selbst die Frage zu beantworten oder dem SchülerInnen einfach zu wenig Zeit zum Nachdenken zu geben. Das ist aber ganz wichtig. Die 1 Klasse war für uns viel leichter zu Unterrichten. Nicht weil sie jünger waren, sondern weil mir mehr Erfahrung mit solchen Tieren hatten. Die Erfahrung spielt in diesem Beruf eine entscheidende Rolle. Mit Erfahrung wird man sicherer. Man traut sich, aus sich selbst heraus zu gehen, einmal vom fixen Konzept abzuweichen ect. Dies traf 165 Miriam Schiebel & Leni Reidinger: Reptilien unserer Meinung nach voll zu. Fachlich haben wir auch sehr viel gelernt. Durch das ständige Wiederholen haben sich die Reptilien fest in unserem Kopf verankert. Trotzdem wissen wir, dass wir auf diesem Gebiet noch immer nicht perfekt sind. Daher ist Weiterbildung ein sehr wichtigstes Thema. Wir haben selbst erlebt, dass man nicht genug wissen kann um alle Fragen der Schüler zu beantworten. Bei dieser Lehrveranstaltung haben wir auch gelernt, im Team zu arbeiten. Mit seinem Partner und mit der gesamten Gruppe. Das ist auch ein wichtiges Thema, dass uns in unserem späteren Beruf einmal begegnen wird. Literatur Grzimek, B. (1973): Grzimeks Tierleben, Kriechtiere. Zürich, 288 pp, 308 pp, 346 pp, 390pp, 394pp, 398pp, 401pp 409pp. Schullerer, P. (1990): Biologie und Umweltkunde, 5. Schulstufe. Linz, 90pp. Jilka, S. (2009): BioTop 1. Wien, 78pp. http://de.wikipedia.org/wiki/reptilien - Zugriff am 9.4.2009. http://www.herpetofauna.at/reptilien/lacerta_agilis.php - Zugriff am 9.4.2009. http://www.herpetofauna.at/reptilien/anguis_fragilis.php - Zugriff am 10.4.2009. http://www.herpetofauna.at/reptilien/coronella_austriaca.php Zugriff am 10.4.2009. http://www.herpetofauna.at/reptilien/zamenis_longissimus.php Zugriff am 10.4.2009. http://www.herpetofauna.at/reptilien/natrix_natrix.php - Zugriff am 10.4.2009. http://www.herpetofauna.at/reptilien/ Natrix_tessellata.php - Zugriff am 10.4.2009. http://de.encarta.msn.com/encyclopedi a_761579044/Reptilien.html - Zugriff am 9.4.2009. http://de.encarta.msn.com/encyclopedi a_721538527/Zauneidechse.html http://de.encarta.msn.com/encyclopedi a_761552939/Blindschleiche.html Zugriff am 10.4.2009. http://de.encarta.msn.com/encyclopedi a_721538506/W%C3%BCrfelnatter.ht ml - Zugriff am 10.4.2009. http://de.encarta.msn.com/encyclopedi a_761557112/Ringelnatter.html#p1 Zugriff am 10.4.2009. http://de.encarta.msn.com/encyclopedi a_761569046/%C3%84skulapnatter.ht ml - Zugriff am 10.4.2009. http://de.encarta.msn.com/encnet/refpa ges/RefArticle.aspx?refid=721537956 - Zugriff am 10.4.2009. Erich beim morgendlichen Wecken (Photo: Philipp) 166 Feedback der Studierenden Was ist eure persönliche „Teko-Message“? (übers.: Take-Home-Message) 167 5