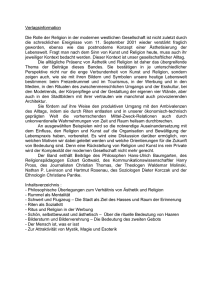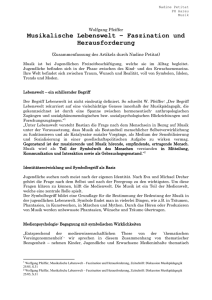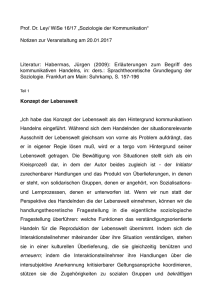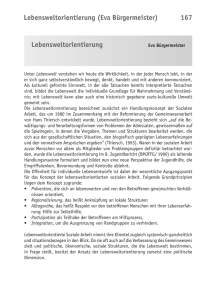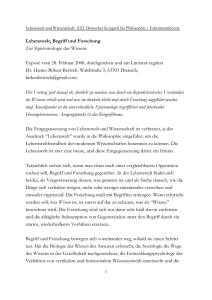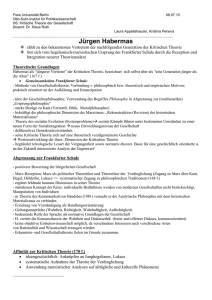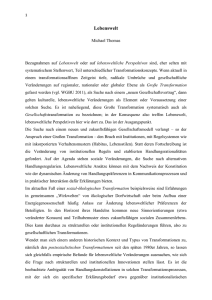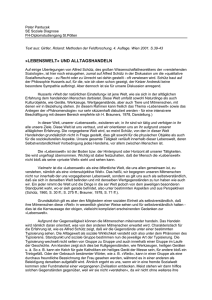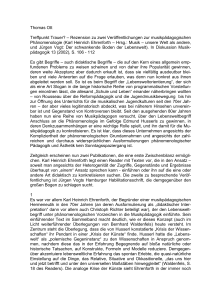Franz Hamburger Wie ethnozentrisch ist die Sozialpädagogik
Werbung

Franz Hamburger Wie ethnozentrisch ist die Sozialpädagogik? Lüneburg, 6.6.2015 Die Fragestellung mag überraschen angesichts der Beobachtung, dass insbesondere in der Pädagogik und in der Sozialpädagogik in den zurückliegenden 30 bis 40 Jahren Anstrengungen unternommen worden sind, helfend und unterstützend auf die besonderen Notstände im Zusammenhang mit Einwanderung einzugehen. Diese Anstrengungen wurden zunächst in der Praxis der außerschulischen Unterstützung und schulischer Verbesserungsversuche unternommen. Die wissenschaftliche Klärung der mit Migration zusammenhängenden pädagogischen Fragen war dann Nacharbeit, teilweise affirmativ, teilweise kritisch zur entwickelten Praxis. Dabei konkurrierten konzeptionelle Vorstellungen um die beste und die am besten begründete Programmatik für den Umgang mit Migrationsfolgen. Die kritische Auseinandersetzung mit den Mustern, die in die Konzepte Eingang gefunden haben, wurde punktuell geführt, hat aber vor allem die beruflichen Praktiken kaum erreicht. Insofern ist die Frage, welche problematischen Muster in die sozialpädagogischen Schriften eingegangen sind, immer noch und immer wieder aktuell. Als „ethnozentrisch“ werden in diesem Zusammenhang nicht nur diejenigen Muster der Wahrnehmung bezeichnet, die sich explizit auf Nation oder Volk, also verallgemeinerte Kollektive beziehen, sondern auch Bewertungen, die die Normativität der je eigenen Lebenswelt als unbefragt gültigen Bewertungsrahmen zu Grunde legen. Ich betrachte meinen Beitrag als einen Mosaikstein in der laufenden und weiterhin notwendigen Diskussion. Ich gehe aus von drei Beobachtungen, mache eine methodische Bemerkung, die eine Anleihe bei der Lebensweltorientierten Sozialpädagogik darstellt und gehe dann auf vier empirische Beispiele zur Prüfung meiner Fragestellung ein. Am Ende versuche ich, eine abschließende These zu formulieren. Drei Beobachtungen Beim letzten Bundeskongress Soziale Arbeit in Hamburg habe ich beim Blick über die Köpfe der Anwesenden bei den Plenumsveranstaltungen die Kopftücher vermisst. Natürlich ist diese Wahrnehmung zunächst meiner eigenen Erwartung geschuldet, eine selbstverständliche Präsenz von Musliminnen, die sich als solche zu erkennen geben, vorzufinden. Und das Fehlen von Kopftüchern, soweit diese Beobachtung überhaupt zutreffend ist, sagt nichts darüber aus, wie viele Musliminnen bzw. Menschen mit Migrationshintergrund anwesend gewesen sind. Begründet und erklärbar wird diese Erwartung nicht nur mit meinen beruflichen Arbeitsschwerpunkten, sondern auch mit meinen Alltagserfahrungen, in denen in den Feldern der Sozialen Arbeit zunehmend Musliminnen aktiv tätig sind, ebenso im Studium der Sozialpädagogik. Besonders aber sind Musliminnen mit oder ohne Kopftuch Teil der Klientel der Sozialpädagogik in allen Praxisfeldern. Bei den Berufstätigen sind sie zweifellos nicht entsprechend repräsentiert, möglicherweise ist aber auch das öffentliche Milieu der Sozialpädagogik eines, in dem spätfeministische Frauenbilder es erschweren, sich in anerkannter Weise bewegen zu können. Dies könnte die Beobachtung erklären, falls sie richtig ist, und sie wäre nur mit einem erheblichen Schuss Spekulation richtig. Eine zweite Beobachtung bezieht sich auf die gegenwärtige Aufnahme von Flüchtlingen. Insbesondere in der Wahrnehmung von unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen beherrscht die Annahme von Traumata die kollektive öffentliche Anamnese. Auch diejenigen, die keinen jungen Flüchtling kennen oder mit ihm arbeiten, können sich auf Grund des öffentlichen Meinungsbildes sicher sein, dass traumatische Belastungen die Lebenssituation der Flüchtlinge kennzeichnen. Die Bilder, die die Medien transportieren, fokussieren nur auf dramatische Situationen, deren Bewältigung dem Beobachter als schier unmöglich erscheint, zumindest ohne besonderen Schaden zu nehmen. Die Formulierungen „viele sind traumatisiert“ oder „oft ist mit Flucht ein Trauma verbunden“ setzen die mediale Anamnese in eine scheinbar plausible Diagnose um. Für diejenigen, die in die Soziale Arbeit mit jungen Flüchtlingen einsteigen, und es sind auf Grund der Besonderheit des Arbeitsfeldes häufig Berufsanfängerinnen, bedeutet das öffentlich markierte Vorausurteil eine Belastung, wissen sie doch, dass pädagogische Konzepte nur sehr begrenzt oder gar nicht tatsächliche therapeutische Bedarfe abdecken können. Betrachtet man nun näher die herrschende Wahrnehmung, dann kann man ihre Besonderheit vor allem auf die lebensweltliche Fundierung der Wahrnehmungsmuster zurückführen. Im eigenen Erfahrungshorizont erscheinen die Bilder der Flucht als schrecklich und sie aktivieren Bewältigungsängste und starke Gefühle des hilflosen Ausgesetztseins. Weil in der Struktur der eigenen Lebenswelt die Ressourcen für die Bewältigung großer Belastungen noch nicht erlebt wurden, wird als einziges Bewältigungsmuster das des Traumas projiziert. Auch eine dritte Beobachtung beruht nicht darauf, dass den Milieus der Sozialen Arbeit schlicht Rassismus vorgeworfen wird, sondern wohl darauf, dass die Kultur der Empathie und des Gutmachenwollens die Befangenheit in den Mustern der eigenen Lebenswelt verdeckt. So wird generell – von der Polizei bis zur Gefängnisseelsorge, vom Kindergarten bis zur Schule – der Bedarf an Pädagogen und Pädagoginnen „mit Migrationshintergrund“ artikuliert. Der Zweck dieses speziellen Personals wird durchgehend auf die Funktion eines guten Umgangs mit „Klientel mit Migrationshintergrund“ reduziert. Auch wenn die Sorge um gute Dienstleistungen für bestimmte Personengruppen dabei im Vordergrund stehen kann, ist die Delegation der Integrationsaufgabe an die Repräsentanten der zu Integrierenden faktisch eine Segregation. Die Repräsentanten der einheimischen Pädagogik entledigen sich der Aufgabe der notwendigen Reflexion des Eigenen in der Interaktion mit als fremd definierten Personen und stürzen die Fachkräfte mit Migrationshintergrund in die paradoxe Situation, dass sie etwas repräsentieren sollen was andere sind. Denn ihre Besonderung als Fachkräfte mit Migrationshintergrund kann nur als halbierte Integration verstanden werden. Sie sind nicht der übliche Lehrer, sondern eben der besondere. Eine methodische Zwischenbemerkung Die Beobachtungen sind selbstverständlich widersprüchlich. Denn sie thematisieren sowohl eine unzureichende als auch eine übertriebene Wahrnehmung von Differenz. Was aber als übertrieben oder als unzureichend verstanden werden kann, erscheint willkürlich. Erst in einer kritischen und empirischen Auseinandersetzung können solche Behauptungen, was als unzureichend gelten soll, konkretisiert werden. Eine ähnliche Aufgabe sieht die Soziale Arbeit vor sich, wenn sie mit dem Anspruch der Lebensweltorientierung antritt. Versteht man Lebensweltorientierung als ein „pragmatisches Konzept“ (Grunwald/Thiersch 2015, S. 936), dann bezieht es sich auf das sozialpädagogische Handeln, das sich dem Anspruch unterwirft, sich explizit und reflektiert, anerkennend und zugleich kritisch auf die Adressaten der Sozialen Arbeit und ihre Lebenswelt zu beziehen. Dabei ist die lebensweltliche Eingebundenheit des pädagogisch Handelnden Voraussetzung seiner Handlungsentwürfe und deren Realisierung. Diese lebensweltliche Bindung des Handelnden selbst kann Ermöglichung eines gelingenden Bezugs zur Lebenswelt der Adressaten ebenso sein wie eines misslingenden Bezugs, weil der pädagogisch Handelnde in den Befangenheiten seiner Lebenswelt verstrickt bleibt. Diese Verstricktheit in die eigene Lebenswelt und die besondere Formierung des eigenen Lebenslaufs kann inzwischen, das heißt nach einigen biografischen Studien zu den Sozialarbeitern und Sozialpädagoginnen, als ein besonderes Hindernis gelingenderer Arbeitsbeziehungen gelten (vgl. beispielsweise Melter 2006). Versteht man aber die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ als die Theorie des pragmatischen Konzepts, dann kann man ihre analytischen Möglichkeiten nutzen und nicht nur die Verstricktheiten des performativen Handelns untersuchen, sondern auch die wissenschaftlichen Äußerungen im akademischen Sprachhandeln. Für beide Dimensionen stellt sich die Frage, wie Differenzen wahrgenommen werden und wie die Strukturen der je eigenen Lebenswelt diese Wahrnehmung beeinflussen. Diese Art der Betrachtung, die die Reproduktion von gesellschaftlichem Bewusstsein und nicht innerwissenschaftliche Gedankenströme untersucht, thematisiert also einen Diskurs. Die Texte zur Sozialen Arbeit stellen dabei eine bestimmte Diskursebene dar. Sie vermitteln thematisch und inhaltlich zwischen teils wissenschaftlichen, teils praktischen Akteuren und der nachwachsenden Generation von Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen in der Phase des Studiums und begrenzt auf den Ort der Hochschule. Eine zentrale Interpretationsleistung in der Vermittlung erbringen die Dozenten und Dozentinnen, die die Texte einsetzen, kritisieren oder bestärken in Bezug auf ihren Inhalt und ihre Intentionen. Auch die Studierenden können die Texte affirmativ oder ablehnend aufnehmen. Insoweit sind die Inhalte der Texte in der sozialpädagogischen Literatur von begrenzter Relevanz. Gleichzeitig aber sind sie Repräsentanten einer Bildungskultur, die den Gesetzen des Buchmarktes unterworfen ist. Insofern in den Texten eine für die Herausbildung von gesellschaftlichem Bewusstsein und politischer Handlungsbereitschaft relevante Ebene eines bedeutsamen Akteursnetzwerks (pädagogische Profession und nachwachsende Generation, Wissenschaft und öffentliche Meinung) untersucht werden kann, ist es für eine Diskursanalyse besonders geeignet. Vier empirische Beispiele Ein Beispiel für die starke Wirkung der eigenen Lebenswelt finden wir bei Klaus Mollenhauer(1996). So wird von ihm mit großer Selbstverständlichkeit "Interkulturalität" als eine von vier zentralen theoretischen Problemlagen bestimmt, wobei das Problem lediglich als "Verschiedenheit kultureller Herkünfte" (Mollenhauer 1996, S. 880) bestimmt wird und als sichere Grundlage für die Unterscheidung typischer sozialpädagogischer Aufgaben erscheint. Als Beleg, um die Zentralität des Themas als theoretische Aufgabe zu begründen, wird auf den Jahresbericht der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1995 hingewiesen, in dem fünf zurechenbare Projekte aufgeführt sind. Der Beleg ist für eine Satire gut - angesichts der Reichweite des programmatischen Anspruchs. Das Problem ist nun nicht die Zuschreibung von Relevanzen, sondern die Selbstverständlichkeit der Definition als "Kulturproblem", das auf der Annahme einer grundlegenden Differenz zwischen Nationalkulturen beruht. Die in den Blick genommene Person wird auf ganz bestimmte Weise wahrgenommen und definiert, nämlich schon vorab als Fall einer allgemeinen Kategorie. Der von Mollenhauer erwähnte Fall, nämlich die "Situation eines 16-jährigen türkischen Mädchens, in Berlin-Kreuzberg lebend und Besucherin einer Jugendfreizeiteinrichtung" (Mollenhauer 1996, S. 881), kann zwar auch kulturelle Dimensionen erfassen, müsste aber zugleich und vordinglich unter dem Gesichtspunkt geprüft werden, ob und inwiefern sich die Zuordnung des Problems zu "Interkulturalität" überhaupt begründen lässt. Woher kommt aber die Sicherheit für die Vorwegkonstruktion einer grundlegenden Differenz zu anderen sozialpädagogischen Situationen und sozialpädagogisch relevanten Personen? Es kann nur das Befremdungsgefühl im Rahmen der eigenen Lebenswelt sein, das diese Sicherheit vermittelt. Während auf „Augenscheinliches“ gezeigt werden kann, nämlich auf Aussehen oder Sprachhandeln usw., bleibt der Horizont der Fremdheitswahrnehmung unthematisiert. Dass ähnliche Themen in Forschungsprojekten thematisiert werden, erscheint als hinreichende Validierung im Wissenschaftssystem. Wenn schon DFG-prämiert über das Thema geforscht wird, dann muss da etwas dran sein. Das hier betrachtete Beispiel erweist sich also – unter anderem – als ein Beispiel der Befangenheit in der Lebenswelt der wissenschaftlichen Kommunikationsgemeinschaft. Das Faktum einer DFG-geförderten Forschung erweist sich als Signal für die Dignität einer Fragestellung bzw. genauer: für die eigenständige, kategorial gerechtfertigte Unterscheidung von Forschungsgegenständen. Diese Unterscheidung schreibt sich in das alltägliche Klassifizierungsschema des Wissenschaftlers ein und ordnet seine Welt, das heißt den Ausschnitt seiner beruflich bearbeiteten Welt. Ein anderes Beispiel ist eine Passage im 14. Kinder- und Jugendbericht, der mit einer anschaulichen Reflexion über den Wandel des Aufwachsens in Deutschland eröffnet wird. In diesem einleitenden Text werden die später differenziert referierten Studien zur Lage der Kindheit und Jugend zusammengefasst. Dort findet sich auch ein Abschnitt zur Migration und zum Aufwachsen mit Migrationshintergrund, aber spezielle Aspekte werden nur dieser besonderen Gruppe zugeschrieben. So auch in der Einleitung: „In Deutschland wächst eine erhebliche Zahl an Kindern und Jugendlichen auf, für die es zum Alltag gehört, dass ihre Eltern nicht hierzulande geboren sind und dass ihre Großeltern zumindest zum Teil nicht hier in Deutschland leben. Sie erleben Heterogenität in vielen alltäglichen Dingen von Kindesbeinen an. Sie entwickeln daraus Stärken und Kompetenzen, sie müssen aber oft auch mit den Widersprüchlichkeiten und Ungleichzeitigkeiten , mit den widerstreitenden Mustern der Lebensführung ganz unterschiedlicher Kulturen, Lebensstile und Wertsysteme zurechtkommen, sie erleben die Ambivalenzen kultureller Heterogenität vielfach am eigenen Leib. Die traditionell enge Verwobenheit von Lebensort, Lebensalltag und Lebensstilen ist ihnen fremd. Vermeintliche Selbstverständlichkeiten verlieren ihre Eindeutigkeit und werden eher zu einer allgegenwärtigen Differenzerfahrung.“ (S. 56) Gerade an diesem Text kann gezeigt werden, dass es nicht um richtig oder falsch einer Situationsbeschreibung geht, auch dass es nicht um mangelndes Verständnis für die Lage bestimmter Gruppen von Kindern und Jugendlichen geht. Warum aber werden bestimmte Merkmale einer Gruppe zugeschrieben oder nur einer Gruppe? Der Jugendbericht analysiert das Aufwachsen in modernen Gesellschaften so, dass die genannten Erfahrungsmerkmale für alle Kinder zutreffen, dass die kulturelle und soziale Differenziertheit der Gesellschaft als universell verbreitet angenommen werden kann. In diesen strukturellen Beschreibungen werden diese personenunabhängig, also nicht aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen beschrieben. Hier aber wird scheinbar die Perspektive der Kinder eingenommen, auch wenn man diese rein hypothetisch formulieren muss. Die Erfahrung von Fremdheit wird ihnen zugeschrieben, die sie doch in Deutschland schon aufgewachsen sind. Eine einfache Umkehr der Wahrnehmungsperspektive, subjektiv möglicherweise aus dem Bestreben verstehen zu wollen motiviert, verschiebt die Fremdheitswahrnehmung aus der Beobachterperspektive in die Beobachtetenperspektive. Heterogenität, Widersprüchlichkeiten, Ungleichzeitigkeiten, widerstreitende Muster – alle diese Strukturmerkmale der einheimischen Gesellschaft werden als verdichteter Erfahrungshorizont einer ausgewählten und wohldefinierten Gruppe zugeschrieben. Vor allem die behauptete „enge Verwobenheit von Lebensort, Lebensalltag und Lebensstilen“ ist bemerkenswert. Üblicherweise wird mit dieser Trias von Elementen der Lebenswelt „Heimat“ beschrieben und vielleicht handelt es sich hier um eine Projektion von Harmonievorstellungen oder –wünschen auf eine Gruppe, die als Migrantengruppe „offensichtlich“, nämlich ganz von außen betrachtet, diese Harmonie nicht erleben kann. Insbesondere zu dieser Vorstellung von der Harmonie lebensweltlicher Strukturen gibt es nicht nur eine lange Kritik sozialwissenschaftlicher Studien. Gerade im Hinblick auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, deren Vorfahren eingewandert sind, zeigen empirische Untersuchungen, wie sie sich ihre lokale Lebenswelt aneignen, wenn ihre Zugehörigkeit zu diesem Lebensort nicht bestritten wird. Eine zentrale Bedingung für die Möglichkeit der beschriebenen Besonderheiten wird ausgeblendet, nämlich die Vorenthaltung von Selbstverständlichkeit. „Hierzulande“ ist der Ort, von dem aus die Erkenntnis über Migrantenkinder formuliert wird, und wer hierher kommt, muss wohl Fremdheitserfahrungen machen. Auch dass Selbstverständlichkeiten keine sind, sondern ihre Eindeutigkeit verlieren, ist eine Beobachtung, die unschwer den zutreffenden allgemeinen Gesellschaftsanalysen des Kinderund Jugendberichts zugeordnet werden kann. Sie wird hier aber gedreht und auf eine Personengruppe fokussiert. Das Analysieren in Gegensätzen, das sich häufig im Jugendbericht findet, wird in diesem Abschnitt auf eine zentralisierende Problemperspektive verengt. Auch in einer neueren, an sich verdienstvollen Dissertation in der Tradition der Mädchenhausbewegung findet sich die Dominanz eigenkultureller Wertsetzungen bei der Wahrnehmung des Fremden. Der „Rollenzerfall migrierter Personen“ (Kirchhart 2008, S. 220) rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung und bildet eine Interpretationsfolie für heterogene Beobachtungen. Zwar werden ähnliche Problemlagen, die zur Inobhutnahme führen, bei allen betroffenen Mädchen festgestellt und laufen die empirisch feststellbaren Differenzierungen entlang anderer Kriterien, doch wird für die Mädchen mit Migrationshintergrund ein akzentuiertes Bild gezeichnet: „Autoritär-restriktives Erziehungsverhalten der Eltern greift in einem traditionellen und partikular organisierten engmaschigen sozialen Netz, das der modern und universalistisch strukturierten Lebenswelt deutscher Städte widerspricht.“ (Kirchhart 2008, S. 60) Die als Gegenwelt zur Welt der Migranten konstruierte Eigenwelt der Moderne müsste ja spätestens dann problematisiert werden, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen für die Notwendigkeit von Inobhutnahme gerade von Mädchen analysiert werden. So aber kann autoritäres und patriarchalisches Erziehungsverhalten der Welt der Anderen zugerechnet werden. Ein letztes Beispiel kommt zwar nicht direkt aus der Sozialpädagogik, aber die Soziologie des Klaus Hurrelmanns wurde vielfach rezipiert. In seinem jüngsten Buch hat der zusammen mit dem Journalisten Erik Albrecht eine reißerische Abhandlung über die Jugend von heute geschrieben mit dem Titel: „Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y unsere Welt verändert“ (2014). Oberflächliche Verallgemeinerungen, Charakterisierungen wie in der Bildzeitung, aufgeblasene Trivialitäten und Lobpreisungen der schönen neuen Welt kennzeichnen dieses Elaborat. In dieser Form ist Jugendsoziologie verkommen zu einer Apologetik der Phänomene. Natürlich kommen auch die „Berufskritiker“ zu Wort, wobei an erster Stelle die Pädagogen genannt werden. Und typischerweise kommt der Wandel durch Einwanderung nur an einer einzigen Stelle (später, nämlich S. 61, ist von speziellen Programmen für Jugendliche mit Migrationshintergrund die Rede, die aufgesucht werden müssen, weil sie zu Bildungsangeboten nicht kommen) auf den 250 Seiten zu Wort: „Die besonders schwachen Schüler stammen ganz überwiegend aus Familien, in denen Vater und Mutter selbst nur wenig gebildet sind. Viele von ihnen sind nach Deutschland eingewandert. Sie sind meist schon längere Zeit arbeitslos, verhältnismäßig arm und oft auf staatliche Unterstützung angewiesen. Im Laufe der Jahre geraten sie in eine verfestigte randständige Lage und sehen keine Chance mehr, sich durch eigene Anstrengungen daraus zu befreien.“ (S. 51) Diese Gruppen verursachen dann „riesige Summen von Wohlfahrtsaufwendungen und darüber hinaus große Produktionsausfälle“ (S. 225). Das „Heer von Enttäuschten und Ausgestoßenen“ (S. 226) bildet eine „soziale Unterklasse von unmotivierten Jugendlichen“, das nicht mehr auf „ die eigene Wettbewerbsfähigkeit“ (S. 225) setzt. Auch hier wird das Glück der modernen Seligkeit getrübt durch die Invasion der Rückständigkeit, die eigene Welt des supertechnologischen Fortschritts und der revolutionären Anpassung der Jugend an diesen Fortschritt der schönen Medienwelt wird belastet durch die Einwanderung der Dummheit. Abschließende These Natürlich rechtfertigen die willkürliche Auswahl der Beispiele und die unsystematischen Beobachtungen nur eine spekulative These. Auch ist darauf hinzuweisen, dass der Gedankengang in Bezug auf die allgemeine Diskussion und den öffentlichen Diskurs im pädagogischen Feld schon mehrfach thematisiert wurde. (vgl. die beiden Bände von Direm/Mecheril 2009 und Direm u.a. 2010; neuerdings: Buchenhorst 2015). Aber der Transformationsprozess der Gesellschaft durch Einwanderung und die Veränderung der pädagogischen Praxis schreiten voran und lassen die in den verschiedenen Phasen der Bewusstwerdung in den letzten vier Jahrzehnten entwickelten Deutungsmuster schnell veralten. Die in den Lebenswelten erworbenen Deutungsschemata veralten schneller als sie kulturell reflektiert und verändert werden können. Das wirft für die Pädagogik und die Erziehungswissenschaft Dauerprobleme und –aufgaben auf. Während die These vom cultural lag ursprünglich bezogen war auf das Verhältnis von sich schnell wandelnder Technologie und kultureller Aneignung dieses Wandels, kann sie heute auch auf das Verhältnis von Gesellschaft und Lebenswelt bezogen werden. Die Dynamik eines digitalisierten globalen Kapitalismus und seine mediale Materialität durchdringen traditionelle Grenzen und Begrenzungen, soziale Definitionsräume und kulturelle Interpretationsrahmen und machen permanente Re-Interpretationen notwendig. Der lebhafte Handel regressiver Deutungsangebote verdeutlicht drastisch die Unmöglichkeit einfacher Anpassungs- und Nachvollzugsstrategien. Dabei können die Interaktionsräume der beruflichen Praxis als Aushandlungsarenen rekonstruiert werden, in denen scheinbar keine Ordnungen mehr zum Zuge kommen. Tatsächlich setzen sich lebensweltliche Traditionen des eigenen biografischen Zusammenhangs ebenso durch wie technologische Scheinlösungen. Von der technischen Ausstattung des Kinderzimmers angefangen mit seinen digitalisierten Animations- und Überwachungsspielgeräten bis hin zum Wohnraum für die ganz Alten, die elektronisch rund um die Uhr kontrolliert werden, dominieren die, man kann das nur ironisch zitieren, „versachlichten“ Muster der Sozialität. Umstandslos setzt sich in dieser Welt der uneingeschränkten Kontrolle das Selbstdeutungsmuster einer modernen, technisch und elektronisch perfekten Welt durch, mit dem die Lebenswelt der modernen Menschen strukturiert wird. Die Entfremdungsgefühle der kolonialisierten Lebenswelt können dann unreflektiert auf das personalisierte Fremde projiziert werden. Frauen mit Kopftuch werden so zum Inbegriff des Rückständigen und Gefährlichen. Für die Fälle der Beratung und der Erziehung wird mehr denn je die Reflexion auf die eigenen lebensweltlichen Erfahrungen bedeutsam, die in einem verwissenschaftlichen Nachdenken über das gute Leben Stützung benötigt. Denn wenn dieser Horizont unbefragt Geltung hat, dann wird das Eigensinnige des Fremden zusammen mit seiner Vorstellung vom guten Leben einer kolonialistischen Moderne unterworfen oder externalisiert. Mehr denn je gehören diese Fragen in die Ausbildung der Sozialen Berufe. Denn die wenigen empirischen Studien zum tatsächlichen pädagogischen Handeln in sozialpädagogischen Einrichtungen stellen „kulturalistische Argumentationsweisen“ (Nortman 2010) oder rassistische Vernachlässigungen der Subjektperspektive (Melter 2006) fest. Dabei zeigt sich, dass auch der Interkulturalismus als generalisierte Handlungsstrategie die eigenen Befangenheiten ausblendet und sich anheischig macht, den anderen besser zu verstehen als er es selbst vermag. Diese Überheblichkeit aber ist eine spezifische Tradition der Sozialen Berufe, die schon immer mit Differenz umgehen müssen. Sie können sie weder wegdefinieren noch pathologisieren noch kulturalisieren. Diese Einsicht in der Tradition von „Etwas fehlt“ (Brumlik/Keckeisen 1976) ist immer wieder zu erneuern. Die Lebensweltorientierung , die ja gerade weder affirmative noch abweisende professionelle Handlungen begründen will (neuerdings pointiert formuliert von Otto/Ziegler 2015), kann dabei hilfreich sein. Wie eine in diesem Sinne analytisch differenzierte Reflexion von Erfahrungen geht, hat Astrid Woog in ihrer Dissertation (1998) gezeigt. Allgemeines (die Prinzipien guter Sozialer Arbeit) und Besonderes (die spezifische soziokulturelle „Einbettung“ einer Familie) bleiben in einer Balance, die weder zu Gunsten einer Kulturalisierung noch im Sinne eines „farbenblinden Liberalismus“ aufgelöst wird. Literatur Brumlik,M./Keckeisen,W. (1976): Etwas fehlt. Zur Kritik und Bestimmung von Hilfsbedürftigkeit für die Sozialpädagogik. In: Kriminologisches Journal 8, S. 241 – 262. Buchenhorst, R.(Hrsg.) (2015): Von Fremdheit lernen. Zum produktiven Umgang mit Erfahrungen des Fremden im Kontext der Globalisierung, Bielefeld. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2013): 14. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. (Bundestagsdrucksache 17/12200) Direm,I./Mecheril,P.(Hrsg.) (2009): Migration und Bildung. Soziologische und erziehungswissenschaftliche Schlaglichter. Münster u.a. Dirim,I./Gomolla,M./Hornberg,S./Mecheril,P./Stojanov,K.(Hrsg.) (2010): Spannungsverhältnisse. Assimilationsdiskurse und interkulturell-pädagogische Forschung, Münster u.a. Grundwald, K./Thiersch, H.(2015): Lebensweltorientierung. In: Otto, H.-U. /Thiersch, H. (Hrsg.)(2015): Handbuch Soziale Arbeit. 5. Erweiterte Auflage, München/Basel, S. 934-943. Hurrelmann, K./Albrecht, E.(2014): Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y unsere Welt verändert. Weinheim und Basel. Kirchhart, St.(2008): Inobhutnahme in Theorie und Praxis. Grundlagen der stationären Krisenintervention in der Jugendhilfe und empirische Untersuchung in einer Inobhutnahmeeinrichtung für Mädchen, Bad Heilbrunn Melter,C.(2006): Rassismuserfahrungen in der Jugendhilfe. Eine empirische Studie zu Kommunikationspraxen in der Sozialen Arbeit. Münster u.a. Mollenhauer, K. (1996): Kinder- und Jugendhilfe. Theorie der Sozialpädagogik - ein thematisch-kritischer Grundriß. In: Zeitschrift für Pädagogik, 42. Jg., S. 870 - 886. Norman, A.(2010): „Migrationshintergrund ist halt auch irgendwie Thema“. Eltern mit Migrationshintergrund im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Freiburg im Breisgau. Ogburn, W.F.: Die Theorie der kulturellen Phasenverschiebung (lag). In: Ders./Duncan, D.O. (Hrsg.): Kultur und sozialer Wandel. Ausgewählte Schriften („On culture and social change“). (Soziologische Texte; Bd. 56), Neuwied am Rhein 1969, S. 134–145. Otto, H.-U./Ziegler, H.(2015): Soziale Arbeit als emanzipatorische Sozialwissenschaft. Ein radikalisiertes Programm der Lebensweltorientierung. In: Zeitschrift für Sozialpädagogik, 13, S. 193 – 205. Woog, A. (1998): Sozialpädagogische Familienhilfe. Weinheim.