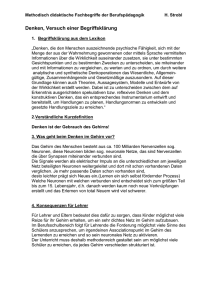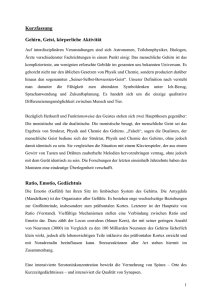Der denkende und handelnde Mensch
Werbung

Der denkende und handelnde Mensch 1 VORBEMERKUNG ....................................................................................................................................... 3 2 ENTWICKLUNGSGESCHICHTLICHER EXKURS ................................................................................... 3 3 DAS NERVENSYSTEM................................................................................................................................. 8 3.1 A LLGEMEINE S TRUKTUR DES N ERVENSYSTEMS .............................................................................................. 8 3.2 D IE N ERVENZELLE ...................................................................................................................................... 10 4 DAS GEHIRN .............................................................................................................................................. 12 4.1 V ORBEMERKUNG ........................................................................................................................................ 12 4.2 S TRUKTUR .................................................................................................................................................. 13 4.2.1 Myelencephalon (Medulla oblongata) ................................................................................................. 14 4.2.2 Metencephalon (Hinterhirn) ............................................................................................................... 14 4.2.3 Mesencephalon (Mittelhirn)................................................................................................................ 15 4.2.4 Diencephalon (Zwischenhirn) ............................................................................................................. 15 4.2.5 Telencephalon (Endhirn) .................................................................................................................... 15 4.2.6 Isocortex ............................................................................................................................................ 15 4.2.6.1 Limbisches System ................................................................................................................................... 18 4.2.6.2 Hemisphären............................................................................................................................................. 18 4.3 D AS G EHIRN UND SPEZIFISCHE P ROZESSE .................................................................................................... 20 5 5.1 4.3.1 Bewußtsein und Kognition .................................................................................................................. 20 4.3.2 Wahrnehmung .................................................................................................................................... 24 4.3.3 Mentale Modelle ................................................................................................................................ 26 4.3.4 Bedeutung und Erwartung .................................................................................................................. 27 4.3.5 Neuroplastizität.................................................................................................................................. 28 4.3.6 Lernen, Wissen und Gedächtnis .......................................................................................................... 30 4.3.7 Sprache .............................................................................................................................................. 31 4.3.8 Taktgeber ........................................................................................................................................... 32 4.3.9 Informationsverarbeitung ................................................................................................................... 33 DAS GEDÄCHTNIS..................................................................................................................................... 35 GEDÄCHTNISMODELLE......................................................................................................................... 36 5.1.1 Mehrspeichermodell ........................................................................................................................... 37 5.1.2 Ebenen der Verarbeitungstiefe............................................................................................................ 38 1 5.2 G EDÄCHTNISARTEFAKTE ............................................................................................................................. 39 5.2.1 Sensorische Speicher: Iconic memory, Echoic memory ....................................................................... 39 5.2.2 Arbeitsgedächtnis............................................................................................................................... 40 5.2.3 Langzeitspeicher ................................................................................................................................ 42 5.3 LEISTUNGSDATEN ....................................................................................................................................... 44 5.3.1 Sensorische Speicher .......................................................................................................................... 45 5.3.2 Kurzzeitgedächtnis ............................................................................................................................. 46 5.3.3 Enkodierung....................................................................................................................................... 47 5.3.4 Assoziative Verknüpfung..................................................................................................................... 47 5.3.5 Stroop Effekt ...................................................................................................................................... 47 5.3.6 Explizites Gedächtnis bzw. Erinnern................................................................................................... 48 5.3.7 Flashbulb memory.............................................................................................................................. 48 5.3.8 Eidetisches Gedächtnis....................................................................................................................... 48 5.3.9 Alltagserfahrungen............................................................................................................................. 48 5.3.10 Interferenz...................................................................................................................................... 48 5.3.11 Emotion und Motivation ................................................................................................................. 49 5.3.12 Training ......................................................................................................................................... 49 5.3.13 Erinnern und Vergessen ................................................................................................................. 49 6 HANDLUNGSSTEUERUNG ....................................................................................................................... 50 7 DER BENUTZER......................................................................................................................................... 56 8 MUSKELARBEIT........................................................................................................................................ 58 9 ZUSAMMENFASSUNG............................................................................................................................... 59 2 1 Vorbemerkung Strukturen und Prozesse des Menschen als denkender und handelnder Akteur sind konstituierende Bedingungen für eine wissenschaftliche Betrachtung der Interaktion von Mensch und Arbeitsmittel. Zwei Sichtweisen oder auch Zugänge sollen hier praktiziert werden: auf der einen Seite gilt es die Biologie des Menschen zu betrachten, die ihn zum denkenden Akteur macht. Die andere Sichtweise geht von der Annahme aus, daß jede unserer Handlungen initiiert und gesteuert wird von zentralnervösen Prozessen. Die zugrundeliegenden Mechanismen der Initiierung und Steuerung von Handlungen bedürfen somit ebenfalls einer Klärung. Beide Sichtweisen führen zu einem Menschenbild, welches die Grundlage arbeitswissenschaftlicher Gestaltungsbemühungen bildet. Ein solches Menschenbild ist auch immer ein Konstrukt seiner historischen Entwicklung und des aktuellen Zeitgeistes, so daß ein Verständnis ohne eine geschichtliche Einordnung unvollständig bleiben würde. 2 Entwicklungsgeschichtlicher Exkurs Die Entwicklungsgeschichte des Menschen umfaßt rückschauend ca. 4 Millionen Jahre. Für uns Menschen ein nicht überschaubarer Zeitraum. Ein kleiner Abschnitt in der 50 Millionen Jahre andauernden Evolution der Säugetiere und der 500 Millionen Jahre währenden Erdgeschichte. Noch nicht 200 Jahre alt sind die Überlegungen von Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck zum Transformismus oder wie wir heute sagen zur Evolution. Er formulierte die Hypothese, daß Organismen als Reaktion auf ihre Umwelt die Genetik der Nachkommen beeinflussen. Beeindruckt von der Erfindung und Fortschrittskraft der Dampfmaschine wurde für ihn die Vererbung grundlegender Fähigkeiten zum Fortschrittsmotor in der Natur. Der Mensch war hiernach das Ende einer langen Entwicklungslinie. Die bis dahin deduktiv begründete Kette des Seins die besagt, daß niemals das "Vollkommenere" aus dem "Unvollkommeneren" hervorgehen kann, wurde umgekehrt. Die zugrundeliegende Erkenntnistheorie stellte aber den Geist als besondere Entität des Menschen nicht in Frage (Bateson, 1983). Vor nicht einmal 150 Jahren publizierte Darwin sein Werk "The Origin of Species". Der Mensch wurde zum Abkömmling des Tierreichs deklariert - wenn auch ein sehr hoch entwickelter - und der Geist als besonderes Erklärungsprinzip verneint. Die technologische Revolution der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fand mit Darwins Theorie eine erkenntnistheoretische Entsprechung. Darwin und seine Ideen sind noch heute in der wissenschaftlichen Diskussion präsent. Eine Fülle von Publikationen über Darwin, den Neodarwinismus, Universaldarwinismus bzw. Neurondarwinismus belegen dies (Wilson, 2000; Dennett, 1997). Aus heutiger Sicht liegen Evidenzen vor, daß keine sogenannten evolutionären Schwellen existieren, deren Überwindung zwangsweise zu höherentwickelten Lebensformen führen und der homo sapiens nicht als eine herausragende Spezifität betrachtet werden muß, die ihn von anderen Lebensformen prinzipiell abgrenzt. Darwins Theorie der natürlichen Selektion bzw. des Überlebens des Tüchtigsten wird von Heschl (1998) im Prinzip übernommen, es werden aber berechtigte Zweifel formuliert, ob trotz des unfaßbaren Ausmaßes an Struktur und Ordnung in der belebten Natur eine gerichtete Evolution vorstellbar ist. Plausibler erscheint, daß keine nach Prinzipien verlaufende Evolution des Fortschritts existiert, sondern der Zufall das vorherrschende Prinzip in unserer Entwicklungsgeschichte ist. Die Umwelt übt zwar einen kontinuierlichen selektiven Einfluß auf lebende Systeme aus, dieser kann aber nicht als gerichtet bzw. instruktiv angenommen werden. Zufälle verursachen die Brüche in der Evolution, die es unmöglich machen, von der Vergangenheit auf Zukünftiges zu schließen. Eine gerichtete Evolution, wie Lamarck sie postulierte, ist nur schwer vorstellbar. Lamarck formulierte einen Kurzschluß, der notgedrungen zu ei- 3 nem immer besser angepaßten Lebewesen führen müßte, welches letztendlich unsterblich wäre (Herschl, 1998). Selbst Darwin ist auf den Galapagos zu der Erkenntnis gelangt, daß der Zufall und nicht ein fester Plan das Gestaltungsprinzip der Evolution sein könnte. Der Begriff des Zufalls schließt dabei nicht aus, daß auch dieser Gesetzmäßigkeiten unterliegt, die sich in den typischen biologischen Phänomen ebenso widerspiegeln wie dies bei klassischen physikalischen Erscheinungen der Fall ist (Eigen, 1992). Die genetische Ausstattung eines Organismus bestimmt seine ontogenetische Entwicklung. Die Fülle der in den Genen verankerten Informationen bekommen ihren Sinn und ihre Bedeutung aber erst, wenn sie in einem entsprechenden Organismus integriert sind. Die Proteine und andere wichtigen Moleküle wie Kohlenhydrate, Fette, etc. bestimmen im Zusammenhang mit den Genen, was im allgemeinen als Leben umschrieben wird. Aber nur die Gene unterliegen der genetischen Mutation, von der die Veränderlichkeit der Struktur der Proteine abhängig ist. Analog der biologischen Evolution unterliegen die Entwicklungsprozesse des Menschen der genetischen Mutation und der natürlichen Selektion. Mutation als evolutionstheoretischer Begriff meint, das Erbgut zu verändern (Zufallsveränderungen der zugrundeliegenden biochemischen Strukturen) um dann die Veränderung zu Überprüfen (Selektion). Die natürliche Selektion ist von zentraler Bedeutung für die Evolution. Sie setzt voraus, was sie selbst nicht erklären kann, die Variabilität der Lebensformen. Genetische Mutation schafft etwas Neues. Wenn ein lebender Organismus durch Mutation verändert wird, so hat dieser Organismus keinen Zugang mehr zu dieser Veränderung. Im Gegensatz zu den Artefakten dieser Welt besitzen Lebewesen eine erkennbare und damit auch durch Mutation zerstörbare Identität. Ungerichtete genetische Zufallsveränderungen als der zentrale Mechanismus der Evolution könnte letztendlich auch für das Wirken der natürlichen Selektion (die Gesamtheit der physikalischen und ökologischen Umweltbedingungen) herangezogen werden. Eigen (1992) hat das Selektionsprinzip als ein klares "Wenn-dann"-Prinzip formuliert, welches ein aus definierten Voraussetzungen ableitbares Verhalten impliziert. Die Voraussetzungen für natürliche Selektion sind hiernach: • Selbstreproduktivität der zur Selektion gelangenen Einheiten wie DNS-Moleküle, Viren, Bakterien). Sie dürfen nicht gänzlich neu entstehen, sondern sie bilden sich als Replikatoren über einen Kopiervorgang vorhandener Einheiten. • Mutagenität insofern, als sich Replikatoren nicht ausschließlich durch exakte Selbstreproduktionen bilden, sondern auch durch Fehlkopierungen nahe verwandter Replikatoren. • Metabolismus für die ständige Zufuhr von Energie, da die Selbstreproduktion weitab vom chemischen Gleichgewicht verläuft. Selektion resultiert somit aus der unterschiedlichen Effizienz der Reproduktion, wenn Evolution auf der Grundlage natürlicher Selektion stattfindet, dann ist sie auch wertorientiert, die den Zufall einschränkt und nachvollziehbaren Prinzipien folgt. Aber nicht die Biologie macht den Menschen zu einer speziellen Spezies, sondern das Bewußtsein als IchGefühl, als Sicherheit hinsichtlich der eigenen Person und Identität und der willentlichen Kontrolle über die eigenen Handlungen. Bewußtsein hat sich nach Daniel Povinelli evolutionär aus dem Körperbewußtsein entwickelt und ist in den biologischen Basisprozessen des ganzen Körper verankert. Die spezifische Beziehung zwischen Bewußtsein und Körper kann an vielen Sachverhalten des täglichen Lebens festgemacht werden. So zum Beispiel die Bedeutung der Körpersprache in Kommunikationsprozessen (Molcho, 1983). Samy Molcho kommt zu der Auffassung, daß der Anteil der nonverbalen Kommunikation bei wichtigen Entscheidungsprozessen als Ergebnis vom Kommunikationsbeziehungen mindestens mit einem Gewicht von 0.8 veranschlagt werden müßte. Es gibt keine Erfahrungen außerhalb des eigenen Körpers. Nach Molcho kann das Leib-Seele Problem als einfache Antwort auf die folgende Frage gelöst werden: Habe ich einen Körper oder bin ich ein Körper? Seine Antwort lautet: "Solange ich lebe und mit anderen kommuniziere bin ich mein Körper." Dies ist eine etwas andere Art und Weise, um sich für den Monismus und gegen den Dualismus auszusprechen. Die Psychogerontologen verweisen auf den Zusam- 4 menhang von mentalen Trainingsversuchen und Bewegungstherapien. Beide Methoden isoliert angewandt bewirken keinen nachweisbaren Therapieerfolg. In Kombination jedoch sind deutliche Erfolge nachweisbar (Oswald, u.a., 1998). Die Arbeiten von Feldenkrais (1996) dokumentieren einen weiteren Zugang zum Verständnis des Zusammenhanges von Bewußtsein und Bewegung. „Wir haben das Bedürfnis, uns zu entfalten und zu entwickeln. ..Menschen müssen sich ständig weiterentwickeln. Doch Entwicklung ist ein sehr körperliches Ereignis, selbst wenn es durch Reden ausgelöst wird. Reden ist sehr körperlich. Gefühle sind sehr körperlich. Gedanken sind sehr körperlich.“ (Anat Baniel, eine Feldenkrais-Therapeutin, zitiert in Wilson, 2000, S. 270). Wilson (2000) beschreibt am Beispiel des Jonglierens in praxisnaher Weise, daß Intelligenz nicht nur als geistiges Phänomen begriffen werden darf und die Geist-Körper-Dichotomie eine unangemessene Gegenüberstellung zusammengehörender Entitäten postuliert. Er versucht über die Beschreibung vielfältiger Lebenssituationen und – erfahrungen seine zentrale Hypothese zu belegen, daß die Hand eine ebenso wichtige Rolle im menschlichen Leben spielt wie das Gehirn. „die Evolution der Hand und ihrer Kontrollmechanismen sind entscheidende Faktoren für die Organisation unserer kognitiven Architektur und geistigen Funktionen.“ (Wilson, 2000, S. 306). Mit der Entdeckung von sogenannten Spiegelneuronen wurde ein weiteres Indiz für den Zusammenhang von Bewegung und Bewußtsein ausgemacht. Vittorio Gallese vom Istituto di Fisiologia Umana an der Universität Parma hat in der prämotorischen Großhirnrinde von Makaken eine solche Klasse von Nervenzellen entdeckt. Diese Nervenzellen spielen bei der Erzeugung von Greifbewegungen eine wichtige Rolle. Gallese konnte zeigen, daß diese Neurone auch dann feuern, wenn der Affe nicht selbst zielgerichtete motorischen Handlungen ausführt sondern auch dann, wenn das Tier lediglich die Ausführung einer Handlung bei anderen Akteuren beobachtet (spiegelt). Auch beim Menschen gibt es solche Neurone, die dem Abgleich von Beobachtungen und Handlungen dienen. Die Durchführung und die Beobachtung bzw. geistige Simulation von Greifbewegungen der Hand gingen mit einer Aktivierung des Sprachzentrums einher. Mittels der Positronenemissionstomographie konnten Neuronengruppen für die Ausführung und Beobachtung von Handbewegungen im Broca-Areal nachgewiesen werden. Die Spekulationen angesichts dieser Funktionaltät von Nervenzellen sind weitreichend. Gallese vermutet, daß die SpiegelNeuronen im Laufe der Evolution über die innere Repräsentation von körperlichen Bewegungen Sprache beim Menschen erst möglich machten. Danach hätte sich das Sprachzentrum des Gehirns letztlich aus seinen motorischen Regionen heraus entwickelt (Gallese & Goldman, 1998). Auch eine wichtige Prämisse der darwinistischen Theorie, daß Bau und Funktion von Organismen wechselseitig voneinander abhängig und koevolutiv sind, findet durch diese Entdeckung eine Bestätigung. Als Ausdruck der Sehnsucht nach unserem Körper kann die hohe Besuchernachfrage (über 700.000) nach der Ausstellung "Körperwelten" in Mannheim (1998) gewertet werden. Der Heidelberger Mediziner Gunther von Hagens hat hier plastinierte Körper und Organe ausgestellt. In Berlin wurden für diese Ausstellung von Anfang Februar bis Ende August 2001 1.3 Millionen Karten verkauft (WK, vom 3. September). Bereits 1911 lockte der Blick unter die Haut - hier die Gesichtsmuskeln - 5 Millionen Besucher zur ersten Hygieneausstellung nach Dresden. An Schaubildern, anatomischen Modellen, transparenten Präparaten, etc. konnten die Besucher einen Blick in den menschlichen Körper werfen. Das im Jahre 1930 eröffnete Hygieneinstitut in Dresden wurde zum Publikumserfolg (Geo, 1997, S. 144 ff). Die Kopplung des Bewußtseins an Basisprozesse des Körpers wird auch durch solche Theorien unterstützt, die die evolutionäre Trennung von Menschenaffen und unseren Vorfahren mit größeren Umweltkatastrophen verbinden. Mit dem Verschwinden überlebensfreundlicher Waldstrukturen und der Verdrängung in die Graslandschaft wurde die Entwicklung zum aufrechten Gang überlebensnotwendig. Die Entwicklung eines längeren Daumens zur Ausübung des Pinzettengriffes, von Kehlkopf, Sprache und Bewußtsein war eine Folge der evolutionären Trennung der Entwicklungslinien von Menschenaffen und des Menschen. Die Evolutionstheorie als solche kann als hinreichend abgesicherte Theorie der Naturwissenschaften angesehen werden. Es besteht kein Zweifel mehr daran, daß wir Menschen aus biologischer Sicht große Übereinstimmungen 5 mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten aufweisen. Diskussionsfähig ist lediglich die Frage, wann und warum sich die menschliche Entwicklungslinie von der des Bonobo, Schimpansen oder Gorillas getrennt hat. Insofern liegt auch die Schlußfolgerung nahe, daß viele unserer Verhaltensweisen einer biologischen Interpretation zugänglich sind. Folgerichtig versucht die Sozialbiologie die Vielfalt des menschlichen Sozialverhaltens im Rahmen der Evolutionstheorie zu beschreiben. Heschl (1998) spitzt diese Fragestellung zu in der provokanten These, daß die Mensch den Grundmechanismen der biologischen Evolution unterliegen und somit wie alle anderen Lebewesen aus evolutionären wie auch erkenntnistheoretischen Gründen "von der Möglichkeit echten Erkenntnisgewinns prinzipiell ausgeschlossen sein müssen." Nur in der Phylogenese (Keimbahn) finden relevante evolutionäre Veränderungen statt. "Alles Wissen des Individuums steckt in dessen GENOM." (Heschl, 1998, S. 15) Mit dieser provokanten These wird nicht der Erkenntnisgewinn schlechthin verneint, wer vermag schon die genialen Einfälle von Einstein oder die vielen kleinen neuen Ideen des Alltags als Erkenntnisgewinn leugnen, sondern es geht um den gerichteten oder anders ausgedrückt methodisch basierten und damit reproduzierbaren Erkenntnisgewinn. Es ist die Logik der Argumentation: Bereits die befruchtet Eizelle muß wissen, daß aus ihr ein denkender Mensch wird. Insofern ist die philosophische Diskussion um die Frage der Methode hinsichtlich der Gewinnung objektiver Erkenntnisse aus dieser Sichtweise heraus obsolet. Unabhängig von solch einer Betrachtungsweise erfüllen die Ausführungen von Popper, wie wir zu relativ sicherem empirischen Wissen gelangen können, als auch die von Kant, wie wir zu absolut objektivem Wissen über die Welt gelangen, sui generis einen erkenntnistheoretischen Zweck. Die Erkenntnistheoretischen Überlegungen von Heschl, wenn man ihnen denn folgt, schreiben die evolutionstheoretischen Überlegungen von Darwin fort. In der Biologie kann sich danach keine Spezies die Fähigkeiten einer anderen aneignen. Biologische Evolution ist ein divergenter Prozeß hervorgerufen durch eine Zufallskomponente und Selektionsmechanismen. Vom Einfachen zum Komplexen ist nicht das alleinige Konstruktionsprinzip. Evolutionäre Entwicklungen können sowohl zu einer Vereinfachung führen als auch zur Komplizierung von Organismen beitragen. Beide Prozesse bedingen sich nicht zwangsläufig, sondern können unabhängig voneinander stattfinden. Erkenntnisgewinn als erfolgreiche Anpassung eines Lebewesens an seine Umwelt, kann nicht gerichtet sein, da "dies immer schon automatisch genau jenes Wissen voraussetzt, nach dem eigentlich erst zu suchen wäre". (Heschl, 1998, S. 88). Evolution ist gleichbedeutend mit der Entstehung neuer kognitiver Systeme. Aus dieser Logik leitet sich die Feststellung ab, daß es für echten Wissens- bzw. Erkenntniszuwachses des Zufalls bedarf. Die Behavioristen postulieren als eine zentrale These, daß alles Verhalten erlerntes Verhalten ist. Heute liegen empirische Evidenzen vor, daß viele Verhaltensweisen als das Resultat nachweisbarer genetischer Instruktionen zu verstehen sind. Kant hat den Tatbestand der biologischen Determinierung unseres Wissens über die von ihn postulierten apriorischen Vorbedingungen entsprochen. Im Dialog mit Eccles beschreibt Popper Erkenntnis als einen Prozeß der Beobachtung, der stets eine Modifikation früherer Erkenntnis voraussetzt. "Erkenntnis geht letztlich auf angeborenes Wissen und auf tierisches Wissen im Sinne von Erwartungen zurück. Beobachtungen sind immer schon in Begriffen früherer Erkenntnis interpretiert; d. h. die Beobachtungen selbst würden gar nicht existieren, wenn es kein früheres Wissen gäbe, das sie modifizieren oder auch falsifizieren könnten." (Popper & Eccles, 1982, S. 505) Bateson (1983) hat in seinem Werk "Geist und Natur" den biologischen und anthropologischen Forschungsergebnissen der letzten Jahre vorgegriffen und betrachtete die Evolution folgerichtig als stochastischen Prozeß. Er umschreibt Evolution als einen Strom von Ereignissen, die unter gewissen Aspekten zufällig sind und einem nichtzufälligen Selektionsprozeß unterliegen, der bestimmte Komponenten länger überleben läßt. "Ohne das Zufällige gibt es nichts Neues" oder auch "das Neue (kann) nur dem Zufälligen entrissen werden". Alle innovativen und kreativen Systeme sind divergent, umgekehrt sind alle voraussagbaren Ereignissequenzen konvergent. Divergente Prozesse sind dann stochastisch, wenn eine zufällige Komponente einwirken kann und ein Vergleichsmechanismus existiert, "der in der Evolution natürliche Selektion und im Denken Präferenz oder Verstärkung genannt 6 wird." (Bateson, 1983, S. 218). Diese Grundannahme gilt sowohl für die Gesamtheit der Populationen und dem Grundprinzip der Vererbung als auch für die individuellen Anpassungsprozesse einschließlich der durch Gewohnheit und Umgebung induzierten Prozesse. Die Betrachtungsweise von Bateson (1983) folgt einer strengen dichotomen Struktur: der Dichotomie von Form und Prozeß, Kalibrierung und Rückkopplung, Zustands- und Prozeßgrößen, innerer und äußerer Welt. Form und Prozeß bzw. Kalibrierung und Rückkopplung alternieren in einer hierarchischen Abfolge und beeinflussen sich gegenseitig. Ihre Relationen verbinden Ebenen niedrigeren und höheren logischen Typs. Mit jeder neuen Ebene erweitert sich die Relevanz der betrachteten Strukturen (Bateson, 1983). Die grundlegende Erkenntnis, daß wir Menschen nur ein Zufallsprodukt der Evolution sind, kann trotz spektakulärer Ergebnisse in der Genforschung auf der Ebene der Zellentwicklung nicht verifiziert werden. Die Aufklärung des Wunders der Embryogenese als geordneter Prozeß steht noch aus. Die Komplexität dieser Thematik soll hier nur über einige Fakten entsprochen werden. Das menschliche Erbgut befindet sich in den Zellkernen und ist eingelagert in 46 Chromosome. Trägerin der Erbinformation ist die Desoxyribonukleinsäure (DNS), die aus den Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin besteht. Diese Basen treten als Paare in allen erdenklichen Kombinationen auf. Als Gene (die eigentlichen Erbinformationsträger) werden Abschnitte der DNS bezeichnet (nur ca. 5% der DNS), die die Information zur Herstellung eines Proteins tragen. Die Proteine wiederum sind die eigentlichen Funktionsträger, die für die Eigenschaften der unterschiedlichen Zellen (ca. 200) zuständig sind. Alle Lebewesen benutzen als Speicher für ihr Erbmaterial die DNS. Die gespeicherten Informationen unterliegen alle dem gleichen Schema (Eigen, 1992). Legislative Nachricht Exekutive Funktion ▼ ▼ ▼ ▼ DNS RNA (Ribonucleinsäure) Protein Stoffwechsel Nach Pinel (1997) besteht unser Erbgut aus ca. 200.000 Genen bzw. 6,6 Milliarden DNS-Bausteinen. Neuere Forschungen sprechen von ca. 40000 Genen (Andre Rosenthal, Institut für Molekulare Biotechnologie in Jena). Das Chromosom 22 ist weitgehend entschlüsselt (VDI Nachrichten, 1999). Es ist mit ca. 34 Millionen DNSAbschnitten das zweitkleinste der menschlichen Erbinformationsträger. Es umfaßt mit seinen 545 Genen schätzungsweise 1,8 % des humanen Erbgutes. In der Tagesschau am 8. Mai wurde die Entschlüsselung des Chromosoms 21 durch deutsche und japanische Forschergruppen bekanntgegeben (Publikation in Nature, 18. May 2000). Danach verfügt dieses Chromosom auch über mehr als 33 Millionen Basenpaare mit 225 Genen. Welches dieser Gene für spezifische Merkmale, wie z. B. die Augenfarbe zuständig ist, ist ungeklärt. Die Gesamtzahl der Gene eines Organismus wird mit dem Begriff GENOM umschrieben. (Knippers, 1997). Als Proteom wird die Gesamtheit der Eiweiße (Proteine) einer Zelle bezeichnet. Wie kann es angehen, daß diese unvorstellbar hohe Informationsmenge, die unsere Entwicklung und unser Überleben steuert, in einer befruchteten Eizelle bereits vorhanden ist? Bereits am dritten Tag hat sich die befruchtete Eizelle in ca. 8 gleiche Zellen (totipotente embryonale Stammzellen) geteilt. Jede dieser Zellen könnte sich theoretisch zu einem Menschen mit identischen Erbgut entwickeln. Nach 6 Tagen sind es 140 ballförmig angeordnete Zellen. An einer verdickten Stelle, dem Embryoblast, liegen die embryonalen Stammzellen, aus denen sämtliche Körperteile hervorgehen. Am 16. Tag ist eine dreischichtige Keimscheibe entstanden mit drei unterscheidbaren Zelltypen. Innerhalb von nur 12 Wochen vollzieht sich die Verwandlung einer einzigen befruchteten Eizelle in einen Organismus mit Herz, Lunge, Fingern, Augen und Ohren. 7 Woher weiß jede Zelle, ob sie Insulin, Antikörper oder andere Botenstoffe produzieren soll, woher weiß jede Zelle welchen Körperteil sie bilden soll, wodurch wird der Bauplan jedes Körperteils bestimmt, alles Fragen die nur rudimentär und hypothetisch beantwortet werden können. Als sicher kann angenommen werden, daß alle Zellen, an welche Funktion sie auch immer gebunden sind, ihre Aufgabe mit hoher Effizienz erfüllen. Evolution ist insofern auch Optimierung der funktionellen Effizienz (Eigen, 1992). Wenn nicht einmal die Grundlagen unserer Entwicklung und Funktionsmechanismen wissenschaftlich hinreichend erklärt werden können, welchen wissenschaftlichen Wert haben dann die Erkenntnisse zum Endprodukt dieses Entwicklungsprozesses, dem handelnden und denkenden Menschen? Wir entziehen uns der Beantwortung dieser Frage und bedienen uns eines Tricks. Wir begreifen den "Stand der Erkenntnis" als phänomenale Wirklichkeit, welche sich wandelt, gänzlich umdefiniert oder verworfen wird aber immer dem Ziel folgt, irgendwann nicht mehr Wirklichkeit sondern die Realität selbst zu sein. Verwenden wir die Erkenntnisse als Artefakte zur Begründung oder Rechtfertigung bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen in dem Bewußtsein, Bestandteil eines Evolutionsprozesses zu sein, dessen Entwicklungsstadien wir über die Zeit in unserem Denken und Handeln unterworfen sind. Technik als kulturgeschichtliches Ereignis folgt auf dem ersten Blick anderen Prinzipien in seiner Entwicklung als die der biologischen Evolution. Der Mensch als Gestalter von Technik hat die Möglichkeit, sich technologische Fähigkeiten anderer Kulturen anzueignen bzw. sie an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Kulturelle Evolution ist somit ein Prozeß der Ansammlung und des immer wieder neu Lernens. Kultur meint dabei die unendlich große Vielfalt aber auch Einheitlichkeit der Selektionsdrücke, die die Mitglieder einer sozialen Gruppe durch ihr Verhalten aufeinander ausüben. Dawkins (1994) hat seine Überlegungen zur kulturellen Evolution an das Konstrukt „Mem“ gebunden. Meme sind Einheiten der kulturellen Vererbung wie Melodien, Gedanken, Schlagworte, technische Artefakte, etc. Mit dem Begriff „Mem“ hat er eine bewußte Assoziation zum Gen gewählt um zum Ausdruck zu bringen, daß die Evolution der „Meme“ analog der biologischen Evolution verläuft. Auch Kulturen wandeln sich im Laufe der Zeit, sie nehmen Eigenschaften an und verlieren sie, behalten manche Eigenschaften dauerhaft bei und entwickeln völlig neue Eigenschaften. Für die Arbeitswissenschaft ist aber nicht das Spannungsfeld von Sozialdarwinismus und Kulturentwicklung die zentrale Frage, sondern die Form des spezifischen Sozialdarwinismus, wie unsere Gesellschaft ihn praktiziert. Reichtum oder Armut, Arbeiter oder Arbeitsloser, Arbeiter oder Angestellter, Belastung und Beanspruchung durch Arbeit, etc. 3 Das Nervensystem 3.1 Allgemeine Struktur des Nervensystems Das Nervensystem wird üblicherweise untergliedert in das Zentralnervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem. Gehirn und Rückenmark, beide geschützt durch die knöchernen Strukturen des Schädels und der Wirbelsäule, werden gemeinhin als Zetralnervensystem (ZNS) bezeichnet. Das ZNS verbindet die unterschiedlichen Zellgruppen des Körpers miteinander, steuert ihre Funktionsverläufe und dient als allgemeines "Kommunikationsund Korrelationszentrum" (Keidel, 1979). Unsere Verhaltensweisen wie Motivation, Wut, Enttäuschung, Freude, Aufmerksamkeit oder körperliche Leistungsbereitschaft sind Ergebnis der Kommunikations- und Korrelationsprozesse des ZNS. Das periphere Nervensystem wird unterteilt nach dem somatischen Nervensystem und dem vegetativen (autonomen) Nervensystem. Das somatische Nervensystem ist zuständig für die Interaktion mit der Umwelt. Es besteht aus afferenten (zuleitenden) und efferenten (ableitenden) Nerven. Die sensorische Informationen von den Augen 8 oder Ohren, den Rezeptoren in der Haut, den Skelettmuskeln und Gelenken werden von den afferenten Nerven zum ZNS geleitet. Die efferenten Nerven wiederum übermitteln Signale vom ZNS an die Skelettmuskeln. Dieser Teil des peripheren Nervensystems, der die Muskeltätigkeit entsprechend den situativen Gegebenheiten steuert und unserer willkürlichen Kontrolle unterliegt, wird auch als motorisches System bezeichnet. Die afferenten Nerven, die zuständig sind für die Verarbeitung von Signalen zu Empfindungen und Wahrnehmungen, werden auch als sensorisches System bezeichnet. Das vegetative (autonome) System wiederum dient den Abstimmungsprozessen für die Leistungen unserer inneren Organe. Die Unterteilung in motorisches, sensorisches und vegetatives Nervensystem ist zwar physiologisch durchaus begründbar, darf aber nicht vergessen machen, daß diese Teilsysteme eng miteinander verbunden sind. Nerven sind Bündel von Nervenfasern. Periphere Nerven bestehen in der Regel sowohl aus afferenten und efferenten Nervenfasern. Diejenigen Nerven, die die Verbindung vom Rückenmark zur willkürlich beeinflußbaren Skelettmuskulatur und zu Sinnesrezeptoren herstellen, werden als somatische Nerven bezeichnet. Die somatischen Nerven (gemischte Nerven) trennen sich erst in der Nähe ihrer Zielorte (z. B. Muskel oder Haut) in motorische und sensorische Nervenfasern. Die Nerven des autonomen (vegetativen) Systems stellen die Verbindungen zu inneren Organen und Drüsen her. Mit der Attributierung autonom wird zum Ausdruck gebracht, daß dieses System nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Nur mental besonders geschulte Personen wie z. B. Fakire oder Zen-Mönche haben einen willentlichen Zugang zu diesem System (Kornadt, 1996). Das vegetative Nervensystem untergliedert sich in den sympathischen und den parasympathischen Teil. Die Nervenfasern des sympathischen Teils verlaufen vom Rückenmark bis zu den sympathischen Ganglien als gemischte Nerven. Ganglien sind Ansammlungen von Zellkörpern. Diese liegen beim Sympathikus organfern im sogenannten Grenzstrang. In den Ganglien sind die sympathischen Fasern über Synapsen mit postganglionären Nerven verbunden, die schließlich die inneren Organe innervieren. Die Nerven des parasympathischen Teils des autonomen Systems entstammen den hinteren Abschnitten der Hirnnerven bzw. dem unteren Ende des Rückenmarks. Sie verlaufen zu Ganglien, die in direkter Nachbarschaft zum Zielorgan liegen. Hier bilden sie Synapsen mit kurzen Neuronen, welche die Verbindung zum Organ herstellen (Thompson, 1990). Der Parasympatikus ist dezentral organisiert, die für die Steuerungsprozesse zuständigen Ganglien sind in der Nähe der Zielorgane angesiedelt, der Sympatikus ist zentral organisiert, die Ganglien liegen überwiegend im sogenannten Grenzstrang. Die meisten inneren Organe werden sowohl sympathisch als auch parasympathisch innerviert. Mit Ausnahme der zwölf paarigen Hirnnerven, die vom Gehirn ausgehen, gehen die Nerven des peripheren Nervensystems vom Rückmark aus. Das Rückenmark übernimmt somit zwei unterschiedliche Funktionen, es steuert die spinalen Reflexe (muskuläre und autonome Reaktionen auf körperliche Reize) als auch supraspinale Prozesse, die unter Einbeziehung des Gehirns ablaufen. So senden die Gehirnregionen ihre Informationen, die unsere Körperbewegungen kontrollieren, über das Rückenmark zu den Motoneuronen, die mit den Muskeln verknüpft sind. Gefühle wirken automatisch und nicht willkürlich. Werden wir beispielsweise in Furcht versetzt, sind wir automatisch flucht- oder kampfbereit. Gefühle und Emotionen sind eine Basisfunktion unseres Nervensystems. Zwei Notfallsysteme stehen dem Menschen zur Verfügung. Das sympathische Nervensystem ist zuständig für die Aktivierung in Flucht/Kampfsituationen. Es erhöht den Tonus der Skelettmuskulatur, steigert die Leistung des HerzKreislauf-Systems, die Atmung wird beschleunigt und der Stoffwechsel auf eine erhöhte Leistungserbringung eingestellt. Anzeichen einer erhöhten Aktivierung des Sympatikus sind Schweißbildung, Herzklopfen und trockene Mundschleimhäute. Der Selbsterhaltungsmechanismus wird durch eine erhöhte Aktivität des Parasympatikus unterstützt. Dies führt zu einer Verringerung des Muskeltonus, die Sauerstoffversorgung und die Stoffwechselprozesse werden reduziert. 9 Für die Aktivierung des Sympatikus oder des Parasympatikus sind unterschiedliche Nervenschaltungen und Neurotransmitter zuständig. Noradrenalin überträgt die Signale des Sympatikus, Acetylcholin die des Parasympatikus. Neuronen des Sympatikus liegen in zentralen Bereichen des Gehirns und wirken von hier aus auf die zu innervierenden Organe ein. Wir haben Gefühle und Emotionen als Basisfunktionen unseres Nervensystems bezeichnet. Diese Begrifflichkeiten werden unterschiedlich verwandt. Den Psychologen ist es bisher nicht gelungen, eine gemeinsame und klare Definition zu liefern. Beide Begriffe sind uns aus dem umgangssprachlichen vertraut, so daß wir beim Leser zumindest in dieser Hinsicht Verständnis erwarten können. Oftmals wird zwischen diesen beiden Begriffen kein Unterschied gemacht bzw. sie werden synonym benutzt. Nach Molcho (1983) sollte aber zwischen Gefühl und Emotionen differenziert werden. "Gefühl ist alles, was wir durch sinnliche Eindrücke wahrnehmen." (Molcho, 1998, S. 50). Kälte und Wärme, Form und Gestalt, Geruch und Geschmack, etc. Sie kommen von außen und werden über die entsprechenden Sensoren in den Körper transportiert. Unser Gleichgewicht wird durch Gefühle nicht grundsätzlich gestört. Wenn ich friere, kleide ich mich entsprechend, einen schlechten Geschmack vermeide ich. Von innen entwickeln sich Zärtlichkeit und Zuneigung, Wohlbehagen und Unwohlsein. Für diese Gefühle gilt die gleiche Aussage wie für die von außen initiierten Gefühle: sie bringen uns nicht prinzipiell aus dem Gleichgewicht. Anders bei Emotionen, hier entsteht ein Bruch, der die innere Balance aufhebt. Wird unseren Gefühlen hinsichtlich Wünsche und Bedürfnisse nicht entsprochen, werden aus den Gefühlen Emotionen, ein Zustand mangelnder innerer Balance. Dies muß nicht zwangsläufig negativ sein. Der Anblick einer grandiosen Landschaft, das Hören eines bestimmten Musikstückes erweckt angenehme Emotionen. Überwiegend sind Emotionen jedoch negativ. Angst, Enttäuschung, Unsicherheit sind die Zustände, die negative Emotionen ausmachen. Die Emotionen wirken auf den ganzen Körper. In allen Aktionen unseres Körpers kommt dies direkt oder indirekt zum Ausdruck. Werden Emotionen unterdrückt, sind psychosomatische Störungen die Folge. Der Körper reagiert mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern, ohne daß die Ursachen hierfür nachvollzogen werden können. Diese von Molcho vorgenommene Differenzierung von Gefühle und Emotionen ist zwar einleuchtend und mit der allgemeinen Lebenserfahrung in Einklang zu bringen, liefert aber keinen prinzipiellen Erkenntnisgewinn. Wir wollen deshalb Emotionen und Gefühle synonym verwenden und unter Bezug auf Dörner (1999) als Modulatoren des Verhaltens oder unserer inneren Zustände begreifen. Intellekt und Emotionen/Gefühle stehen in einer koevolutionären Beziehung, die wir als solche hinnehmen wollen ohne hierfür eine Beschreibung dieser Wirkungsbeziehungen leisten zu können. 3.2 Die Nervenzelle Grundbausteine des Nervenystems sind die Zellen. Zwei grundsätzliche Typen werden unterschieden. Die eigentlichen Nervenzellen, auch Neurone genannt und die Zellen mit unterstützender Funktion. Im ZNS sind dies die Gliazellen und im peripheren Nervensystem die Sattelitenzellen. Die Neurone sind ein Zelltyp, der sich durch eine spezifische Erregbarkeit und Leitfähigkeit hervorhebt. Um zumindest eine Vorstellung von diesen Mechanismen zu bekommen, erscheint ein prinzipielles Verständnis von Funktion und Aufbau einer Nervenzelle sinnvoll. Drei Zugänge zur Funktionalität der Nervenzellen haben sich etabliert: 1. Messung der elektrischen Aktivität einer Nervenzelle mittels einer Mikroelektrode. Als Ruhepotential halten die Zellen eine Potentialdiffernz zwischen Innenseite (Zellkern) und Außenmembran von -70 Millivolt aufrecht. Jede Zelle stellt als eine Batterie mit einer Spannung von -70 Millivolt dar. Bei der Entstehung eines Aktionspotentials (das Neuron feuert) verschiebt sich das Membranpotential von -70 auf +30 bis +40 Millivolt. Das Elektrische Potential stellt einen Gleichgewichtszustand dar, ohne daß ein elektrischer Ladungsfluß entsteht. Bei einem Aktionspotential findet ein Ionenfluß zu anderen Zellen statt. Dies bedeutet, es fließt Strom. Die Leitungsgeschwindigkeit beträgt ca. 1 bis 100 Meter pro Sekunde; 10 2. Analyse der chemischen Substanzen (Neurotransmitter), die von den Neuronen freigesetzt werden um mit anderen Neuronen Verbindungen herzustellen; 3. Nachweis von Anatomie und Vernetzungsstruktur mittels bildgebender Verfahren. Vier Basisfunktionen werden von Neuronen geleistet: sie aktivieren oder hemmen sich untereinander, verändern die Verbindungen bzw. die Verbindungstärke untereinander oder lösen solche Verbindungen wieder vollständig auf. Dies leisten sie ausschließlich über chemisch-elektrische Prozesse. Die wichtigsten äußeren Strukturen eines typischen Neurons sind der Zellkörper (Soma) und die Zellmembran. Die Zellmembran ist für die Übertragung von Signalen spezialisiert. Die vom Zellkörper ausgehenden faserförmigen Fortsätze werden als Dendriten bezeichnet. Dendriten vergrößern die reizaufnehmende Fläche der Nervenzelle. Sie sind das Hauptempfangsorgan. Dendriten und Zellkörper sind oft von Synapsen übersät, die mit den Axonendigungen anderer Nervenzellen gebildet werden. Ein Neuron der Großhirnrinde kann Tausende von Synapsen mit anderen Zellen besitzen. An den Dendriten kommen die synaptischen Impulsübertragungen von anderen Neuronen an. Das Soma empfängt die Signale in Form von chemisch ausgelösten lokalen Hyper- oder Depolarisierungen der Zellmenbran. Dies sind die oben beschriebenen Spannungsänderungen. Der Axonhügel ist der kegelige Übergang zwischen Zellkörper und dem Axon, welches als längerer dünner Fortsatz die Aktionspotentiale, d. h. den Output des Neurons, vom Zellkörper fortleitet. In der Nähe seiner Zielzellen spaltet das Axon sich in mehrere kleinere Äste auf. Sie enden in sogenannten synaptischen Endknöpfchen, die über den synaptischen Spalt mit den Synapsen anderer Neurone Neurotransmitter austauschen. Als Ranviersche Schnürringe werden die unmyelinisierten Einschnürungen zwischen den myelinisierten Abschnitten des Axons bezeichnet. Neurone sind entweder inhibitorisch (hemmend) oder aktivatorisch (erregend). Mischformen sind noch nicht bekannt. Ein Neuron kann sich aber auch selbst erregen oder hemmen. Die Leitungsgeschwindigkeit der Axone hängt zum einen von ihrem Querschnitt ab. Je dicker ein Axon um so höher die Leitungsgeschwindigkeit. Im Gehirn des Menschen haben des weiteren alle größeren Axone eine Myelinhülle, die für die Axonmembran wie ein Isolator funktioniert und die Leitungsgeschwindigkeit erhöht. Für die schnelle Weiterleitung visueller Signale sind die Axone der Sehnerven (ca. 1 Millionen) myelinisiert. Myelinfrei sind die langsamen Nervenfasern, die für die Weiterleitung von Schmerz und Temperaturunterschied an das Gehirn zuständig sind. Die Motoneurone (Neurone die Synapsen auf den Skelettmuskeln ausbilden) erreichen Leitungsgeschwindigkeiten bis 300 Meter pro Sekunde. Unmyelinisierte Axone leiten das Aktionspotential lediglich mit 1 Meter pro Sekunde weiter (Pinel, 1997). Die Mitochondrien kommen im Zellkörper, in den Fasern und in den Axonendigungen vor. Mitochondrien sind die Energieproduzenten. Mitochondrien benötigen über das Blut Sauerstoff und Glucose um ATP- (Adenosintriphosphat-) Moleküle zu produzieren. Das Gehirn umfaßt ca. 2% des Körpergewichtes, benötigt aber 16% der Blutversorgung (Thompson, 1990). Fast alle Prozesse, die in den Zellen ablaufen benötigen Energie. Keine Energie benötigt das sogenannte Aktionspotential, welches die Signale vom Zellkörper zu den Endungen transportiert. Das menschliche Gehirn besteht zu ca. 10% aus Neuronen und zu 90% aus Gliazellen. Die Funktionen der Gliazellen sind noch weitgehend unbekannt. Virchow hatte sie bereits entdeckt und bezeichnete sie als sogenannten Nervenkitt. Drei Typen von Gliazellen sind bekannt. Die sternförmigen Astrozyten wickeln sich um die Neuronen, versorgen sie mit Nährstoffen und entsorgen die von den Nervenzellen ausgeschütteten Botenstoffe. Die Oligodendrozyten produzieren das Myelin, welches für die Isolation der schnellen Nervenbahnen benötigt wird. Der dritte Type wird als Mikroglia bezeichnet. Diese wandern während der Embryonalentwicklung aus dem Blutkreislauf ins Gehirn. Ihre Funktionen sind noch gänzlich unbekannt. Vermutet wird, daß sie eine Abwehrfunktion gegenüber Nervengifte haben. Diese Vermutung wird abgeleitet aus der Tatsache, daß Mikroglia bei allen Krankheiten des ZNS, wie z.B. Alzheimer oder Multipler Sklerose, eine Schlüsselrolle spielen. 11 Erst in den letzten Jahren entdeckte der Physiologe Stephen Smith von der kalifornischen Stanford University, daß Gliazellen über eine eigene "Sprache" verfügen. Bei der Untersuchung des Ionenspiegels in Neuronen stellte er fest, daß auch die sie umgebenden Astrozyten große Mengen von Kalzium-Ionen aus ihren Zellspeichern frei gaben und dann durch Verbindungsporen von einer Gliazelle zur anderen wanderten. Verglichen mit den schnellen Reaktionen der Neuronen sind die Gliazellen in ihrer Kommunikation langsam. Nur 4 mm pro Sekunde wandert eine Kalzium-Ionen-Welle durch das Gehirn. Diese Geschwindigkeit reicht nicht aus, um schnelle Reaktionen bei Bewegungsabläufen oder in der Wahrnehmung zu steuern. Für Lernprozesse ist eine solche Geschwindigkeit durchaus ausreichend. Experimentelle Evidenz liegt dahingehend vor, daß Gliazellen nicht nur untereinander kommunizieren sonder auch die Kommunikation der Nervenzellen untereinander registrieren und beeinflussen. Barbara Barres kultivierte Neuronen aus der Netzhaut neugeborener Ratten. Diese bildeten zwar reichlich Synapsen, die Informationsübertragung war jedoch schwach und fehlerhaft. Mit den zugehörigen Gliazellen stieg die Frequenz der angeregten Signale zwischen den Neuronen um ca. 70%. Barbara Barres vertritt die Hypothese, daß Gliazellen aktiv an der Informationsverarbeitung teilnehmen und solche hochentwickelten Leistungen wie Lernen und Erinnern erst möglich machen. Auch Untersuchungen von Kettenmann (1995) zeigen, daß Gliazellen neuronale Verbindungen herstellen und abschalten können. Die grundlegenden Wirkungsmechanismen in den Neuronen aller Lebewesen sind gleich, die Unterschiede liegen in den Verknüpfungsmustern, also in der Organisation des Zusammenwirkens der Neuronen. Die Mechanismen dieser Signalverarbeitung sind noch Gegenstand vielfältiger Forschungsbemühungen. Ihre Modellierung wird seit mehreren Jahrzehnten versucht. Die Entwicklung neuronaler Netze und deren Simulation auf dem Computer führten zu weiteren Formalisierungsansätzen. Nach Dörner (1999) ist die Vektormultiplikation das vorherrschende Modellierungsprinzip hinsichtlich der Verknüpfung von Neuronen. Ein Vektor wird über die Angabe der Koordinaten in einem n-dimensionalen Raum beschrieben. Die Länge des Vektors ist gleich der Wurzel aus der Summe der Quadrate der einzelnen Komponenten. Die Normierung von Vektoren erfolgt durch Division jeder Komponente durch seine "Länge". Bei der Multiplikation von Vektoren werden die Komponenten der beiden Vektoren paarweise multipliziert und die Ergebnisse summiert. Das Ergebnis heißt das Skalarprodukt zweier Vektoren. Auf der Grundlage dieses Ansatzes und der bekannten oder zumindest vermuteten Funktionsweise der Neuronen modelliert Dörner (1999) Neuronen als Universalelemente der Informationsverarbeitung, die miteinander verknüpft als durchaus funktionierende "Methaper" eines Gehirns betrachtet werden können. Wie wir aufgezeigt haben, ist das menschliche Nervensystem das Ergebnis evolutionärer Prozesse über einen Zeitraum, der jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Evolutionäre Prozesse sind konservativ. Dies läßt die Schlußfolgerung zu, daß Strukturen, die einmal entwickelt wurden, in den nächsten Entwicklungsstufen weiter genutzt werden, da die Evolution unfähig ist, etwas geschaffenes zurückzunehmen. Entsprechend komplex und miteinander verschachtelt gestalten sich die Verarbeitungsmechanismen in unseren neuronalen Strukturen. 4 Das Gehirn 4.1 Vorbemerkung Das Gehirn als Organ des ZNS dominiert dieses in dreifacher Hinsicht. Es ist Informationszentrale, in der alle Signale der Sinnesorgane zusammentreffen. Es ist Steuerungszentrale für alle Muskelaktivitäten, die für zielgerichtete Handlungen notwendig sind. Es ist Zentrale für die kognitiven Leistungen in unserer Arbeits- und Lebenswelt. 12 Ein globales Verständnis von Struktur und Funktion dieses Organs ist insofern notwendige Voraussetzung für die Herausarbeitung eines Menschenbildes im Kontext des Arbeitssystems. Dabei befindet man sich aber in einer Dilemmasituation. Jede Beschreibung und jedes Modell kognitiver Strukturen und Prozesse in Form von Flußdiagrammen oder einfachen Zeichnungen, deren Elemente mit Pfeilen verbunden sind, wird der Realität nicht gerecht. Serielle und parallele Informationsverarbeitung, hierachischer Aufbau sensorischer Prozesse, etc. sind Begrifflichkeiten, die letztendlich nur als Methapher für etwas stehen, zu dem mehr Fragen als Antworten existieren. Nun kann man sich trösten mit der Feststellung, daß es nicht Aufgabe von formalen Darstellungen/Theorien sein kann, die Realität zu beschreiben, sondern es kommt lediglich darauf an, daß die formulierten Voraussetzungen mit den empirischen Daten übereinstimmen. Dem kann so nicht widersprochen werden, vorausgesetzt derartige Theorien beziehen die funktionalen Basisprozesse in ausreichender Weise in ihre Begründungszusammenhänge mit ein. Angesichts der Breite unserer Thematik können wir einer solchen Forderung verständlicher weise nicht entsprechen. Wie aber nun ein globales Verständnis von Struktur und Funktion des Gehirns beschreiben, ohne sich der Gefahr einer Simplifizierung mit dem Verlust des Respektes vor Komplexität und Leistungsfähigkeit dieses Organs auszusetzen? Je nach Sichtweise werden in der Literatur unterschiedliche Systematiken praktiziert. Unsere Sichtweise wird durch den Objektbereich der Gestaltung vorgegeben. Es kommt also darauf an, ein Erklärungmodell zu liefern, welches eine gestaltungsorientierte Interpretation von einschlägigen Erkenntnissen zuläßt. So zum Beispiel die sinnhafte Interpretation der magischen Zahl 7 von Miller. Wir wollen deshalb auf der Grundlage neuerer Literatur zur Gehirnforschung eine diesem Anspruch folgende Beschreibung vornehmen. Dies auch in der Weise, daß die Ausführungen zum Menschen als kognitives Wesen verständlich werden in ihrer Konsequenz für die Konstituierung eines Menschenbildes aus arbeitswissenschaftlicher Sicht. 4.2 Struktur Der Aufbau des menschlichen Gehirns entspricht dem der Säugetiere. Aus einer funktionalen Sicht betrachtet könnte man sehr vereinfacht unser Gehirn in drei Systeme aufteilen: in das Stammhirn als Bewegungszentrum, in das limbischen System als Gefühlszentrum und dem Cortex als Denkzentrum. Wenn wir aber die funktionelle Bedeutung des Gehirns für die Steuerung von Verhalten aus der Sichtweise arbeitswissenschaftlicher Gestaltung erkennen wollen, bedarf es einer weiteren Erschließung der generellen Strukturen. In der nachstehenden Tabelle sind solche Strukturen dargestellt. Neocortex Basalgang lien Limbische s System Telencephalon Endhirn 13 Thalamus Hypothal amus Diencephalon Zwischen hirn Vorderhirn Tectum Tegmentum Mesencephalon Mittelhirn Cerebellum Pons Metencephalon Hinterhirn Medulla oblongata Mittelhirn Encephalon Hirn ZNS ZentralNervensystem Rautenhirn Myelencephalon Nachhirn Rückenmark Tab. 2: Gehirnstrukturen Diese Unterteilung folgt der Entwicklung und Lage der Hirnabschnitte wie sie bereits sechs Wochen nach der Geburt sichtbar sind (Birbaumer & Schmidt, 1990; Pinel, 1997). 4.2.1 Myelencephalon (Medulla oblongata) Die Medulla ist die Fortsetzung des Rückenmarks in das Gehirn. Die meisten Nerven erreichen bzw. verlassen das Gehirn in diesem Bereich bzw. in der Region der Brücke (Pons). Die Medulla oblongata besteht fast vollständig aus Faserzügen, die Signale zwischen den übrigen Gehirnteilen und dem Körper übermitteln. In der Medulla oblongata beginnt auch die Formatio reticularis. Diese besteht aus einem komplexen Geflecht von ca. 100 winzigen Kernen. Diese Kerne sind an einer Vielzahl unspezifischer, voneinander unabhängiger Funktionen beteiligt (Pinel, 1997). So z.B. Schlaf, Aufmerksamkeit, Bewegung, Erhalt des Muskeltonus und diverse Herz-, Kreislaufund Atemreflexe. 4.2.2 Metencephalon (Hinterhirn) Auch hier befinden sich diverse auf- und absteigende Faserzüge sowie Teile der Formatio reticularis sowie die Kerne der Hirnnerven. Auf der Ventralseite befindet sich eine Ausbeulung, die als Pons (Brücke) bezeichnet wird. Auf der Dorsalseite des Hirnstammes befindet sich das Cerebellum (Kleinhirn). Das Kleinhirn besitzt beim Menschen eine beträchtliche Größe. Es macht zwar nur 10% der Masse des Gehirns aus, besitzt aber mehr als die Hälfte der Neurone bezogen auf das gesamte Gehirn. Hier ist das Gleichgewichtssystem und diverse visuomotorische Eingänge angesiedelt. Die Steuerung des Gleichgewichts, der Augenfolgebewegungen und der feinen Willkürmotrik sind wesentliche Funktion. Das Kleinhirn ist unter dem Einfluß der Großhirnrinde der wichtigste Ort motorischen Lernens. Es empfängt Erregungen vom Gleichgewichtssystem, den Muskelspindeln, den Hautsinnesrezeptoren, den Augen und den Ohren. Neuere Untersuchungen belegen, daß unser Kleinhirn nicht nur als Bewegungssteuerungszentrum betrachtet werden darf, sondern auch an nicht bewußtseinsfähigen kognitiven Leistungen und Sprache beteiligt ist (Roth, 1998). Die Funktionen des Cerebellum sorgen für eine präzise Bewegungskontrolle und der motorischen Anpassung an wechselnde Umgebungsbedingungen. 14 4.2.3 Mesencephalon (Mittelhirn) Auch hier werden zwei dominante Strukturen unterschieden, das Tectum und das Tegmentum. Das Tectum bildet zwei paarige Erhebungen oder auch Colliculi. Das posteriore Paar wird als Colliculi inferiores bezeichnet und ist zuständig für Hörfunktionen, das anteriore Paar hat die Bezeichnung Colliculi superiores und ist am Prozeß des Sehens beteiligt. Wichtige Strukturen des Tegmentums für unser sensumotrisches System ist die Substantia nigra und der Nucleus ruber. 4.2.4 Diencephalon (Zwischenhirn) Thalamus und Hypothalamus sind die Strukturen des Zwischenhirns. Der Thalamus enthält viele verschiedene Kernpaare, von denen die meisten in den Cortex projizieren (Pinel, 1997). Er besteht aus zwei kleinen ovalen Strukturen, jeweils eine in beiden Hemisphären. Der Thalamus ist eine übergeordnete Schaltstation für die wichtigsten sensorischen Systeme, die zur Großhirnrinde ziehen. Die afferenten Signale des visuellen, auditorischen und somatosensorischen Systems werden hier vorverarbeitet, bevor sie in den sensorischen Cortex übermittelt werden. Der Hypothalamus ist Teil des sogenannten limbischen Systems und hat somit eine bedeutende Rolle bei der Steuerung motivationaler Zustände. Seine Nerven innervieren u.a. die Hypophyse (Hirnanhangdrüse). Der Hypothalamus steht mit vielen Gehirnregionen in Verbindung und übt eine starke Kontrolle über die Körperfunktionen aus. Er ist wichtiges Regulationszentrum für die vegetativen Funktionen wie Atmung, Kreislauf, Nahrungs- und Flüssigkeitshaushalt sowie für die Thermoregulation. Er beeinflußt somit überlebensnotwendige Verhaltenweisen. Hypothalamus und Hypophyse sind übergeordnete Kontrollsystem für die Ausschüttung von Hormonen (Transmitterstoffe) durch die endokrinen Drüsen. An der Unterseite des Thalamus liegen zwei weitere Strukturen: das Chiasma opticum, der Ort an dem die beiden Sehnerven zusammentreffen, und die Mamillarkörper als wichtige Kerne des Hypothalamus. 4.2.5 Telencephalon (Endhirn) Das Endhirn macht den Menschen aus. Hier ist der Verarbeitungsort für unsere Wahrnehmung und kognitiven sowie emotionalen Leistungen. Bewußtsein und Sprache finden hier statt. Dies Teil des Gehirns ist somit für die komplexesten Hinfunktionen zuständig und ist deshalb die größte Struktur des Gehirns. Die Großhirnhemisphären werden durch eine Gewebeschicht bedeckt, die als Cortex cerebri bezeichnet wird. Die Großhirnrinde umfaßt ca. 80 bis 90 % des Gesamthirns und gliedert sich in die Basalganglien und die Hirnrinde (Roth, 1998). Als Basalganglien werden diejenigen Kerne bezeichnet, die im Zentrum der Großhirnhemisphären liegen. Sie wirken bei der Bewegungskontrolle mit und bilden das Hauptelement des extrapyramedialen motorischen Systems. Das Striatum als Teil der Basalganglien ist die größte subcorticale Zellmasse im menschlichen Hirn und besteht aus ca. 100 Millionen Zellen (Roth, 1998). Das sogenannte somatische Striatum ist zuständig für Handlungsplanung und Verhaltensteuerung. Für Emotionen und Verhaltenbewertungen steht das limbische Striatum. Die Großhirnrinde unterteilt Roth (1998) entgegen der herrschenden Lehrmeinung in den Allocortex und den Neo-/bzw. Isocortex. Dem Allocortex zugerechnet werden die Amygdala (Mandelkern) sowie der Hippocampus. Sie sind wichtige Strukturen des limbischen Systems. 4.2.6 Isocortex Der Isocortex macht ca. die Hälfte des gesamten Hirnvolumens aus. Der Isocortex hat eine Dicke von 1.5 bis 5 mm und ist stark gefaltet. Würde man ihn glätten, hätte er eine Fläche von ca. 2200 bis 2500 cm2. Die Struktur 15 des Cortex ist sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung weitgehend (über 90%) gleichförmig. Histologisch betrachtet ist er in sechs Schichten aufgebaut. Die Schicht I liegt außen und die Schicht VI ist die innere Schicht. Nervenzellen mit Sinnesinformationen aus den unteren Regionen des Gehirns stellen immer eine Verbindung zur Schicht IV her (siehe hierzu Pinel, 1997 und Birbaumer & Schmidt (1990). Vertikal betrachtet ist der Cortex in sogenannten funktionellen Säulen (zylindrische Informationsverarbeitungsmodule) strukturiert. Ob derartige funktionelle Säulen abgrenzbare Strukturen der neuronalen Informationsverarbeitung sind oder lediglich physiologische Strukturartefakte ist noch unklar. Dominierender Zelltyp sind die Pyramidenzellen. Auf einen Kubikmillimeter Kortex entfallen ca. 100000 Neuronen. Der visuelle Cortex enthält pro Kubikmillimeter etwa das Doppelte. Pyramidenzellen sind die wesentlichen Träger der Informationsverabeitung im Cortex. Ca. 70 % der Zellen im Cortex sind von diesem Typ. Der von ihnen verwendete Neurotransmitter ist Glutamat. Man bezeichnet solche Zellen als glutamaterg. Etwa 20 bis 30 % der Neuronen des Cortex wirken hemmend (inhibitorisch). Sie verwenden den Tranmitter Gamma-Amino-Buttersäure (GABA). Da sie anderen erregenden Neuronen zwischengeschaltet sind, nennt man sie auch GABAergen. Bei den Pyramidenzellen erfolgt die glutamaterge Transmission Ionenkanalgekoppelt. Die Anlagerung von Glutamat verursacht innerhalb von ein bis drei Millisekunden eine Veränderung des Membranpotentials. Die Schaltzeiten GABAerger Internueronen sind etwas länger und ihre Projektionen nicht so eindeutig strukturiert wie bei den glutamatergenen Neuronen. Die funktionelle Umgebung einer kortikalen Pyramidenzelle kann unter Bezug auf den Ausführungen bei Spitzer (1996) wie folgt beschrieben werden: • Eine Zelle kann benachbarte Zellen durch die NMDA-Rezeptoren aktivieren. In Abhängigkeit von der Benutzung ist dieser Vorgang modifizierbar. • Die Verschaltung in horizontaler Richtung hat die Form eines Zylinders von weniger als 100 (m Durchmesser. • Die Aktivität der Säule unterliegt "Ermüdungsprozessen", d.h. nach einer kurzen Dauer der Erregung bricht diese Aktivität zusammen und ist erst nach ca. zehn Millisekunden wieder erregbar. • Neben den starken Verbindungen zwischen den Neuronen einer Säule gibt es schwächere Verbindungen eiter entfernt liegenden Pyramidenzellen. Diese Verbindung ist jedoch nicht so stark, daß hierüber ein Erregungsprozeß eingeleitet werden kann. Sie ist jedoch ausreichend, um die Empflindlichkeit der Zellen für Eingangssignale zu modifizieren. • GABAerge Interneuronen werden durch die Pyramidenzellen aktiviert und wirken hemmend auf andere Pyramidenzellen. Man spricht auch vom Prinzip der lateralen Hemmung. Die über unsere Sinne aufgenommen Reize werden im somatosensorischen Kortex in sogenannten Landkarten repräsentiert, d.h. die Eingangssignale werden nach Ähnlichkeit, Häufigkeit und Wichtigkeit geordnet repräsentiert. Je nach Bedeutung der reizaufnehmenden Körperteile sind diese Bereiche entsprechend groß. Für den Tastsinn beispielsweise nehmen die Repräsentationen für Hände und Lippen einen größeren Bereich in Anspruch als andere Körperteile. Für das Sehen sind mehr als ein Dutzend sogenannter retinotope Karten bekannt, d. h. räumlich geordnete Repräsentationen der Netzhaut. Der Fovea steht hier mehr Platz zur Verfügung als den Randzonen der Netzhaut. Desweiteren sind tonope Karten bekannt, auf die die vom Ohr aufgenommenen Reize repräsentiert sind. Der Zusammenhang zwischen hervorgehobenen Fähigkeiten des Menschen und einer entsprechenden Größe der zuständigen cortikalen Bereiche ist offensichtlich. Anzumerken ist auch die von Roth immer wieder herausgestellte Tatsache, daß nur der Ort der Verarbeitung Hinweise über die Reizentstehung liefert. Der wie auch immer kodierte Reiz ist vom Code nicht zu unterscheiden. 16 Dem Cortex vorgelagert sind sogenannte Zwischenschichten. Der Sehnerv stellt eine solche Zwischenschicht dar. Der Sehnerv liefert mit seinen 2 Millionen Nervenfasern den bedeutensten Input für das Gehirn. Die gesamte Anzahl von Inputfasern des Gehirn beläuft sich auf ca. 107. Nur zwei bis drei Millionen Fasern (Axone) motorischer Nerven verlassen das ZNS, um so das Resultat der zentralen Informationsverarbeitung in Verhalten umzusetzen. Nimmt man noch die Verbindungen zu den inneren Organen, Drüsen, etc. hinzu, liegt die Anzahl der Outputfasern ebenfalls in der Größenordnung von 107. Veranschlagt man nun in vereinfachender Weise die Gesamtzahl der Neuronen im Cortex mit 2 * 107, so besteht das Gehirn nur aus 0,1 % Neuronen, die direkt sensorisch oder direkt motorisch sind. Anders formuliert: 99,9 % der kortikalen Neuronen erhalten ihren Input von anderen kortikalen Neuronen. Eine kortikale Pyramidenzelle versendet ihren Output an bis zu 10000 andere Pyramidenzellen. Von eben so vielen Pyramidenzellen kann sie auch Input bekommen. Das Prinzip der Rückkopplung dominiert. Eine einfache Rechnung macht dies deutlich. Wenn ein Neuron zu 10000 anderen projiziert, so sind bereits nach drei synaptischen übertragungschritten 1012 Neuronen involviert und damit ist zwangsläufig der Ausgangspunkt der Erregung wieder erreicht (Spitzer, 1996). Der größte Teil der Afferenzen des Isocortex kommen vom Thalamus, des weiteren aus der Amygdala, den Basalganglien und dem Hypothalamus. Die meisten kommen aus der Schicht VI und ziehen zum Thalamus. Die massivsten Faserzüge machen somit die intercorticalen Verbindungen, die sogenannten Assoziationsfasern aus. Diese hohe innere Verschaltung macht auch den Tatbestand aus, daß die größte Zahl der Erregungen des Cortex nicht aus der sensorischen Pheripherie bzw. den subcorticalen Strukturen kommt, sondern selbstreferentielle Erregungen sind. Die Verbindungen innerhalb des Cortex weisen, wie oben bereits aufgeführt, eine regelhaft Struktur auf. Dieser Sachverhalt verleitet zu der Interpretation, daß wir es hier mit einem modularen System zu tun haben, wo jedes Modul einen eindeutig definierten Aspekt der Informationsverarbeitung erfüllt um das Ergebnis einem anderen Modul zur Verfügung zu stellen. Dies ist nicht der Fall. Die Mehrheit der Axone kortikaler Pyramidenzellen führt nicht zu anderen Zellen im gleichen Areal, sondern zu Zellen in anderen Arealen. Die kortikalen Prozesse verlaufen konvergent wie divergent, parallel wie seriell, top-down wie auch bottom-up. Die Gestaltpsychologie hat eine Fülle von Beispielen aufgezeigt, bei denen Wahrnehmung weder durch reine Analyse noch durch reine Synthese funktioniert, sondern einen interaktiven Prozeß zwischen top-down- und bottom-up-Prozessen darstellt. Das Fleckenbild mit der Darstellung eines Dalmatiners ist ein Beispiel für derartige Verarbeitungsprozesse. Wir sehen zuerst die von der Retina gelieferte Fleckenstruktur. Erst durch einen zentralnervösen Abgleich der Flecken mit bereits abgespeicherten Informationen über Objekte, hier einer Hunderasse, sehen wir einen Hund. Nur durch eine Analyse der Input-Signale hätte der semantische Gehalt "Hund" nicht generiert werden können. Die sensorischen Felder besitzen trotz ihrer erfahrungsbezogen Konnektiviät eine hohe Anpassungsfähigkeit. Je höher ein kortikales Areal im Verarbeitungsprozeß angesiedelt ist, um so anpassungsfähiger ist es auch. Spitzer (1996) berichtet von einem Experiment, in dem man einem Affen dasjenige kortikale Areal entfernte, welches für die gesamte Hand als sensorisches Feld fungierte. Dies führte dazu, daß zunächst nachgeschaltete komplexere sensorische Felder nicht mehr auf entsprechende sensorische Stimuli reagierten. Bereits nach zwei Monaten reagierte der gesamte somatosensorische Kortex wieder, aber jetzt auf Stimulation des Fußes. Es hatte also eine vollständige Reorganisation der Vernetzung stattgefunden. Der Isocortex ist nach den sogenannten Brodmann-Arealen kartiert. Die funktionalen Zuständigkeiten der einzelnen Areale sind bekannt. Bestimmte Areale der Großhirnrinde stehen für spezifische Aufgaben zur Verfügung. So auch die sensorischen Felder. Jedes der sensorischen Felder enthält eine "Karte" von dem Außenbereich, der durch die entsprechenden Rezeptoren erfaßt wird. So existiert eine "Karte" der gesamten Körperoberfläche oder auch der Netzhaut unseres Auges. Da die Netzhaut nur ein zweidimensionales Bild der Außenwelt abbildet, wird erst in der Großhirnrinde eine vollständige Projektion der wahrgenommenen Umgebung geleistet. Trotz der umfänglichen Erkenntnisse bleiben aus der Sichtweise dessen, der ein Gehirn nachbauen wollte, die meisten Konstruktionsprinzipien im Dunkeln und können nur hypothetisch anhand neurobiologischer Evidenzen diskutiert 17 werden. Wir erinnern uns: das menschliche Gehirn verfügt über hundert Milliarden bis eine Billion Neurone. Die Neurone sind untereinander durchschnittlich mit 10.000 anderen Neuronen über Synapsen verbunden und jede Synapse selbst ist ein komplexer und variabler Teil der Informationsverarbeitung, deren Funktionalität noch nicht vollständig geklärt ist (Zimmermann, 1997). 4.2.6.1 Limbisches System Dem limbischen System zugeordnet werden Anteile der Hirnrinde, insbesondere Hippocampus, allo- und subcorticale Gebiete, insbesondere Amygdala, Hypothalamus, Kerne des Mittelhirns und der Formatio reticularis, der die Transmitter Noradrenalin, Serotonin und Dopamin zuzurechnen sind. Mit dem Begriff limbisches System wird also keine physiologisch bzw. lokale Struktur umschrieben, sondern eine Funktionalität, die sich über weite Teile des Gehirns verteilt. Roth (1998) vertritt die Auffassung, daß das limbische System als ein allgemeines Bewertungssystem für alle Aktivitäten des Gehirns aufzufassen ist. Die Bewertung erfolgt unter evolutionsbiologischen Gesichtspunkten in der Weise, daß Verhaltensweisen produziert werden, die das Überleben sicherstellen. Bewertet wird nach den Konsequenzen früherer Erfahrungen. Insofern ist Bewertung auf gespeicherte Informationen des Gedächtnissystems angewiesen. Bewertungsprozeß und Gedächtnisprozeß bedingen sich somit gegenseitig. Da die Bewertung immer vom situativen emotionalen Zustand abhängig ist, sind auch Gedächtnisinhalte mit emotionalen Wertigkeiten (Angst, Freude, etc.) belegt. Hierfür ist der Mandelkern zuständig. Die Interaktion zwischen Hippocampus und Amygdala spielen eine zentrale Rolle bei diesen Vorgängen. Der Hippocampus organisiert das Lernen und die Speicherung von Informationen, ist aber nach Roth (1998) selbst nicht der Ort der Speicherung sondern die erfolgt modalitätsspezifisch und nach Funktionen in den entsprechenden Rindenarealen. Die Zellen im Hippocampus können sich neu bilden, wie neuere Untersuchungen bei Weißbüschelaffen belegen (Eberhard Fuchs, Primatenzentrum der Universität Göttingen). Der amerikanische Verhaltensforscher Fernando Nottebohm (1991) hatte bereits vor mehreren Jahren nachgewiesen, daß sich beim männlichen Kanarienvogel im Frühling neue Hirnzellen bilden um neue Melodien für die Paarungszeit zu lernen. Jedes Jahr trillert der Kanarienvogel neue Melodien. Die alten werden durch Zellabbau vergessen. Nottebohm leitet hieraus die Theorie ab, daß der Hippocampus als Zwischenspeicher (KZG, Arbeitsgedächtnis) mit begrenzter Kapazität ständig je nach Anforderungen aus der Lebenssituation Zellen verliert und damit auch ihren Inhalt und neue aufbaut. 4.2.6.2 Hemisphären Die Zuweisung menschlicher Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen zu den beiden Gehirnhälften findet sich wiederholt in der einschlägigen Literatur. Der linken Gehirnhälfte verfügt danach über eine mehr analytischbegriffliche und die rechte Gehirnhälfte über eine synthetisch-anschauliche Kompetenz bzw. die rechte Hemisphäre dominiert deutlich beim räumlichen Vorstellungsvermögen sowie bei emotionalen als auch musikalischen Aspekten. Eine Übersicht funktionaler Zuweisungen zu den beiden Hemisphären ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. (Pinel, 1997). Solche Zuweisungen machen wenig Sinn und sind mit großer Skepsis zu betrachten (Roth, 1998). Denn beide Gehirnhälften sind über den Balken (Corpus callosum) aufs engste miteinander verbunden und sind immer gemeinsam involviert. Die Ergebnisse der Experimente zu lateralisierten Funktionen kommen deshalb allenfalls zu statischen Signifikanzen zu einer leichten Überlegenheiten der einen oder anderen Hemisphäre bei entsprechenden Testaufgaben. 18 Dominanz der linken Hemisphäre Wörter Allgemeine Funktion Sehen Buchstaben Dominanz der rechten Hemisphäre Geometrische Muster Gesichter Emotionaler Ausdruck Sprachlaute Hören Nichtsprachliche Laute Musik Tasten Taktile Muster Braille (Blindenschrift) Komplexe Bewegungen Bewegungen Bewegungen im Raum Verbales Gedächtnis Gedächtnis Nichtverbales Gedächtnis Sprechen Sprachliche Fähigkeiten Emotionaler Inhalt Räumliche Fähigkeiten Geometrie Lesen Schreiben Rechnen Richtung Entfernung Mentale Rotation von Formen Tab. 3: Hemisphären-Dominanz Lediglich bei den split-brain Patienten, bei denen der Balken durchtrennt wurde, machen derartige hemisphärische Betrachtungen Sinn. Die Folge einer solchen Trennung der beiden Hemisphären ist die Herausbildung einer gespaltenen Persönlichkeit. Zumindest unser ICH benötigt also beide Gehirnhälften. Die Lokalisierung von Gehirnregionen, die an der Erbringung kognitiver Leistungen beteiligt sind, kann heute mit sogenannten bildgebenden Verfahren erfolgen. Aktivitäten des Gehirns werden gemessen, modelliert und auf Computerbildern sichtbar gemacht. Zu diesen Verfahren gehören die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und die funktionelle Kernresonanzspektroskopie (fNMR). Durch Kombination der bildgebenden Verfahren (gute räumlicher Auflösung, 1 bis 2 mm) mit den tradierten Verfahren wie beispielsweise EEG/EMG (hohe zeitliche Auflösung) können Verknüpfungen zwischen Aufgabentypen aus der Experimentalforschung und den beteiligten Hirnarealen hergestellt werden. Trotz dieses methodischen Fortschritts dürfen derartige Kartierungen nicht zu dem Trugschluß führen, unser Gehirn würde aus einzelnen Modulen bestehen, die über separate Funktionalitäten verfügen. Zwar lassen sich einfache Reize und dementsprechende Reaktionen als das Ergebnis der Tätigkeit kleinerer oder größerer Verbände 19 von Nervenzellen dokumentieren, aber selbst für einfache Tätigkeiten im Alltag bedarf es der gesamten Komplexität unserer neuronalen Strukturen. Der Rückschluß auf die Funktion neuronaler Strukturen bei der Analyse von Läsionen liefert eine Fülle von Erkenntnissen und ist dennoch nicht frei von Täuschungen. Betrachten wir einen Fall aus dem täglichen Leben. Ein Lichtschalter wird betätigt, aber das Licht geht nicht an. Für einen naiven Benutzer folgt daraus, das Modul "Birne" ist defekt und muß ausgetauscht werden. Eine andere Erklärung wäre, die für den Stromkreis zuständige Sicherung ist defekt oder hat den Stromkreis unterbrochen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein mechanischer Defekt des Lichtschalters. Welch Erklärung zutrifft, kann nur durch eine Überprüfung der Funktionalität aller beteiligten Module überprüft werden. Für den Fachmann, der über das Wissen der Funktionalität aller Module verfügt, ist das kein Problem. Für das menschliche Gehirn haben wir zur Zeit noch keinen Fachmann. 4.3 4.3.1 Das Gehirn und spezifische Prozesse Bewußtsein und Kognition Bewußtsein kann allgemein als geistige oder mentale Begleiterscheinung beim Wahrnehmen, Erinnern und Handeln bezeichnet werden. Manche Autoren setzen Bewußtsein mit Selbstreflexion gleich (Tisdale, 1998). Roth (1998) begründet einen spezifischen Bewußtseinszustand, den er als Aufmerksamkeits-Bewußtsein bezeichnet. Hierunter wird ein hervorgehobener mentaler Zustand verstanden, der bestimmte Wahrnehmungs- und Handlungsprozesse durch Aufmerksamkeit in unser Bewußtsein rückt. Aufmerksamkeit und Bewußtsein bedingen sich gegenseitig oder sind vielleicht synonyme Bezeichnungen für das gleiche Phänomen. Für Roth (2001) werden mit dem Begriff Bewußtsein psychische Zustände bezeichnet, die von Individuen erlebt und wie auch immer artikuliert werden können. Als solche Zustände werden beschrieben: 1. Wahrnehmung von Vorgängen in der Umwelt und im eigenen Körper; 2. mentale Zustände und Tätigkeiten wie Denken, Vorstellen und Erinnern; 3. Emotionen, Affekte, Bedürfnisse; 4. Erleben der eigenen Identität und Kontinuität; 5. "Meinigkeit" des eigenen Körpers; 6. Autorschaft und Kontrolle der eigenen Handlungen und mentalen Akte; 7. Verortung des Selbst und des Körpers in Raum und Zeit; 8. Realitätscharakter von Erlebtem und Unterscheidung zwischen Realität und Vorstellung. Die Bewußtseinszustände 1 bis 3 konstituieren das Aktualbewußtsein, welches sich in stetig wechselnder Form auf dem Hintergrund der Zustände 4 bis 8 herausbildet. Das ICH und Bewußtsein sind zwar phänomenal und funktional miteinander verbunden, sind aber nicht identisch (Roth, 2001), da es Bewußtseinszustände wie allgemeine Wachheit (Vigilanz) gibt, die nicht mit einem ICHGefühl verknüpft sind. Ebenso wie beim Bewußtsein werden auch bezogen auf das ICH unterschiedliche Zustände postuliert: 1. das Körper_ICH, d. h. das Gefühl es ist mein Körper; 2. das Verortungs-ICH, d. h. das Gefühl, daß ich mich an diesem konkreten Ort befinde und nicht gleichzeitig woanders; 20 3. das perspektivische ICH, d. h. der Eindruck, das ich den Mittelpunkt der von mit wahrgenommen Welt bilde; 4. das Autorschafts- und Kontroll-ICH, d. h. das Gefühl, das ich Verursacher und Kontrolleur meiner Gedanken und Handlungen bin; 5. das autobiografische ICH, d. h. die Überzeugung, das ich derjenige bin, der ich gestern war und damit eine Kontinuität in meinen Empfindungen erlebe; 6. das selbst-reflexive-ICH, d. h. die Fähigkeit über mich selbst nachzudenken; 7. das ethische ICH (Gewissen), also das Gefühl über eine Instanz zu verfügen, die mir sagt was richtig oder falsch ist. Die Herausbildung der ICH-Zustände erfolgen in etwa bei der Entwicklung des Menschen in der genannten Reihenfolge und stehen im Zusammenhang mit der Ausweitung der assoziativen Areale. Die genannten Bewußtseins- und ICH-Zustände sind keine analytischen theoriegeleiteten Kategorien sondern Ergebnis von Untersuchungen bei Hirnkranken und dort beobachteten Defekte. Hieraus wird die Schlußfolgerung abgeleitet, das unser Bewußtsein und unser ICH kein homogenes Konstrukt sondern in vielfältiger Weise modularisiert vorstellbar ist (siehe auch Claxton, 1997, Kolb & Whishaw, 1996). Werden diese Bewußtseins- und ICH-Zustände aktiv, lassen sich ihnen spezifische Gehirnstrukturen zuweisen, in denen hervorzuhebende Aktivitäten zu beobachten sind bzw. bei Läsionen dieser Strukturen sind die genannten Zustände gestört oder können von den Personen nicht mehr eingenommen werden. Das Bewußtsein ist mehr oder weniger permanent aktiv. Nur im Koma ist das Bewußtsein ausgelöscht. Selbst im Schlaf bleibt es eingeschränkt tätig. Bewußtsein ist somit kein einzelner Prozeß, sondern es muß differenziert betrachtet werden nach unterschiedlichen Bewußtseinsebenen und Bewußtseinsgraden. Stellvertretend für viele naturwissenschaftlich orientierten Forscher geht Roth (1998) von der Annahme aus, daß das Auftreten von Bewußtsein wesentlich mit dem Zustand der Neuverknüpfung von Nervennetzen verbunden ist. "Bewußtsein ist das Eigensignal des Gehirns für die Bewältigung eines neuen Problems." Bereits Popper (1982) kommt zu der Feststellung, daß Probleme, die durch Routine gelöst werden können, kein Bewußtsein erfordern. Aus Zuständen heraus, für die das Gehirn neue Nervennetze anlegen muß um die Probleme bewältigen zu können, entwickelt sich Bewußtsein. Der Zustand des subjektiven Erlebens ist eine besondere Kennzeichnung dieser Prozesse, um sie von nicht bewußtseinspflichtigen unterscheiden zu können. Bewußtsein wird zu einer Eigenschaft bestimmter neuronaler Zustände, die es dem Gehirn erlauben, seine eigene Komplexität zu überwinden um sich einem Ausschnitt der Welt besonders zuzuwenden. Hinsichtlich Komplexität und Vielfältigkeit unterscheiden sich diese Prozesse erst einmal nicht von den unbewußt ablaufenden Prozessen. Bewußtsein wird danach zu einem physiologischen Artefakt. Je mehr Verknüpfungsaufwand für ein spezifisches Verhalten betrieben wird, um so bewußter ist uns dieses Verhalten. Je mehr vorgefertigte Netzwerke für eine kognitive oder motorische Aufgabe vorliegen, desto automatisierter und unbewußter wird diese Aufgabe erledigt. Etwas überzogen kann man diese Position als Bewußtseinsnaturalismus bezeichnen (Prinz, 1996). Der Bewußtseinsnaturalismus versteht Bewußtsein als eine Qualität, die vom Gehirn produziert wird. Gehirnprozesse werden als notwendige und hinreichende Bedingungen für die Herausbildung von Bewußtsein postuliert. Wenn hier von Gehirn gesprochen wird, so ist damit das Organ mit seinen physischen Strukturen und physikalisch/chemischen Prozessen gemeint. Der Bewußtseinsfundalismus begreift Bewußtseinserscheinungen als Gegebenheiten fundamentaler Art, zu denen wir als Individuen unmittelbaren Zugang haben. Beide Dogmen werden von Prinz (1996) als überholt angesehen und ein Konzept in Form einer psychohistorischen Spekulation entwickelt, welches Bewußtsein als Erscheinung mit der Konstituierung des ICH verknüpft. Prinz betrachtet das Gehirn zwar auch als notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Herausbil- 21 dung von Bewußtsein. Bewußtsein ist für Prinz nicht nur ein Korrelat der Gehirnfunktionen sondern bedingt soziale und kulturgeschichtliche Entwicklungsprozesse. Prinz unterscheidet drei Instanzen: 1. Bewußtseinserscheinungen 2. Kognitive Prozesse 3. Gehirnprozesse. Gehirnprozesse werden durch die Biologie neuronalen Strukturen und physikalische/chemischen Prozessen zugewiesen. Kognitive Prozesse sind Korrelate der Aktivitäten der neuronalen Strukturen. Bewußtsein ist in dieser Modellvorstellung Ergebnis einer kulturell vermittelten Interpretation von kognitiven Prozessen. Bewußtsein, Kognition und Gehirn stehen in einer hierarchischen Beziehung. In einer botton-up Betrachtung kann angenommen werden, daß neuronale Strukturen aktiv sein können, ohne daß dabei bereits von Kognition gesprochen werden könnte. Kognitive Prozesse führen nicht zwangsläufig zu Bewußtsein. Situation, in denen unser ICH nicht gegenwärtig ist, führen nicht zu bewußten kognitiven Repräsentationen. Die Betätigung der Bildtaste auf einer Computertastatur führt bei einem Novizen durchaus zu kognitiven Repräsentationen. Die Konzentration auf die Taste, um sie nicht zu verfehlen, die Orientierung auf dem Bildschirm und ggf. die Beobachtung des Srollbalkens zur Positionsorientierung verlangen eine bewußte Hinwendung zu diesen Aktivitäten. Der Experte, in einem angeregten Gespräch mit einem Systementwickler über ein geschickte Programmiertechnik verstrickt, scrollt gleichzeitig durch einen längeren Source-Code, ohne daß die zugrundeliegenden regulativen Prozesse bewußt werden. Top-down gesehen, sind Kognition und Gehirn notwendige Voraussetzungen für Bewußtsein. Konstituierende Bedingung für die Herausbildung bewußter Repräsentationen ist die "Bezogenheit auf ein implizit anwesendes ICH". Die bewußte Repräsentation einer Situation ist dann beendet, wenn sich das ICH aus ihr verabschiedet. Für ICH-bezogene Repräsentationsmodi postuliert Prinz zwei Prinzipien: • Duale Repräsentation • Personale Attribution. Unter "Duale Repräsentation" wird die Fähigkeit eines Organismus beschrieben, wahrgenommene und bereits vergegenwärtigte Inhalte nebeneinander und funktional getrennt zu halten. Unter Vergegenwärtigungen werden Repräsentationen von abwesenden Sachverhalten verstanden. Derartige Repräsentationen erlauben eine Entkopplung von aktuellen Wahrnehmungen, ohne deren handlungssteuernde Wirkung zu verhindern. Die personale Attribution setzt Erklärungsmodelle voraus, die das Auftreten von Vergegenwärtigungen auf personale Instanzen zurückzuführen erlaubt. Zur bewußten Repräsentation werden danach Sachverhalte immer dann, wenn sie in ihren Beziehungen zum ICH repräsentiert werden. So reagiert unser Gehirn auch unterschiedlich auf Sinneswahrnehmungen, die wir selbst oder andere auslösen. Sarah-Jayne Blakemore von der Londoner Universität hat dies eindrucksvoll in ihren "Kitzel-Experimenten" nachgewiesen. Unser Gehirn läßt sich nicht täuschen ob wir gekitzelt werden oder uns selbst kitzeln. Die Unterschiede in den Reaktionen sind jedem von uns gegenwärtig. Vergegenwärtigungen entspringen aus zwei Quellen: den Wahrnehmungen und den durch die Instanzen selbst induzierten Gedanken, Erinnerungen und Einstellungen. Die letztgenannten Repräsentationen benötigen einen Objektbezug, wenn sie nicht beim Akteur zur Verwirrung führen sollen. Eine solche Verknüpfung leistet eine eigenständige personale Instanz, die mit dem Körper des Akteurs verbunden ist: das ICH. Die Konstituierung des ICH 22 erlaubt nicht nur die Zuweisung von Repräsentationen und Gedanken auf diese Instanz sondern weist ihr auch die Funktion einer Zentrale für die Entscheidungs- und Steuerungsfunktion im Handlungsprozeß zu. Die Herausbildung von Handlungszielen, die nicht aus der aktuellen Wahrnehmung entspringen, findet ihre Erklärung über die Fähigkeit zur dualen Repräsentation. So können bedürfnisgerechte Handlungsziele auch unabhängig von der aktuellen Wahrnehmungssituation aufrechterhalten und verhaltenswirksam werden. Ein Tatbestand, den wir täglich selbst an uns beobachten können. Über die postulierte Existenz des ICH ist der Akteur in der Lage, sich seine inneren und äußeren Handlungen selbst zu erklären. Das ICH wird im sozialen Austausch mit anderen Akteuren der sozialen Gemeinschaft erzeugt, ist somit sozial konstruiert und als Selbstmodell in uns. Das Selbstmodell ist in jeder Wahrnehmungssituation gegenwärtig und entscheidet in autonomer Weise, auch im Widerspruch zur aktuellen Wahrnehmungssituation, über die Handlungsziele. Hiernach ist Autonomie und nicht Gehorsam eine personale Dimension, die konstitutiv das Menschenbild bestimmt. Für Dörner (1999) ist Autonomie eine notwendige "konstruktive" Eigenschaft unseres kognitiven Apparates, wenn man von der Annahme ausgeht, daß die Evolution uns mit einem universalen Anforderungssystem ausgestattet hat, welches für alle Lebenssituation adäquate Prozesse bereithält. Für Prinz (1996a, S. 97) sind Autonomie und Freiheit lediglich „Konzepte, die sich bei einem Vakuum von wahrnehmbarer Determination geradezu anbieten.“ Prinz (1996) liefert mit seinem Konzept auch eine Grundlage für die Beantwortung der Frage, ob Tiere über Bewußtsein in dem hier skizzierten Sinne verfügen können. Diese Frage ist solange mit nein zu beantworten, wie die Fähigkeit zur dualen Repräsentation bei Tieren nicht nachgewiesen ist. Demgegenüber könnten Menschen hiernach durchaus als Zombis existieren, wenn ihnen in ihrer Entwicklung die Angebote für die Herausbildung einer ICH-förmigen mentalen Struktur vorenthalten werden. Die theoretischen Überlegungen von Prinz finden in der neueren experimentellen Forschung eine gewissen Bestätigung. Stellvertretend für eine Fülle von Forschungen zu dieser Thematik soll auf die Arbeiten von Thomas Suddendorf verwiesen werden (siehe u.a. Suddendorf, 1999; Der Spiegel, 35, 2000, .S. 222). Suddendorf begründet drei mentale Ebenen. Hiernach hat sich vor einigen 100 Millionen Jahren ein „Primärgeist“ entwickelt, der heute bei Vögel und Säugetieren existent ist. Im menschlichen Fetus entwickelt er sich etwa in der 30. Woche. In dieser Entwicklungsphase existiert ein einfaches mentales Modell der Welt, welches direkt über die sinnliche Wahrnehmung aktualisiert wird. In der vor rund 15 Millionen Jahren eingeleiteten nächsten Entwicklungsstufe konnten die Menschenaffen auch sogenannte „sekundäre Repräsentationen“ herausbilden, die nur dann entstehen können, wenn die Fähigkeit besteht über Ereignisse nachzudenken, die nicht aktuell präsent sind. Diese Fähigkeit bildet sich beim Menschen im Alter von ca. 1.5 Jahren heraus. Die dem Menschen vorbehaltene Entwicklungsstufe wurde vor ca. 1.5 Millionen Jahren eingeleitet. Es entwickelte sich eine Entität (metamind), die es ermöglichte, über die eigene Geistestätigkeit und die anderer Artgenossen nachzudenken. So konnte sich ein eigenes mentales Abbild der Welt entwickeln. Bei Kindern setzt dieser Entwicklungsschritt erst im vierten Lebenjahr ein. Bei Schimpansen oder den Bonobo konnte die Forschung weder ein eigenes biografisches Gedächtnis noch die Fähigkeit, Handlungen der ferneren Zukunft zu antizipieren, nachgewiesen werden. Materielle Grundlage kognitiver Prozesse sind die Art der Verknüpfung zwischen den Neuronen und die Weise, wie Erregung in den Zellen räumlich und zeitlich abläuft. Was sich in einzelnen Nervenzellen ereignet, hat mit Kognition nichts gemein. Erst das geordnete Zusammenwirken größerer Verbände ermöglicht kognitive Leistungen. Eine Systematik kognitiver Leistungen ist nicht existent. Hierfür stehen Untersuchungsbereiche wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Denken, Wille, Handlungssteuerung, Motivation und Emotion, etc. Die überwiegenden kognitiven Leistungen des Gehirn verlangen gleichzeitige und aufeinanderfolgende Aktivität vieler unterschiedlicher neuronaler Netzwerke. Pinker (1998, S. 700) schließt sein Buch „How the Mind Works“ unter Bezug auf McGinn (1993), „Problems in Philosophy: The Limits of Inquiry“ ab mit den Worten: „Unsere völlige Ratlosigkeit gegenüber den Rätseln Bewußtsein, Ich, Wille und Wissen beruht möglicherweise auf der Unvereinbarkeit der grundlegenden Natur dieser Probleme und dem Rechenapparat, mit dem die natürliche Selektion uns ausgestattet hat. Sind diese Vermutungen korrekt, so würde unsere 23 eigene Psyche für uns das größte Rätsel von allen bleiben. Das auf dieser Welt Unbestreitbarste, unser eigenes Bewußtsein, entzöge sich für alle Zeiten unserem intellektuellen Zugriff. Doch wenn unser Denken ein Teil der Natur ist, dann ist dies zu erwarten, ja zu begrüßen.“ Etwas positiver formuliert: Bewußtsein,Vorstellungen und Aufmerksamkeit sind nach dem Stand der Forschung keine Phänomene bzw. Eigenschaften des Gehirns, welche als emergente Zugaben aus der Komplexität des Gehirns erwachsen, sondern sind notwendige Eigenschaften des Nervensystem, um all die wundersamen Dinge in unserer Lebenswelt zu vollbringen und zu bewältigen. 4.3.2 Wahrnehmung "Wahrnehmung ist in erster Hinsicht das Orientieren an Umweltmerkmalen zum Zweck des Lebens und Überlebens, wobei beim Menschen und vielen anderen Tieren auch das soziale Leben und Überleben eingeschlossen ist." (Roth, 1998). Wahrnehmung ist somit kein Zustand, sondern ein aktiver Transformationsprozeß. Wahrnehmung basiert auf den äußeren Sinnesreizen. Unsere Sensorik, wie beispielsweise das Auge oder das Ohr, wandeln den Reiz in für die Weiterverarbeitung taugliche Elementarereignisse um. Beim Auge sind dies die Lichtintensität bzw. die Wellenlänge des Lichtes oder noch genauer die Lichtquanten bestimmter Wellenlängen. Diese Elementarereignisse werden bereits in einer präkognitiven Phase in automatisierter und dem Bewußtsein nicht zugänglicher Weise verarbeitet. Hier wird den Signalen bereits Bedeutung zugewiesen, so daß Information entsteht. Die zugrunde liegenden Prozesse verlaufen konvergent, divergent und parallel. Die Anzahl der mit der Verarbeitung betroffenen Neuronen nimmt von der sensorischen Peripherie bis in die corticalen Zentren ständig zu. Selbst einfach erscheinende Wahrnehmung von Sinnesreizen, wie die Betrachtung des persönlichen Desktops, erfordern komplexe Wahrnehmungsprozesse unter Beteiligung vieler räumlich getrennter Hirnareale. Auf subcorticaler und corticaler Ebene werden die sensorischen Informationen immer stärker mit Informationen aus dem Gedächtnis vermischt. Die Bedeutungszuweisung ist dabei ein konstitutiver Bestandteil des Wahrnehmungsprozesses selbst. Wahrnehmung ist stets selektiv. Es werden primär die Informationen verarbeitet, die für eine überlebensfördernde (situative) Verhaltenssteuerung relevant sind. Dabei gibt es kein oberstes kognitives Zentrum (Roth, 1998). Wahrnehmung ist im Regelfall multimodal, d.h. es werden Informationen über mehrere Wahrnehmungsmodalitäten gleichzeitig verarbeitet. Für den erkenntnistheoretischen Konstruktivismus und nicht-reduktionistischen Physikalismus von Roth (1998) ist Wahrnehmung aufgrund der modalitätsunspezifischen Codierungsmechanismen nicht abbildend sondern konstruktiv. Dies gilt sowohl für elementare Wahrnehmungsereignisse wie Lage einer Kante als auch von komplexen Wahrnehmungsereignissen wie das wiedererkennen von Szenen, Gesichtern oder auch Musikstücken. Das, was wir sehen oder hören, ist kein ähnliches Abbild der Realität, sondern ihre rekonstruktive Interpretation. Dies kann man am Beispiel der Wahrnehmung von Farbe sehr gut nachvollziehen. In der Realität existiert Farbe nicht. Hier handelt es sich um die Absorptions- bzw. Reflexionseigenschaften von Oberflächen für elektromagnetische Wellen einer wohldefinierten Wellenlänge. In der Wahrnehmung werden dieser physikalischen Eigenschaft subjektive Qualitäten zugeordnet, die wir mit Farbbegriffen belegen, die wir gelernt haben. Bedeutung ist somit auch keine Dimension der Realität, sondern ein Konstrukt des Konstruktionsprozesses der Wirklichkeit, welchen wir als Wahrnehmung bezeichnen. Die konstruktiven Prozesse unterliegen nicht der Willkür des Menschen sondern vollziehen sich entlang der Rahmenbedingungen, die durch Evolution oder Lebenserfahrung gesetzt worden sind. Da diese Mechanismen nicht unserem subjektiven Willen unterworfen sind, ist die präkognitive Wahrnehmung unserer Umwelt relativ zuverlässig. Ein anderes beeindruckendes Beispiel für die Fähigkeit unserer Wahrnehmung ist das stereoskopische Sehen. Der Physiker Charles Wheatstone, der Erfinder der „Wheatstone-Brücke“, hat dieses Phänomen 1838 entdeckt. Heute wissen wir, das der wichtigste Faktor für die Tiefenwahrnehmung das stereoskopische Sehen ist. Ein Bild, welches die Retina erreicht, entsteht durch Projektion und ist erstmal zweidimensional. Verursacher einer Projektion 24 auf der Netzhaut sind Photonen, masselose Energiequanten der elektromagnetischen Strahlung, die von der Oberfläche eines Gegenstandes reflektiert werden. Sie gelangen auf einem wohldefinierten Richtungsvektor durch die Optik des Auges auf die Netzhaut und erregen hier die Rezeptoren (Stäbchen, Zapfen). Die Erregungen werden an das Gehirn weitergeleitet. Das Gehirn kennt dann zwar die Richtung, aus der das Photon kam, aber nicht den Ausgangspunkt. Diesen Mangel muß das Gehirn durch eigene Berechnungen ausgleichen. Hierfür wird das Sehen mit zwei Augen benötigt. Tiefenwahrnehmung ist eingeschränkt auch mit einem Augen möglich. Die Mechanismen sind Überschneidungen und Verdeckungen von Objekten, die durch Bewegung induzierte Parallaxe, die Drehung von Objekten sowie Schattierung und Perspektive (Hubel, 1989). Beim Sehen mit zwei Augen fallen beim Fixieren eines Punktes im Raum dessen Bilder auf die beiden Foveae. Jeder weitere Punkt, der als gleich weit wie der fixierte beurteilt wird, projiziert seine zwei Abbilder auf korrespondierenden Netzhautstellen. Wenn die Abbilder relativ zu den korrespondierenden Punkten nach außen verschoben sind, erscheint das Objekt näher als der fixierte Punkt. Erfolgt die Verschiebung nach innen, erscheint es weiter entfernt. Diese Verschiebungen liefern die Informationen über die Tiefenverhältnisse. Die Informationen für die absolute Tiefe ergeben sich aus der Stellung des Augapfels. Akkomodations- und Schielreflex sind miteinander verkoppelt. Werden die Augen auf einen nahen Punkt fokussiert, bewegen sie sich zur Mitte, bei einer Fokussierung auf große Entfernung richten sie sich parallel aus. Die trigonometrischen Berechnungen des Gehirns aus der Stellung des Auges und den Abbildungspunkten auf der Fovea führen zu einer recht zuverlässigen Tiefenwahrnehmung. Wie unser Gehirn diese Berechnungen ausführt ist unbekannt. Wir sprechen dann einfach von neuronaler Informationsverarbeitung. Beeindruckende Beispiele für das stereoskopische Sehen liefern sogenannte Random-Dot-Autostereogramme (siehe hierzu das Beispiel bei Pinker, 1998, S. 291). Wahrnehmung ist nicht immer zuverlässig. Als Quellen des Irrtums sind bekannt: die Kontrastverstärkung durch die Netzhaut mittels der lateralen Inhibition, Nachbilder Ergänzung durch Mangel an Reizinformationen. Wir sehen kanten, wo keine sind, die Größenkonstanz, ein Objekt welches wir mit der Hand langsam näher zum Auge bewegen, bleibt gleich groß. Da dieser Prozeß Zeit benötigt, tritt der Effekt bei einer schnellen Bewegung nicht auf, sondern das Objekt wird größer. Erinnern bedeutet nach konstruktivistischem Verständnis nicht, Situationen oder Fakten aus dem Gedächtnis abzurufen. Erinnern ist hiernach ein konstruktiver Prozeß, in dem Bedeutungen situationsadäquat in Form neuronaler Erregungsmuster aktiviert werden. Wie bereits festgestellt, erfolgt die Interaktion der Nervenzellen des Gehirns über elektrische Signale und chemische Botenstoffe. Nur diese oder die ihnen physiko-chemisch hinreichend ähnlichen Signale werden vom Gehirn verstanden. Das Gehirn "sieht, hört, riecht und fühlt nichts von der Welt". Der Zugang zur Umwelt erfolgt über die Sinnesrezeptoren. Den Rezeptoren ist gemeinsam, daß aufgrund von Einwirkungen aus der Umwelt Veränderungen der elektrischen Eigenschaft ihrer Membran erfolgen. Nach der Umwandlung von Lichtquanten, Schalldruckwellen und Geruchsmolekülen in elektrische Potentiale, haben sie ihre physikalisch-chemischen Eigenheiten verloren. Sie sind hinsichtlich der sie auslösenden Ereignisse bedeutungsneutral. Die Leistung des Gehirns besteht darin, diese Signale zu verarbeiten und ihnen Bedeutung zuzuweisen. Stadler & Kruse (1986) gehen deshalb auch davon aus, daß das Gehirn als kognitives System als semantisch abgeschlossen betrachtet werden kann. Wahrnehmung, Denken und Vorstellungen werden von ihnen als "Prozesse der Selbstbeschreibung des kognitiven Systems" verstanden. Bei Roth (1985) ist das die Selbstreferentialität des Gehirns. Die fehlende Spezifität der Nervenimpulse ist Voraussetzung eines intermodalen Transfers von Informationen. Die Unspezifität der Nervenimpulse macht die freie Bedeutungszuweisung möglich und gestattet eine Kommuni- 25 kation der Sinnesempfindungen und deren situationsadäquate Überführung in Wahrnehmung und entsprechende Aktionen (Roth, 1998). "Wahrnehmung besteht aus der Gleichzeitigkeit des Details und des Generellen." Ein Objekt wird danach sowohl in seinen Details als auch als Ganzes erfaßt. Entscheidend für die Objektidentifizierung sind dabei nicht nur die lokalen Objektmerkmale wie Farbe, Kontrast, der Verlauf von Linienzügen, etc. sondern auch die Relationen zwischen diesen lokalen Merkmalen. Es muß jeweils die Zusammengehörigkeit von Objekten und Merkmalen erkannt werden. Dieser Bindungs- oder auch Segmentierungsprozeß arbeitet hocheffizient und ist nicht nur abhängig von den Objekten und Merkmalen sonder auch von der Aufmerksamkeit und dem Vorwissen des wahrnehmenden Akteurs bzw. den ihm zur Verfügung stehenden Regeln, nach denen die Objektmerkmale zu kohärenten Einheiten (siehe hierzu der Abschnitt "Gestalt") zusammengefaßt werden. Das pop-out Phänomen ist Ausdruck des erstgenannten Tatbestandes, die schnelle Erfassung komplexer Szenen belegt die Effizienz des Segmentierungsprozesses. Die topologische Spezifität des Gehirns begründet das Prinzip der Parallelverarbeitung sensorischer Reize und damit auch die kapazitätsfreie Verarbeitung von Detailinformationen. Konvergenz der Erregung sorgt für die entsprechende Integration, Verallgemeinerung und Abstrahierung, so daß den Detailinformationen ein situativer oder kategorialer Bedeutungsgehalt zugewiesen werden kann. Dieses Konzept räumlich-verteilter Informationsverarbeitung wird von Roth (1998) als erkenntnistheoretischer Konstruktivismus und nicht-reduktionistischer Physikalismus bezeichnet. James Gibson hat bereits darauf hingewiesen, daß die Wahrnehmung unserer Umgebung bzw. einer Szene nicht die Verarbeitung neutraler bzw. objektiver Daten von Geometrie und Wellenlängen ist. Unser Bewußtsein verarbeitet diese Daten im Zusammenhang mit unseren Wirkungs- bzw. Bewegungsmöglichkeiten oder auch anders formuliert unserem Streben nach Selbsterhaltung. In Anlehnung an Roth und dem oben genannten Paradigma folgend, wollen wir dementsprechend unterscheiden nach der äußeren Welt, die wir als transphänomenale, bewußtseinsunabhängige Realität bezeichnen, und der inneren Welt, die wir als phänomenale, bewußtseinsabhängige Wirklichkeit bezeichnen wollen. Wirklichkeit ist somit ein Konstrukt unseres Gehirns. Alle erlebten Vorgänge zwischen dem ICH und der Außenwelt, dem ICH und dem Körper sowie zwischen Körper und Außenwelt laufen innerhalb dieser konstruierten Wirklichkeit ab und sind somit direkt oder indirekt der persönlichen Erfahrung zugänglich. Es existieren so viele Wirklichkeiten, wie es bewußte Akteure gibt. Innerhalb der Wirklichkeit gibt es für das ICH auch keinen Zweifel, daß der Wille die Tat hervorbringt. 4.3.3 Mentale Modelle Unsere innere Welt, die phänomenale, bewußtseinabhängige Wirklichkeit, ist gegenwärtig als neuronales Erregungsmuster bzw. als Schemata, welche wir als interne Repräsentation oder auch spezifisch auf ein Objekt bzw. Objektbereich ausgerichtet als "Mentales Modell" bezeichnen wollen. Zwei qualitativ verschiedene Verarbeitungssysteme werden unterschieden: Eines für die Sprache und eines für bildhafte Sinneseindrücke. Beide interagieren jedoch miteinander und die Art der Reiz-Codierung bestimmt nicht zwangsläufig die interne Codierung. Es kann angenommen werden, daß unser Gehirn über eine Vielfalt von Codierungstypen verfügt. Mit der dualen Kodierungshypothese hat Paivio (1986) bereits auf den Tatbestand aufmerksam gemacht, daß mentale Modelle von unterschiedlicher Qualität sein können. Diese auf die Gedächtniseffizienz (Bildüberlegenheits- und Konkretheitseffekt) zielende Hypothese geht davon aus, daß jedes Wort in zwei Formen repräsentiert wird. Innerhalb eines sprachlichen Systems und eines bildhaften Systems. Es wird angenommen, daß die Einheiten der beiden Systeme durch referentielle Links miteinander verknüpft sind. Diese Hypothese begründet sich auch aus den Sachverhalt, daß konkrete Wörter besser gelernt werden als abstrakte. Während die konkreten Wörter sowohl ei- 26 nen sprachlichen als auch nicht-sprachlichen Kode anregen verfügen abstrakte Wörter nur über einen sprachlichen Kode. Beim Erinnern laufen ähnliche Prozesse ab. Bilder werden besser erinnert als Wörter, und konkrete besser als abstrakte. Engelkamp (1994) kritisiert die Annahme variabler Wahrscheinlichkeiten für eine duale Kodierung, da sie in der Regel nur post hoc für die Befunde herangezogen wird. Des weiteren werden nur zwei Repräsentationssysteme angenommen, ein verbales und ein nonverbales, ohne diese Prozesse mit den Sinnesmodalitäten zu verknüpfen. "Würden akustische nonverbale Reize wie das klingeln des Telefons die gleichen Prozesse auslösen wie der Anblick des Telefons, so wäre die Reizmodalität unkritisch (Engelkamp 1994, S. 201). Es bedarf keiner Erklärung, daß dies nicht zutreffen kann. Wenn aber die Sinnesmodalitäten wie Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen unterschiedliche Gedächtniseffekte produzieren, müssen diese in einer Theorie nach Engelkamp auch mehr Beachtung finden, wenn man von der Theorie eine validen Erklärungsgehalt erwartet. Die Experimente von Posner & Snyder (1980) verweisen auf mindestens vier verschiedene Formate von Repräsentationen im Gehirn. Eines ist ist das visuelle Bild als Schablone eines zweidimensionalen bildartigen Mosaiks. Ein anderes ist ist phonetisch-phonologische Abbild einer Folge von Silben als wichtiger Bestandteil unseres Kurzzeitgedächtnisses. Ein drittes Format ist die grammatikalische Repräsentation, bei dem Verben, Substantive, Satzteile, etc. in Hierarchiebäumen angeordnet sind. Das vierte Format bezeichnet Pinker (1998) als „Mentalesisch“, die Sprache der Gedanken, in der unser begriffliches Wissen repräsentiert ist. Bildhafte Repräsentationen können im Gegensatz zu sprachlichen als analoge Repräsentationen angenommen werden, die mentalen Transformationen unterworfen werden können, wie z.B. die mentale Rotation. Die Zeiten für die Rotation eines Vorstellungsbildes und für die Rotation einer intendierten motorischen Antwort kovariieren (Spitzer, 1996). In beiden Fällen ist sowohl der primäre motorische Kortex als auch Teile des Frontallappens involviert. Bilder können mit einer Geschwindigkeit von 400 Grad pro Sekunde gedreht werden (Shepard & Cooper, 1982) Mentale Modelle haben zwei Informationszugänge: der eine über die Perzeption und der andere über unsere inneren emotionalen Zustände. Insbesondere aus dem ständigen Wechselspiel zwischen Reizen und Handlungen werden „Bilder“ konstruiert, die auch exakte zeitliche Abfolgen für Handlungsprozesse beinhalten. Alle Wahrnehmungen und die inneren emotionalen Zustände werden zu unserer Wirklichkeit verschmolzen. Subjektivität ist somit eine immanente Eigenschaft unseres Gehirns. Das jeweils aktivierte Modell der Wirklichkeit wird mittels der personalen Attributierung in ein Selbstmodell eingebettet, so daß die aktuelle Tätigkeit zu meiner Tätigkeit, der Desktop zu meinem Desktop wird, etc. 4.3.4 Bedeutung und Erwartung Die Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt ist immer mit Bedeutungszuweisung verbunden. Bedeutung besteht durch Bezug auf erfahrene Situationen und erlebtes Verhalten. Bedeutungen werden durch die Beziehungen von Schemata konstituiert und nicht durch einzelne Neuronen. Nach Roth (Universität Bremen, 1997) ist die eigentliche Wurzel von Bedeutungszuweisung die Selbstbewertung, welche als ein selbsterzeugender, selbstreferentieller Prozeß zu begreifen ist. Selbstbewertung ist an Selbsterhaltung bzw. Selbstherstellung gebunden. Selbstherstellung kennzeichnet die Fähigkeit, autonom einen Ordnungszustand einnehmen zu können. Selbsterhaltung wird primär mit der Herstellung und Einhaltung physiologisch bedingter Gleichgewichtszustände assoziiert, der Homöostase. Selbsterhaltung ist somit eine charakteristische Fähigkeit von Lebewesen und ist an die Wechselwirkung mit der Umwelt gebunden. Grundvoraussetzung für diese Wechselwirkung ist Wahrnehmung. Sie muß zugleich selektiv sein um nur die notwendigen und die ungefährlichen Wechselwirkungen zuzulassen. Für einige Umweltereignisse ist die menschliche Wahrnehmung nicht sensitiv, z.B. für Strahlungen. 27 Das Streben nach Selbsterhaltung und Gleichgewichtszuständen kann auch zentral-nervösen Prozessen unterstellt werden. Der Hypothalamus hat für derartige Verhaltenserscheinungen eine zentrale Stellung inne. Demnach wären stabile mentale Zustände nichts anderes als das Ergebnis der Bedeutungszuweisung unter dem Aspekt der Selbsterhaltung. Die Bedeutungszuweisung von Ereignissen ist dabei auch abhängig davon, was wir in der jeweiligen Situation erwarten. Es liegen Evidenzen vor, daß beispielsweise Reaktionen auf Streß stärker von den Erwartungen als von dem eigentlichen streßauslösenden Ereignis beeinflußt werden können. (Ornstein, R. & Sobel, D. (1995). Erwartungen sind gefühlsbestimmte Erlebniszustände als Ergebnis von gemachter Erfahrung mit unserer Umwelt. Erwartung bzw. die Fähigkeit des Menschen auf bestimmte Situationen vorbereitet zu sein, ist eine Grundvoraussetzung um sich in der Welt angemessen zu verhalten. Schnelle, also zeitkritische Reaktionen sind nur so möglich. Erwartung ermöglicht uns auch, viele Dinge parallel zu bearbeiten. Wahrnehmung ohne Erwartung ist nicht möglich. Wir haben oben festgestellt, Wahrnehmung ist selektiv. Dies trifft aber nur auf die Reize zu, für die wir keine Sensoren besitzen. Die eigentliche Selektivität entsteht erst durch die Verbindung von Wahrnehmungen bzw. vergegenwärtigten Erlebniszuständen mit Erwartungen. Erwartungen haben somit einen positiven Effekt, z. B. auf negative Ereignisse angemessen zu reagieren. Sie wirken aber auch negativ, weil sie die Flexibilität unseres Handelns und Denkens einschränken. Die Verknüpfung von Wahrnehmung und Erfahrung findet auf unterschiedlichen Verarbeitungsstufen statt. Sie können bewußt oder als kognitver Prozeß ohne bewußtseinszuwendung stattfinden. Reflexe sind eine besondere Kategorie, die wir als durch Evolution und Kultur entstandene Gehirnprozesse begreifen wollen. 4.3.5 Neuroplastizität Neuronale Strukturen sind dynamisch und unterliegen Veränderungen. Üblicherweise wird dieser Vorgang mit Lernen umschrieben. Lernen ist hiernach nichts anderes als die Veränderung des Bedeutungsgehaltes neuronaler Ereignisse. Neuroplastizität führt somit zu neuen Wissenstrukturen bzw. Fertigkeiten und Fähigkeiten, aber auch zu veränderten Einstellungen und Verhaltensweisen, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung, daß unser Gehirn ein mehr oder weniger statisches Organ sei, wissen wir heute, daß unser Gehirn das anpassungsfähigste Organ ist, welches wir besitzen (Spitzer, 1996). Die Anpassungsprozesse des überwiegend unbewußt arbeitenden Gefühlssystems (limbische System) verlaufen dabei relativ langsam. Gefühle werden langsam gelernt und noch langsamer vergessen. Offen dabei ist, ob das Vergessen ein nachweisbarer Verlust von Gedächtnisinhalten ist, oder ob diese nur nicht mehr aktualisiert werden können. Die Veränderung unserer kognitiven Strukturen ist selbst nur schwierig zu erfassen. Wenn man beispielsweise eine neue Sprache lernt, ist einem zum Beginn des Lernprozesses durchaus bewußt, daß man die Sprache nicht kann. Eine triviale Aussage, da mit der Intention die Sprache zu lernen auch der Status bewußt ist, von dem aus man zu diesem Entschluß bzw. zu dieser Entscheidung gelangt ist. Nach einer längeren Lernphase ist es nicht mehr möglich, sich den vorherigen Zustand bewußt zu machen. Die Veränderung ist erfolgt und nicht reversibel. Veränderungen in der Persönlichkeit über die Zeit sind nur über die Konfrontation mit Dokumenten aus diesem Zeitabschnitt unserer Bewertung zugänglich. Kleidung und Haarfrisur vergangener Jahre sorgen zwar immer wieder für Heiterkeit, dennoch sind wir uns dieser Veränderung ohne Konfrontation mit Artefakten dieser Zeit nicht bewußt. Das gleiche gilt für unsere gesamte Persönlichkeit. Nachgewiesen ist die Herausbildung größerer sensorischer Areale für Extremitäten als Folge intensiver Benutzung. So z.B. das sensorische Areal der Fingerkuppe des rechten Zeigefingers bei Braill-Lesern oder die Vergrößerung des kortikalen somatosensorischen Areals für die Finger der linken Hand bei Musikern (Streichern) (Elbert, u.a. 1995). Dies gilt insbesondere bei Kindern , die vor dem 12. Lebensjahr intensiven Übungsprozessen ausgesetzt waren. Umgekehrt gilt auch die Verkleinerung derjenigen Areale, die für amputierte Glieder zuständig 28 waren (Spitzer, 1996). Bei Läsionen in neuronalen Strukturen wird bereits kurz nach dem Eintreten der Schädigung eine erhöhte Reizbarkeit von Nachbarzellen nachgewiesen. Eine noch ungeklärte Frage ist, wo die Grenzen der Neuroplastizität liegen und wie sich die Veränderungen als Funktion der Zeit entwickeln. Eine erschreckende Bandbreite extremer Neuroplastizität können wir täglich den Medien entnehmen. Geisteskrankheiten, Sexual- und Gewaltverbrechen, Verkehrsrowdytum, politischer Extremismus, etc. Wie sind derartige Verformungen entstanden und wo liegen die Grenzen? Eine rhetorische Frage in diesem Zusammenhang. Uns erschließt sich lediglich das Ergebnis solcher Verformungen über das Verhalten solcher Akteure. Der zeitliche Verlauf entzieht sich ebenso unserer Bewertung, wie oben an den einfachen Beispielen aufgezeigt. Die Lernforschung bemüht sich seit Jahrzehnten zu diesem Problemfeld einen Zugang zu finden. Die Soziologen versuchen die Veränderungen von Individuum und Gesellschaft zu erfassen. Eine Forschungsthematik, die sich im Verlauf der Zeit immer wieder neu stellt. Ein interessantes Beispiel zeitlicher Verläufe von Stoffwechselveränderung und Veränderungen neuronaler Strukturen finden wir im klinischen Bereich. Werden beispielsweise Schizophrene mit einem Medikament behandelt, welches hemmende Wirkung auf die Dopaminrezeptoren ausübt, so setzt die physiologische Wirkung des Medikamentes bereits nach wenigen Minuten ein. Die schizophrenen Symtome bessern sich aber erst nach einer Woche oder noch später (Thompson, 1990). Anders ausgedrückt, die Entwicklung kognitiver Leistungen benötigt weit mehr Zeit als die Veränderung physiologischer Parameter. Spitzer (1996) stellt einer solchen Betrachtungsweise folgende Argumentation entgegen. Dopamin wirkt im Gehirn als Transmitterstoff bei drei unterschiedlichen Systemen: das nigro-striatale System, welches die Bewegungen steuert, das tuberoinfundibuläre System, welches die Ausschüttung des Hormons Prolaktin zur Aktivierung der Brustdrüsen regelt und das mesokortikale System mit seinem Einfluß auf den Kortex. Werden dann DopaminAntagonisten therapeutisch verabreicht, zeigen sich die Effekte auf den Bewegungsapparat sehr rasch. Ob die nach Wochen eintretenden weiteren therapeutischen Wirkungen als Effekte der Verminderung der Wirkung von Dopamin zu betrachten sind, bleibt ungeklärt. Wie langsam sich kognitive Strukturen verändern, wird beispielsweise deutlich bei Studierenden der Ingenieurwissenschaften. Die Regelstudienzeit beträgt 10 Semester, die realen Studienzeiten liegen im Durchschnitt bei mehr als 14 Semester. Dies sind sieben Lebensjahre in einem Lebensabschnitt, in dem alle Funktionen ein Leistungsniveau aufweisen, welches in späteren Jahren nur noch stagniert oder einen negativen Gradienten aufweist. Würde man einen Absolventen fragen, über welche Kompetenzen er jetzt verfügt, wäre die Antwort enttäuschend. Dennoch kann angenommen werden, daß seine kognitiven Strukturen, welche seine Persönlichkeit, sein Verhalten und sein Wissen und seine Fähigkeiten ausmachen, sich deutlich von der des Sudienanfängers unterscheiden. Ob die Veränderungen und der zeitliche Aufwand in einer angemessenen Relation stehen oder vergleichbare Veränderungen auch in der Hälfte der Zeit möglich wären, bleibt eine offene Frage. Ein weiteres Phänomen der Neuroplastizität repräsentieren die Synästhetiker. Synästhesie oder auch Crossmodality bezeichnet den Vorgang, daß Erfahrungen einzelner Sinnesbereiche ohne zusätzlich Lernleistungen auch von anderen Sinnesbereichen verwendet werden können. Synästhesie beschreibt somit eine Vermischung der Sinne. Die Sinnesreize werden bei Synästhetiker nicht nach den Modalitäten getrennt, sondern zu neuen neuronalen Strukturen verwoben. Diese neuronalen Strukturen sind nicht einheitlich sondern variieren unter den Synästhetikern. Synästhetiker spüren z.B. Geschmack als ein geometrisches Muster auf der Haut, Farben können ein Geruchserlebnis auslösen, beim Hören von Tönen werden Farben gesehen oder es werden Farben gehört. (Literatur unter den Namen Hinderk Emrich und Karen Trocha suchen, bereits im Lit-Verzeichnis aufgenommen) 29 4.3.6 Lernen, Wissen und Gedächtnis Wie oben bereits ausgeführt, bedeutet Lernen im Verständnis des Konstruktivismus vorhandene neuronale Strukturen zu verändern bzw. neue aufzubauen. Diese Prozesse sind im Vergleich zu den Operationen einer CPU (central processing unit) langsam. Ein mit 100 MHz getakteter Prozessor leistet 100 Millionen Operationen in der Sekunde. Selbst die schnellsten Neuronen benötigen Schaltzeiten von maximal 1 KHz. Überwiegend werden Schaltzeiten von 2 bis 3 Millisekunden benötigt. Die Bearbeitung höherer geistiger Leistungen wie die Bilderkennung oder das Lesen eines Wortes müssen als von Gehirn mit einer geringen Anzahl von Bearbeitungsschritten (100 step problem) bewältigt werden können. Dies setzt Verarbeitungsalgorithmen voraus, die uns noch unbekannt sind (Spitzer, 1996). Wir wollen der Einfachheit halber die Hebb-Metapher zugrundelegen. Bereits 1949 hat Donald Hebb ein Funktionsprinzip postuliert, welches heute noch als Hebbsche Lernregel bekannt ist und erst Jahrzehnte später experimentell bestätigt wurde. Die Hebbsche Lernregel besagt, daß in den Fällen, wo zwei miteinander verbundene Neuronen gleichzeitig aktiv sind, die Verbindung zwischen ihnen stärker wird. In der Abbildung 1 ist das Prinzip einer solchen Langzeitpotenzierung schematisch dargestellt. Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Gedächtnisfunktion auf Zellebene im Hippocambus (siehe hierzu Spitzer, 1996) Aus einem schwachen Reiz der Synapse Ssch resultiert nur eine geringe Aktivierung der Zelle in der Änderung des Membranpotentials über die Zeit. Erfolgt die gleiche Reizung zum selben Zeitpunkt mit einer starken Reizung Sst durch eine andere Synapse so resultiert hieraus ein deutlich stärkerer Output und die Verbindung an Sysnapse Ssch wird intensiviert. Aus dieser Verstärkung resultiert dann aus dem eingangs benannten schwachen Input ein starker Output (Spitzer, 1996). Lernen ist somit ein Prozeß der Veränderung von Übergangsgewichten zwischen Neuronen bzw. deren Synapsen (Dörner, 1999). Die Übergangsgewichte bestimmen die synaptischen Schwellenwerte. Hohe Übergangsgewichte bedeuten dabei niedrige Schwellenwerte und vice versa. Die Veränderung der Über- 30 gangsgewichte führt dementsprechend zu veränderten Reiz-Reaktions-Schemata. Ergebnis solcher Prozesse ist Wissen. Wissen sind Bestände an Modellen über konkrete und abstrakte Objekte, Ereignisse und Sachverhalte, die im Gedächtnis eines Individuums repräsentiert sind (Hennings, 1991). Je mehr Wissen auf einem Gebiet zur Verfügung steht, um so effizienter wird auch neues Wissen angeeignet. Als Metapher für diesen Sachverhalt kann man sich das vorhandene Wissen als Netzwerk mit Knoten und Relationen vorstellen. Je differenzierter dieses Netzwerk ist, um so leichter läßt sich neues Wissen einlagern. Gedächtnis steht als Bezeichnung für diverse Hirnareale, in denen Informationen wie Wissen, Sprache, Verhalten und Einstellungen gespeichert sind. Petri und Mishkin (1994) haben auf der Grundlage der für Gedächtnisfunktionen identifizierten neuronalen Strukturen Modell für ein explizites und ein implizites Gedächtnis vorgeschlagen. Als implizites Gedächtnis werden die Strukturen bezeichnet, die Informationen speichern, die unserem bewußten Zugriff entzogen sind. Sie sind entweder vorhanden oder auch nicht. Sie liegen in einer Codierungsform vor, die ähnlich der bei der Informationsverarbeitung sein sollte. Insofern spricht man auch von einer bottom-up bzw. informationsgesteuerten Verarbeitung. Diese Gedächtnisart wird auch häufig als "prozedural" bezeichnet Dem steht das explizite Gedächtnis gegenüber, welches Informationen speichert, die durch bewußte Erinnerung reproduziert werden können. Es sollte sich um eine kozeptionell gesteuerte top-down-Verarbeitung handeln. Insofern werden derartige Gedächtnisarten auch als "deklarativ" bezeichnet. Dem expliziten Gedächtnis werden die limbischen Strukturen wie der rhinale Cortex, die Amygdala, der Hippocampus und der präfontale Cortex zugeordnet. Diese Strukturen sind reziprok mit dem medialen Thalamus, dem basalen Vorderhirn und den sensorischen Feldern des Neocortex verknüpft. Für die impliziten Gedächtnisfunktionen spielen die Basalganglien (Nucleus caudatus und Putamen) eine wichtige Rolle. Sie empfangen Projektionen aus allen Gebieten des Neocortex und sind über den Globus pallidus und dem ventralen Thalamus mit dem prämotorischen Cortex verbunden. Dopamin kommt in den Basalganglien in hoher Konzentration vor und dient diesen Projektionen als Transmitter (Kolb & Whishaw, 1994). Als Ort des Gedächtnisses wird u. a. der Hippocampus vermutet. Zentral nervöse Prozesse unterliegen sowohl der Habituation (Gewöhnung), d. h. Abschwächung einer Reaktion auf einen wiederholten Lernreiz als auch der Sensibilisierung, d. h. Verstärkung der Reaktion auf einen Lernreiz. Es handelt es sich dabei nicht um Rezeptoranpassung oder Muskelermüdung, sondern um eine Veränderung zentral nervöser Prozesse. 4.3.7 Sprache Mit Sprache wird die spezielle menschliche Kompetenz umschrieben kognitive Inhalte symbolisch in neuronalen Strukturen zu repäsentieren, diese syntaktisch zu verknüpfen und das Resultat dieses Aktes anderen Menschen mitzuteilen. Über die Entstehung der Sprache werden zwischen Evolutionstheoretikern, Linguisten und Philosophen heftige Dispute geführt (siehe hierzu Dennett, 1997). Während der Linguist Noam Chomsky und er Evoutionstheoretiker Stephen Jay Gould die Auffassung vertreten, daß die Entwicklung der Sprache eine Folge der großen Gehirnkapazitäten des Menschen ist, wird von Dennett (1997) und Pinker (1998) die Entwicklung der Sprache als darwinistischer Prozeß erklärt. Es kann von der Annahme ausgegangen werden, daß das menschliche Gehirn für das Erlernen und Benutzen von Sprache besonders gut geeignet ist. Chomsky (1980) kommt zu der Feststellung, daß die Sprachkompetenz im wesentlichen bereits als angeborene Regeln beim Menschen verankert ist und im Lernprozeß nur noch geeignete Verknüpfungen aufgebaut werden müssen. Sprechen bedeutet nach dem hier formulierten Verständnis die gesteuerte Aktivierung von Gedächtnisinhalten und deren akustische Umsetzung durch unseren Sprechapparat. Sprache kann aber auch stattfinden, ohne daß eine 31 Artikulation erfolgt. So können wir nur im Bewußtsein sprechen. Dieses Sprachvermögen ist hinsichtlich phonetischer Ausdrucksform leistungsfähiger als der artikulatorische Teil. So können schwierige Wörter einer anderen Sprache im Geiste korrekt "ausgesprochen" werden, während die Artikulation fehlerbehaftet ist. Aus der Sichtweise unserer Wahrnehmung ist Sprache respektive die gesprochenen Wörter erstmal Luftdruckschwankungen, die wir mittels des auditiven Rezeptorsystems identifizieren können. Wir kommunizieren in Sätzen und nicht in Wörtern, selbst dann, wenn die Kommunikation nur aus einem Wort besteht. In diesem Fall ersetzt der Kontext den "Satz", wie bei der Interaktion mit dem Computer über Wörter als Menüitems, Befehle oder Ikons, deren semantischer Gehalt im Sinne ihrer Bedeutung mehr oder weniger vertraut ist. Die Sätze muß der Benutzer selbst bilden über sein Wissen zur Zielerreichung. Dies in zweierlei Hinsicht: sowohl auf die Aufgabe bezogen als auch auf den Interaktionsprozeß selbst. 4.3.8 Taktgeber Die komplizierten neuronalen Prozesse im Gehirn bedürfen einer genauen zeitlichen Abstimmung, wenn nicht das Chaos unser Bewußtsein beherrschen soll. Zwei Zentren im Gehirn funktionieren als Taktgeber. Eine bilateralsymmetrische Struktur im Hypothalamus, die als suprachiasmatische Kerne (Nucleus suprachiasmaticus) bezeichnet werden, regeln den Tagesrhythmus. Dieser Aktivitätszyklus liegt zwischen 24 und 25 Stunden (circadian). Die Kerne liegen oberhalb der Überkreuzung der beiden Sehnerven (Chiasma opticum). Einige Fasern der Sehnerven zweigen am Chiasma opticum vor dem Eintritt in den Thalamus ab und innervieren die Neuronen der suprachiasmatische Kerne. Der Sehnerv übt keine Kontrolle über den autonomen circadianen Rhythmus aus, sondern modifiziert ihn entsprechend den gegebenen Außenreizen. Bei Flügen in Zeitzonen mit mehrstündigen Verschiebungen müssen solche Modifikationen erfolgen. Ein anderes Hirnareal arbeitet als interner Zeitprozessor, mit welchem das Gehirn Zeitspannen mißt. E. Pöppel geht davon aus, daß dies nicht kontinuierlich erfolgt, sondern in einem Rhythmus von ca. 30 Millisekunden. Das Jetzt ist nach Pöppel kein Zeitpunkt sondern die Zeitspanne von 30 Millisekunden (siehe hierzu auch Pöppel, u.a. 1989). Dies hat den Vorteil, daß das Gehirn sensorische Ereignisse, die zusammengehören, auch dann verbinden kann, wenn sie zeitlich versetzt in den neuronalen Strukturen eintreffen. Nur so ist es möglich, die Maus mit der Hand zu bewegen und "gleichzeitig" die Position des Mauszeigers auf dem Bildschirm zu verfolgen. Die Signale der Lagerezeptoren des Hand-Arm-Systems benötigen bis in das Gehirn deutlich mehr Zeit als die visuellen Signale über die Position des Mauszeigers auf dem Bildschirm. Der Umgang des Gehirns mit der Zeit wurde von Benjamin Libet spektakulär demonstriert. Er reizte Nervenbahnen von Patienten bei offener Schädekdecke. Bei der Reizung von neuronalen Strukturen, die für die Motorik der Hand zuständig sind, wurde von den Patienten angegeben, daß sie den Reiz bereits eine halbe Sekunde vorher wahrgenommen hatten. Für Libet ist dies ein Trick des ZNS, seine eigene Langsamkeit zu überwinden. Um dem Menschen nicht der Verwirrung auszusetzen, der Realität hinterherzulaufen, werden die Ereignisse um diese Zeitspanne zurückdatiert. Begreift man das ZNS als hierarchische Struktur mit frühen und späteren bzw. niederen und höheren Strukturen, so bedingen die Leitungs- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten zeitliche Differenzen. Das Bewußtsein als höchste Struktur ist danach immer zu spät, es sei denn, es datiert für das gesamte System die Ereignisse vor bzw. verbindet sie in einem Zeitfenster von 30 Millisekunden. Ähnlich verhält es sich mit der bewußten Willensbildung. Bei den Patienten konnten bereits ca. 300-350 Millisekunden vor dem bewußten Entschluß die Hand zu heben, entsprechende Erregungen der neuronalen Strukturen (Bereitschaftspotential) gemessen werden. Die Versuche von Libet haben auch wieder die Frage aktualisiert, inwieweit unser Bewußtsein unabhängig vom Gehirn agieren und entscheiden kann. Empirisch ist es bisher nicht gelungen mentale Erlebnisse ohne hirnphysiologische Korrelate nachzuweisen. Der umgekehrte Fall ist dagegen die Regel (Ruschmeier, 1998). Monistische 32 Theorien gewinnen gegenüber dem Dualismus von Geist und Gehirn an Boden. Der überzeugte Dualist Eccles ist 1997 verstorben. Den Vorstellungen des Dualismus stehen zwei grundsätzliche Überlegungen entgegen: 1. Wenn der Wille auf das Gehirn eine Wirkung ausüben könnte, würde er hierfür Energie benötigen. Dagegen spricht der Energieerhaltungsansatz (Ruschmeier, 1998). 2. Die vielfältigen empirischen Ergebnisse sprechen gegen eine Autonomie des Geistigen gegenüber physiologischen Prozessen. Der Monismus postuliert, daß der Gedanke nichts anderes ist als ein Gehirnvorgang. Der Logik dieser Argumentation folgend bedeutet dies, daß unser Denken "gesetzlich" bestimmt ist und die Willensfreiheit ein Artefakt unseres eigenen Denkens ist. Es kann durchaus angenommen werden, das der Zustand dieses Organs zum Zeitpunkt Xi durch den im Zeitpunkt Xi-1 bestimmt wird. Voraussetzung und Grundlage hierfür ist eine globale Zielvorstellung als Resultat von Motiven, Lebenserfahrungen bzw. von multiplen Determinanten die unsere Persönlichkeit ausmachen. Angesichts der Komplexität unseres Gehirns ist der Zustand Xi weder vorhersagbar noch als solcher beschreibbar. 4.3.9 Informationsverarbeitung Unter dieser Bezeichnung werden Prozesse subsumiert, deren Leistungsdaten und spezifische Verläufe durchaus pragmatischen Wert besitzen. Roth (1998) unterscheidet zwei Stufen der Informationsverarbeitung: Periphere Codierung und Zentrale Verarbeitung. Diese Funktionsaufteilung ist bei allen Modalitäten gleich. Lediglich die Prozesse der Reizübertragung sind unterschiedlich. Die Sinnesrezeptoren haben die Funktion, die physikalischen und chemischen Reize aus unserer Umwelt umzuwandeln in den Code der Membran- und Aktionspotentiale bzw. der Neurotransmitter und Neuropeptide, so daß die Nervenzellen entweder erregt oder gehemmt werden. Wie oben bereits ausgeführt, geht Roth (1998) dabei von der Hypothese aus, daß der neuronale Code keine Spezifität mehr aufweist hinsichtlich der Modalität der Informationsaufnahme durch die Sinnesorgane. Es ist ein neutraler Code. Angesichts des Vakuums an verläßlicher Information hinsichtlich der Codierung in den neuronalen Strukturen ist dieses Konzept erstmal einsichtig. Die Verarbeitung der Ergebnisse der peripheren Codierung erfolgt in einem zentralwärts stark anwachsenden Netzwerk von Nervenzellen. Diese Verarbeitung wird von Roth (1998) als parallele, konvergente und divergente Erregungsverarbeitung umschrieben. Angesichts des neutralen Codes würde die primäre und die später durch Konvergenz/Kombination entstandene Information verlorengehen. Um diese Information zu erhalten, denn sie bilden die Grundlage der Formerkennung, der auditorischen Raumwahrnehmung, etc., erfolgt eine räumliche Separierung der Verarbeitungsbahnen im neuronalen Netzwerk. "Dies bedeutet, daß ein Neuron, welches der Ort der Konvergenz von Information und damit der Entstehung neuer Information ist, seine Axone aufspaltet und zum Zwecke der Bewahrung dieser neuen Information mindestens eine dieser Axonkollaterale separat hält und nicht auf Neuronen münden läßt, die ebenfalls Ort von Erregungskonvergenz sind." (Roth, 1998, S. 109). Wenn primäre Information bis in die corticalen Assoziationsareale gelangen soll, dürfen die nachgeschalteten Neurone nur reine "Schaltneurone" sein, die die Information unverarbeitet weiterleiten. Die Ermittlung des Informationsgehaltes einer Nachricht wurde von Shannon und Weaver über die Auftretenswahrscheinlichkeit der Signale berechnet. Dieser Informationsbegriff ist bezogen auf die menschliche Wahrnehmung untauglich, da die Bedeutung von Signalen erst mal unabhängig von der Auftretenswahrscheinlichkeit des Ereignisses ist. Information entsteht erst im semantischen Kontext des Empfängers. Bedeutung wird den neuronalen Erregungen erst innerhalb eines kognitiven Systems zugewiesen. Dies erfolgt in Abhängigkeit vom Kontext, in dem die Erregungen stattgefunden hat (Roth, 1998) Die Frage nach der Existenz von Detektorneuronen verneint Roth (1998): Diese Position wird damit begründet, daß Neuronen auf ein gleiches Objektmerkmal unterschiedliches Antwortverhalten (Entladungsrate) entwickeln können und das Neuronen auf Merkmalkombinationen und ihre Reizstärke reagieren. Zwischen verschiedenen 33 "optimalen" Merkmalskombinationen und Reizstärken ist auf neuronaler Ebene keine Unterscheidbarkeit gegeben. Die Umsetzung von Umweltreizen in Sinneserregungen erfolgt nach drei Grundprinzipien (Roth, 1998). 1. Mechanisch: Druck auf und Verbiegung entsprechender Strukturen (z. B. Haare): Hören, Vibrationssinn, Strömungssinn (Wasser und Wind), Schweresinn, Drehsinn, Tastsinn, Muskelstellungs- und Gelenklagesinn (Propriozeption) 2. Elektrisch: Elektrorezeption, Passive und aktive Elektroortung, Chemisch:, Geruchssinn, Geschmackssinn 3. Wahrnehmung elektromagnetischer Wellen (sehen) Die Sinnesorgane des Menschen nehmen oftmals nur ein kleines Spektrum der existierende Umweltreize wahr. Bei den Schallwellen ist es der Frequenzbereich von 18 Hz bis 18 KHz (bei Jugendlichen), bei Lichtwellen der Bereich von 400-750 nm. Fünf Eigenschaften der Umweltreize sind für die Wahrnehmung von Bedeutung: Modalität (Sehen, Hören, etc.), Qualität (z. B. Farbe oder Helligkeit), Intensität, Zeitstruktur sowie der Ort der Reizentstehung. Wie werden nun diese Reizeigenschaften codiert? Die Intensität kann in der Anzahl der Aktionspotentiale einer Zelle pro Zeiteinheit codiert werden. Das Verhältnis von Reizstärke und Entladungsfrequenz ist dabei nicht linear. Viele Zellen reagieren auf den Reizbeginn hochfrequent um dann deutlich abzufallen. Des weiteren adaptieren viele Rezeptoren sehr schnell. Nicht zuletzt gilt das Weber-Fechner`sche Gesetz hinsichtlich der Umsetzung der Reizstärke. Die Umsetzung erfolgt logarithmisch, so daß niedrige Reizstärken überdurchschnittlich hoch codiert werden und höhere Reizstärken unterdurchschnittlich beantwortet werden. Die Zeitstruktur wird im Regelfall über Beginn und Ende der Entladung codiert. Allerdings zeigen viele Nervenzellen/Rezeptoren ein phasisches Antwortverhalten bzw. feuern auch nach dem Ende des Reizes weiter. Bereits die Codierung dieser zwei Reizeigenschaften Intensität und Zeitstruktur ist nicht eindeutig. "Eindeutigkeit erlangt das Gehirn erst durch die Auswertung der relativen Aktivität verschiedener phasisch und tonisch antwortender Zellen innerhalb eines Netzwerkes." (Roth, 1998) Modalität eines Reizes kann nicht über den neuronalen Code einer Zelle repräsentiert werden. Es gibt streng genommen keine visuellen oder auditorischen Neurone. Lediglich der Ort der Verarbeitung in unserem Gehirn (schon eine Vermutung von Helmholtz) bestimmt die Modalität und auch seine Qualität. Dies bedeutet, daß unser Gehirn "dasjenige als Sehen interpretiert, was den visuellen Cortex erregt, und dasjenige als Hören, was den auditorischen Cortex erregt, und zwar gleichgültig, ob die Erregung tatsächlich vom Auge oder vom Ohr kommt." (Roth, 1998). Dies bedeutet, daß die wichtigsten Reizeigenschaften wie Modalität und Qualität in unserer Wahrnehmung ein Konstrukt unseres Gehirns bzw. der Gehirntopologie sind. Z. B. wird der dreidimensionale Ort eines Objektes im Sehraum über die zweidimensionale Abbildung auf der Netzhaut des linken und rechten Auges, ihrer Abweichungen (Disparitäten), der Stellung der Augachsen (Konvergenz) und die Linsenakkomodation berechnet. Der Übergang zwischen den physikalischen und chemischen Reizen unserer Rezeptoren zu den Wahrnehmungszuständen in unserem Gehirn "stellt einen radikalen Bruch" dar. Die Komplexität der Signale aus der Umwelt wird reduziert auf Erregungszustände von Sinnesrezeptoren. Diesen wiederum werden, wie auch immer kodiert, auf den unterschiedlichen Stufen der Wahrnehmung wieder mit Informationen angereichert und Bedeutung produziert. Beim Sehen entsteht kein Bild auf der Netzhaut, wie es oft fälschlicherweise beschrieben wird. Es gibt lediglich ein Mosaik aus Millionen von erregter Zapfen und Stäbchen. Diese Rezeptoren reagieren lediglich auf die Zahl der Lichtquanten pro Zeiteinheit in spezifischen Wellenlängenbereichen. 34 Diese physikalischen Reize haben nichts mehr mit dem Code gemein, der in den Verarbeitungsprozessen der neuronalen Netzwerke von Retina und Gehirn produziert wird. Die einfachste Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden bedarf bereits hochkomplexer Verrechnungsschritte. Es existiert keine feste Zuordnung zwischen Wellenlängen und Farbempfindungen. Unterschiedliche Erregungsmuster der Farbrezeptoren können beispielsweise die gleiche Farbempfindung hervorrufen. Je nach Tageslichtverhältnissen interpretiert das visuelle System die kürzestes Wellenlänge als "blau-violett" und die jeweils längste als "rot". Physikalisch betrachtet können das "blau-violett" und das "rot" jeweils deutlich unterschiedliche Wellenlängen aufweisen. Dies ist die Grundlage der Farbkonstanz, unserer Fähigkeit trotz unterschiedlicher Lichtverhältnisse die Farben von Gegenständen zu identifizieren. Unter der Annahme, daß unser Gehirn über 1 Billionen Nervenzellen verfügt, haben hiervon etwa 200 Milliarden irgend etwas mit dem Prozeß des Sehens zu tun. Dies bedeutet, daß einer einzigen Retinaganglienzelle etwa 100.000 zentrale Neurone zur Auswertung der einlaufenden visuellen Informationen gegenüberstehen." (Roth, 1998). Hennings (1991) kommt zu der Feststellung, daß ca. 50% aller Neuronen im Cortex etwas mit Sehen zu tun haben bzw. können durch den Prozeß des Sehens assoziiert werden. Dieser Sachverhalt verweist auf die Bedeutung des visuellen Kanals und erklärt die Leistungsfähigkeit mentaler Operationen bei der Verarbeitung graphischer Repräsentationen. Beim auditorischen System ist dies Verhältnis noch höher. Es kann angenommen werden, daß im Innenohr lediglich die 3000 sogenannten inneren Haarzellen die primäre auditorische Information erzeugen und die 30.000 äußeren Haarzellen der Modulation der inneren Zellen dienen. Wenn dies zutrifft, stehen den zwei mal 3.000 Haarzellen ca. 100 Milliarden zentrale Neurone zur Verarbeitung auditorischer Informationen gegenüber. Nachdem Stärke und Frequenz der Schalldruckwellen, die auf die Haarzellen einwirken, die periphere Codierung durchlaufen haben, ist die Melodie verloren gegangen und entsteht erst wieder als Wahrnehmung in unserem Gehirn. Wenn hier solch ein Verhältnis von Sinnesneuronen zu zentralen Verarbeitungsneuronen aufgemacht wird, soll damit nicht der Eindruck erweckt werden, alle diese zentralen Neuronen werden auch aktiviert. Es ist immer nur ein Bruchteil der gesamten Kapazität die situativ eingesetzt wird. Diese sind dann zugleich über viele Hirnareale verteilt und die momentanen Erregungsmuster wechseln ständig. 5 Das Gedächtnis Mit dem Begriff "Gedächtnis" werden die Areale des ZNS gekennzeichnet, die die funktionale Integration der von den sensorischen Bereichen gelieferten Signale leisten. Gedächtnis umschreibt somit eine spezielle Funktionalität des ZNS. Diese Funktionalität speichert Informationen und stellt sie unter bestimmten Bedingungen wieder zur Verfügung (Bereitstellung). Der Forschungsstand zum Aufbau und zur Funktionsweise unseres Gedächtnisses wird je nach Sichtweise und Gegenstandsbereich unterschiedlich beurteilt. Aus der Sichtweise dessen, der ein Gedächtnis konstruieren und nachbauen möchte, gibt es mehr offene als beantwortete Fragen. Unklar ist, welches die Prinzipien sind, die eine funktionale Integration sensorischer Signale und Gedächtnisinhalte leisten. Phänomene wie die Gestaltprinzipien und das Prinzip der Isomorphy, Übereinstimmung in den Merkmalen bzw. Merkmalsbereichen von Reiz und Gedächtnisinhalt sind zwar als Artefakte bekannt, die Erklärungen hierfür sind weitgehend spekulativ. Zu diesem auch als Bindungsproblem bezeichneten Thema stehen sich zwei konkurrierende Hypothesen gegenüber. Die eine Hypothese geht von einem Konvergenzzentrum im Gehirn aus, welches die kohärente Wahrnehmung der unterschiedlichsten Umweltreize leistet und dazu beiträgt, daß sich ein intentionales ICH konstituieren kann. Intuitiv ist eine solche Erklärung durchaus einsichtig, die moderne Hirnforschung hat ein solches Zentrum trotz detailierter Kartierung des Gehirns bisher nicht ausmachen können. Gesicherte Erkenntnis ist, daß 35 die einzelnen wohl definierten Areale des Gehirns nur Teilfunktionen erfüllen und hochgradig vernetzt sind. Wie es trotz dieser Arbeitsteilung zu kohärenten Repräsentationen kommen kann, ist unklar. Denkbar wäre, daß nicht einzelne Nervenzellen sondern Ensembles von Nervenzellen einzelne Repräsentationen bilden. Dann muß jedoch geklärt werden, welche der vielen aktiven Nervenzellen zu einem solchen Ensembles gehört. Die andere Hypothese geht auch aus von der Überlegung, daß Ensembles und nicht die einzelnen Nervenzellen als Einheiten der Wahrnehmung gelten. Die Zugehörigkeit zu Ensembles wird hier über Synchronisierungsaktivitäten postuliert. Da solche merkmalspezifischen Synchronisationsphänomene in der Regel einhergehen mit oszillatorischen Aktivitäten im Bereich von 40 Hz wird vermutet, daß auf diesem Wege der Kohärenzeffekt wirksam wird (Singer, 1999, Zeitungsartikel, nicht zitierbar, ersetzen, Lucas Turin (Name ?) hat die Theorie aufgestellt, daß unser Geruchssinn das Schwingungsverhalten der Moleküle verarbeitet; Literatur noch suchen; im Netz nichts gefunden). Nicht nur die Verarbeitung und Speicherung von Informationen ist ein Problemfeld mit vielen Unbekannten sondern auch dasjenige wie Gedächtnisinhalte wieder abgerufen werden. Eine Möglichkeit wäre, daß kohärente Beziehungen zwischen den sensorischen Reizen und neuronalen Strukturen herausgebildet werden. Eine solche Erklärung ist jedoch nicht hinreichend, denn auch ohne die Aufnahme sensorischer Reize können wir uns selbst Fragen stellen, zu deren Beantwortung Gedächtnisinhalte abrufen werden müssen. Die Architektur der Speichersysteme ist unbekannt. Das Prinzip der Selbstverstärkung wäre eine mögliche Erklärung. Auch die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Hirnarealen und ihre funktionale Verknüpfung liegt weitgehend im Dunkeln. Neuere Untersuchen begründen die Hypothese, daß neuronale Erregungen eine Zeitstruktur besitzen (von Malsburg, noch suchen). Im Widerspruch zu diesem geringen Erkenntnisstand steht der Umfang der Literatur zum Gedächtnis. Es ist kaum mehr leistbar, über alle Theorien, Experimente und deren Ergebnisse zu referieren. Dies ist primär ein quantitatives Problem. Ein quantitatives und qualitatives Problem stellt sich, wenn man die Ergebnisse der Gedächtnisforschung hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf einen Gestaltungsbereich untersuchen will. Deshalb macht es wenig Sinn, Gedächtnismodelle und Theorien an dieser Stelle zu diskutieren. Wir wollen uns dieser Dilemmasituation in der gleichen Weise entziehen, wie es beispielsweise die Physik schon lange praktiziert. Die Physik versucht nicht Kraft zu beschreiben bzw. zu erklären. Sie hat lediglich definiert, wie Kraft gemessen wird. Mit dieser Meßvorschrift besteht eine Verständigungsbasis die ausreichend ist um das Phänomen Kraft in der Wissenschaftssystematik zu verankern. Als Meßvorschrift für unser zentrales Nervensystem könnte man dessen Leistungsfähigkeit festlegen. Hierzu benötigen wir eine angemessene Sprachsystematik, um die Leistungsdaten beschreiben zu können. Eine solche Sprachsystematik bietet die Literatur zur Gedächtnisforschung hinsichtlich Strukturen und Prozesse durchaus, wenn man sich beschränkt auf die Dokumentation von Leistungsdaten und die Strukturen und Prozesse als hypothetische Artefakte begreift. Die Leistungsfähigkeit könnte dann über Merkmale, die in solch einer Sprachsystematik eingebettet sind, weiter aufgeschlüsselt werden. 5.1 Gedächtnismodelle Der Modellierung des Gedächtnisses ist in den letzten Dekaden umfangreiches Schrifttum gewidmet worden. Es existieren eine Vielzahl von Modellen und Modellvarianten. Am erfolgreichsten war das in den 60iger Jahren entwickelte Mehr-Speicher-Modell. In den 70iger Jahren wurde ein Ansatz entwickelt, der von unterschiedlichen Ebenen der Verarbeitungstiefe ausgeht. Beide Modellierungsansätze wollen wir hier kurz vorstellen mit der oben zkizzierten Absicht, Begrifflichkeiten für hypothetische Artefakte einzuführen, die es später erleichtern, sowohl die Erkenntnisse empirischer Forschung als auch daraus abgeleitete Gestaltungsaussagen sachgerecht einzuord- 36 nen. Konstrukte wie "Sensorische Speicher, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis" wollen wir nicht als physisch verortbare Einheiten begreifen, sondern als Funktionalitäten, die in spezifischen Tätigkeiten benötigt werden. Stand der Forschung sind beide Ansätze nicht mehr. Die Gedächtnisforschung versucht nunmehr Prozeßtypen beim Enkodieren und beim Abrufen von Informationen zu elaborieren und zu klären, welche Informationen diese Prozesse benutzen (Engelkamp, 1994). Mit Enkodierung wird die Phase des Gedächtnisprozesses umschrieben, in der die Informationen in eine Form transferiert werden, die eine Speicherung erlaubt. Anderson (1990) schlägt vor, die Analyse menschlicher Kognition nicht über die Beschreibung der Komponenten und Prozesse vorzunehmen, sondern über Rationalitätsannahmen. "The cognitive system operates at all times to optimize the adaption of the behavior of the organism". (Anderson, (1990), S. 28). 5.1.1 Mehrspeichermodell In den sechziger Jahren begann der verstärkte Einsatz von Computer in der Wissenschaft, Technik und Verwaltung. Die Computer besaßen einen zentralen Prozessor, der für die Steuerung aller Aktionen zuständig war, und für die damaligen Verhältnisse mächtige Speichermedien, die die Bereitstellung der Daten leistete. Psychologen entdeckten dann eine Ähnlichkeit zwischen dieser Struktur und dem Gedächtnismodell von William James (Parkin, 1993). Dieser hatte bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein primäres Gedächtnis und ein sekundäres Gedächtnis postuliert. Das primäre Gedächtnis wurde als Bewußtsein unterstützend konzeptualisiert, während das sekundäre Gedächtnis als Speicherort für die Vergangenheit beschrieben wurde. Primäres Gedächtnis hatte somit CPUFunktionalität und das Sekundäre Gedächtnis entsprach der Datenbasis. Das Mehrspeichermodell von Atkinson & Shiffrin (1968) und das Informationsverarbeitungs-Paradigma sind Ergebnisse dieser Bewegung. Der Mensch wird als ein Informationsverarbeitungs-System begriffen. Das Verhalten und die Leistung dieses Systems basieren auf interne Informationsflüsse, die durch spezifische Programme gesteuert werden. Die Ablaufkontrolle obliegt dabei einem zentralen Prozessor. Dieser Prozessor wird als Gedächtnis bezeichnet. Er ist in der Lage, Repräsentationen zu speichern und bei Bedarf wieder zur Verfügung zu stellen. Diese Grundannahme führt dann auch zu der Postulierung einer funktionalen Äquivalenz zwischen menschlicher Kognition und der Informationsverarbeitung durch den Computer. Das Mehrspeichermodell unterscheidet die Komponenten Sensorische Speicher, Kurzzeitspeicher und Langzeitspeicher. Zwischen KZS und LZS besteht eine enge Interaktion. Der LZS liefert auch Inhalte zum sensorischen Speicher. Die über die Sensoren aufgenommenen Informationen gelangen zuerst in den sensorischen Speicher. Sein Inhalt ist flüchtig. Seit den Experimenten von Sperling sowie Howell & Dawin wird die kurzfristige Speicherung visueller und auditiver Informationen dem ikonischen bzw. dem auditiven Gedächtnis zugewiesen. Von den sensorischen Speichern gelangt die Information in den KZS. Dieser Speicher ist der zentrale Ort kognitiver Aktivität. Der Transfer vom KZS in den LZS ist u.a. abhängig von der Anzahl der Wiederholungen. Unter welchen Bedingungen sich Gedächtnisinhalte langfristig konsolidieren, ist noch unbekannt. Mit Sicherheit kann angenommen werden, daß die dafür zuständigen Prozesse zeitabhängig sind und die Anzahl der Wiederholungen eine bedeutsame Variable darstellen. Jedes dieser Speichersysteme benötigt einen speziellen Code, in dem die Informationen gespeichert werden. Wörter beispielsweise haben drei unterschiedliche Enkodierungsdimensionen, die als Grundlage zur Generierung eines entsprechenden Speicherkodes dienen können: Orthographische Dimension ⇒ Muster der Buchstaben Phonologische Dimension ⇒ der Klang des Wortes Semantische Dimension ⇒ die Bedeutung des Wortes. 37 In der Literatur wird dem Kurzzeitgedächtnis ein phonologischer Kode und dem Langzeitgedächtnis ein semantischer Kode zugewiesen bzw. werden die beiden Kodierungsformen zur Differenzierung dieser Gedächtniskomponenten herangezogen. Wie Parkin (1993) mit Recht feststellt, ist eine derartige Zuweisung von Kodierungsformen zu einfach. Sollte diese Theorie richtig sein, würden wir nichts unmittelbar verstehen können. Unsere Alltagserfahrung lehrt uns das Gegenteil. Wir können auch nur im "Geiste" sprechen ohne unseren Sprachapparat zu bemühen und ohne unser Kurzzeitgedächtnis über sensorische Reize zu initialisieren. Schwierig ist dabei nur die Identifikation der eigenen Stimme. Da wir im gesunden Zustand aber nur mit einer Stimme mit uns selber sprechen können, stellt sich dies nicht als Problem dar. Engelkamp (1994) stellt zwei grundlegende Schwächen der Mehrspeicher-Modellierung heraus. Die Metapher "Speicher" assoziiert eine räumlich getrennte Organisation von Speichereinheiten und eine feste Bindung von Informationszuständen an diese Komponenten. Deren Leistungen werden beschrieben über Kapazitäten und Haltedauer. Weder der Typ der gespeicherten Information findet in diesem Ansatz Berücksichtigung noch fließt der Stand der Erkenntnis aus der Neurophysiologie ein. Diese hat in vielfältiger Weise dokumentiert, daß Informationen an neuronale Strukturen gebunden sind, die im Cortex weit verteilt liegen und deren Zustände variieren können. Des weiteren postuliert das Modell nur einen Weg der Informationen durch das Gedächtnis, nämlich zwischen dem Langzeitspeicher und dem Kurzzeitspeicher. Das Modell sieht nicht vor, daß Veränderungen der Informationen durch die Prozesse selbst erfolgen können. 5.1.2 Ebenen der Verarbeitungstiefe Das modulare Konzept von Gedächtnisstrukturen hat den Vorteil, mit Modulen zu arbeiten, die in ihrer Konzeptualisierung gut verständlich sind und zu pragmatischen Aussagen und Begründungen herangezogen werden können. Dem gegenüber steht der Nachteil, daß die spezifizierten Module letztendlich hypothetische Konstrukte sind, die die Komplexität menschlicher Informationsverarbeitung auf ein mechanisches Modell reduzieren. Geht man von der Annahme aus, daß für die Verarbeitung neuer Informationen andere Komponenten zuständig sind als für bereits existierende Gedächtnisinhalte, bietet der Ansatz der unterschiedlichen Ebenen der Verarbeitungstiefe von Craik & Lockhart (1972) einen alternativen Zugang zur Betrachtung menschlicher Informationsverarbeitung. Dieser geht von der grundlegenden Annahme aus, daß unterschiedliche Typen der beim Lernen eingesetzten Enkodierungsprozesse existieren. Hier steht die Prozeßbetrachtung und die Flexibilität und Dynamik der Informationsverarbeitung im Vordergrund des Interesses. Auch dieser Ansatz von Craik & Lockhart (1972) geht wie das Mehrspeicherkonzept von einer stufenweisen Verarbeitung der Informationen in einer Richtung aus. Verdienst dieses Ansatzes ist, zwischen unterschiedlichen Prozessen und Informationstypen beim Enkodieren zu differenzieren (Engelkamp, 1994). Die Gedächtnisleistung wird nicht mehr abhängig gesehen von den Eigenschaften der Speicher sondern als Folge der Prozesse, die beim Enkodieren stattfinden. Craik & Lockhart betrachten die Enkodierprozesse als ein Kontinuum unterschiedlich tief agierender Mechanismen. Ausgehend von der orthographischen (strukturellen) Kodierung über die phonemische bis hin zur semantischen Kodierung als tiefste Ebene der Verarbeitung steuert ein zentraler Prozessor mit begrenzter, jedoch flexibler Kapazität die Verarbeitung. Auf jede dieser Ebenen werden die spezifischen Informationen eines Ereignisses, nämlich die strukturellen, phonemischen und semantischen verarbeitet. Je tiefer die Verarbeitung um so besser die Retentionsleistung. Diesem Ansatz liegt eine sogenannte Entsprechungsannahme zugrunde (Parkin, 1993), die eine direkte Abhängigkeit der offensichtlichen Anforderungen einer Aufgabe mit der Verarbeitungstiefe postuliert. Danach wäre beispielsweise die Auswahl des Menüpunktes "ZOOM" für einen geübten Benutzer eine Aufgabe, die auf der orthographischen Ebene abgewickelt wird, während für den ungeübten 38 Benutzer eine semantische Verarbeitung notwendig wäre. Phänomene wie der Stroop-Effekt, wo bei der Betrachtung eines Wortes auch gleichzeitig die Bedeutung bewußt wird, laufen der Entsprechungsannahme zuwider. Das revidierte Modell von Craik & Tulving (1975) verzichtet dann auch auf die Annahme serialer Abläufe durch die Ebenen und läßt auch die Verarbeitung auf einer oder auch mehreren Ebenen zu. Die bei ihren Experimenten ermittelten längeren Bearbeitungszeiten bei Orientierungsaufgaben mit semantischen Anforderungen gegenüber solchen nicht-semantischen Typs führten zu der Annahme, daß die Verarbeitungszeit ein geeignetes Tiefenmaß für die Verarbeitungsstufen darstellen könnte. Diese Annahme konnte jedoch experimentell nicht nachgewiesen werden. Der Ansatz der Ebenen unterschiedlicher Verarbeitungstiefe wurde bisher als Theorie nicht verifiziert. Die Erkenntnis jedoch, daß beim Enkodieren vielfältige Variationen zu berücksichtigen sind und Defizite beim Erinnern auf Enkodierungsdefizite zurückzuführen sind, haben sich in der Forschung verfestigt (Parkin, 1993). Des weiteren kann davon ausgegangen werden, daß unterschiedliche Prozeßtypen und Informationstypen zu betrachten sind. Obwohl das Modell keine analytische Trennung dieser beiden Kategorien leistet, ist deren Unterscheidung im Kern vorhanden (Engelkamp, 1994). Prozeßtyp Informationstyp strukturelle Ebene ⇒ sensorischen Oberflächeneigenschaften der Reize phonemische Ebene ⇒ lautliche Reizeigenschaften semantische Ebene ⇒ Reizbedeutung Die Untersuchungen von Craik & Lockhart basierten auf einzelne Lernitems mit deutlich unterscheidbarer Gedächtnisspur. Angenommen werden können aber auch relationale Enkodierprozesse, bei denen die Behaltensleistungen auf einer organisierten Einordnung in vorhandene Gedächtnisinhalte basiert. 5.2 Gedächtnisartefakte Die in den oben genannten Modellen spezifizierten Gedächtniskonstrukte wollen wir im weiteren als Artefakte begreifen und im Sinne einer Systematik für die Zuordnung von Leistungsdaten verwenden. Dort, wo neuere Erkenntniss vorliegen, werden wir die Begrifflichkeiten entsprechend erweitern. 5.2.1 Sensorische Speicher: Iconic memory, Echoic memory Mitte des 18. Jahrhunderts (1740) hat der schwedische Wissenschaftler Segner gezeigt, daß die Leuchtspur eines glühendes Stückchen Kohle auf einem sich drehenden Rad für die menschliche Wahrnehmung ab einer Umlaufzeit von ca. 100 ms als ein geschlossener Kreis erscheint. Dies ist offensichtlich nur deshalb möglich, weil für diese Zeit Informationen bereitgestellt werden können. Neisser (1967) hat hierfür den Begriff "iconic memory" oder ikonischen Speicher eingeführt. Sperling konnte zeigen, daß Buchstaben bis zu 500 msec. gespeichert werden können. (Baddeley, 1997) Das ikonische Gedächtnis ist leistungsfähig hinsichtlich der Informationsmenge die auf einen Blick erfaßt werden kann. Die Informationen verfallen innerhalb der ersten Sekunde. Die Inhalte des ikonischen Speichers sind die Grundlage für alle Orientierungsleistungen. Der kurze Blick auf den Desktop reicht für eine Orientierung aus. Das auditive System verfügt über eine deutlich höhere Speicherdauer. Bei Card, u.a. (1983) werden als Mittelwert für die Verweildauer 1.5 sec. genannt. Das Auflösungsvermögen liegt bei ca. 130 msec. 39 5.2.2 Arbeitsgedächtnis Das Kurzzeitgedächtnis wird auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet. Hiermit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß hier der Ort ist in dem solche Informationen bearbeitet werden, die für den aktuellen Arbeitsprozeß (Handlungsvollzug) benötigt werden. Es gilt als gesichert, daß der präfrontale Cortex eine zentrale Funktion für das kurzfristige Halten (2 bis 3 Sekunden) von Informationen innehat und als ein "multicomponent executive system" begriffen werden kann (Goschke, 1997). Die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses wird in der Literatur immer wieder thematisiert. Die magische Nummer 7 (+-2) von Miller als Kapazitätsmaß wird als Begründung für Gestaltungsempfehlungen zitiert. Baddeley hat in seinen Arbeiten ein modifiziertes Konzept des Arbeitsgedächtnisses begründet, indem er belegen konnte, daß das Behalten von Ziffernfolgen und das Lernen von Wortlisten bzw. das Schlußfolgern möglich ist, ohne die Kapazität im Sinne von Miller um die gleichen Anteile zu vermindern. In seinen Experimenten auf der Grundlage des Zweitaufgabenparadigmas mußten die Probanden sowohl Ziffernfolgen reproduzieren als auch Wortlisten lernen bzw. schlußfolgernde Entscheidungen treffen. Er konzeptualisierte funktionsorientierte Subsysteme des Arbeitsgedächtnisses. Das Arbeitsgedächtnismodell besteht aus der artikulatorischen Schleife, einem bildhaft-räumlichen Notizblock und einer zentralen Exekutive (planende und aufmerksamkeitsbezogene Aspekte). Die artikulatorische Schleife wird differenziert in einen phonologischen Speicher (kurzfristige Speicherung - 1.5 bis 2 Sek. - sprachbasierter Informationen) und einen artikulatorischen Kontrollprozeß, der auf einer inneren Sprache basiert. Die Kapazitätsbegrenzung von Miller ist nach diesem Modell lediglich eine Kapazitätsbegrenzung der artikulatorischen Schleife. Der artikulatorischen Schleife wird auch eine bedeutsame Funktion beim Lesen zugewiesen. Die Gedächtnisspanne im phonologischen Speicher kann aufgefrischt werden durch "Auslesen" der Gedächtnisinhalte in den artikulatorischen Kontrollprozeß, der sie wiederum in den Phonologischen Speicher einspeist. Das Aus- und Einlesen wird als subvokales Wiederholen verstanden. Der artikulatorische Kontrollprozeß kann ebensogut geschriebenes Material verarbeiten. Evidenz für dieses Konzept wird abgeleitet aus dem Tatbestand, daß die Bereitstellung von Inhalten aus dem Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt wird durch die Ähnlichkeit des Stimulusmaterials hinsichtlich Klangbild bzw. Aussprachecharakteristik. Ähnliche Informationen werden danach ähnlich kodiert, so daß sich die Diskrimination dann bei der Bereitstellung entsprechend schwieriger darstellt. Batteley (1997, S. 53) berichtet von einem Experiment, bei dem 9 visuell dargebotene Zahlen wiederholt werden mußten. Die Präsentation erfolgte einmal ohne Störung und mit einer Störung. Die Störung bestand einmal aus gesprochenen Wörtern und einmal aus nonsens Silben. Bei beiden Störungen war die Leistung gegenüber der ohne Störung gleich stark beeinträchtigt. Dieses Ergebnis wird als Begründung für die Annahme herangezogen, daß im KZG lauthaft enkodiert wird. Gleiche Leistungseinbußen wurden auch mit Musik als Störung erzielt. Dabei hatten instrumentelle Musikstücke den geringsten Einfluß. Dies bedeutet, daß bei Tätigkeiten, die das Arbeitsgedächtnis belasten, Hintergrundgeräusche mit Bedeutung Kapazität binden und Leistungseinbußen in Kauf genommen werden müssen. Wenn angenommen werden kann, daß die Gedächtnisinhalte nach einer bestimmten Zeit zerfallen, wird die Spanne bestimmt durch Anzahl der Wörter, die vor dem Zerfall wieder aufgefrischt werden können. Dieser Prozeß ist abhängig von der Geschwindigkeit des Zerfallprozesses, der Zeit für die Artikulation jedes Items und der Zeit für die Auffrischung selbst. Untersuchungen belegen, daß die Gedächtnisspanne von Sprache zu Sprache unterschiedlich ist. Allgemein gilt, daß die Gedächtnisspanne bestimmt wird durch die Anzahl der Item, die in zwei Sekunden artikuliert werden können. Millers magische Nummer 7 muß also in Abhängigkeit von sprachlich unterschiedlichen Kulturkreisen neu bestimmt werden. 40 Eine sehr dicht an den neurologischen Erkenntnissen anlehnende Konzeptionierung des Arbeitsgedächtnisses liefert (Logie, 1995). 1. Das Arbeitsgedächtnis ist ein vom LZG separater Speicher, der temporären Speicher für visuelle und räumliche Informationen bereitstellt. Zwischen beiden Speichern findet ein Informationsaustausch statt. 2. Visueller und räumlicher Speicher werden als kognitive Prozesse begriffen. Der visuelle Prozeß verarbeitet die visuellen statischen Muster. Der Prozeß ist eng verbunden mit der visuellen Wahrnehmung, beide sind aber unterschiedlich. Er bezeichnet diesen Prozeß als "visual cache". Das räumliche Arbeitsgedächtnis verarbeitet die Informationen über Bewegungen und Bewegungssequenzen und ist eng verbunden mit der Kontrolle physikalischer Aktionen. Er bezeichnet diesen Prozeß als "inner scribe". Dieser Prozeß sorgt für das Redrawing der Informationen des visual cache. Des weiteren sorgt er für die Auffrischung, Manipulation und Transformation visueller und räumlicher Informationen 3. Die Informationen des sensorischen Inputs werden nicht direkt dem visual cache bzw. inner scribe zugeführt sondern in Form von Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis. Diese Repräsentationen werden vom LZG bereitgestellt und im KZG temporär gehalten und ermöglichen die Handlungssteuerung. Aufmerksamkeit ist ein weiteres Artefakt, welches im Kontext des Arbeitsgedächtnisses und Handlungsvollzugs betrachtet werden muß. Aufmerksamkeit ist etwas was man mehr oder weniger hat, wenn man etwas tut. Es können mentale Prozesse sein, welche für die bewußte Verarbeitung sensorischer Informationen in das Arbeitsgedächtnis zuständig sind. Aufmerksamkeit kann auch eine besondere Prozeßform (siehe hierzu die Ausführungen unter 3.1 unter Bezugnahme auf Roth, 1998) bzw. die Konsequenz von Informationsverarbeitung sein. Hieraus resultiert auch die Auffassung, daß Aufmerksamkeit nicht trainiert werden kann. Trainieren kann man nur die gleichzeitige Ausführung bestimmter Tätigkeiten wie Klavierspielen und eine Unterhaltung führen, etc. (Hirst & Pinner, 1996) Bisher hat die Forschung dem Beziehungsverhältnis zwischen Aufmerksamkeit und Handlung wenig Bedeutung zugemessen (Neumann, 1990). Wenn Aufmerksamkeit thematisiert wurde, erfolgte dies im Kontext des Informationsverarbeitungsansatzes. Aufmerksamkeitsprozesse wurden angesehen als Vorgänge, die in gerichteter und selektiver Weise (Lurija, 1992) den Informationsfluß für die weitere Verarbeitung modifizieren. Zentrale Frage war, wo in den Verarbeitungssequenzen die Selektion stattfindet. Diese Frage wurde kontrastiert mit den Schlagworten späte und frühe Selektion. Späte Selektion bedeutet, daß die Informationsaufnahme bereits abgeschlossen ist bevor der Selektionsprozeß beginnt, während frühe Selektion bereits vor der kompletten Informationsanalyse einsetzt. Beide Positionen gehen von der Annahme aus, daß die Verarbeitungskapazitäten limitiert sind. Neurophysiologische Erkenntnisse belegen die Theorie einer frühen Selektion. Aufmerksamkeitsmodulation der Zellaktivitäten erfolgt bereits im primären Cortex. Dies sowohl hinsichtlich räumlicher als auch sonstiger Eigenschaften (hier Leuchtdichte) des Stimulusmaterials (siehe hierzu Treue, S. & Maunsell, J. H. R., 1999). Der Ansatz handlungsbezogener Aufmerksamkeitsselektion eröffnete eine modifizierte Sichtweise. Es wird von einer funktionalen Beziehung zwischen limitierter Kapazität und aufmerksamkeitsbezogener Selektivität ausgegangen. Danach ist das grundlegende Charakteristikum von Aufmerksamkeit nicht die begrenzte Kapazität sondern die Selektivität. Erst die Selektivität begründet, warum die Kapazität limitiert ist. Selektive Aufmerksamkeit existiert, weil zwischen möglichen Handlungsalternativen entschieden werden muß und nur die Informationen benötigt werden, die zur Handlungsregulation erforderlich sind. Insofern wird Selektivität als ein mächtiges Instrument und Produkt menschlicher Evolution betrachtet. Visuelle Aufmerksamkeit und auditive Aufmerksamkeit unterliegen unterschiedlichen Wirkungsmechanismen, da die zugrundeliegenden physiologischen Systeme verschiedene Verarbeitungsmechanismen aufweisen. Die Augen sind hoch mobil. Optische Informationen sind räumlich strukturiert und sind aus allen Bereichen entsprechend beleuchteter Umgebung aufnehmbar. Akustische Informationen sind zeitlich begrenzte Ereignisse, die entsprechende Schallwellen produzieren. Zwei Selektionstypen bzw. Selektionsprobleme werden elaboriert: 1. Selektion zwischen alternativen Handlungen: Hier geht es um die Selektion der zur Handlung benötigten Effektoren. Es liegt biologische Evidenz vor, daß wir nur eine Handlung zur gleichen Zeit ausführen können. Es können zwar "dual 41 tasks" zur gleichen Zeit ausgeführt werden, die Ausführung wird aber kontrolliert durch nur einen gemeinsamen Aktionsplan. Zusätzliche Selektionsprobleme entstehen durch die Aufnahme von Informationen aus der Umgebung. 2. Selektion zwischen der Art und Weise der Handlungsausführung: Hier geht es um die Parameterselektion für die konkrete Handlungsausführung. Auch hierfür werden Informationen aus der Umgebung selektiert. Sensorische Aufmerksamkeit existiert auch ohne mögliche Handlungen. So ist experimentell nachgewiesen, daß visuelle Aufmerksamkeit gewechselt werden kann ohne Augenbewegungen (Neumann, 1990, S 231). Um eine interne Repräsentation der Umgebung aufzufrischen bzw. neuen Umgebungsbedingungen anzupassen, ist ebenfalls eine Selektion ohne Handlung notwendig, da nicht alle Informationen effektiv verarbeitet werden können. 5.2.3 Langzeitspeicher Umfangreiche psychologische Theorien haben in den letzten Jahrzehnten eine Unterscheidung in Lang- und Kurzzeitgedächtnis beschrieben. Die Differenzierung erfolgte über Enkodierungstyp, Speicherdauer, Reaktionszeiten, etc. Nimmt man die Lokation als weiteres differenzierendes Merkmal auf, so wird deutlich, warum das Mehrspeicherkonzept sich erfolgreich etabliert hat. Üblicher Weise wird dem KZG phonetische Kodierungsform und dem LZG eine semantische Kodierungsform zugewiesen. Die Kodierungsform als Begründung für eine Differenzierung nach Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis heranzuziehen, wird von Baddeley als zu einfach beurteilt. Er begründet eine mehr prozeßorientierte Betrachtung (Baddeley, 1997). Der Zugang zum Langzeitgedächtnis erfolgt nach vorherrschender Lehrmeinung über das Kurzzeitgedächtnis. Der Übertragungsmodus kann bewußt oder unbewußt sein. Das LZG verfügt über eine unbegrenzte Kapazität und Speicherdauer. Der durchschnittliche College-Student mit einem Alter von ca. 20 Jahren kennt die Bedeutung von ca. 100.000 Wörtern. Dies bedeutet, daß er von seinem 2. Lebensjahr an täglich ca. 15 Wörter gelernt hat. Die meisten Wörter wurden durch Lesen erworben. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, daß nur ca. 20 % der geschriebenen Wörter auch in der sprachlichen Kommunikation eingesetzt werden (Landauer & Dumais, 1996). Roth (1998) kommt zu der Feststellung, daß der durchschnittliche Erwachsene über einen Sprechwortschatz von ca. 10.000 Wörter verfügt und mehr als 1.000 grammatikalische Regeln verwendet. Der überwiegende Anteil der Regeln wird jedoch unbewußt angewandt. Tulving konzeptualisierte drei unterschiedliche Typen des Langzeitgedächtnisses. Episodisch: (Auto-noetisch, auf das Selbst bezogene Wissen, die Speicherung von Erfahrung) Es erfolgt ein bewußter Zugang zum Gedächtnis über Geschehnisse, die wir schon einmal erfahren haben. Dabei können wir uns an Ereignisse erinnern ohne dabei auf Informationen zugreifen zu können, warum wir es wissen. Semantisch: (Noetisch, Wissen und Erkenntnis betreffend, aus der Erfahrung gewonnenes Wissen) Bewußter Zugang zum Gedächtnis möglich aber nicht unbedingt erforderlich. Erlaubt dem Menschen die Konstruktion mentaler Modelle der realen Welt. Prozedural (Anoetisch, nicht erkennend). Es ist kein bewußter Zugang möglich. Es sind die Grundlagen unserer motorischen Fähigkeiten. Eine derartige Typisierung darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß zwischen den Komponenten vielfältige Wechselwirkungen bestehen. Wie Parkin (1993) mit Recht feststellt, leitet sich unser gesamtes Wissen von Erfahrungen bzw. Lernereignissen ab. Dabei ist es durchaus denkbar, Inhalte aus dem episodischen Gedächtnis abzurufen ohne eine Erinnerung des Ereignisses selbst leisten zu können. "So besteht die Möglichkeit, daß die Bedeutung eines neu erworbenen Wortes anfänglich nur unter Rückgriff auf einen episodischen Gedächtnisinhalt zuverlässig erinnert werden kann, der den semantischen Gehalt des Wortes bestätigt. Nach einiger Zeit wird die Wortbedeutung in das semantische Gedächtnis aufgenommen, so daß dem episodischen Gedächtnisinhalt keine weitere semantische Bedeutung zukommt. Das Faszinierende an diesem System ist, daß das Wissen über die Welt irgendwann unabhängig von den Ereignissen repräsentiert werden kann, die 42 ursprünglich die Basis für den Wissenserwerb waren. Indem die Repräsentationen von Wissen nicht notwendigerweise mit den Lernereignissen verbunden bleiben muß, wird eine erhebliche ökonomische Speicherung ermöglicht, da der Ballast der Erinnerungen an die Ereignisse an sich abgeworfen werden kann." (Parkin, 1993, S. 43) Das Schreiben auf der Tastatur ohne Blickkontakt ist ein Beispiel, welches Parkin selbst anführt. Es kann angenommen werden, daß zu Beginn der Übung ein mentales Abbild der Tastatur mit den Positionen der einzelnen Tasten erlernt worden ist. Mit zunehmender Übung wird dieses Abbild nicht mehr benötigt und geht verloren. Die Aneignung von prozeduralen Fertigkeiten ist jedoch auch ohne bewußte Prozesse dieser Art möglich. Ich wundere mich immer wieder, wie ich blind die Tasten von bestimmten Buchstabenübergängen treffe, ohne jemals ein (bewußtes) mentales Modell der Tastaturpositionen aufgenommen zu haben. Denkbar wäre aber auch, daß nie ein mentales Abbild bestanden hat bzw. notwendig ist, sondern lediglich Buchstabenübergänge, Fingerposition oder Bewegungsabläufe gelernt worden sind, die solch einen automatisierten Prozeß ermöglichen. Die Annahme von drei Komponenten des Langzeitgedächtnisses ist durchaus plausibel, wie man an den Antworten (Gedächtnisinhalte) für die nachstehenden Fragen erkennen kann: 1. Wann haben sie zuletzt mit MS-Office gearbeitet? 2. Was ist MS-Office? 3. Wie benutzen Sie MS-Office? Die Beantwortung der ersten Frage erfordert eine Reflexion der persönlichen Arbeitssituation und das Erinnern an eine Episode. Die zweite Frage zielt nicht ab auf eine Situation, sondern auf gemachte Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind "bedeutungsvoll" gespeichert (semantische Strukturen) und müssen auf die Frage bezogen abgerufen werden. Die Frage drei kann nur für konkrete Tätigkeitsabläufe beantwortet werden, so daß letztendlich Prozeduren erinnert werden müssen. Hieraus jedoch zu schlußfolgern, daß zur Beantwortung der Fragen drei unterschiedliche Gedächtnistypen resultieren - episodisch, semantisch, prozedural - ist nicht zwingend und konnte bisher experimentell auch nicht nachgewiesen werden (Parkin, 1993). Unstrittig ist lediglich, daß prozedurales Wissen unabhängig von bewußt zugänglichen Gedächtnisstrukturen ist und das im klinischen Bereich (amnestische Patienten) eine Fülle von Beispielen gibt, bei denen prozedurale Gedächtnisstrukturen noch funktionierten aber episodische und semantische Gedächtnisinhalte nicht mehr gebildet werden konnten. Angesicht der fließenden Übergänge zwischen episodischen und semantischen Gedächtnisinhalten erscheint eine Differenzierung nach deklarativen (episodisch, semantisch) und prozeduralen Strukturen sinnvoller (Squire, 1987). Diese Unterscheidung hat den Vorteil, daß sie auch mit unserer Alltagserfahrung übereinstimmt. Wir unterscheiden nach Dingen bzw. Sachverhalten, über die wir etwas wissen, und Prozeduren, die wir können. Oder anders ausgedrückt: "über etwas wissen" und "etwas können" macht einen großen Unterschied. Hirst & Pinner (1996) plädieren für eine Unterscheidung des LZG nach "memory images" gleich Fakten und "memory beliefs" gleich Ereignisse, die den memory images assoziiert werden. Eine solche Unterscheidung erklärt nicht, wie oben bereits ausgeführt, die offensichtliche Abkopplung von Lernereignis und Wissenselement. Für die enorme Speicherfähigkeit von Bildern wird die Versuchsreihe von Standing, Conezio & Haber (1973) gern herangezogen. In Kenntnis der Prozedur, relativiert sich das Ergebnis. 2.560 Farbbilder wurden den VP`s jeweils für 10 Sekunden gezeigt. Die Leistungsfähigkeit wurde in der Weise getestet, daß jeweils 2 Bilder (ein neues und eines aus dem Set von 2.560) verglichen werden mußten unter der Fragestellung: Welches dieser Bilder haben Sie schon einmal gesehen? Ca. 90% der Bilder wurden nach einigen Tagen noch "Wiedererkannt". Es ist offensichtlich, daß hier nicht gesamte Bilder verglichen wurden, sondern nur einzelne Merkmale der Bilder wiedererkannt wurden. 43 5.3 Leistungsdaten Es gibt wenig Erkenntnisse zur menschlichen Informationsverarbeitung, die eine hohe Allgemeingültigkeit und Faktizität haben. Auch die Gesetze von Weber, Hick und Fitt haben keinen Erklärungswert und sind theoretisch nicht begründbar, beschreiben aber die nachstehenden Artefakte bzw. Phänomene recht zuverlässig. Weber-Fechner: Zusammenhang zwischen Wahrnehmungsstärke und physikalischer Reizstärke. Webersches Gesetz: ∆S/S = k; das Verhältnis von Empfindungsunterschied ∆S zu einem Standardreiz S ist konstant. Die Unterscheidungsschwelle zweier Reize mit gleicher Dimension und Modalität ist ihrer absoluten Stärke proportional. Der Weberbruch kann als eine Konstante begriffen werden, die die Auflösungsfähigkeit eines Sinnessystems beschreibt. Als Weber-Fechnersche Gesetz gilt die Beziehung: Empfindungswert E = c logE +C , wobei c von der Weberschen Konstanten und C von der absoluten Wahrnehmungschwelle für diese Modalität abhängt. Hick: Die Reaktionszeit wächst linear mit dem Logarithmus der Anzahl von Auswahlentscheidungen. Hick-Hyman-Gesetz: Reaktionzeit = c + k log2 b; wobei c und k Konstanten darstellen und b die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten beschreibt. Fitt: Zusammenhang zwischen Bewegung (Weg, Genauigkeit) und Zielgröße. Bewegungszeit zu einer Zielgröße= IM * log2 (2D/S) wobei IM eine informationstechnische Konstante (Signalübertragungszeiten und Aufgabenschwierigkeit) darstellt, D die Entfernung zum Ziel und S die Breite des Ziels beschreibt. Experimente mit Probanden zum Aufbau, zur Funktionalität und Leistung des Gedächtnisses durchzuführen, stehen u.a. vor dem grundsätzlichen Problem, daß nicht exakt festgestellt werden kann, mit welchen unterschiedlichen Gedächtnisinhalten die Probanden ausgestattet sind und somit Gedächtnisleistungen stärker durch das Vorwissen denn durch die Bedingungen der Experimentalprozedur beeinflußt werden. Um diese Störvariable auszuschalten, hat es Tradition in der Gedächtnisforschung mit "künstlichem" Material zu arbeiten. Hermann Ebbinghaus hat bereits 1885 in seinem Werk "Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie" gezeigt, wie man mit einfachen Experimenten diese Schwierigkeit überwinden kann. Er wählte als Gedächtnismaterial Buchstabenkombinationen ohne semantischen Gehalt. Eine innovative Methode zu Beginn der Gedächtnisforschung. Den Methoden und Ergebnissen solcher Forschungsbemühungen kann jedoch keine ökologische Validität zugesprochen werden. Es wird zu sehr von der realen Lebenssituation abstrahiert und es mangelt an ökologischer Validität, so daß die aus den Situations-, Kontext- und Inhaltsvarianten abgeleiteten Gedächtnisstrukturen und Prozessen keine allgemein gültigen Erkenntnisse begründen. Neisser kommt zu der Auffassung, daß auch in weniger elaborierter Form derartige Erkenntnisse auch über unsere allgemeine Lebenserfahrung zugänglich sind. Die Erfassung von Gedächtnisleistungen aus realen Arbeits- und Lebenssituationen ist jedoch problematisch, wie Parkin (1993) am Beispiel der Zeugenaussagen von John Dean zum Watergate-Skandal exemplifiziert. Dean beeindruckte durch umfangreiches Faktenwissen. Die Auswertung von heimlich aufgenommenen Tonbandaufnahmen von den berichteten Situationen belegten aber, daß eine Fülle von Details durch Dean falsch wiedergegeben wurden. Dean hatte keine Falschaussagen gemacht, sondern die Ereignisse in seinem situativen Kontext für ihn positiv gespeichert und wiedergegeben. Erinnert werden also nicht Fakten der realen Situation und Ereignisse, sondern die gespeicherten Gedächtnisinhalte oder deren Reinterpretation im entsprechenden Kontext. Unabhängig von dieser grundsätzlichen Problematik sind Erkenntnisse aus der Literatur auf konkrete Gestaltungsaussagen nur dann anwendbar, wenn die jeweiligen Ausprägungen der für die Gedächtnisleistungen unab- 44 hängigen Variablen bekannt sind. Als unabhängige Variable können genannt werden: (siehe hierzu auch Searleman, A. & Herrmann, D. (1994): Organismische (Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Motivation); Allgemein situative (Schlafdauer, Alkohol, Belohnung der Probanden); Aufgabenbezogene (Instruktionen, Stimulusmaterial, Präsentationsform und Dauer, Umgebungsvariablen). Eine weitere Differenzierung müßte nach den beteiligten Prozessen wie Wahrnehmung bzw. Informationsaufnahme, Speicherung, Erinnern (Informationsbereitstellung) erfolgen. Dieser durch pragmatische Variablen und phänomenologische Prozesse umrissene Problemraum zeigt die Dimensionalität auf, in der Erkenntnisse einzuordnen wären. Ein wenig aussichtsreiches Unterfangen. Die heutige Forschungsproblematik verdeutlicht (Baddeley, 1991, S. 2) mit seiner Feststellung: "Elegant methods are not enough if they limit us to studying trivial questions". Anders ausgedrückt: Je kontrollierbarer die Methode um so größer die Distanz zwischen gewonnen Erkenntnissen und ihrer Verwendbarkeit im Gestaltungszusammenhang. Erkenntnisse zum Gedächtnis entstammen im wesentlichen aus zwei Quellen: Laborexperimente in den einschlägigen Wissenschaftsdisziplinen (Psychologie, Biologie, Physiologie) sowie aus dem klinischen Bereich. Für beide Quellen gilt, daß die dokumentierten Erkenntnisse nur Gültigkeit besitzen im Rahmen der Logik/Methode ihrer Gewinnung. Bei den Laborexperimenten sollten deshalb die Erkenntnisse immer im Zusammenhang mit der Methode und den auszuführende Aufgaben betrachtet werden. Aus dem klinischen Bereich sind es die Defekte von Organen bzw. Organteile, die Aussagen zur Funktion und zu Funktionszusammenhängen begründen. Ausgegangen wird von der Annahme, daß die gesamte Leistung unseres ZNS von zahlreichen funktionalen Komponenten erbracht wird. Die mentalen Funktionen werden bestimmten Modulen zugeordnet. Jedes Modul besitzt funktionale Autonomie. Fallen durch Hirnschädigungen bestimmte Module aus, so erlaubt dies Einblicke in die Organisation des Systems bzw. in die Interaktion zwischen den Modulen. Es ist offensichtlich, daß derartige Erkenntnisse für die Neurophysiologie durchaus einen Fortschritt hinsichtlich des Verständnisses von Gehirnstrukturen und -funktionen begründen können, für die arbeitswissenschaftliche Gestaltung und Beurteilung machen sie wenig Sinn, solange wir von gesunden Akteuren in der Arbeitssituation ausgehen. Angesichts der Fülle von Erkenntnissen aus Experimenten und dem klinischen Bereich werden nachstehend lediglich einige ausgewählte Artefakte aufgeführt, die geeignet erscheinen, die eingangs geforderte Terminologie zur Leistungsbeschreibung zu vervollständigen. Der grundsätzliche Zugang zur Bewertung der Leistung ergibt sich aus den oben angestellten Überlegungen und einer Interpretation der Erkenntnisse in der konkreten Arbeitssituation. 5.3.1 Sensorische Speicher Sperling (1960): Versuchspersonen wurden drei Reihen mit jeweils vier Buchstaben für 50 ms präsentiert. Durchschnittlich wurden 4 bis 5 Buchstaben korrekt erinnert. Folgte der Darbietung ein akustisches Signal, welches die zu reproduzierte Reihe kennzeichnete, konnten im Regelfall die Buchstaben erinnert werden. Voraussetzung war, daß die Zeitspanne zwischen der Buchstabenpräsentation und dem akustischen Signal zur Kennzeichnung der Reihe nicht größer wurde als 500 ms. Dieses Ergebnis ließ die Annahme begründet erscheinen, daß die Personen in der Gesamtaufgabe mehr Informationen aufgenommen hatten, als bei der Reproduktion deutlich wurde. Die Leistungszunahme bei der Teilwiedergabe (partial report advantage) wurde einer Gedächtniskomponente zugeschrieben, die als ikonisches Gedächtnis bezeichnet wurde. Howell & Darwin (1977): Versuchspersonen wurden Phoneme dargeboten. Sie sollten entscheiden, ob zwei ihnen dargebotene Töne dem gleichen Phonem entsprachen. Erhoben wurden die Reaktionszeiten. Die Entscheidungen wurden für akustisch itentische Töne schneller durchgeführt, wenn das Intervall zwischen den beiden Phonemen nicht größer war als 800 ms. Diese Ergebnisse wurden dahingehend interpretiert, daß ein auditives sensorisches 45 Gedächtnis (echoic memory) diese Leistungen möglich machte. Ebenso wie für visuelle Stimuli können perzeptuelle Qualitäten für nur einen kurzen Zeitraum gespeichert werden. 5.3.2 Kurzzeitgedächtnis Baddeley et al. (1975): In den Experimenten konnte belegt werden, daß die Gedächtnisspanne des Kurzzeitgedächtnisses für kurze Wörter größer war als für lange Wörter. Diese Ergebnisse provozierten die Frage, ob dieser Effekt von der Anzahl der Silben oder von der unterschiedlichen Aussprechdauer abhängt. Die Ergebnisse zeigten, daß in der Tat die Gedächtnisspanne für Wörter mit längerer Aussprechdauer weniger Items umfaßte. Dies wurde als weiterer Hinweis gewertet, daß für das Erinnern ein System mit artikulatorischer Natur zuständig ist. Unter der Bedingung artikulatorischer Suppression, die Versuchspersonen mußten dabei eine bedeutungslose Sequenz von Worten sprechen, konnte der Wortlängeneffekt nicht nachgewiesen werden. Die Leistungen bei kurzen Wörtern sanken dabei jedoch auf das Leistungsniveau für lange Wörter. Experimente mit freier Wiedergabe (free recall): Bei dieser Methode werden den Probanden Wörter für ca. 2 Sekunden hintereinander präsentiert. Nach dem letzten Item werden die Probanden aufgefordert, die gezeigten Wörter in beliebiger Reihenfolge zu wiederholen. Die Leistungen waren signifikant abhängig von der Position der Wörter im Darbietungsablauf. Zwei Effekte wurden konstatiert: Der primacy effect und der recency-effect. Mit diesen Effekten wird der Tatbestand umschrieben, daß die ersten und die letzten Wörter besser erinnert werden als die mittleren. In Abhängigkeit vom Untersuchungsdesign treten die Effekte in unterschiedlicher Weise auf. Unter teleologischen Gesichtspunkten kann der recencyeffect durch einen Quotienten ausgedrückt werden (siehe Parkin 1993). Hiernach berechnet sich die Wiedergabewahrscheinlichkeit aus dem Quotienten von "Darbietungsintervall zwischen Items" und "Zeitverzögerungen zwischen Itemdarbietung und Beginn der Wiedergabe". Werden Buchstabengruppe präsentiert, die unterschieden werden müssen, z. B. wechselte AA zu Aa, so benötigten die Probanden ca. 80 msec mehr für diese Unterscheidung (Posner & Snyder, 1980). Die Bereitstellungsdauer liegt bei ca. 2 Sekunden. Die Bereitstellungsdauer der auditiven Komponente liegt bei ca. 2 bis 20 Sekunden. Gesprochene Zahlen lassen sich besser wieder bereitstellen als gelesene. Wird man nach einer mündlichen Telefonauskunft noch mit der Frage konfrontiert: Können Sie das auch behalten? Ist die Erinnerungsleistung bedeutend kleiner als in anderen Fällen. Der Verlust der Informationen im Kurzzeitgedächtnis wird unterschiedlich erklärt. Experimente zeigen Evidenz bezüglich eines Informationsverlustes als Funktion der Zeit als auch als Ergebnis der Überlagerung mit neuen Inhalten. Akustisch vermittelte Zahlen lassen sich besser reproduzieren als gelesene. Wenn die Nummern gruppiert werden und zwischen den Gruppen beim Vortrag kurze Pausen liegen, werden die Reproduktionsleistungen besser. Bei dreier Gruppen werden die besten Leistungen erzielt. Dabei werden die erste und die letzte Gruppe besser erinnert als die mittlere. Phonetisch unterschiedliche Wörter werden besser wiedergegeben als phonetisch ähnliche. Bei der kurzfristigen Wiedergabe verursachte die Bedeutung (Semantik) der Wörter keinen Effekt. Nach einer Pause verschwindet der phonetische Effekt und semantisch ähnliche Wörter werden schlechter reproduziert als semantisch verschiedene. Anzumerken bleibt, daß die Leistungsangaben zum Kurzzeitgedächtniss sich jeweils auf Informationen ohne Bezug zu Inhalten des Langzeitgedächtnisses beziehen. So kann es auch im Prinzip durch Übung keine Kapazitätserweiterung des Kurzzeitgedächtnisses geben. Leistungssteigerungen sind im Regelfall durch die Verknüpfung von Stimulusmaterial mit Gedächtnisinhalten des Langzeitgedächtnisses zu erzielen (Baddeley, 1991). 46 5.3.3 Enkodierung Conrad (1964); Baddeley (1966): Bei diesen Versuchsreihen ging es darum, phonologisch ähnliche oder unähnliche Buchstabenkombinationen rückwärts in der korrekten Reihenfolge wiederzugeben. Leicht verwechselbare Buchstabenkombinationen waren dabei schwerer zu erinnern als deutlich unterscheidbare. Diese Ergebnisse belegen, daß Personen beim unmittelbaren Erinnern von Wörter dies auf der Basis eines phonologischen Kodes erbringen. Baddeley konnte den gleichen Effekt mit phonologisch ähnlichen Wortsequenzen nachweisen. Bei verzögerter Wiedergabe von phonologisch und semantisch ähnlichen Sequenzen hatte die phonologische Ähnlichkeit keine Auswirkungen während die semantisch ähnlichen Wortsequenzen erheblich schlechter erinnert wurden als neutrale. Craik & Tulving (1975): In den Experimenten zur Bestätigung des Ansatzes unterschiedlicher Ebenen der Verarbeitungstiefe konnten die Autoren nachweisen, daß Orientierungsaufgaben mit semantischer Verarbeitungstiefe zu besseren Gedächtnisleistungen führten als nicht-semantische. In einen Satz mit einer Wortlücke ein sinnvolles Wort einzusetzen führt zu besseren Leistungen als Entscheidungen über die Zugehörigkeit eines Wortes zu einer Kategorie. Die Wort-Satz-Paßaufgaben erfordern nach Ansicht der Autoren eine umfassend elaborierte Gedächtnisspur (Elaborationseffekt), so daß derartige Verarbeitungen auf den semantischen Bereich angewiesen sind. Ein weitere Phänomen wird als Kongruenzeffekt bezeichnet. Bei Orientierungsaufgaben, die eine Ja-Antwort erforderten, waren die Leistungen signifikant besser als bei solchen, die eine Nein-Antwort notwendig machten. Am ausgeprägten war dieser Effekt bei Aufgaben mit semantischen Anforderungen. 5.3.4 Assoziative Verknüpfung Parkin (1979): Parkin ging der Frage nach, ob semantisch und nicht semantische Aufgaben hinsichtlich ihrer assoziativen Verarbeitung über die Verarbeitungsleistungen unterschieden werden können. Empirisch belegt ist der Tatbestand, daß bei der sequentiellen Darbietung zweier Wörter das zweite Wort schneller identifiziert wird, wenn ein assoziative Verknüpfung zwischen beiden besteht, z.B. Tisch & Stuhl. Dieser Effekt wird als assoziatives Priming bezeichnet und basiert auf semantischen Verarbeitungsprozessen, deren Überlegenheit gegenüber nicht-semantischen von Parkin (1993) nachgewiesen werden konnte. Die Überlegenheit semantischer Prozesse gilt jedoch nur für Anforderungen bei denen Worte erkannt oder erinnert werden müssen. Werden Personen aufgefordert nach einem Wortstimulus frei assoziierend andere Wörter zu nennen, werden einige Wörter deutlich häufiger genannt, als andere. So zum Beispiel nach dem Stimulus Tisch als Assoziation Stuhl. Für die hinweisreizbedingte Wiedergabe sind derartige Assoziationen sehr wirksam. Für kaskadierende Menüs kann dieser Effekt bei der Begriffswahl, z. B. nach Kategorien, positiv genutzt werden. Werden zwei Wörter seriell dargeboten und gehören beide einer gleichen Kategorie an, so sind die Reaktionen deutlich kürzer, als wenn dies nicht der Fall ist. Diese Erkenntnis sollte bei der Gestaltung von kaskadierenden Menüs in der Weise berücksichtigt werden, daß in einer Kaskade kein Kategorienwechsel erfolgt. Aus diesen Ergebnissen kann des weiteren die Schlußfolgerung gezogen werden, daß im Aufgabenkontext dargebotene bedeutungsvolle aber irrelevante Informationen der Ausführung hemmend entgegenstehen. 5.3.5 Stroop Effekt Versuchspersonen werden nach der Farbe von Wörtern gefragt, die ihnen präsentiert werden. Z. B. das Word "grün" in der Farbe grün. Die Nennung der Farbe ist bei dieser Präsentation signifikant schneller, als wenn das Word "rot" lautet aber in grüner Farbe geschrieben ist. Hieraus kann geschlossen werden, daß in einer ersten Phase eine minimale semantische Enkodierung erfolgt, die dann ergänzt wird durch eine bewußte und aufgabenspezi- 47 fische Enkodierung. Des weiteren gilt bei Reaktionen auf Bedeutungszuweisungen (semantischer Bereich), daß bei einer positiven Bestätigung signifikant bessere Leistungen erbracht werden als bei einer Verneinung. 5.3.6 Explizites Gedächtnis bzw. Erinnern Bei der Überprüfung des expliziten Gedächtnisses werden Aufgaben gestellt, die sich auf vorangegangene Lernereignisse beziehen. Drei verschiedene Verfahrensweisen können dabei unterschieden werden: 1. Freie Wiedergabe: Erinnerung wird ohne Unterstützung gefordert. 2. Hinweisreizbedingte Wiedergabe: Erinnern mit Hilfe von auf die Zielinformation bezogene Hinweisreize. 3. Wiedererkennen: Ein Stimulus wird präsentiert und die Entscheidung wird gefordert, ob dieser Teil des zu erinnernden Materials ist. Gemessen über die Leistung können diese drei Arten unter normalen Bedingungen in eine Rangreihe gebracht werden (Parkin, 1993). Die freie Wiedergabe wird immer zu schlechteren Erinnerungsleistungen führen als die Hinweisreizbedingte. Diese wiederum ist dem Wiedererkennen unterlegen. Darüber hinaus ist gesicherte empirische Erkenntnis, daß in einer Sprache häufig benutzte Wörter leichter erinnert werden, als seltene Wörter. Beim Wiedererkennen ist dies genau umgekehrt (Engelkamp, 1994). 5.3.7 Flashbulb memory Hiermit wird die Erinnerungsfähigkeit von bedeutsamen Situationen bezeichnet. Sie verknüpften dies mit der Frage, wie die einzelnen Personen sich an die Meldung vom Tode J. F. Kennedy´s erinnern konnten. Wie Neisser (1982) ausführt, sind derartige Gedächtnisleistungen nicht unbedingt korrekt sonder stecken voller Inkonsistenzen. 5.3.8 Eidetisches Gedächtnis Die Fähigkeit, Informationen als Bild abzuspeichern und im Detail reproduzieren zu können. Eidetische Fähigkeiten können bei 8% Kinder aber nur 0.1% Erwachsene beobachtet werden (Parkin, 1993). 5.3.9 Alltagserfahrungen Augenzeugenberichte bei Gerichtsverhandlungen sind hochgradig ungenau. Sie berichten nicht was sie gesehen haben, sondern an was sie sich erinnern können. Machen Sie selbst einen kurzen Test: Wenn Sie ein erfahrener Windows Benutzer sind, versuchen sie aus dem Gedächtnis ihren Desktop zu zeichnen und vergleichen sie das Ergebnis mit der Realität. Sie werden erstaunt sein über das Ergebnis. 5.3.10 Interferenz Zwischen alten und neuen/neuen und alten Gedächtnisinhalten entstehen Interferenzen. Aber auch zwischen irrelevanten und relevanten Informationsanteilen. Ein Beispiel für die erste Kategorie aus dem Alltagsleben betrifft das Autofahren. Es ist gesicherte Erkenntnis, daß für das führen eines Fahrzeuges mit Schaltung höhere kognitive und physiologische Leistungen zu erbringen sind als bei einem Fahrzeug mit Automatik. Steigt ein so geübter Fahrer auf ein Automatikfahrzeug um, so ist in der ersten Phase eine höhere kognitive Belastung vorhanden, obwohl absolut gesehen die Führung eines Automatikfahrzeuges unter Belastungs- und Beanspruchungsaspekten niedriger einzustufen ist. 48 Interferenz liegt auch dann vor, wenn ein nicht relevanter Informationsausschnitt die Verarbeitung der relevanten stört, ohne daß dieser Vorgang mit einer Einschränkung der Aufmerksamkeit verbunden wäre. Störeffekte dieser Art sind der bereits genannte Stroop-Effekt in seinen verschiedenartigsten Varianten. Ebenso wie der Name von Wörtern nicht ausgeschaltet werden kann, kann auch die Namensinformation von Buchstaben nicht ausgeschaltet werden. Der Beurteilungsvorgang, daß die Buchstaben A (großes A) und a (kleines a) verschiedene Buchstaben (visuell) sind, dauert länger als für A (großes A)und b (kleines b). Auch durch Training kann eine solche Interferenz nicht vollständig unterdrückt werden. Aber auch die physische Struktur von Buchstaben kann nicht ausgefiltert werden. Die Feststellung, daß A und a (namentlich) gleich sind, dauert länger als für A und A bzw. a und a. 5.3.11 Emotion und Motivation Extrem unangenehme Ereignisse/Abläufe werden verdrängt und nicht gespeichert. 5.3.12 Training Das Gedächtnis ist kein Muskel, den man einfach trainieren kann. Wenn z.B. die Speicherung und das Erinnern von Telefonnummern trainiert wird und deutliche Leistungssteigerungen erreicht werden, so garantiert diese Trainingsleistung nicht, daß bei einer Personenvorstellung durch einen Dritten die genannten Namen nach wenigen Sekunden wieder vergessen worden sind. Die Aneignung von speziellen Gedächtnisfähigkeiten ist nur von eingeschränktem Wert, da nur Gedächtnisstrategien für spezielle Anwendungsbereiche trainiert werden können. Die Aneignung solcher Gedächtnisstrategien ist immer verbunden mit dem Erwerb von Wissen im Langzeitspeicher, insbesondere episodischer Natur, wie Untersuchungen an Rechenkünstlern belegen. (Spektrum der Wissenschaft, Juni 2001, S. 16, publ. unter Nature Neuroscience, Bd. 4, S. 103). Nicht nur das Arbeitsgedächtnis (räumlich-visueller Notizblock) war bei Rüdiger Gamm beim Rechnen aktiv, sondern auch fünf weitere Hirnareale, denen Funktionen als Langzeitgedächtnis zugewiesen werden. 5.3.13 Erinnern und Vergessen Mit dem Begriff Vergessen umschreiben wir im Alltag den Tatbestand, Informationen aus dem Langzeitgedächtnis verloren zu haben. Wir differenzieren dabei nicht die möglichen Ursachen. Parkin (1993) leitet seine Ausführungen zu diesem Thema ein mit einem Zitat von Friedrich Nietsche: "Die Existenz des Vergessens wurde bisher nicht bewiesen: Wir wissen nur, daß manche Dinge uns dann nicht in den Sinn kommen, wenn wir dies gerne möchten." Dieses Zitat verweist auf eine noch heute aktuelle Thematik, wie "Vergessen" zu deuten ist. Bedeutet es den unwiderruflichen Verlust von Speicherinhalt des Langzeitgedächtnisses oder umschreibt diese Formulierung nur den fehlerhafter Versuch, die betreffende Information zu finden bzw. abzurufen. Parkin (1993) beschreibt einen beeindruckenden Fall, in dem nach 20 Jahren bei einer Person Gedächtnisinhalte abgerufen wurden konnten, von deren Existenz sie bis dahin keine Ahnung hatte. Die Mädchen Eileen und Susan waren Freundinnen. Eines Tage verschwand Susan spurlos und wurde zwei Monate später tot aufgefunden. Der Mörder konnte nicht ausfindig gemacht werden. Erst zwanzig Jahre später konnte Eileen, ausgelöst durch einen Gesichtsausdruck ihrer Tochter, sich erinnern. Ihr Vater hatte auf einem Ausflug mit Eileen und Susan diese versucht zu vergewaltigen und sie anschließend brutal ermordet. Erinnern kann explizit oder implizit sein. Beim expliziten Erinnern geht es darum, sich an ein vorangegangenes Lernereignis zu erinnern und es wiederzugeben. Explizites Erinnern ist konzeptgesteuert und damit bewußt, d.h. es existieren mentale Prozesse zum zu erinnernden Ereignis. Das implizite Erinnern betrifft Gedächtnisinhalte, die ohne Bezug zum Lernereignis wiedergegeben werden können. Der Bezug ist in der Regel der Person auch nicht bewußt. Der Bezug wäre nur datengesteuert herstellbar. Dies macht es notwendig, daß das stimulierende Ereignis 49 oder Teile davon perzeptuell verfügbar sein müssen. Nachstehend ein Beispiel des impliziten Erinnerns aus der täglichen Arbeitssituation am Computer. Ein Kollege hat ein Problem bei der Installation einer Applikation. Es sind schon mehrere Versuche fehlgeschlagen. Er bittet Sie um Hilfe. Sie machen einen konkreten Lösungsvorschlag, während der Kollege bereits wieder einen neuen Versuch startet. Er geht auf Ihren Vorschlag nicht ein sondern erklärt Ihnen Wortreich seine vielen Versuche und woran es gegebenenfalls liegen könnte. Nach mehreren Minuten intensiver Betriebsamkeit, ruft ihr Kollege spontan aus: Ich glaube, ich habe es jetzt! Er trägt Ihnen dann genau Ihren ersten Lösungsvorschlag vor, ohne sich dessen bewußt zu sein. Tulving & Thomson (1973) formulierten auf der Grundlage ihrer empirischen Ergebnisse das Prinzip der Enkodierungsspezifität (encoding specifity principle, ESP; oder auch transfer appropriate processing). Es wird differenziert nach Wiedergabe und Wiedererkennen. Beides sind Formen eines Abrufsystems, welches abhängig ist vom Grad der Übereinstimmung in der Gedächtnisspur enkodierter Merkmale und den aktuellen Merkmalen der Aufgabensituation (eine Hypothese, von der auch Malsburg ausgeht, siehe Einleitung zu diesem Kapitel). Hiernach gibt es einen positiven Effekt beim Erinnern, wenn in der Situation des Erinnerns der gleiche Kontext gegeben ist wie in der Lernsituation. Als intrinsischer Kontext gelten die Merkmale, die Bestandteil des eigentlichen Stimulus sind und in der Lernphase encodiert worden sind. Als Extrinsischer Kontext gelten die Merkmale, die in der Lernsituation präsent aber nicht Bestandteil des Stimulus sind. Es kann angenommen werden, daß Wiedererkennen auf zwei Typen von Prozessen basiert: Bekanntheitsabruf und Kontextabruf (Parkin, 1993). Beim Wiedererkennen von Personen wird dieser Vorgang besonders deutlich. Als erstes stellen wir fest, die Person kenne ich. Anschließend kommt die manchmal mühevolle Rekonstruktion nach dem Kontext, der für diese Person relevant ist. (z. B. ein Studierender aus dem Seminar). Bekanntheitsurteile sind primär datengesteuert und nach Treisman kontextfrei, während die Kontexteinordnung ein rekonstruierender Suchvorgang nach Repräsentationen im episodischen oder semantischen Gedächtnis ist. Der Rückgriff auf episodische Gedächtnisinhalte verlangt dabei bewußte Verarbeitung während dies bei semantischen Strukturen nicht notwendig ist (man weiß es halt oder auch nicht). Neuere Untersuchungen (Vortrag Nothdurft) belegen aber, daß durchaus der Kontext bei datengetriebenen Prozessen eine Rolle spielt. Unabhängig von der Art der Information kann beim Wiedererkennen unterschieden werden in automatische und kontrollierte Prozesse. Datengetriebene Prozesse sind dabei eher automatischer Art während konzeptgetriebene Prozesse eher als kontrolliert anzusehen sind. 6 Handlungssteuerung Tätigkeiten sind Ausschnitte unseres Verhaltensstromes, die sich unterscheiden lassen nach den sie initiierenden Motiven. Handlungen sind Ausschnitte unseres Verhaltensstromes, die auf das Erreichen eines Zieles ausgerichtet sind. Handlungen sind eingebettet in Tätigkeiten, die wiederum den Bedeutungsgehalt von Handlungen bestimmen. Es ist offensichtlich, daß die Selektion eines Menüitems mit der Maus als Handlung im Tätigkeitskontext "Korrespondenz" von anderer Bedeutung ist als im Kontext "Steuerung Kernkraftwerk". Handlungen machen den der Beobachtung zugänglichen Teil des Interaktionsprozesses aus. Sie sind von kurzer Dauer, bestehen aus einfachen Bewegungen und ihre Komponenten bilden einen kohärenten Verhaltensausschnitt (Prinz, 1998). Im Kapitel "Arbeitsaufgabe und Arbeitsablauf" werden wir Handlungen des Interaktionsprozesses beschreiben. An dieser Stelle sollen lediglich grundlegende Bemerkungen zur Steuerungen von Handlungen angestellt werden. Der Handlungssteuerung liegen Aktionsschemata zugrunde. Ein Aktionsschema besteht aus einer sensorischen, einer effektorischen und einer weiteren sensorischen Einheit oder auch anders ausgedrückt aus einem Bedingungs-, Effektor- und Erwartungsschema. Das Erwartungsschema erlaubt uns die Überprüfung des Erfolgs des 50 Aktionsschemas (Reafferenzprinzip). Ein Aktionsschema repräsentiert eine elementare Form von Intelligenz, nämlich die Einsicht darüber, daß eine bestimmte Aktion unter entsprechenden Umständen vorhersagbare Folgen hat. Diese Basisintelligenz ist die Voraussetzung dafür, das Tun auf Ziele auszurichten (Finalität) und die Kompetenz besitzen, welche Mittel hierfür zur Verfügung stehen müssen (Instrumentalität). Erst das Wissen um die Finalität ermöglicht Verhaltenskontrolle. Aktionsschemata werden über Verknüpfungen zu größeren Einheiten, den Verhaltensprogrammen, zusammengefaßt. Der Ausführung von Handlungen sind kognitive Prozesse vorgelagert. Auf corticaler Ebene kommt dies im lateralisierten Bereitschaftspotential zum Ausdruck, welches mittels Kopfhautelektroden nachgewiesen werden kann. An den Muskeln ist bereits 50 ms vor der ersten beobachtbaren Reaktion ein Potentialanstieg im Elektromyogramm (EMG) vorhanden. In der Reaktionszeit, also die Zeit zwischen der Darbietung eines Reizes und einer ersten sichtbaren Reaktion, sind somit die Zeiten für elektromechanische Prozesse am Muskel (motorische Zeit tm) sowie die prämotorische Zeit (tp), die auf corticaler Ebenen benötigt wird, enthalten. Die Reaktionszeit kann somit als Ausdruck für die Qualität der Handlungsvorbereitung interpretiert werden, wenn auch eine Konfundierung über die Güte der Reaktion gegeben ist. Von Interesse ist, welche Faktoren die Reaktionszeit und damit indirekt die Initiierungsvorbereitung von Handlungen beeinflussen. Unsere Alltagserfahrung lehrt uns, daß die Reaktionszeiten abhängig sind von dem Körperteil (Effektor), welcher für die Ausführung der Reaktion herangezogen wird. Beispielsweise liegen die Reaktionszeiten auf einen einfachen akustischen Reiz für das Anhaben eines Fingers (153 ms) niedriger als bei einer Reaktion durch Flexion des Ellenbogens (166 ms) bzw. durch Flexion der Schulter (173 ms). Dies kann darauf zurückzuführen sein, daß die für die Finger zuständigen corticalen Areale um das Vielfache größer sind als die für den Ellbogen bzw. für die Schulter, so daß eine effizientere neuronale Erregungsübertragung diesem Effekt zuzurechnen ist. Denkbar ist aber auch, daß mit der Größe der zu innervierenden Muskelmasse auch die dafür benötigte motorische Zeit tm ansteigt. Ein weiterer die Reaktionszeit beeinflussender Faktor ist die Erwartung der Versuchsperson hinsichtlich einer Reaktion. So kann mit einem Vorsignal die Reaktionszeit deutlich verkürzt werden. Die gilt jedoch nur dann, wenn die Zeit zwischen Vorsignal und Reizdarbietung nicht zu groß ist und das Vorsignal valide ist. Diese Befundmuster können dahingehend interpretiert werden, daß die nach dem Vorsignal beginnende Bereitstellung von "Ausführungsprogrammen" nicht beliebig lange aufrechterhalten werden kann. Die dieser Schlußfolgerung zugrundeliegende Programm-Metapher ist nicht unumstritten. Die beobachteten Effekte behalten aber unabhängig von den theoretischen Begründungen ihre Gültigkeit. Unbestritten ist, daß die motorischen Komponenten der Ausführungsprogramme unter der Kontrolle zentraler kognitiver Prozesse stehen und damit die Bewegungsausführung durchaus Korrekturen über visuelle oder propriozeptive Rückmeldungen unterzogen werden kann. Neben den Reiz-Raktionsabläufen, in denen auf einen definierten Reiz nur eine korrekte Reaktion erfolgt (1:1), sind sogenannte Wahlreaktionen von Interesse. Hierbei sind auf definierte Reize unterschiedliche Reaktionen möglich. Dies bedeutet für den Probanden im ersten Reaktionsschritt eine Reizidentifikation um dann die zugehörige Reaktionswahl zu treffen. Es ist offensichtlich, daß die Reaktionszeiten für diesen Typus länger sind, und zwar für alle Modalitäten. Des weiteren nimmt mit der Anzahl der möglichen Auswahlreaktionen auch die Reaktionszeit zu. Die Variation der Reaktionen kann über unterschiedlich Merkmale erfolgen. So z. B. hinsichtlich der räumlichen Anordnung. Unterschiede in den Reaktionszeiten können dann als Effekte der räumlichen Anordnung interpretiert werden. Stimmen räumliche Eigenschaften von Reiz und Reaktion überein, spricht man von ReizReaktions-Kompatibilität. Kompatible Zuordnungen haben dann geringere Reaktionszeiten als inkompatible Zuordnungen. Räumliche Eigenschaften von Reizen bei Wahlreaktionsaufgaben haben auch dann einen Einfluß, wenn sie für die eigentliche Aufgabenausführung keine Relevanz haben (Müsseler, Aschersleben & Prinz, 1996). Die Autoren formulieren die Vermutung, daß Kompatibiltätsaspekte nicht der Ebene elementarer sensumotori- 51 scher Prozesse zuzurechnen sind, sondern daß auch hier kognitive Repräsentationen das raum-zeitliche Muster von Körperbewegungen induzieren. Auch mit der zeitlichen Steuerung von Handlungen sind spezifische Phänomene von Bedeutung. So die Ergebnisse von sogenannten Tapping-Experimenten. Hierbei muß die Versuchsperson ihre Handlungen mit einem vorgegebenen Ton-Rhythmus (Tip) synchronisieren (Synchronisationsphase) und anschließend ohne die Vorgabe weiterführen (Continuationphase). In der Synchronisationsphase erfolgt in allen Untersuchungsreihen die Reaktion (Tap) um 30 ms zu früh. Daraus leiten die Autoren die Hypothese ab, daß die Synchronisation nicht auf der externen beobachtbaren Ebene stattfindet sondern die zentralen Repräsentation von Tip und Tap synchronisiert werden. Die 30 ms gehen somit zu lasten der zentralen Verarbeitungsmechanismen. Wobei den afferenten Informationen zur zeitlichen Steuerungen von Handlungen eine größere Bedeutung zugewiesen wird als den efferenten. Die Informationsübertragung vom Ohr (das Tip) zu den zentralen Instanzen ist rein aus anatomischen Gründen kürzer als die Zeit für die Informationsübertragung der taktilen und kinästhetischen Rückmeldungen zum Aufbau einer zentralen Repräsentation. Wird für die Analyse nicht nur der Tastendruck sondern die gesamte Amplitude der Fingerbewegung ausgewertet, zeigt sich eine Abhängigkeit von Amplitude und Asynchronie. Bei größeren Amplituden wird die Taste auch mit einer größeren Kraft beaufschlagt. Dies führt zu einer Intensivierung der Rückmeldung und damit auch zu kleineren Asynchronien. Das Reiz-Reaktionsparadigma klammert die Intentionalität von Handlungen völlig aus. Wie und Was gehandelt werden soll, wird durch das experimentelle Design vorgegeben. Im Arbeitsprozeß wird der Handlungskontext durch die Tätigkeiten festgelegt. Tätigkeiten lösen als solche noch keine Handlung aus. Nach unserem Alltagsverständnis ist es ist der Wille oder auch die subjektiven Intentionen des Akteurs, welche die Handlung hervorbringen. Die Ausführungen zum Bewußtsein lassen die Schlußfolgerung zu, daß Willenserscheinungen nicht als die Verursacher objektiver Handlungen zu betrachten sind, sondern subjektve Begleiterscheinungen irgendwelcher neurophysiologischer Prozesse darstellen (Prinz, 1998). Andere Konzepte sehen den Willen als notwendiges Konstrukt welches dann benötigt wird, wenn das Handeln durch die momentane Motivation nicht unterstützt wird (Sokolowski, 1997). Motivation oder Wille sind hiernach handlungsinduzierende Konstrukte. Dieser Vorstellung liegt ein Konzept zugrunde (siehe hierzu Abbildung 2), welches ein rationales Wissenssystem mit willkürlichem Zugang zum Bewußtsein und ein affektives Erfahrungssystem mit unwillkürlichem Bewußtseinszugang postuliert. 52 Abbildung 2: Affektives Erfahrungssystem als Gefühle und rationales Erfahrungssystem als Gedanken repräsentiert im Bewußtsein (siehe hierzu Sokolowski, 1997). Das rationale System steuert den Verhaltensstrom mittels bewußter Einschätzungen auf der Grundlage analytisch verknüpfter Ursachen und Wirkungen. Die Informationsverarbeitung basiert auf Willkür und Bewußtheit und wird als langsam angenommen. Die Inhalte sollen sprachlich kodiert sein. Das Erfahrungssystem generiert Handlungen nach hedonistischen Gesichtspunkten basierend auf den Erfahrungen in ähnlichen Situationen. Die Informationsverarbeitung ist schnell und unmittelbar. Die erlebten Gefühle besitzen eine individuumspezifische Semantik und sind nur schwer in Sprache umzusetzen. Das rationale Wissenssystem induziert Gedanken und das Erfahrungssystem Gefühle als Bewußtseinsinhalte. Sind Gefühle und Gedanken kongruent, kommt es zur motivationalen Handlungssteuerung. Ist dies nicht der Fall, werden Gedanken aktualisiert, die die aktuelle Gefühlslage wieder so unter Kontrolle zu bringen haben, daß die zur Ausführung der willentlichen Handlung notwendige Motivationslage simuliert wird (Sokolowski, 1997). Reaktionen auf einen äußeren Reiz sind nach diesem Konzept als Willenshandlungen anzusehen, ohne daß diese hier hinsichtlich der zugrundliegenden Strukturen und Prozesse weiter beschrieben wird. Dies leistet Prinz (1998) mit seinem Konzept der Reaktion als Willenshandlung, in dem die mangelnde ökologische Validität des Reiz-Reaktionsparadigmas nachgewiesen und ein neues Konzept der Handlungssteuerung entwickelt wird. Willensentscheidungen sind hiernach nicht die handlungsverursachenden Prozesse, sondern sind lediglich deren Begleiterscheinungen. Prinz läßt die Frage unbeantwortet, wie handlungsverursachende Prozesse abzubilden wären bzw. wie sie initiiert werden. Wir gehen von der oben angestellten Überlegungen von Solokowski aus, um diese Lücke zu schließen. Das Arbeitsmodell von Prinz berücksichtigt als Determinanten von Handlungen nicht nur solche, die von der Reiz-Situation ausgehen, sondern auch jene, die von der aktuellen Disposition des Akteurs bestimmt werden. Dies sind Pläne, die der Organisation langfristiger und komplexer Handlungszusammenhänge dienen, es sind Absichten als abstrakte Zielsetzungen, die erst in der Handlung selbst charakterisiert werden und die Ziele als konkrete Zustände, die durch einfache Handlungen realisiert werden können. Die Repräsentationen der Ziele und ihre Einwirkung bei der Planung, Initierung und Ausführung von Handlungen wird in einem Arbeitsmodell über zwei Bausteine beschrieben, die Handlungseffekte und die Handlungscodes. Handlungseffekte: Jede Körperbewegung bewirkt für den Akteur eine große Anzahl wahrnehmbarer Effekte. Diese lassen sich nach dem Zeitpunkt ihres Auftretens in frühe und späte Effekte unterscheiden. Erstere sind die propriozeptiv wahrnehmbaren Wirkungen sowie visuelle oder akustische Wahrnehmungen, als spätere Effekte gelten die wahrgenommenen Wirkungen, die die Bewegung in ihrer näheren Umgebung verursacht. Einige dieser Effekte sind mit einer gewissen Regelmäßigkeit an die Ausführung der entsprechenden Bewegung gekoppelt. Es kann also angenommen werden, daß diese Verbindungen aufgrund ihres regelmäßigen auftretens gelernt werden können. 53 Abbildung 3: Konvergente und divergente Fächerstrukturen (nach Prinz, 1998) Die Verbindungen zwischen Bewegungen und Effekte kann man sich auch als fächerförmige Strukturen vorstellen. Diese sind entweder divergent oder konvergent. Bei divergenten Fächern wird nach Bewegungstypen unterschieden, denen bestimmte Ereignisse folgen. Konvergente Strukturen sind solche, bei denen Ereignistypen spezifiziert werden die durch verschiedene Bewegungen ausgelöst werden können (siehe Abbildung 3.3). Anders ausgedrückt: "Divergente Fächer beschreiben, welche späten Effekte auf bestimmte frühe Effekte folgen - d.h. sie spezifizieren den Zusammenhang zwischen bestimmten Bewegungen (vertreten durch Begleiteffekte) und ihren Wirkungen in der Umwelt (vertreten durch Nah- und Ferneffekte). Konvergente Fächer beschreiben dagegen, welche frühen Effekte bestimmte späte Effekte erzeugen können - d.h. sie spezifizieren den umgekehrten Zusammenhang zwischen bestimmten Ereignissen in der Umwelt (=Nah- oder Ferneffekte) und geeigneten Bewegungen (=Begleiteffekte), die sie herbeiführen können." (Prinz, 2000, S. 44). Handlungscodes: Während die Handlungseffekte als strukturelle Grundlagen der Handlungssteuerung aufgefaßt werden können, stellen die Handlungscodes die prozessuralen Grundlagen dar. Es wird angenommen, daß die Fächerstrukturen eine Funktionsgrundlage für die Antizipation von Handlungszielen und für die Umsetzung von Zielen in Handlungen darstellen. Handlungsziele sind nichts anderes als Handlungseffekte, die in einer spezifischen Situation angestrebt werden. Bei einer konvergenten Fächerstruktur werden somit durch das beabsichtigte Handlungsziel die entsprechenden Bewegungen aufgerufen. Diesem Gedankengang liegt die Annahme zugrunde, daß die Fächerstrukturen im Lernprozeß sich von vorne nach hinten aufbauen während sie bei der Steuerung von Handlungen umgekehrt abgearbeitet werden. Lernprozesse führen von Bewegungen zu Effekten, Prozesse der Handlungssteuerung führen von intendierten Zielen bzw. Effekten zu Bewegungen. Wenn diese Annahmen zutreffen, können die Fächerstrukturen als Handlungsrepräsentationen bzw. Handlungscodes aufgefaßt werden. Sie repräsentieren Bewegungen, die mit Zielen verknüpft sind. Demnach kann weiter unterschieden werden in eine Zielkomponenten (Zielcode) und Bewegungskomponente (Bewegungscode). Handlungscodes ordnen gegebenen Zielen geeignete Realisierungsbewegungen zu lautet somit die Grundannahme des von Prinz entwickelten Arbeitsmodells. Bestätigung finden diese Überlegungen durch die Ergebnis solcher Experimente, in denen nachgewiesen werden konnte, daß bildhafte Vorstellungen von Bewegungen in ihren Eigenschaften weitgehend den realen Bewegungen entsprechen. Fordert man beispielsweise ein Person auf, einen von zwei Würfeln so zu drehen, daß beide Würfel die gleiche Punktzahl in identischer Position aufweisen, werden offensichtlich dieselbe Zahl von Bewegungen und etwa die gleiche Zeit benötigt, wenn diese Bewegungen nur in der Vorstellung erfolgen (Kolb & Whishaw, 1996). 54 Das Arbeitsmodell von Prinz erlaubt auch eine differenziertere Betrachtung von Kompatibilitätsaspekten, die bei Reiz-Reaktionshandlungen beobachtet werden können. Bei den klassischen Experimenten die auf diesem Paradigma beruhen stellt die Handlung nicht das Mittel zur Erreichung eines Zieles bzw. Effektes dar, sondern die Handlung selbst ist zugleich das Ziel. Dies führt zwangsläufig zu einer anderen Betrachtung von Kompatibilitätseffekten als nach den Überlegungen von Prinz (1998). Auf der Grundlage eines modifizierten experimentellen Designs konnte er nachweisen, daß nicht die Übereinstimmung zwischen Eigenschaften des Reizes und der Bewegung sondern zwischen Eigenschaften des Reizes und des Zieles für Kompatibilitätsvorteile relevant sind. Hieraus ist die Konsequenz zu ziehen, daß bei der Modellierung der Handlungssteuerung zwischen einer Zielkomponente und einer Bewegungskomponente zu unterscheiden ist. Die Eigenständigkeit der Handlung findet auch in der Literatur ihren Niederschlag. Schlink (1997, S. 21-22) schreibt hierzu: „Aber ich erkenne heute im damaligen Geschehen das Muster, nach dem sich mein Leben lang Denken und Handeln zueinander gefügt haben. Ich denke, komme zu einem Ergebnis, halte das Ergebnis in einer Entscheidung fest und erfahre, daß das Handeln eine Sache für sich ist und der Entscheidung folgen kann, aber nicht folgen muß. Oft genug habe ich im Laufe meines Lebens getan, wofür ich mich nicht entschieden hatte, und nicht getan, wofür ich mich entschieden hatte. Es, was immer es sein mag, handelt; es fährt zu der Frau, die ich nicht mehr sehen will, macht gegenüber dem Vorgesetzten die Bemerkung, mit der ich mich um Kopf und Kragen rede, raucht weiter, obwohl ich mich entschlossen habe, das Rauchen aufzugeben, und gibt das Rauchen auf, nachdem ich eingesehen habe, daß ich Raucher bin und bleiben werde.“ Handlungen im Arbeitsprozeß werden überwiegend mit dem Hand-Arm-System ausgeführt. Ein besonderes Problematik ist die sogenannte Händigkeit. Hiermit wird der Tatbestand gekennzeichnet, daß wir Menschen bei einer Vielfalt von manuellen Aufgaben eine ausgeprägte Neigung besitzen, diese mit der gleichen Hand auszuführen. Händigkeit ist nach Wilson (2000) eine rein menschliche Eigenschaft und ist neben der Sprache und dem Werkzeuggebrauch ein wesentliches Charakteristikum des homo sapiens. Aus der Biologie liegen Anhaltspukte vor, daß die Händigkeit ebenso alt ist wie der zweifüßige Gang und für die menschliche Entwicklung eine ebenso große Bedeutung hat. Es kann angenommer werden, daß die Händigkeit Ergebnis eines kumulativen Evolutionseffektes von Umweltansprüchen und –chancen darstellt. Eine wichtige Voraussetzung bei den Hominidenhänden waren dabei die für das Überleben notwendigen Griffpositionen. Drei Griffpositionen wurden nachgewiesen (Wilson, 2000). Der Drei-Punkte-Spanngriff (Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger in Steinwurfstellung). Dieser Griff diente dem Steinwurf. Der seitliche Zangengriff oder auch Pinzettengriff (Daumenspitze gegen Innenseite des Zeigefingers). Dieser Griff diente der dominanten Hand zum Schneiden, Sägen, etc. Die nichtdominante Hand verwandte diesen Griff zur Darbietung der Gegenstände für den Bearbeitungsprozeß. Der Korb-Präzisionsgriff, bei denen der Daumen den Spitzen der anderen Finger gegenübersteht. Dieser Griff wird von der nichtdominanten Hand zur präziesen Bereitstellung von Gegenständen für die Bearbeitung mit der dominanten Hand benötigt. Verbunden mit den Griffpositionen wurden den Händen somit unterschiedliche Aufgagentypen zugewiesen. Unabhängig von dieser Arbeitsteilung sind im Regelfall jedoch beide Hände am Handlungsprozeß beteiligt. Guiard (1987) hat nachgewiesen, daß selbst bei einer als unilateral angenommen Fertigkeit, dem Schreiben, die nichtdominante Hand das Papier unter Vorwegnahme der Schreibbewegung positioniert. Selbst bei Wurfbewegungen dient die nichtdominante Hand dazu, die Schwungbewegung auszubalancieren (Komplementaritätsprinzip). Darüberhinaus konnte Guiard zeigen, daß die physischen Bewegungsmerkmale und die erforderlichen sensorischen Kontrollprozesse für die Hände unterschiedlich sind. Die Amplituden der dominanten Hand sind kleiner als die der nichtdominanten Hand und besitzen eine höhere Frequenz (mikrometrisch). Sie sind geübt und werden durch die internen Kontrollprozesse gesteuert. Die Aktivität der nichtdominanten Hand stellt den Bezugsrahmen (makrometrisch) für die dominante Hand dar und sorgt für dessen Stabilität. Diese Aktivitäten sind improvisatorisch, extern bestimmt und denen der dominanten Hand vorgelagert. Wilson (2000, S. 176) kommt zu einer provokanten 55 Schlußfolgerung: „Die linke Hand weiß, was die rechte vorhat, und die rechte weiß, was die linke gerade getan hat.“ 7 Der Benutzer Das System muß nicht nur unterschiedlichen Aufgabenzusammenhängen sondern auch die Verschiedenartigkeit der Benutzer hinsichtlich Handlungskompetenz, Bedürfnisse und Einstellungen genügen. Unter Zeit- und Notwendigkeitsapekten können Benutzer unterschieden werden in solche, für die das System zwingend notwendiges Arbeitsmittel zur Ausführung ihrer zentralen Arbeitsaufgabe ist und andere, die nur gelegentlich solch ein System nutzen, weil es die Erfüllung ihrer Arbeitsaufgabe erleichtert. Die erste Gruppe nimmt Zeit und Anstrengungen in Kauf, um das Arbeitsmittel bedienen zu können, ist hoch motiviert und arbeitet in technischen Arbeitszusammenhängen. Die zweite Gruppe möchte nur die primäre Arbeitsaufgabe erledigen und keinen Lernaufwand zur Beherrschung des Arbeitsmittels aufbringen. Technische Details sind nicht von Interesse und es besteht keine hervorgehobene Motivation zur Benutzung des Systems. Für beide Gruppen gilt, daß auch Emotionen und Gefühle als Ausdruck des inneren Zustandes aus der Arbeitsgestaltung nicht ausgeklammert werden dürfen. Die im Menschen vorhandene Kreativität, Wertschätzungen und Emotionen sind Grundlage jeder anspruchsvollen Leistungserbringung. Bei der Gestaltung gilt es zu respektieren, daß andere anders denken, fühlen, urteilen und entscheiden. Dies macht die Gestaltung zu einem ambivalenten Prozeß. Die Ambivalenz resultiert dabei nicht aus den genannten Kategorien sondern ist Ausdruck der normalen Lebensäußerung des Menschen. Um diesen Gedankengang etwas konkreter zu Beschreiben, greifen wir die Überlegungen von Dörner und Mitarbeiter auf, die Grundlage ihres Simulationsprogrammes EMOREGUL sind, in dem die Interaktion von Motivation, Emotion und Kognition unter besonderer Berücksichtigung emotionaler Prozesse modelliert wird (siehe hierzu auch Dörner, 1999). Es geht hier um zielgerichtetes Mehrfachhandeln in einer komplexen dynamischen Umwelt. Ein Tatbestand also, der auch für die Interaktionen zwischen Benutzer und Computer angenommen werden kann. Es gilt zu erklären, wie sich Menschen in Abhängigkeit von ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten in bestimmten Situationen Ziele setzen, wie die Zielauswahl erfolgt und warum die Zielerreichung in so unterschiedlicher Weise angestrebt wird. Zentraler Ausgangspunkt einer solchen Betrachtung ist die Klärung des Begriffes Bedürfnisse. Im Zusammenhang mit der Arbeit an einem Computer mag zuerst dieser Begriff unpassend sein. Kann es überhaupt ein Bedürfnis nach Interaktion mit dem Computer geben? Zumindest kann man von der Annahme ausgehen, daß am Anfang weder Wort noch Tat steht, sondern Bedürfnisse die etwas initiieren bzw. in Gang setzen. Nach diesem Verständnis gibt es eine unbegrenzte Anzahl menschlicher Bedürfnisse, so daß eine Aufzählung sinnlos ist. Formal unterscheiden Dörner und Mitarbeiter die folgenden Bedürfnisklassen: Appetive und aversive Bedürfnisse, also solche bei denen man etwas haben möchte und solche, bei denen man es nicht haben möchte. Von außen induzierte Bedürfnisse, also solche die durch einen äußeren Anlaß hervorgerufen werden. Von innen induzierte Bedürfnisse. Diese sind entweder konsumptorischer Natur und damit verbrauchsabhängig oder periodisch wiederkehrende Bedürfnisse, die regelmäßig wiederkehren und im Prinzip nicht verbrauchsabhängig sind. Die in uns innewohnenden Bedürfnisse haben latenten Charakter und werden erst aktiv, wenn eine bestimmte Stärke erreicht ist. Ist ein entsprechender Schwellenwert erreicht, erfolgt als erste Stufe der Bedürfnisbefriedigung die Erzeugung eines Motivs. So z. B. das Motiv, dem Geschäftspartner einen Brief zu schreiben. Der Schwellenwert ist jedoch kein absoluter Wert sondern ist abhängig von unserem inneren Zustand. So ist erklärbar, daß das genannte Motiv nicht zwangsläufig in die Tat umgesetzt wird und der Brief nicht geschrieben wird. Die Bedürf- 56 nisse konkurrieren mehr oder weniger miteinander, entsprechende Motive zu erzeugen. Je bedeutsamer die vorhandenen Motive sind um so schwieriger wird es für ein Bedürfnis, daß entsprechende Motiv zu erzeugen. Die Auswahl eines Motivs richtet sich nach der Wichtigkeit und Dringlichkeit in der gegebenen Situation und der Fähigkeit zur Befriedigung des Bedürfnisses bzw. der Erreichung des Ziels. Die Wichtigkeit ist wie der Schwellenwert kein absoluter Wert. Deshalb kann die Wichtigkeit auch als notwendig Sollwertabweichung angesehen werden. Je größer die Sollwertabweichung ist, um so höher besteht für das Motiv auch "erledigt" zu werden, wie das besagte Schreiben an den Geschäftsfreund. Die Dringlichkeit berücksichtigt den Zeitaspekt. Der Brief an den Geschäftsfreund mußte vielleicht nur um eine Stunde verschoben werden, weil es einen wichtigen Auftrag zu aquirieren galt. Sind Wichtigkeit und Dringlichkeit gegeben, bedarf es noch der Fähigkeit, daß Bedürfnis auch wirklich befriedigen zu können. Dörner und Mitarbeiter verknüpfen die Auswahlparameter Wichtigkeit, Dringlichkeit und Fähigkeit multiplikativ zu dem sogenannten Auswahldruck. Diese Verknüpfung entspricht dem Erwartung * Wert-Prinzip. Der Wert einer Handlung ergibt sich über das Ausmaß der Bedürnisbefriedigung hinsichtlich des Erfolgs der Handlung und damit der Stärkung unseres Selbstvertrauens. Die Erfolgserwartung operationalisiert über die Handlungskompetenz wird mit dem Wert (=Wichtigkeit * Dringlichkeit) multipliziert um so zu einer gewichteten Motivhierarchie zu gelangen. Die Berechnung des Auswahldrucks gilt nur für das augenblickliche handlungsleitende Motiv. Für alle anderen Motive wird ein Modulationsparameter (Auswahlschwelle) mit verrechnet, der eine laterale Inhibition der anderen Motive durch das handlungsleitende Motiv realisiert, um die Zielereichung bei einzelnen Motiven sicherzustellen. Für die Abarbeitung eines Motivs muß geplant, exploriert und agiert werden. Es kann sein, daß die Abarbeitung automatisiert erfolgt. So z.B. der Ausdruck eines Briefes. Bei der Formatierung eines Absatzes muß vielleicht probiert werden, wobei bestimmte Funktionen erst durch entsprechendes Explorieren erschlossen werden. Die Gestaltung eines kompletten Dokumentes bedarf der Planung, die aber Erfahrung und ausreichendes Kompetenzempfinden voraussetzt. Reicht die Erfahrung nicht aus, muß zwangsläufig exploriert werden. Der hierdurch geleistete Erfahrungsgewinn ist abhängig von der Feinheit der Betrachtungsweise bzw. dem Auflösungsgrad des Problemfeldes. Der Entwurf eines Eingabeformulars für eine Datenbank hat bei einem Visual Basic Programmierer einen feineren Auflösungsgrad als bei einem Benutzer, der sich lediglich der grafischen Möglichkeiten des Formulareditors bedient. Des weiteren ist der Erfolg der Exploration von der Aktiviertheit (Arousal) des Benutzers abhängig. Bei hoher Aktiviertheit ist die Erweiterung der Handlungskompetenz sicherlich höher einzustufen als bei einer gleichmütigen Herangehensweise. Darüber hinaus spielt das Ausmaß der "Hintergrundkontrolle" oder auch Abtastrate eine wesentliche Rolle. Je mehr Aufmerksamkeit durch die Umgebung und Rahmenbedingungen gebunden wird, um so weniger Aufmerksamkeit kann der eigentlichen Zielerreichung zugestanden werden. Auflösungsgrad, Aktiviertheit und Abtastrate sind nicht unabhängig voneinander. Der Auflösungsgrad beispielsweise wird beeinflußt durch die Aktiviertheit, die Wichtigkeit des aktuellen Motivs und dessen Dringlichkeit. Um so höher der Auflösungsgrad ist, um so geringer kann die Aktiviertheit sein. Die Planung für eine Zielerreichung ist somit abhängig von dem Auflösungsgrad, der Abtastrate; der Handlungskompetenz zur Befriedigung des konkreten Bedürfnisses; der heuristischen Kompetenz, d. h. dem Wissen darüber, wie man zu Wissen gelangt. Nach erfolgreicher Exploration und Planung wird agiert. Ob eine Handlung erfolgreich ist oder fehlschlägt, hängt von der Handlungskompetenz und der Güte des Planes ab. All diese Vorgänge werden moderiert von einem Lust/Unlustpegel, der die jeweilige Stimmung wiedergibt und das Kompetenzempfinden bestimmt. Der israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovski hat Bedürfnisse in einer etwas anderen Weise beschrieben. In seiner Studie ging es um den Zusammenhang von Bedürfnissen bzw. deren Bedeutung in der Wahrnehmung von Lebenssituation und den entwickelten Abwehrressourcen (Ornstein, R. & Sobel, D. (1995). In seinen Unter- 57 suchungen konnte er höhere Abwehrressourcen bei denjenigen Frauen feststellen, die als globale Einstellung ein "Gefühl der Kontinuität" entwickelt hatten. Das Gefühl der Kontinuität wurde über drei Bedürfnisdimensionen abgebildet. Erfaßbarkeit: Die an den Menschen gestellten Anforderungen aus der Arbeits- und Lebenssituation erscheinen ihm geordnet, konsequent, strukturiert und klar, d. h. vorhersagbar. Beim gegensätzlichen Fall wären die Anforderungen nicht vorhersehbar und damit willkürlich, chaotisch, verwirrend. Umsetzbarkeit: Die Mittel zur Erfüllung der Anforderungen müssen dem Akteuer in ausreichender Weise zur Verfügung stehen. Dies setzt keine vollständige Kontrolle über die Mittel voraus. Diese kann durchaus bei Freunden oder anderen Personen des Vertrauens liegen. Sinnhaftigkeit: Es muß sich ein Gefühl entwickeln, in dem die Anforderungen einen Sinn haben. Ein solcher positiver Sinn ist dann gegeben, wenn die Anforderungen als Herausforderung und nicht als Bedrohung gesehen werden und die Anforderungen es wert sind, daß ihnen persönliches Engagement zugestanden wird. Diese aus der Sichtweise der Gesundheitsforschung formulierten Dimensionen gelten natürlich ebenso für die Arbeitssituation. Es ist offensichtlich, daß diese hier nur beispielhaft beschriebenen Variablen, ihre Ausprägungen und Abhängigkeiten einen Problemraum bilden, der die vielfältigsten Benutzerprofile abbildet. Gestaltung ist demnach zu differenzieren nach solcher, die spezifische Profile einzelner Benutzer bzw. Benutzergruppen aufgreift oder die sich in Kenntnis der Widersprüche von Motiven und Empfindungen auf grundlegende Erkenntnisse der Ergonomie beschränkt. 8 Muskelarbeit Die Arbeit an Bildschirmarbeitsplätzen wird üblicherweise nicht mit Muskelarbeit in Verbindung gebracht. Es ist jedoch offensichtlich, daß der Stütz- und Bewegungsapparat des Menschen auch bei der Bildschirmarbeit Belastungen ausgesetzt ist, die in ihrer Beanspruchswirkung durch Gestaltung beeinflußt werden können. Dies betrifft die Dateneingabe über die Tastatur oder andere Geräte sowie die Haltungsarbeit die notwendig ist, um den Körper bzw. Körperteile in einer angemessenen Position zu halten. Die speziellen Belastungen, deren Wirkungen und Beeinflussungsmöglichkeiten werden im Kapitel 5 behandelt. Prinzipiell können zwei Formen der Muskelarbeit unterschieden werden, die dynamische und die statische Arbeit. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium dieser beiden Formen wird aus den Stoffwechselmechanismen abgeleitet. Im Arbeitsprozeß muß der Mensch durch Muskelanspannungen bzw. Muskelbewegungen mechanische Kräfte gegenüber äußeren und inneren Krafteinwirkungen entwickeln. Bei der Arbeit an Bildschirmarbeitsplätzen können die äußeren Krafteinwirkungen vernachlässigt werden, so daß wir hier nur von statischer Haltungsarbeit in Bezug auf den eigenen Körper bzw. Körperteile ausgehen wollen. Ein Sonderproblem ist die Tastaturbedienung. Hier findet zwar eine äußere Krafteinwirkung statt, die als solche unter Belastungsaspekten nur über Widerholfrequenz eine Rolle spielt. Die für die Muskelarbeit notwendige Energie wird dem arbeitenden Muskel über Glukose (im Blut gelöster Zucker) und Glykogen (ein im Muskel gespeichertes stärkeähnliches Kohlehydrat) zur Verfügung gestellt. Durch einen aeroben oder anaeroben Stoffwechselprozeß wird die Transmittersubstanz Adenosin-Triphosphat (ATP) produziert. Diese wird vom Muskel bei seiner Arbeit in eine energieärmere Verbindung (Adenosin-Diphosphat, ADP) abgebaut. Eine fortgesetzte Muskelarbeit ist nur möglich, wenn durch Zellatmung (= aerober Energiestoffwechsel) bzw. Gärung (=anaerober Energiestoffwechsel) aus dem ADP erneut ATP resynthetisiert wird. Optimal ist dies nur mög- 58 lich, wenn die arbeitende Muskulatur über die Blutgefäße bedarfsgerecht mit Glukose und Sauerstoff versorgt wird und gleichzeitig die aus der Zellatmung resultierenden Abbauprodukte Kohlendioxid und Wasser abtransportiert werden. Mit geringerem Wirkungsgrad kann eine ATP-Resynthese auch erfolgen, wenn der Muskel zumindest in der Lage ist, noch vorhandenes Glykogen zu Milchsäure bzw. Brenztraubensäure zu vergären. Bei Tätigkeiten mit Bewegungen, bei denen im Wechsel unterschiedliche Anteile der Körpermuskulatur eingesetzt werden, liegt dynamische Muskelarbeit vor. Sie ist gekennzeichnet durch einen Wechsel von Muskelkontraktion und Erschlaffung (Erholung), einer bedarfsgerechten Durchblutung des Muskels zur Sauerstoff- und Nährstoffversorgung, einen Energietransfer mittels der aeroben Zellatmung mit hohem Nutzeffekt. Dynamische Arbeit ist die effizientere Form der Muskelarbeit und kann über längere Zeiträume ausgeübt werden. Statische Muskelarbeit ist notwendig, wenn Gegenstände gehalten oder Lasten gehoben werden. Desweiteren bei der Haltungsarbeit, bei der der Körper bzw. Körperteile gegen die Schwerkraft in einer bestimmten Stellung bzw. Haltung fixiert werden muß. Hierfür ist eine Dauerkontraktion der Muskulatur über längere Zeiträume notwendig. Hierbei findet auch eine Kontraktion der für die Muskelversorgung zuständigen Blutgefäße statt, so daß die Sauerstoffversorgung des Muskels defizitär wird. Die Konsequenz ist ein anaeroben Energietransfer mit geringem Nutzeffekt auf der Basis der Milchsäuregärung, eine schnelle Ermüdung und ungünstige biomechanische Beanspruchungsbedingungen für Knochen, Gelenke und Bänder. Statische Muskelarbeit sollte insofern vermieden werden. Dort wo dies nicht möglich ist, beispielsweise bei der Haltungsarbeit der Muskeln, gilt es über die Gestaltung auf der Grundlage anthropometrischer und biomechanischer Daten negative Folgen zu verhindern. Dabei ist die Pausengestaltung mit entsprechenden Entspannungsübung ein unverzichtbarer Bestandteil eines Gestaltungskonzeptes für Bildschirmarbeitsplätze. 9 Zusammenfassung Wir haben ein Menschenbild beschrieben, welches den Menschen aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet. Der Mensch als kognitives Wesen zielt ab auf die Artefakte und Prozesse der Wahrnehmung, der Mensch als tätiges/handelndes Wesen macht die Handlung zum Gegenstand der Betrachtung, der Mensch als Akteur in unserer Gesellschaft verlangt nach Humankriterien und der Mensch als Benutzer von technischen Artefakten will die Variabilität seiner Einstellungen, Motive und Handlungen berücksichtigt wissen. Der Mensch als kognitives Wesen unterliegt dabei angesichts der Anstrengungen der modernen Hirnforschung in den naturwissenschaftlichen Disziplinen tiefgreifenden Veränderungsprozessen, deren Auswirkungen auch die anderen Sichtweisen betreffen. Nach Ansicht von Wolf Singer werden die zu erwartenden Erkenntnisse hinsichtlich der Begründung unserer Selbstwahrnehmung als freie, geistige Wesen folgenreicher sein als die kopernikanische Neudefinition unseres Ortes im Kosmos oder die Darwinsche Evolutionstheorie, die uns unsere biologische Bedingtheit erstmals deutlich aufgezeigt hat. Es liegen Evidenzen vor, daß der Mensch Materie ist und alles was ihn ausmacht sich zurückführen läßt auf die Verknüpfungen von Milliarden Nervenzellen des Gehirns. Freude und Trauer, Lust und Unlust, Depression und Euphorie sind Ausdruck hirnorganischer Aktivitäten. Die materielle Bedingtheit psychischer Phänomene und damit die Frage nach ihren neuronalen Korrelaten führt zu einem neuen Menschenbild. Es kann als gesicherte Erkenntnis angenommen werden, daß die Funktionalität unserer Hirnfunktionen ausschließlich durch die Art der Verschaltungsarchitektur und die Effizienz der Kopplungen der Nervenzellen festgelegt ist. Die Verschaltungsarchitektur entwickelt sich beim Menschen noch bis zur Pubertät. Die Ausdifferenzierung der Verschaltungen wird von Sinnessignalen beeinflußt. Erfahrungen und Interaktionen mit der Umwelt führen zur Konsolidierung, Abschwächung oder Zerstörung von Verschaltungen. Lernvorgänge beruhen darauf, daß die vorhandenen Verbindungen verändert werden. Drei Quellen für das Wissen im Gehirn können somit ausge- 59 macht werden: die Evolutionen die in unseren Genen entsprechendes Wissen gespeichert hat, die Ontogonese, während der erworbenes Erfahrungswissen in irreversible Verschaltungen umgesetzt wird und nicht zuletzt was wir als alltägliches Lernen bezeichnen, bei dem Wissen durch die Modifikation der Effizienz bereits konsolidierter Verschaltungen gespeichert wird. Es kann davon ausgegangen werden, daß eine Vielzahl von Signalmolekülen, die in der Embryonalentwicklung den Aufbau von Verschaltungen begründen, dies auch in der erfahrungsabhängigen Modifikation von Verschaltungen und auch bei Lernprozessen leisten. Dies begründet fließende Übergänge zwischen den Resultaten der Evolution, den Prägungen durch die Umwelt und Lernvorgängen im weiteren Leben des Menschen. Es begründet aber auch, daß derartige Prozesse an Entwicklungsphasen gebunden sind. Solche, in denen nichts mehr nachgeholt werden kann oder auch solche, in denen irreversible Verschaltungen formiert werden. Neben der Systemarchitektur unseres Nervensystems ist der Prozeß der Signalübertragung bedeutsam. Zwei Prozesse wurden unterschieden: die durch die elektrische Erregung von Nervenzellen freigesetzten Transmittersubstanzen sowie die Umsetzung dieser Stoffe zu elektrischen Potentialschwankungen in den nachgeschalteten Zellen. Die Erkenntnisse zu diesen Prozessen leisten noch keine Aussage darüber, wie die raum-zeitlichen Aktivierungsmuster in Neuronenverbänden funktionieren bzw. wie die Korrelationen solcher Aktivierungsmuster mit spezifischen motorischen und kognitiven Leistungen zu spezifizieren sind. Nach wie vor bleibt zu klären, wie die Sinnesorgane die perzipierten Umweltsignale in neuronale Informationen umsetzen, wie die Wahrnehmungsobjekte im Gehirn repräsentiert sind und wie es zu dauerhaften Veränderungen im Gehirn kommt. Das harte Problem, wie es David Chalmers (1996) formulierte, nämlich wie erzeugen neurobiologische Prozesse im Gehirn bewußte Erlebnisse, bleibt nach wie vor ungelöst. Die Physik lehrt uns zwischenzeitlich, daß die bisher für unverrückbar gehaltene Koordination von Raum und Zeit relativiert werden muß. Es kann erwartet werden, daß die Hirnforschung in den nächsten Jahren unser Menschenbild neu definieren wird und die noch offenen Fragen besser beantworten kann, als die gesicherten Erkenntnisse hierzu es heute zulassen. 60