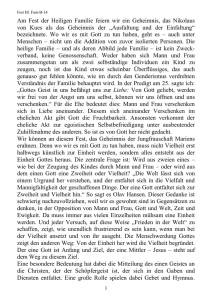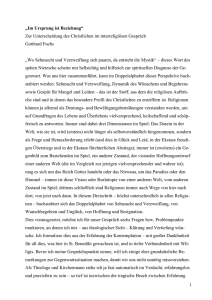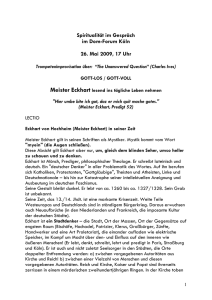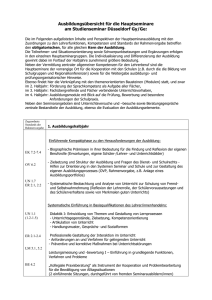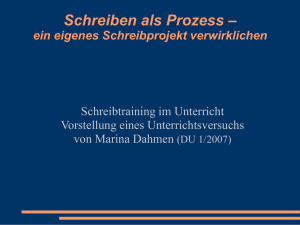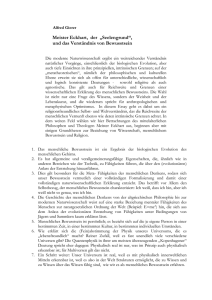ZIP
Werbung
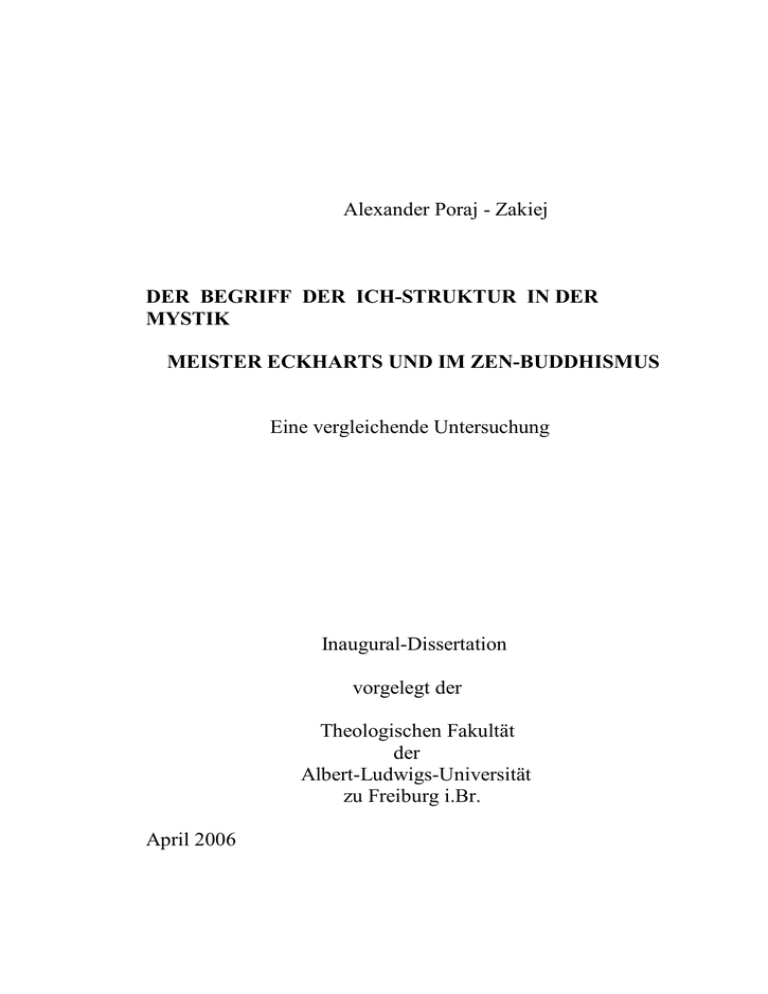
Alexander Poraj - Zakiej DER BEGRIFF DER ICH-STRUKTUR IN DER MYSTIK MEISTER ECKHARTS UND IM ZEN-BUDDHISMUS Eine vergleichende Untersuchung Inaugural-Dissertation vorgelegt der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i.Br. April 2006 Dekan: Prof. Dr. Helmut Hoping Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Bernhard Uhde Zweitgutachter: Prof. Dr. Dr. Markus Enders Tag des Promotionsbeschlusses: 20. Juli 2006 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT.................................................................................................... S. 1 EINLEITUNG................................................................................................ S. 6 I. MYSTIK – EINE BEGRIFFSBESTIMMUNG ............................. S. 12 II. DER MYSTIK-BEGRIFF UND DAS WERK MEISTER ECKHARTS………………………………………………………… S. 37 1. 2. a. b. c. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV. Das Eine und das Viele................................................................................ Die Einheit................................................................................................... Die kausale Einheit und analoge Vielheit.................................................... Die konditionale Einheit und univoke Vielheit........................................... Der Begriff der nichtdualen `gotheit`.......................................................... Der Begriff der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit....................... S. S. S. S. S. S. 39 45 46 49 56 60 DER BEGRIFF DER ICH-STRUKTUR IN DER MYSTIK MEISTER ECKHARTS........................................................................................... S. 66 Der Ich-Begriff und der Begriff `gotheit`..................................................... Die Ich-Struktur in der `gotheit`................................................................... Der Ich-Begriff und der Begriff `gott`.......................................................... Die Ich-Struktur und der Begriff der Trinität............................................... Die Ich-Struktur begriffen als Trinität.......................................................... Die Ich-Struktur als die Entfaltung des Absoluten....................................... Zusammenfassung und Ausblick.................................................................. DER MYSTIK-BEGRIFF UND DER ZEN-BUDDHISMUS.......... S. S. S. S. S. S. S. 68 69 75 83 96 100 111 S. 113 1. Zen und der Hînayâna-Buddhismus............................................................. S. 118 2. Zen und der Mâhâyana-Buddhismus............................................................ S. 120 3. Zen und der Begriff der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten......... S. 124 V. DER BEGRIFF DER ICH-STRUKTUR IM ZEN-BUDDHISMUS.. S. 130 1. Der Ich-Begriff der Prajnāpāramitāhrdayasūtra........................................... S. 134 2. Der Ich-Begriff der Vijñānavāda-Schule...................................................... S. 143 a. Die Stufe der relativen Ich-Identität............................................................. S. 144 b. Die Stufe der universalen Ich-Identität......................................................... S. 150 c. Die Stufe der absoluten Ich-Identität............................................................ S. 153 3. Ergebnis........................................................................................................ S. 155 VI. DER VERGLEICH.............................................................................. S. 157 1. Der abendländische Begriff der Ich-Struktur als tertium comparationis..... S. 164 2. Das Absolute als Grund der Ich-Strukturen................................................. S. 170 3. Der Vollzug der Ich-Strukturen im Vergleich............................................. S. 174 VII. SCHLUSSWORT................................................................................................ S. 185 NACHWORT................................................................................................... S. 186 LITERATURVERZEICHNIS........................................................................ S. 188 VORWORT Die weltweit operierenden Wirtschaftsunternehmen sowie die Grenzen überschreitende Vernetzung der Informations- und Telekommunikationsbranche münden in einem Synergismus, dessen Dynamik weitläufig mit dem Begriff der „Globalisierung“ zur Sprache gebracht wird. In Folge dieses Prozesses erfährt die bisherige Identitätsbildung aller Gruppierungen bis hin zu jedem einzelnen Menschen einen grundsätzlichen Wandel. War es der Einzelperson noch vor einigen Jahrzehnten möglich gewesen, der eigenen Ich-Identität durch den Vollzug der Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten Sippe, einem Volk, einer Nation, Religion oder Staat Ausdruck zu verleihen, so erfährt diese Identität im Zuge der oben erwähnten Globalisierung eine Relativierung, eben weil sie sich von einem größeren Ganzen herausgefordert sieht, das noch unbestimmt, weil nicht identifiziert ist, und verlockend zu einer neuen Identitätsbildung einlädt. Bei diesem Prozess handelt es sich keinesfalls um ein bislang völlig unbekanntes Phänomen, waren doch die bereits vollzogenen Übergänge von der Sippe zum Stamm, vom Stamm zum Volk und vom Volk zum Staat nichts anderes als das Aufgehen – keinesfalls jedoch der Verlust! – der kleineren in eine nächst größere Identität. Wird daher jegliche auftretende Identität als Prozess der Identitätsbildung begriffen und mit diesem gleichgesetzt, mithin dynamisch verstanden, so muß ihr Vollzug ganz von sich aus immer um neue Einsichten und Erkenntnisse angereichert, vor allem also vergrößert werden. Ein Ist-Zustand der Identität wäre dagegen statisch und ein Beharren auf ihm widerspräche dem Fluss der Identitätsbildungen, weil er – in der Regel – von außen als reaktionär und totalitär bezüglich seiner Wirkung wahrgenommen werden kann. Die Gesetze der Ökonomie aber, die seit eh und je für einen Grenzen überschreitenden Austausch unter den zahlreichen Völkern gesorgt haben, erfahren innerhalb des Prozesses der Globalisierung ihre erste kritische Relativierung darin, daß das ökonomisch Mögliche allzu oft human und ökologisch unverträglich, ja sogar zerstörerisch wirkt. 1 Eine zweite Relativierung ergibt sich: obwohl wir zunehmend und zeitgleich - eben im Zuge der Globalisierung - an jedem Ort der Erde Zugang zu den gleichen Informationen und Produkten haben können, verstehen wir diese aber nicht gerecht zu verteilen und sehen uns außerstande, Konflikten unter Menschen ein Ende zu bereiten. Wir scheinen eher an den gegebenen Identitäten festzuhalten, die dann auf dem globalen Markt der Interkommunikation gegen andere nicht nur behauptet, sondern vor allem durchgesetzt werden, als handele es sich hierbei um für die Ewigkeit festgelegte Größen. Damit ist die so verstandene Globalisierung zunächst nichts anderes als das größtmögliche Schlachtfeld für den Schlagabtausch bestehender Identitäten und Identifikationen, wie es Samuel P. Huntington in seinem berühmten Aufsatz „The Clash of Civilizations?“ im Akademischen Journal „Foreign Affairs“ bereits im Jahre 1993 ausgemalt hatte. Es muß also einen qualitativen Unterschied geben zwischen dem, was unter Globalisierung zu verstehen ist, und dem, was unter einer globalen Identität begriffen werden kann. Globalisierung könnte auch die räumlich uneingeschränkte Expansion der Interessen und Identitäten einer fest definierten Gruppe sein, und die Regeln für diese Expansion fallen zunächst in den Zuständigkeitsbereich von Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissenschaften, die, um der Aufgabe gerecht zu werden, bereits im globalen Austausch stehen müssten. Weil aber hier die Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissenschaften selbst Erzeugnisse herrschender Identitäten sind und in dieser Funktion immer schon und immer nur bereits als Konfliktparteien auf dem globalen Markt menschlicher Kommunikation auftreten können, werden sie damit in ihrer Funktion als relative Erscheinungen - und somit per definitionem - niemals in der Lage sein können, dem ganzen Prozess der Globalisierung an sich und damit sich selber eine grundlegende Werte-Hierarchie zu schaffen, nach der der Prozeß der Globalisierung zu verlaufen habe, ohne daß diese WerteHierarchie, genau wie ihre Schöpfer, dem Fluß der Unbeständigkeit anheim fallen würde, mithin dem Anspruch der allgemein gültigen Grundlage widerspräche. Hier wird der Ruf nach einer globalen Werte-Ordnung laut erhoben – so etwa von Hans Küng mit seinem Projekt eines „Weltethos“ - und das Anliegen aus der strukturellen Ohnmacht heraus allgemein verständlich: eben solch eine globale Werte-Ordnung ermöglichte einen Austausch nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern gewährleistete gleichzeitig dessen organisches Wachstum zum Wohle aller. 2 Deutlich ist damit: Globalisierung und eine globale von allen zumindest nachvollziehbare Werteordnung sind zwei unterschiedliche Größen. Bei einer solchen Werteordnung nämlich handelt es sich um den möglichen Zugang zu einer globalen Identität, welche, um ihrem Anspruch der Allgemeingültigkeit gerecht zu werden, von jedem Menschen in völliger Unabhängigkeit von allen ihn bestimmenden Determinationen immer wieder vollzogen werden könnte und angesichts der Ernsthaftigkeit der Lage der Menschheit wohl auch müsste. Damit entspricht die Frage nach der notwendig gewordenen globalen Identität der bislang grundsätzlichen Frage überhaupt, nämlich der Frage: Wer bin ich? Dieser Frage widmet sich bereits ein breites Spektrum von Naturwissenschaften, ebenso auch die verschiedenen Religionen, wie das Vaticanum II in seiner „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“ („Nostra Aetate“), 1., wegweisend gesehen hat. Dies trifft vor allem die Lehren der Hochreligionen bereits vom Zeitpunkt ihres jeweiligen Entstehens an. So kann nachvollzogen werden, weshalb gerade zu diesem Zeitpunkt das Interesse seitens der Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissenschaften an spirituellen Themen, welche bislang die Domäne der Religionen waren und in der Neuzeit in weiten Teilen der Bevölkerung zum Privatissimum des freien Menschen gezählt werden, stetig zunimmt. Die Dringlichkeit der Beantwortung der Frage nach dem Ich und der Hierarchie seiner Identitäten wird zusätzlich dadurch verstärkt, daß der Sog der allgemein stattfindenden Globalisierung Menschen und Gruppierungen unterschiedlicher bis konträrer Identitäten direkt (durch Reisen, Auswanderungen, Migrationen, Geschäftstätigkeiten usw.) und indirekt (durch Massenmedien und den Konsum gleicher Produkte) einander begegnen läßt, ohne daß gleichzeitig die Möglichkeit der Anknüpfung an eine allgemein gültige und Konflikt transzendierende Grund-Lage bestünde. Zu dieser Situation kommt es nicht nur im Augenblick der Konfrontation selber, sondern oftmals bereits zuvor, indem die Identitäten der bestehenden Gruppierungen ihren Mitgliedern nicht selten in der einen oder anderen Weise den uneingeschränkten Umgang und Austausch auf der nächst höheren oder gar globalen Ebene untersagen, weil sie die eigene Identität statisch und exklusiv begreifen und damit oft als einzig wahr, mithin diese absolut und universal setzen oder die Gefahr ihrer Relativierung, ihrer Revidierung, ja sogar ihrer Aufgabe erahnen, was mit der Angst vor dem Neuen und dem Verlust des Gewohnten verknüpft ist. 3 Weil aber – und so scheint es zumindest – alles menschliche Handeln letztlich auch mit Identitäten verknüpft ist, so erscheint es als fraglich, ob die Suche nach einer allgemeinen Grundlage oder Werte-Hierarchie, einer globalen alle Menschen umfassenden Identität, überhaupt möglich ist. Und wenn, handelt es sich dabei - um eine Übereinkunft in der Art einer Absprache zwischen den Vertretern der jeweiligen Gruppierungen, oder um einen aus dieser Absprache mangels rationaler Argumente entstandenen globalen Glaubensakt, gleichsam ein Postulat, oder könnte es sein, daß jeder Einzelne die Einsicht in diese Grundlage mittels spiritueller Übung erlangen kann, wie sie etwa innerhalb aller Hochreligionen seit Jahrtausenden gelehrt und praktiziert wird? Treffen die beiden letzten oder nur die letzte dieser drei Fragestellungen den Sachverhalt richtig – die erste scheidet allein schon aus Gründen der Beliebigkeit der Antworten aus –: begeben wir uns damit nicht in den persönlichen, vom freien Entschluß bestimmten Bereich menschlichen Handelns, wo nichts erzwungen und befohlen werden kann? Und: läge dann nicht das Gewahr-werden der Grundlage menschlichen Handels im persönlichen Ermessen eines jeden von uns, dieses Wagnis einzugehen, was neben einer allgemein akzeptierbaren Ausrichtung zusätzlich noch viel Geduld und Liebe voraussetzen würde? Diese und ähnliche Fragen ergeben sich zwangsläufig aus dem Umkreis des zu behandelnden Themas und sie sind es, die erneut einen Blick in den Bereich des religiösen Wissens erfordern. Eine Reihe von Forschungsergebnissen im Bereich der vergleichenden Religionswissenschaften führt zum unmittelbaren Ergebnis, daß die absolute Grundlage aller möglichen Wertesysteme, eben ihrer Absolutheit wegen, niemals das alleinige Gut einer einzigen der fünf Hochreligionen sein kann. Alle Hochreligionen lassen sich erst dadurch als unterschiedlich bestimmen, daß sie Universalität der Absolutheit ursprünglich und unterschiedlich beanspruchen. Eben dieser Begriff des universalen Absoluten muß, so er seinem Namen gerecht werden will, der jeweils zeitlichen und räumlichen Erscheinung seiner ihn offenbarenden Religion bereits immer schon als dieser vorausliegend gedacht werden, und das ganz selbstverständlich ohne die geringste Möglichkeit der Abgrenzung gegen den Begriff des Absoluten 4 innerhalb der übrigen Hochreligionen, so diese ebenfalls über einen solchen verfügen, weil allein schon die Möglichkeit der Abgrenzung des universalen Absoluten seiner Relativierung gleichkommt, mithin diesen Begriff aufhebt. Und weil der Begriff der globalen Identität, der eine Nähe zum Begriff des Absoluten hat, allein schon der Notwendigkeit seines Vollzugs wegen nicht abseits der sich vollziehenden Ich-Struktur eines jeden Menschen gedacht werden kann, ist die Suche nach dem Begriff der absoluten Identität sowohl naheliegend als auch notwendig. Diese Suche kann in unterschiedlichen Wissenschaften mit unterschiedlichen Methoden und Zielen betrieben werden. Innerhalb der Geschichte der Religionen aber hat diese Suche in dem einen Anhalt, was gemeinhin als Mystik verstanden wird: wird dort doch der Vollzug absoluter Identität behauptet. Und weil es sich bei der Mystik – der Begriff wird seiner weitläufigen Verwendung wegen zunächst zu klären sein – etwa im Falle des ZenBuddhismus oder des abendländischen Mönchstums keinesfalls um Einzelmeinungen oder Erscheinungen, vielmehr aber um Kultur- und damit Identität bildende Größen handelt, wird das Problem der Objektivität dieser Untersuchung und des Vergleichens an sich ebenfalls zu bedenken sein, zumal kein mit diesem Thema ernsthaft Befasster sich diesen identitätsbildenden Größen selbst völlig entziehen kann. Weshalb nun gerade Meister Eckhart und der Zen-Buddhismus? Diese Themenstellung, zumal als Vergleich, ist nicht neu. Im Abendland wie auch im fernen Osten sind die oben genannten Größen jedoch unter anderen Aspekten verglichen worden. Sie sind über die jeweiligen Religionen hinaus auch bezüglich vorliegender Themenstellung als Autoritäten anerkannt werden. So wird es möglich sein, eine über die kulturellen Barrieren hinausgehende Vertrautheit vorauszusetzen, ohne die Anzahl vielfältiger Mißverständnisse zu vermehren. 5 EINLEITUNG Die Untersuchung der Ich-Struktur in der Mystik Eckharts und im ZenBuddhismus läuft auf einen Vergleich beider hinaus. Dieses ist nichts Neues, werden doch der Buddhismus und das Christentum im Allgemeinen, das Zen und die christliche Mystik im Besonderen in den letzten Jahrzehnten oft gegenübergestellt und ihre Beziehungen zueinander untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen bislang zwei Grundpositionen erkennen: Die erste dieser Positionen behauptet, daß auf beide Größen der Begriff „Mystik“ zutreffe, da sie die Absicht verfolgten, eine unmittelbare Erfahrung Gottes, des Göttlichen, der Ersten Wirklichkeit oder der Nichtdualität zu erreichen; die Unterschiede zum jeweils anderen ergäben sich nicht aus dieser Erfahrung heraus, die in beiden Fällen als identisch angenommen wird, sondern lägen in den kulturell-sprachlichen Besonderheiten, wodurch das einheitlich Erfahrene unterschiedlich reflektiert und benannt werde, bzw. der Weg in diese Erfahrung kulturbedingt verschieden verlaufe1. 1 Vgl. dazu: W. Jäger, Geh den inneren Weg, Freiburg 1996, S. 9: „Die Erste Wirklichkeit, die wir Abendländer seit einigen Jahrtausenden Gott nennen, wird von den einzelnen Religionen verschieden benannt: das Absolute, Gottheit, Tao, Sunyata, Nirwana. Der Versuch dieser Ersten Wirklichkeit einen für alle akzeptierbaren Namen zu geben, trennt die Religionen. Daher kam es in der Geschichte immer wieder zu Glaubenskriegen, zu Verfolgungen, Verleumdungen, Herabsetzungen usw. (...) Religionen sind Wege, auf denen der Mensch zu seinem Ursprung zurückfinden soll, zu dem, was wir unser tiefstes Wesen nennen oder auch das Göttliche in allem, was existiert.“ Weil es die gleiche „Erste Wirklichkeit“ ist, die allem zugrunde liegt, sei auch die Erfahrung dieser in allen Religionen gleich. Diese Erfahrung wird als „Transkonfessionell“ begriffen. Ausführlicher zum gleichen Thema vgl. ders.: Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, Petersberg 1996.; und: Auf der Suche nach der Wahrheit, Petersberg 1999: Hier wird Meister Eckharts Begriff „gotheit“ mit dem Begriff der „Leere“ im Zen verglichen und gleichgesetzt. Eine ähnliche Position, wenn auch umfassender begründet und detaillierter strukturiert diskutiert K.Wilber in: Eros, Kosmos, Logos, Frankfurt am Main 1996. Wilber denkt die gesamte Evolutionsgeschichte als eine auf diese Erfahrung hinaus orientierte Bewegung. Die gegenwärtig erreichte Stufe bezeichnet er, in Anlehnung an Habermas, Kohlberg und Gilligen als „formal – operationales Bewußtsein“, dessen Weiterentwicklung „ ...jenseits der Vernunft und niemals – niemals – diesseits“ (S.29) stattfinden werde. Dieser „Raum“ jenseits der Vernunft lasse sich in vier aufeinander aufbauende Stufen gliedern (die psychische, subtile, kausale, nichtduale, und er denkt deren zugehörigen Referenten als die Naturmystik, Gottheitenmystik, formlose Mystik und nichtduale Mystik, S. 344), wovon 6 Die zweite Position vertritt die Ansicht, daß die Mystik nicht Religions- und Kultur- übergreifend existiere; daß diese nur innerhalb einer konkreten Religion begreifbar sei, und zwar als besonderer Ausdruck derselben. Deswegen sei auch das, was innerhalb der Mystik als Gotteserfahrung gelte, immer schon bezogen auf den Inhalt der jeweiligen Religion und bezüglich der Inhalte befänden sich das Christentum und der Buddhismus in keinerlei Übereinstimmung, da die erste Gott zum Inhalt ihrer Bewegung habe (Religion) und seine Erfahrbarkeit (Mystik) zulasse2, während im Buddhismus die Leere (Śūnyatā) als Prinzip eingesehen werde (Religion) und deren unmittelbare Erfahrung (Mystik/Zen) als die Vollendung der Buddhaschaft gelte3. die letzte, die „Nichtduale“, aller Evolution voraus und zugrunde läge, daher immer und überall, unabhängig von der individuellen Konditionierung erreicht werden könne. Sie werde auch immer wieder erreicht, beispielsweise von Meister Eckhart (S. 378 ff.). Auf die Arbeit von K. Wilber kommen wir im Zusammenhang von Sprache und Mystik (Kap. I. 1) dieser Arbeit zu sprechen. Abschließend sei noch auf das Werk H. E. – Lassalles verwiesen und hier exemplarisch für alle: Zen und christliche Mystik, Freiburg. i. BR. 1986. Die Position Lassalles läßt Eindeutigkeit in der Begriffsbestimmung vermissen. So wird Zen als Erfahrung verstanden und der christlichen Mystik (dieser Begriff wird ohne Bestimmung eingeführt) gleichgesetzt. Diese wiederum muß, um dem Vergleich standzuhalten, auf den Begriff der Naturmystik (ebenfalls keine eindeutige Bestimmung und Abgrenzung des Begriffes) beschränkt bleiben, will man den christologisch – theistischen Inhalt des Christlichen aufrechterhalten. Damit bleiben die zahlreichen Einzelvergleiche ohne Gesamtbezug stehen. 2 Der Ort der Unmittelbarkeit einer Gotteserfahrung im Christentum und vor allem in den einzelnen Konfessionen ist nicht eindeutig formuliert. Diesbezüglich sei nur an die vermittelnde Aufgabe der Gnade, der Sakramente und der ecclesia an sich erinnert. 3 Vgl. dazu das Werk von D.T. Suzuki. Obwohl er dem Gedanken Eckharts sehr interessiert gegenübersteht und darin viele Parallelen zum Zen sieht (vgl. hierzu: Der westliche und der östliche Weg – Über christliche und Buddhistische Mystik, Frankfurt am Main, 1995), bleiben seiner Ansicht nach das Zen und die Christliche Mystik voneinander unterschieden vgl. dazu: Leben aus Zen. S.28 ff. Darüber hinaus sei die Religion des Westens immer schon eine „Religion der Fleischwerdung des Logos“, im Gegensatz zum Zen, das als Religion des Ostens in der Gegenbewegung der „Exkarnation“ gründe. Vgl. dazu: H. Rzepkowski, Das Menschenbild bei D. T. Suzuki, Steyl 1971, S. 28. Zu einem ähnlichen Schluß kommt S. Ueda in seiner Untersuchung: Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit. Die mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre Konfrontation mit der Mystik des Zen-Buddhismus, Gütersloh 1965: „Durch unseren kurzen Vergleich mit dem Zen-Buddhismus zeigt sich also die Mystik Meister Eckharts in ihrer Untrennbarkeit von der christlichen Grundlage als eine christliche Mystik...“(S.169). Eine ähnliche Meinung über die grundsätzliche Unvereinbarkeit beider scheint in der SotoSchule des Zen verbreitet zu sein vgl. dazu: D.G. Merzel, W sercu zen - Oko nigdy nie śpi, Warszawa 1994, S. 61. 7 Diese Stellungnahmen markieren die beiden äußeren Rahmen der gegenwärtigen Diskussion. Die prinzipielle Schwierigkeit des Vergleiches beider liegt (und hier herrscht allgemeiner Konsens) in der verstandesmäßigen, ja selbst vernunftmäßigen Unerreichbarkeit des angegebenen Inhaltes der einzelnen mystischen Bewegungen4. Aus dieser Einsicht heraus wird auch die Unmöglichkeit der Begriffsbestimmung der Mystik an sich gefolgert, was nicht etwa dazu führt, konsequenterweise darüber zu schweigen, sondern im freien Austausch des Meinens mündet, und zwar in der Weise, daß der Begriff „Mystik“, ähnlich wie der der „Religion“, von einer konkreten Religion/Mystik – hin der Regel der eigenen bzw. der bevorzugten – abgeleitet und derart bestimmt, auf eine andere konkrete Religion/Mystik angewandt wird. Dadurch erfährt das Einzelne eine Erhebung in den Status des Allgemeingültigen und wird als solches zum Maßstab für den Vergleich Von der christlichen Seite wird diese Position ebenfalls häufig vertreten. Vgl. dazu exemplarisch: J. Sudbrack: Mystik. Selbsterfahrung – Kosmische Erfahrung – Gotteserfahrung. Mainz/Stuttgart 1991 und: Meditative Erfahrung – Quellgrund der Religionen. Mainz/Stuttgart 1994. Trotz vieler Ähnlichkeiten und inspiritativer Momente gäbe es immer nur die jeweils konkrete, meistens innerhalb einer Religion auftretende und aus ihr heraus zu verstehende Mystik. Von einer übergreifenden Mystik zu sprechen, führe in den Synkretismus. Diesbezüglich auch das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche Papst Johannes Paul II.: „Daher besteht trotz so mancher Übereinstimmung ein wesentlicher Unterschied. Die christliche Mystik aller Zeiten (...) entsteht nicht aus einer rein negativen Erleuchtung, die dem Menschen das Böse bewußt werden läßt, das aus seinem Festhalten an der Welt mittels der Sinne, des Intellekts und des Geistes hervorgeht, sondern sie entsteht aus der Offenbarung des lebendigen Gottes.“ In: Johannes Paul II, Die Schwelle der Hoffnung überschreiten, Hrsg. Vittorio Messori, Hamburg 1994, S. 115. Unter den neueren Veröffentlichungen deutscher Sprache ist vor allem zu beachten: K. Ceming: Einheit im Nichts. Die mystische Theologie des Christentums, des Hinduismus und des Buddhismus im Vergleich. Augsburg 2004. Ungeachtet des missverständlichen Titels („mystische Theologie“ im Zusammenhang mit „Buddhismus“?) legt die Autorin eine weitgreifende Untersuchung vor, in deren Verlauf sie übereinstimmende Grundzüge und Differenzen zwischen christlichem und buddhistischem Gedankengut genau betrachtet (vgl. besonders S. 269 ff.). 4 Angesichts der Fülle der Aussagen zu diesem Thema überrascht das prinzipielle Beharren auf der Feststellung der Unerreichberkeit, mithin der Unaussagbarkeit. Wissenschaftsgeschichtlich begegnet dieses Problem erstmals deutlich bei R. Otto: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. (erstmals 1917), München 36.-40. A. 1971. Die bei Otto auf den Inhalt von Religion bezogenen Überlegungen finden sowohl für diese wie auch für die Mystik in der Folgezeit zahlreiche Anhänger. Der Gedanke Unerreichbarkeit des Inhalts dieser Erfahrung mittels Verstand und Vernunft gilt als eine starke Tradition abendländischer Philosophie. Exemplarisch sei hier nur auf Plotin hingewiesen, der im Verlauf dieser Arbeit genau diesbezüglich zitiert wird. 8 herangezogen, was jeglicher Objektivität entbehrt, könnte diese doch erst als Folge der begrifflichen Bestimmbarkeit des Allgemeinen auftreten. Ist aber eine solche im Falle der Mystik überhaupt denkbar? Und wenn nicht, wird ein Sprechen „darüber“ von vornherein bedeutungslos? Gründete dann nicht jeder und vor allem ein der Religionswissenschaft verpflichteter Ansatz im Sinnlosen, wollte dieser im Anliegen nicht nur die Mystik benennen, sondern auch noch den Grund der Benennung bestimmen? Lässt aber die Mystik im Allgemeinen keine begriffliche Bestimmung zu, so ist die Zuwendung zum Einzelnen, hier dem „Ich“ und seiner Struktur, ebenfalls sinnlos, weil eine solche, der abendländischen Tradition zufolge, nur vom Allgemeinen zum Einzelnen hin möglich ist und nicht umgekehrt. Damit ist die Durchführbarkeit der Absicht dieser Untersuchung fraglich geworden, denn wie soll das jeweilige Ich (anders formuliert: der Mystiker) bestimmbar sein, wenn die Mystik als solche es nicht ist? Und ist dem so, führt dann nicht jeder Vergleich beider Größen ins Beliebige, weil er im Beliebigen gründet und von dort seine Bestimmung bezieht?5 Mit diesen Feststellungen sind wir an die Grundlagen des Vergleiches von beiden Größen angekommen. Im Falle der Mystik wird hier, wenn es um Grundlegendes geht, von „Erfahrung“ gesprochen, die dem „Ich“ in der Regel nach gewissen Übungen zuteil werde. Diese Erfahrung eignet sich für einen religionswissenschaftlichen Vergleich nur dann, wenn sie eine Begriffsbestimmung ihres Inhaltes zulässt und damit aus der Vereinzelung des Unsagbaren und somit auch dem Begriffe nach Unbestimmbaren in die Kommunikabilität des Vergleiches hineintritt. Damit unterscheidet sich die „Grundlage“ des Inhalts der Mystik von der Vorgehensweise dieser Untersuchung dadurch, daß die zweite immer schon und immer nur eine Reflexion der ersten bleiben wird und bleiben will. 5 Beispielsweise vertritt F. de Saussure die Meinung, das Allgemeine ließe sich vom Besonderen ableiten. Im Verlaufe seiner Untersuchungen zeigt sich jedoch, daß das Einzelne immer schon, meist implizit, aus einem größeren Kontext heraus bestimmt worden ist und niemals umgekehrt. Vgl. dazu: Linguistik und Semiologie, Notizen aus dem Nachlaß, Frankfurt a. Main 1997, S. 66 und den Aufbau seines Standardwerkes, Grundlagen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1967. Dort beginnt er mit der Definition der Sprache im Allgemeinen und kommt dann zu den besonderen Bestimmungen. Grundlegend dazu: Aristoteles, Metaphysik 982 b 2 f. Diese Methode ist auch für die Vergleiche innerhalb der Religionswissenschft von grundlegender Bedeutung, da sonst eine Fülle einzelner Vergleiche gezogen werden kann, die aus unbestimmten Kontext der Beliebigkeit anheimfallen. 9 Innerhalb einer vergleichenden Wissenschaft aber besteht der Fortschritt und mit ihm das Neue darin, daß die zu vergleichenden Sachverhalte auf Grund der beständig zunehmenden Weiterentwicklung der einzelnen Wissenschaften immer differenzierter und damit präziser erkannt werden können. Ist dieser Prozeß in ständiger Bewegung und in seiner Folge die bereits unternommenen Vergleiche, so verfügt er doch gleichzeitig und formell betrachtet über zwei Konstanten: Zum einen ist jeglicher Vergleich reflektiver Art, mithin ein Denkprozeß, der notwendigerweise einen Denker im Sinne eines Subjekts voraussetzt. Zum anderen, und aus dem ersten resultierend, muß der Inhalt des Vergleiches, da Gegenstand der Reflexion des Denkens, also völlig unabhängig in seiner eigentlichen Beschaffenheit, immer schon als Begriff vorliegen, weswegen auch eine jede Einzelwissenschaft letztlich als der Vollzug von Begriffsableitungen innerhalb eines zuvor festgelegten Gebietes verstanden – und somit wiederum – begriffen werden kann. Können aber seit dem Beginn der Neuzeit des abendländischen Denkens Denker und Denken als Subjekt des Denkens, mithin als einheitlich betrachtet werden, ergibt sich daraus ein einheitlicher Begriff. Daher kann die Begriffsableitung äußerer Gegebenheiten, wie die Aufrechterhaltung der eigenen Ich-Identität der Form nach betrachtet, identisch und nur inhaltlich unterschieden gedacht werden, da es sich um Begriffe handelt. Damit sind der Denker und das Denken auf das Engste miteinander verbunden, so daß der Begriff der Objektivität einer Untersuchung unmöglich ist, müsste er die beiden Konstanten nicht nur statisch, sondern auch noch getrennt voneinander denken, was im Widerspruch mündet. Weil also das Subjekt und Objekt einer jeden und so auch dieser Untersuchung der Form nach, da jeweils Begriffe, konstant bleiben und nur dem Inhalt nach variieren, sind sie (als Begriffe) ihre Grundlage, weswegen auch die begriffliche Ableitung der Ich-Strukturen bereits eine Abhandlung über die Grundlagen dieses konkreten Vergleiches ist, wie auch eines jeden anderen Vergleiches sein kann. Dieser „Versuch über die Grundlagen des Vergleiches“ versteht damit unter Grundlagen die Begriffsbestimmung der Mystik im Allgemeinen und die des „Ichs“ im Konkreten, und zwar genau in der angegebenen Reihenfolge, soweit das religionswissenschaftlich möglich ist, und bringt dadurch Begriffe hervor, welche einem Vergleich zur Verfügung stehen können und diesen als solchen ermöglichen. 10 Das so Erkannte markiert zugleich eine Grenze, deren Überschreitung das Sprechen zunächst in den Modus des Konjunktivs umwandeln müsste, bevor es ins bloße Meinen herabgleiten würde. Diese Untersuchung bleibt deswegen auch ein „Versuch“, weil sie von dem Einen lebt, das dem Denken und Sprechen immer schon bestimmend vorausliegt und sich zugleich nicht als bestimmt und begriffen ableitet und ergibt. Das bisher Gesagte ordnet die Reihe der Untersuchungen: Als Erstes wird die Möglichkeit und die Notwendigkeit der allgemeinen Begriffsbestimmung der Mystik aufgezeigt (erster Teil) und am Werk Eckharts und dem Zen überprüft (zweiter und vierter Teil), um aus diesem Verständnis heraus die Ich-Struktur innerhalb des Werkes Eckharts (dritter Teil) und dem Zen (fünfter Teil) getrennt voneinander bestimmen zu können. Die auf diesem Wege gewonnen Begriffe werden dann, im sechsten Teil, einem Vergleich unterzogen. 11 I. MYSTIK – EINE BEGRIFFSBESTIMMUNG Wird das Werk Meister Eckharts als Mystik und er selber als Mystiker bezeichnet und wird gleichzeitig derselbe Begriff auf den Zen-Buddhismus angewandt, so wird damit von vornherein nicht nur ein Vergleich getroffen, sondern die Zuordnung beider Größen unter den gleichen Begriff vorgenommen. Diese Art der Begriffsanwendung setzt nicht nur seine allgemeine Bestimmbarkeit6, sondern eine bereits vorliegende Bestimmung voraus, die einer jeden konkreten Mystik zugrunde gelegt werden muß, damit diese als solche erkannt werden kann7. Eine solche allgemeine Begriffsbestimmung der Mystik aber liegt der Religionswissenschaft nicht vor, und es lassen sich grundsätzlich zwei 6 Der Skeptiker Agryppa vertitt die generelle Unmöglichkeit einer begrifflichen Bestimmbarkeit, da diese immer schon eine vorherige Bestimmung voraussetzen würde und das ins Unendliche. Vgl.: Hypotyposes, I 166. Ähnlich Sextus Empiricus in Hypotyposes, II 207. Beides in: A. Chojecki, Mowa mowy – o języku wspόłczesnej humanistyki. Gdańsk 1997. Gegen diese auf Beliebigkeit hinauslaufende Bestimmbarkeit des Konkreten gilt der „Satz vom (zu vermeidenden) Widerspruch des Aristoteles. Vgl. Aristoteles, Metaphysik 1005 b 19f. Damit ist diese Diskussion aber bereits zu Beginn der abendländischen Philosophie geklärt worden. 7 Den Versuch einer solchen Bestimmung liefert A. Paus, Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 31998, Bd.7, S. 583: Demnach ist Mystik, religionsgeschichtlich gesehen „Ausdrucksform des vorübergehenden, unmittelbaren, integralen Ergriffenseins od. werdens des homo religiosus von der numinosen anderen Wirklichkeit...“ Allein schon anhand des Begriffes „homo religiosus“ zeigt sich die Schwierigkeit der Anwendung dieser Definition für die Religionswissenschaft, setzt diese Definition doch die Bestimmung eines Menschen und seiner wie allgemein auch immer gefassten Religiosität voraus. Die prinzipielle Behauptung der Ichlosigkeit im Zen und sein Begriff der „Leere“ lassen sich dann aber von dieser Art der Begriffsvorlage nicht ableiten und als Mystik erkennen. D. Mieth bemerkt die Schwierigkeit einer allgemeinen Definition der Mystik und beschränkt sich deswegen nur auf die Bestimmung der christlichen Mystik: vgl. dazu: Die Einheit von Vita activa und Vita contemplativa, Regensburg 1969. Auch die Überlegungen über „Das Wesen der Mystik. Eine heuristische Skizze“ (S. 11 ff.) sowie der Forschungsbericht über „die moderne Mystikforschung“ (S. 383 ff.) im 1. Bd. des monumentalen Werkes (mit weitläufigem Literaturverzeichnis) von B. McGinn, Die Mystik im Abendland. Aus dem Engl. übers. von Clemens Maaß. Freiburg/Basel/Wien 1994 ff. beziehen sich dem Titel des Werkes entsprechend ausschließlich und bewußt auf die christliche Mystik. Gleiches gilt für das Werk von K. Ruh „Geschichte der abendländischen Mystik“, 4 Bde., München 1990 - 1999. Dieses monumentale Werk erhebt eine Reihe von Bestimmungen, die gleichwohl nicht religionsübergreifend und schon gar nicht für „Vergleiche“ außerhalb monotheistischer Religionen gedacht sind. 12 Gründe dafür benennen, weshalb die vorhandenen Bestimmungen innerhalb der Religionswissenschaft nicht allgemein anerkannt werden: 1. Zum einen wird behauptet, die Mystik als solche liege außerhalb des Zugriffs der Sprache, der Logik und der Vernunft und sei deswegen, in ihrem Wesen, durch diese weder erreichbar noch bestimmbar8; 2. Zum anderen sei Mystik, innerhalb der fünf Hochreligionen, immer schon als Teil einer konkreten Religion erkannt und von dieser abgeleitet worden mit dem Ergebnis, es existiere immer nur eine konkrete Mystik, genauso wie es immer nur eine konkrete Religion geben könne9. 1. Der erste Einwand unterscheidet nicht zwischen dem Begriff der Mystik und ihrem eigentlichen Referenten, d.h. im Falle des Meister Eckhart und des Zen, zwischen der „gotheit“ (Eckhart) bzw. der „Leerheit“ (Zen) an sich und dem Begriff der „gotheit“ und „Leerheit“ als Inhalt der Reflexion. Genauer ausgedrückt: Es wird nicht zwischen den drei Komponenten des sprachlichen Gefüges differenziert, die nach F. de Saussure aus dem Signifikanten, also dem Bezeichnenden, dem Signifikat, also dem unter dem Signifikanten Vorgestellten, und dem eigentlichen Referenten bestehen10. Am Beispiel des eckhartschen Begriffes „gotheit“ soll dies verdeutlicht werden: Der Signifikant ist das geschriebene oder gesprochene Wort „gotheit“. Das Signifikat ist das, was unter diesem Begriff denkbar und vorstellbar ist (hat also seinen Ort in der Reflexion!), während der Referent, auf den der Signifikant und das Signifikat hindeuten, die „gotheit“ selber und an sich ist (jenseits der Reflexion!). Beide Seiten also, Signifikant/Signifikat auf der einen und der Referent auf der anderen, sind nicht identisch. Wird jetzt das Signifikat, also der reflektierte Begriff „gotheit“, mit dem Referenten, also 8 D.T.Suzuki überträgt den abendländischen Begriff Mystik ohne vorherige Definition auch auf das Zen, und das in der Weise, daß dem Zen alleine diese Begriffszuordnung zukomme. Damit soll zwar das Zen „mehr“ Mystik sein als das Christentum; was aber unter dieser „Mystik“ allgemein zu verstehen ist, wird nicht deutlich, so daß im Ergebnis das „mehr“ einen eher emotionalen Charakter bekommt. Vgl. dazu: Leben aus Zen, München 1987, S. 45. 9 Vgl. F. de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1967, S. 78 ff. 10 Vgl. F. de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1967, S. 78 ff. 13 der „gotheit“ selber, gleichgesetzt, so liegt hier ein Mißverständnis vor, gegen das jede Kritik seitens der Vertreter der Wissenschaft wie auch der Mystik angebracht ist. Keineswegs zulässig ist dagegen die Schlußfolgerung, Mystik sei deswegen nicht bestimmbar. Die Verwechslung der Ebene der Reflexion (Signifikat) mit der der unmittelbaren Anwesenheit (auch „Erfahrung“ genannt) beim Referenten (im Falle Eckharts bei der „gotheit“) ist gleichzusetzen mit der Verwechslung von begrifflicher Bestimmbarkeit mit realer Anwesenheit, mit Ein-Sicht. Wiewohl die zweite Ebene der Ersten immer schon zur Voraussetzung ist, zeigt innerhalb der einzelnen Religionen die Stellung des jeweiligen Hervortretens des Einen in die Vielheit, daß keine der – vor allem theistischen Hochreligionen – eine unmittelbare und unvermittelte Anwesenheit bei ihrem eigenen Prinzip kennt und deshalb ihr Wissen (Signifikat) um diese Einheit aus dem Erscheinen dieser in der Vielheit (Inkarnation im Christentum, Thora im Judentum, der Koran im Islam, usw. als der jeweilige Referent) bezieht. Es ist also immer schon und immer nur – innerhalb einer konkreten Religion gedacht - die Einsicht in die aus sich hervorgetretene Einheit, der Gegenstand/Referent der Reflexion/Signifikat, und das auf Grund ihrer unmittelbaren Erfahrbarkeit (Vielheit der Reflexion kann nur Vielheit zu ihrem Gegenstand haben), weil hier das Hervorbringende und Hervorgebrachte – vorgreifend formuliert – als zwei Pole einer einzigen Größe gedacht werden. Signifikat/Signifikant auf der einen Seite und der Referent auf der anderen, bilden damit zwei Pole eines Ganzen. Läßt man eine der beiden Seiten unberücksichtigt, beispielsweise die des Signifikates/Signifikanten, fällt der Referent in die Beliebigkeit und Inkommunikabilität. Umgekehrt, verzichtet man auf den Referenten, ereignet sich die Reflexion/Signifikat als bloßes Meinen11. Dem Sachverhalt zufolge sollte die Bestimmung der Mystik den Mystikern überlassen bleiben, ist ihnen doch eine unmittelbare Einsicht in den Referenten gegeben. 11 Ausführlicher zum Problem der Sprache und der Mystik sowie der Mystik als Wissenschaft: K. Wilber, Eros, Kosmos, Logos, Frankfurt a. Main 1996. S. 333 ff. Auf der Sprachtheorie de Saussures aufbauend und unter Hinzufügung der Merkmale einer „Wissensuche“,die er in der Injuktion, dem Erkennen und seiner Bestätigung sieht, plädiert Wilber sogar für die Bezeichnung der Mystik als Wissenschaft. S. 339 ff. 14 Diese Feststellung als Einwand wäre dann richtig, wenn dieses Vorhaben auch eine solche Einsicht im Sinne der unmittelbaren Anwesenheit beim Einen für sich beanspruchen würde (in unserem Beispiel also ein wie auch immer gedachtes „Erreichen“ der „gotheit“ oder der „Leere“) und hierfür gilt auch die Grenze, auf die in der Einleitung zu dieser Arbeit hingewiesen worden ist. Für die Religionswissenschaft ist aber die Mystik als Erscheinung innerhalb der bestehenden Religionen der Referent und daher von Interesse, und zwar in der Weise, daß deren Absicht auf die Möglichkeit einer begrifflichen Bestimmbarkeit hin bedacht wird, was gerade nicht gleichgesetzt werden darf mit der Meinung, damit werde ein Versuch unternommen, ihr Ziel auf dem Wege der Benennung bzw. des Begreifens zu erreichen. Der Referent, der somit als Begriff der Reflexion/Signifikat gegenübersteht, kann zum Gegenstand dieser werden, da er keine Einheit sondern Vielheit ist, und in diesem Sinne als Gleicher vom Gleichen erkannt werden kann12. 2. Der zweite Einwand gegen eine allgemeine Begriffsbestimmung der Mystik deutet auf das Erscheinen einer immer schon konkreten Mystik innerhalb einer immer schon konkreten Religion. Aber genau diese Einsicht setzt ein Wissen darüber voraus, was Mystik im Allgemeinen ist: sie könnte nämlich als konkrete ohne das bereits vorausgesetzte Wissen um ihre allgemeine Bestimmung gar nicht als solche erkannt werden. Damit ist die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Begriffsbestimmung der Mystik gezeigt und gleichzeitig ein Hinweis auf die Vorgehensweise bezüglich dieser Bestimmung gegeben worden: Wird nämlich die Mystik als in allen Hochreligionen auftretende Erscheinung erkannt, und zwar als besonderes Merkmal einer jeden, in der Weise, daß die Hochreligionen als reflektierter Vorgriff auf den Inhalt von Mystik bestimmbar sind13, so läßt sich der Begriff der Mystik im 12 Vgl. dazu: Plotin, Enneade VI, 9, 11, 77. 13 Exemplarisch für viele: J. Sudbrack, Mystik, Mainz/Stuttgart 1988. Hier wird an Einzelbeispielen die Vielfalt der mystischen Erscheinungen aufgezeigt und ihre jeweilige Rückbindung an die Herkunft im Sinne der Kultur, Sprache und Religion hervorgehoben. Zwei allgemeine Definitionen der Mystik, nämlich als „ Aufgehen des Menschen in Gott oder im Göttlichen...“ (Wörterbuch der Religionen, Kröners Taschenbuchausgabe 1976.) und: „...nach innerer seelischer Erfahrung suchen, die durch äußere Sinneserfahrung nicht gewonnen werden kann.“ (Ökumene – Lexikon, Frankfurt 1987, Art. Mystik.) müssen hier mit dem Hinweis auf die erste Bemerkung (oben S. 12 f.) als unzureichend zurückgewiesen werden. In den angeführten Definitionen liegt eine Verwechslung zwischen einer allgemeinen Begriffsbestimmung der Mystik und der Deskription einer konkreten vor. Die 15 Allgemeinen von dem der Religion im Allgemeinen ableiten, vorausgesetzt, ein solcher steht der Religionswissenschaft zur Verfügung.14 Eine diesen Kriterien genügende Begriffsbestimmung der Religion liegt bereits vor.15 Sie lautet: „Religion gründet in der reflektierten Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart, hat das Wissen um die notwendige Voraussetzung der verborgenen Einheit zum Inhalt und ist im Beachten der Herrschaft des Prinzips von Allem lebendig.“16 Diese Begriffsbestimmung beansprucht deshalb zurecht die Bezeichnung einer allgemeinen, ist sie doch von keiner einzelnen Religion abgeleitet17, ermöglicht jedoch die Bestimmung jeglicher Religion. Zugleich in der Religionswissenschaft verankert und darüber hinaus der abendländischen Philosophie verpflichtet, steht diese Begriffsbestimmung in keinerlei Widerspruch zu den Prinzipien eben jener Philosophie in ihrer zweiten Epoche18. Aufgabe der Ersten besteht nicht darin, die Fülle der Einzelheiten einer konkreten zu beschreiben, wohl aber Kriterien zu benennen, anhand welcher eine jede als solche überhaupt erkannt werden kann. 14 Vgl. dazu besonders E. Feil (Hrsg.), Streitfall „Religion“. Diskussionen zur Bestimmung und Abgrenzung des Religionsbegriffs (= Studien zur systematischen Theologie und Ethik 21), Münster 2000. 15 Vgl. dazu M. Enders, Ist ‚Religion’ wirklich undefinierbar? Überlegungen zu einem interreligiös verwendbaren Religionsbegriff, in: M. Enders/H. Zaborowski (Hrsg.), Phänomenologie der Religion. Zugänge und Grundfragen, Freiburg/München 2004, S. 49 ff. Enders greift das Problem von seiner grundsätzlichen Seite auf und diskutiert eine Anzahl von Vorschlägen, um schließlich den von Uhde vorgeschlagenen Begriff (s.u. A 16 und 18) aufzunehmen und weiterzuinterpretieren (vgl. Enders S. 68, S. 86 f.). 16 B. Uhde, Gegenwart und Einheit – Versuch über Religion, Freiburg im Breisgau 1982. S. 8, sowie B. Uhde „Fiat mihi secundum verbum tuum“. Die Zurücknahme des menschlichen Willens als ein Prinzip der Weltreligionen. Ein religionsphilosophischer Entwurf, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 1/ 2002, S. 88 f. Die Arbeit von Uhde wie auch die hier folgenden Überlegungen sind eng angelehnt an den von Heribert Boeder vorgelegten Versuch einer prinzipiellen Betrachtung der abendländischen Philosophie. S. H. Boeder, Topologie der Methaphysik, Freiburg/München 1980. 17 Vgl. dazu H.-M. Haußig, Der Religionsbegriff in den Religionen. Studien zum Selbstund Religionsverständnis in Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Islam, Berlin 1999. 18 Vgl. B. Uhde, Gegenwart und Einheit, Freiburg 1982. Diese Untersuchung – in ihrer Bedeutung für die Religionswissenschaft gewürdigt von P. Antes, Religion in den Theorien der Religionswissenschaft, in: Handbuch der Fundamentaltheologie, hrsg. W. Kern u.a., 16 Ist damit die Religion als solche dem Begriff nach bestimmt worden und läßt sich innerhalb einer jeden einzelnen der fünf Hochreligionen19 eine Größe, die als Mystik bezeichnet wird, erkennen und das in der Weise, daß Mystik als eine besondere Erscheinung der Religion von dieser bestimmt wird und innerhalb dieser auftritt, so gilt das Gleiche für den Begriff der Bd. I, Freiburg 1985, S. 34 f. – hat die Begriffsbestimmung der Religion im Einklang mit den Prinzipien der abendländischen Philosophie versucht und gleichzeitig deren Gültigkeit erinnert. Ein Prinzip erweist sich demnach als solches, wenn es einheitlich, einsichtig, allgemeingültig ist und jeder Versuch seiner Widerlegung seinen Inhalt als bewiesen voraussetzt. Dementsprechend wird als erstes Prinzip der abendländischen Philosophie der „Satz vom (zu vermeidenden) Widerspruch“ des Aristoteles erkannt, wonach einem Subjekt nicht gleichzeitig und in gleicher Hinsicht zwei sich einander widersprechende Prädikate zugeordnet werden können (S. 50 ff.; vgl. dazu auch B. Uhde, Erste Philosophie und menschliche Unfreiheit. Studien zur Geschichte der Ersten Philosophie. Teil I: Von den Anfängen bis Aristoteles, Wiesbaden 1976, S. 82 f., dazu S. 70 f.). Dem Inhalt nach wird dieses erste Prinzip als die Reflexion des Denkens bestimmt, die als Einheit sich selbst zum Gegenstand hat und der erscheinenden Vielheit verborgen bleibt in dem Sinne, daß sie ihr zugrunde liegt (S. 35 ff.). Dieses Prinzip wird der Form nach als Maßstab genommen für die Bestimmung des sichersten und allgemeinsten Grundes und dem Inhalt nach für die Bestimmung des Inhalts von Religion und findet sich so in der Formulierung der ersten beiden Teile der Begriffsbestimmung der Religion wieder (S. 50 bis 64). Nun wird jedoch im weiteren Verlauf der Untersuchung erkannt, daß Einheit als Reflexion begriffen immer noch eine Doppelung darstellt und somit zwar als Prinzip gedacht werden kann, jedoch nicht als Prinzip von Allem. In der plotinischen Bestimmung der Einheit als das „Eine“ wird dann das Hervortreten eines neuen Prinzips gesehen, welches „erhaben“ ist über alle Doppelungen, wodurch das alte Prinzip auf dieses nicht mehr angewandt werden kann, da es ihm (Doppelung) als absolute Einheit immer schon vorausgeht (S. 91 bis 102). Darin erkennt Uhde das Prinzip der zweiten Epoche, die von grundlegender Bedeutung für die Begriffsbestimmung der Religion im Allgemeinen ist (nämlich als Prinzip von Allem, mithin auch von Religion S. 101), wie auch für die des Christentums im Konkreten, da es in seiner Absolutheit „... auch das nach dem Verstandesprinzip Gegensätzliche ohne Mühe durchdringen oder überwinden“ kann (S. 101), wodurch der Weg frei wird für die Christologie und das Dogma von Nicaea (Christus ist Gott und Mensch zugleich), welches nach dem „Satz vom Widerspruch“ nicht möglich, weil ohne kommunikablen Sinn gewesen wäre (S. 102). Das von Descartes vorgelegte sichere Wissen um die Ich-Existenz offenbart schließlich das Prinzip der Neuzeit (S. 7), welches sich – gleichzeitig mit der Erkenntnis des Todes – als die allgemeinste und sicherste Bestimmung erweist, die der Bestimmung der Religion zugrundegelegt werden kann (S. 15 ff.). Das von Descartes vorgelegte sichere Wissen um die Ich-Existenz offenbart schließlich das Prinzip der Neuzeit (S. 7), welches sich – gleichzeitig mit der Erkenntnis des Todes – als die allgemeinste und sicherste Bestimmung erweist, die der Bestimmung der Religion zugrundegelegt werden kann (S. 15 ff.). 19 „Hochreligionen“ – oder auch „Weltreligionen“ – können Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus genannt werden, da sie einen absoluten und universalen Anspruch vertreten; vgl. B. Uhde, Judentum: eine „ethnozentrische“ Religion? Eine religionsgeschichtliche Überlegung, in: G. Biemer u.a., Freiburger Leitlinien zum Lernprozeß Christen Juden, Düsseldorf 1981, S. 193 ff. 17 Mystik an sich, der dann aus dem Begriff der Religion an sich hervortreten muß. Das Hervortreten des Begriffes aber kann nur im Besonderen und nicht im Allgemeinen stattfinden, und das aus zwei Gründen: Erstens: Ein Unterschied beider Größen – Religion und Mystik – im Allgemeinen würde notwendig in eine Neubestimmung der Mystik unabhängig von der der Religion führen, wodurch sie ihren von der jeweiligen Religion immer schon vorgegebenen Inhalt aufgeben und sich gleichzeitig dadurch in die Unbestimmbarkeit des begrifflich Unerkannten begeben müßte. Zweitens: Beide Begriffe – Religion und Mystik – können nur im Allgemeinen übereinstimmen und müssen im Besonderen Unterschiede aufweisen, weil sie sonst entweder gleich wären oder aber gänzlich voneinander unterschieden. Die Mystik kann also nur bestimmbar sein als das Besondere innerhalb des größeren Allgemeinen (Religion), jedoch so, daß dieses Besondere wiederum allgemein gefasst sein muß, damit es der begrifflichen Ableitbarkeit einer konkret auftretenden Mystik innerhalb der vereinzelt erscheinenden Religion zugrunde gelegt werden kann. Die genannten Voraussetzungen lassen folgende Schlüsse zu: Kann der Begriff der Mystik nur als Hervortreten aus dem Begriff der Religion in der besonderen und nicht in der allgemeinen Bestimmung verstanden werden, so setzt das die Übereinstimmung beider Begriffe eben in jener allgemeinen und einen Unterschied in der besonderen Bestimmung voraus. Das Allgemeine aber ist stets das Grundsätzliche und daher der Religion Grund. Dieser bestimmt sich: „... in der reflektierten Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart ...“, wobei die Reflexion der Einsicht und nicht die Erfahrung die Bestimmung ermöglicht20. 20 Die Voraussetzung für den Erweis einer Begriffsbestimmung, sei es des Grundes, des Inhaltes oder der Tätigkeit der Religion liegt darin, daß diese, entgegen der zur Zeit weit verbreiteten Meinung, immer von der bereits reflektierten Einsicht in einen gegebenen Sachverhalt auszugehen hat und nicht von einer, wie auch immer aufgefassten Erfahrung, wodurch diese nicht negiert wird: „Mit der Reflexion dieser Berührung – der Einsicht in die Ergriffenheit von der Einsicht in den Mangel an anwesender Gegenwart – gründet „Religion“, während in der unreflektierten Einsicht in den Mangel an anwesender Gegenwart ein als bedeutungslos genommener Sachverhalt zur Selbstaufgabe der ersten Einsicht und zum Verlust des Wissens drängt. Das dadurch hervortretende Bewußsein begreift sich selbst nicht, weil es seine Endlichkeit reflexionslos negiert; es begreift aber auch seine Umwelt nicht, weil es weder deren 18 Dieser Grund also, als der allgemeinste, ist der Religion und damit auch der Mystik eigen. Ist damit das Grundsätzliche als das Allgemeine bestimmt worden, so fällt dem Inhalt die Bestimmung des Besonderen zu, will dieser ja im Vorausgehenden seinen Grund erkennen. Dem Inhalt nach bestimmt sich die Religion im : „...Wissen um die notwendige Voraussetzung der verborgenen Einheit“, eine Bestimmung, die jetzt genauer bedacht werden soll, kann nämlich nur in ihr der Unterschied beider Größen begriffen werden.21 Im zweiten Teil der Grundbestimmung des Begriffes der Religion ist vom „Wissen“ die Rede, welches die Einheit nicht unmittelbar zum Gegenstand der Erkenntnis hat, sondern um deren „verborgene“ und „notwendige Voraussetzung“ weiß und das auf Grund ihres Hervortretens in die Vielheit 22. Die Art und Weise des Hervortretens ihrerseits bildet die Vielheit der Religionen, welche wiederum auf diesem Wege das oben genannte Verfassung noch deren Grenze ins Urteil nimmt. So tritt dieses Bewußtsein – alter Überlegung nach – in die Unfreiheit, ja in die Nähe der Tiere und der Werkzeuge.“ (Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit. , S. 26; vgl. Uhde, Erste Philosophie, op. cit. ., S. 90 ff.). Daher benötigt die Entfaltung des Wissens die Fähigkeit der Bildung der Signifikate, die letztendlich zum Gegenstand der Reflexion werden können. 21 Der dritte Teil der Begriffsbestimmung der Religion, nämlich das „... Beachten der Herrschaft des Prinzips von Allem“, läßt sich dann als unmittelbare Folge des zweiten Teils denken, was für die Bestimmung der Mystik heißen muß, daß auch hier ein Unterschied bedacht werden will. Vgl. dazu B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 50 ff.: Die Anerkennung der Einheit, als einer der Vielheit zugrunde liegenden Größe ist zunächst ein erkenntnistheoretisches Anliegen, wie Sokrates, Platon und Aristoteles gezeigt haben, und führt nicht notwendigerweise in die Begründung einer Religion, wohl aber in die Entfaltung der Philosophie als einer Wissenschaft von der Bestimmbarkeit dieser Einheit. Die Religion ereignet sich erst dann, wenn die Reflexion der Einsicht in den Mangel an anwesender Gegenwart eine Betroffenheit auslöst, die sich mit dem Mangel nicht zufrieden gibt und dessen Aufhebung in der „Beachtung der Herrschaft des Prinzips von Allem“ sucht, dem ein Wissen um diese vorausgehen muß. 22 Zur Verborgenheit der jenseitigen Einheit vgl. B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 38 und zur Erlangung des Wissens um diese vgl. ebd. S. 103. Dort heißt es: „Dabei ist dieses Prinzip zur Welt des Erscheinens jenseitig, aber Herr dieser Welt. Kenntnis von ihm ist offenbar möglich – wie könnte sonst, selbst in der Vorsicht des `gleichsam`, von ihm gesprochen werden?“ 19 „Wissen“ um das „Prinzip von Allem“ erlangen und den Alltag durch die „Beachtung“ des so Erkannten gestalten23. Selbst wenn im Heraustreten die Einheit als Einheit erhalten bleibt, bleibt das Wissen um diese als Reflexion immer schon Vielheit, für die oder – religiös ausgedrückt – in die sich die jenseitige Einheit hinein offenbart24. Aber ein als Vielheit erkanntes und sich selbst begreifendes Wissen ist damit immer schon bedürftig, und im Angewiesen-Sein auf eine Vermittlung erfährt es notwendigerweise seine Begrenztheit. Aus dieser ergibt sich dann die Erkenntnis seiner eigenen Endlichkeit und in deren Folge das Wissen um die Vergänglichkeit. Diese Selbsterkenntnis der Reflexion besteht darin, daß sie sich und die Vielheit der erscheinenden Welt immer nur in der „Doppelung“ als kleinster erscheinender Vielheit25 und daher als Doppelung, also als kleinste erscheinende Vielheit, vorstellen kann. Selbst dann, wenn sie die Einheit dem Begriff nach denken kann, so kann dieses Denken nur vermittelt geschehen und bedarf des tätigen Eingreifens seitens der Einheit selber in der Weise ihres Hervortretens.26 Das Charakteristikum der Vielheit – und damit der Begrenztheit, Endlichkeit und Vergänglichkeit – haftet der Reflexion an in der Art, wie diese als Ursache jener eingesehen werden muß, und das in zweifacher Weise, nämlich im Hervorbringen und im Erkennen, eben weil dieses Erkennen als Doppelung Doppelungen hervorbringt und von diesen Doppelungen selber hervorgebracht wird. Damit aber zeigt sich das „Wissen“ als Reflexion der direkten Einsicht in die Einheit als Hindernis, weil es als Doppelung eben nur Doppelungen zum Gegenstand der Betrachtung haben kann. Gleichzeitig aber liegt in der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten das Heil, und dort muß es auch gesucht 23 Vgl. B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 38. Anm. 81. 24 Vgl. B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 108. 25 Das Wort „Doppelung“ sucht die plotinische Rede von „δύο“ wiederzugeben, vgl. Plotin, Enneade III. 8,9,1-25. 26 Hier hat beispielsweise im Christentum der Stellvertretungsgedanke seinen Ort, der in Christus als Vermittler nicht nur die Einheit der Welt/Vielheit zugänglich macht, sondern auch in seiner Person stellvertretenderweise alle Vielheit aufhebt. Vgl. dazu: K. M. Menke, Stellvertretung: Schlüsselbegriff christlichen Lebens und theologische Grundkathegorie, Einsiedeln/Freiburg 1992. Obwohl auf eine reiche Tradition gestützt, bleibt der „pro nobis“ Gedanke weiterhin nicht eindeutig, weil die Übersetzung mit „für uns“ nicht zwangsläufig mit „an unserer statt“ übersetzt werden muß. 20 werden. Allein dieses hebt, alle Doppelungen übersteigend, Begrenztheit und damit Vergänglichkeit, Leid und Tod auf27. Genau hier ist der Ort erreicht, an dem sich der Begriff der Mystik von dem der Religion unterscheidet und eine Wandlung vollzieht: Haben nämlich die Religion und die Mystik das „Wissen um die notwendige Voraussetzung der verborgenen Einheit“ zu eigen, so ist und bleibt dieses Wissen als Reflexion und somit Doppelung der Inhalt von Religion und eröffnet ihr damit ein sich Entfalten ins „Beachten“ – wiederum Doppelung - des stets vermittelten Inhaltes derselben, während die Mystik, indem sie die Doppelungen tilgen möchte, notwendigerweise die unmittelbare und unvermittelte Anwesenheit bei dieser verborgenen Einheit zu ihrem Inhalt haben muß. Anders formuliert: Der Inhalt der Religion wird für die Mystik zu ihrer Voraussetzung, da diese im Wollen nur auf etwas hinstreben kann, was sie zuvor im Geist – Reflexion – erkannte28. Die Mystik will und muß über diese Reflexion – jedoch wie eben gezeigt, nur dank dieser und nicht gegen diese – hinaus, indem sie in die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit selber einzugehen sucht, während die Religion in das Beachten des in der Vielheit erschienen Prinzips von Allem umschlägt. Der dabei der Mystik eigene Widerspruch, durch Vermittlung unmittelbar ins Unvermittelte zu gelangen, bleibt dem Verstandeswissen anstößig. Ist die Bewegung der Religion bedacht und als Wissen gesichert, bleibt die Frage offen, ob eine unmittelbare Anwesenheit bei dem Einen überhaupt vorstellbar und damit denkbar sei. Diese Frage bindet uns zurück an die ursprüngliche Frage nach den Kriterien einer religionswissenschaftlichen Begriffsbestimmung der Mystik. Daher ist die Antwort darauf für diese Untersuchung von tragender Bedeutung. Der sich in der eben genannten Weise ankündigende Begriff der Mystik muß, analog dem der Religion, von dem er sich ableitet, einer Prüfung unterzogen werden. Hierfür erweisen sich ebenfalls Prinzipien abendländischer Philosophie29 als dienlich, haben sie sich ja nicht nur dem 27 Vgl. dazu: B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit. , S. 99 und S. 103. Zum Begriff „Heil“ als Vollendung alles Strebens, welches notwendigerweise allen Doppelungen – vgl.: Plotin, Enneade III, 8, 9, 1ff. - enthoben sein muß vgl.: Plotin, Enneade VI, 9, 9, 62. 28 Vgl. Augustinus, De trinitate, X 2, 4: „ Nemo prorsus amat incognita.“ 29 Vgl. dazu H. Boeder, Topologie der Metayphysik, op. cit., S. 39 ff. 21 Begriff von Religion als widerspruchsfrei gezeigt, sondern diesen Begriff konstituiert. Begreift man den „Satz vom Widerspruch“ des Aristoteles als der Form nach erstes Prinzip abendländischen Denkens und wendet dieses Prinzip auf den Gedanken der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit an, so offenbart sich die Unmöglichkeit des Bestehens dieses Gedankens darin, daß der Begriff der Vielheit, um die Anwesenheit bei der Einheit erreichen zu können, selber als Einheit gedacht werden müßte, womit ihm gleichzeitig und in gleicher Hinsicht zwei sich widersprechende Prädikate zukommen würden, also genau das, wogegen sich der Satz vom Widerspruch richtet30. Inhaltlich erfasst Aristoteles das einheitliche Prinzip als Reflexion des Denkens, welches sich selber zum Gegenstand hat und unabhängig von Raum und Zeit das vollzieht, was dem Menschen im Vollzug der Reflexion in gleicher Weise nur analog möglich ist31. Damit ist die Bestimmung des Inhaltes der Mystik als unmittelbare Anwesenheit beim Prinzip von Allem nicht denkbar, weil keine menschliche Reflexion absolute Einheit hervorbringt und die Nähe zur absoluten Einheit keine absolute Einheit ist. In dieser inhaltlichen Bestimmung der Einheit als Reflexion des Denkens kann der Ort der Anwesenheit der Reflexion beim ersten Prinzip gesehen werden. Genau dies ist auch von Plotin gesehen und zurückgewiesen worden32 mit dem Hinweis darauf, daß die Einheit, begriffen als das Denken des Denkens, immer noch, wenn auch subtiler, eine Doppelung aufweist und damit nicht als das absolut Eine gedacht werden kann. Weil aber der Begriff des absolut Einen nicht als Ergebnis der Reflexion des Denkens – ihrer Doppelung wegen- gedacht werden kann, gleichzeitig aber als Begriff vorhanden ist, muß er seine Erscheinung der Manifestation des Einen selbst verdanken, weswegen er über jeglichen Zweifel erhaben, da gleichzeitig immer schon von diesen vorausgesetzt, sicheres Wissen ist und damit als Prinzip gilt. 30 Vgl.: Aristoteles, Metaphysik 1005 b 19 f. 31 Vgl: Aristoteles, Metaphysik 1072 b 15 f. 32 Vgl. Plotin, Enneade VI, 9, 2, 14 und VI, 9, 3, 4. 22 Das Erscheinen dieses Prinzips im plotinischen Begriff des Einen tritt hervor in der Art, daß es alle Vielheit, Doppelung wie auch Reflexion übersteigend von diesen und damit auch von Prinzipien („Satz vom Widerspruch des Aristoteles“), welche diese beherrschen, notwendigerweise unberührt bleiben muß, kann nämlich ein Verstandesprinzip immer nur innerhalb eines Reflexionsverhältnisses seine Anwendung finden. Ein Verstandesprinzip muß in Folge und damit notwendigerweise jenseits seines Anwendungsfeldes den Anspruch auf Gültigkeit aufgeben33. Indem jedoch das eine Prinzip, wie es Aristoteles bestimmt, von Plotin als „Doppelung“ erkannt worden ist, erweist es sich damit gleichzeitig als ungeeignetes Ziel der mystischen Bewegung, für deren Bestimmung nur die unmittelbare Anwesenheit bei der absoluten Einheit, jenseits aller Doppelungen, von Bedeutung sein kann. Daraus ergeben sich für die Bestimmbarkeit der Mystik folgende Konsequenzen: Konnte diese bei prinzipieller Anerkennung des Widerspruchsprinzips, dem „Satz vom Widerspruch“ zufolge, nicht als unmittelbare Anwesenheit beim Prinzip von Allem gedacht werden, so zeigt sich jetzt, daß dieses Prinzip im Bezug auf die Einheit nicht angewendet werden kann. Weil aber in der Einheit nur Einheit denkbar ist, muß die unmittelbare Anwesenheit bei dieser ebenfalls als Einheit gedacht werden und damit „jenseits“ der Anwendbarkeit des Satzes vom Widerspruch ihren Ort haben, da dieser Satz Zuordnungsproblematiken – mithin Vielheit – beherrscht. Selbst wenn also das Prinzip der Philosophie des Aristoteles inhaltlich eine unmittelbare Anwesenheit im Denken zulässt, so zeigt sich diese als Doppelung und ist damit nicht als Inhalt von Mystik bestimmbar. In diesem Sinne unterläuft und überbietet das plotinische Prinzip des Einen das aristotelische Prinzip der Einheit einzig hinsichtlich des Einen selbst, schränkt also den Gültigkeitsbereich des aristotelischen Prinzips nur in Bezug auf jenes plotinische Eine ein und offenbart sich damit gleichzeitig als ein Neues im Sinne des sichersten Wissens, welches eine neue Epoche des Denkens begründet und beherrscht, setzt doch die relative Einheit, ihrer Eigenart als Doppelung wegen, den Begriff der absoluten immer schon 33 Dazu Plotin in Enneade VI, 9, 2, 14: „ί ι έ όςό ίό ς χ άς όο“ – „Selbst wenn der Geist des Denkende und das Gedachte ist, so ist er Zweiheit und nicht Einheit, und damit nicht das Eine.“ Zu der Unanwendbarkeit des Prinzips der ersten Epoche auf das Eine des Plotins vgl.: B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit. : S. 99. 23 voraus und somit als sicher. Für die Begriffsbestimmung der Mystik heißt dies, daß sie aus der Wissensentfaltung dieser neuen Epoche, die das Absolute zum Prinzip erhebt, ihre Begriffsbestimmung ableiten kann. Sollte sich aber herausstellen, daß beim Prinzip des Einen in dieser neuen Epoche eine unmittelbare Anwesenheit nicht gedacht werden kann, so läßt sich die Mystik als Begriff in der vorgelegten Weise nicht bestimmen und von dem der Religion auch nicht ableiten. Und weil die absolute Einheit, wie eben gezeigt wurde, in keiner Weise von der Reflexion des Denkens, wie rein auch diese gedacht werden mag, erreichbar ist, läßt sich unter der unmittelbaren Anwesenheit der Reflexion bei jener absoluten Einheit zunächst überhaupt nichts vorstellen und nichts denken: „ ός άέή έήηά έ ό όός·““ Denn die Wissenschaft ist Wort, und das Wort ist Vielheit.“ Unterscheidet aber diese Feststellung Plotins zwischen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten und seinem Begriff, so hat sie keine allgemeine Gültigkeit in dem Sinne, daß eine unmittelbare Anwesenheit überhaupt nicht gedacht werden kann, sondern bezieht sich nur auf das Verhältnis Einheit – Vielheit/Reflexion und meint damit, daß diese Anwesenheit zwar gedacht, jedoch nicht im Denken erreicht werden kann. Denn kann das Gleiche nur vom Gleichen erkannt werden, so muß die Reflexion sich selber aufheben – auf daß sie der Einheit kein Gegenüber bietet - um damit die Voraussetzung zu schaffen, als unmittelbar anwesend bei dieser gedacht zu werden. Mit anderen Worten: Wenn das Denken seine eigene Aufhebung erkennen kann, kann es als deren Folge den Begriff der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten ebenfalls erkennen: „ύέέήίίίίήέίύ έ ΐάά ίέιήςίέςά ίάς “35 – „ So soll sie (die Seele) die Reflexion hinter sich lassen, und aus dem Einssein nicht hervortreten; sie soll von allem Wissen und Gewußtem, ebenfalls von jedem Gegenstand der Betrachtung Abstand nehmen, so schön dieser auch sein mag.“ 34 Plotin, Enneade VI. 9, 4, 24. 35 Plotin, Enneade VI. 9, 4, 25. 24 Und weiter heißt es: „ίόέόςέέτός ίό όίέπίό ίόον 36 “ „...denn das Sehen und das Schauen ist keine Vernunft mehr, vielmehr ist es größer als die Vernunft, ist vor der Vernunft und über der Vernunft, in gleicher Weise wie das Geschaute.“ Damit zeigt Plotin, daß die Aufhebung der Entzweiung der Reflexion des Denkens im Durchschreiten derselben als Schau vorzustellen ist, und wenn dem so ist, dann ist auch die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit, und zwar als Einheit erkennbar, weil in ihr alle Gegensätze aufgehoben sein müssen, damit im Ergebnis das Gleiche vom Gleichen als das Gleiche erkannt wird, weil es dann das Gleiche/Eine ist37. Für diese Untersuchung zeigt sich, daß die inhaltliche Bestimmung der Mystik, gedacht als unmittelbare Anwesenheit beim Prinzip von Allem, gemäß der Bestimmung des Prinzips selber erkennbar und beschreibbar ist, kann doch die Aufhebung der Reflexion des Denkens von dieser selbst erkannt werden, womit kein Widerspruch im Sinne eines Gegenüber zum Absoluten erkennbar bleibt und der Begriff der unmittelbaren Anwesenheit ableitbar ist. Damit ist deutlich, daß Mystik eine begriffliche Bestimmung ihres Inhaltes zuläßt und daß diese Bestimmung, ähnlich wie die der Religion, im Einklang mit dem abendländischen Denken steht, wie sich dieses bis zu der plotinischen Epoche bestimmen läßt38. Kann die Bestimmung von Mystik 36 Plotin, Enneade VI. 9, 10, 69. 37 Vgl. dazu Anm. 12. Zu Plotin vgl. auch die erhellenden Ausführungen von W. Beierwaltes, Plotin. Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7). Übers., eingel. und kommentiert Frankfurt a.M. 1967, S. 11 ff. Hier sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Denkbarkeit des Inhalts der Mystik als erscheinende Größe innerhalb der Religionen und die unmittelbare Anwesenheit beim Inhalt dieser, wenn auch denkbar, so doch zwei gänzlich unterschiedliche Größen sind, denn mit dieser Bestimmung hat sich lediglich die Erreichbarkeit der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit als denkbar erwiesen, nicht etwa das Erreichen dieser mittels des Denkens. 38 Wie B. Uhde richtig bemerkt, müsste das Prinzip der Neuen Epoche innerhalb der Religion – im Christentum seitens seiner Dogmatik – bedacht werden, bevor es Gegenstand einer religionswissenschftlichen Untersuchung werden kann. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 7. Nichtdestoweniger wird innerhalb dieser Untersuchung auf den Einfluß des neuen Prinzips und dessen Konsequenzen auf die Begriffsbestimmung der Mystik ausführlicher eingegangen. Vgl. dazu S. 28 ff. dieser Arbeit. 25 als ein Auftrag für das Fach Religionsgeschichte als Wissenschaft betrachtet werden, so findet die unmittelbare Anwesenheit als Übung an einem anderen Ort statt, wenngleich beides von einer und derselben Person vollzogen werden kann39. Es hat sich aber auch gezeigt, daß die Bestimmung des Inhaltes der Mystik den Inhalt des Begriffs der Religion voraussetzt und somit zwar einen Unterschied, jedoch keinen Widerspruch zu dieser aufweist. Während die Religion nach der vermittelten Erkenntnis des Einen, im Beachten seiner Herrschaft lebendig bleibt 40, scheint die Mystik erst mit der unmittelbaren Anwesenheit bei dem Einen das Heil und somit die Vollendung erreichen zu wollen. Trifft dies zu, muß bei der Bestimmung von Mystik die Abwendung von der Vielheit hinzu gedacht werden. Eben dies ist genau zu bedenken, da es immer schon zu vielen Mißverständnissen in der Vergangenheit wie in der Gegenwart Anlaß gegeben hat. Der Gedanke muß sich folglich auf die genauere Bestimmung der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten richten. Der Weg in die Unmittelbarkeit des Einen führt durch den Rückzug aus der Vielheit in der Art, wie die Reflexion, welche Vielheit bedeutet, aufgehoben wird. Damit aber muß die Vielheit weder gemieden noch verachtet werden, da die Ursache der Zweiheit in der Reflexion als solcher gründet und nicht außerhalb ihrer zu denken ist, weswegen die Reflexion und nicht die Vielheit (immer schon als ihr Ergebnis) überwunden werden muß. Ein jegliches Verneinen bzw. Verachten, aber auch das Gegenteil, nämlich das Hochheben und Anhaften an der Vielheit, zeigt sich immer schon als die Tätigkeit der Reflexion des Denkens, wodurch diese nur verstärkt wird. Und so kann das Ereignis der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten als direkte Folge des Aufhebens der Reflexion des Denkens bestimmt werden, muß die Entzweiung und Vielheit als Ergebnis des Auftretens dieser gedacht werden. Damit wird der Unterschied zwischen der Religion und der Mystik im unterschiedlichen Umgang dieser beiden mit der Reflexion des Denkens begriffen, denn sowohl Religion wie auch Mystik sehen ein, daß das erste 39 Dieses scheint bei Plotin der Fall gewesen zu sein. Vgl. dazu: K. Jaspers, Die großen Philosophen, München/Zürich 1981, Bd. 1. S. 676. 40 Vgl. dazu: B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 104. 26 Prinzip aller Vielheit zugrunde liegt in der Weise, daß sich die Vielheit in ihm als solche begründet weiß. Innerhalb des Begriffes der Religion, wie er hier nachgezeichnet wurde, bleibt aber die Reflexion immer bestehen und muß konsequenterweise einsehen, daß die Einheit für sie nur vermittelt erkennbar ist mit der Folge, daß die Religion und die Religionen immer nur eine vermittelte und damit reflektive, da begriffliche Anwesenheit sowohl bei der Einheit wie auch in der Vielheit zulassen, weil sie diese gegenüber beiden selber konstituieren. Der Blick von der Reflexion des Denkens auf die Einheit hin ist immer schon ein entzweiender, einer, der Unterschied setzt, weil er Unterschied ist, ganz gleich welchen Inhalt die Vermittlung auch anzunehmen vermag. Im Begriff der Mystik dagegen, wie gezeigt worden ist, läßt sich die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit dergestalt denken, daß zunächst die Entzweiung setzende Instanz, die Reflexion des Denkens, aufgehoben sein muß, damit sich diese ereignet. Aus der so erreichten Perspektive der Einheit heraus wird der Unterschied Einheit – Vielheit notwendigerweise zu Fall gebracht, und das gleich in zweifacher Weise: Zum einen fällt er mit der Reflexion als deren Erkenntnisweise, zum anderen wird die Einheit als durch nichts begrenzt gedacht, damit auch nicht durch die Vielheit, und so muß die unmittelbare Anwesenheit bei ihr in die unmittelbare Anwesenheit bei jedem einzelnem Ding in der Vielheit münden, worin sich die Mystik in ihrer Bewegung vollendet41. Diese Vollendung wird bereits als ein Herausfallen aus der unmittelbaren Anwesenheit bei dem Einen gedacht; jedoch im Unterschied zu der Möglichkeit der Anwesenheit bei dem Prinzip der ersten Epoche, das eine gelegentliche Anwesenheit bei sich zulässt42, geschieht dieses in beide Richtungen gewollt und damit bewußt43. Die Rückkehr in die Vielheit wiederum muß als allererstes als Rückkehr in die Reflexion des Denkens gedacht werden – war diese nämlich die Letzte 41 Dieses Verständnis der Mystik ergibt sich notwendigerweise aus der plotinischen Bestimmung des Einen, welches von sich aus keine Unterschiedenheit kennt und dadurch immerschon bei uns anwesend ist. Plotin, Enneade VI 9, 9, 59. 42 Vgl. Aristoteles, Metaphysik 1072b 13 f. 43 „Und ist man so mit jenem vereint und hat genug gleichsam Umgang mit ihm gepflogen, so möge man wiederkehren und wenn mans vermag auch anderen von der Vereinigung mit jenem Kunde geben;...“ Plotin, Enneade VI 9, 7, 52 übersetzt von R. Harder, Plotins Schriften, Hamburg 1956, Bd. 1 S. 193. 27 vor dem Eintritt in die unmittelbare Anwesenheit bei dem Einen, so ist sie die Erste nach dem Heraustreten aus dieser Einheit - und damit in ein Erkennen dieser, jetzt aber als Vollzug jener44. Der Unterschied der Reflexion vor und nach dem Eintritt in die unmittelbare Anwesenheit besteht jetzt im Wissen um den Vollzug der Vielheit und damit ihrer selbst als ununterschieden von der Einheit, da diese von sich aus weder Begrenzung noch Unterschied aufweist. Gleichzeitig verfügt diese Art der Erkenntnis über ein Wissen um die Beschaffenheit der Vielheit an sich im Unterschied zu dem von außen Hinzugedachten. Diese Art des Wissens setzt jedoch die unmittelbare Anwesenheit bei dem Einen als notwendig vollzogene Tatsache voraus45. So zeigt sich, daß der Unterschied zwischen der Einheit und der Vielheit nicht im Sein und damit als ein ontologischer Unterschied gedacht werden kann, sondern im Erkennen des Unterschiedes, also in der Reflexion des Denkens selber begründet ist, und zwar in dem Sinne, daß die Reflexion des Denkens im Vollzug ihrer selbst diesen hervorbringt46. Der Begriff der Mystik und sein Inhalt, die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit, lassen sich mithin auch aus der begrifflichen Vorlage der plotinischen Epoche ableiten. Ist aber diese hinsichtlich ihrer Eigenschaft als sicheres Wissen vom Prinzip der Moderne, durch Descartes, abgelöst worden, so daß dieses den Zeitraum und damit die Begrifflichkeit dieser Untersuchung beherrscht, so ist die Überprüfung des Begriffes der Mystik 44 Dazu K. Jaspers sehr treffend in seiner Deutung des plotinischen Begriffes der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit in der Relation zum Denken: „Das Denkbare ist das Zwischenreich, an dessen Grenzen auf das Undenkbare zu treffen ist. Wird diese Grenze in den Augenblicken der Einung mit dem Einen überschritten, so doch auf dem Wege über das Denken, und, solange das Zeitdasein bleibt, mit der folgenden Rückkehr in das Denken.“ Jaspers, Die großen Philosophen, München/Zürich 1981, Bd. I. S. 678. 45 Das Wirken in der Vielheit und für die Vielheit steht jetzt im Einklang mit der Wirkung des Einen dank der vollzogenen unmittelbaren Anwesenheit bei diesem: „in solcher Vereinigung stand vielleicht auch Minos, weshalb er in der Sage als des Zeus vertrauter Genosse galt, und dieser Gemeinschaft gedenkend gab er als ihr Abbild seine Gesetze, durch die Berührung des Göttlichen befruchtet zur Gesetzgebung.“ Plotin, Enneade VI 9, 7, 52 übersetzt von R. Harder in op. cit., S.193. 46 Die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit setzt das Überwinden der Reflexion und nur dieser voraus, da sie ihrer Eigenschaft nach diese verhindert. Sie: „...flieht die Gesamtheit, fällt ab in Geschiedenheit,...richtet sich auf ein Teilwesen und in der Absonderung von der Ganzheit läßt sie sich dann auf irgend ein Einzelding nieder,...“ Plotin, Enneade IV 8, 4, 22. übers. von R. Harder in op. cit., S.138 f. 28 im Hinblick auf eben dieses Prinzip unerläßlich, bildet dieses Prinzip immer noch einen Maßstab zeitgenössischer Wissensentfaltung, wozu auch die Religionswissenschaft zählt. Die neuere abendländische Philosophie, beginnend mit Descartes, und verstanden als die Methode der Entfaltung sichersten Wissens, fand eben dieses Wissen in der Betrachtung („Meditationes“!) der Reflexion des Denkens selber.47 Das „Ich“ nämlich, als reine Tätigkeit der Reflexion des Denkens betrachtet, kann die Existenz von allem, seine eigene mit eingeschlossen, in den Zweifel ziehen; indem es aber an allem zweifelt, kann es gleichzeitig nicht daran zweifeln, daß es dasjenige ist, das zweifelt, woraus es ein sicheres Wissen der eigenen Identität schöpft, indem es diese hervorbringend aufrechterhält 48: „Suppono igitur omnia, que video, falsa esse, credo nihil umquam existisse eorum, que mendax memoria repraesentant, nullos plane habeo sensus; corpus, figura, extensio, motus loqusque sunt chimerae; quid igitur erit verum? Fortassis hoc unum nihil esse certi. ...Numquid est aliquis Deus, vel quocumque nomine illum vocem, qui mihi has ipsas cogitationes immittit?....haud dubie igitur ego etiam sum, si me fallit, et fallat quantum potest, numquam tamen efficiet, ut nihil sim quamdiur me aliquid esse cogitabo. Adeo ut omnibus satis superque pensitatis denique statuendum sit hos pronuntiatum: ego sum, ego existo, quoties a me profertur vel mente concipitur, necessario esse verum.“49. Dieses Wissen offenbart sich als ein einheitliches, einsehbares wie auch allgemeingültiges und jedem Einspruch als bewiesen vorausgehendes, so daß es den Anspruch eines neuen Prinzips allen sicheren Wissens erfüllt. 47 Vgl. H. Boeder, Topologie der Metaphysik, op. cit. S. 371 ff. Die Methode der Entfaltung des sichersten Wissens in der neueren abendländischen Philosophie zeigt vorzüglich C.-A.. Scheier, Die Selbstentfaltung der methodischen Reflexion als Prinzip der neueren Philosophie. Von Descartes zu Hegel. Freiburg/München 1973. 48 Die Ableitung der Gewissheit des eigenen Daseins aus der negativen Reflexion des Denkens kommt bereits bei Augustinus vor. Vgl. dazu: Augustinus, De trinitate, X 10, 14 f. 49 Descartes, Meditationes de Prima Philosophia,, Meditatio II, 17, 18 in: Oeuvres de Descartes, ed. Adam & Tannery, Paris 1996, Bd. 7, S. 24 f. 29 Seine Überlegenheit gegenüber dem Einen, wie es Plotin als notwendige Voraussetzung von Allem, also aller Vielheit, eingesehen hat, erweist das Ich als neueres Prinzip dadurch, daß es im Vollzug des Selbstzweifels alles andere und das heißt die Existenz aller bis dahin abgeleiteten Begriffe, mithin auch die vorausgesetzte Einheit, bezweifeln kann, mit Ausnahme seiner selbst, das den Selbstzweifel ja vollzieht und als „Ich“ begreift. Es ist eben der negative Vollzug der Reflexion des Denkens verstanden als Zweifel, welcher sogar das Prinzip des plotinischen Einen bezweifeln kann50, weil dieses die Möglichkeit des Zweifelns an sich zulassen und damit den Status des sicher Gewussten im Sinne des Unbezweifelbaren, das nicht einmal die Möglichkeit des Zweifels zuläßt, notwendigerweise aufgeben muß, während gerade diese Möglichkeit des Zweifelns, gedacht als Inhalt der sich vollziehenden Reflexion des Denkens, das „Ich“ als sicher Gewußtes hervorbringt und das so Hervorgebrachte sich gleichzeitig darin als sicher Existierendes erkennt. Das „Ich“, seiner selbst gewiß, gründet damit in der sich vollziehenden Reflexion des Denkens und kann nicht mehr als eine von dieser unabhängig existierende Größe gedacht werden: „Ego sum, ego existo, certum est. Quamdiu autem? Nempe quamdiu cogito;“51 Das Denken also und das Ich sind nicht als zwei voneinander unterschiedene - wenn auch sprachlich unterscheidbare - Größen etwa derart vorstellbar, daß einem bereits vorhandenen Ich die Reflexion des Denkens als Fähigkeit oder Fertigkeit hinzugedacht werden kann, welche dann von diesem, je nach Umstand und Lage, vollzogen werden kann oder auch nicht: „Cogitare? Hic invenio: cogitatio est, haec sola a me divelli nequit. (...) Sum igitur praecise tantum res cogitans,... . Sum autem res vera, & vere existens; sed qualis res? Dixi, cogitans.“52 Daher ergeben sich für die Bestimmung des Zusammenhangs zwischen dem Ich und der Reflexion des Denkens folgende Schlüsse: 50 Die Möglichkeit des Zweifels am Ersten Prinzip besteht; vgl. Anselm von Canterbury, Proslogion II („Dixit insipiens ...“); Thomas von Aquin, Summa Theologiae I, II, 3 (obiectiones); u.a. 51 Descartes, in op. cit., S. 27. 52 Descartes, in op. cit. , S. 27. 30 - Das Ich existiert im Vollzug des Denkens, und nur während dieses geschieht, ist es seines Daseins in der Form des Wissens von sich selbst sicher. - Weil das Ich unabhängig vom Geschehen des sich vollziehenden Denkens – ganz gleich welchen Inhalt dieses hat – nicht gedacht werden kann, besteht eine Gleichzeitigkeit im Hervortreten beider in der Weise, daß eine Trennung zwischen Denken und Ich zwar grammatikalisch möglich, der Sache nach aber nicht denkbar ist53. - Eine kausale Abhängigkeit beider Größen – etwa im Sinne des Verursachers und des Verursachten – ist für die Verhältnisbestimmung des Ichs und des Denkens ebenfalls nicht vorstellbar, setzt diese nämlich ein zeitliches Nacheinander voraus, was hier, wie gezeigt worden ist, nicht zutreffen kann. - Kann das Ich als Ich sich selbst nur im Vollzug des Denkens begreifen und ist eine Existenz beider unabhängig voneinander nicht denkbar, so muß das Verhältnis beider zueinander als konditionale Wechselwirkung dergestalt aufgefaßt werden, daß das Ich sein Dasein behauptet, wenn sich das Denken vollzieht, und das Denkens ereignet sich, wenn das Ich seine Existenz behauptet. Dieses Prinzip dieser Epoche der abendländischen Philosophie, dessen Gültigkeit bis heute nicht obsolet ist,54 entmachtet das Prinzip der von Plotin bestimmten Epoche, indem jenes Eine nicht mehr als erstes Sicheres, sondern nur noch als ein zweites gedacht werden kann.55 53 Die Unmöglichkeit der Vorstellbarkeit eines Ichs, dessen Dasein unabhängig von der Reflexion des Denkens möglich sein sollte, scheitert immer schon daran, daß die Vorstellbarkeit an sich - ganz unabhängig von der Richtigkeit ihrer Argumentation – immer schon ein im Vollzug begriffenes Denken ist. 54 Wohl haben philosophische Schulen die res cogitans, ihrer Eigenart zufolge, unterschiedlich bedacht und damit das „wie“ dieser differenzierter vorgestellt, ohne aber das „was“, die res cogitans, aufheben zu können. Selbst das von M. Heidegger angedachte `Ende der Metaphysik`, dessen Kennzeichen, die Umwandlung des Denkens als Vorstellen vom Seienden zum Andenken des Seins, wie es sich von sich aus zeigt, bedenkt, bleibt im Wesen weiterhin als Reflexion des Denkens bestehen – wenn auch einem `Anderem` zugewandt - damit immer noch Ich-stiftend und Ich-aufrechterhaltend, mithin res cogitans.– Freilich ist die Literatur zu diesem Thema kaum überschaubar. 55 Vgl. Descartes, Meditationes, op. cit., Meditatio III. 31 Für die Begriffsbestimmung der Mystik hat dies Folgen. Sie betreffen jedoch nur die Gewichtung einzelner Begriffe innerhalb der Gesamtbestimmung: war die Voraussetzung der absoluten Einheit, gedacht als Prinzip von Allem, innerhalb der plotinischen Epoche das sicherste Wissen dieser, so konnte das Ich in der negativen Reflexion die Gewissheit seines Daseins behaupten, wußte aber um dieses als eines von der Einheit Empfangenes. Damit war die absolute Einheit – nicht etwa die Reflexion des Denkens – für das Ich-Dasein seinsstiftend. Das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit bei dieser Einheit – immer noch gedacht innerhalb der Herrschaft dieses Prinzips – bedeutete dann das Verlassen des bedingt Seienden für den Seinsstifter, also des Unsicheren für das mit Sicherheit Gewußte56. Mit dem Auftreten des cartesischen Prinzips erfährt die schon angedeutete Gewichtung innerhalb der Begriffsbestimmung der Mystik ihre Umkehrung, wird jetzt das Ich, welches gerade im Vollzug der negativen Reflexion des Denkens als erstes und mithin zunächst Einziges nicht zu bezweifelndes und somit sicher Gewußtes hervortritt, verlassen auf das Eine hin, dessen Dasein Zweifel zuläßt und somit nur noch als ein zweites denkbar ist57. Die Einheit als Voraussetzung und Prinzip von Allem bleibt weiterhin denkbar - wenn auch nicht mehr als sicherstes Wissen, mithin herrschendes Prinzip der ersten Philosophie – und als Folge ihrer Bestimmung ebenfalls eine unmittelbare Anwesenheit bei dieser. Allerdings muß die Frage 56 In der populären Auslegung der Verlagerung des absolut sicheren Wissens auf die Einheit hin – das betrifft vor allem die monotheistischen Religionen – liegt eine der Ursachen, für die zuweilen lebensverneinende Ausübung dieser Religionen. Vgl. dazu: M. Erbstösser/E. Werner, Ideologische Probleme des mittelalterlichen Plebejertums. Die freigeistige Häresie und ihre sozialen Wurzeln, Berlin 1960. 57 War die Einheit innerhalb der plotinischen Epoche das logische Subjekt und Objekt der Theologie – weswegen auch ihre Existenz als sicher und über alle Zweifel erhaben am Anfang aller großen Abhandlungen der Hochscholastik stand, Ableitungen zulassend, jedoch selbst nicht mehr ableitbar – so tritt sie jetzt an zweite Stelle, nachdem das Ich, als sicherstes Wissen, die Erste annimmt, und wird damit zum Gegenstand der Betrachtung, also zum Objekt der Reflexion. Vgl. dazu den Aufbau des „Opus tripartitum“ von M. Eckhart, das er als sein größtes Werk geplant und bereits begonnen hat. Es beginnt mit dem „Opus propositionum“ und dort heiß es in den ersten zwei Sätzen: „Esse Deus est. Incipit. pars prima tripartiti operis....“ in: LW I, S. 166; ferner den Aufbau der „Summa theologiae“ des Aquitanen. Dagegen folgt bei Descartes die Abhandlung über Gott – Meditatio III: De Deo, quod existat – auf die „De natura mentis humanae...“, die der erstgenannten als sicheres Wissen vorausgeht. 32 beantwortet werden, weswegen das Ich, als sicherstes Prinzip, sich selber als res cogitans aufgeben sollte, um in die unmittelbare Anwesenheit bei dem Einen, das nicht mehr als ein Erstes sicher vorausgesetzt werden kann, zu gelangen. Die Antwort darauf ergibt sich aus der Bestimmung der res cogitans an sich, die zwar einheitlich, doch kein Absolutes ist, weswegen sie der Zeitlichkeit unterworfen ist – „Ego sum, ego existo, certum est. Quamdiu autem? Nempe quamdiu cogito.“ – und dadurch gleichzeitig die Erkenntnis ihres Daseins mit der ihres Todes verbinden muß58. Damit kommen wir an den Anfang der Untersuchung zurück, zeigte sich doch die reflektierte Einsicht in die Endlichkeit des Daseins als „reflektierte Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart“59 und damit als Grund für die Bestimmbarkeit sowohl des Begriffes der Religion wie auch der Mystik. Die Reflexion des Denkens, bestimmt als letzte Stufe vor dem Eintritt in die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit und als erste Stufe nach dem Heraustreten aus dieser, wird jetzt in ihrem Vollzug mit dem Ich identisch und begriffen als res cogitans gleichzeitig zum sicheren Wissen. Dieses wiederum gilt als Voraussetzung aller Freiheit, gründet diese gerade in der reflektierten Gewissheit der Selbstbestimmung. Aus dieser Bestimmung der Freiheit heraus läßt sich das Verhältnis des „Ichs“, begriffen als Reflexion, innerhalb des Reflexionsverhältnisses der Einheit, der Vielheit, aber auch sich selbst gegenüber ebenfalls als ein freies Verhältnis denken, was in einer gewollten Ausrichtung dieses so bestimmten „Ichs“ hinsichtlich der drei genannten Größen zum Vorschein kommt 60. 58 Vgl. dazu: B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 18: „Nun ist aber die Reflexion dieser ersten Einsicht – nicht etwa dieser Erfahrung! – stets unmittelbar mit der Einsicht in die gegensätzlichen Seiten des Reflektierenden verbunden, ist doch das reflektirte Einsehen zwar Anfang, doch nicht Einheit. Die Unmittelbarkeit der ersten Reflexion verbindet die Erkenntnis des Daseins mit der Erkenntnis des Todes“. 59 B. Uhde, Gegenwart und Einheit, op. cit., S. 27 f. 60 Die Nennung der drei Größen, nämlich der Einheit, der Vielheit und der Reflexion des Denkens als identisch mit dem Ich, stellt keine Reduzierung der Auswahl für die willentliche Ausrichtung der Reflexion, vielmehr die begriffliche Vorlage und zwar im Sinne der weitesten und sichersten, weil für diese prinzipiellen, dar. 33 Diese Ausrichtung der Reflexion bedarf einer Entscheidung, die nicht als mögliche, sondern als notwendige gedacht werden muß, setzt auf der Stufe der reflektierten Selbstgewissheit jegliche Art der Ausrichtung, auch deren Verweigerung - da Willensakt, mithin Reflexion – diese voraus. Damit ist für das „Ich“, als res cogitans und Prinzip neuzeitlichen Denkens, der Umgang mit Allem, auch mit sich selbst, stets reflektiver Art – also Doppelung –, weil das Ich diese Reflexion selber ist. Die willentliche Ausrichtung dieser ist nur dann als eine Freie denkbar, wenn das Gewollte zuvor als Gewußtes zum Gegenstand der Reflexion geworden ist. Dieses Geschehen setzt eine begriffliche Bestimmbarkeit einer jeden Begebenheit voraus, weil diese dem Ich, also der Reflexion des Denkens nur als Begriff gegenüber treten kann, um ihr zum Gegenstand der Betrachtung zu werden. Als eine solche begriffliche Vorgabe dienen die Prinzipien der durch Aristoteles und Plotin bestimmten vorhergehenden Epochen, die ihre Gültigkeit gegenüber dem cartesischen Prinzip nur dem Rang nach verloren haben. Und so kann das Ich zunächst aus der reflektierten Einsicht in die eigene Vergänglichkeit den Willen auf die Aufrechterhaltung der Reflexion des Denkens und somit seiner selbst richten, in deren Vollzug es philosophisch wird und die Weltweisheit erlangt. Es kann sodann dem Wissen um die notwendige Voraussetzung der verborgenen Einheit zustimmen, in ihr das Prinzip von Allem erkennen (Prinzip der zweiten Epoche) und im Beachten ihrer Herrschaft religiös werden. Schließlich kann das Ich die unmittelbare Anwesenheit bei dem zuvor als absolute Einheit erkannten Prinzip der zweiten Epoche suchen und damit den Willen auf die Rücknahme der Reflexion des Denkens von aller Beschäftigung mit der Vielheit, aber auch mit der Einheit richten. Der durch die Rücknahme der Reflexion des Denkens ziellos gewordene Wille hebt sich selber auf, wodurch die ursprüngliche Unmittelbarkeit hergestellt werden kann und im Herausfallen aus dieser in die Reflexion zurück als solche auch begriffen. Im Vollzug dieser Möglichkeit wird das Ich mystisch. Der Ursprung der Bewegung lag in der res cogitans und der damit zusammenhängenden reflektierten Einsicht in den Mangel an anwesender Gegenwart, während die reflektierte Einsicht in die Fülle dieser Gegenwart den Willen nach der unmittelbaren Anwesenheit bei ihr erklären läßt. Indem aber die unmittelbare Anwesenheit die völlige Aufhebung der Reflexion des Denkens wie auch des Willens – als welches sich das Ich gegründet weiß voraussetzt, ist sie dem Tod des Ichs gleichzusetzen, womit die Mystik nicht 34 als eine Abhebung von der Religion, sondern als deren Konkretisierung und Radikalisierung erscheint, sieht nämlich jede der fünf Hochreligionen61 in dem Festhalten an der Willensentfaltung62 des Ich den Grund für die Unmöglichkeit der Erkenntnis und damit auch des Vollzuges der Wirklichkeit des Einen63. Der Durchgang durch Prinzipien der abendländischen Philosophie hat gezeigt, daß das Eine die begriffliche Bestimmung seiner selbst und die der Anwesenheit bei sich zuläßt, damit einerseits über dem Welt-Prinzip der ersten Epoche steht, andererseits aber mit der Bestimmung der res cogitans als Prinzip die Qualität des an erster Stelle sicher Gewußten an diese abgeben muß – wodurch diese die Freiheit der Selbstbestimmung gewinnt -, während es gleichzeitig die Attraktion für die willentliche Ausrichtung dieser weiterhin behält, ja sogar noch verstärkt, begreift sich doch das aus der res cogitans entfaltete Ich im Vollzug der Reflexion des Denkens als Dasein zum Tode und im Leiden erlösungsbedürftig. Damit ist die Mystik dem Begriff nach bestimmt worden. Dieser lautet: Mystik gründet in der reflektierten Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart, weiß um die notwendige Voraussetzung der verborgenen Einheit, hat das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit bei dieser zum Inhalt und erkennt sich dadurch als ihr Vollzug in der Vielheit. Dieser Begriff erfüllt für den weiteren Verlauf der Untersuchung zwei Aufgaben: - Die erste besteht in der Hervorbringung einer möglichen allgemeinen Grundlage im Sinne des tertium comparationis für die Bestimmbarkeit beider Größen, der Mystik Eckharts und des Zen-Buddhismus, und damit für die Möglichkeit der ersten Bestimmung des Verhältnisses beider zueinander und das in der angegebenen Reihenfolge. Die zweite Bestimmung wird das Ergebnis der ersten - in Form eines Begriffes – zum Inhalt haben64. 61 Vgl. Anm. 16. 62 B. Uhde „Fiat mihi secundum verbum tuum“, op. cit., S. 93 f. 63 Vgl. exemplarisch für das Judentum: Ex. 33, 20 ff.; für das Christentum: Joh. 3,1 ff.; den Buddhismus: Maka Hannnaya Haramita Shin Gyo – Sutra. 64 Die Beschränkung auf die Möglichkeit der Hervorbringung der für die Untersuchung relevanter Begriffe erweist sich deswegen als eine Notwendige, da, wie gezeigt worden ist, 35 - Die zweite Aufgabe erfüllt der Begriff der Mystik, indem er den Raum strukturiert, in welchem das Ich als das Besondere gegenüber dem Allgemeinen innerhalb dieser konkreten Mystik bedacht und damit gleichzeitig bestimmt werden muß, um in die Bestimmung des Verhältnisses beider – wiederum als Begriff - gelangen zu können. dem Ich, gedacht als Reflexion des Denkens, nur diese Begriffe zum Gegenstand werden können. Dieses sei bedacht vor allem hinsichtlich der zahlreichen Verweise auf Erfahrungen, die innerhalb der aufrecherhaltenen res cogitans, also dem Ich – und damit der Wissenschaft notwendigerweise verstanden als Reflexion des Denkens - nur Mittels der Begriffe zugänglich sein können. Dadurch wird jetzt schon deutlich (auch vorausgreifend für die genauere Untersuchung im III und V Kapitel dieser Arbeit), daß die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit weder Erfahrung noch Reflexion sein kann, da beide einen Inhalt bzw. ein Gegenüber voraussetzen, somit eine Doppelung, was in der absoluten Einheit nicht gedacht werden kann. 36 II. DER MYSTIK-BEGRIFF UND DAS WERK MEISTER ECKHARTS Das Werk Meister Eckharts als Beispiel einer konkreten Mystik innerhalb einer konkreten Religion und beides innerhalb einer konkreten Zeit soll nun im Folgenden als eine solche konkrete Mystik bedacht werden, wobei das Denken im Falle einer Konkretion die Zeit und den Ort ihres Auftretens deshalb nicht außer Acht wird lassen können, weil ihm nämlich diese zwei Komponenten die Bestimmung der Konkretion als solche ermöglichen. So erscheint das Werk Meister Eckharts, zeitlich gesehen, innerhalb des Geltungsbereiches des Prinzips der zweiten Epoche, hat damit das Wissen um die jenseitige Einheit als sicheres zu eigen und muß daher den Fortschritt aller weiteren Reflexion aus der reflektierten Voraussetzung dieser ersten Einheit entfalten65. Der Ort dieser Wissensentfaltung gründet bei Meister Eckhart in der Religion des Christentums, welche das Wissen um die Einheit als „cognitio Dei“ auffaßt und diese dank dem Heraustreten Gottes als Vollzug der Trinität dem Begriff nach empfängt66. Das Christentum kann damit die Einheit als Gott in seiner zeitlosen trinitarischen Reflexion denken, deren Vollzug und damit Inhalt die Liebe ist67. 65 Vgl. dazu Anm. 15, S. 15 f. 66 Eckhart nimmt zunächst den Begriff des plotinischen Einen auf und setzt ihn gleich mit dem Begriff Gott. Vgl. dazu: Prol. prop. n. 6, LW I, S. 43: „Rursus eodem modo se habet de uno, scilicet quod solus deus proprie aut unum aut unus est, Deut. 6: `deus unus est`. Ad hoc facit quod proclus et Liber de causis frequenter nomine unius aut unitatis deum exprimunt.“. In den Predigten wird der der trinitarische Gott und die eine `gotheit` differenziert. Ausf. dazu: Kap. I und II dieser Arbeit. Zur „Cognitio Dei“ als Aufgabe der Theologie vgl. Thomas Aquinas, Summa Theologiea, Prolog. Zum Gedanken der Trinität als Offenbarung Gottes vgl. Augustinus, De trinitate XIII, 17 ff. 67 Vgl. Augustinus, De trinitate, XI, 12. 37 Das geoffenbarte Wissen um das Trinitarische Geschehen ist dem Christentum Inhalt und – gemäß der allgemeinen Bestimmung des Begriffes der Mystik - ihre notwendige Voraussetzung.68 Aus dem so Gedachten zeigt sich aber auch, daß im Falle der Werke Eckharts sowohl die genannte Voraussetzung für die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit wie auch das sicherste Wissen, also das herrschende Prinzip der Epoche, welches die Wissensentfaltung als solche überhaupt erst möglich macht, der Form wie dem Inhalt nach gleich sind. In beiden Fällen wird die verborgene Einheit - innerhalb der Religion des Christentums begriffen als Gott im Vollzug der Trinität – vom Denken als sicheres Wissen um die Notwendigkeit seiner Voraussetzung und damit als notwendig seiend reflektiert. Dadurch aber beansprucht dieses Wissen für sich – als erste sichere Reflexion – die Position der allgemeinsten und sichersten Grundeinsicht, aus der heraus – und somit innerhalb der Begriffsbestimmung der Mystik, sofern diese auf Eckhart bezogen wird – die Vielheit in ihrem umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart gedacht und erst als solche erkannt werden kann. Innerhalb der Herrschaft des Prinzips der durch das Denken Plotins bestimmten „zweiten“ Epoche und der Form nach gedacht erscheint damit notwendigerweise die Reflexion der Einsicht in die Beschaffenheit der Vielheit immer nur als Folge der bereits gewußten und damit ihr begrifflich vorausgesetzten Einheit 69. Diese Vorüberlegungen erklären den Aufbau der Argumentationsstruktur des systematischen Teils des eckhartschen Werkes und erweisen diesen Aufbau als einen – gemäß der zweiten Epoche – folgerichtigen, der dann den Grundvoraussetzungen der Bestimmung der Mystik entspricht: 68 Zur Trinität als Charakteristikum des Christentums vgl. auch B. Uhde, Gott der Eine – Dreieinig? Christliche Überlegungen und Anregungen im Gespräch mit Juden und Muslimen, in: Lebendige Seelsorge, 53/2002, S. 19 f. 69 Hier zeigt sich, daß die Wissensentfaltung der einer Epoche immer nur eine sein kann, die das Prinzip dieser in der Reflexion bereits voraussetzt: „Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philosophie, ihre Zeit in Gedanken erfasst.“ (G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, GA ed. H. Glockner, Reprint Stuttgart-Bad Cannstadt 1964, S. 35.) Und so mußte die Bestimmung des Grundes des Begriffes der Mystik wie auch der Religion, wenn sie dem neuzeitlichen Denken verpflichtet sein will, dessen Prinzip zum Ausgang der Bestimmung nehmen, was auch geschah, indem die res cogitans der reflektierten Einsicht in den Mangel an anwesender Gegenwart als sicheres Wissen vorausgegangen ist. Genau dies unternimmt Eckhart, wenn er dieser Einsicht das sicherste Wissen vorauslegt, welches innerhalb der zweiten Epoche das Wissen um die Voraussetzung der jenseitigen Einheit war. 38 Im Wissen um die notwendige Voraussetzung der verborgenen Einheit muß sich die Reflexion der Einsicht in die Vielheit als die Bestimmung ihrer Nichtigkeit erweisen, weil sie von sich aus Gegenwart und somit Sein nicht hervorbringen kann. Und so wird zunächst nachzuvollziehen sein, wie Eckhart den Begriff der Einheit innerhalb der gegebenen Religion des Christentums bestimmt, ihn als sicherste und damit erste Reflexion begreift, aus ihr heraus die Vielheit in ihrem Wesen erkennt, um sodann schließlich, aus den beiden Grundreflexionen heraus, die unmittelbare Anwesenheit bei dem Einen zu bedenken. 1. Das Eine und das Viele Das Wissen um Gott als erste Reflexion wird von Eckhart aus den oben genannten Gründen an den Anfang aller weiteren Reflexionen, damit also zu Beginn des „Opus tripartitum“, seines systematischen Hauptwerks gestellt, womit er formell der inhaltlichen Priorität des Einen Folge leistet und das gleich in dreifach differenzierter Weise, nämlich mit „Esse est Deus.“ als `prima propositio` des `Opus propositorum`; „Utrum deus sit.“ als `prima questio` des `Opus quaestionum` und „In principio creavit deus caelum et terram.“ als `prima expositio` des `Opus expositionum`70. Der damit aller weiteren Reflexionsentfaltung notwendigerweise vorangestellte Begriff `Gott` bedarf aber im nächsten Schritt des Erweises als sicheres Wissen, damit er die Ableitung aller anderen Reflexionen – hier vor allem der in die Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart - zulassen kann, ohne selber einer solchen zu unterliegen. 70 Prol. gen. in op. trip. n. 11, LW I, S. 38. Daß die Wissensentfaltung Eckharts dem Geist seiner Zeit entsprach (d.h. dem Prinzip der zweiten Epoche folgte) und vom Allgemeinen und Sicheren zum Konkreten und damit aber auch Möglichen sich entfaltete, war dem Meister eine Selbsverständlichkeit: „Primum est quod de terminis generalibus, puta est, unitate, veritate, sapientia, bonitate et similibus nequaquam est imaginandum vel iudicandum secundum modum et naturam accidencium, quae accipiunt esse in subiecto et per subiectum et per ipsius transmutationem et sunt posteriora ipso et inhaerendo esse acipiunt. (...) Secus autem omnio se habent de praemissis generalibus. Non enim ipsum esse et quae cum ipso convertibiliter idem sunt, superveniunt rebus tamquam posteriora, sed sunt priora omnibus in rebus.“ Prol. gen. in op. trip. n. 8, LW I, S. 36. 39 So muß Eckhart als erstes die begriffliche Bestimmung der Existenz Gottes als sicherste Reflexion erweisen, die damit allen anderen vorausgehend von diesen wiederum als ihr sicherster Grund reflektiert werden kann. Als Zweites muß er dessen Wesen bestimmen, damit ein Qualitätsurteil über die Vielheit ableitbar ist. Aus den beiden Vorhergehenden und damit als drittes resultierend steht dann die Benennung des Verhältnisses beider zueinander an, welche dem Inhalt nach im Begriff des Qualitätsurteils erscheinen wird. Weil aber in Gott dem Begriff nach Sein und Wesen zusammenfallen – „Sed esse est essentia dei sive deus“ – ist die Bestimmung seiner Existenz gleichzeitig die seines Wesens und umgekehrt, so daß beide Erweise nur der Form nach getrennt voneinander durchführbar sind, dem Inhalt nach jedoch notwendigerweise als aufeinander bezogen gedacht werden müssen71. Damit gilt für, daß Gott ist, weil das Sein Gott ist, und weil das Sein Gottes Wesen ist, sind beide untrennbar und daher identisch. Daher die erste propositio: „Esse est deus“. Und nun bedenkt Eckhart den Erweis dieser propositio in fünf Stufen:72 - Erstens: Alles, was ist, kann ohne das Sein nicht gedacht werden, da es sein „Ist“ von diesem empfängt. Das gilt auch für Gott. Ist dieses Sein jedoch nicht identisch mit ihm, so müsste Gott dem Sein nach eine andere Ursache außerhalb seiner selbst haben, weswegen dann diese Ursache und nicht er als Gott begriffen werden müsste. Weil Gott aber nicht die Ursache seiner selbst außerhalb seiner selbst haben kann, muß das Sein als mit ihm Identisches gedacht werden. - Zweitens: Haben alle Dinge ihre Ursache im Sein und wäre dieses nicht Gott, so müßten sie diese außerhalb seiner haben, was wiederum Gott als verursacht voraussetzen würde. Weil die zweite Behauptung im ersten Argument bereits widerlegt worden ist und alle Dinge im Sein gründen, muß dieses identisch mit Gott sein. - Drittens: Dem Sein kann nur der Begriff des Nichts gegenübergestellt werden, und Schöpfung wird dadurch als Seinsgabe aus dem Nichts durch das Sein selber gedacht. Könnten das Sein und Gott als getrennt 71 Vgl. Prol. gen. n. 13, LW I, S. 39. Hier stimmt Eckhart noch mit Thomas überein. Vgl. dazu Thomas, Summa theol. I q. 3 a. 4. 72 Prol. gen. n. 13, LW I, S. 38. Eine detaillierte Analyse dieser Argumentationen findet sich bei B. Mojsisch, Meister Eckhart. Analogie, Univizität und Einheit, Hamburg 1983, S. 44 ff. 40 voneinander gedacht werden, so müsste dieser Gedanke notwendigerweise eine Trennung von Schöpfer und Gott beinhalten, was nicht sein kann. - Viertens: Alles was Sein hat, ist, indem es dieses empfängt, und kann daher ohne das Sein nicht gedacht werden (drittes Argument). Wäre das Sein getrennt von Gott, so könnte dieser notwendigerweise nicht als erste Ursache gedacht und somit nicht als Gott bestimmt werden. - Fünftens: Wie Eckhart bereits im dritten Argument formulierte, ist außerhalb des Seins nur das Nichts denkbar, und so müsste Gott als Nichts gedacht werden, was nicht möglich ist und woraus die Identität von Sein und Gott folgt. Der Erweis der Gleichstellung des Seins mit Gott ermöglicht Eckhart jetzt, im zweiten Schritt, das Bedenken der Frage nach der Existenz Gottes überhaupt: „Utrum deus sit“, die Eckhart als `prima quaestio` zu Beginn des `Opus quaestionum´ stellt und die Gründe für ihre Bejahung in enger Anlehnung an die vorher erwiesene `propositio` wie folgt entfaltet:73 - Wenn Gott nicht ist, dann ist nichts. Und weil für Eckhart der Nachsatz nicht stimmt – „probat natura, sensus et ratio“ - schließt er dadurch auf die falsche Annahme des Vorsatzes. - Weil die Selbstprädikation für Eckhart die sicherste Aussage ist und Gott und das Sein identisch sind, ist der Satz, Gott ist, die sicherste Reflexion. - Augustinus zustimmend begreift Eckhart die Unmöglichkeit der Selbstaufgabe aller Dinge und damit auch des Seins. Weil er aber das Sein als identisch mit Gott denkt, müsste die Selbstaufgabe des Seins die Nichtexistenz Gottes zu Folge haben, wovon die Voraussetzung und daher auch der Nachsatz falsch ist. 73 Prol. gen.in op. trip. n. 13, LW I, S. 39. Bezüglich der sogenannten `Gottesbeweise` sei Folgendes bemerkt: Innerhalb der Hochscholastik war die Existenz Gottes als sicheres Wissen derart erhaben über alle Zweifel, daß der Schwerpunkt der Traktate und Abhandlungen dieser Zeit eher in der Klärung des „wie“ der Existenz Gottes und dem Verhältnis Gott – Schöpfung – Kreatur seine Aufgabe gesehen hat. Dieser Bestimmung widmete auch Eckhart den Hauptteil seines systematischen Werkes und allem voran die Predigten. 41 - Weil das Wesentliche dem Seienden sein Eigenes und nicht Verursachtes ist und Gottes Wesen eben mit dem Sein schlechthin als identisch begriffen wird, ist für Eckhart der Nachsatz nicht nur wegen der Richtigkeit des Vorsatzes, sondern in Bezug auf Gott wegen der Identität beider Inhalte notwendig wahr. Die begriffliche Bestimmung der Existenz wie auch des Wesens Gottes vorausgesetzt und als Wissen gesichert ermöglicht Eckhart jetzt das Bedenken des Verhältnisses zwischen Gott und der Welt, kann nämlich diese nur dank der als sicher geltenden Reflexion in die notwendige Voraussetzung der Existenz Gottes und der Erkenntnis seines Wesens, in ihrem Wesen erkannt und dem Begriff nach bestimmt werden. Die Grundlagen dieses Verhältnisses bedenkt Eckhart als `prima expositio` zu Beginn des `Opus expositionum` und das deswegen an dieser Stelle, weil die Schrift – sowohl die des alten wie auch die des neuen Bundes – die Offenbarung Gottes an die Schöpfung nicht nur beinhaltet, sondern im gewissen Sinne auch ist; und so denkt Eckhart das Heraustreten Gottes aus sich und in sich im Wort und als Wort und dieses Wort wiederum als das Leben und somit das Sein der Schöpfung, das von dieser im Erkennen empfangen wird74. Daher kann Eckhart dieses Verhältnis wie folgt bestimmen75: - Wurde Gott dem Wesen nach als Sein bestimmt, so empfangen alle Dinge von ihm ihr Sein. - Ist außerhalb des Seins nur das Nichts als Begriff denkbar und ist das Sein mit Gott identisch, so sind alle Dinge im Sein und damit in Gott gegründet. - Weil bei Gott keine Zeit gedacht werden kann, muß das `in principio creavit` der Schöpfung als ein `semper creit` gedacht werden. 74 Hier an dieser Stelle soll nur angedeutet werden, was im Kap. III dieser Untersuchung ausführlicher bedacht wird, nämlich das Verhältnis der Vernunft zum Sein, wie dieses Eckhart zu eigen ist und das er in den Quaestiones Parisienses I und II zu entwickeln beginnt und in den Predigten zur Vollendung führt. Vgl. dazu: Quest. Par. I n. 4 ff. LW V, S. 40 ff.; In Ioh. n. 10 ff. LW III, S. 10 ff. 75 Prol. gen. n . 17 ff. LW I, S. 39 f.; Gen. n. 2 ff. LW I, S. 49. 42 - Aus dem gleichen Grunde der Zeitlosigkeit muß alles Geschaffene als vollendet und beendet zugleich gedacht werden. Das Verhältnis zwischen Gott und Vielheit denkt Eckhart zunächst als das des Schöpfers zum Geschaffenem, der Ursache zum Verursachten, des Gebenden zum Empfangenden und des Seins zum Nichts und zeigt, daß die Reflexion der Einsicht in die Beschaffenheit der Welt nur als Ableitung des Wissens um die notwendige Voraussetzung des ihr zugrunde liegenden Gottes möglich ist, den er ja deswegen im Vorfeld dem Begriff nach in dreifacher Weise bestimmt hat, nämlich „daß“ er ist, „was“ er ist und „wie“ er ist. Diese dreifache Bestimmung Gottes macht jetzt auch ein dreifaches und daraus ableitbares, daher analoges Wissen um die Beschaffenheit der Welt möglich: - Erstens: Kann Gott und nur ihm allein die Existenz aus sich selber zukommen – wegen der Identität von Sein und Gott –, so kann das Seiende als unabhängig von Gott, gleichsam als aus sich heraus Existierendes nicht gedacht werden76. - Zweitens: Ist Sein mit Gott identisch, so sind alle Dinge an sich, also unabhängig bzw. außerhalb von Gott, für Eckhart ein „Nichts“77. Der Begriff des Nichts bezogen auf den Wesensstand der Dinge, wenn sie als unabhängig von Gott gedacht sein sollten, kann für Eckhart nicht scharf genug hervorgehoben werden und so fügt er ihm – als würde dieser auf ein Etwas bezogen sein können und somit paradoxerweise – das Adjektiv „rein“ hinzu78 ; übersteigt ihn nochmals mit der Umformulierung zur „Nichtigkeit“79 und „Nichtheit“80 um im Begriff der „Lüge“ zu münden81. 76 Prol. prop. n. 21. LW I, S. 46:„...nihil ens hoc vel hoc dat esse.“ 77 In Sap. n. 91. LW II, S. 424: „Omne autem ens divisum a deo dividitur et distinguitur ab esse, quia deus est ipsum esse. Divisum autem ab esse et distinctum necessario nihil est; nihil enim tam quam divisum ab esse.“ 78 Pred. 4, DW I, S. 69 f.: „ Alle crêatûren sind ein lûter niht. Ich spriche niht, daz sie kleine sîn oder iht sin: sie sint ein lûter niht. Swaz niht wesens enthât, daz enist niht. Alle crêatûren hânt kein wesen, wan ir wesen swebet an der gegenwerticheit gotes. Kêrte sich got ab allen crêatûren einen ougenblik, sô würden sie ze nihte.“ 79 Sermo XXVII, n. 375, LW II, S. 320: „Et notatur etiam in hoc creaturae nihileitas.“ 43 Drittens: Wird die Welt in ihrem Verhältnis zu Gott als eine von ihm verursachte Größe begriffen und zwar derart, daß ohne ihn nur das Nichts als Begriff nennbar, nicht aber inhaltlich denkbar ist, so müssen alle Aussagen, die von Gott gemacht werden können – also die Transzendentalien – bezüglich der geschaffenen Dinge ausschließlich als deren Negation in Erscheinung treten, denn positiv ausgedrückt kommen sie nur Gott zu82 und Allem, was im Sein selbst und das heißt in Gott gedacht wird83. An sich aber sind sie als Nichts die Negation des Seins84; als Vielheit die Negation der Einheit 85, als Lüge die Negation der Wahrheit86 und als das Schlechte die Negation des Guten87. Das Sein, gedacht als Gott; begriffen als das Eine, Wahre und Gute; erkannt als sicheres Wissen und damit erste Reflexion ist für Eckhart Voraussetzung genug, die Einsicht in die Vielheit als die Reflexion ihrer gänzlichen Nichtigkeit zu begreifen und damit in ihr und sie selbst für sich genommen als Ausdruck des umfassendsten Mangels an anwesender Gegenwart zu bestimmen. Und weil sich in dieser Reflexion auch die Mystik gegründet weiß und auf den Begriff der Mystik hin das Denken Eckharts in diesem Teil der Untersuchung bedacht sein wollte, erfüllt Eckhart mit dieser ihre erste Grundbestimmung. Gleichzeitig mit der Bestimmung Gottes als Sein, 80 Sermo XV 2, n. 158, LW II, S. 150: „...nec vitae, quae vapori et umbrae comparatur, non tam pro brevitate, durationis quam pro nulleitate...“. Die Übersetzung von „nulleitate“ mit Nichtheit entnommen aus: B. Mojsisch, Meister Eckhart, op. cit., S. 51. Dort heißt es treffend: „...Ohnmacht des Bestimmten gegenüber der Undurchschauten sich mit sich selbst vermittelten Andersheit, dem Sein. Das Bestimmte als solches ist Lüge, ist Versagen, ist Ohnmacht ist nicht allein nichts, sondern das Nichts schlechthin: nihileitas oder nulleitas, Nichtheit oder Nichtigkeit.“ 81 Sermo XXV 2, n. 264, LW II, S. 240: „Hoc enim et hoc creatura est, proprium est, mendacium est.“ 82 Prol. prop. n. 25, LW I, S. 47:„...solus deus proprie est ens, unum, verum, bonum.“ 83 Prol. prop. n. 9, LW I, S. 43: „...quod a solo deo omnia habent esse, unum esse, et verum esse et bonum esse (...) Quomodo enim quippiam esset nisi ab esse, aut unum esset nisi ab uno aut per unum sive per unitatem, aut verum sine veritate, vel bonum nisi per bonitatem...?“ 84 Pred. 11, DW I, S. 185. 85 In Gen. n. 113 f. LW I, S. 71 f. 86 Vgl. dazu Anm. 78. 87 In Sap. n 15 f. LW II, S. 336 f. 44 Eines, Wahrheit und Gutheit, die er notwendigerweise der zweiten Reflexion hat voranstellen müssen, könnte auch schon die zweite ausbleibende Grundvoraussetzung der Mystik erfüllt sein, stimmt nämlich der von Eckhart oben aufgeführte Begriff Gottes mit dem Inhalt der christlichen Religion überein und ist damit die zweite Voraussetzung der Mystik – wie diese bereits definiert worden ist. Hier sieht Eckhart die Stärke seiner bisherigen – zugleich aber auch der zeitkonformen – Begriffsbestimmung Gottes, ihre und damit auch seine eigene Absicht vollzogen zu haben, welche in der Betonung der Allheit Gottes gegenüber der Nichtigkeit der Dinge – sofern sie außerhalb seiner gedacht werden – ihren Inhalt erschöpft88. Die Schwäche dieses Begriffes von Gott offenbart sich für Eckhart in der trinitarischen und damit reflexiven Bezogenheit Gottes auf sich selber wie auch auf die Vielheit. Dadurch nämlich ist Gott dem Begriff nach Doppelung und kann als Ziel der Aufhebung einer solchen – und somit als Ziel der Mystik – nicht gedacht werden89. 2. Die Einheit Den gedanklichen Weg von Gott als `unum et trinum` über den Gott als `unus´ bis hin zum Begriff der `gotheit` versteht Eckhart als Läuterung des ersten auf den letzten hin, der dann weder als sein Gegensatz - die Trinität als Begriff und Erkenntnisweise der Reflexion und damit als revelatio dei quo ad nos bleibt mit dieser, für diese und als diese notwendigerweise erhalten – noch als dessen Essenz und somit begriffliche Verdichtung erscheint. Vielmehr denkt Eckhart das `unus-esse dei´ im Vorgang der Läuterung als begriffliches Destillat des `unum esse dei´, und zwar deswegen, weil das ´unus´ als Begriff im Vorgang des Erkennens das 88 Damit reduziert Eckhart die seine Zeit beherrschende Analogielehre zum rhetorischen Stilmittel einer weit aufs Größeres angelegten Unterweisung. Vgl. dazu: In Joh. n. 5, LW III, S. 7; In Eccli. n. 61; LW II, S. 290. In der Beurteilung dieser Stelle übereinstimmend mit B. Mojsisch, Meister Eckhart, op. cit., S. 51: „Einzig zum Zweck der Hervorhebung der Schwachheit der Geschöpfe gegenüber der Erhabenheit Gottes, zum Zweck der Markierung ihrer Nichtigkeit, sofern sie in sich selbst genommen werden, dient, wie Eckhart selbst bemerkt, die Analogielehre.“ 89 Vgl. Pred. 2, DW I, S. 42 ff. 45 `unum´ in sich hinein aufhebt und dadurch voraussetzt, somit der Offenbarung Gottes – die uns zu Erkenntnis geschah – notwendigerweise in umgekehrter Richtung denkerisch folgt. Anders ausgedrückt: Zunächst beginnt Eckhart den innertrinitarischen Vorgang als kausales Verhältnis zu denken, an dem das Seiende in analoger Weise partizipiert und sich damit als Vielheit gegenüber der Einheit begreift. Indem aber Eckhart innerhalb der Trinität das Erkennen vorrangig vor dem Sein denkt, muß er die Trinität als Reflexion des Denkens im Vollzug begreifen, und als Reflexion läßt sie sich nicht mehr als kausales, sondern als konditionales Verhältnis denken, wonach das Denken und das Gedachte jeweils gegenseitig Ursache und Verursachter füreinander sind und damit zwar „unus“, als Reflexion jedoch weiterhin „trinus“, mithin „Doppelung“ – in der Dreiheit der Personen – bleiben. Im weiteren Verlauf nimmt er den Begriff des „unus“ nur noch vor der Wesensbestimmung der „gotheit“ an sich zurück, die in ihrer absoluten Einheit beide Bestimmungen übersteigend, die Reflexion und damit jegliche Doppelung zu ihrer Selbstaufgabe zwingt. Diese „Zurücknahme“ des „unus“ als letzte Doppelung vor der Einheit geschieht für Eckhart innerhalb der als konditionales Wechselverhältnis von Denken und Gedachtem, also als der durch Vater und Sohn begriffenen Trinität, und zwar dadurch, daß eine Seite des Verhältnisses – nämlich die des Sohnes und damit der Schöpfung – dem Begriff nach aufgehoben wird, wodurch sich gleichzeitig (eben weil konditional bezogen) die zweite – nämlich Gott als Vater und Schöpfer – aufhebt. Das Ergebnis der Aufhebung wird manifest in der Möglichkeit der Benennung der absoluten Einheit im Begriff der „gotheit“, die erst jetzt in Erscheinung treten kann. a. Die kausale Einheit und analoge Vielheit Den Ausgang aller Entwicklung des Begriffes „Gott“ bildet die zu Eckharts Zeiten ausgeprägte Trinitätslehre, die dem Magister bestens bekannt ist und die er wie folgt wiedergibt: „...propter hoc restat ostendere ex naturalibus, per naturalia et in naturalibus quod in divinis et praecipue in deo necessarium est dicere et fateri patrem, filium et spiritum sanctum, et quod `hi tres unum sunt`, non unus; adhuc 46 autem quod coaeterni sunt, coaecuales et consubstantiales, unum in omnibus, que naturae sunt, distincti autem in solis illis et omnibus, quae generare et generari, spirare et spirari sapiunt, connotant vel important.“90 Diese Trinitätsauffassung im Sinne einer Definition ist nicht das Problem Eckharts, so daß er bemüht wäre, eine neue zu bestimmen. Die oben aufgeführte hat seine Zustimmung, und deren tragende Begriffe werden von ihm übernommen. Der ganze Schwerpunkt seines Denkens gründet in der Auseinandersetzung mit der zu seiner Zeit üblichen Interpretation der trinitarischen Bestimmung und damit der Begriffsbestimmung Gottes im Sinne der absoluten Einheit. Die scholastische Lehre seiner Zeit gipfelt in den beiden Summen des Aquinaten, der die causa efficiens-Theorie wie auch den Hylomorphismus des Aristoteles auf Gott überträgt, wonach dann in Gott dessen Sein, Wesen, Erkenntnisvermögen- und Akt sowie Tätigkeit zusammenfallen und in der Weise eins sind, wie dies analog und daher zeitlich und räumlich begrenzt dem Seienden, entsprechend dessen Position innerhalb der Seinshierarchie, zukommt 91. Um die Einheit der drei göttlichen Personen aufrecht zu erfassen, ist die zweite Person als „natus et non creatus“ aufzunehmen. Sie bleibt aber auf die erste als Ursache derart bezogen, daß diese ohne die zweite, die zweite aber nicht ohne die erste gedacht werden kann, da ihr sonst der Status der absolut ersten Ursache und damit das Gott-Sein abgesprochen werden müsste. Das gleiche gilt dann für den Geist, der aus den beiden ersten Personen seiner Ursache nach hervorgeht. Thomasisch gedacht also gründet das „unum“ der drei göttlichen Personen im „natus“ der zweiten und „spiritus“ der dritten, während das innertrinitarische Verhältnis vom Vater zum Sohn und von beiden zum Geist kausal bestimmt ist und das bei der gleichzeitigen Voraussetzung, daß der Kausalitätsbegriff, angewandt auf Gott, die Tendenz der trinitarischen Begriffsentfaltung und nicht den Sachverhalt selbst, die Trinität also, wiedergibt, kann nämlich das Denken als Vielheit diese, da dem Inhalt nach als Einheit gedacht, in der Folge eines synthetischen Urteils nicht erfassen. 90 In Joh. n. 160, LW III, S. 132. 91 Vgl. Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, I 45. 47 Die so verstandene kausale Bestimmung des innertrinitarischen Vorgangs wiederum erklärt damit ihrerseits die Entfaltung der Analogielehre, indem sie diese als solche ermöglicht: Das zeit- und raumlose kausale Verhältnis der göttlichen Personen zueinander wird in ihrem Heraustreten aus sich selber als Ursache der Schöpfung gedacht, welche sich dann, nicht nur in Raum und Zeit, sondern als Raum und Zeit, damit notwendigerweise als qualitativ minderes Sein – eben analoges – im Nach-Vollzug der Trinität begreift. Damit zeigt die Bestimmung der Trinität als kausales Verhältnis zwei Gründe auf, die sie als Ziel der Mystik ausschließen: - Erstens: Die Trinität, gedacht als kausales Verhältnis der drei Personen zueinander, erweist sich allein schon auf Grund der Möglichkeit, ein Verhältnis innerhalb der „gotheit“ bestimmen zu können, als „Doppelung“ und damit nicht absolute Einheit. Dabei ist es für den Begriff der Mystik völlig unerheblich, wie dieses Verhältnis bestimmt wird. Alleine die Tatsache, daß eine Verhältnisbestimmung möglich ist – und innerhalb der Religion des Christentums war und ist es notwendig, eine solche anzunehmen – deutet auf eine „Doppelung“ – in der Dreiheit der Personen – hin. - Zweitens: Indem das aus der Kausalität stammende Prinzip der Analogie dem Seienden eine der Trinität qualitativ untergeordnete Seinsstufe zuweist, errichtet es damit gleichzeitig zwischen beiden eine ontologische Schranke und damit einen eben solchen Unterschied, der die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit deswegen ausschließt, weil dadurch das Erkennen des Gleichen vom Gleichen als prinzipiell nicht denkbar besiegelt wird. Diese beiden Gedankengänge zwingen Eckhart geradezu, die Einheit Gottes neu zu bedenken, und daß er damit bei der Trinität einsetzen muß, ergibt sich nicht nur aus dem Kontext der Zeit, sondern aus dem Selbstverständnis des Christentums an sich. 48 b. Die konditionale Einheit und univoke Vielheit. Wie schon angedeutet behält Eckhart die innertrinitarische Begrifflichkeit bei, setzt den Begriff Gott mit dem des Vaters gleich, betont dessen zeitlose „Fruchtbarkeit“92 im Zeugen des Sohnes und – hier setzt die Wende gegenüber der thomasischen Vorlage an – denkt das Zeugen als Erkennen und damit als Denken93. Während sich, thomasisch gedacht, der Vater im Gezeugten erkennt und somit das Zeugen als ins Sein-Rufen Vorrang vor dem Erkennen hat (daß die Rede vom `Vorrang` innerhalb der Trinität weder zeitlich noch räumlich gedacht werden kann, versteht sich von selbst), denkt Eckhart das Erkennen und somit das Denken an sich schon als Sohnzeugend und damit das SohnSein nicht als `voraussetzendes`, sondern stiftendes Geschehen94. Weil er damit das Denken als zeugend und erkennend in einem denkt und weil der Denker im Gedachten sich selbst denkend erkennt und damit zeugt, ist für Eckhart Gott, trinitarisch gedacht, Reflexion des Denkens im Vollzug und daher Tätigkeit. Der Vater denkt sich im Sohn als Sohn und erkennt sich dadurch als Vater, weil er sich im Sohn als Vater gleichzeitig zeugt95 und das in zeitloser, weil ewiger Weise96. Indem Eckhart Gott und damit die Trinität mit der Reflexion des Denkens identisch denkt, muß er notwendigerweise für das innertrinitarische Verhältnis der drei Personen zueinander die Bestimmungen übernehmen, die den drei Komponenten der Reflexion des Denkens eigen sind. Lassen sich die drei Komponenten der Reflexion als der Denker, das Gedachte und 92 „Amplius autem paternitas nomen est fecunditatis.“ Sermo n. 363, XXXV, LW IV, S. 312. 93 In Joh. n. 31, LW III, S. 25, 4: „...quia semper intellexit, semper filium genuit.“ 94 In Joh. n. 31, LW III, S. 25, 2 – 4: „... quia semper actu intelligit, et intelligendo gignit rationem; et ipsa ratio, quam gignit ipsum intelligere suum, est ipse deus: deus erat verbum, et hoc erat in principio apud deum, quia semper intellexit, semper filium genuit.“ 95 Quest. Par. I n. 4, LW V, S. 40:„...et est ipsum intelligere fundamentum ipsius esse.“ 96 In Joh. n. 31, LW III, S. 25, 6 – 8: „...quia semper gignit actu sicut erat, id est sicut genuit, a principio: aut enim semper aut nunquam, quia finis et principium idem ibi est, ut dictum est supra.“ 49 das Denken benennen, so ist das Verhältnis dieser zueinander konditionaler Art: - Der Denker , das Gedachte und das Denken treten nur gleichzeitig als Gesamtheit im Vollzug auf. Man kann nämlich nicht das Gedachte ohne den Denker, das Denken ohne den Denker und das Gedachte und den Denker ohne das Denken und das Gedachte denken. - Weil, wie gezeigt worden ist, alle drei Komponenten entweder gleichzeitig oder gar nicht auftreten können, führt die Aufhebung einer einzigen Komponente in die gleichzeitige Aufhebung aller anderen und somit der Reflexion an sich. Damit ist notwendigerweise jede Komponente die conditio sine qua non innerhalb des Gesamtgefüges. - Im Vollzug sind die drei Komponenten nur dem Begriff, jedoch nicht der Sache nach zu unterscheiden. Würde nämlich das zweite zutreffen, müsste einer jeden unabhängige Existenz zukommen, was aber nicht denkbar ist. - Keine der drei Komponenten hat Vorrang vor einer der beiden anderen als deren Ursache, weil sie damit als deren Voraussetzung ohne die anderen denkbar sein müsste, was nicht möglich ist. Aus dem Gesagten ergibt sich für den Begriff der Trinität, daß durch die Tatsache ihrer Bestimmung als Reflexion des Denkens im Vollzug das Verhältnis der trinitarischen Personen zueinander nicht mehr kausal, sondern nur noch konditional denkbar ist mit der Folge, daß die drei Personen der Trinität als gleichzeitig und gleichberechtigt erscheinend – eben im Sinne der conditio sine qua non – gedacht werden müssen. Diesen Wandel zur Konditionalität hin formuliert Eckhart in aller Deutlichkeit im Johanniskommentar, wo es jetzt heißt: „Pater enim et filius opponuntur relative: in quantum opponuntur, distinguuntur, sed in quantum relative mutuo se ponunt; nec est nec intelligitur pater sine filio et e converso, et per consequens filius non excludit nec tacet, sed enarrat patrem esse patrem. Si enim filius est , pater est; si pater est , filius est. Si semper Pater fuit et est, semper filius fuit et est: semper natus, semper nascitur.“97 97 In Joh. n. 197, LW III, S. 166. 50 Das bedeutet: - Treten der Denker und das Gedachte gleichzeitig hervor, so auch der Vater und der Sohn98. - Das gleichzeitige Hervortreten begründet nicht im Sinne einer Ursache, sondern ist als Hervortreten selbst das Verhältnis beider zueinander: „Pater enim et filius opponuntur relative“, und damit Unterschied: „in quantum opponuntur, distinguuntur“. - Manifestiert sich die Reflexion des Denkens immer schon als Denker und Gedachtes, damit Gott als Vater und Sohn, und ist das Auftreten einer jeden Komponente des Reflexionsverhältnisses nur im Zusammenhang mit den anderen denkbar, so ist der Vater Vater wegen des Sohnes und der Sohn Sohn wegen des Vaters: „nec est nec intelligitur pater sine filio et e converso, et per consequens filius non excludit nec tacet, sed enarrat patrem esse patrem. Si enim filius est , pater est; si pater est , filius est. Si semper Pater fuit et est, semper filius fuit et est...“, so daß der Vater nicht mehr als Ursache und der Sohn als Verursachter gedacht, sondern jeweils als conditio sine qua non füreinander, in der Gleichzeitigkeit ihres Erscheinens begriffen werden. Die konditionale Wechselbeziehung der drei Komponenten der Reflexion des Denkens ist immer schon notwendigerweise der Ausdruck ihrer Einheit, weil keine der drei als unabhängig existierend denkbar ist. Für den Gottesbegriff folgt daraus für Eckhart: Ist Gott immer nur und immer schon als Vater, Sohn und Geist denkbar - wobei der Vater nicht ohne den Sohn, dieser nicht ohne den Vater; der Geist nicht ohne die beiden und die beiden nicht ohne den Geist vorstellbar sind – so sind die drei göttlichen Personen die „Komponenten Gottes“ in der Weise, wie dieser jetzt als Erkenntnis gedacht wird. Die Erkenntnis an sich aber ist die Reflexion des Denkens und das ist jetzt für Eckhart dem Begriff nach Gott. Gott ist damit weder Vater noch Sohn noch Geist, sondern diese drei, als Momente ihrer selbst vereinende und damit übersteigende Reflexion des Denkens, als Ganzes im zeitlosen Vollzug ihrer selbst und erst als solche begriffene Einheit im Sinne des „unus“: - „deus tuus deus unus est. Ubi nota, quod unitas sive unum videtur proprium et proprietas intellectus solius.(...) Unde signanter dictum est: 98 In Gen. n. 7, LW I, S. 190: „Simul enim et semel, quo deus fuit, quo filius sibi coaeternum per omnia coaequalem, deum genuit...“ 51 deus tuus deus unus est, deus Israel, deus videns, deus videntium, qui scilicet intelligit...“99 - „...quod (unum) nusquam est et nunquam nisi in intellectu, nec est, sed intelligitur.(...) Intellectus enim proprie dei est, deus autem unus.“100 Bestand, thomasisch gedacht, das innertrinitarische Verhältnis aus „Doppelungen“, die kausal bestimmt waren, so hat sie Eckhart in die Einheit Gottes, begriffen als Reflexion des Denkens, dadurch aufheben können, daß er ihre Konditionalität innerhalb der sich vollziehenden Reflexion des Denkens erkannte. Das kausale „generare“ als Bezeichnung des Verhältnisses vom Vater zum Sohn bestimmte die christliche Trinitätslehre und ist als Begriff Träger und damit Ausdruck des „unum esse die“. Eckhart kann ihn jetzt, auf Grund der erkannten Konditionalität, durch den Begriff des „ponere“, ersetzen, der die besagte Konditionalität zum Ausdruck bringend die Einheit nicht schafft, sondern bereits voraussetzt. Damit ist der Unus-Begriff Gottes die erste Konsequenz aus seiner Bestimmung als Reflexion des Denkens. Die zweite Konsequenz betrifft die Aufhebung der „ontologischen Schranke“ welche das analoge Denken der Scholastik in Folge der kausalen Gottesbestimmung zwischen ihm und dem Seienden errichtet hat. Innerhalb der thomasischen Gottes- und damit Trinitätslehre bezieht sich der kausale Begriff des „generare“ ausschließlich auf den Sohn, soweit er Gott ist und innertrinitarisch gedacht wird. Außerhalb der Trinität gilt die creatio ex nihilo, die dem als absolut gedachten Sein Gottes notwendigerweise qualitativ, weil verursacht und quantitativ, weil Vielheit gegenüber dem Einen, untergeordnet ist. Begreift aber Eckhart Gott als „intellectus se toto“101, der nicht mehr das oberste Sein der Kausalität ist, sondern dieses Sein denkend, weil er Denken ist, hervorbringt, so ergeben sich daraus für das Verhältnis Gottes zu seiner Schöpfung folgende Bestimmungen: 99 Sermo XXIX, n. 300, LW IV, S. 267. 100 Sermo XXIX, n. 303 f. LW IV, S. 269. 101 Sermo XXIX, n. 300, LW IV, S. 267. 52 - Gott ist Vater und nur dann Vater, sofern er den Sohn zeugt. Er zeugt ihn, indem er ihn ausspricht, denn der Sohn ist das Wort. Das Zeugen als Sprechen ist Vollzug des Denkens: Also zeugt Gott den Sohn, weil er ihn denkt102. - Der Zeitlosigkeit wegen kann in Gott weder ein `Vorher` noch ein `Nachher` gedacht werden, weswegen Gott nur ein Wort spricht und dieses notwendigerweise am Anfang103, weil damit der Anfang im Sinne der „Doppelung“ und als Folge dessen Wahrnehmung und damit Zeit überhaupt erst in Erscheinung treten. Dieses Wort ist dann sowohl der Sohn wie auch die ganze Schöpfung104. - Weil alles entweder Sein ist (Gott) oder Sein hat (Schöpfung) und dieses von Gott denkend geschaffen wird in der Weise, daß es identisch mit ihm ist, kann notwendigerweise außerhalb des Seins und damit Gottes nichts existieren, denn sonst müsste Gott etwas außerhalb seiner selbst denkend schaffen, was seinem Alles-Sein widerspräche und er nicht als Gott denkbar wäre. Damit ist das Nichts außerhalb Gottes kein Hinweis auf ein Etwas, vielmehr reine Verneinung des Seins105 und begriffliche Notwendigkeit innerhalb der Entfaltung der bipolaren Logik. - Daraus resultiert wiederum, daß es nur Gott gibt, weil es nur Gott geben kann und weil er entweder ganz oder gar nicht gedacht werden kann, ist alles dem Sein nach in ihm und mit ihm gleiches Sein oder nicht existierend106. Mit diesen Schritten hebt Eckhart die klassische „ontologische Schranke“ auf, ohne aber auf die Hierarchie zwischen dem „deus unus“ und seiner creatio gänzlich verzichten zu wollen und zu können, denn diese, so Eckhart jetzt, findet im Erkennen und nicht im Sein statt, denn im Sein müssen alle Dinge – und nicht nur die göttlichen Personen – notwendigerweise in Gott 102 Vgl. dazu: In Joh. n. 44, LW III, S. 37. 103 Vgl. dazu: Prol. gen. n. 15 f. LW I, S. 39; In Gen. n. 7, LW I, S. 50.; In Joh. n. 4 – 51. LW III, S. 5 – 42. 104 Vgl. In Gen. n. 7, LW I, S. 50 f. 105 Vgl. Prol. gen. n. 17, LW I, S. 39. 106 Vgl. In Gen. n. 7, LW I, S. 50. 53 und damit gewissermaßen als Gott gedacht werden. Im Erkennen jedoch besteht für Eckhart folgende Hierarchie: - Sind alle Dinge das eine Sein und ist dieses eine Sein Gott, dann ist Gott nur in der Weise Gott, wie er dieses Sein im Denken hervorbringt da er reines Denken ist107. - Weil in Gott das Sein und Denken eins sind und weil außerhalb seiner kein Sein gedacht werden kann, ist ein möglicher Abfall von Gott nur in die Entzweiung von Sein und Denken denkbar, welches dadurch als Doppelung die Einheit verliert108. - Der Abfall von Gott ist damit der Verlust der Fähigkeit diesen aus der Doppelung der Reflexion heraus als Einheit zu erkennen109. - Je weniger diese Fähigkeit einem Seienden zukommt, desto weiter ist es von der Einheit entfernt, obwohl es gleichzeitig dem Sein nach in Gott gedacht werden muß110. War die Aufhebung der „ontologischen Schranke“ als Ergebnis der Einsicht in die Konditionalität der Trinität möglich, und konnte diese wiederum aus der Bestimmung Gottes als Reflexion des Denkens erkannt werden, so ist jetzt das Aufrichten einer Erkenntnishierarchie die notwendige Folge der Bestimmung Gottes als Erkenntnis, die eine solche setzt, weil sie eine solche ist. Gesucht war innerhalb des eckhartschen Werkes ein Gottesbegriff, der als Einheit Doppelungen übersteigt und als Ziel für die Aufhebung dieser der Mystik zu Voraussetzung wird. Zunächst schied das thomasische „unum dei“ auf Grund seiner innertrinitarischen Kausalität und der daraus folgenden Analogielehre aus. Mit dem Begriff des „unus“ auf der einen und der Aufhebung der „ontologischen Schranke“ auf der anderen Seite hat Eckhart nicht nur die Einheit Gottes dem Begriff nach gedacht, sondern er 107 Vgl. Quest. Par.I, n. 4 ff. LW V, S. 40 ff. 108 Vgl. In. Joh. n. 44, LW III, S. 37. 109 Vgl. In Joh. n. 44, LW III, S. 37. 110 Vgl. Sermo XXIX, n. 304, LW IV, S. 269 f. 54 legte zugleich den Weg in die unmittelbare Anwesenheit bei dieser an, die, obwohl eine qualitative Hierarchie auf den „unus deus“ hin wahrend und im Vollzug des Denkens selber einheitlich bleibend, diese bei ihm erreichen kann. Ist nämlich Gott nur dann „unus“, wenn er Reflexion des Denkens ist, so ist die unmittelbare Anwesenheit bei ihm im Denken selber möglich, und zwar so, daß dieses in seiner Vereinheitlichung und damit Abkehr von der Vielheit in der Weise ihrer begrifflichen Durchdringung mit dem „unus“ eins wird, indem es das „unum in esse“ erkennt. In der Begegnung beider Reflexionen wird die Grundvoraussetzung der unmittelbaren Anwesenheit dadurch erfüllt, daß jetzt das Gleiche, also Vernunft, vom Gleichen, ebenfalls Vernunft, erkannt werden kann. Mit diesen Bestimmungen hat Eckhart zwar die thomasische Kausalität in die Konditionalität wie auch die Analogie in die Univozität aufheben können, erreicht aber mit dem Begriff „deus unus est quia intellectus“ weiterhin nicht einen Gottesbegriff, der frei wäre von jeglicher Doppelung und damit der Mystik zur Voraussetzung, weil Gott, gedacht als „intellectus“ immer schon ein „intellectus“ im Vollzug – also “intelligitur“ ist, daher Tätigkeit: und in solcher Tätigkeit gedacht stiftet er Beziehung, weil er Beziehung und damit Zweiheit ist111. Ganz gleich, wie rein die Reflexion des Denkens und damit Gott gedacht wird – etwa in Bezug auf sich selbst – ist dieses Sich-Beziehen immer schon ein Verhältnis, damit Doppelung und niemals absolute Einheit. Für die Tatsache, daß Eckhart diese duale Begriffsbestimmung Gottes immer schon gesehen hat und sie aufzuheben bemüht war, spricht die Fortführung seines Denkens auf den Begriff der „gotheit“ hin, mit dem er letztlich die Dualität dem Begriff nach zu tilgen versucht. Mit dem gedanklichen Durchdringen Gottes auf die „gotheit“ aber verläßt Eckhart zugleich die offizielle Kirchenlehre, die nicht nur zu seiner Zeit ihre auf der logischen Begrifflichkeit basierende Gültigkeit beanspruchte.112 111 Sermo XXIX, n. 303, LW IV, S. 269: „...quod nusquam est et nunquam nisi in intellectu, nec est, sed intelligitur.“ 112 War der Eckhartsche Begriff Gottes als Erkennen innerhalb der Scholastik – hier reduziert auf die Thomistik – durchaus noch als eine Variante dieser denkbar und deswegen auch weitestgehend nicht von der offiziellen Seite beanstandet, so führt der Begriff der `gotheit´ mit all seinen Konsequenzen in die Verdammung seiner Lehre insgesamt. 55 c. Der Begriff der nichtdualen `gotheit` Um Gott nicht als „Doppelung“ denken zu müssen, verläßt Eckhart den trinitarischen Gottesbegriff, konnte nämlich dieser, selbst durch die konditionale Bestimmung seiner Komponenten, die duale Grundstruktur nicht aufgeben.113 Ganz unabhängig davon also, wie das innertrinitarische Verhältnis gedacht wird, die Tatsache allein, daß ein solches gedacht werden kann – und der Christologie wegen in der christlichen Orthodoxie gedacht werden muß – zeigt die „Doppelung“ des christlichen Gottesbegriffes, gedacht als Trinität. Das bedeutet im Ergebnis: solange Gott als Vater, Sohn und Geist, bzw. synonym als Schöpfer gedacht wird, wird er immer schon dual gedacht, weil er von der Reflexion des Denkens, die zwar einheitlich, jedoch Doppelung ist, als Reflexion des Denkens und innerhalb der Reflexion des Denkens gedacht und erkannt werden kann. Damit erkennt zwar Doppelung Doppelung, bleibt aber notwendigerweise als solche bestehen, setzt der Erkenntnisakt einen Unterschied – auch innerhalb der Trinität – voraus, der aber nicht, wie gezeigt worden ist, ontologisch besteht, sondern der die Erkenntnis als Erkenntnis selber ist. Aus dem Gesagten wird verständlich, weshalb der Begriff der `gotheit` als absolute Einheit gegenüber Gott als eine relative – der Begriff `relativ` hier im Sinne der relatio als Beziehung und damit Doppelung verwendet - nicht erkannt, bzw. positiv als Begriff gedacht werden kann, da sie im Augenblick ihrer begrifflichen Bestimmbarkeit den Status der nicht-dualen `gotheit` für den dualen Gott und damit für die Reflexion des Denkens notwendigerweise aufgeben muß114. Und weil sich das Erkennen als Reflexion des Denkens und Doppelung zugleich in Begriffen und damit in der Sprache vollzieht, 113 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß bezeichnenderweise die bisherige Entfaltung der Eckhartschen Gedanken fast gänzlich dem systematischen Teil seines Werkes hat entnommen werden können, das im wörtlichen Sinne scholastisch (nämlich während seiner Lehrtätigkeit an der Pariser Universität angelegt worden) und in der Anlehnung an die Summen der damaligen Zeit gedacht worden ist. Die folgenden Ausführungen werden die `gotheit` und die unmittelbare Anwesenheit bei dieser bedenken. Sie stammen fast ausschließlich aus den Predigten. 114 Pred. 71; DW III, S. 223: „Der iht sihet oder vellet iht in dîn bekennen, daz enist got niht; dâ von niht, wan er noch diz noch daz enist. Swer sprichet, daz got hie oder dâ sî, dem engloubet niht.“ 56 kann diese, der absoluten Einheit der `gotheit´ wegen, auf diese nicht angewendet werden115. Hat Eckhart aber den innertrinitarischen Prozeß, also Gott als Reflexion des Denkens im Vollzug und damit als „Doppelung“ bestimmt in der Weise, daß er Gottes Wirken seinem Erkennen gleichgesetzt hat, so führt seine Aussage „Got wirket, diu gotheit wirket niht, si enhât niht zu wirkenne, in ir ist kein werc. Si geluogete ûf nie kein werc. Got unde gotheit hât underscheid an würken und an niht-würken.“116 in die Konsequenz, daß das Nichtwirken der `gotheit` notwendigerweise ein Nichtdenken ist und damit `gotheit` von Gott, als Einheit gegenüber Doppelung, nicht erkannt werden kann und somit ebenfalls unterschieden ist. Dieser Zusammenhang begründet dann die eckhartsche Aussage, wonach „got unde gotheit hât underschied als verre als himel und erde“117, denn `gotheit` ist Gott bevor er denkt, also bevor er sich in der Trinität und als Trinität offenbart118. Das unmittelbare Erkennen der `gotheit´ ist demnach der Vernunft nicht möglich, da sie per definitionem als absolute Einheit außerhalb dieser – da Doppelung – ihren Ort hat. Damit läßt die `gotheit´ auch keinerlei inhaltliche Begriffsbestimmung zu, da der Begriff die einzige Weise der Vernunfterkenntnis und somit ihr Vollzug ist119. Das angemessene Verhalten des Denkens der `gotheit` gegenüber wäre demnach, wie Eckhart es selbst bemerkte, ein Nicht-Sprechen und damit ein Nicht-Denken. Dieser Zusammenhang erklärt damit, weshalb er, indem er auf die `gotheit´ hinweist, inhaltlich wie auch formal seine bisherige Vorgehensweise ändert: 115 Pfeiffer, S. 181, 7 – 10: „Alsô sprechent alle crêatûren von gote. Und war umbe sprechent sie niht von der gotheit? Allez daz, daz in der gotheit ist, daz ist ein, unde dâ von ist niht zu sprechenne.“ 116 Pfeiffer, S. 181, 10 – 13. 117 Pfeiffer, S. 180, 15 f. 118 Pred. 21, DW I, S. 361: „...`ein got´.(...) dâ er in im selber ist, ê er ûzulieze in sun und heiligen geist.“ 119 Pred. 71, DW III, S. 221 f.: „Ein sache ist, wan got namelôs ist. Sölte si im namen geben, daz müeste bedâht werden. Got ist über alle namen; nieman enkan im zuokomen, daz er got gesprechen müge.“ 57 - Was den Inhalt angeht, so wechselt sein Denken von der Unmittelbarkeit der bisher üblichen Benennung in die theologia negativa, die ihrer Eigenart zufolge ein „Außerhalb“ der eigenen Doppelung durch Selbstverneinung voraussetzt. Dieses „Außerhalb“ muß notwendigerweise dem Begriff nach als absolute Einheit gedacht werden, ermöglicht doch die Voraussetzung dieser die Selbsterkenntnis der trinitarischen Reflexion als „Doppelung“. - Der Form nach entfaltet sich das eckhartsche Denken der theologia negativa ausschließlich in den Predigten, ist damit ein unmittelbarer Ausdruck der Seelsorge und damit der caritas. Und weil der zuletzt genannten im Sendungs- und Heilsbewußtsein der christlichen Religion der Wichtigkeit nach die erste Position zukommt, sprengt das Gebot der Nächstenliebe - des Heils wegen - im Konfliktfall die Regeln der natürlichen Erkenntnis120. - Als drittes soll daran erinnert werden, daß gemäß dem Prinzip der zweiten Epoche nur dasjenige geliebt werden kann, das zuvor erkannt worden ist. Damit setzt die Mystik die „cognitio die“ notwendigerweise weiterhin voraus, verläßt seiner Doppelungen wegen den Begriff des trinitarischen Gottes und bestimmt im Vollzug der via negativa die aduale `Gotheit` als ihre Voraussetzung121. War also Gott begriffen worden als Vater, Sohn und Geist, damit als das Eine, Wahre und Gute, wonach sich dann der Wille bzw. die Liebe hat ausrichten können, so heißt es jetzt für Eckhart, indem er die Liebe nach der Ausrichtung – und damit der notwendig vorausgehenden Erkenntnis - fragen läßt: „Wie sol ich in denne minnen? Dû solt in minnen als er ist: ein nihtgot, ein nihtgeist, ein nihtpersone, ein nihtbilde, mêr: als er ein lûter pûr klâr ein ist, gesundert von alle zweiheite...“122. Erst an der Unmöglichkeit, die `gotheit` unmittelbar zum Gegenstand ihrer selbst haben zu können, erkennt die Reflexion des Denkens – hier als 120 Vgl. dazu: Thomas v. Aquin, Summa Theologiae I, qu. II, prologus. 121 Diese Bestimmung, dem Verstand ein Widerspruch, wird durch den Begriff des plotinischen Einen ermöglicht, wonach das Eine, erhaben über alle Widersprüche, diese überwindet. Vgl. dazu: Plotin. Enneade VI, 8, 13, 8 f. 122 Pfeiffer, S. 320, 27 – 30. 58 Trinität - sich selber als Doppelung123 und setzt damit gleichzeitig den Begriff der `gotheit` als absolute Einheit voraus124. Dieses Wissen um die absolute Einheit Gottes – eben die `gotheit` - liegt allem Wirken Gottes, und das bedeutet bei Eckhart auch der Reflexion des Denkens, zugrunde, begreift sich diese dadurch selbst als Doppelung und damit in letzter Konsequenz als nicht Gott125, denn Gott kann nur als Gott in der Absolutheit seiner Einheit gedacht werden und damit als `gotheit`126. War der kausale Gottesbegriff ausreichend für die Reflexion der Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart, so zeigte er sich als Doppelung für die Aufhebung einer solchen und damit als Voraussetzung der Mystik ungeeignet. Auch die konditionale Bestimmung des Gottesbegriffes, gegründet in der Einsicht in den reflektiven Charakter der Trinität, erwies sich als Doppelung und damit ebenfalls für die Aufhebung dieser nicht in Frage kommend; gleichwohl hat dieser Begriff Gottes, zum ersten Mal innerhalb der Entfaltung der christlichen Lehre, eine unmittelbare Anwesenheit bei sich zulassen können127. Erst mit der Bestimmung Gottes als `gotheit` erreicht Eckhart die notwendige Voraussetzung für die Aufhebung aller Doppelungen. Die Bestimmung Gottes als `gotheit` setzte wiederum die vorhergehende als Reflexion des Denkens notwendigerweise voraus, konnte nämlich das absolut Eine nicht unmittelbar gedacht, sondern nur von der Reflexion des Denkens im Vollzug ihrer selbst als Denken und somit Erkennen der eigenen Doppelung notwendigerweise als Begriff vorausgesetzt werden. Diese notwendige Voraussetzung des Begriffes der Einheit, welche das 123 Pred. 21, DW I, S. 368, 6: „Ich spriche: got entmöhnte niemer gebern sînen einbornen sun, enwaere er niht ein.“ 124 Pred. 21, DW I, S. 368, 6 – 8: „In dem daz got ein ist, in dem nimet er allez, daz er würket an crêatûren und an gotheit.“ 125 Pred. 21, DW I, S. 368, 8 – 9: „Gotes eigenschaft ist einicheit; an dem nimet got, daz er got ist, er enwaere anders got nicht.“ 126 Pred. 21, DW I, S. 368, 5: „`Ein got`: in dem daz got ein ist, sô ist volbrâht gotes gotheit.“ 127 Die Parallele zum aristotelischen Gottesbegriff ist unverkennbar, wenn auch nur im Ansatz übereinstimmend. Während der aristotelische Gott, dem Begriff nach als Reflexion des Denkens, seiner Absolutheit und Erhabenheit wegen nur sich selber zum Gegenstand haben kann (ähnlich dann auch die Entfaltung der Thomistik), denkt der eckhartsche Gott im Wort ( als Sohn ) und gleichzeitig und unvermittelt die ganze Schöpfung. Vgl. dazu: Aristoteles, Metaphysik, XII, 7.; für Meister Eckhart exemplarisch: In Gen. LW I, S. 49 ff. 59 unmittelbare Ergebnis der reflektierten Einsicht der Reflexion selber in die eigene Beschaffenheit ist, bleibt als Wissen weiterhin der Reflexion verhaftet, ist damit Doppelung und darf als solche nicht mit der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit selber verwechselt werden. Es ist eben das Wissen um die notwendige Voraussetzung der Einheit, und nur dieses Gegenstand der Reflexion des Denkens und nicht die Einheit an sich. Diese bleibt dem Denken, per definitionem, weiterhin verborgen. Innerhalb der christlichen Religiosität ausgedrückt ersetzt die begriffliche `revelatio` der `gotheit` in die Reflexion des Denkens – und nur eine solche kommt in Frage - die unmittelbare Anwesenheit bei der ersten in keinster Weise, geschieht nämlich die revelatio dei nicht in eine bereits vorhandene Reflexion, sondern als eine solche und ist damit immer schon „Doppelung“. Der Umgang mit dem so gewonnenen Begriff der Einheit kann sich dann in diversen Formen seiner Beachtung niederschlagen, damit Doppelung bleiben und somit als Religion hervortreten oder aber, den Begriff des Einen voraussetzend, die durch ihn als Doppelung erkannte Identifikation in diesen hinein aufzuheben suchen. Setzte die Mystik, ihrer Bestimmung nach, neben der reflektierten Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart auch ein Wissen um die notwendige Voraussetzung der Einheit voraus, so ist dieses, im Denken Eckharts, mit seiner Bestimmung der `gotheit´ gegeben. 3. Der Begriff der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit Die inhaltliche Bestimmung des Begriffes der Mystik als das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit scheint zunächst den Eindruck zu erwecken, als beabsichtige diese, ein „Etwas“ zu erreichen, das zeitlich wie auch räumlich nicht mehr oder noch nicht präsent ist, und das als Folge der reflektierten Einsicht in den absoluten Mangel an anwesender Gegenwart. Gleichzeitig setzt der Begriff „Erreichen“ einen Willen voraus, der das zuvor Erkannte – in diesem Fall die Einheit im Begriff der `gotheit` - mit seiner Ausrichtung anstrebt. Da aber der Wille, in Anlehnung an die Reflexion des Denkens im Sinne seiner notwendigen Voraussetzung, ebenfalls der Spaltung in Subjekt/ 60 Objekt unterliegt, ist er Zweiheit und damit Doppelung. Und kann der Wille nur das wollen, was zuvor von der Reflexion des Denkens als Begriff oder Vorstellung erkannt worden ist, und konnte er – weil selbst Doppelung – diese absolute Einheit nicht unmittelbar, sondern nur indirekt, begriffen als Wissen um ihre notwendige Voraussetzung, denken, so hat das für den Willen zur Folge, daß er die unmittelbare Anwesenheit bei dieser deswegen nicht wird anstreben können, weil sie ihm nicht als ein erkanntes Etwas vorgelegt werden kann. Damit befindet sich sowohl die eckhartsche Reflexion des Denkens wie auch die des Willens innerhalb einer paradoxen Situation: Zum einen verfügt das Denken – und zwar mit Notwendigkeit – über den Begriff des absolut Einen, kann den Einen jedoch logischerweise nicht positiv bestimmen, da er sonst augenblicklich zum Gegenstand des Denkens werden würde, damit Doppelung und nicht mehr absolute Einheit, setzt die unmittelbare Anwesenheit bei der `gotheit` doch auch die Aufhebung der theologia negativa voraus, die in ihrem Vollzug, den Begriff des Einen als ihre Voraussetzung gewinnend, mit diesem wiederum ein Etwas in der `gotheit` begreift – nämlich sein Einssein – was wiederum Doppelung und damit nicht `gotheit` sein kann. Weil die `gotheit` damit nicht als das Ergebnis der theologia negativa begriffen werden kann, „ist“ sie ihre Negation und damit die Negation der Negation128. Zum anderen ergibt sich daraus für die Reflexion des Willens die Erkenntnis, daß sich dieser auf den Einen nicht wird ausrichten können, zeigt sich nämlich der Begriff des Einen – nicht das Eine an sich – als Doppelung. Anders ausgedrückt heißt das: Solange der Wille als Wille besteht, will er etwas und zwar genau das gleiche Etwas, das zuvor von der Vernunft als ein Solches erkannt worden ist. Wird aber das Eine von der Vernunft, mittels der via negativa, genau als ein Nicht-Etwas begriffen, entzieht diese dem Willen das Ziel seiner Ausrichtung. Will der Wille das absolut Eine trotzdem wollen, so bleibt er innerhalb der Reflexion des Denkens verhaftet in der Weise, daß er diese und damit eine Doppelung weiterhin aufrechterhält. Denn entledigt sich die Reflexion des Denkens – und zwar willentlich – aller ihrer Inhalte, behält aber das absolut Eine als Begriff in der Art, wie sich dann der Wille danach ausrichten könnte, so erreicht sie, wie Eckhart es bereits gezeigt hat, die unmittelbare Anwesenheit bei dem als Reflexion des Denkens begriffenen Gott, der aber, 128 Pred. 21, DW I, S. 364: „in dem daz ich gote versage, dâ begrîfe ich etwaz von im, daz er niht enist; daz selbe muost abe. Got ist ein, er ist ein versagen des versagennes.“ 61 genau wie sie, Doppelung bleibt. Und weil Eckhart zufolge der Unterschied zwischen Gott und `gotheit` wie der zwischen Erde und Himmel oder Doppelung und Einheit ist, muß der Wille notwendigerweise über alles Erkannte und damit in die Aufhebung seiner selbst hinaufsteigen 129. Aus der Perspektive der Reflexion des Denkens betrachtet müssen der Begriff der absoluten Einheit und die absolute Einheit an sich gänzlich voneinander unterschieden sein in der Weise, wie die Doppelung vom Absoluten es ist. Aus der Perspektive der absoluten Einheit jedoch kann ein solcher Unterschied deswegen nicht gedacht werden, da sich zunächst das Absolute dadurch selber begrenzen und somit aufheben müsste130. Ihrer Absolutheit, Allmacht und Erhabenheit wegen wäre das Zweite aber trotzdem denkbar, dann aber nur in der Art, wie die Einheit über alle Widersprüche des Verstandes erhaben, von diesen, falls überhaupt vorhanden, in ihrem Einssein unberührt bleibt 131 . Damit ist der Begriff der absoluten Einheit – gemeint ist der Signifikat und das Signifikant - der Reflexion des Denkens zugeordnet, seine Herkunft aber hält weiterhin zwei Denkrichtungen offen: innerhalb der einen wird er als „revelatio dei quoad nos“ gedacht, womit alle monotheistischen Religionen gemeint sind. Innerhalb der anderen aber kann er der Selbsterkenntnis der Reflexion als Doppelung und damit von dieser als ihr notwendiges „Außerhalb“ vorausgesetzt werden, weil sich diese nur dann dem Begriff nach als Doppelung bestimmen kann, sofern sie gleichzeitig über den Begriff der Einheit verfügt. Da in beiden Fällen der notwendige Nachweis des kausalen Ursprungs des Begriffes der absoluten Einheit fehlt – und da es sich hier um den außerverstandesmäßigen Bereich gedacht als Nicht-Doppelung handelt, auch logischerweise fehlen muß –, entzieht sich das absolut Eine der unmittelbaren Betrachtung durch die Vernunft und damit der Wissenschaft in ihrem bisherigen abendländischen Selbstverständnis. Ganz gleich aber, woher der Begriff der Einheit seinen Ursprung hat, er bleibt als solcher immer schon Doppelung und kann im Denken selber und von diesem niemals aufgehoben werden, ist jede Bewegung des Denkens 129 Pred. 21, DW I, S. 367: „Got will sprechen: swie hôch, swie lûter der Wille sî, er muoz ûf baz. Diz ist ein widerkôsen, daz got sprichet: `vriunt, klim ûf baz, sô geschihet dir êre.“ 130 Vgl. dazu: In Sap. n. 122, LW II, S. 459. 131 116 Vgl. dazu: Pred. 52, DW II, S. 503 f.; Von abgesch. DW V, S. 400 f. 62 immer schon und immer nur Denken und damit Verlust der Einheit. Anders ausgedrückt: die Doppelung der Reflexion, will sie die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit erreichen, muß sich selbst vor ihr bzw. in sie aufheben, während die Einheit die Doppelung, ihrer absoluten Macht und Erhabenheit wegen, als solche bestehen lassen kann, ja sogar muß, ohne sich dabei selbst aufzugeben. Wird das Gesagte als Voraussetzung beibehalten, so wird jetzt verständlich, an welchem Ort die berühmte eckhartsche Predigt „Beati pauperes spiritu“ ansetzt. Sie beginnt nämlich mit der Aufhebung der beiden Reflexionen genau dort, wo die unmittelbare Anwesenheit im Denken bei dem als Denken und damit konditional bestimmten Gott bereits erreicht worden ist. War also Gott: „Deus enim unus est intellectus, et intellectus est deus unus“132 und die unmittelbare Einheit mit ihm entsprechend im Denken möglich133, so wird jetzt die in Gott aufgehobene Reflexion des Denkens und des Willens und damit Gott selber als letzte Doppelung aufgehoben134, weil die Seligkeit und damit die unmittelbare Anwesenheit bei der absoluten Einheit, der Doppelung wegen, weder im Denken noch im Lieben und damit Wollen als aufgehoben gedacht werden kann135. Aus diesem Zusammenhang heraus erklärt sich die ekckhartsche Formulierung „Her umbe sô bite ich got, daz ermich ledic mache gotes“136, denn der wirkende und das heißt denkende Gott konnte, wegen der Doppelung beider Reflexionen, nicht deren Aufhebung gewesen sein137. Im Ergebnis ist die unmittelbare Anwesenheit bei der absoluten Einheit 132 Sermo XXIX, n. 304, LW IV, S. 270, 1-2. 133 Sermo XXIX, n. 304, LW IV, S. 270, 4 – 6: „Ascendere igitur ad intellectum, subdi ipsi, est uniri deo. Uniri, unum esse, est unum cum deo esse. Deus enim unus est.“ 134 Pred. 52, DW II, S. 497, 4 f.: „Sô sprechent wir: got enist niht wesen noch vernünftic, noch enbekennet niht diz noch daz.“ 135 Pred. 52, DW II, S. 496, 2: „Aber wir sprechen, daz si ( die saelicheit ) niht enlige an bekennenne, noch an minnenne;“ 136 Pred. 52, DW II, S. 502, 6. 137 Pred. 52, DW II, S. 505, 2 – 4: „In disem îndrucke enpfâhe ich sôgetâne rîchheit, daz mir niht genuoc enmac gesîn got nâch allem dem, daz ´got´ ist, und nâch allen sînen götlîchen werken;“ 63 notwendigerweise diese Einheit selbst: “wan ich enpfâhe in diesem durchbrechen, daz ich und got einz sîn.“138. Mit diesem „Erreichen“ vollendet Eckhart den ersten Teil der inhaltlichen Begriffsbestimmung der Mystik, womit aber noch nicht ersichtlich ist, in welcher Art sich diese Bestimmung auf das Verhältnis für Vielheit auswirkt. Sollte nämlich die in der Aufhebung der Doppelung beider Reflexionen erreichte absolute Einheit die Einheit mit der Vielheit negieren und sich damit nicht gleichzeitig als unmittelbare Anwesenheit bei dieser erweisen, so müsste daraus geschlossen werden, daß mit dem Begriff der `gotheit` diese nicht als erreicht gedacht worden ist und in Folge das eckhartsche Denken den Begriff der Mystik für sich nicht beanspruchen kann. Diesen Sachverhalt löst das eckhartsche Denken wie folgt: Der Unterschied zwischen der Einheit und der Vielheit konnte, wie bereits gezeigt worden ist, nicht im Sein, sondern nur im Denken bestehen, weil das Denken ein solcher Unterschied – im Sinne einer Doppelung –selber ist und daher einen solchen setzt. Aus der Perspektive der sich vollziehenden Reflexion des Denkens also und nur aus ihr heraus, und das bedeutet wiederum zeitgleich mit dem Aufkommen dieser – wobei das Denken gleichzeitig seine eigene Perpektive setzt, weil es diese ist – entsteht der Bruch in Einheit und Vielheit, jedoch nicht zwischen Einheit und Vielheit, weil der Begriff „zwischen“ einen vorhandenen Unterschied bereits voraussetzen müsste, der dann als solcher und damit zeitlich versetzt, von dieser erkannt werden würde. Daher gibt es bis zum Aufkommen der Reflexion des Denkens bei Eckhart weder Seiendes noch Schöpfung. Diese taucht notwendigerweise mit Gott, gedacht als Reflexion des Denkens zeitund raumgleich auf, indem sie Zeit und Raum als Vollzug ihrer selbst schafft. Mit der Aufhebung der beiden Reflexionen und damit Gottes erreicht Eckhart die Nichtdualität und damit die unmittelbare Anwesenheit bei der absoluten Einheit und da diese, ihrer Absolutheit wegen, über jeden Unterschied erhaben, von sich aus keinen Unterschied setzt, wird dieser der 138 Pred. 52, DW II, S. 505, 4 – 5. Es ist zu beachten bei der Formulierung der unmittelbaren Anwesenheit bei der absoluten Einheit, daß Eckhart hierfür keinen seiner bisherigen Begriffe, wie Erkennen oder Wissen benutzt, da diese eindeutig als Doppelungen belegt worden sind. Gleichzeitig aber und per definitionem, kann es keinen Begriff geben, der nicht Doppelung wäre und somit ist der von ihm diesbezüglich vewendete Begriff „Enpfâhen“, obwohl neu und einmalig in diesem Zusammenhang, so doch auch eine solche. 64 Vielheit gegenüber – jedoch nicht diese! – aus ihrer Perspektive her gedacht, notwendigerweise aufgehoben139 und damit gleichzeitig die unmittelbare Anwesenheit auch bei der Vielheit erreicht. Wird die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit - und mit ihr auch bei der Vielheit – in die Reflexion zurückgelassen, so geschieht jetzt der Vollzug dieser, begriffen als Gott und Doppelung, im Wissen um die Einheit von Gott und `gotheit`. Jetzt erst nämlich wird Gott als Vollzug der `gotheit` im Denken und damit zugleich als Denken von diesem erkannt140. Mit dem letzten Erweis zeigt sich das eckhartsche Denken als Mystik, so wie diese dem Begriff nach hat bestimmt werden können. Damit ist sein Denken von der abendländischen Philosophie her im Allgemeinen und dem christlichen Gedankengut im Besonderen derart abhängig, daß es beide notwendigerweise voraussetzt, bei gleichzeitiger Unabhängigkeit aber, welche die Erste dem Begriff nach in der Zweiten aufnimmt und beide in dem, was als Mystik bestimmt hat werden können, aufheben läßt. Für den religionswissenschaftlichen Vergleich im Allgemeinen steht somit das Denken Eckharts dem Begriff nach als konkretes Beispiel der Mystik wie folgt zur Verfügung: Die notwendige Voraussetzung der verborgenen Einheit im Begriff der `gotheit`, läßt die Reflexion des Denkens als Vielheit und somit Mangel an Einheit in Erscheinung treten; gewährt in der Aufhebung dieser die unmittelbare Anwesenheit bei sich und erkennt sich damit selber als ihr Vollzug. War die Bestimmung des Begriffes der Mystik Grundvoraussetzung für die Annäherung an das eckhartsche Denken, so ist jetzt, mit seiner erwiesenen Bestimmung als konkrete Erscheinung derselben, wiederum die Grundvoraussetzung gegeben, das „Ich“ innerhalb ihrer dem Begriff nach zu bestimmen. Gesucht wird damit die Bestimmung des „Ichs“ dem Begriffe nach, denn nur auf diesen kann die vergleichende Reflexion des Denkens zurückgreifen. 139 Pred. 52, DW II, S. 497, 4 – 6: „Sô sprechen wir: got enist niht wesen noch vernünftic noch enbekennet niht diz noch daz. Her umbe ist got ledic aller dinge, und her umbe ist er alliu dinc.“ 140 Pred. 52, DW II, S. 503 f: „In mîner geburt, dâ wurden alliu dinc geborn, und was sache mîn selbes und aller dinge; und haete ich gewolt, ich enwaere niht, noch alliu dinc enwaeren niht; und ewaere ich niht, sô enwaere ouch `got` niht.“ 65 III. DER BEGRIFF DER ICH-STRUKTUR IN DER MYSTIK MEISTER ECKHARTS Der Ort, den das `Ich` innerhalb der eckhartschen Denkstruktur – jetzt begriffen als Mystik – einnimmt, wird von der Begriffsentfaltung der absoluten Einheit in der Weise bestimmt, wie diese die unmittelbare Anwesenheit bei sich selber dem Begriff nach zuläßt. Die Ich-Struktur also setzt der Eigenbestimmung nicht nur das Wissen um die notwendige Voraussetzung der absoluten Einheit voraus, wie das der Theologie als Wissensentfaltung innerhalb der christlichen Religion der zweiten Epoche nach entsprechend der Fall gewesen ist, sondern den Inhalt der zuvor begrifflich bestimmten Mystik und damit die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit selbst. Das eckhartsche Ich wird damit nicht in Differenz zu Gott und somit, dem Begriff nach, religiös bestimmt, sondern aus der Tatsache der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit heraus und damit zusammen mit jener Einheit.141 Dadurch ergibt sich für das Bedenken der eckhartschen Entfaltung der IchStruktur die Notwendigkeit ihrer begrifflichen Rückkopplung an die jeweils zuvor vollzogene begriffliche Bestimmung Gottes. Diese wiederum, wie vorausgehend gezeigt worden ist, bedenkt Eckhart sowohl im Begriff der ´gotheit` als absolute Einheit, wie auch im Begriff des Gottes, welcher als die `gotheit` im Wirken, und das heißt im Vollzug ihrer selbst als Reflexion des Denkens und deswegen Trinität, in Erscheinung tritt. Das Besondere an der eckhartschen Ich-Bestimmung liegt somit in der jeweiligen Ausrichtung dieser auf die unmittelbare Anwesenheit bei der `gotheit` wie auch bei Gott, und weil Eckhart diese in beiden Fällen dem Begriff nach für möglich, ja notwendig hält, gilt für das Ich als erstes innerhalb der unmittelbaren Anwesenheit bei der `gotheit` oder bei Gott, der Einheit von Ich und `gotheit` oder Ich und Gott wegen, die absolute Identität der jeweiligen Strukturen. Wird die unmittelbare Anwesenheit des Ichs bei der `gotheit` gedacht, so übernimmt das Ich, weil selbst Einheit, notwendigerweise ihre `Struktur`. Das Gleiche wiederholt sich bei der Einheitsbestimmung mit Gott in seiner trinitarischen Erscheinung. Das ist der Hintergrund der eckhartschen Aussage, wonach der Mensch Gott erkennt, indem er sich selber erkennt, 141 „Ich“ wird hier und im Folgenden als Begriff in der Mystik des Meister Eckhart verstanden, nicht als beliebiger grammatischer oder alltäglicher Gebrauch. 66 und umgekehrt erkennt er sich nur dann vollständig selber, indem er Gott erkannt hat. Innerhalb des eckhartschen Denkens also, insofern es als Mystik bestimmt ist, kann notwendigerweise nicht nach einem Ich-Begriff gesucht werden, der subjekthaft statisch innerhalb des Seienden als ein Seiendes gedacht werden kann in der Weise einer Abgrenzung gegen ein anderes Seiendes und gleichzeitig im Stand einer wie auch immer gedachten Trennung von Gott. Eine solche Ich-Bestimmung läge im Widerspruch zu der bisher aufgezeigten Entfaltung des eckhartschen Denkens, begriffen als Mystik, und wird von Eckhart selber, wie im Folgendem zu zeigen sein wird, zwar gesehen, jedoch mit dem Stand der Sünde gleichgesetzt. Es wird so ersichtlich, daß die vorausgehende Begriffsbestimmung des eckhartschen Denkens als Mystik die Struktur und damit die notwendige Voraussetzung liefert, innerhalb der die eckhartsche Ich-Bestimmung ihren Ort findet, nämlich als Doppelung und damit als Vielheit begriffenes `Ausfließen` aus der ´gotheit` im Vollzug der Reflexion des Denkens, welche wiederum die Vielheit im Denken vereinheitlichend aufhebt und damit unmittelbare Anwesenheit bei dem als Trinität gedachten Gott erreicht, um diesen wissend und willentlich – da Doppelung – in der Aufhebung seiner Selbst auf die `gotheit` hin zu `durchbrechen`. Dort angekommen, erkennt das Ich sich selber in der Einheit von `Ausfluß` und `Durchbruch` als den Selbstvollzug der einen `gotheit`. Dieser Vorgriff auf die Bestimmung der eckhartschen Ich-Struktur soll nun in einzelnen Schritten entfaltet und entlang seiner Werke begründet werden. Daß der Beginn der Entfaltung der Ich-Struktur notwendigerweise bei der Bestimmung dieser innerhalb der `gotheit` seinen Ausgangsort findet, erklärt sich auch hier aus der Tatsache, daß die absolute Einheit im eckhartschen Begriff der `gotheit` innerhalb seiner Zeit als erste und sicherste Reflexion Voraussetzung und damit Ausgang aller anderen war. 67 1. Der Ich-Begriff und der Begriff `gotheit` Der Eckhartsche Begriff der ´gotheit`, als absolute Einheit gedacht, erweist zunächst seine Erhabenheit über alle Vielheit in der Art, wie er von dieser ihrer Entzweiung wegen nicht unmittelbar erkannt werden kann. Weil jegliche Entzweiung aber notwendigerweise sowohl Begrenzung und daher Raum wie auch Vergänglichkeit und daher Zeit in der Gleichzeitigkeit ihres Erscheinens hervorbringt, muß die absolute Einheit in sich raum- und zeitlos, daher als absolute Gegenwart und in dem Sinne der Vielheit gegenüber als erhaben (`superius`) gedacht werden, wie sie keinerlei Gesetzmäßigkeiten und somit Begrifflichkeiten unterworfen von diesen unberührt bleibt 142. Als absolute Gegenwart aber ist sie in ihrer Gleichzeitigkeit weder Ursprung noch Ende der Vielheit (sie wäre damit ein Etwas, mithin wiederum Doppelung), sondern ist in ihrer Präsenz, gedacht als unmittelbare Anwesenheit bei der Vielheit, die Ermöglichung der Zeitabfolge und daher der Zeitwahrnehmung schlechthin, kann nämlich die Erste von der Zweiten nur deswegen wahrgenommen werden, da beide Doppelungen und damit Bestandteile des Reflexionsverhältnisses sind und die Gegenwart als Einheit notwendigerweise voraussetzen. Daher ist die `gotheit` immer schon da, und das vor der Vielheit, in der Vielheit und nach der Vielheit, wobei sie mit dem Hervortreten der Vielheit, so Eckhart, zum Gott wird in dem Sinne, wie sie von der Vielheit im Denken als Denken und somit unmittelbar dem Begriff nach gedacht werden kann143. Weil aber, wie erneut gezeigt worden ist, die `gotheit` wegen ihrer absoluten Einheit und Gegenwart als unabhängig, im Sinne von unberührt von aller Vielheit und damit von Raum und Zeit gedacht werden muß und gleichzeitig, so Eckhart, eine unmittelbare Anwesenheit bei sich zuläßt, so besteht diese unmittelbare Anwesenheit des Ichs bei der `gotheit` notwendigerweise vor dem `Ausfließen` dieser als Gott und somit vor der Schöpfung. Kann aber bei der `gotheit` im Unterschied zu Gott, weder ein `Vor` noch ein `Nach` der Schöpfung gedacht werden, so muß die unmittelbare Anwesenheit des Ichs bei der `gotheit` notwendigerweise ein 142 In Joh. n. 207, LW III, S. 174 f. 143 Vgl. dazu: Pred. 52, DW II, S. 486 ff. 68 permanenter Ist-Zustand sein im Sinne der absoluten Gegenwart und daher ebenfalls absoluten Einheit144. Wenn dem so ist, muß die Struktur des Ich-Begriffes derart bestimmt sein, daß ihre Anwesenheit bei der `gotheit` gedacht werden kann. 2. Die Ich-Struktur in der `gotheit` Recht bedacht hat sowohl die vorhergehende wie auch diese Überschrift eine paradoxe Formulierung zum Inhalt, suggeriert sie nämlich mit dem Begriff der Ich-Struktur und dem der ´gotheit` ein räumliches, mit dem `vor der Schöpfung` auch ein zeitliches Verhältnis innerhalb der absoluten Einheit. Die Not der Formulierung aber, die per definitionem immer als Vielheit zu begreifen ist, offenbart sich bezüglich der gestellten Frage insofern als Tugend, verweist sie allein schon der Sprache nach auf die Widersprüchlichkeit und somit Unmöglichkeit, irgend ein Etwas, und damit Zeitlichkeit wie auch Räumlichkeit innerhalb der `gotheit`, dem Begriff nach zu denken. Ein solches Etwas wäre demnach das Ich, während das `in` die `gotheit` ebenfalls zum solchen herabsetzen müsste und es sprachlich auch tut. Der Begriff der absoluten Einheit ist damit der Reflexion des Denkens zwar gegeben, entzieht aber gleichzeitig dieser seinen `Inhalt`, so daß er nicht vor–gestellt, wohl aber, aus der Not der Entzweiung heraus, dieser notwendig vorausgesetzt werden muß. Um daher die prinzipielle Anwesenheit des Ichs bei der `gotheit` denken zu können, benötigt Eckhart einen Ich-Begriff, der mit dieser identisch sein muß, da in der `gotheit` als das Absolute nur das Absolute, mithin sie selbst dem Begriff nach gedacht werden kann.145 144 Vgl. dazu: Pred. 52, DW II, S. 504 f: „sô bin ich ob allen crêatûren und enbin weder got noch crêatûre, mêr: ich bin, daz ich was und daz ich bl°iben sol nû und iemermê.“ 145 Vgl. – übrigens die vorliegende Untersuchung mit anregend – B. Mojsisch, <Dieses Ich>: Meister Eckharts Ich-Konzeption, in: K. Flasch/ U.R. Jeck (Hrsg.): Das Licht der Vernunft. Die Anfänge der Aufklärung im Mittelalter, München 1997, S. 101: „Eckharts spezifisches Interesse war es nun, dem Ich des Menschen, sofern es Ich ist, eine besondere Stellung einzuräumen, ungeschützt formuliert: Das Ich als solches tritt an die Stelle der Gottheit. Deshalb müssen mindestens zwei Probleme geklärt werden: 1. Wie wird das Ich des Menschen zur Gottheit – ein pädagogisch-philosophisches Problem? 2. Was ist das Ich, wenn es an die Stelle der Gottheit getreten ist?“ 69 Die Ich-Struktur also, unter dem eckhartschen Begriff der Seele, muß damit jeweils die gleiche Struktur aufweisen wie der ihr korrespondierende Gottesbegriff, von dem her sie abgeleitet und auf den hin sie gerichtet ist. Die Entfaltung der Ich-Struktur läßt Eckhart daher der Entfaltung seines Gottesbegriffes folgen und das in der Reihenfolge, wie dieser innerhalb seiner „revelatio quoad nos“ das Wissen von sich selber, mithin die Ableitung der Begriffe zuläßt. Der Beginn der Entfaltung liegt damit notwendigerweise bei der ´gotheit´, die einzig als absolute Einheit gedacht, für Eckhart Gott schlechthin ist. War aber, der Entfaltung des sicheren Wissens innerhalb der zweiten Epoche wegen und somit der Form nach, der Beginn dieser bei der `gotheit` anzusetzen, so kommt jetzt, wegen der unmittelbaren Anwesenheit der Ich-Struktur bei der ´gotheit`, die inhaltliche Notwendigkeit für diesen Ansatz hinzu, nämlich, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, die absolute Identität beider. Aus dem Gesagten wird verständlich, weshalb die eckhartsche Folge analytischer Urteile bezüglich der `gotheit` wie auch der ihr unmittelbar anwesenden Ich-Struktur, von ihm als Grund der Seele begriffen, identisch sein muß und wie folgt zum Ausdruck kommt: Die absolute Einheit kann zwar als Begriff Gegenstand der Reflexion des Denkens werden, ihrer Absolutheit wegen aber läßt dieser Begriff bezüglich seines Inhaltes die Entfaltung synthetischer Urteile nicht zu, da diese eine Kenntnis und damit Anwesenheit bei der Einheit selber im Denken zur Voraussetzung hätten, was widersprüchlich ist. Deswegen ist die `gotheit` ein „nihtgot“146 – da Gott noch als Denken im Denken dem Ich, wiederum als Denken begriffen, unmittelbare Anwesenheit gewährt, – damit dem Inhalt nach ein „unbekanntes“, da notwendigerweise kein Gegenstand des Denkens mehr und somit ein „übergotten gotes“147. Das eckhartsche `Über` im Sinne von `Außerhalb` der `gotheit` darf wiederum nur in Bezug zum Ich als Einheit mit Gott, gedacht als Reflexion Dazu auch W. Goris, Der Mensch im Kreislauf des Seins. Vom >Neuplatonismus< zur >Subjektivität< bei Meister Eckhart, in: T. Kobusch/B. Mojsisch/O.F. Summerell (Hrsg.): Selbst – Singularität – Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum Deutschen Idealismus, Amsterdam/Philadelphia 2002, S. 185 ff, bes. S. 192 ff. (>Ich< als Fundamentalkategorie bei Meister Eckhart). Von Bedeutung auch die Arbeit von B. Mojsisch, Die Theorie des Ich in seiner Selbst – und Weltbegründung bei Meister Eckhart, in: C. Wénin (Hrsg.): L‘ homme et son univers au moyen âge, Louvain-la-Neuve, 1982, Bd. 1, S. 267 – 272. 146 Pfeiffer S. 320, 28. 147 Pfeiffer S. 8, 5. 70 des Denkens verstanden werden und nur aus der Perspektive von dieser, die in ihrer Eigenschaft als Doppelung die Einheit dem Inhalt nach nicht immanent denken kann. Damit ist für Eckhart die `gotheit` absolut beziehungslos148 und so bestimmt die begriffliche Voraussetzung ihrer selbst als Gott, und dadurch erst „grund der gotheit“149 und somit das Absolute150. Deswegen entspricht dann dem `grund der gotheit` auf der Seite der IchStruktur im Begriff der Seele der Seelengrund, der allein, so Eckhart, frei von allen Doppelungen ist und auch sein muß, weil er in der unmittelbaren Anwesenheit bei der absoluten Einheit nur so gedacht werden kann151. Er ist damit in sich absolut einheitlich und in dieser Einheit der Einheit, wie sie Eckhart als `gotheit` gedacht hat, gleich152. Das „einvaltic“ gedacht im Unterschied zu Vielheit, begreift die `gotheit` und den Seelengrund als absolute Einheit vor dem Ausfließen dieser als die zeitlose Reflexion des Denkens und damit Trinität, so wie vor dem Ausfließen Gottes, bestimmt als zeitlicher Vollzug der relativen Einheit, begriffen als die Entfaltung ihrer Kräfte, gedacht als Reflexion des Denkens und des Wollens153. Der Grund der Seele aber, einfältig, da ledig aller Reflexionsverhältnisse und daher in sich lauter154, gleicht damit nicht der `gotheit`, sondern ist diese und das deswegen, weil die Gleichheit Doppelung und damit Entzweiung voraussetzt und auch beibehält in der Weise, wie die Reflexion des Denkens Gott in seiner Doppelung als Trinität erfasst und willentlich im Sinne der imitatio dei nachahmt. Deswegen sagt Eckhart, daß Gott 148 Pred. 10, DW I, S. 171 f.: „got in sîne einunge und in sîner einoede: got in sîne wüestunge und in sînem eigenen grunde: got in sîne gotheit und in sînem eigentuome sîner eigenen natûre...“ 149 Pred. 15, DW I, S. 247, 3. 150 Pred. 22, DW I, S. 388, 10 f. : „...diu stille vinsternisse der verborgenen vaterschaft.“ 151 Pred. 2, DW I, S. 40. 2: „Ez ist von allen namen vrî und von allen formen blôz, ledic und vrî zemâle...“ 152 Pred. 2, DW I, S. 40. 3 f. : „Ez ist sô gar ein und einvaltic, als got ein und einvaltic ist...“ 153 Vgl. dazu: Pred. 22, DW I, S. 389. 154 Pred. 21, DW I, S. : „Diu sêle in ir selber, dâ si obe dem lîchamen ist, ist so lûter und sô zart...“ 71 Gleichheit nicht ertragen kann, weil es in ihm, begriffen als `gotheit`, „niht vremdes (keine Doppelung also) in der einicheit“ geben kann155. Vor der Schöpfung also – und wegen der Zeitlosigkeit der ´gotheit` notwendigerweise auch während dieser und nach ihr156 – ist der äußerste Teil der Ich-Struktur begriffen als Seelengrund, zeitlos bei der `gotheit` unmittelbar anwesend157, und da in der Einheit nur Einheit gedacht werden kann, eins mit ihr in aller Ewigkeit: „ez gibet mir einsîn in der êwicheit“158. In der `gotheit´ begriffen weist damit das `Ich` eine mit ihr notwendigerweise identische Struktur auf und, als absolute Einheit gedacht, kommt dem Ich in der `gotheit`, jetzt als `gotheit´, da unterschiedslos zu ihr, eine und dieselbe Folge analytischer Urteile zu, wie sie die absolute Einheit dem Begriff nach zuläßt. Denkt Eckhart aber den Grund der Ich-Struktur in permanenter, weil zeitloser Einheit mit der `gotheit`, somit als diese selbst – und damit vor, während und nach der Schöpfung –, so ist die Frage nach dem „wozu“ derselben deswegen berechtigt, scheinen der Beginn wie auch das Ende 155 Pred. 13, DW I, S. 216. 156 Vgl. dazu: Pred. 22, DW I, S. 387. 157 Pred. 22, DW I, S. 382, 5: „...inneblîbende in dem êrsten beginne der êrsten lûterkeit...“ 158 Pred. 13, DW I, S. 216, 7. Vgl. dazu aber auch die folgenden Bemerkungen – wenn sie sich auch auf Seuse beziehen – von M. Enders, Selbsterkenntnis „im Seelengrund“ in: T. Kobusch, B. Mojsisch, O.F. Summerell (Hrsg.): Selbst – Singularität – Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum deutschen Idealismus, Amsterdam/Philadelphia 2002, S. 227, mit denen Enders (ein ebenso seltenes wie zu lobendes Beispiel in der deutschen Geisteswissenschaft!) eine eigene früher vorgetragene Interpretation einer Stelle bei Heinrich Seuse selbst korrigiert: „Meine frühere Interpretation dieser Stelle ... war von der Aussage des Textes motiviert, daß das ‚vernúnftig gemuete ... och ewig ist‘ [Seuse, Leben Seuses II, S. 191, 34 f.]. Aus der Annahme, daß der Ausdruck ‚ewig‘ hier im strengen Sinne entzeitlichter Gegenwart zu verstehen sei, glaubte ich, auf die Identität des Seelengrundes mit der ewig-innergöttlichen Seinsweise des Menschen schließen zu können. Daß diese Annahme und der aus ihr gezogene Schluß jedoch falsch waren, daß also der Terminus ‚ewig‘ als Bestimmung des ‚vernúnftig gemuete‘ nicht im strengen Sinne einer entzeitlichten Gegenwart und damit einer göttlichen Seinsbestimmung aufgefaßt werden darf, davon konnte mich inzwischen ein Blick auf Seuses mutmaßliche Quelle im ersten Kapitel des Itinerarium mentis in Deum Bonaventuras überzeugen, die von ihm hier teilweise zitiert wird. Bei Bonaventura ist in bezug auf die menschliche (Geist-)Seele nicht von imago Dei aeterna, sondern von imago Dei aeviterna die Rede. [Vgl. Bonaventura Itinerarium mentis in Deum (Ed. Collegii S. Bonaventurae, tom. V, Quaracchi 1891), cap. I, n. 2, p. 297] Offensichtlich übersetzt Seuse diesen Ausdruck mangels eines geeigneten sprachlichen Äquivalents im Mittelhochdeutschen mit ‚ewig‘“. 72 dieser – indem sie aus der Einheit kommend mit dem Grunde der IchStruktur diese auch während der Schöpfung nie verlässt – identisch zu sein. Gleichwohl die Frage nach dem „wozu“ der Schöpfung bereits an diesem Ort der Überlegungen berechtigterweise aufkommt, so setzt die Beantwortung derselben ein Wissen voraus, welches seinerseits wiederum die unmittelbare Anwesenheit bei der `gotheit` im `Durchbruch` voraussetzt, der eben damit und auch dadurch, da eine Art des Wissens hervorbringend, edler aufzufassen ist als das Bleiben in ihr bzw. `Ausfließen` aus dieser159. Der Form nach betrachtet also ist das bis hierher vorgetragene Wissen sowohl um die ´gotheit` wie auch um die Ich-Struktur innerhalb dieser eines aus der Perspektive der zweiten Gedachtes und zwar so, wie sich diese ihre notwendige Voraussetzung denken muß, sobald sie sich selber als Reflexion des Denkens im Vollzug und daher als Doppelung erkennt und eben noch nicht als eines aus der Perspektive der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit selbst. Und weil sich das Ich als Doppelung erkennt, läßt sich diese Erkenntnis als Folge synthetischer Urteile auffassen, kann nämlich das Ich als Doppelung gedacht, dem Ich als Reflexion des Denkens, dem Begriff nach zum Gegenstand der Betrachtung werden. Daraus folgt wiederum – und dies soll zunächst an diesem Ort als Antwort auf das `Wozu` der Schöpfung ausreichen – daß die Schöpfung die Entfaltung synthetischer Urteile nicht nur zuläßt, sondern mit dem Aufkommen der Reflexion des Denkens gleichgesetzt, sich als Folge synthetischer Urteile und somit als die Hervorbringung des Wissens um sich selbst und in sich selbst manifestiert160. Die eckhartschen Begriffe `gotheit` und der „Grund“ der Ich-Struktur als absolute Einheit gedacht, treten aus sich heraus (Schöpfung), jedoch nicht in die Vielheit, denn das müßte diese als bereits gegeben voraussetzen, sondern als diese und damit als Doppelung gedachter Vollzug der Reflexion 159 Vgl. dazu: Pred. 52, DW II, S. 500 ff. Folgt man der Struktur dieser Predigt, so erscheint das Wissen um das Heraustreten der `gotheit` in die Reflexion des Denkens als Trinität notwendigerweise als das Ergebnis der unmittelbaren Anwesenheit in ihr im Durchbruch, und das, nachdem das Denken und der Wille bereits aufgehoben worden sind, was wiederum deren Ausfluß voraussetzt. 160 Vgl. dazu: Pred. 45, DW II, S. 363 f.; Sermo XI, 2 n. 120, LW IV, S. 114 f. Die „seeligkeit“, wie sich Eckhart ausdrückt, liegt hier in der Erkenntnis und daher in der Einheit mit Gott, wie sich dieser bereits als Dreifaltiger in der Eigenschaft als Vollzug der Reflexion des Denkens offenbart. Daß es sich dabei jedoch letztlich nicht um den Endzustand handeln kann – wegen der Doppelung der Dreifaltigkeit – zeigt innerhalb der Predigt 52, seine Aufhebung auf die aduale `gotheit` hin. 73 des Denkens, begriffen als Gott in seiner dreifaltigen Struktur vom Denker (Vater ), Gedachtes oder Wort ( Sohn ) und dem Denken (Geist)161, welcher gleichzeitig mit seinem Erscheinen, jedoch nicht im temporalen Nachher, die Schöpfung denkend hervorbringt, ist in ihm doch Denken und Sein eins162. Der Form nach gesehen sind Gott und die Schöpfung dem Sein nach insofern gleich, als beide im Heraustreten aus der Einheit in den Status der Doppelung übergehen, inhaltlich betrachtet jedoch, und das heißt bei Eckhart der konditional bestimmten Hierarchie des Denkens zufolge, erhebt sich Gott über das Seiende derart, wie in ihm Denken und Sein zusammenfallen und er dadurch ist, weil er denkt, damit seine Existenz der eigenen Reflexion des Denkens verdankt und das in der Weise, wie die Erste als immerwährendes Ergebnis der sich vollziehenden Zweiten in Erscheinung tritt. Dieses In-Erscheinung-Treten-Gottes, da reflektiver Art, ist immer schon ein Gedachtes und Seiendes zugleich, somit Einheitliches, jedoch weil Doppelung kein Absolutes. Als Manifestation zerfällt es erneut in das Seiende und seine begriffliche Erkenntnis, die damit die einheitliche Voraussetzung zeitlich (nach-einander) und räumlich (getrennt voneinander) erkennend begreift. Diese Tatsache kann nur dann sinnvoll bedacht werden, wenn die zeitliche Manifestation Gottes (relative Einheit) ihrer Struktur nach Begriffsableitungen zuläßt. Die Struktur der zeitlichen und räumlichen Manifestation also muß damit ebenfalls eine reflektive sein und das wiederum notwendigerweise, ist nämlich nur die sich vollziehende Reflexion des Denkens in der Lage einen Begriff hervor zu bringen. Der dreifaltigen Struktur Gottes also muß seitens des zeitlichen Ichs eine Struktur entsprechen, in die hinein sich Gott, jetzt als Begriff gedacht, nicht nur offenbaren kann, sondern die ihrer Struktur nach – und damit von sich aus in der Lage sein muß – eine unmittelbare Anwesenheit bei dem sich 161 Vgl. dazu: In Gen. n. 3, LW I, S. 186 f.: „ De primo sciendum quod principium, in quo creavit deus caelum et terram,est ratio idealis. Et hoc est quod Joh. I dicitur: `in principio erat verbum`- Graecus habet logos, id est ratio - et sequitur: `omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil´.(...) Hinc est et tertio quod commentator VII Metaphysicae dicit quod quiditas rei sensibilis semper fuit desiderata sciri ab antiquis, eo quod ipsa scita sciretur causa prima omnium. Vocat autem commentator, primam causam non ipsum deum, ut plerique errantes putant, sed ipsam rerum quiditatem, que ratio rerum est, quam diffinitio indicant, causam primam vocat.“ 161 In Gen. n. 3, LW I, S. 186 f. 162 In Gen. n. 3, LW I, S. 186 f. 74 offenbarenden Gott zu erreichen. Denn beim ersten Anspruch an die Beschaffenheit des Ichs stehengeblieben wäre Gott dem Ich ein Gegenüber, mithin das Denken ein religiöses, während es, dem Begriff der Mystik zufolge, auf die Einheit von beiden gerichtet sein muß. Diese Ausrichtung des Denkens auf die Einheit mit Gott ist für Eckhart an dieser Stelle deswegen möglich, denkt er Gott bereits als Ausfluß der `gotheit`, mithin als Doppelung, die in Folge eine Begriffsableitung zuläßt163. 3. Der Ich-Begriff und der Begriff `got` Aus dem permanenten Ist-Zustand der absoluten Einheit, die bei Eckhart im Begriff der `gotheit` die Identität des Seelengrundes und damit der IchStruktur mit Gott – sofern beide keinerlei Reflexionsverhältnisse mehr aufweisen – zusammenfaßt, manifestiert sich `got` als eine dreifaltige Struktur und ebenso der Mensch als Träger einer Ich-Struktur. Weil aber Eckhart den Grund der Ich–Struktur immer schon in unmittelbarer Anwesenheit bei der `gotheit` denkt, kann er die Manifestation der `gotheit` in die Doppelung des Seins, bestimmt als Reflexion des Denkens und begriffen als Trinität, immer nur gleichzeitig mit der Entfaltung der IchStruktur aus seinem einheitlichem Grunde heraus bedenken. Dieser Vorgang als Ganzes ist damit notwendigerweise zeitlos wegen der absoluten Einheit des Seelengrundes164 und ebenfalls zeitlos wegen der Einheit der Trinität, jedoch zeitlich, so sich diese im Nacheinander begreifend entfaltet165. Die Parallelität der Entfaltung des Ichs aus seinem eigenen einheitlichen Grunde und Gottes als Trinität aus der `gotheit` bietet zunächst die Möglichkeit an, daß sowohl Gott der Dreifaltige wie auch die Ich-Struktur des Menschen in keinster Weise zusammen gedacht werden können, und das wegen der ontologischen Differenz, welche zwischen den beiden 163 In Joh. n. 195, LW III, S. 163 f.: „ Nihil enim cognoscitur per aliud sive alienum a se, sicut nec est per aliud. Notum est autem omne superius, omne divinum, in quantum huismodi, sibi soli et genito a se ipso, quod non est aliud nec alienum ab ipso. Generat enim unumquodque alterum se, non aliud a se.“ 164 Pfeiffer, S. 3, n. 4: „...die got der vater hât geborn unde gebirt âne undelâz in êwigkeit,“ 165 Pfeiffer, S. 3, n. 5: „ ...daz diu selbe geburt nû ist geborn in der zit in menschlîcher nâtûre.“ 75 notwendigerweise gedacht werden muß, soll Gott als Gott und somit als absolute Einheit begriffen und auch belassen werden. Hier erweist der eckhartsche Gottesbegriff in der Differenzierung zwischen `got` und `gotheit` seine Stärke gegenüber dem der maßgeblichen Tradition, wonach bereits innerhalb der Trinität die absolute Einheit gesucht und als solche bedacht wird, und zwar in der Person des Gott-Vaters, dessen Absolutheit sich „quoad nos“, und das heißt im Wort als Sohn, mithin Doppelung, der Vielheit (und nicht als Vielheit) offenbart hat. Weil die gesamte Schöpfung, somit auch das menschliche Ich, innerhalb der Religion des Christentums als „creatio dei extra sui“ gedacht wird, befindet sich das Ich außerhalb der Trinität und damit notwendigerweise dieser, der Qualität des Seins nach betrachtet, unterstellt. Von sich aus kann das so gedachte Ich hinsichtlich der Überwindung dieser Spaltung nichts tun – allein schon die Möglichkeit einer eigenständigen Ausrichtung auf Gott widerspräche der „ontologischen Schranke“ zwischen den beiden Größen – und ist damit von vorneherein als erlösungsbedürftig bestimmt. Die Erlösung als Gnadenakt und somit Eingriff der Einheit in die Vielheit wird innerhalb des Christentums in der Erlösergestalt Christi begriffen, in der exemplarisch und explizit, da als Einheit und Vielheit zugleich bestimmt, diese Schranke auf die als Doppelung begriffene Einheit hin als überwunden gedacht wird. Das Ich als „creatio ex nihilo“ und somit „extra die“ – hier wird der Begriff Gott im engerem Sinn nur auf den innertrinitarischen Vorgang selbst bezogen, der ausschließlich die drei göttlichen Personen umfaßt – ist zwar nach seinem Bild geschaffen, dies jedoch nur in analoger Weise, so daß es zeitlebens trotz der Menschwerdung Christi Vielheit bleibt, um danach in Gott aufgenommen zu werden, jedoch nicht als Gott im Sinne der absoluten Einheit. Damit entledigt sich das Ich seiner selbst als Vielheit, jedoch nicht der endgültigen Doppelung, welche die Formulierung `in Gott` weiterhin aufrechterhält, indem sie ein wie auch immer gedachtes Ich beibehält und dieses in die zeitlose Betrachtung Gottes versetzt. Das Ich, in der Tradition um Eckhart, ist damit durchgehend getrennt von Gott gedacht worden und das beginnend mit der „creatio (ex nihilo)“, über die analoge Seinsweise hindurch, bis hin zur „salvatio“, welche, wie eben gezeigt, weiterhin Zweiheit und damit einen Unterschied in Gott beibehält. Jetzt wird verständlich, weshalb formal – und das heißt zunächst zum Beginn seines Werkes (entsprechend auch dieser Arbeit) – wie auch dem Inhalt nach die absolute Einheit der Ich-Struktur mit Gott im Begriff der `gotheit` bedacht worden ist, denn so Eckhart selbst: 76 „ `nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo`.“166 Soll also die absolute Einheit zwischen dem Ich und Gott, also die `gotheit` wiederhergestellt werden, so muß dieselbe Einheit notwendigerweise immer schon bestehen, weil es sonst nicht denkbar ist, wie diese aus der Vielheit heraus erreicht werden soll, ist doch jedes Wollen und Denken, damit jegliches Bestreben, immer nur die Fortsetzung der Entfaltung der Vielheit wie auch gleichzeitig ihre Aufrechterhaltung167. Anders ausgedrückt: Einheit als Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn sie als solche der Ausgangspunkt der Bewegung selbst ist, mithin ihr Ursprung. Fallen aber im Begriff der absoluten Einheit Anfang und Ende zusammen in dem Sinne, wie jegliche unterscheidende Begriffe und damit Verstandesprinzipien auf sie bezogen ihre Gültigkeit verlieren, so ist der Vielheit der Begriff ihrer Erscheinung einzig und allein das Ergebnis ihrer eigenen Betrachtungsweise, damit eine Frage der Erkenntnis und nicht des Seins. Weil aber nur das Heraustreten der Einheit als Ganzes und nicht ein Heraustreten aus der Einheit denkbar ist – im zweiten Falle wäre nur ein größeres Ganzes gedacht, mithin nicht Einheit – ist die Entfaltung der IchStruktur aus ihrem eigenen Grunde und Gottes als Trinität aus der `gotheit` notwendigerweise ein und derselbe Vorgang. Mehr noch: Auf Grund der absoluten und daher stets gegenwärtigen Einheit beider Größen im Begriff der `gotheit´ kann Eckhart den Gedanken der „creatio ex nihilo“ fallen lassen168, der das Ich in die analoge Seinsweise führt. Er formuliert jetzt den einen Vorgang des Heraustretens der `gotheit` wie folgt: „ got unde gotheit hât underscheit als verre als himel und erde. Ich spriche mê: der inner und ûzer mensche die hânt alse verre underscheit als himel und erde.“169. 166 In Joh. n. 279, LW III, S. 234. 167 Vgl. dazu: Pred. 11, DW I, S. 179: „ Ich sprach einest: einicheit einet alle manicvalticheit, aber manicvalticheit eneinet niht einicheit.“ 168 Vgl. dazu: Prol. gen. LW I, S. 161: „ Non ergo falsum imaginandum est quasi deus proiecerit creaturas vel creaverit extra se in quodam infinito seu vacuo.“; In Joh. n. 329, LW III, S. 278: „ Sic etiam omne, quod natum est vel quod nascitur ab uno ut unum, necessario est unum. Ab uno enim ut sic non procedit nisi unum.“ 169 Pfeiffer, S. 180, 15 ff. 77 Der innere Mensch in der absoluten Einheit mit der `gotheit` gedacht, tritt hervor – jetzt im Sinne der creatio – als äußerer Mensch in gleicher Weise und zeitgleich, wie der trinitarische Gott aus der ´gotheit`. Mehr noch: wegen der Einheit vom inneren Menschen und der `gotheit` sind der äußere Mensch und Gott Zeitgleiche, da mit ihrem Aufkommen das Erscheinen der Vielheit und somit die Zeit zusammenfällt170. Denkt Eckhart den Grund der Ich-Struktur in der `gotheit` und damit mit ihr identisch, so bleibt die Frage offen, wie sich diese in ihrem Ausfluß als Vielheit zu Gott, der seinerseits als Ausfluß der `gotheit` gedacht und als Trinität begriffen, verhält. Fraglich ist das Verhältnis vor allem deswegen, weil bei der Annahme der absoluten Einheit und daher Identität beider Größen im Begriff der `gotheit` zusätzlich zu der vertikalen Spaltung in Einheit und Vielheit, das heißt der `gotheit` (Einheit) in Gott als Trinität (Doppelung) und des inneren Menschen (Einheit) in den äußeren Menschen (Doppelung) eine horizontale Spaltung hinzukäme: zwischen dem Begriff des trinitarischen Gottes und der als Doppelung verstandenen äußeren IchStruktur des Menschen. Zweifelsohne bedenkt die christliche Theologie bis in die Gegenwart hinein das Verhältnis Gottes als Trinität zum Menschen und umgekehrt immer schon in der Weise, wie sie die Eigenständigkeit beider grundsätzlich in der Entfaltung der Überlegungen von Beginn an voraussetzt. Diese Möglichkeit drängt sich auf, mehr noch, sie ist die einzig logische, sobald ein dualer Ausgangspunkt der Begriffsentfaltung beider angenommen wird. Das genau aber ist bei Eckhart nicht der Fall! ´Gotheit,` dem Begriff nach, ist die absolute Einheit von Ich und Gott, daher analytisch entfaltet zugleich absolute Gegenwart, mithin permanenter Ist-Zustand, bestimmt als Wechselerscheinung von Ausfluß (Vielheit) und Durchbruch (Rückkehr), weshalb eine erneute Spaltung des Abschnittes der Vielheit in Gott und Ich, der Logik nach, keineswegs mehr zwingend notwendig ist. Mehr noch: Die Annahme der Trinität als absolute Einheit scheitert für Eckhart an der Tatsache der ihr dem Begriff nach innewohnenden „Doppelung“, ausgedrückt in der Dreiheit der göttlichen Personen. Damit ist der trinitarisch gedachte Gott nicht mehr Gott, da ´über` ihn der Begriff der `gotheit` gedacht werden kann und muß, welcher, über alle Doppelungen erhaben, ein qualitatives `Mehr` gegenüber dem trinitarisch gedachten Gott aufweist171. 170 Pred. 52, DW II, S. 504: „ Dô ich ûz gote vlôz, dô sprâchen alliu dinc: got der ist.“ 171 Vgl. dazu: Anselm v. Canterbury, Proslogion, cap. II. Hierzu die Studie von B. Weiß, Der Einfluß von Anselm von Canterbury auf Meister Eckhart, in: Analecta Anselmiana 78 Zugleich eröffnet der Begriff Gott die Entfaltung synthetischer Urteile – etwa in der Benennung der drei Personen und ihres Verhältnissens zueinander – woran seine Relativität (exakt im Sinne von Beziehung verstanden) erkennbar, weil denkbar, zum Vorschein kommt. Aus dem Gesagten resultiert, daß Eckhart durch die Einführung des Begriffes der `gotheit` für die absolute Einheit gleichzeitig den bis dahin unter dem Begriff der Trinität gedachten Gott nicht mehr als Gott denken und der Vielheit als Begriff der absoluten Einheit voraussetzen kann. Die Trinität als Ganzes und nicht nur, wie in der Tradition angenommen wurde und wird, der Sohn alleine, ist bereits - da Doppelung und somit als Doppelung – begreifbar. Sie ist damit immer schon Offenbarung, mithin Verlust der absoluten Einheit und eben dadurch nicht mehr Gott172. Und weil der als absolute Einheit gedachte Gott nur der doppelungsfreien `gotheit` zukommen kann und diese wegen der Unmittelbarkeit ihrer Voraussetzung keine Vermittlung zuläßt – so gesehen keinen, wie auch immer gedachten Gott zwischen dem Ich und der `gotheit` duldet – wozu der trinitarisch gedachte Gott, nach der Einführung des Begriffes der `gotheit` degradiert worden wäre, ist die Trinität die Weise des Heraustretens der absloluten Einheit, welche Eckhart nicht mehr erneut spalten kann und muß, in den trinitarischen Gott und die, wie auch immer gedachte äußere Ich-Struktur, weil er damit die absolute Einheit der `gotheit` durch die Einführung des trinitarischen Schöpfergottes aufzuheben suchte, was in sich widersprüchlich ist. Die `gotheit` manifestiert sich als Trinität nach Eckhart also als Vollzug des Denkens, die gleichzeitig Vielheit setzt, weil sie sich als diese entfaltet. Da die `gotheit` dem Begriff nach identisch ist mit dem Grund der Ich-Struktur, muß als Folge dieser begrifflichen Voraussetzung die Trinität nicht nur als Manifestation der `gotheit`, sondern auch des Grundes der Ich-Struktur gedacht werden, die identisch mit der trinitarischen Struktur Gottes sein muß, da ein Unterschied zwischen den beiden im Heraustreten der Identität IV/2, Frankfurt 1975. Dazu M. Enders, Denken des Unübertrefflichen, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie I/2002, S. 69 f. 172 Hier handelt es sich um die entscheidende Stelle, an der sich Eckhart von Augustinus und damit auch seiner Deutung des Neuplatonismus absetzt. Augustinus setzt die absolute Einheit mit dem Begriff des Vaters innerhalb der Trinität gleich, dessen Offenbarung im Wort (Sohn) quo ad nos geschieht und als Begriff vom vernünftigen Teil der Seele in Empfang genommen werden kann, welche auf diesen Vorgang hin geschaffen worden ist. Vgl. dazu: Augustinus, De trinitate, lib. XIII, cap. XVII ff. 79 beider im Begriff der `gotheit` widerspräche, wodurch dieser, da erneut Doppelung bestünde, die Voraussetzung der absoluten Einheit abgesprochen werden müßte173. Daß Eckhart die Begriffe `gotheit`, `got` und Ich mit ihren jeweiligen Konsequenzen sehr wohl nicht nur inhaltlich, sondern auch der Form nach streng zu unterscheiden gewußt hat, spiegelt erneut der Aufbau seines Werkes, worin er im systematischen Teil nur den trinitarisch gedachten Gott und die sich davon analog ableitende äußere Ich-Struktur als die sich vollziehende Reflexion des Denkens bestimmt, sowie deren Verhältnis zueinander, in welchem die Trinität im Denken der ebenfalls als solcher begriffenen Ich-Struktur unmittelbare Anwesenheit gewährt, soweit sich diese, innerhalb der Denkhierarchie bedacht, im Denken selber vereinheitlicht (sie wird, was sie denkt, und denkt, was sie ist), mithin aufhebt. Die unmittelbare Anwesenheit der Ich-Struktur bei dem trinitarischen Gott ist damit zwar denkbar, offenbart sich jedoch immer nur als Doppelung, da die Trinität, als Reflexion des Denkens begriffen, eine solche der Struktur nach ist: drei wesensgleiche göttliche Personen. Die Doppelung aber als Ziel der Aufhebung derselben ist ein Widerspruch in sich, weswegen Eckhart der Trinität den Status der `gotheit` und damit der absoluten Einheit abgesprochen hat174. Weil damit der trinitarisch gedachte Gott für Eckhart notwendigerweise nicht mehr der Gott – also absolute Einheit – ist und als solcher der als Vielheit begriffenen Ich-Struktur, da selber Vielheit, kein Ziel (wohl aber Ursprung und Ende), wird die bis dahin innerhalb der christlichen Tradition mit dem Begriff Gott bedachte trinitarische Struktur der sich vollziehenden 173 Pred. 52, DW II, S. 502: „ Her umbe sô bite ich got, daz er mich ledic mache gotes, wan mîn wesenlich wesen ist obe gote, alsô als wir got nehmen begin der crêatûren; wan in dem selben wesene gotes, dâ got ist obe wesene und ob underschiede, dâ was ich selbe.“ Gott als Beginn der Kreaturen ist damit immer schon und immer nur die sich vollziehende Reflexion des Denkens, welche notwendigerweise unterhalb, da Vielheit, des einheitlich begriffenen Grundes der Ich-Struktur zu denken ist und zwar als dessen gewollte Schöpfung: „ dâ wollte ich mich selben und bekante mich selben ze machenne disen menschen.“ 174 Pred 52, DW II, S. 493: „ Nû sprechen wir, daz got nâch dem, als er `got` ist, sô enist er nihit ein volmachet ende der crêatûre; alsô grôze rîcheit hât diu minste crêature in gote. Und waere daz sache, daz ein vliege vernunft haete und möhte vernünfticlîche suochen den êwigen abgrunt götlîches wesens, ûz dem si komen ist, sô spraechen wir, daz got mit allem dem, daz er `got` ist, sô enmöhte er niht ervüllen noch genuoc tuon der vliegen.“ 80 Reflexion des Denkens von Eckhart im ersten Schritt als solche erkannt (systematischer Teil) und mit der ganzen äußeren Ich-Struktur als permanenter, da zeitloser Ausfluß der `gotheit`, identisch gesetzt (das Werk der Predigten). Die Verbindung zwischen seinem systematischen Werk und den Predigten besteht also darin, daß das Erste reine preparatio des Begriffes der Reflexion des Denkens und gleichzeitig selbst ihr eigenes Ergebnis ist, während die `gotheit`, von der Reflexion des Denkens notwendigerweise dem Begriff nach als absolute Einheit vorausgesetzt, in der Aufhebung derselben und daher weder im Begriff noch als Doppelung die unmittelbare Anwesenheit bei sich selber zuläßt, welche wiederum in der Gleichzeitigkeit, da absolute Einheit, in der Aufhebung des Unterschieds von Vielheit und Einheit mündet. Und weil die Aufhebung der Spaltung in Einheit und Vielheit mit der Aufhebung der Reflexion des Denkens im gleichen Akt zusammenfällt, mithin kein Akt des Denkens sein kann, verlegt Eckhart das Sprechen davon notwendigerweise aus dem systematischen Teil seiner Werke in die Predigten, welche als Reden der Unterweisung und somit reine revelatio der Caritas die prepa-ratio zwar voraussetzen, jedoch nur so weit, wie diese aus dem Bedürfnis der absoluten Erkenntnis heraus sich selbst und die Einheit dem Begriff nach aufgeben müssen, was der Selbstaufhebung auf der einen und gleichzeitig der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit selber, auf der anderen Seite, gleichkommt 175. Der von Eckhart in seinen Predigten eingeführte Begriff der `gotheit´ mit seinen oben nachgedachten Folgen erweist sich damit als der erste ernsthafte Versuch innerhalb der christlichen Theologie, den Begriff der 175 Der in diesem Zusammenhang oft zitierte Beitrag von K. Flasch, Meister Eckhart und die `Deutsche Mystik`, Amsterdam 1988, S. 439 ff. hält seine Kritik gegen eine mystische Vereinnahmung und für eine systematisch-philosophische Quellenforschug Eckharts nur solange berechtigterweise als begründet aufrecht, wie die Mystik allein schon als Begriff von der Wissenschaft – gemeint ist in diesem Fall vor allem die Philosophie - unbedacht bleibt. Verharrt die Philosophie in dieser Position der Mystik gegenüber, so ist das kein Argument für sie, da sie damit zweifelsohne ein Gebiet der abendländischen Geistesgeschichte außer Bedacht läßt und somit den Anspruch, `die Philosophie` sein zu wollen, damit aufgibt. Das Plädoyer von K. Flasch für den, wie auch immer verstandenen Begriff der Philosophie und gegen den, in der Regel zwar formulierten, keinesfalls jedoch allgemein bestimmten Begriff der Mystik läuft Gefahr das eckhartsche Werk in der gleichen Weise einseitig zu deuten, wie die vom Autor kritisierte Subsumierung unter einen unklaren Begriff derselben. Ein systematisches Durchdenken dieser, wenn auch inhaltlich angreifbar, ist doch formal gesehen der einzig mögliche Weg, der Weite des eckhartschen Denkens Folge zu leisten, dem es offensichtlich meisterhaft gelungen ist, beides zu verknüpfen. 81 absoluten176 Einheit mit all seinen Konsequenzen einzuführen, der, wie bereits angedeutet und im Folgenden weiterhin näher auszuführen sein wird, der äußeren Ich-Struktur den zuvor von dem trinitarisch gedachten Gott besetzten Begriff zuweisen wird177. 176 Die Betonung liegt hier deswegen auf dem Begriff der Absolutheit, da der Einheitsbegriff ohne diese Radikalisierung sehr wohl Bestandteil der Tradition innerhalb der Entfaltung der Trinitätslehre gewesen ist. Vgl. hierzu vor allem Augustinus, De trinitate. Auch Eckhart, wie bereits gezeigt worden ist, denkt die konditinal erkannte Trinität als Einheit, ihrer Doppelungen wegen jedoch nicht als das Absolute. 177 Den Gedanken der absoluten Einheit zwischen dem Ich und Gott im Begriff der `gotheit` entwickelt Eckhart, wie bereits gezeigt worden ist, einzig und alleine in seinen Predigten (vgl. dazu Kap. II, 2b und c. dieser Arbeit). Das Gleiche gilt für die Einheit zwischen dem äußern Ich und dem trinitarischen Gott. Das `Wie` dieser wird ebenfalls von ihm nur innerhalb der Predigten bedacht. Die systematischen Werke bereiten die jeweiligen Begriffe vor und zwar in der Weise, daß die Gleichheit ihrer jeweiligen Strukturen bereits erkennbar ist und das vor allem dann, wenn diese aus der Perspektive der bereits zur Kenntnis genommenen Predigten analysiert werden. Damit ist der Unterschied zwischen dem Systematischen Werk und dem Predigerwerk analog der gleiche wie zwischen dem Begriff der Religion und dem der Mystik. Das Erste ist jeweils, der Logik des sich entfaltenden Wissens nach, notwendig die Voraussetzung des Zweiten. Formal betrachtet läßt die Mystik als Einheitslehre keine Entfaltung synthetischer Urteile zu, gehört daher als Abhandlung nicht in den Bereich der auf Vernunft gestützten Wissensentfaltung. Die Trennung beider Bereiche im Werke Eckharts ist daher verständlich und unterliegt keineswegs der Willkür ihres Schöpfers und auch nicht des Kommentators. Die Verfasser der neuesten Werke der Eckhartforschung sind sich zwar in der Herausarbeitung der eckhartschen Schlüsselbegriffe weitgehend einig, lassen aber die Konsequenzen eigener Einsichten außer Acht, indem sie die Dualität zwischen Gott und Mensch anhand der eckhartschen Werke verfeinern, jedoch nicht verlassen und daher in Selbstwiderspruch treten. So befasst sich R. Manstettens Gesamtinterpretation Eckharts „Esse est Deus“, Freiburg/München 1993 erst im letzten Teil mit dem Begriff der `gotheit`, der, würde er vom Autor in seiner Wirkung ernst genommen, die duale Auffassung einzelner Kapitel im Ansatz unmöglich machen würde. Ohne die permanente Voraussetzung der `gotheit` ist Eckharts Einheitsdenken in einzelnen Gebieten nicht vollziehbar. Die Arbeit von A. Wilke, Ein Sein – Ein Erkennen, Lang Verlag 1995, differenziert überhaupt nicht die Begriffe Gott und `gotheit`, woraus als Folge nicht einsichtig ist, weswegen der Gott-Vater als Teil der Trinität, bzw. diese, als absolute Einheit auch noch im neuplatonischen Sinne begriffen werden sollen. Die Entfaltung des Einheitsbegriffes (Ebd. Kap. 2.6.4.2) stützt sich auschließlich auf das systematische Werk Eckharts, verkennt damit formal wie auch inhaltlich den Begriff der `gotheit` und damit den der Einheit. Die Behauptung: „ Eckhart denkt Einheit trinitätstheologisch“ (Ebd. Kap. 4, S. 443) ist schlichtweg falsch und liefert demnach eine Voraussetzung für den Vergleich mit der angeführten östlichen Einheitslehre Śamkaras, der dieser nicht standhält, weil er nicht standhalten kann, da er sich, auf die Trinität als Einheit verstanden, immer wieder als dual erweist. Die daraus resultierende Schlußbemerkung, der Vergleich sei sinvoll, da er die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Einheitslehren verdeutliche (ebd. S. 448) ist damit aus 82 4. Die Ich-Struktur und der Begriff der Trinität Der Unterschied zwischen der inneren und der äußeren Ich-Struktur ist für Eckhart der Unterschied zwischen der absoluten Einheit - dem Grund der Ich-Struktur – und seiner Erscheinungsform178, die zwar zunächst einen Unterschied aufweist, jedoch nicht als Unterschiedliches gedacht werden kann, müsste sie damit ein Außerhalb der Einheit setzen, mithin diese aufheben. Weil der Grund der Ich-Struktur, als absolute Einheit im Begriff der `gotheit` gedacht, sich eben dadurch auszeichnet, daß er keinerlei Doppelungen aufweist 179, müssen die äußere Ich-Struktur und ihr eigener Grund gleichzeitig einheitlich und unterschieden sein, da sie, der absoluten Einheit des eigenen Grundes wegen, von diesem nicht getrennt gedacht werden kann und doch in gleicher Hinsicht, allein durch die Tatsache ihrer Manifestation, eine Doppelung und daher Unterschied setzt. Die solchermaßen angedeutete Entfaltung der äußeren Ich-Struktur ist dem Satz vom Widerspruch und somit dem Prinzip der ersten Epoche180 nach undenkbar, wodurch Eckhart notwendigerweise auf die plotinische Vorlage des absolut Einen zurückgreift, das als Prinzip der zweiten Epoche das Prinzip der ersten Epoche in seiner Eigenschaft als sicherstes Wissen ablöst181. zweifachen Gründen falsch. Zum einen, weil die auf dem Begriff der Trinität aufbauende Interpretation Eckharts keine Einheitlehre hergibt, zum anderen ist die Behauptung, es gäbe unterschiedliche Einheitslehren, in sich als Satz ein Widerspruch, da es, dem Begriff der Einheit zufolge, immer nur eine geben kann. Ein Vergleich muß daher notwendigerweise, was die Einheit an sich betrifft, entweder mit der Identität der Verglichenen oder dem Erweis enden, daß eine von beiden, gegebenfalls auch, beim Vorhandensein eines tertium comparationis (was die Arbeit vermissen läßt), beide, sich dem Begriff nach nicht als solche bestimmen lassen. 178 Vgl. Pfeiffer, S. 180, 16 f. 179 Pfeiffer, S. 181, 10: „ ...diu gotheit wirket niht, si enhât niht zu wirkenne, in ir ist kein werc.“ 180 Zu den Prinzipien der abendländischen Philosophie vgl. abermals H. Boeder, Topologie der Metaphysik, op. cit. Dazu auch, gleichsam als Kurzfassung, B. Uhde, Katholische Theologie und neuere Philosophie. Zum Verhältnis zweier Wissenschaften, in: G. Stephenson (Hrsg.): Der Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft, Darmstadt 1976, S. 248 ff. 181 Zum detaillierten Nachweis plotinischen Gedankengutes im Werke Eckharts vgl.: H. Ebeling, Meister Eckharts Mystik, Stuttgart 1941, sowie auch H. Hof, Scintilla Animae. Eine Studie zu einem Grundbegriff in Meister Eckharts Philosophie mit besonderer 83 Die Konsequenz aus der Voraussetzung der absoluten Einheit hebt sämtliche Eigenständigkeit außerhalb ihrer selbst auf, aus der logischen Folge heraus, daß ein Außerhalb ihrer nicht mehr gedacht werden kann182. Die äußere Ich-Struktur muß demnach die zeitliche Erscheinung des sich permanent - und weil einheitlich, deswegen auch zeitlos – offenbarenden eigenen Grundes sein.183 Diese Manifestation des Grundes nennt Eckhart „homo“184, der sich selbst als „animal rationale“185 begreift, um im Vollzug des Begreifens, der Einsicht in die Beschaffenheit desselben als Doppelung, die Einheit – zunächst dem Begriff nach – vorauszusetzen, als deren Bild (`ad imaginem dei`)186 und somit Vollzug er sich selber versteht. Entfaltet sich der Ich-Grund zunächst als Doppelung und dann als Vielheit, so folgt das Nach-Denken dieser Entfaltung der Chrono-logie ihrer begrifflichen Entfaltung, indem zunächst „animal rationale“ und in seiner Folge „imago dei“ untersucht werden, setzt nämlich der zweite Begriff den tätigen Vollzug des Ersten voraus187. Berücksichtigung des Verhältnisses der Eckhartschen Philosophie zur neuplatonischen und thomistischen Anschauung, Lund/Bonn 1952. 182 In Joh. n. 341, LW III, S. 289: „...omnia ex semet ipso, per semet ipsum, in semet ipso et propter semet ipsum...“ 183 Vgl. dazu W. Goris, Der Mensch im Kreislauf, op. cit., S. 194 f. 184 Gen. II, n. 138, LW III, S. 604, 3. 185 Gen II, n. 138, LW III, S. 604, 3 f. 186 Pred. 69, DW III, S. 176 f.: „...bilde und bilde ist sô gar ein und mit einander, daz man keinen underscheit dâ verstân enmac.“ Vergleicht man dieses Zitat mit dem Kontext der Interpretation des `ad imaginem dei` aus Gen. II, n. 138, LW III, S. 604, so wird das Angedeutete einsichtig, daß das systematische Werk die Dualität beibehält, während das Predigerwerk den zuvor herausgearbeiteten Begriff der Bildhaftigkeit Gottes auf Grund seiner zuvor bestimmten Konditionalität in die Einheit von beiden aufhebt. 187 Daß die Zeitlichkeit der äußeren Ich-Struktur das Ergebnis ihrer eigenen Erscheinung ist, ist zu Eckharts Zeiten Allgemeingut. Vgl. dazu: Pred. 32, DW II, S. 133 f.: „ Ein alter meister [Alcher v. Clairvaux] sprichet, daz diu sêle ist gemachet enmitten zwischen einem und zwein. Daz ein ist diu êwicheit, diu sich alle zît aleineheltet und einvar ist. Diu zwei daz ist diu zît, diu sich wandelt und manicvaltiget.“ 84 Den Begriff des Menschen setzt Eckhart damit mit dem der Vernunft188 gleich, und diesen wiederum entfaltet er zunächst im systematischen Teil des Werkes, und das entsprechend seiner Ausrichtung zum einen auf die Vielheit hin, zum anderen auf die Einheit, unter der er, weiterhin im systematischen Teil bleibend, den dreifaltigen Gott versteht. Weil die Ausrichtung der Vernunft im Begriff der `ratio superior` auf den trinitarischen Gott stattfinden muß, der, wie noch zu zeigen sein wird, der unmittelbaren Anwesenheit bei ihm gleichkommt, unterscheidet sich an dieser Stelle das eckhartsche Denken vom aristotelischen und damit auch thomasischen dadurch, daß diese den äußeren Menschen lediglich mit dem Vollzug der auf die Vielheit gerichteten Vernunft identifizieren.189 Diese auf die Vielheit ausgerichtete Vernunft ist die `ratio inferior`190, welche in ihrer Eigenschaft als `tabula rasa`191 aus den durch die Sinne vermittelten Vorstellungsbildern der Dinge die Begriffe abstrahiert, mithin diese denkt192. Die so gewonnenen Begriffe aber sind zugleich die jeweiligen Ideen der Dinge selbst, welche, so Eckhart weiter, als Logos im Begriff des Sohnes und damit als Vollzug der Trinität aufrechterhalten werden. Die Verbindung 188 Pred. 15, DW I, S. 250: „Nun will ich och wissen, was ain mentsch si. Homo sprichet als vil als ain mentsch, (...) vnd ain vernunftiges wesen.“ Der eckhartsche Begriff der Vernunft basiert gänzlich auf dem Prinzip der zweiten Epoche, die die unmittelbare Anwesenheit sowohl bei der Einheit wie bei der Vielheit denken kann und somit die ausschließliche (aristotelische) Bestimmung des Menschen als zeitlicher Vollzug des Denkens mit in die neue intergriert. 189 Hierzu übereinstimmend: W. Tatarkiewicz in: Historia filozofii, Bd. I, Warszawa 1990, 116 ff.; und Jean Bernhard, den ich stellvertretend zu zitieren an dieser Stelle der Diskussion für wichtig halte: „In einem Fragment der Abhandlung Über Philosophie, also in einem frühen Text, erinnert ein Bild an die Höhle, die zu verlassen Platon die Menschen anhält, damit sie zum Licht des Wahren gelangen. (...) Aristoteles evoziert nicht eine Höhle elender Sklaven, sondern: „schöne Wohnungen (...) ausgestattet mit Bildern und Gemälden“; nichts treibt die Menschen, zu versuchen, dort auszubrechen. (...) Sie bemühen sich also nicht, wie bei Platon, um eine schwierige Wandlung, die sie dazu brächte, Ihr Sehen, das von der sinnlichen Welt beherrscht ist, aufzugeben, um ein anderes anzunehmen, das von einer intelligiblen Welt beherrscht wäre.“ In „Geschichte der Philosophie“ Bd I, Hrsg.: F. Chatelet, Frankfurt 1973. S.142. 190 Gen. II, n. 138, LW I, S. 605, 10. 191 Gen. II, n. 138, LW I, S. 604, 5. 192 In Joh. n. 29, LW II, S. 22: „...est enim ratio a rebus accepta sive abstracta per intellectum ...“ 85 zwischen dem zeitlichen und reflektiven Vollzug der zeitlosen und ebenfalls reflektiven Voraussetzung ist die Stelle, an dem sich der von der Mystik her abgeleitete Begriff der Ich-Struktur und der von der Religion her abgeleitete qualitativ unterscheiden müssen, kann nämlich der durch die Vermittlung der Sinne erkannte Begriff, gedacht als die Idee der Dinge, nicht allein der Willkür der sich vollziehenden ratio inferior unterliegen, alleine der Sinnestäuschung wegen, wie auch vor allem der Notwendigkeit des Wissens um die Gewährleistung der „imitatio die“. Und so muß der ratio inferior notwendigerweise zumindest die Möglichkeit der Schau derselben in Gott gegeben werden. Anders ausgedrückt: die ratio inferior muß, bei der notwendigen Voraussetzung einer jenseitigen Einheit, wie sie Plotin epochemachend dachte, über die Möglichkeit des Zugangs zum a priorischen Wissen verfügen. Sonst könnte dieses ihr nicht als vorausgesetzt gedacht werden, was innerhalb der zweiten Epoche des abendländischen Denkens ein Widerspruch ist, ermöglicht sie ihm, als sicherstes Wissen, geradezu den Selbstvollzug im Begriff der Reflexion des Denkens193. Denkt die Religion, gemäß ihrer dualen Begriffsbestimmung, den Zugang zu dieser Art des notwendigen Wissens mit dem Hinweis auf das äußere Geschehen einer geschichtlichen Offenbarung (etwa der Logos als bereits inkarnierter Christus; aber auch der Koran und die Thora), so wird die Mystik diesen Zugang aus dem Begriff der Ich-Struktur heraus ableiten müssen, und zwar als notwendige Folge aus der Voraussetzung der absoluten Einheit, zu der jegliche Vermittlung im Widerspruch steht. Der bis hierher nachgedachte eckhartsche Begriff der ratio inferior folgt dem thomasischen intellectus agens, welcher die qualitativ mindere, da nicht göttliche Seinsweise alles Geschaffenen, mithin auch die des Menschen, auf seine Seelenkraft, eben den intellectus agens notwendigerweise ausweiten muß, der die eine, zeitlose und unmittelbare göttliche Idee analog, somit auch zeitlich, das heißt in einem Nach-einander und vermittelt durch die Dinge, deren Bilder und Begriffe er im Sinne der imitatio dei, nach-denkt194. 193 Wenn überhaupt, so gleicht der eckhartsche Begriff der `gotheit` als sicheres Wissen dem augustinischen „Deus absconditus“ , dessen Bestimmung als „Vater“ ihn doch zum Mitträger eines Reflexionsverhältnisses macht, eine Tatsache, die Eckhart strengstens zu vermeiden vermochte, indem die Trinität als Ganzes bereits unterhalb der absoluten Einheit gedacht wird. Das thomasische Denken und in seiner Folge die gesamte Scholastik, überbieten nicht den Begriff der Trinität, der damit als eine Verhältnisbestimmung aufrechterhalten bleibt. Dazu: Gen II, n. 138, LW I, S. 604; In Joh. n. 28, f.; LW II, S. 22 f. 194 Thomas v. Aquin, Summa theologicae, I 84, 6 c.: „...illud superius et nobilius agens quod vocat intellectum agentem, de quo supra jam diximus, facit phantasmata a sensibus accepta intelligibilia in actu, per modum abstractionis cujusdam.“ 86 Da sich aber der intellectus agens seiner Beschaffenheit nach nur auf ein Seiendes richten kann, soweit dieses eine Begriffsbestimmung zuläßt, bleibt die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Mensch – gedacht als intellectus agens im Vollzug – und Gott – gedacht als absolute Einheit – zu klären, kann nämlich der intellectus agens Gott unmöglich zum Gegenstand haben, wiewohl er aber gleichzeitig und notwendigerweise nicht nur einen Begriff von ihm hat, sondern auch ein Wissen, und dies allein schon seiner Bestimmung als imitatio wegen. Die Art der Teilhabe am Wissen um die absolute Einheit ist damit der Ort195, an dem sich Eckhart sowohl von der thomasischen wie auch der augustinischen Denkweise der Ich-Struktur unterscheiden muß, und das aus Gründen seiner als Mystik bestimmten Denkweise: - Der thomasische intellectus agens ist nicht nur Doppelung, sondern Vielheit, da er analog zu Gott, daher „extra die“, so dieser innertrinitarisch gedacht wird, agiert. Die Teilhabe am Wissen um die absolute Einheit hebt diese Doppelung nicht auf, da der intellectus agens aus der revelatio dei, welche in der Inkarnation Christi gipfelnd in die Vielheit herausgetreten ist, die Ableitung einer Begriffsbildung vornehmen kann und auch muß, ohne sich selber dabei aufzuheben. Der intellectus agens als Hauptmerkmal der thomasischen Ich-Struktur begreift sich, wegen der „ontologischen Schranke“, die notwendigerweise auch ihn selber betrifft, als grundsätzlich von der Einheit geschieden in der Weise, daß er als gänzlich auf deren Offenbarung ausgerichtet gedacht wird196. - Die augustinische ratio inferior, so Eckhart, wird durch die Vereinheitlichung, und das heißt durch Selbstaufhebung zur ratio superior197, welche dann die Idee unvermittelt als Ursache der Dinge in ihrem Ursprung erkennt. Diese Idee, mit Wort gleichgesetzt und als Logos begriffen, ist der `Sohn`, auf den die ratio superior gleichzeitig 195 Zum „Ort“ der „mystischen Einung“ bei Seuse, Tauler und Eckhart vgl. M. Enders, Selbsterkenntnis „im Seelengrund“, op. cit., S. 204. 196 Auch das lumen intellectuale, eröffnet dem intellectus agens eine „ participata similitudo luminis increati“ Thomas v. Aquin, Summa theologicae, I 84, 5 c. welches die Analogie beibehaltend, logischerweise kein unmittelbares Apriori denken läßt. 197 Zur Rede von „ratio superior“ vgl. A. M. Haas, Gottleiden – Gottlieben. Zur volkssprachlichen Mystik im Mittelalter, Frankfurt am Main 1989, S. 54 f. 87 mit ihrem Erscheinen ausgerichtet ist, und das heißt in diesem Fall mit ihr in der Liebe vereint. Weil aber der Sohn im Begriff des Logos bereits die „revelatio dei quoad nos“ ist und damit, wenn nicht Vielheit so doch Doppelung, ist die Teilhabe an der Einheit durch den Logos wiederum nur eine vermittelte, daher nicht unmittelbare Teilhabe an der absoluten Einheit selbst198, muß zwangsläufig bei jeder Vermittlung ein Ziel dieser mitgedacht werden, mithin ein Etwas, was den Begriff der absoluten Einheit aufhebt. Hat aber Eckhart den Begriff des trinitarischen Gottes als Reflexion des Denkens im Vollzug bestimmen und somit die „ontologische Schranke“ zwischen ihm und der Schöpfung aufheben können (Einwand gegen Thomas und indirekt gegen Aristoteles), so mußte er in gleicher Folge den eben als Denken begriffenen Gott um `Gottes willen` fallen lassen, da er, der Struktur nach notwendigerweise Doppelungen aufweisend (der Denker, das Gedachte und das Denken entsprechend als Vater, Sohn und Geist), bereits Manifestation der absoluten Einheit, damit Doppelung, mithin nicht als diese an sich gedacht werden kann (Einwand gegen Augustinus )199. Für die Denker der mittleren Epoche gilt als allgemeines Gesetz, das Eckhart so formuliert: „nihil potest facere opera propria alicui naturae vel formae, nisi participet formam illam et ipsam in se habeat“200, so kann infolge dessen die absolute Einheit von der Ich-Struktur nur dann erreicht werden, wenn sie von vornherein an dieser partizipiert. Genau das aber ist weder von Thomas (wegen der „ontologischen Schranke“) noch von Augustinus (wegen des als „Doppelung“ bestimmten trinitarischen Gottesbegriffes) jeweils als möglich gedacht worden. Genau diese Voraussetzung denkt Eckhart mit dem Begriff der `gotheit`. Damit ist `gotheit` der entscheidende Begriff in seinem Denken, mit dem er sowohl die „ontologische Schranke“ wie auch die als „Doppelung“ gedachte Trinität aufhebt, und indem er ihn als identisch mit dem inneren Grund der äußeren Ich-Struktur – jetzt als intellectus agens bestimmt – denkt, kann er der oben genannten Voraussetzung gerecht werden, wonach die äußere IchStruktur die absolute Einheit deswegen erreichen kann, weil sie bereits immer schon an ihr teilnimmt. Die Einführung des Begriffes der `gotheit` ist damit gleichzusetzen mit der Einführung des Begriffes der absoluten 198 Vgl. dazu eckhartsche Hinweise auf Augustinus in Gen II, n. 139, LW I, S. 606 f. 199 Vgl. dazu: Kap. II, 2 dieser Arbeit. 200 In Joh. n. 322, LW II, S. 270, 11 f. 88 Einheit, die in dieser Konsequenz notwendig war und deren erste Folge nicht mehr das „Ob“ der unmittelbaren Teilnahme des intellectus agens an ihr, sondern das „Wie“ dieser Teilnahme zu bedenken bemüht ist201. Auf die ratio inferior, welche die Idee a posteriori via phantasmata erkennt, folgt, so Eckhart, die ratio superior, die direkt, daher unmittelbar auf Gott als trinitarischer Vollzug gerichtet ist202 und somit als „ratio rebus prior“ agiert, die dann gleichzeitig die „causa rerum et ratio“ ist, mithin diese „in ipsis principiis intrinsecis“ erfasst203 und damit ihr Wissen a priori erlangt. Die ratio superior liegt damit der ratio inferior immer schon zugrunde und das in der Weise, wie sie einer jeden durch zeitliches Ableiten gewonnenen Idee dieselbige a priori vorlegt und „quam diffinitio indicat“204. Die ratio inferior ist damit als Vollzug des Denkens aus der sinnlichen Wahrnehmung heraus, durch welche sie die Dinge im Begriff erkennt, notwendigerweise auf die unmittelbare Schau der Ganzheit der Ideen angewiesen, als deren spiegelbildliche zeitlich-räumliche Entfaltung sie sich dann versteht. Denkt Eckhart aus diesem Zusammenhang heraus die ratio inferior als Reflexion des Denkens im Vollzug ihrer eigenen Voraussetzung, bedeutet die Rückbeugung der ratio inferior auf sich selber das Verlassen dieses natürlichen Vollzugs und in Folge nichts anderes als die Bildung des IchBegriffes als Ersatzzentrierung der eigenen Tätigkeit, die als zeitliche IchIdentität erlebt und aufrechterhalten wird. Der Ich-Begriff setzt wiederum gleichzeitig mit der Tatsache des Erscheinens sein Gegenteil und damit Unterschied: Wenn Ich, dann auch ein nicht Ich, mithin ein anderer; wenn ein anderer, so auch gleichzeitig ein anderes, mithin Vielheit. Die Vielheit ist damit das unmittelbare Ergebnis der auf sich selbst sich beziehenden ratio inferior, mit der gemeinhin die äußere Ich-Struktur und damit der 201 Vgl. dazu: B. Mojsisch, Meister Eckhart, op. cit., S. 117: „ Prinzipiell ist dem Menschen nichts verborgen, da er nicht nur nachträglich in die Absolutheit des Absoluten aufgenommen wird, diese Absolutheit ihm somit nicht vorgängig fremd, sondern uneingeschränkt bekannt ist, insofern er die Prozessualität des Absoluten selbst ist, Prozessualität auch erst ermöglicht.“ 202 Gen. II, n. 139, LW I, S. 607, 11: „...ordinata in suum superius, deum scilicet...“ 203 In Joh. n. 29, LW II, S. 23, 1 ff. 204 In Joh. n. 29, LW II, S. 23, 1. 89 Mensch gleichgesetzt wird205, und entsteht auf Grund der Verneinung, durch die sich jeder abgeleitete Begriff von seinem Gegenteil absetzen muß206. Daraus zieht Eckhart die Konsequenz: daß dem so verstandenen Ich-Begriff und dadurch auch dem Begriff der Vielheit an sich keine Wesenheit zukommen kann, ist sie vielmehr als begriffliches Ergebnis der reflektierten Einsicht ihrer selbst in sich selbst ein Festhalten am Spiegelbild ihres eigenen Grundes und deswegen „ein zouval der natûre“207 und damit Akzidenz208. Die mit ratio inferior bestimmte äußere Ich-Struktur ist in ihrem Vollzug als intellectus agens die Ursache des Ich-Begriffes, mithin der Ich-Identität und damit die bestehende Perspektive der Schöpfung. Und weil der intellectus agens auf dem `niht` der Unterscheidung gründet, ist die alleinige Identifikation des Menschen mit ihm die Verleugnung des Ganzen zu Gunsten eines Teils, was mit der Verleugnung der Einheit zu Gunsten der selektiv, weil mit der Willkür der jeweiligen Ich-Identität entsprechend begrifflich vollzogenen Vielheit identisch ist. Dadurch aber, gleichzeitig und irrtümlich, wird die zeitliche Identität in den Status ihrer Ursache erhoben, indem sie sich selber, obwohl nur Spiegelbild, so doch eigenständig und damit substanziell denkt. In dieser Verkehrung gründet der Abfall von der Wahrheit 209 in die Sünde, und weil das Wesen der Sünde in der Verneinung gründet, sodann in das aus der Verneinung begriffene Nichts: „et nihil est“210. 205 Pred. 46, DW II, S. 379 f. 206 Pred. 46, DW II, S. 382, 5 ff: „...wan niht machet underscheit. Wie ? Daz merket! Daz dû niht enbist dêr mensche, daz niht machet underscheit zwischen dir und dêm menschen.“ 207 Pred. 46, DW II, S. 381, 4. 208 Der Begriff `Akzidenz` in diesem Zusammenhang geht auf die Quintsche Übersetzung zurück, DW II, S.707, 381, der im Bezug auf die Definition des Menschen in der Predigt 16, wo Eckhart den Begriff der `Substanz` verwendet, als äußerst präzise gewählt erscheint. Darüber hinaus aber auch deswegen, weil auf diesen Ich-Begriff die Kategorien des Aristoteles zutreffen, womit sich wiederum zeigt, daß das aristotelische Denken (und die Ich-Bestimmung) Bestandteil der Mystik Meister Eckharts sein kann und muß, weil es als solches immer schon vorausgesetzt wird, um überschritten und ins größere Ganze intergriert zu werden. 209 Pred. 29, DW II, S. 88, 4 f: „Dâ diu sêle ir natürlich geschaffen wesen hât, dâ enist keine wârheit.“ 210 In Joh. n. 454, LW III, S. 388, 6 f.: „Omne quod quis facit ex se ipso, motus non ex deo patre, peccatum est ...“ 90 Selbst dann, wenn die ratio inferior während ihres Selbstvollzuges als Reflexion des Denkens sich selbst als Doppelung erkennt und damit notwendigerweise die Einheit zumindest dem Begriff nach voraussetzen muß, bleibt ihr – innerhalb der monotheistischen Religionen – der Status der Vielheit während ihres Vollzuges (und das heißt das Leben lang) erhalten211. Gleichzeitig aber – jetzt innerhalb der christlichen Tradition gedacht – läuft sie Gefahr, die als ihre eigene Voraussetzung gedachte Einheit nicht in ihrer Absolutheit denken zu können, kann das Denken als Doppelung und damit per definitionem diese zwar voraussetzen, inhaltlich jedoch nicht entfalten212. Es mangelt daher der christlichen Tradition, im Festhalten am Begriff des trinitarischen Gottes, und daher als Religion bestimmt, auch innerhalb der zweiten Epoche an entfalteter Konsequenz aus der Voraussetzung einer absoluten Einheit 213, die der Begriff der Trinität, seiner Doppelungen wegen, nicht hergibt. Mehr noch: der als Trinität gedachte Gottesbegriff, da synthetische Urteile zulassend, ist notwendigerweise bereits Doppelung, weil er von der ratio inferior im Sinne einer Verhältnisbestimmung entfaltet werden kann214. In Folge davon wird der Versuch der Gotteserkenntnis auf der Ebene der ratio inferior nur dann notwendig, wenn gleichzeitig die unmittelbare Erkenntnisweise der ratio superior verlassen, bzw. überhaupt nicht versucht wird. Deswegen ist, so Eckhart, die Erkenntnis Gottes durch die ratio inferior: „ein vnverstandenheit“215 Gottes, und weil er, bereits als relative 211 Die drei großen monotheistischen Religionen, das Judentum, das Christentum und der Islam, verfügen innerhalb ihrer Orthodoxie (im Unterschied zu den jeweils vorhandenen mystischen Denkweisen) über die „ontologische Schranke“, welche die Vielheit von der Einheit trennt und deren Überwindung nur seitens der Einheit selber geschehen kann, in der Weise ihres Heraustretens in die Vielheit. Auf diesem Hintergrund wird die jeweilige Funktion der Thora, der Inkarnation Christi und des Korans verständlich. 212 Pred. 83, DW III, S. 442, 4 f.: „...do von swig und klaffe nit von gotte; wande mit dem, so dv von imme claffest, so lvgest du, so tvstv svnde.“ 213 Dieses Problem sieht schon Augustinus, indem aus der notwendigen Voraussetzung Gottes als absoluter Einheit kein unmittelbares Verstehen zu gewinnen ist, da Gott als absolute Einheit keinem Begreifen zugänglich: „Si enim comprehenids, non es Deus“ (Sermo CXVII, 3 (5)). 214 Pred. 83, DW III, S. 443, 1 f.: „...vertast dv nv iht vin ime, des en ist er nit, vnde mit dem, so dv iht von ime versast,...“ 215 Pred. 83, DW III, S. 443, 2. 91 Einheit, notwendigerweise alles ist, führt seine Nichterkenntnis in die gänzliche Erkenntnislosigkeit und damit in die Eigenschaft der Tiere216. Das Erkennen Gottes in Begriffen und damit als Vollzug der ratio inferior ist demnach für Eckhart nichts anderes als zunächst die Projektion ihrer selbst auf ihre eigene Voraussetzung217, und weil hier Vielheit Einheit zu begreifen sucht, ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Der eben genannte Ort der Trinität, welche dem Begriff nach innerhalb der christlichen Religion Gott vorbehalten war und auch weiterhin ist, wird vollends erst dann verständlich, so dem eckhartschen Begriff der ratio superior noch genauer nachgedacht wird. Fraglich in diesem Zusammenhang ist zunächst, weshalb Eckhart die ratio inferior, welche: „natürlich geschaffen wesen hât“218, somit gottgewollt ist, auf die ratio superior ausrichtet und letztlich als gänzlich von ihr abhängig denkt, bleibt für den Menschen doch, begriffen als Vollzug der ratio inferior, das Argument der unmittelbaren Gotteserkenntnis zwar verlockend, jedoch als Begriff der Natur nach selber Vielheit, mithin eines unter vielen und somit nicht zwingend notwendig. Die Antwort liegt nicht nur, wie bereits gezeigt, in der Logik der Sache, sondern vor allem im Wesen der sich als Vielheit vollziehenden Ich-Identität des Menschen, die sich als zeitlich und räumlich begrenzt bestimmen muß, damit als Vergängliche, was in Folge notwendigerweise eher oder später von dieser Identität als Leid erfahren wird, weil es, genauer ausgedrückt, die Ursache des Leidens an sich ist. Daß das Verharren in der ratio inferior, mithin in der Vielheit, notwendigerweise bereits Leiden ist und wenn nicht zu einem solchen hinführt, ergibt sich auch aus dem Begriff der Vielheit selber, denn jeder Versuch einer zeitlichen Identifikation ist gleichzeitig nur möglich als Folge der Trennung vom Ganzen219. Der vom Leiden ergriffene Mensch – so er 216 Pred. 83, DW III, S. 443, 3: „...vnd von der unverstandenheit kvmest dv in ein vihelicheit.“ 217 Pred. 83, DW III, S. 441, 2 f.: „Swas wir verstant oder sprechent von der ersten sachen, das sin wir me selber, dan es die erste sache si, wan si ist vber allis sprechen vnd verstan.“.; Ausführlicher dazu: S. 70 ff dieser Arbeit. 218 Pred. 29, DW II, S. 88, 5. Sermo XLIV, LW IV, S. 368 f.: „Omne ergo creatum, omne duo, omne multum separans ab uno et per consequens ab vero, a bono, ab esse est amarum, tenebra et quoddam nihil.“ 219 92 immer noch und immer nur mit sich als der ratio inferior identifiziert ist – richtet sich als diese entweder auf die Vielheit oder auf Gott. Da aber der Vielheit an sich, eben weil sie als solche dem Begriff nach leidstiftend ist, die Aufhebung desselben verwehrt bleiben muß220, verursacht der Mensch, indem er sich als Reflexion des Denkens begriffen im beständigen Vollzug derselben zwecks Leidensaufhebung an diese weiterhin bindet, dieses sein Leiden selbst 221. Dieser Art des Vollzugs der ratio inferior entspricht der Begriff der „eigenschaft“222 oder der der „sünde“223, die von Eckhart synonym verwendet werden. Richtet sich aber die Reflexion des Denkens, mithin der Mensch, auf Gott, so bleibt er dem Vollzug der Sünde weiterhin verhaftet, kann sich die als Vielheit gedachte ratio inferior ihrer Struktur nach immer nur auf ihresgleichen ausrichten und erreicht damit die absolute Einheit lediglich in der Gestalt des Begriffes, der, da wiederum Vielheit, dem Gesetz seiner eigenen Vergänglichkeit unterliegend, niemals Gott sein kann224. Selbst die Struktur des Bittgebetes, in welchem ein Seiendes ersehnt oder abgewendet werden soll, setzt gleichzeitig ein Ich im Vollzug der ´eigenschaft` voraus, wie auch die Unkenntnis über die Beschaffenheit der Vielheit an sich, bleibt damit als Folge in ihr und somit dem Leiden verhaftet225. Der Tod als natürliches Merkmal der Vielheit und Höhepunkt des Leidens ist damit als logische Konsequenz die unmittelbare Folge der Reflexion des Denkens im Vollzug ihrer selbst, sofern sie die `eigenschaft` 220 Pred. 79, DW III, S. 366, 2: „Daz ist allen crêatûren versaget, daz deheiniu allez daz habe, daz den menschen genzlîche getroesten müge.“ 221 Buch der göttlichen Tröstung, DW V, S. 16, 1 f.: „Wie möhte der getroestet sîn und âne leit, der sich kêret ze dem schaden und ze dem leide und bildet daz in sich und sich darinund siehet daz ane, und ez sihet wider in ane und kôset mit im und sprichet mit dem schaden, und der schade kôset wider mit im und sehent sich ane von antlize ze antlize.“ 222 Pred. 2, DW I, S. 25, 8. 223 Gen. II, n. 144, LW I, S. 612, 8 f. 224 Reden der Unterweisung, DW V, S. 205, 5 f.: „Der mensche ensol niht haben noch im lâzen genügen mit einem gedâhtem gote, wan, swenne der gedank vergât, sô vergât ouch der got.“ 225 Pred. 26, DW II, S. 25 f.: „Alsô schiere sô dû gote anebetest umbe die crêatûre, sô bitest dû umbe dînen eigenen schaden, wan alsô balde sô crêatûre crêatûre ist, sô treget si inne bitterkeit und schaden und übel und ungemach. Und dar umbe sô geschihet den liuten gar reht, die dâ hânt ungemach und bitterkeit. War umbe? Sie hânt dar umbe gebeten.“ 93 aufrechterhalten will. Zugleich aber, so Eckhart weiter, ist das Leiden der schnellste Weg in die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit226, muß in ihm nämlich die zwingendste Ursache für die Aufhebung der `eigenschaft` gedacht werden. Denkt Eckhart somit das Leiden als Folge der `eigenschaft`, mithin der Sünde und reduziert diesen Begriff eben nicht auf jenen Kodex moralisch – sittlichen Verhaltens der Vielheit innerhalb der Vielheit, so ist ihr Vollzug eine der zwei möglichen Voraussetzungen für den Beginn der Ausrichtung auf die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit, deswegen auch notwendiger Bestandteil der Schöpfungsgeschichte und damit der Ort seiner Gnadenlehre227. Verläßt man aber die Perspektive der ratio inferior und bedenkt den gleichen Sachverhalt bereits aus der Entfaltung des Begriffes der `gotheit`, so ist die Ausrichtung der ratio inferior auf die ratio superior die notwendige Folge dieses Begriffes selbst im Sinne eines analytischen Urteils, wonach die absolute Einheit, erhaben über alle Widersprüche und damit auch während des Vollzuges der Vielheit immer in sich selber bleibend, gedacht werden muß228, weswegen dieser „status“ nicht nur „ante peccatum“ gedacht werden kann, sondern als ein „immer“ im Sinne permanenter Gegenwart gedacht werden will229. Das ist die zweite Voraussetzung, beziehungsweise bereits der natürliche, wenn auch unbewußte Zustand der Hinordnung der ratio inferior auf die ratio superior. Erkannt worden ist die ratio inferior in ihrer Struktur, die von Eckhart als äußerer Mensch - „ûzer mensche“230 - begriffen, welche die sich vollziehende Reflexion des Denkens ist. Gezeigt worden ist auch die Ursache für eine mögliche Ausrichtung dieser auf die absolute Einheit selbst, die im Leiden gegründet, das vom Denken und das bedeutet notwendigerweise im Denken niemals aufgehoben werden kann. Die Ausrichtung des Denkens auf Gott ergibt in Folge auch nur einen Begriff 226 Von abgescheidenheit, DW V, S. 433, 1 f.: „Daz snellste tier, daz iuch treget ze dirre volkomenheit, daz ist lîden.“ 227 Vgl. dazu: Gen. II, n. 145, LW I, S. 613 f. 228 Pred. 12, DW I, S. 201, 5: „ Daz ouge, dâ inne ich got sihe, daz ist daz selbe ouge, dâ inne mich got sihet; mîn ouge und gotes ouge daz ist ein ouge und ein gesiht und ein bekennen und ein minnen.“ 229 Gen. II, n. 143, LW I, S. 612, 6: „...et est status naturae...“ 230 Von abgescheidenheit, DW V, S. 419, 10. 94 desselbigen, mithin Vielheit, darf auch deswegen niemals mit der absoluten Einheit an sich verwechselt werden. Genau hier entscheidet sich das religiöse Denken gemäß dem Begriff der Religion für die Beachtung der im Begriff vorausgesetzten Einheit, mithin für den Verbleib in der Vielheit, was nach Eckhart dem Vollzug der Sünde gleichkommt, während die Mystik, ebenfalls gemäß ihrer Bestimmung, den Begriff der absoluten Einheit, somit den Inhalt der Religion voraussetzend und korrigierend, die unmittelbare Anwesenheit bei dieser zu erreichen sucht231, was Eckhart mit der Ausrichtung der ratio inferior zunächst auf die ratio superior innerhalb des systematischen Teils seines Werkes oder des äußeren auf den inneren Menschen – „inner mensche“232 – innerhalb seiner Predigten wiedergibt. 231 Vgl. dazu: Pred. 79, DW III, S. 368, 6 ff.: „Und ich spriche mê, daz aller crêatûren wesen und leben liget dar ane, daz sie got suochent und im nâchjagent.“ Das „Finden“ Gottes, als Ende der Suche ist dann identisch mit der unmittelbaren Anwesenheit bei der `gotheit`. Dazu: Pred. 15, DW I, S. 252 f. 232 Von abgescheidenheit, DW V, S. 419, 12. 95 5. Die Ich-Struktur begriffen als Trinität Formal betrachtet denkt Eckhart die ratio superior zunächst als unmittelbar auf Gott gerichtetes Vermögen233, folgt damit – äußerlich gesehen – der Tradition234, die er aber, wegen ihrer Ausrichtung auf den Begriff des trinitarisch gedachten Gottes, genau an dieser Stelle verläßt, um daraufhin – und der Form nach – außerhalb seiner systematischen Werke die unmittelbare Anwesenheit bei der im Begriff der `Trinität` eingeführten Einheit zu predigen235. Die inhaltlich wie auch formal vollzogene Trennung spiegelt sich dann erneut in der Sprache der Predigten wider, die sich, da auf die direkte Begriffsgewinnung verzichtend, in Sprachbildern und Gleichnissen niederschlägt. Die ratio superior ist demnach auf den Ursprung aller Vielheit ausgerichtet, weil sie in die Ursache derselben, nämlich in die sich als Trinität vollziehende Einheit der Ideen „blicket“236 und „durchbrichet“ diese auf ihre absolute Voraussetzung hin, wo sie diese in ihrer Gesamtheit aus dem „herzen des vaters“, - der begriffen als `gotheit` eben das Absolute ist – empfängt237. Der Vollzug der ratio superior („vernünfticheit“) ist auf Grund dieser Tätigkeit Doppelung, weswegen sie an dieser kein Gefallen im Sinne ihrer Aufhebung finden kann238, ist die Identität der ratio superior mit sich selbst, begriffen als Vollzug der Trinität, wiederum nichts anderes als erneutes Festhalten am Teil einer größeren Gesamtstruktur, mithin 233 Gen. II, n. 140, LW I, S. 607 ff. 234 Vgl. dazu: Augustinus, Confessiones, X, caut. XXVI. n. 37, den hier Eckhart explizit neben Maimonides zitiert. Gen II, n. 139, LW I, S. 606. 235 Da sich nirgendwo innerhalb der systematischen Werke der Begriff der `gotheit` als absolute Einheit finden läßt, scheint mir diese Tatsache, bei einem so präzis denkendem Menschen wie Eckhart, keine Willkür zu sein, vielmehr die formelle Konsequenz des Inhaltes selber, dessen Erscheinen die Aufhebung des Denkens zu Voraussetzung hat, folglich von diesem nicht erfasst werden kann, im Sinne einer systematischen Darlegung. 236 Pred. 69, DW III, S. 178, 10. 237 Pred. 69, DW III, S. 178, 2. 238 Pred. 69, DW III, S. 179, 3: „ Jâ, bî guoter wâhrheit, ir engenüeget als wênic an gote als an einem steine oder an einem boume.“ 96 „eigenschaft“239 und in diesem Sinne auch Sünde. Bleibt aber die ratio superior im Vollzug ihrer selbst ohne Anhaftung, somit offen und deswegen auch sine peccatum, ist sie über sich selber - begriffen als Gott - erhaben und befindet sich damit im „Ausfluß“ des Einen, nämlich im „Anfang“240. Der „Ort“, auf den die ratio superior jetzt „blicket“, ist damit „in principio“ und damit sie selbst vor jeder Doppelung und damit gleichzeitig, weil Zeit hervorbringend, vor jeder zeitlichen Entfaltung derselben241. Und so läßt sie sich als die immer währende Manifestation des Einen bestimmen, die zeitlos im Begriff der Trinität die Ideen - begriffen als Sohn, als Logos oder als das Wort242 - denkt, indem sie diese schafft und so gedacht werden kann, weil sie diese im Vollzug gleichzeitig ist243. Es ergibt sich, daß der ratio superior laut Eckhart genau die Tätigkeit zukommen muß, die innerhalb der Tradition Gott, gedacht als Trinität, dem Begriff nach vorbehalten war, weswegen sie die gleiche Struktur aufweisen muß, denn sie ist jetzt im Ursprung und, weil identisch mit ihm, notwendigerweise der Ursprung selber. Hat Eckhart die erste Ursache244 als die sich zeitlos vollziehende Reflexion des Denkens gedacht und als Gott begriffen, deren Sein eben in ihrem Vollzug gründet, so daß sie ist, weil sie denkt, so kommt der ratio superior eben die Struktur der zeitlosen und einheitlichen, da hier Denken und Sein identisch sind, Reflexion des Denkens zu. Ist diese wiederum als konditionales Wechselverhältnis bestimmt worden, so muß das Sohnsein in 239 Pred. 48, DW II, S. 420, 1´: „Im engenüeget noch an vater noch an sune noch an heligem geiste noch an den drin persônen, als verre als ein ieglîchu bestât in ir eigenschaft.“ 240 Pred. 69, DW III, S. 179, 9: „ Einheit „dâ der sun ûzquillet und der heilige geist ûzblüejende ist.“ 241 Pred. 69, DW III, S. 179, 6: „...ê ez dâ deheinen namen gewinne, ê ez ûzbreche, in einem vil hoehern grunde, dan güete und wîsheit sî.“ 242 In Joh. n. 29, LW III, S. 23, 1 ff. 243 In Joh. n. 29, LW III, S. 23, 3: „ Propter quod dicitur quod logos, ratio scilicet, est in principio: in principio, inquit, erat verbum.“ 244 Zu „erster Ursache“ bei Eckhart vgl. auch T. Kobusch, Bedingte Selbstverursachung. Zu einem Grundmotiv der neuplatonischen Tradition, in: T. Kobusch, B. Mojsisch, O.F. Summerell (Hrsg.): Selbst – Singularität – Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum deutschen Idealismus, Amsterdam/Philadelphia 2002, S. 167 ff. 97 gleichzeitiger Einheit mit dem Vater und dem Geist gedacht werden, weswegen die ratio superior unmöglich nur als der Sohn gedacht werden kann, sondern als der Vollzug der Trinität im ganzen und somit als der gleiche Prozeß: „Daz ist ein geburt“245. Können aber, unabhängig von Raum und Zeit, nicht zwei getrennte Strukturen – Gott und die ratio superior – gedacht werden, setzt die Trennung eben Raum und Zeit, mithin die Vielheit voraus, weswegen die ratio superior zunächst in Gott gedacht wird: „...und dar umbe ist si ein bilde in der drîvaltikeit...“, und dort, eben weil keine Unterschiede denkbar sind, nicht nur als das Gleiche, sondern identisch und somit eins mit ihm: „...und dar umbe sprach unser herre vater, mache sie einz mit uns.“246. Die ratio inferior ist damit, weil Vielheit, „ad imaginem die“, während die ratio superior das Bild selber ist und in Relation zu der ersten gedacht das Urbild und somit das Licht, erkannt als die Idee a priori, in dessen Glanze die ratio inferior die Dinge – a posteriori – erkennend vollziehen kann. Dank der Tatsache, daß der im Begriff der Trinität gedachte Gott der ratio inferior in ihrer Wandlung zur ratio superior die unmittelbare Anwesenheit bei sich gewährt und diese wiederum als die absolute Identität beider gedacht werden muß und auch kann, wird der zuvor von der ratio inferior `außerhalb` ihrer vorgestellte Gott zum Vollzug ihrer selbst, sobald sie den Status der ratio superior beziehungsweise ihr Innerstes erreicht hat. Der als Einheit gedachte trinitarische Gott, von dem sich der äußere Mensch analog begriffen hat, ist damit er selbst im Begriff der ratio superior. Weil aber innerhalb der ratio superior auf Grund ihrer Konditionalität Verhältnisse, mithin Doppelungen gedacht werden müssen247, kann diese mit dem Begriff der absoluten Einheit nicht gleichgesetzt werden, weswegen sie zwar als die Ursache der ratio inferior gedacht werden kann, nicht aber als ihr Grund und somit vollständige Aufhebung. Läßt die absolute Einheit keine synthetischen Urteile zu, wodurch sie nicht als die Verneinung der Vorausgegangenen gedacht werden kann – sie wäre damit 245 Pred. 10, DW I, S. 171, 8 ff.: „Diu sêle, diu dâ stât in einem gegenwertigen nû, dâ gebirt der vater in sie sînen eingeborenen sun (...) und in der selben geburt, wird diu sêle (Sohn) wider in got geboren.“ 246 Pfeiffer, S. 581, 34 f. 247 In Joh. n. 194, LW III, S. 162 f.: „...`ego et pater unum sumus`: `unum` propter naturae identitatem, sumus propter imaginis et eius, cuius est imago, distinctionem personalem.“ 98 ein anderes, mithin ein Etwas –, ist sie als Verneinung dieser Verneinung die endgültige und damit auch notwendige Voraussetzung der sich bisher als Vielheit (ratio inferior) beziehungsweise Doppelung (ratio superior) erweisenden Ich-Struktur. Das Sprechen von ihr ist alleine in Sprachbildern möglich, deren Gebrauch den logischen Verzicht auf die Begrifflichkeit als Ergebnis der sich vollziehende Reflexion des Denkens voraussetzt und damit ihrer Aufhebung gleichkommt. Das Absolute im Begriff der `gotheit` und als Grund der ganzen bis hierhin gedachten Ich-Struktur übersteigt im Sinne von Verlassen jeglichen Ansatz einer durch diese erfassten Begrifflichkeit 248, und war die ratio superior begriffen als Idee, Logos und Licht, so ist die absolute Einheit „kein lieht“, weshalb ihr eigener Grund identisch mit der `gotheit` ist, weil er selber als absolute Einheit bestimmt, es in Folge dieser Bestimmung notwendigerweise sein muß249. Der Grund der Ich-Struktur im Begriff der absoluten Einheit muß damit als die notwendige Voraussetzung seiner eigenen Entfaltung gedacht werden und sich - weil erhaben über jegliche Doppelungen, und daher permanent – als ihre Aufhebung im Begriff der unmittelbaren Anwesenheit bei sich selber bestimmen lassen250. Die Frage nach der Ausrichtung der äußeren Ich-Struktur auf ihr Innerstes ist damit die Frage nach der Methode der Aufhebung derselben, die gleichzeitig und notwendigerweise der Vollzug der jetzt in ihrer Ganzheit begriffenen Ich-Struktur ist. Dieser will nun zum Abschluß ebenfalls nachgedacht sein. 248 Pred. 72, DW III, S. 253, 5: „ Dâ got (ratio superior) ûzbrichet in sînen sun, dâ enbehanget diu sêle niht.“ 249 Pred 22, DW I, S. 389, 7 f.:„ ...diu verborgene vinsternisse der êwigen gotheit, (weshalb sie auch) unbekant und wart nie bekant und enwirt niemer bekannt.“ 250 Pred 22, DW I, S. 389, 1 f.: „`In principio` daz sprichet als vil ze tiutsche als ein angenge alles wesens, als ich sprach in der schoule; ich sprach noch mê: ez ist ein ende alles wesens, wan der êrste begin ist durch des lesten endes willen.“ 99 6. Die Ich-Struktur als Entfaltung des Absoluten Die Gedankenführung des Meister Eckhart zeigt: die Struktur der Reflexion des Denkens, als welche sich der äußere wie auch der innere Mensch hat bestimmen lassen, ist trinitarisch, können in ihr der Denker, das Gedachte und das Denken unterschieden und benannt werden. Dabei ist die als Vielheit erscheinende Reflexion des Denkens (ratio inferior) nichts anderes als der zeitliche Vollzug ihrer als Einheit bestimmten Voraussetzung (ratio superior), weswegen sie in den sinnlich hervorgebrachten Gegenständen ihre Ursprungsidee (Begriff, Logos) erkennend vollzieht, so sie aus der unmittelbaren Anwesenheit bei sich selber agiert. Die Möglichkeit der Anhaftung („eigenschaft“) an die der ständigen Veränderung unterworfenen Vielheit, die in der zeitlichen Aufrechterhaltung einer im Ich-Begriff bestimmten Ich-Identität ihre Ausformung findet, behindert so gesehen den natürlichen Fluß der ursprünglichen und in diesem Sinne verstandenen ganzheitlichen Ich-Entfaltung251. So gesehen existiert immer nur die als Denken begriffene ratio superior (Trinität), die sich im und als ihr zeitliches Abbild (ad imaginem dei) manifestiert, welches usurpatorisch auf Grund der als Ich-Begiff aufrechterhaltenen zeitlichen Ich-Identität in dieser statt in ihrem Ursprung Substanzhaftigkeit behauptet. Weil aber jegliche Ausrichtung des Denkens, seinen eigenen Vollzug voraussetzend, diesen weiterhin fortsetzt und in der Selbstreflexion direkt, in der Hinwendung auf ein anderes indirekt, das Ich als Begriff bildet, muß es sich selber in der Hinwendung zum eigenen Grund gänzlich aufheben, was, wegen der Identifizierung mit dem Ich-Begriff, dessen Tod gleichkommt.252 Erfolgt die Entfaltung – „ûzfluz“ – der absoluten Einheit, begriffen als innerer Mensch, in einem Dreischritt, nämlich als Vernunft, Verstand (äußerer Mensch) und Wille, so muß die Aufhebung dieser, erneut und 251 Pred 15, DW I, S. 250. Einem vernünftigen Menschen, so Eckhart hier, kann nur dann Substanz, mithin Wesen zugesprochen werden, so er „abgescheiden“ ist und damit bereits im Status der relativen Einheit. Mit `Vernunft`ist hier dann die ratio superior gemeint. 252 Die Aufhebung des Denkens, da sie logischerweise nicht gedacht werden kann, versteht sich daher selbst als Übung, der wiederum innerhalb dieser Arbeit nur im Denken nachgegangen werden kann, womit diese nur im Verzicht auf die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit ihr Anliegen fortsetzen kann. 100 notwendigerweise, drei Stufen aufweisen, dann jedoch in umgekehrter Reihenfolge253: 1. Die jetzt nachzuvollziehende Aufhebung betrifft zunächst den Willen und erfolgt deswegen an erster Stelle, wird seine Manifestation zwar aus der Vernunft gedacht, jedoch nach dem Auftreten des Verstandes und damit in Abhängigkeit von ihm, weswegen er in der Reihenfolge zweiter ist254. Andernfalls müßte er sonst unabhängig von der Reflexion des Denkens gedacht werden, was widersprüchlich wäre, setzt er seiner Ausrichtung die Erkenntnis, mithin den Begriff voraus255. Der Wille also ist, genau wie der äußere Mensch, zum einen unmittelbare Manifestation des inneren Menschen, zum anderen aber, weil dem äußeren Menschen nachkommend, damit als Reflexion seiner Reflexion gedacht, die reine – sofern als Liebe begriffen – Ausrichtung derselben auf ihre Ursache256. In dieser Ausrichtung auf die ratio superior – die sein erster Ursprung ist und weswegen er überhaupt als mögliche Ausrichtung auf diese gedacht werden kann257 - ist er der Reflexion des Denkens deswegen überlegen, weil er, als Liebe gedacht, den Liebenden, mithin die ihn konstituierende Reflexion des Denkens, auf den Geliebten hin aufhebt258. 253 Vgl. dazu: Pred. 73, DW III, S. 260 f. und S. 266, 7 f.; Pfeifer, S. 255, 6 ff. Es sei hier vorab auf den Aufbau der Aufhebungsstruktur der äußeren Ich-Struktur in der Pred. 52, DW II, S. 486 ff. hingewiesen. 254 Pred. 37, DW II, S, 219, 8: „Verstantnisse (äußere Mensch) brichet ze dem êrsten ûz vernünfticheit, und wille gât dar nâch ûz in beiden.“ 255 In Gen. II, LW I, S. 530, 5: „ Voluntas autem et amor descendunt ab intellectu et cognitione, et procedunt ab istis, ut impossibile sit quippiam esse volitum vel amatum, quod non fuerit prius cognitum.“ 256 Pred. 3, DW I, S. 52, 11: „...wan swaz ich will, daz suoche ich.“ 257 Die Vernunft, als ratio superior gedacht, ist der Beginn aller begrifflichen Entfaltung, bringt den Willen als Liebe (Heiliger Geist) aus sich hervor und richtet ihn auf sich zurück (Reflexion des Willens), nachdem sie von der ratio inferior als `Gutheit` erkannt worden ist. Vgl. dazu: Pred. 69, DW III, S. 179, 2 ff. Die Ausrichtung auf die Einheit, begriffen als Gott, ist der Wille der Einheit selber, in der Tradition auch als Engel begriffen. Der Unterschied zum Willen, begriffen als Liebe, besteht damit nicht in der Sache, sondern in der Perspektive der Betrachtung. Vgl. dazu: Pred. 3, DW I, S. 48 ff.; Pred. 12, DW, I, S. 199 f. 258 Aus diesem Grund wurde der Wille zum Inhalt des Prinzips der zweiten Epoche (Vgl. Pred. 6, DW I, S. 113, 8 ff.) und löste damit die Reflexion des Denkens als den Inhalt des Prinzips der Ersten ab. Der eckhartsche Begriff der Vernunft aber, mit der er den Willen übersteigt, meint die ratio superior, mithin die absolute Einheit, und darf deswegen 101 Diese Selbstaufhebung der Reflexion des Denkens in ihren eigenen Willen, begriffen als Liebe, ist das Äußerste, was diese denken kann, erreicht aber Gott nur, insofern er das Gute, also die Liebe ist, damit ein Etwas, nicht aber die absolute Einheit, setzt nämlich die Tatsache der begrifflichen Voraussetzung, gedacht als Folge ihrer Ursächlichkeit, dem Willen ein notwendiges Gegenüber und bestimmt ihn damit seiner Struktur nach als Doppelung. Selbst dann, wenn der Geliebte, also Gott, seinerseits in der Liebe aufgehoben wäre – und in diesem Zusammenhang wird er als diese gedacht –, bliebe die Liebe als solche bestehen, mithin immer noch ein Etwas, das ein Subjekt und Objekt voraussetzt und somit Ausrichtung andeutet259. Gleichzeitig aber, der eckhartschen Terminologie folgend, wonach die Erkenntnis der Einheit mit dieser identisch ist, wird verständlich, weshalb der Wille diese Erkenntnis im Begriff der Einheit voraussetzen muß, ist die Einheit als ratio superior seine Ursache und sein Ziel einzig und alleine auf Grund der begrifflichen Voraussetzung und somit der Tätigkeit der ratio inferior wegen. Das ist auch die Ursache, weshalb der Wille gegen die vom Begriff der Religion geprägte Tradition weiterhin von Eckhart der Wichtigkeit nach an zweiter Stelle gedacht wird260. Der so verstandene Wille ist damit die Ausrichtung des inneren Menschen durch den äußeren auf sich selbst zurück: Er, der Wille, setzt nämlich im Ursprung die Einheit des ersten notwendigerweise als Erstursache voraus261, richtet den äußeren Menschen – hder damit und gleichzeitig dadurch seine Zweitursache ist - und durch seinen Vollzug als Reflexion des Denkens alle anderen Dinge der Schöpfung, da als Begriff gegeben, auf sich (innerer keinesfalls mit einer Regression auf den aristotelischen Begriff derselben verwechselt werden. Deswegen haben seine Zeitgenossen Unrecht, denn „ wan laege ez alleine an willen, sô enwaere ez niht ein.“ Ebd. S. 114, 1 f. 259 Pred. 69, DW III, S. 174, 7: „...der wille gât ûz ûf daz, daz er minnet.“.; Vgl. dazu: Von abgescheidenheit, DW V, S. 402 f. Vgl. dazu auch B. Uhde, „Fiat mihi secundum verbum tuum“, op. cit., S. 93 f. 260 Pred. 3, DW I, S. 52. 9 ff.: „...wan bekantnisse ( obere Vernunft ) hât den slüzzel und sliuzet ûf und dringet und brichet durch und vindet got blôz und saget denne ir gespilen, dem willen, waz si besezzen habe, swie si doch den willen ê gehabet habe.“ Die Möglichkeit der Aufhebung der ratio in die Liebe läßt bereits mit Augustinus die zweite über die erste herrschen. 261 Pred 13, DW I, S. 218, 9: „Daz got staete ist, daz machet alliu dinc loufende.“ 102 Mensch) aus262, „...daz sie komen wider, dannen sie gevlozzen sint...“263. In dieser Bewegung bleibt der Wille immer dem Zustand der jeweiligen IchStruktur, begriffen als obere und untere Vernunft, notwendigerweise untergeordnet, indem er sie, ihrer Zuständigkeit entsprechend, als Ursache voraussetzt. Ist der Wille aber bereits in principio ein Verursachter und als solcher Doppelung, wird er es in finiis auch bleiben müssen, was als die erste Ursache seiner Aufhebung vor dem `Eintritt` in die absolute Einheit gedacht werden muß, gemäß dem Prinzip, wonach „ Finis autem et principium idem.“264. Damit ist die Liebe die letzte und subtilste Weise der Reflexion des Denkens, das von ihr dem Begriff nach Erkannte zu erreichen. Mit dem Hinweis auf die duale Struktur des Willens und der Liebe verläßt Eckhart endgültig, weil dem Inhalt nach, die augustinische265 und mit ihr die überkommene religiöse Art des Denkens. 2. Weil Etwas gedacht werden kann, ohne daß es gewollt wird, jedoch nichts gewollt werden kann, ohne vorher gedacht worden zu sein, folgt der Aufhebung des Verursachten und damit notwendigerweise an zweiter Stelle die Aufhebung der Ursache selbst, nämlich des äußeren Menschen. Und weil aus dem vorausgehenden Satz gefolgert werden muß, daß ein Ich gedacht werden kann, welches über keine Willensäußerung verfügt, jedoch keine Willensäußerung ohne einen Träger, findet im Tod des Ichs die eigentliche Aufhebung des dem Willen vorausgesetzten Trägers statt. Kommt dem Ich, unabhängig von der Reflexion des Denkens, begriffen als Vollzug ihrer drei Momente, die da sind: der Denker, das Gedachte und das Denken, keinerlei Existenz zu und werden gleichzeitig diese drei Momente als im konditionalen Wechselverhältnis zueinander stehend erkannt, so folgt daraus, daß das Ich das unmittelbare Ergebnis der sich vollziehenden Reflexion des Denkens ist, mithin ein Begriff und somit genau das, was der Wille als Ursache jeglicher Ausrichtung seiner selbst innerhalb der erscheinenden Vielheit voraussetzt. 262 Pfeiffer, S. 180, 24.: „ Ich alleine bereite alle crêatûren wider zuo gote.“ 263 Pred. 13, DW I, S. 219, 1. 264 In Gen. II, LW I, S. 636, 3. 265 Vgl. Augustinus, In Ioannis Evangelium XIX, 1 f. Daher auch die Ausrichtung aller auf Gott, begriffen als Liebe: „...ad unum deum tendentes et ei uni religantes animas nostras – unde religio dicta creditur...“ Augustinus, De vera religionae LV, 111. 103 Daraus ergibt sich zum einen, daß die Aufhebung des Ichs nicht als gewollt gedacht werden kann, ist der Wille auf dieser Stufe doch bereits aufgehoben. Wenn nicht, so ist die Aufhebung der Ursache (des IchBegriffs) vom Verursachten (dem Wille) deswegen nicht denkbar, weil dann das Verursachte ohne seine Ursache bestehen müßte, was, wie bereits gezeigt, widersprüchlich wäre. Zum anderen kann die Aufhebung des Ichs nicht im Denken vollzogen werden, ist gerade der Vollzug des Denkens als Begriff die Ursache des Ichs, weshalb die Aufrechterhaltung der Reflexion des Denkens auf direkte (indem sie sich selber denkt) oder indirekte (indem sie anderes denkt) Weise immer das Ich als Begriff hervorbringt und aufrechterhält. Daraus folgt wiederum, daß die Ich-Aufhebung der Aufhebung seiner Ursache, mithin der Reflexion des Denkens, gleichkommt, weshalb Eckhart im Anschluß an die Aufhebung des Willens von der Aufhebung des Wissens und nicht des Ichs spricht266. Setzt das konditionale Wechselverhältnis die völlige Gleichberechtigung ihrer einzelnen Momente untereinander voraus, ist eine etwaige Hierarchie unter diesen auf die Grammatik, nicht aber die Logik der Sprache zurückzuführen. So suggeriert etwa die besagte grammatische Struktur der Sprache mit dem Begriff des Denkers eine zeitliche Vorab- und subjektive Einzelstellung eines Seienden gegenüber dem zeitlich nachgestellten Gedachten, und die Ursächlichkeit beider für das Aufkommen des ganzen Prozesses begriffen als Denken mithin eine Kausalität. Die Logik des Denkens, angewendet auf das Denken selber, erkennt dieses unter dem Begriff der Konditionalität, indem sie das grammatische Subjekt, Objekt und Prädikat, also den Denker, das Denken und das Gedachte, eben nicht der grammatischen Suggestion folgend, miteinander entsprechend gleichsetzt, sondern als gleichberechtigte Momente des gleichen Prozesses erkennt, dessen Ergebnis, unabhängig von dessen Ausrichtung, immer nur einen (singular) Begriff hervorbringt267. 266 Pred. 52, DW II, S.494, 4 : „Ze dem andern mâle (als zweite Stufe) ist daz ein arm mensche, der niht enweiz.“ 267 Auf diesem Hintergrund wird erneut verständlich, weshalb Eckhart den vorgefundenen kausalen Gottesbegriff notwendigerweise in die Konditionalität aufhebt, ergibt der erste, alleine durch die Versetzung in die Zeitlosigkeit, immer noch keine im Denken eindeutig nachvollziehbare Verbindung zwischen den einzelnen Personen und keinesfalls den Begriff der absoluten Einheit. Der als Reflexion des Denkens bestimmte Gottesbegriff erweist dagegen in der Konditionalität der inneren Struktur die Notwendigkeit seiner Einheitlichkeit, erklärt zugleich als reiner Vollzug dieser und das wiederum notwendigerweise, die Identität von 104 Daraus folgt, daß der zunächst kausal gedachte trinitarische Gottesbegriff, die in die Zeitlosigkeit versetzte und ihrem Stand entsprechende Selbsterkenntnis des Menschen, begriffen als Reflexion des Denkens und damit ratio inferior ist. Setzt aber diese bei ihrem Vollzug, gedacht als Begriffsableitung von den sinnlich vermittelten Bildern ein a priorisches Wissen um dieselben Begriffe notwendigerweise voraus, ist der von den Dingen abstrahierte Begriff nichts anderes als die Idee des Dinges selber268, die immer schon als seine Ursache gedacht, ihm und damit seiner Erkenntnis vorausgeht. Deswegen ist auch die Idee – als a priorisches Wissen gedacht – die „Causa prima omnis rei“ und damit das „verbum in principio“269. Das „verbum“ wiederum begriffen als „Sohn“ kann, der Konditionalität wegen, nicht ohne den „Vater“ gedacht werden, weshalb die „causa prima omnis rei“ Gott im Vollzug der Trinität ist. Als diese ist er dann der ratio inferior notwendige Voraussetzung und muß ihr, als deren a priorisches Wissen, Anwesenheit bei sich gewähren, die, wiederum der Konditionalität wegen, nicht mehr vermittelt – durch den „Sohn“ als das „verbum“ – gedacht werden kann, sondern unmittelbar bei sich im Vollzug begriffen werden muß und daher mit ihr identisch. Die notwendige Anwesenheit der ratio inferior bei Gott kann deswegen unmittelbar gedacht werden und wird darum in Folge als ratio superior begriffen. So gedacht folgt, daß der Inhalt der Religion, innerhalb der Entfaltung des Begriffes der Mystik, kein `Außerhalb` der Ich-Struktur sein kann, sondern als Doppelung bestimmtes und im Begriff der ratio superior gedachtes a priorisches Wissen, notwendiger Moment ihres Selbstvollzuges, weswegen die ratio superior oder Gott (immer als Trinität) niemals Ziel der Aufhebung derselben sein können, vielmehr dieser selbst unterliegen. Die Aufhebung der Ich-Struktur, begriffen als Reflexion des Denkens, unterteilt sich Sein und Denken, wonach Gott zeitgleich ist und sein muß, weil er denkt, und nicht etwa umgekehrt, womit er damit im letzten Schritt die vom kausalen Begriff her errichtete „ontologische Schranke“ zum Seienden hin aufhebt. Und obwohl der so gedachte Gottesbegriff,die unmittelbare Anwesenheit bei sich zulassen müsste – im Denken nämlich – erweist er sich wegen der Doppelungen, die notwendige Momente seines Selbstvollzuges sind, nicht als absolute Einheit, mithin nicht als Gott. 268 In Joh. n. 11, LW III, S. 11: „Constat ergo, quod in rebus creatis nihil lucet praeter solam rerum ipsarum rationem.“ 269 In Joh. n. 12, LW III, S. 13. 105 deswegen selbst wiederum in zwei Stufen: die Aufhebung der äußeren IchStruktur (ratio inferior) und die der inneren Ich-Struktur (ratio superior). Ist damit der Denker das Ergebnis der Ausrichtung des Denkens auf das Gedachte, so erreicht Eckhart die Aufhebung der ganzen Bewegung durch die des einen Teils, nämlich des dritten, welcher die Begriffe selber sind in der Hierarchie ihrer Aufstiegs- und Abstiegsfolge und damit in der Weise, wie sich die Reflexion des Denkens aus der eigenen Gewissheit heraus entfaltet, beziehungsweise im Denken zu überwinden sucht, mithin auf sich bezogen ist im Sinne der `eigenschaft` und damit Bindung, verstanden als Ich-Begriff der Selbst-Identifikation270. Die Aufhebung ereignet sich damit wie folgt: In der Aufstiegshierarchie folgt der Aufhebung der Reflexion des Denkens, hier begriffen als Wissen und damit diskursives Denken271, die Identifikation mit und damit die Notwendigkeit der Aufhebung der Erkenntnis als der vergleichenden Hinordnung des Einzelfalls des sinnlich Wahrnehmbaren auf den Begriff hin272, um schließlich die im Grunde gegebene Identifikation mit den Sinnen273 selber aufzugeben274. Die Aufhebung der ratio inferior erfolgt im Fallenlassen der als „eigenschaft“ bestimmten Bindung an die Schein-Substanzhaftigkeit der im Ich-Begriff stattfindenden Selbst-Identifikation275. Als Folge davon erreicht die ratio inferior die unmittelbare Anwesenheit beim Ursprung ihrer selbst, begriffen als ratio superior, als deren zeitliches Erscheinen sie sich im 270 Weswegen die `Seligkeit`, somit die unmittelbare Anwesenheit bei der absoluten Einheit, in keinerlei Reflexionsverhältnissen begründet sein kann. Vgl. dazu: Pred. 52, DW III, S. 496, 1 ff. 271 Vgl. zum Problem der Entfaltung des Begriffes der Wissenschaft: Aristoteles, Metaphysik 981 b 10 f. 272 Vgl. dazu: In Joh. n. 11, LW III, S. 11.; die Tatsache, daß in diesem Zusammenhang der Begriff der Erkenntnis zwischen dem des Wissens und dem der sinnlichen Wahrnehmung steht, spricht für seine Entsprechung mit dem des Künstlers bei Aristoteles. Vgl. Aristoteles, Metaphysik 981 a, 25. 273 Vgl. dazu: Pred. 83. DW III, S. 443.; In Gen. II, n. 141 ff, LW I, S. 609 ff.; Aristoteles, Metaphysik 981 b, 30. 274 Pred. 52, DW II, S. 494, 10: „...daz er niht enwizze noch enbekenne noch enbevinde...“ 275 Sermo XXIX, n. 304, LW IV, S. 269. 106 begrifflichen Vollzug der erscheinenden Vielheit denkend manifestiert. Ohne die Zentrierung auf die zeitliche und damit begriffliche Ich-Identität denkt sie die erscheinende Vielheit unmittelbar aus ihrem Ursprung heraus und auf ihren Ursprung hin und damit einheitlich, ohne einen explizit als Ich definierten Träger dieser Reflexion276. Alleine die Einsicht in die Substanzlosigkeit der aufrechterhaltenen Ich-Identität ereignet sich als die unmittelbare Anwesenheit bei der Einheit, die dem Sein nach der eigentliche Träger ihrer eigenen Entfaltung ist277. Der äußere Mensch ist jetzt, da willenlos, im Stand der „hoesten armuot“278, und wissenslos, darum in „klârste armout“279, und somit im Innersten seiner Struktur, die jedoch die „ naeste armout“280, so Eckhart weiter, noch nicht erreicht hat, ist Gott, gedacht als ratio superior, Doppelung, mithin nicht das Ziel der Aufhebung derselben281, behält er noch mit dieser Bestimmung Identität, mithin auch Unterschied282 und ist damit Ursache erneuter Identifikation im Sinne der `eigenschaft`, weswegen er, als ratio superior begriffen, ebenfalls aufgehoben werden muß283. Ergab sich aber die Ursache der Aufhebung der ratio inferior aus ihrem Leiden heraus, so ist die ratio superior, im Sinne der ´eigenschaft` begriffen, deswegen schwerer zu durchbrechen, ist sie, wegen der bereits stattgefundenen Aufhebung der Vielheit, doch ein Zustand der „Lust“284, der 276 Sermo XXIX, n. 305, LW IV, S. 270. 277 Von abgescheidenheit, DW V, S. 402. 278 Pred. 52, DW II, S. 499, 4. Hier ist der Begriff `hoeste` wegen der ursprünglichen Besetzung durch den Begriff des Willens, der nämlich auf das `hoeste` gerichtet war, beibehalten worden. 279 Pred. 52, DW II, S. 499, 6. 280 Pred. 52, DW II, S. 499, 7. 281 Pred. 52, DW II, S. 502, 7: „ ...alsô als wir got nemen begin der crêatûren...“ 282 Pred. 52, DW II, S. 502, 5: „ ...dâ behaltet er underscheit...“ 283 Pred. 52, DW II, S. 502, 6: „Her umbe sô bite ich got, daz er mich ledic mache gotes; wan miîn wesenlich wesen ist obe gote...“ 284 Pred. 86, DW III, S. 482, 17: „...umbegriffen was mit luste nâch aller ir sêle genüegende...“ 107 um seiner selbst willen gesucht wird285 und dies auf Kosten der Verachtung und der Geringschätzung der erscheinenden Vielheit. Damit ist die auschließliche Ausrichtung auf die ratio superior ihrer Doppelung wegen nicht nur „under gote“, sondern ein Widerspruch zu der sich vollziehenden Vielheit im Begriff der Tugend286, deren Vollzug aus der Einheit in die Vielheit, unmittelbar nach der Erkenntnis des Absoluten, die zweitwichtigste Tätigkeit ist287. 3. War das Durchschauen der Ich-Identität auf ihre Substanzlosigkeit hin die Übung und der Zustand zugleich, durch welche zunächst die ratio inferior hat aufgehoben werden können, so geschieht die Aufhebung der ratio superior mit der Einsicht in die Doppelung ihrer Struktur. Weil die Aufhebung der Doppelung niemals sich solch einer als „Mittel“ bedienen kann und weswegen jegliche als Reflexion vorstellbare Tätigkeiten ausscheiden, müssen die „Übung“ der Aufhebung und ihr Ergebnis identisch sein, denn es ist sonst ein Widerspruch zu denken, daß sich die Vielheit (ratio inferior) durch die Vielheit (Reflexion des Denkens) oder durch die Doppelung (ratio superior), mithin ihren Selbstvollzug, aufheben könnte. Dies bestimmt Eckhart mit dem Begriff der „abgescheidenheit“, deren Bestimmung mit der der absoluten Einheit identisch ist288. So gedacht kommt die völlige Identifikation der Vielheit mit sich selbst dem nicht aufgenommenen Vollzug der Abgeschiedenheit gleich, während die Identifikation mit dem Logos im Begriff der ratio superior dem Abbruch derselben auf dieser Stufe gleichkommt, ist die Abgeschiedenheit, als absolute Einheit, immer schon die Aufhebung schlechthin289. 285 Pred. 86, DW III, S. 483, 15: „ ...mê durch lust da durch redelîchen nutz.“ 286 Pred. 86, DW III, S. 483, 3 f.: „ Leben gibet daz edelste bekennen. Leben bekennet baz dan lust oder lieht allez, daz man in disem lîbe under gote enpfâhen mac, und etlîche wîs bekennet leben lûterer, dan êwic lieht gegeben müge.“ 287 Pred. 86, DW III, S. 482, 17 ff. 288 Von abgescheidenheit, DW V, S. 400 ff. 289 Von abgescheidenheit, DW V, S. 428, 7 ff.; Vgl. dazu: Pred. 2, DW I, S. 43, 3 ff: „ Got selber louget dâ niemer în einen ougenblik und geluogete noch nie dar în, als verre als er sich habende ist nâch wîse und ûf eigenschaft sîner persônen (...) Und sô diu abgescheidenheit kumet ûf daz hoehste, sô wirt si von bekennenne kennelôs (die Aufhebung der Reflexion des Denkens) von minne minnelôs (die Aufhebung des Willens) und von liehte vinster (die Aufhebung der ratio superior).“ 108 Daraus folgt, daß die Abgeschiedenheit als vollkommenste Aufhebung aller zuvor gedachten Stufen der Ich-Struktur zu denken ist. Sie gründet damit und notwendigerweise indirekt – aus ihrer Perspektive betrachtet – „ûf einem blôzen nihte“290, kann deswegen nicht mehr als ein Etwas innerhalb oder gegenüber der absoluten Einheit gedacht werden und muß in Folge mit ihr identisch sein291. Mit dem Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit bei der absoluten Einheit erreicht das Nachdenken der Ich-Struktur ihren Grund, mithin die `gotheit`292 und damit, wenn auch im zeitlichen Nachher, das Wissen um den permanenten Ist-Zustand dieser selbst im Begriff der absoluten Einheit. Die somit erreichte Perspektive der absoluten Einheit mündet notwendigerweise zeitgleich in der unmittelbaren Anwesenheit bei allen Dingen, hebt doch die absolute Einheit alle Unterschiede, mithin Vermittlung auf293. Die Aufhebung des Unterschiedes ist aber keinesfalls mit der Aufhebung der Vielheit an sich gleichzusetzen, kann nämlich diese innerhalb der absoluten Einheit gedacht werden, eben weil sie erhaben über alle Unterschiede und gemäß ihrer Absolutheit dieselben aufhebt. Deswegen kann jetzt, aus der Perspektive des Begriffes der absoluten Einheit gedacht, in dem jeweilig gesetzten Unterschied – damit im Denken – und nicht in den einzelnen Dingen – damit im Sein – die als Sünde begriffene „eigenschaft“ der Identifikation bestimmt werden. In der Möglichkeit dieser Identität scheint die Freiheit des Menschen zu gründen, die damit im Widerspruch zum Ganzen seiner Entfaltung steht. Was nämlich als Freiheit auf der einen Stufe der Entfaltung der Ich-Struktur erscheinen kann, wird mit dem Erreichen der nächst höher liegenden als Notwendigkeit erkannt, bis beide Begriffe im Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten ihre Gegensätzlichkeit verlieren. 290 Von abgescheidenheit, DW V, S. 423, 3. 291 Von abgescheidenheit, DW V, S. 428, 1: „...sô diu sêle dâ zuo kumet, sô verliuset si irn namen und ziuhet sie got in sich, daz sie an ir selber ze nihte wirt, als diu sunne dat morgenrôt an sich ziuhet, daz ez ze nihte wirt.“ 292 Pred. 47, DW II, S. 409, 8: „ ...sô muz daz sîne daz ir sîn, und daz îr daz ist eigentlîche daz sîne.“ 293 Von dem edeln Menschen, DW V, S. 116, 8 ff. 109 Und ist die Sünde, begriffen als „eigenschaft“, die Aufrechterhaltung der Unterschiede, so ist das daraus resultierende Leid bereits die „Strafe“ und damit die „Hölle“294. Die einmalige unmittelbare Anwesenheit der Ich-Struktur in ihrem Grund – wegen der Zeitlosigkeit der Absolutheit ist der Begriff „einmalig“ gleichbedeutend mit „immer“ – muß jetzt als die notwendige Voraussetzung für den freien Vollzug der äußeren wie auch der inneren Struktur ihrer selbst gedacht werden. Dies Anwesenheit gründet die Freiheit in der Auflösung der „eigenschaft“295, die, aus der jetzigen Perspektive bedacht, nichts anderes war als die ausschließliche Identifikation der jeweiligen ratio mit sich selbst, begriffen als Ich oder Gott. Und konnte der Mensch, in der „eigenschaft“ der ratio superior stehend mit dem Sprachbild (und gleichzeitig, da Identifikation somit in der „eigenschaft“) der Jungfrau „juncvrouwe“296 wiedergegeben werden, so muß und kann er jetzt Weib „wîp“297 sein. Somit kann die im Vollzug der ratio superior erkannte und als Logos begriffene Einheit der Vielheit (a priorisches Wissen) sich innerhalb der Letzten, mithin im zeitlichen Nacheinander ohne „eigenschaft“ und damit als Tugend entfalten298, ist doch die Ursache der Eigenschaft-Bildung, nämlich die duale Anschauungsweise, mit dem Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten aufgehoben worden. Die Entfaltung der Einheit aller Dinge ist dann gleichbedeutend mit dem Vollzug der ratio inferior, begriffen als Reflexion des Denkens, die jetzt unterschiedslos die Dinge in der Reihenfolge ihres Erscheinens dem Begriff nach denken kann299, um sie damit, erkannt als das, was sie sind – mithin in Form des Begriffes – in ihren Ursprung zurück zu tragen, der nichts anderes 294 Pred. 5b, DW I, S. 88, 9: „Aber ich spriche waerlîche, daz niht [der Unterschied] in der helle brinnet.“ 295 Vgl. Pred. 2, DW I, S. 43, 3 ff. 296 Pred. 2, DW I, S. 24. 8 f. 297 Pred. 2, DW I, S. 27, 3. 298 Pred. 2, DW I, S. 27. 6: „Daz aber got vruhtbaerlich in im werde, daz ist bezzer...“ 299 Pfeiffer, S. 180, 23 f.: „ Alle crêaturen tragent sich in mîne vernunft, daz si in mir vernünftic sint. Ich alleine bereite alle crêatûren wider zuo gote.“ 110 ist als die einheitlich gedachte Idee der Dinge selbst im Spiel ihres Selbstvollzuges300. Der Mensch, gedacht als zeitlicher Vollzug der Reflexion des Denkens, ist immer schon und immer nur der unmittelbare begriffliche Vollzug seines Innersten, erkannt aus der absoluten Einheit seiner selbst heraus im Begriff des Grundes. An dieser Stelle und aus dieser Perspektive heraus kann die anfangs gestellte Frage nach dem Sinn der Schöpfung dahingehend beantwortet werden, daß diese im Begriff der äußeren Ich-Struktur die Entfaltung des Schöpfers im Begriff ihres Grundes, mithin das notwendige Moment für die Konstituierung der Möglichkeit seiner Selbstreflexion verstanden werden kann. Der gewissermaßen durch das Leiden an der Identifikation mit der äußeren Ich-Struktur erzwungene Vollzug der unmittelbaren Anwesenheit bei der absoluten Einheit ist eine Rückbeugung derselben auf sich selber, mithin Selbstreflexion und deswegen auch Leben. In der Möglichkeit der Verweigerung der Hingabe an das in diesem Sinne verstandene Leben könnte der Ursprung menschlicher Freiheit gedacht werden, allerdings vorausgesetzt, die Verweigerung hielte dem Leiden Stand, denn als auf diesem gegründet ist sie anzusehen, was, wie jetzt erkennbar, gegen die Natur der Sache ist. 7. Zusammenfassung des ersten Teils und Ausblick Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung verstand die Religionsgeschichte als Wissenschaft, mithin auch den Versuch der Begriffsbestimmung einzelner Phänomene innerhalb des vom Begriff der Religion angezeigten Gebietes. Als ein solches Phänomen zeigen sich das Werk Eckharts und der Zen-Buddhismus und innerhalb dieser die jeweilige Entfaltung der IchStruktur, die den Schwerpunkt der Gegenüberstellung bildet. Kann aber das Vereinzelte innerhalb der gegebenen Phänomene nur dann verglichen werden, wenn diese zuvor und somit das Allgemeine als vergleichbar erkannt worden ist, so muß dann – innerhalb einer 300 Pred. 2, DW I, S. 27. 6 f: „ ...wan vruhtbaerkeit der gâbe daz ist aleine dankbaerkeit der gâbe, und dâ ist der geist ein wîp in der widerbernden dankbaerkeit, dâ er gote widergibirt Jêsum in daz veterlîche herze.“ 111 Wissenschaft – die Subsumierung unter denselben Begriff (Signifikat) dieser Voraussetzung folgen. Aus diesem Grund geschah zu Beginn dieser Untersuchung die Ableitung der allgemeinsten Voraussetzung im Begriff der Mystik und der Erweis der Werke Eckharts als die Konkretion dieser innerhalb der christlichen Religiosität. Diese Voraussetzungen wiederum waren notwendig, um ein vereinzeltes Phänomen wie das der Ich-Struktur dem Begriff nach ableiten zu können. Im Folgenden muß daher überprüft werden, inwieweit Zen-Buddhismus als Mystik begriffen werden kann, denn sollte sich die Subsumierung des ZenBuddhismus unter denselben Begriff als unmöglich erweisen und gleichzeitig kein neuer allgemeiner Begriff abgeleitet werden können, wäre zwar die nachfolgende Ableitung der Ich-Struktur dem Begriff nach innerhalb des Zen-Buddhismus weiterhin möglich, ein Vergleich aber mit der Ich-Struktur innerhalb des eckhartschen Werkes deswegen unsinnig, läge das Ergebnis dieser bereits zu Beginn vor. Es kann nämlich das Vereinzelte – hier der jeweilige Begriff der Ich-Struktur – nur aus dem Kontext der Konkretion abgeleitet werden – hier innerhalb der Werke Eckharts oder der des Zen-Buddhismus –, die wiederum allgemein vergleichbar sein müssen, und das im Sinne der Subsumierung unter denselben Begriff, hier als Mystik bestimmt. Weil dann in Folge das Konkrete nicht auf das gemeinsame Allgemeine hin bestimmt werden könnte, entbehrte die Fortführung des Vergleiches auf der Ebene der Vereinzelung jeglicher begrifflicher Grundlage und widerspräche dem wissenschaftlichen Anspruch dieser Untersuchung. 112 IV. DER MYSTIK-BEGRIFF UND DER ZEN-BUDDHISMUS Die Untersuchung der Möglichkeit, den Zen-Buddhismus als Mystik zu begreifen, folgt zunächst der allgemeinen Weise, wie dieser innerhalb der Moderne bereits umschrieben worden ist301. Dabei kommt dem Begriff der Mystik an sich tragende Funktion zu, bestimmte er bislang das Unbestimmbare, nämlich das als Mystik vermutete Werk Eckharts oder das Zen, weswegen er selbst (und das irrtümlich!) in den Bereich des Unbestimmbaren gerückt ist, womit konsequenterweise eine konkrete Erscheinung derselben nicht wirklich gedacht werden konnte, fehlte ihr die notwendige begriffliche Allgemeinerfassung. Erhebt aber die Religionsgeschichte selbst den Anspruch einer Wissenschaft, so kann dieser nur dann und solange aufrechterhalten werden, wie diese in der Lage ist, gemäß ihrem eigenen Verständnis das Vorgestellte und Angetroffene dem Begriff nach zu denken. Die Begriffsentfaltung und Ableitung wiederum, will sie nicht ins bloße Meinen abgleiten, muß dem Maßstab des abendländischen Denkens Folge leisten, das in seinen Prinzipien offenkundig geworden ist302. Damit ist der Begriff der Mystik, verstanden als Ergebnis der Religionsgeschichte in ihrem Eigenverständnis als abendländische Wissenschaft, gleichsam dem Befragten jeweils immer nur ein Begriff und kann in diesem Zusammenhang keinesfalls durch den Verweis auf eine Erfahrung auf beiden Seiten ersetzt werden, ist die zweite nämlich nur mittels des Begriffes Gegenstand der Betrachtung, mithin wissenschaftsfähig und niemals an sich selbst303. 301 Vgl. dazu: Dumoulin, Zen, Bern 1959, S. 10.; Lasalle, Zen und christliche Mystik, Freiburg 1986, S. 26. Diese Stellen seien nur exemplarisch angeführt für die selbstverständliche Anwendung des Mystik-Begriffes auf beide Größen, ohne seine vorherige exakte Bestimmung. 302 Nochmals sei hier auf die grundlegende Arbeit von Heribert Boeder, Topologie der Metaphysik, op. cit., verwiesen. 303 Mit der Hervorhebung der Erfahrung gegenüber der Begriffsbestimmung innerhalb einer Wissenschaft begibt sich diese in einen Selbstwiderspruch, indem sie ihren reflektiven, mithin auf Begriffe angewiesenen Vollzug negiert. Vgl. dazu exemplarisch die Abgrenzung des Begriffes der Vergänglichkeit gegenüber wie auch immer verstandenen Erfahrung derselben in B. Uhde, Einheit und Gegenwart, op. cit., S. 17. Dort der Verweis auf die Hegelsche Begründung des Sachverhalts, die ihrer Wichtigkeit wegen für die Annäherung an das Zen als Begriff und nicht Erfahrung angeführt sei: „Über dieses Prinzip ist zunächst die richtige Reflexion gemacht worden, daß in dem, was Erfahrung genannt wird und von bloßer einzelner Wahrnehmung einzelner Tatsachen zu unterscheiden ist, sich zwei Elemente finden,- das eine der für sich vereinzelte, unendlich mannigfaltige Stoff, - das 113 Deshalb soll und kann im Folgenden untersucht werden, inwieweit die Selbstreflexion des Zen einen Begriff hervorbringt, welcher der fragenden Hinbewegung im Begriff der Mystik entspricht. Das Zen versteht sich selbst wie folgt: „ Eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften unabhängig von Wort und Schriftzeichen: Unmittelbar des Menschen Herz zeigen,die (eigene) Natur schauen und Buddha werden.“304 Die Begrifflichkeit dieser Selbstreflexion, so die Eigendefinition des Zen weiter, entstammt der buddhistischen Lehre: „Die Worte und der Geist des Buddha bilden die Grundlage des Zen“305 und wird von den Trägern der Zen-Orthodoxie, die gemäß der Definition die Buddhaschaft erlangt haben und qualifiziert sind, in diese hineinzuführen, nämlich den Zen-Meistern (jap. Rôshi306), fast ausschließlich auf dreierlei Weise betrieben: in der Form einer „Aufgabe“ (jap. Kôan), der „Unterweisenden Darlegung“ (jap. Teishô), und des „Zwiegespräches“ (jap. Mondô). andere die Form, die Bestimung der Allgemeinheit und Notwendigkeit. Die Empirie zeigt wohl viele, etwa unzählbar viele, gleiche Wahrnehmungen auf; aber etwas ganz anderes ist noch die Allgemeinheit als die große Menge. Ebenso gewährt die Empirie wohl Wahrnehmungen von aufeinander-folgenden Veränderungen oder von nebeneinanderliegenden Gegenständen, aber nicht einen Zusammenhang der Notwendigkeit. Indem nun die Wahrnehmung die Grundlage dessen, was für Wahrheit gelte, bleiben soll, so erscheint die Allgemeinheit und Notwendigkeit als etwas Unberechtigtes, als eine subjektive Zufälligkeit, eine bloße Gewohnheit, deren Inhalt so oder anders beschaffen sein kann. Eine wichtige Konsequenz hiervon ist, daß in dieser empirischen Weise die rechtlichen und sittlichen Bestimmungen und Gesetze sowie der Inhalt der Religion als etwas Zufälliges erscheinen und deren Objektivität und innere Wahrheit aufgegeben ist.“ G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse von 1830, § 39. 304 H. Dumoulin, Zen, Bern, 1959, S. 73. Die Verse stammen vermutlich vom Zen-Meister Nan-chüan und sind auf das Jahr 1237 datiert, bzw. auf das Jahr 1108 nach H. W. Schumann, Mahâyâna Buddhismus, München 1990, S. 103. 305 Mumon Ekai, Mumonkan, München 1989, S. 23. 306 Der Rôshi-Titel beinhaltet die vollständige Erlangung der Buddhaschaft und gleichzeitig die Befähigung, den Weg zu dieser zu lehren. Inhaltlich betrachtet versteht sich jeder ZenMeister der Qualität seiner Einsicht nach identisch mit dem historischen Buddha Siddhârta Gautama, in dessen Traditionskette er namentlich eingetragen wird. Vgl. dazu: K. J. Notz, Das Schüler-Meister-Verhältnis im Zen, Festschrift für G. J. Bellinger, Dortmund, 1996, S. 411 ff. 114 Bei einem Kôan handelt es sich meistens um eine erzählte Begebenheit, deren Unlösbarkeit auf dem intellektuellen Wege den Übenden aus der Identifikation mit dem Ich, begriffen als Vollzug der Reflexion des Denkens, befreien soll, während der japanische Begriff Teishô mit dem Begriff `Darlegung` wiedergegeben, je nach der Eigenart des Rôshis, oft allgemeiner Natur ist und die Grundlagen des Zen an sich reflektieren kann, jedoch immer nur im Hinblick auf die unmittelbare Erlangung der Buddhaschaft selbst, mithin die Übung der Aufhebung der Reflexion des Denkens unterstützend307. Das Mondô ist entweder ein Wortgefecht zweier Rôshis und dann zum Zweck der Vertiefung der bereits erworbenen Einsicht selbst, oder eine Frage-Antwort-Begebenheit des Meisters mit dem Schüler zwecks der Belehrung des Letzteren. Teile des Mondôs wie auch des Teishôs bilden oft ein Kôan, wobei alle drei keinesfalls begrifflicher Natur sein müssen, so daß nur die begrifflichen Gegenstand dieser Untersuchung sein können. Damit sind die in der oben genannten Form verfassten und überlieferten Aussagen der Zen-Meister für die begriffliche Bestimmung des Zen die Primärquelle: „Solange einer für sein Verständnis dieser inneren Zusammenhänge nicht das Siegel der Bestätigung durch einen Meister erhält, nach welchem Maßstab will er sich dann anstellen, Worte zu reden, die in das Geheimnis der Tiefe führen?“, Worte, mit deren Hilfe der Möglichkeit der Begriffsbestimmung des Zen als Mystik nachzudenken sein wird308. In der Eigendefinition begreift sich das Zen als die unmittelbare Erlangung der Buddhaschaft, scheint damit dem Inhalt der Begriffsbestimmung der Mystik zu entsprechen, vorausgesetzt aber, der Begriff der `Buddhaschaft` 307 Exemplarisch dazu: D. T. Suzuki, Koan, der Sprung ins Grenzenlose, Bern 1988.; ferner T. Cleary, Zur Geschichte der Koan-Übung, in Mumonkan, München 1989, S. 273 ff. 308 Engo Kokugon Roshi, Bi-yän-lu, Bd. I, Leipzig 1980, S. 255. – Der Hinweis auf die Primärquelle kann nicht genug hervorgehoben werden, vor allem in Zeiten wachsender Sekundärliteratur, die zum Selbstverständnis des Zen im Widerspruch steht. So versteht beispielweise Yamada Kôun Rôshi die Aussage: „Die Worte und der Geist von Buddha bilden die Grundlage des Zen“ dahingehend, daß „ die Worte aus dem Geist als Entfaltung seiner Erfahrung hervorgehen“ (Mumonkan, München 1989, S. 25), mithin diese notwendigerweise voraussetzen und eben den Rôshi-Status begründen, der wiederum, eben weil erfahren, befähigt ist, diese (Begriffe) zu entfalten. Die Schriften Zen-Geübter müssen daher notwendigerweise als Sekundärliteratur gelten, können diese die Entfaltung der Begriffe aus der Erfahrung nicht hervorbringen, so ihnen diese Erfahrung nicht bestätigt worden ist. Dazu gehören vor allem auch die Werke des D. T. Suzukis wie auch der Mitglieder der Kyôto-Schule, mit Außnahme von Hisamatsu Shin` ichi, die über kein InkaShômei verfügen. 115 läßt sich als absolute Einheit bestimmen und die unmittelbare Anwesenheit bei der so verstandenen Einheit mit der bei der Vielheit denken. Selbst dann, wenn sich das Zen weiterhin, der Eigendefinition zufolge, eben nur auf das Erreichen der Buddhaschaft beschränken möchte, so setzt dieses Selbstverständnis ein Wissen um die Buddhaschaft im Sinne der absoluten Einheit, mithin einen Begriff voraus, der wiederum nur dann sinnvoll gedacht werden kann, wird er mittels der Selbstreflexion der Vielheit, als deren notwendige Voraussetzung, im Zuge ihrer Selbsterkenntnis bestimmt. Verzichtet aber das Zen weitgehend auf die reflexive Analyse seiner eigenen Begrifflichkeit (erster Teil der Eigendefinition), ist aber gleichzeitig auf diese angewiesen (zweiter Teil der Eigendefinition), so muß es auf eine bereits vorhandene Bestimmung seiner tragenden Begriffe zurückgreifen, um diese überwinden zu können und sich damit seinem Inhalt entsprechend zu manifestieren. Damit erweist sich als erstes die formale Anwendung der Begriffsbestimmung der Mystik auf den Begriff des Zen als möglich, während sich die inhaltliche wie folgt entfaltet: In der reflektierten Einsicht in den umfassenden Mangel an anwesender Gegenwart in der Vielheit, verstanden als erster Teil der Begriffsbestimmung der Mystik, gründet die Gesamtlehre Buddhas, damit auch die des Zen, und das sowohl der Form wie auch dem Inhalt nach. Der Form nach, weil die Reflexion dieser Einsicht zu Beginn seiner Lehrtätigkeit steht, nämlich am Anfang der ersten Lehrrede, gehalten wohl im Jahre 528 im Gazellenhain von Benares; dem Inhalt nach, weil die Reflexion dieser Einsicht in die Vielheit die Substanzlosigkeit derselben erkennen läßt und somit die Voraussetzung für ihre Aufhebung begründet. Umgekehrt formuliert und damit in der Absetzung gegen die Lehre der Upanishaden argumentiert: In der Annahme einer Wesenheit innerhalb (âtman) oder außerhalb (Brahmâ) der Vielheit liegt die Ursache einer möglichen, jedoch irrtümlichen Identifikation mit einer von beiden, die Unterschied, mithin wiederum irrtümlich, Dualität stiftet309. Die erscheinende Vielheit ermangelt deswegen nicht nur einer Dauerhaftigkeit im Sinne der anwesenden Gegenwärtigkeit, sondern läßt sich als deren absoluter Mangel bestimmen, kann diese notwendigerweise nur im Zusammenhang mit einer ihr innewohnenden Wesenheit gedacht werden, welche aber alles Erscheinende entbehrt: 309 Vgl. dazu: Majjhima - Nikâya 22, Pali Text Society,Vol. I, London 1954. 116 „Wenn im Geiste der Bodhisattva-Mahasattvas solche willkürliche Begriffe von Phänomenen wie: die Existenz einer eigenen Selbstheit, die Selbstheit eines Anderen, Selbstheit verteilt unter einer unendlichen Zahl lebender und sterbender Wesen oder Selbstheit vereinigt in einem ewig existierenden Universalselbst, vorhanden wären, so wären sie unwürdig, BodhisattvaMahasattvas genannt zu werden.“310 „Der Buddhismus lehrt (im Gegensatz zum Christentum, Judentum, Islam und Hinduismus), daß alle erscheinende Vielheit ( jap. shiki ) dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen ist. Ändert sich die Ursache, erfolgt eine entsprechende Änderung in der Wirkung. Mit dem Aufheben der Ursache geschieht gleichzeitig und auf natürliche Weise die Aufhebung der Wirkung. Damit ist verständlich, daß keine Erscheinung über eine eigene dauerhafte Wesenheit verfügen kann.“311 Die Reflexion dieser fundamentalen Einsicht in die Beschaffenheit alles Erscheinenden ist dem Buddhismus begriffen als Religion312 und dem Zen in der möglichen Bestimmbarkeit als Mystik seiner allgemeinsten Aussage wegen gleichermaßen eigen. Folgt man weiter der Begriffsbestimmung der Religion wie auch der Mystik, so ist der Inhalt der ersten im Begriff der absoluten Einheit die notwendige Voraussetzung der zweiten, jedoch so, daß zunächst nur die Position des Begriffes, keinesfalls aber dieser an sich unterschiedlich gedacht werden muß. Der abendländischen Bestimmung der absoluten Einheit im plotinischen Begriff des `τò έν` innerhalb der Begriffsbestimmung der Mystik entspricht im Zen neben dem Begriff der `Buddhaschaft` der Begriff der „Leerheit“ – (Skrt. Śūnyatã; P. Sunnatã; jap. Kû) -, dessen Erhabenheit über jegliche Dualität und Doppelung bestimmbar sein muß, damit dieser als gewußte Voraussetzung für die Aufhebung derselben, mithin das Zen als Mystik gedacht werden kann. 310 Dana-Paramita 3 in Vajracchedikâ-Prajñāpāramita-Sûtra. Übersetzung aus: MeditationsSutras des Mahayana-Buddhismus, hrsg. Muralt, Bd. I, Zürich 1973, S. 19. 311 Hakuun Yuasutani Roshi, Osiem podstaw buddyzmu zen, Gdańsk 1993. S. 13. 312 Unabhängig von der westlichen Diskussion über die Bestimmbarkeit des Buddhismus als Religion wird dieser abendländische Begriff von den Vertretern des Buddhismus zu Bestimmung desselben angewendet. Dazu: K. Nishitani, Was ist Religion, Frankfurt 1982.; D. T. Suzuki, Wesen und Sinn des Buddhismus, Freiburg 1998, S. 15 ff. 117 War der auf den historischen Buddha zurückgehende Begriff der Leerheit und damit verbunden die Predigt vom „Nicht-Ich“ („Anatta“-Predigt) eine Absetzung gegen die Lehre der Upanischaden und damit gegen die Fundamente der frühbrahmanischen hinduistischen Religiosität, so ist jetzt seine Positionierung im reflexiven Selbstverständnis und die damit zusammenhängende Bestimmung desselben innerhalb der sich ausbreitenden Lehre des Buddha Ursache für die Gründung diverser Schulen, zu denen sich auch das Zen zählt 313. Die Überprüfung des vom Zen übernommenen Begriffes der „Leerheit“ auf seine Bestimmbarkeit als absolute Einheit kann damit anhand seiner Entfaltung innerhalb der zwei größten buddhistischen Schulen, dem Hînayâna und dem Mahâyâna, nachgedacht werden, von denen sich das Zen, gemäß der eingangs gegebenen Selbstdefinition, durch die Unmittelbarkeit („unabhängig von Wort und Schriftzeichen“, mithin nicht reflektiver Art) seiner Anwesenheit beim Prinzip von Allem zu unterscheiden glaubt. Damit liegt die Möglichkeit der Subsumierung des Zen unter den Begriff der Mystik in der Möglichkeit der reflektiven Bestimmung des Begriffes der „Leerheit“ innerhalb seiner Selbstdefinition. 1. Zen und der Hînayâna-Buddhismus Verfügt keine Erscheinung über eine Wesenheit, mithin Dauer, ist jede substanzlos und daher „leer“ (Skt. śūnya). Der adjektivisch gebrauchte Begriff „leer“ bezieht sich damit zunächst ausschließlich auf die Bestimmung der Beschaffenheit aller aufkommenden Phänomene und sagt nichts über deren Voraussetzung aus. Diese wurde zu Beginn der Entwicklung der buddhistischen Lehre und damit innerhalb des Hînayâna mit dem als Substantiv gebrauchten Begriff „Leerheit“ (P. Śunnatā) bestimmt und im Sinne der Einheit der reflektierten Einsicht in die mangelnde Gegenwart (śūnya) zugrunde gelegt314. Bezeichnet aber der Begriff der „Leerheit“ das Fehlen „von Faktoren, die der Meditation und der Erlösung im Wege stehen – und ist damit oft eine Bezeichnung der Erlösung 313 Vgl. dazu: Schumann, Mahâyâna Buddhismus, München 1990, S. 29 ff.; Suzuki, Leben aus Zen, Bern 1987, S. 19. 314 Vgl. dazu: Majjhima-Nikâya 121 und 122, in op. cit., Vol. I. 118 selbst“315, so ist, weiterhin innerhalb des Hînayâna gedacht, der Begriff der „Leerheit“ mit dem Begriff des „Nirvâna“ (Pali: „Nibbâna“) identisch. Indem aber das Hînayâna zwischen dem Bereich der „bedingten“ (Pali: sankhata), daher als leer erkannten Phänomene und dem Bereich des Nichtbedingten (Pali: asankhata), begriffen als Nibbâna, nicht nur unterscheidet, sondern diese voneinander als getrennt denkt316, kann die im Begriff des Nibbâna beziehungsweise Śunnatā der Vielheit vorausgesetzte Einheit unmöglich als absolut gedacht werden, widerspricht dieser Bestimmung nicht nur jegliche Trennung, sondern allein schon die Möglichkeit, einen Unterschied innerhalb ihrer zu denken. Selbst die Tatsache, daß das Hînayâna den Śunnatā-Begriff innerhalb seines Selbstverständnisses als die begrifflich erfasste Voraussetzung für die inhaltlich zu erreichende unmittelbare Anwesenheit bei der unter dem gleichen Begriff verstandenen Einheit denkt, läßt ihn zwar der Form nach bereits als Mystik vermuten, dieses jedoch keinesfalls inhaltlich, offenbart sich die als Einheit gedachte Śunnatā, ihrer Doppelung wegen hinsichtlich der erscheinenden Vielheit, nicht als absolut. Im Ergebnis führt die unmittelbare Anwesenheit bei der als Śunnatā gedachten Einheit logischerweise nicht in die unmittelbare Anwesenheit bei der als Vielheit begriffenen Erscheinungswelt (samsarâ), ist die Trennung von ihr nicht nur die Voraussetzung der Śunnatā, sondern auch das Ergebnis der Bewegung selbst, mündet diese in der Idealgestalt des Heiligen (Pali: Arahat)317, der die Vielheit eben durch die Vernichtung derselben weitgehend aufgehoben hat und damit im Zwischenstadium des Savupadisesa-Nibbâna weilt, bevor er in den, mit dem Tod verbundenen endgültigen Zustand der Einheit (Pali: Anupadisesa-Nibbâna) eintritt. Die vom Zen verwendeten und für seine Bestimmbarkeit als Mystik relevanten Begriffe können damit ihre Begründung nicht aus der HînayânaTradition entnehmen, entspricht die Entfaltung dieser innerhalb des Gesamtzusammenhangs der ersten buddhistischen Lehre weder dem Selbstverständnis des Zen318 noch dem Begriff der Mystik. 315 H.W. Schumann, op. cit., S. 32. 316 H.W. Schumann, op. cit., S. 34. 317 Vgl. dazu: N. Katz, Buddhist images of human perfection, Delhi 1982. 318 Hierzu sei auf den ethisch betonten Achtfachen Pfad bezüglich der Erreichung der Bedingung der Möglichkeit der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit innerhalb des Hînayâna hingewiesen, die keinerlei Schlüsse auf die Unmittelbarkeit dieser Anwesenheit, 119 Die Frage nach der absoluten Einheit und dem Verhältnis dieser zur Vielheit und umgekehrt der Vielheit zur Einheit führte zu einer Verschiebung innerhalb der Bestimmung beider Begriffe, infolgedessen das zunächst für die Beschreibung der Vielheit benutzte Adjektiv `leer` (Skt. śūnya) jetzt auch Wesensbestimmung der Leerheit und damit des Nibbâna wurde, wodurch in beiden das gleiche Wesen gedacht werden konnte, welches auch deswegen substantiviert wurde319. Mit dieser Bestimmung ist die Trennung zwischen der Einheit und der Vielheit dem Begriff nach aufgehoben und dadurch gleichzeitig die Weise erkannt worden, wie die Einheit jetzt in ihrer Absolutheit begriffen der Vielheit nicht nur als notwendig vorausgesetzt gedacht werden kann, sondern auch die unmittelbare Anwesenheit bei sich, mithin auch bei eben dieser Vielheit zuläßt. Diese reflektive Neubestimmung ereignete sich im Rahmen dessen, was allgemein unter dem Mâhâyana-Buddhismus verstanden wird. 2. Zen und der Mâhâyana-Buddhismus Obwohl das Zen seine vier fundamentalen Begriffe, nämlich die Leerheit (Skt. Śūnyatā), die Form (Skt. Rupam), den konditional bedingten Kreislauf der Erscheinungen (Skt. Samsâra) und dessen Verlöschen ( Skt. Nirvâna ) bereits mit dem Hînayâna gemeinsam hat, verdankt es die Art und Weise ihrer Verwendung aber einzig und allein der Bestimmung, welche diese Begriffe innerhalb der als Mâhayâna bekannten buddhistischen Tradition und Lehre bekommen haben. Die Mâhayâna-Tradition entfaltete ihre Lehre wie sie eben das Zen propagiert, zuläßt. Dazu: Majjhima-Nikâya 117; ferner: U. Schneider, Einführung in den Buddhismus, Darmstadt, S. 75 ff. – Darüber hinaus äußert sich das Zen kritisch bis abschätzig über das Hînayâna. Dazu Yôka Daishi im „Lobgesang des Erleuchtungsweges“ (jap. Shôdôka), Geh den inneren Weg, Freiburg 1999, S. 113: „Der leere Schein-Leib ist der wahre Dharma-Leib.(...) Gier, Zorn und Verblendung erscheinen und verschwinden Wie Blasen auf der Oberfläche des Meeres.(...) Keine Sünde, kein Segen, kein Verlust und kein Gewinn.“ Dies gegen asketische Übungen und Selbstdisziplin des Hînayâna, deren Ernstnehmen die Vielheit als solche konstituiert, mithin die Unterscheidung aufrechterhält. Vgl. auch Kôun Yamada Rôshi, Teishô n. 10, Mumonkan, München 1989, S. 77 f. 319 Vgl. dazu: H.W. Schumann, op. cit., S. 33. 120 innerhalb ihres umfangreichen Sûtra-Werkes und in den auf die Interpretation dieser ausgerichteten Lehrbücher (Skt. Śāstra). Das Zen greift die Bestimmung seiner Begrifflichkeit allem voran aus dem Prajñāpāramitā -Sûtra und dessen Kern, dem Herz-Sutra (Skt. MahāPrajñāpāramitā-Hridaya-Sûtra), das innerhalb der täglichen Rezitationsübungen in den Zen-Klöstern gelesen wird. Darüberhinaus aus den Śāstras des Nāgārjuna, der in der Zen-Übertragungslinie als der vierzehnte Zen-Patriarch in Indien aufgeführt wird, wie auch aus den des Vasubandhu, der als Hauptvertreter der Vijñānavāda-Schule der einundzwanzigste Zen-Patriarch war320. Damit gehören die Werke der zwei Hauptvertreter des Mâhayâna, dank dieser Personalunion, zugleich in den Kanon der Zen-Orthodoxie mit dem Ergebnis, daß diese für die Bestimmbarkeit ihres Selbstverständnisses auf die eigene Tradition zurückgreifen kann321. Die für die Bestimmung des Zen als Mystik notwendige Voraussetzung des Begriffes der absoluten Einheit erfolgte in einem Zweierschritt: Durch Nāgārjunas Bestimmung derselben im Begriff der `Leerheit` und die innerhalb der Vijñānavāda - Schule vorgenommene Entfaltung der „nur Geist“ - Lehre (Skt. citta). - Nāgārjunas Schule des „Mittleren Weges“ (Skt. Madhyamaka), basierend auf seinem Hauptwerk, dem Kommentar der PrajñāpāramitāSûtra (Skt. Madhyamakakārikā322), entfaltet den Begriff der absoluten Einheit aus der reflektierten Einsicht in die Beschaffenheit der erscheinenden Vielheit, indem er dieser notwendigerweise vorausgesetzt wird. Die erscheinende Vielheit ist demnach wesenlos und daher leer (śūnya), weil bedingt und damit „konditional“ entstanden (Skt. pratītyasamutpāda), gleichzeitig wie die Konditionalität ihrer 320 Vgl. dazu die Traditionstafel des Zen in Dôgen Zenjis, Shôbôgenzô, Bd. I, Zürich 1999, S. 124.; dazu auch: Lexikon der östlichen Weisheitslehren, Bern 1986, S. 474. 321 Es ist bis heute üblich, daß die großen Zen-Meister die jeweilige Begriffsbestimmung innerhalb ihrer Teishos auf Nâgârjuna bzw. Vasubandhu zurückführen. Vgl. dazu exemplarisch: Hakuun Yasutani Rôshi, Teishô III, op. cit., S. 43 ff.; Engo Kokugon Roshi, Bi-yän-lu, Bd. I, Leipzig 1980, S. 252 ff. 322 Die im Folgenden benutzte deutsche Übersetzung der Zitate aus dem Madhyamakakārikā entstammt aus: E. Frauwallner, Die Philosophie des Buddhismus, Berlin 1994, S. 178 – 199.; H.W. Schumann, Mahâyâna-Buddhismus, München 1990, S. 58 – 68. 121 Beschaffenheit erkannt, mithin gedacht werden kann wegen der `Leerheit` (Śūnyatā) ihrer Voraussetzung323. An diesem Punkt vollzieht sich die Substantivierung des Begriffes „śūnya“, der damit gleichzeitig die Beschaffenheit der Vielheit wie auch die der ihr vorausgesetzten Einheit wiedergibt, womit beide in ihrem Grunde als identisch bestimmt werden konnten324. Mit dieser Bestimmung hebt Nāgārjuna die vom Hînayâna gesetzte Trennung beider Bereiche auf und ermöglicht dadurch die Bestimmung der „Leerheit“ als ein Absolutes, denn obwohl das konditionale Entstehen der Vielheit (Samsâra) zeitlos gedacht wird325, ist es dem Wesen nach mit dem des Nirvâna identisch, eben weil es in beiden Bereichen die eine „Leerheit“ ist. Die im Begriff der `Leerheit` bestimmte Identität zwischen der Vielheit und der Einheit ist deswegen niemals aufgegeben worden, weswegen sie auch nicht erlangt werden kann326; sie ist weder ein „Sein“ noch ein „Nichtsein“ wegen der Korrelation dieser Bestimmungen zueinander327; sie ist zwar im Begriff angedeutet328, jedoch ohne ihm zu entsprechen329, weil sie von der durch ihn hervorgebrachten Unterscheidung unberührt bleibt. Sie bleibt immer: „...nichtbedingt und nonkonditional...“330, „...nicht vergangen und nicht ewig, nicht vernichtet und nicht entstanden,...“331 und nur in diesem Sinne das Absolute (Skt. tattva)332. 323 Madhyamakakārikā XXIV, 18. 324 Madhyamakakārikā, XXIV, 39, f. 325 Madhyamakakārikā, XI, 1. 326 Madhyamakakārikā, XXV, 3. 327 Madhyamakakārikā, XXV, 5, Übertr. Frauwallner, op. cit., S.196: „Wenn Nirvâna ein Sein wäre, dann wäre das Nirvâna bedingt.“; XXV, 8: „Wenn das Nirvâna Nichtsein wäre, wieso wäre dann das Nirvâna unabhängig ? Denn es gibt kein Nichtsein, das unabhängig entsteht.“ 328 Madhyamakakārikā, XXIV, 10, Übertr. Schumann, op. cit., S.65: „Ohne daß man sich auf den (weltlichen) Sprachgebrauch stützt, ist der höchste Sinn nicht darzulegen.“ 329 Madhyamakakārikā, XIII, 8, Übertr. Schumann, op. cit., S. 65: „Die Sieger (Buddhas) haben die Leehrheit als das Aufgeben aller (philosophischen) Theorien verkündet. Diejenigen aber, die eine Theorie der Leerheit (aufstellen), die haben sich als unverbesserlich bezeichnet.“ 330 Madhyamakakārikā, XXV, 9, Übertr. Schumann, op. cit., S. 66. 331 Madhyamakakārikā, XXV, 3, Übertr. Schumann, op. cit., S. 66. 332 Madhyamakakārikā, XVIII, 9.; XXIV, 9. Übertr. Schumann, op. cit., S. 66. 122 - Den Begriff der absoluten Einheit entfaltet die Vijñānavāda-Schule vor allem innerhalb der Lankāvatārasūtra, ihrem Versanhang (sagāthaka), sowie den Schriften ihrer Meister, von denen Vasubandhu als einundzwanzigster Zen-Patriarch verständlicherweise innerhalb der ZenTradition das größte Ansehen genießt333. Die Bestimmung selbst erfolgt in drei Stufen, die den jeweiligen Existenzweisen der sich manifestierenden Einheit zugeordnet werden, indem die letzte und äußerste als die Objektwelt der erscheinenden Vielheit, begriffen als „Bewußtsein“ (vijñāna) verstanden wird334. War diese, jetzt innerhalb des Hînayâna gedacht, den sechs Sinnen vorgesetzt und damit von der Einheit als getrennt bestimmt, so vollzieht bereits an diesem Punkt der Vijñānavāda die entscheidende Wende auf die Bestimmung der Einheit als ein Absolutes, indem die einzelnen Sinnesobjekte (vijñāna) von dem ihnen jeweilig zugrundeliegenden Sinnesbewußtsein hervorgebracht335 und somit von diesem nicht getrennt gedacht werden können. Dieses Bewußtsein, begriffen als das „Denken“ (manas) und damit die zweite Existenzweise, gründet seinerseits im „Geist“ (citta) schlechthin, dessen Manifestation wiederum Geist und durch ihn dann auch die erscheinende Sinneswelt ist: „Geist, Vorstellung und Vorstellungsprodukt, (mit anderen Worten:) Grundbewußtsein, Denken und Bewußtsein, die die drei Existenzweisen ausmachen, - sie alle sind Erscheinungsformen des Geistes.“336. Dieser „Geist“ wiederum kann nur begrifflich vorausgesetzt, jedoch niemals selbst Gegenstand des Denkens werden, wäre er damit immer schon ein Verursachter und nicht die Ursache selbst337. Vom Denken - mithin von der erscheinenden Vielheit - unerreichbar, gleichzeitig aber von dieser sowohl ununterschieden wie auch nichtgetrennt338, ist er ein „überweltliches 333 Die Übertragung der Zitate aus dem Sagāthaka, so wie seine Interpretation folgt der Arbeit von H.W. Schumann, op. cit., S. 75 – 102. 334 Sagāthaka, 102. 335 Vgl. Schumann, op. cit., S. 77. 336 Sagāthaka, 459. 337 Vasubandhu, Trimśikā Vijñaptimātratāsiddahih, 27. Übertr. Frauwallner, op. cit., S. 389.: „Auch durch die Wahrnehmung, daß (alles) dies bloß Erkenntnis ist, faßt man in der bloßen (Erkenntnis) nicht Fuß, da man etwas vor sich hinstellt.“ 338 Vasubandhu, op. cit., 28. 123 Wissen“ der „Nichtwahrnehmung“, mithin ledig aller Doppelungen339 und erst dadurch Ziel der Aufhebung derselben: „ Es ist das unbesudelte Element, das undenkbare, heilbringende, unvergängliche, 340 wonnevolle.“ , daher auch das Absolute. Mit dieser Bestimmung des Absoluten im Begriff der „Leerheit“ und im Begriff des „nur Geist“ ist die Überprüfung des Selbstverständnisses des Zen auf seine Denkbarkeit als Mystik hinsichtlich der Grundbestimmung dieses Begriffes erfüllt. Es gilt daher als nächstes die Eigendefinition des Zen auf den Inhalt des Mystikbegriffes hin zu prüfen. 3. Zen und der Begriff der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten Benutzt das Zen den Begriff der Buddhaschaft in gleicher Weise wie den der Leerheit und den des Geistes, mithin als absolute Einheit341, und begreift sich selber gleichzeitig in der unmittelbaren Erlangung derselben unabhängig von Wort und Schrift, so bietet seine Eigendefinition den Ausgangspunkt nicht nur für die Untersuchung der möglichen Begriffsbestimmung der Durchführbarkeit derselben, sondern diese Eigendefinition muß damit zugleich die Begründung für die Entstehung des Zen im Sinne einer Schule hergeben. Das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit bei der als Leerheit beziehungsweise Geist vorausgesetzten absoluten Einheit wird innerhalb der Zen-Orthodoxie der Unterschiedlichkeit dieser Begriffe wegen, keinesfalls jedoch der „Sache“ wegen, auf zweifache Weise bestimmt: - Die unmittelbare Anwesenheit beim Absoluten, begriffen als Leerheit, ist das Ergebnis der gleichen Wesensbestimmung von Einheit und Vielheit. Eben weil die erscheinende Vielheit ihrem Wesen nach „leer“ ist und „dieselbe“ Leerheit gleichzeitig als ihre Voraussetzung im Sinne 339 Vasubandhu, op. cit., 29. 340 Vasubandhu, op. cit., 30. 341 Vgl. dazu: Hui Hai, Der Weg zur blitzartigen Erleuchtung, in Meditationssutras des Mahayana-Buddhismus Bd. II, hrsg. V. Muralt, Zürich, 1956, S. 136. 124 der absoluten Einheit erkannt worden ist, kann die unmittelbare Anwesenheit der ersten bei der zweiten nur dann als erreicht gedacht werden, wenn die Vielheit in ihr eigenes Wesen einkehrt. Gründet aber alle erscheinende Vielheit auf der Dualität der bipolaren Verstandeslogik342, die zugleich Manifestation und damit die Erscheinungsweise des Absoluten selbst ist, so verhindert die ausschließliche Identifikation mit dieser die Erkenntnis ihres eigenen Wesens, kann das Absolute nämlich niemals ihr Gegenstand werden343 und das aus zwei Gründen: zum einen wegen der auf Doppelung, mithin Vielheit angelegten Weise der Erkenntnis selber, zum anderen aber und das ist für die Methode des Gewahrwerdens der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit entscheidend -, weil die erscheinende Vielheit innerhalb des Monismus immer schon und immer nur als ununterschieden vom Absoluten gedacht werden muß344. Ist damit das Erkennende und das Erkannte im Wesen identisch und als Leerheit begriffen345, so ist die unmittelbare Anwesenheit beim Absoluten nur möglich in der Aufhebung der Unterscheidung346 und damit ihres Trägers, bestimmt als das Denken347. Kann aber die Aufhebung des Denkens keine Tätigkeit desselben sein, ist sie damit nur als das Ergebnis seines „Zurruhekommens“ bestimmbar348. Dieses wiederum, 342 Nāgārjunas Begründung des „Mittleren Weges“ gründet zunächst in der Annahme und deswegen auch in der Aufhebung der bipolaren Logik, was für die Zen-Schulen und deren Methoden der Aufhebung von fundamentalen Bedeutung war und ist. 343 Seng-ts`an, (jap. Sôsan), Hsin- hsin- ming (jap. Shinjin-Mei), Geh den inneren Weg, hrsg. W. Jäger ( Kô-un Ken Roshi), Freiburg 1999, S. 140: „Der Leerheit zu folgen heißt, sich gegen die Leerheit wenden.“ 344 Dazu: Hakuin Zenji Roshi, Lied auf Zazen, Übertr. von Joan Rieck in, Geh den inneren Weg, hrsg. W. Jäger (Kô-un Ken Roshi), Freiburg 1999, S. 145: „Alles Seiende ist der Natur nach Buddha...“; Hakuun Yasutani Roshi, op. cit. , S. 32. 345 Seng-ts`an, (jap. Sôsan), op. cit., S. 141: „Willst du beide Ebenen kennen, sie sind ursprünglich die eine Leerheit. 346 Seng-ts`an, (jap. Sôsan), op. cit., S. 141: „Unterscheidest du nicht zwischen fein und grob, wie kann es dann Vorurteile geben ?“ 347 Dazu: Kôun Yamada Roshi, Teishô 5, in: Mumonkan, München 1989, S. 52 ff.; Hakuun Yasutani Roshi, op. cit., S. 32: „Der Begriff der ‚Leerheit’ bildet einen wichtigen Teil der Mâhayâna-Lehre und ist die Grundlage anderer Wissenbereiche. Will aber jemand das absolute Verstehen der ‚Leerheit’ erlangen, so muß er über das begriffliche hinausgehen.“ 348 Madhyamakakārikā, XXV, 24, Übertr. Schumann, op. cit., S. 67: „Zurruhekommen aller Wahrnehmungen, Zurruhekommen der Vielheit, Heil (-das ist Nirvâna).“ 125 obwohl in der Regel lange Übung (jap. Zazen) voraussetzend, ereignet sich „blitzartig“349 wegen der auf Konditionalität beruhenden Verfasstheit von allem350, wie auch wegen ihrer notwendigen Zeitlosigkeit, und sie ist daher mit der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten (jap. Kenshô) identisch. Das Absolute aber, im Begriff der `Leerheit` als Wesen der Vielheit bestimmt, kann unmöglich als unterschieden, geschweige denn als getrennt von dieser gedacht werden351, weswegen gleichzeitig mit dem Gewahrwerden der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten die unmittelbare Anwesenheit bei der erscheinenden Vielheit folgt, verstanden als der gewöhnliche Vollzug des Alltäglichen352. - 349 Die unmittelbare Anwesenheit beim Absoluten, begriffen als `Geist` (citta), wird durch die Tatsache ermöglicht, daß die erscheinende Vielheit als dessen unmittelbare Manifestation erkannt und entsprechend den Entfaltungsstufen derselben als das Speicherbewußtsein (ālayavijñāna), dessen individueller Träger (manas) und das jeweilige Sinnesbewußtsein (vijñāna) begriffen wird. Entstehen alle Sinnesgegenstände als willentliche Objektivierung der im Speicherbewußtsein vorhandenen Inhalte mittels der Reflexion des als Denken (manas) bestimmten Trägers353, so ist die Identifikation mit der Vgl. dazu: Hui Hai, op. cit., S. 137 ff. 350 Madhyamakakārikā, XXIV, 18, Übertr. Schumann, op. cit., S. 60.: „Das Konditionale Entstehen ist es, was wir Leerheit nennen. Sie ist ein synonymer Begriff und sie ist der mittlere Weg.“ 351 Madhyamakakārikā, XXV, 19 f, Übertr. Schumann, op. cit., S. 67: „Es gibt keinen Unterschied des samsâra vom Nirvâna; es gibt keinen Unterschied des Nirvâna vom Samsâra. Der Gipfelpunkt des Nirvâna ist auch der Gipfelpunkt des Samsâra. Zwischen den beiden gibt es auch nicht das mindeste (das sie trennt).“ Darauf aufbauend das Koan 19, Mumonkan, S. 114.: Jôshû fragte Nansen in allem Ernst: „ Was ist der WEG?“ Nansen antwortete: „Der alltägliche Geist ist der WEG.“ 352 Vgl. dazu: Hakuun Yasutani Roshi, op. cit., S. 15 f.: „Obwohl manche Patriarchen ihre Vollendung durchs Sitzen (Zazen) manifestiert haben, können wir sie durch Gehen oder Schlafen ausdrücken – durch alle unsere Tätigkeiten. Manche Menschen beklagen ihre alltägliche Situation, können daher die Vollkommenheit des Augenblickes nicht einschätzen. Immer denken sie egoistisch und finden deshalb keine Zufriedenheit. Solche Menschen sind einfach Dummköpfe.“ Vgl. auch: Yoka Daishi, Shodoka, in: Geh den inneren Weg, hrsg. W. Jäger ( Kô-un Ken Roshi), Freiburg 1999, S. 116.: „Gehen ist Zen, Sitzen ist Zen, Sprechen oder Schweigen, Bewegung oder Ruhe...“ 353 Vgl. dazu: Hui Hai, op. cit., S. 136: 126 so entstehenden und damit vereinzelt erscheinenden Vielheit das Nichterkennen des Geistes als Ganzes, mithin Ursache der Unterscheidungen und der Unterschiede354 und als solches Täuschung355. Sind die irrtümlich als wesenhaft erkannten Objekte nichts anderes als die Projektionen des Denkens „aus dem Denk-, Seh-, usw. (-bewußtsein)“356, so liegt allein in dessen Aufhebung das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten, begriffen als `Geist`. Obwohl der Begriff des „Denkens“ innerhalb der von der Vijñānavāda-Schule inspirierten Zen Meister eine Präzision seiner Positionierung erfährt357, ist der Weg zu seiner Aufhebung mit dem der vorausgehenden Tradition weitgehend identisch, indem in der Regel meist nach einer harten358 Übung (Zazen) mit einem Kôan die Identifizierung mit der Bewußtseinstätigkeit durchbrochen wird359. Der unmittelbaren Anwesenheit beim `Geist` folgt notwendigerweise die unmittelbare Anwesenheit bei jedem sinnlich begreifbaren Objekt, der erst jetzt, in der Reihenfolge seines Erscheinens und daher „1. Phänomene jeglicher Art existieren nur in dem, was wir, mangels eines besseren Ausdrucks, als Geist bezeichnen. 2. Der Geist ist gleichbedeutend mit der höchsten Realität, die der Erscheinung der Phänomene zugrunde liegt. Diese höchste Realität ist nichts anderes als der Bodhi-Geist oder Geist eines Buddha.“; Lankāvatāsūtra, 3, 33. Übertr. Schumann, op. cit., S. 79: „Es gibt keine sichtbaren (Objekte), die Außenwelt ist Geist (citta), darum sieht man eine Vielfalt (citra). Körper, Besitz und Umwelt sind nur Geist, so sage ich.“ 354 Vgl. dazu: Hui Hai, op. cit., S. 136: „5. Da die Phänomene geistiger Natur sind, folgt daraus, daß Unterschiede (...) falsch sind...“ 355 Sagāthaka, 218, Übertr. Schumann, op. cit., S. 79: „Was man sieht, ist der eigene Geist, es gibt kein äußeres Objekt (artha). Wer (mit dieser Einsicht) die (Welt als) Täuschung durchschaut, der erkennt damit die Soheit." 356 Sagāthaka, 872, Übertr. Schumann, op. cit., S. 84. 357 Das Denken ist jetzt nicht nur wie im Hînayâna der sechste Bereich der Sinnesorgane (âyatana), sondern denen hierarchisch übergeordnet und damit zweite Bedingung ihrer Entstehung. Vgl. dazu Sagāthaka, 269. 358 Die Härte und auch Dauer des Zazen sind relativ und richten sich einzig und alleine am Grad der Identifizierung mit dem Ich im Vollzug des Denkens und dem vom Zen-Meister erkannten Wunsch wie auch Begabung, diese zu lösen. Vgl. dazu: Die Vitas der ZenMeister in: Dumoulin, Geschichte des Zen-Buddhismus, Bd.I und II, Bern/München 1985. 359 Vgl. dazu oben Anmerkung 304 dieser Arbeit. 127 unterschiedslos, wahrgenommen werden kann360. Ist aber die unmittelbare Anwesenheit beim `Geist` mit der bei der erscheinenden Vielheit identisch, so folgt der Aufhebung der zweiten konsequent die Aufhebung der ersten, weil deren gewollt werden nichts anderes ist als die Konsequenz aus der Identifikation mit der Vielheit. Damit ist das Nirvâna, genauso wie Samsâra, nur eine Vorstellung und Begriff361. Im Ergebnis setzen beide Traditionen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten jeweils die Aufhebung der irrtümlicherweise mit dem Aufkommen des Denkens stattfindenden Identifikation mit demselben voraus. Weil aber alles, mithin auch das Absolute im Begriff der `Buddhaschaft, der `Leerheit`, des `Geistes` und des `Nirvâna` nichts anderes sein kann als eine weitere Vorstellung und damit letztlich Ursache einer erneuten Identifikationsmöglichkeit, wird verständlich, weshalb das Zen diese niemals benutzt, wiewohl aber voraussetzt362. Äußerlich betrachtet und damit geschichtlich gedacht führte die Entwicklung innerhalb des Mâhayâna zu einer starken intellektuellen Auseinandersetzung um die jeweiligen Begrifflichkeiten, und auf der populären Ebene der Volksreligiosität nicht selten zum Kult der jeweiligen Sûtras363. 360 Vgl. dazu: Shunruyu Suzuki Roshi, Zen-Geist Anfänger-Geist, Zürich 1996, S. 97: „Was immer ihr auch tut, selbst Nichts-Tun, das ist unsere Praxis. Es ist ein Ausdruck des Großen Geistes. Deshalb ist der Große Geist etwas, das auszudrücken ist, nicht aber etwas, das auszudenken ist.“; Hui Hai, op. cit., S. 142.: „Personen verschiedenen Geschlechtes und jeder Art von Phänomenen betrachten ohne Anhaften, ohne Abneigung oder Unterscheiden unter ihnen...“ 361 Lankāvatāsūtra, 2, 146. Übertr. Schumann, op. cit., S. 90: „(Auch) Nirvâna ist (nur) Traum. Nichts ist erkennbar, daß im Samsâra (der Wiedergeburt unterworfen wäre), und nichts kann je (im Nirvâna) verlöschen.“ 362 Dazu exemplarisch: Engo Kokugon Roshi, Bi-yän-lu, Bd. I, Leipzig 1980, S. 240: „Weil Worte nur Gefäße und Stützen sind, um den Weg, die Wahrheit zu tragen: Die Leute verstehen eben einfach nicht, wie die Alten es tatsächlich meinten und suchen nur immer im Wortlaut herum. Was werden sie da wohl für eine Nase zum Anfassen finden ?“ 363 Hier sei an eine der zahlreichen Kritiken Mumons gegen die Vertreter der Gelehrsamkeit erinnert: Mumon Ekai, op. cit., S. 51: „Möge eure Beredsamkeit auch dahinfließen wie ein Strom, es ist ohne Nutzen. Und könntet ihr auch die Gesamtheit der Sutren erklären, es brächte keinen Gewinn.“; Grundsätzliches zum Gebrauch der Begriffe im Zen: Engo Kokugon Roshi in: op. cit. Bd. I, S. 133.: „Die Alten (Meister) sind nicht so leichtfertig wie die Menschen von heute. Die denken nicht daran, auch nur ein Wort, ein halbes Sätzchen an Gewöhnliches zu wenden. Wenn einer an dem Aufbau unseres Lehrgutes arbeitet, so setzt er damit das Leben Buddhas fort, und darum schneidet er mit jedem Wort, mit jedem 128 Das „Erreichen“ der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten, als die Essenz der Sutras, geriet deshalb in Vergessenheit, weswegen das Aufkommen des Zen, im Sinne seiner Eigendefinition, das Aufkommen der buddhistischen Essenz schlechthin wie auch gleichzeitig die Weise der Erinnerung des Weges ihrer Erlangung ist364. Auf Grund seiner Voraussetzung und der Bestimmbarkeit der Durchführbarkeit seines Inhalts kann das Eigenverständnis des Zen als Mystik begriffen werden. In der Tatsache dieser möglichen Bestimmbarkeit des Zen liegt die gesuchte allgemeine begriffliche – damit auch wissenschaftliche- Grundlage, wonach beide Größen, das Zen und das Werk Eckharts, dem Eigenverständnis ihres Inhaltes nach überhaupt erst miteinander verglichen werden können. Die Bestimmbarkeit dieser allgemeinen Grundlage der Vergleichbarkeit macht das Nachdenken der zur Untersuchung anstehenden Konkretion, nämlich der Ich-Struktur im Zen, nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll, liegt doch in der begrifflichen Bestimmung der so abgeleiteten Konkretion das Unterschiedliche wie auch das Gemeinsame. halben Sätzchen, das er spricht, ganz unwillkürlich den anderen Menschen in der Welt die Zunge ab. In solch ein Wort hinein kannst du dir keinen vorsätzlichen Weg bahnen, kannst du es mit deinem ichbefangenen Gefühl nicht deuten, es hilft dir nichts, dich auf vernünftige Erwägung einzulassen.“ 364 Dazu: D.T. Suzuki, Leben aus Zen, op. cit., dort das Vorwort. 129 V. DER BEGRIFF DER ICH-STRUKTUR IM ZEN-BUDDHISMUS Indem die Schulen des Buddhismus im allgemeinen und das Zen im besonderen die Substanzhaftigkeit aller Erscheinungen negieren, mithin auch dem wie auch immer gedachten „Ich“ jegliche Wesenhaftigkeit absprechen, müssen sie jedoch gleichzeitig und notwendig das Vorhandensein einer Struktur voraussetzen und damit auch anerkennen, welche die wenn auch irrtümliche, so doch mögliche Annahme einer sich als „Ich“ begreifenden Erscheinung anzunehmen erlaubt. Weil das Zen aber in seiner Orthodoxie einzig und alleine darauf ausgelegt ist, die unmittelbare Anwesenheit bei der als `Leerheit` beziehungsweise `Geist/ Bewußtsein` begriffenen absoluten Einheit zu erreichen, muß er diese als der Vielheit immanente Größe bestimmen, da sie sonst gegen die Vielheit begrenzt und damit nicht absolut gedacht werden könnte, wiewohl auch das Erreichen einer wie auch immer gedachten Größe, ein `AußerhalbSein` dieser, mithin eine Doppelung wenn nicht konstruieren, so doch suggerieren würde, was innerhalb des auf die Einheit bestimmten Denkens auf das Gleiche hinausläuft. Die Immanenz der absoluten Einheit in der Vielheit gründet im Zen (im Anschluß an die Mahāyāna-Tradition) im Begriff der `Wesenlosigkeit` (Skt. anātman) der zweiten, die damit der absoluten Einheit gegenüber als kein `Etwas` gedacht wird, somit keinerlei Doppelung aufweist und dadurch ein Gegenüber im Sinne der Dualität überhaupt nicht aufkommen läßt. Eben im Begriff der Wesenlosigkeit - der keinesfalls gleichgesetzt und damit verwechselt werden darf mit dem der Realitätslosigkeit 365 - der erscheinenden Vielheit gründet zum einen ihre Vergänglichkeit, welche die Ursache des Leidens ist, zum anderen aber und gleichzeitig ermöglicht dieser Begriff die Aufhebung der erscheinenden Vielheit und erweist sich 365 Ein jegliches Kôan unterscheidet zwischen der Realität der erscheinenden Vielheit und der auf Spekulation gegründeten Annahme einer Substanz, welche dieser zugrunde liegen sollte. Das Hervorbringen und vor allem die Identifikation mit der zweiten ist es, welche überwunden werden muß, um die „Soheit“ der Dinge zu erkennen. Vgl. dazu: Dōgen Zenji, Shinjingahudō, in: Shōbōgenzō, Bd. I, Zürich 2000, S. 35: „Als er (Zen-Meister Sôzan) vollständig erleuchtet war, konnte er durch Schlamm waten und mit schmutzigem Wasser bespritzt werden, ohne aus der Fassung zu geraten. Er akzeptierte einfach Schlamm als Schlamm und schmutziges Wasser als schmutziges Wasser. Er war ein freier Mann, frei von Vorstellungen von Mögen oder Nicht-Mögen. Diese Kraft kommt vom NichtAnhaften.“; S. 34: „Wir müssen sehr sorgfältig unterscheiden zwischen der Realität und den Ideen über Realität.“ 130 damit als die notwendige Bedingung für die unmittelbare Erscheinungsweise der Einheit selber, die erhaben über jegliche Doppelung (ist diese immer schon wesenlos) keinerlei Vermittlung bedarf, wäre diese doch dem Begriff nach wiederum nur als Doppelung denkbar und als solche Vielheit, damit erneut als wesenlos zu bestimmen, mithin nichts anderes als wiederum die unmittelbare Manifestation des Einen. Der Zen-Buddhismus setzt daher die immer nur als gegenwärtig denkbare unmittelbare Anwesenheit der Einheit bei der Vielheit seinem Inhalt voraus, weswegen er die Umkehrung, nämlich die der Vielheit bei der Einheit, überhaupt erst vollziehen kann. Der erste Teil der Begriffsbestimmung der Mystik, angewendet auf das Zen, erweist sich daher als eine Art von Monismus und wird in der Form der begrifflichen Grundlage dem Vollzug des Inhalts (zweiter Teil der Begriffsbestimmung) vorausgesetzt366. Daraus folgt, daß die wie auch immer gedachte Struktur, die zur Entwicklung einer Ich-Identifikation führen kann, zum einen – weil Doppelung – wesenlos gedacht werden muß, zum anderen aber gleichzeitig und aus dem gleichen Grund als die unmittelbare Manifestation des Absoluten begriffen wird, der dieser die unmittelbare Anwesenheit bei sich deswegen gewähren kann, da sie, jetzt aus der Perspektive der Einheit gedacht, niemals aufgegeben worden ist, selbstverständlich auch dann nicht, wenn diese nicht vollzogen wird367. Daher kommt der Ich-Struktur im Zen keinerlei Möglichkeit einer Selbstidentifikation zu. Käme sie der notwendigen Voraussetzung einer Wesenhaftigkeit gleich, die nirgendwo gedacht und damit auch erkannt werden kann, ist die Wesenlosigkeit nicht nur das Merkmal der Vielheit, 366 Vgl. dazu: Hakuun Yasutani Roshi, op. cit., S. 29 f. 367 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 86.: „Die wahre Natur des Absoluten ist etwas, daß uns nie verloren geht, selbst nicht in Momenten des Irrtums, noch wird sie von uns im Augenblick der Erleuchtung gewonnen.“; Hakuun Yasutani Roshi, op. cit., S. 27: „Das typische und auch falsche Verständnis des ´Ichs` ist aus der Perspektive der BuddhaNatur gleichwertig mit dem Nichtverstehen eben dieser Buddha-Natur. Weil diese ohne ein `Ich` ist, kann nichts außerhalb ihrer als ein unabhängiges Ganzes existieren. (...) Es ist einfach so, und deswegen kann die Welt monistisch, beziehungsweise als die Welt des einen großen Kreises verstanden werden. So ist die wirkliche Welt, in der alle Erscheinungen die der Buddha-Natur sind.“ 131 sondern durch die Substantivierung des Begriffes `leer` (śūnya) zur `Leerheit` (Śūnyata) das Absolute schlechthin368. Im Zen wird damit nicht eine zuvor erkannte Wesenlosigkeit der eigenen Person beispielsweise zu Gunsten einer wesenhaft vorausgesetzten Einheit aufgegeben: es wäre die zweite in solch einem Zusammenhang nichts anderes als ein größeres Ganzes, mithin ein Etwas und als solches die Perpetuierung der Dualität schlechthin369. Die Wesenslosigkeit der Ich-Struktur kann damit niemals als ein frei gewordener „Ort“ bestimmt werden, den das Absolute besetzen kann, weil dadurch sofort und notwendigerweise beide, das Absolute und die Vielheit, wenn auch subtil, so doch gegenständlich gedacht werden müßten, sondern sie ist immer schon die permanente Erscheinungsweise des Absoluten selbst, eben weil dieses als wesenlos an sich gedacht wird. Müssen die Vielheit und somit die Ich-Struktur als wesenlos begriffen werden, so schafft das Zen, durch die Tatsache der Anwendung der gleichen Begrifflichkeit auf das Absolute hin, der Form nach die Identität beider, dem Inhalt nach ihre vollständige Aufhebung370. Gerade im Wissen um die Wesenlosigkeit nicht nur der Vielheit im allgemeinen und der Ich-Struktur im besonderen, sondern auch des Absoluten an sich erscheint sowohl die Eigendefinition des Zen wie auch der Inhalt der Begriffsbestimmung der Mystik als bedürftig in dem Sinne und Umfang, wie es deutlich wird, daß eben mit dem Aufkommen der Sprache und damit des Denkens die Dualität ihren Anfang genommen hat371. 368 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein, in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 15: „Unsere eigentliche Buddhanatur ist in Wahrheit nichts, das begriffen werden könnte. Sie ist leer,...“ 369 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein, in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 20: „ Es ist nur zu befürchten, daß Schüler des Weges sich erlauben mögen, nur einen einzigen Gedanken von etwas zu fassen, das absolute Existenz besitzt und so ein Hindernis errichten zwischen sich und dem Wege.“ 370 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein, in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 20: „ Es gibt keine Form, die auch nur von einem Augenblick zum anderen dieselbe bleibt. Es gibt nichts, das eine absolute Existenz hat von einem Moment zum anderen. So ist die Buddhanatur. (...). Das Aufgeben von Jeglichem ist der Dharma, und derjenige, der das versteht, ist ein Buddha, aber das Loslassen von allen Täuschungen läßt keinen Dharma mehr sein, der ergriffen werden könnte.“ 371 Vgl. dazu: Daio Kokushi, Über Zen, in: Geh den inneren Weg, op. cit., S.97: „ In der Absicht, Blinde anzuziehen, ließ Buddha seinem goldenem Munde spielerische Worte entspringen; seitdem sind Himmel und Erde überwuchert mit dichtem Dornengebüsch.(...) 132 Ist aber innerhalb der Zen-Orthodoxie das durch Begriffe sich vollziehende Denken diejenige Struktur, welche einzig und alleine in der Lage ist, eine Selbstidentifikation zu vollbringen und dadurch das Ich als Begriff hervorzubringen, so folgt daraus, daß nicht primär das Denken, sondern die mit seinem Vollzug einhergehende Möglichkeit der Identifikation der Ursprung aller dualen Wirklichkeitssicht und damit ihre Mißdeutung ist372. Hat der Mahāyāna diesen Sachverhalt bereits erkannt, ist aber aus der Sicht des Zen in der begrifflichen Weiterentwicklung desselben steckengeblieben und damit inhaltlich gesehen in der Aufrechterhaltung der Dualität, hat das Zen mit dem Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten als Inhalt seinen Ursprung in der Hinwendung auf die Aufhebung der Identifikation mit dem Gedachten, welche auf Grund der konditionalen Wechselverhältnisse innerhalb der Reflexion des Denkens gleichzeitig die Aufhebung der Ich-Identifikation nach sich zieht373. Kann daher der Umstand der Aufhebung der Ich-Struktur keinesfalls begrifflicher Natur sein, so verdankt diese ihre systematische Entwicklung innerhalb der Zen – Literatur zunächst dem Interesse einiger weniger Meister, und wenn das der Fall gewesen ist, dann wiederum einzig und allein aus dem Grund, die Übung zur ihrer Aufhebung möglichst präzise darlegen zu können. Diese Tatsache wird vor allem für die Blütezeit des Zen im Osten verständlich, konnten die Meister bei Bedarf die Kenntnis besagter Strukturen, die vor allem gleichzusetzen ist mit der Kenntnis der Hauptsutras des Mahāyāna, voraussetzen. Erst die Begegnung des Zen mit der westlichen Kultur innerhalb des 20. Jahrhunderts führte dazu, daß die Vertreter vor allem der von Daiun Sôgaku Harada Roshi begründeten Schule den Aufbau der IchStruktur innerhalb ihrer Teishos wegen der neuen Zuhörerschaft- und nicht der Wichtigkeit des Themas wegen – etwas genauer entwickelt haben374. Wenn ihr euch danach sehnt, die donnernde Stimme des Dharma zu hören, gebt eure Worte auf, entleert eure Gedanken ...“ 372 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein, in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 21: „Die Menschen haben Angst ihren eigenen Geist zu vergessen, indem sie fürchten, durch die Leere hindurch hinunterzustürzen mit nichts, woran sie sich halten könnten. Sie wissen nicht, daß die Leere in Wirklichkeit nicht leer ist, sondern das wahre Reich des Dharma.(...) Ein einziger Gedanke und ihr trennt euch von der Wirklichkeit.“ Dazu auch: Seng-t`san, Shinjin-Mei, in: Geh den inneren Weg, op. cit., S. 140: „Je mehr Worte und Gedanken, desto weiter entfernt von der Wirklichkeit.“ 373 Vgl. dazu: Madhyamakakārikā, XVIII, 6. 374 Vgl. dazu: Daiun Sôgaku Harada Roshi, in: P. Kapleau, Drei Pfeiler des Zen, Bern 1981, S. 429 f.; Hakuun Yuasutani Roshi, op. cit., S. 27 ff. Auf dem Entwurf seines Vorgängers und Meisters, Harada Roshi, widmet Yasutani Roshi der Ich-Struktur vier nacheinander 133 So kann daher beispielsweise, beginnend bei den klassischen KôanSammlungen und dem „Shōbōgenzō“ des Dōgen Zenji bis hin zu den Teishos zeitgenössischer Zen-Meister, eine auf der Prajnāpāramitāhrdayasūtra basierende präzise und für die Übung der Aufhebung derselben vor allem innerhalb einer buddhistischen Kultur ausreichende Andeutung der besagten Struktur gefunden werden, während die auf den Erkenntnissen der Vijňānavāda-Schule basierende Ich-Struktur, vor allem des verwendeten Hauptbegriffes „vijňana“ (Bewußtsein) wegen, ihre Renaissance im Zuge der Ausbreitung des Zen innerhalb der westlichen Kultur gefunden hat375. 1. Der Ich-Begriff der Prajnāpāramitāhrdayasūtra Immer dann, wenn innerhalb der Zen-Orthodoxie die Wesenlosigkeit aller erscheinenden Vielheit als „Leerheit“ gedacht wird, greift diese auf die Bestimmung dieses Begriffes zurück, wie er innerhalb der Tradition des Herz–Sutra (Prajnāpāramitāhrdayasūtra) herausgearbeitet worden ist. Der bipolaren Logik der Sprache- und nicht der „Sache“ wegen setzt der Leerheitsbegriff des Herz–Sutra den der „Form“ voraus, wobei er nicht als dessen Ursache gedacht wird mit der Folge, daß sich dann die „Leerheit“ als Bezeichnung des Absoluten zu der „Form“ als Bezeichnung der erscheinenden Vielheit etwa wie Schöpfer zum Geschaffenen und damit kausal verhält, sondern das Erscheinen des Begriffes der “Leerheit“ bedingt das gleichzeitige Erscheinen (auch dann, wenn dieses nicht ausgesprochen wird) seines Gegenteils, der „Form“ und umgekehrt, ist daher diesbezüglich konditional gedacht376. Was der Sprache nach als getrennt erscheinen muß, folgende Teishos innerhalb eines für die westlichen Schüler gehaltenen Sesshins. Diese werden im Kap. 2, S. 104 dieser Arbeit untersucht. 375 In der Tatsache, daß der buddhistische Begriff „vijňāna“ mit „Bewußtsein“ übersetzt wird, liegt die Quelle zum einen einer möglichen Annäherung an das diesbezüglich vorhandene, wie auch sich stark entwickelnde Gedankengut des Westens, zum anderen aber zahlreicher Mißdeutungen, die dadurch entstehen, daß unter den vermeintlich als identisch vorausgesetzten Wortlaut unterschiedliche Konzepte subsumiert werden. Zur Kritik dieses Ansatzes: Seung Sahn, Strzepując Popiół na Buddę, Warszawa 1990, S. 11; 14 ff. 376 Zu bedingten Entstehung der Begriffe vgl.: Nāgārjuna, Madhyamakakārikā, II ff. 134 ist der Sache nach, so die Zen-Orthodoxie weiter, notwendigerweise eins, ist doch die Wesenlosigkeit der Form identisch mit der Bezeichnung des Absoluten und dieses daher wiederum und notwendigerweise identisch mit der Weise der erscheinenden Vielheit 377: „Sariputra, Form ist nichts anderes als Leere, Leere nichts anderes als Form. Form ist wirklich Leere, Leere wirklich Form.“378 Wird des Weiteren die erscheinende Vielheit der begrifflichen Analyse unterzogen, so läßt sie sich in fünf Aggregatzustände (Skt. Skandha) unterteilen, von denen das dynamische Zusammenspiel aller auch eine im ständigen Prozeß sich befindende Ich-Struktur hervorbringt379. Obwohl die einzelnen Skandhas als gleichwertig untereinander erkannt werden und erkannt werden müssen – sind sie nur alle zusammen auf Grund ihrer konditionalen Wechselwirkung untereinander als das Aufkommen der IchStruktur bestimmbar -, so werden sie im Zen, ohne die Gleichwertigkeit aufzuheben, auf das Erscheinen des Ich-Bewußstsein hin hierarchisch geordnet, weil erst mit dessen Vorhandensein – die Möglichkeit der Anhaftung, welche als das Auseinanderbrechen der ursprünglichen Einheit in Erscheinung tritt, gegeben ist 380. Dieses Ich-Bewußtsein wiederum kann 377 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 21: „Die Leere und der Dharmakaya sind nicht voneinander verschieden, und ebenso steht es mit den lebenden Wesen und den Buddhas, der phänomenalen Welt und dem Nirvana oder der Täuschung und der Bodhi.“ 378 Prajnāpāramitāhrdayasūtra, in: Geh den inneren Weg, op. cit., S. 77. 379 Die fünf Skandhas sind: 1. Materie oder Form (Skt. Rūpa); 2. Empfindung oder Gefühl (Skt. Vedanā); 3. Wahrnehmung, Vorstellung oder Idee (Skt. Samjňā); 4. Wollen (Skt. Samskara); 5. Denken oder Bewußtsein (Skt. Vijňāna). Vgl. auch: Dōgen Zenji, Makahannyaharamitsu, in op. cit., S. 28.; Ausführlich: Samyutta-Nikâya, XXII, 48.; XXII, 18-20 und 97. 380 Wichtig für das Aufkommen des Ich-Bewußtseins ist die Tatsache der wechselseitigen Beziehung aller fünf untereinander, denn für sich alleine genommen ist die Materie (erstes Skandha) die Erscheinungsform der leblosen Materie, im Wechselverhältnis mit Wollen (Selbsterhaltungstrieb und viertes Skandha) aber schon das Aufkommen der Pflanzen und einzelner einfacher Lebewesen usw. Vgl. dazu: Hakuun Yuasutani Roshi, op. cit., S. 28 f.: „Betrachten wir diese Einteilung unter dem Gesichtspunkt der Bewußtseinsentwicklung, bei den leblosen Gegenständen beginnend, über Pflanzen, pflanzenfressende Tiere, fleischfressende Tiere bis hin zu dem Menschen, so wird die Tatsache offensichtlich, daß mit der Zunahme des Intellektes die duale Wahrnehmung ebenfalls zunimmt. (...) Leider akzeptiert die Mehrheit von uns die scheinbare Dualität zwischen dem Ich und dem Nicht- 135 nicht als eine von den anderen Skandhas getrennte und unabhängige Größe gedacht werden, müsste es damit doch zwangsläufig substanziell und somit wesenhaft bestimmt sein, was innerhalb des Buddhismus überhaupt – auf Grund der prinzipiellen „nicht-ein-Ich“- (P. an-atta) Einsicht Buddhas – ein Widerspruch gegen die Drei-Merkmale-Lehre (P. tilakkhana) wäre381. Daher wird von der Zen-Tradition, so sich diese der Begrifflichkeit des HerzSurtas bedient, zunächst konform mit der Mahāyāna-Tradition durch den konditional verstandenen Prozeß der gegenseitigen Bedingtheit der fünf Skandhas untereinander erklärt. Gerade der Konditionalität wegen werden die Skandhas als gleichzeitig und gemeinsam auftretend derart gedacht, daß die Körperlichkeit (erstes Skandha) immer schon und immer nur als Bedingung der Empfindung (zweites Skandha), beide als Bedingung der bildlichen Vorstellung und ihrer begrifflichen Ableitung (drittes Skandha) bestimmt werden, die ihrerseits die Bedingung für die positive oder negative Reflexion des Willens darstellen, um letztlich, und das wiederum in Begriffsform, als Ich im Denkbewußtsein aufrechterhalten zu werden (fünftes Skandha)382. Der Begriff des Ich-Bewußtseins im Zusammenhang der Prajnāpāramitāhrdayasūtra erweist sich somit als durch das Anhaften bedingte gänzliche Identifikation mit dem begrifflichen Ergebnis eines unbeständigen, weil substanzlosen Prozesses der gegenseitigen Bedingtheit der fünf Skandhas, die damit, so die Zen-Orthodoxie weiter, den ersten der drei Leiber des Buddha, den Nirmānakāya, verkörpern383. Sind die Ich. Wir können diesen Dualismus nicht durchschreiten, um die Wahrheit zu erblicken. Weil unser Verstehen begrenzt ist, unterliegen wir einem Irrtum, indem wir glauben, daß der Kampf zwischen dem Ich und einem Nicht-Ich instinktiv sei.(...) Die, welche dieser Illusion unterliegen, sind wie Menschen, welche, wenn sie zwei Hände sehen, die um ein Stück Papier auseinander zu reißen, sich in gegensätzliche Richtungen bewegen, auf Grund dessen was sie sehen glauben, daß zwei getrennte Dinge (Hände) gegeneinander wirken und vergessen dabei das Wichtigste, daß trotz allem diese zwei Hände zu einer und derselben Person dazugehören.“ 381 Diese sind: Unbeständigkeit (P. anicca), Leiden (P. dukkha) und nicht-das-Ich (P. anattâ). Vgl. dazu: Anguttara-Nikâya, III, 134. 382 Vgl. dazu: Bi-Yän-Lu, op. cit., Bd. I, S. 244. 383 Damit unterscheidet sich die im Zen vorgenommene Interpretation der Drei-LeiberLehre der Mahāyāna-Tradition fundamental von ihrer ursprünglichen Deutung, die sich explizit auf die Buddhas bezogen hat. Sie ist säkularisiert worden und bezeichnet das IchBewußtsein eines jeden Menschen, entsprechend seinem Erkenntnisstand. Dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein in: Meditations-Sutras des MahayanaBuddhismus, op. cit., Bd. II, S. 30 f.: „ Der Sambhogakaya und der Nirmanakaya, beide antworten mit Manifestationen, die mit dem Stand des Verständnisses der verschiedenen 136 Skandhas, für sich gedacht jeweils als substanzlos bestimmt worden, so muß das Ich-Bewußtsein es ebenfalls sein, kann die Summe der substanzlosen Komponenten niemals eine substanzielle hervorbringen. Was dem auf diese Art entstehenden Ich-Bewußtsein als Bedrohung der Aufrechterhaltung seiner erscheinenden Existenz vorkommen muß, erwies sich aber schon im Vorfeld als das Absolute schlechthin, daß dadurch die Tatsache, die unmittelbare Anwesenheit bei sich selber zu gewähren, überhaupt erst ermöglicht384. Ist aber die im Begriff der „Leerheit“ bestimmte absolute Einheit mit der Wesenlosigkeit der Ich-Struktur und deren Bewußtseins identisch, erscheint zunächst der Nachdruck seitens der Zen-Meister, das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit bei dieser vollziehen zu sollen, da bereits vorhanden, widersprüchlich, wenn nicht gar sinnlos, weswegen auch ein Erreichen- beziehungsweise Erkennenwollen von vorneherein und ebenfalls mit Nachdruck verneint wird, „weil es nichts zu erreichen gibt“385. Mit der zweiten Feststellung fügt das Zen dem ersten Widerspruch einen zweiten hinzu, markiert aber zugleich den Ort der Aufhebung beider und meint damit den irrtümlichen Glauben des Ich-Bewußtseins an seine eigene Substanzhaftigkeit, die im gleichen Denkakt eine solche beim Gegenüber voraussetzen muß, kreiert das Bestehen auf eigener Wesenhaftigkeit notwendigerweise zeit- und raumgleich die einer nicht eigenen Wesenhaftigkeit, von der die Abgrenzung hat stattfinden können. Ist aber der Inhalt des Ich-Bewußtseins immer nur ein Denkobjekt, mithin ein Begriff, ist der Glaube im Sinne des Anhaftens an ein substanzielles Ich Individuen übereinstimmen.“; Vgl. auch: H.W. Schumann, Buddhismus. Ein Leitfaden durch seine Lehren und Schulen, Darmstadt 1973, S. 83: „Der Zen (...) deutet die DreiLeiber-Lehre in interessanter Weise um. Er nimmt an, daß alle Erdenwesen an allen Drei Leibern teilhaben. Nirmānakāya sei jeder, soweit er einen Körper besitzt...“ 384 Vgl. dazu Anmerkung 344, S. 124 dieser Arbeit. Ein über die fünf Skandas hinausgehende Bewusstsein, ist damit immer schon ein Nicht-Ich-Bewußtsein, in folge notwendigerweise a-temporär und eines diesem zugrundeliegendes. 385 Prajnāpāramitāhrdayasūtra, in: Geh den inneren Weg, op. cit., S. 77. Dazu der ZenMeister Hui Hai in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S.145: „Der Ausdruck Erleuchtung wird nur im relativen Sinne gebraucht. In Wirklichkeit kann sie nicht erreicht werden, und so gibt es keine solchen Zustände wie vor und nach der Erleuchtung. Da sie nicht erreicht werden kann, so gibt es nichts, das darüber gedacht werden kann.“ 137 das Aufrechterhalten einer rein begrifflichen Identität, weshalb auch das gleichzeitige Setzen eines Gegenübers ebenfalls rein begrifflicher Natur sein muß, weswegen diese Identität logischerweise niemals durch einen erneuten Denkvorgang und damit einen Begriff aufgehoben werden kann386. Den ersten Widerspruch, nämlich das Erreichen-Müssen der niemals aufgehobenen unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten, erklären die Zen-Meister dadurch, daß die sprachlich nachvollziehbare Erkenntnis des Monismus als die Erkenntnisweise der bipolaren Logik, somit der Vollzug des diskursiven Denkens und damit wiederum ein Begriff, nichts anderes sei als die Anhaftung an die Dynamik der Skandhas und eben dadurch das Aufrechterhalten des die Scheindualität verursachenden begrifflichen IchBewußtseins387. Gerade weil der Vollzug des Denkens identisch mit der permanenten Hervorbringung von Begriffen ist und diese Substanzhaftigkeit und damit Dualität suggerieren, ist jeglicher Versuch der Gleichstellung von begrifflicher Erkenntnis und der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten absurd, setzt der Begriff der Einheit diese zwangsläufig dem der Vielheit vor, indem er in beiden Fällen Substanzhaftigkeit vortäuscht388. 386 Vgl. dazu: Vajracchedikā-Prajñāpāramitā-Sūtra, in: Meditations-Sutras des MahayanaBuddhismus, op. cit., Bd. I. S. 44: „Deshalb soll jeder Jünger, welcher Anutara-samyaksambodhi sucht, nicht nur Begriffe vom eigenen Selbst, anderer Selbste, lebender Wesen und Universalselbst verwerfen, sondern auch alle Ideen über solche Begriffe und ebenso alle Ideen über die Nichtexistenz solcher Begriffe.“; dazu auch: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 23: „Nur durch vollständiges Entfernen sämtlicher Objektsbegriffe kann der wahre Dharma verstanden werden.“ 387 Exemplarisch dazu sei auf die Teishos des zeitgenössischen Zen –Meisters Genpo Merzel Roshi hingewiesen. Vgl. dazu: Dennis Genpo Merzel Roshi, Oko nigdy nie spi, Warszawa 1995, S. 9. 388 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 60 f.: „Wenn ihr euch mit solchen objektiven Begriffen täuscht, werdet ihr einen Buddha erkennen, aber in diesem Falle wird euch der Buddha ein Hindernis! Und ebenso, wenn ihr lebende Wesen erdenkt, werden diese euch hemmen. (...) Erst wenn ihr euch von der ganzen Folge der dualistischen Begriffe von der unwissenden und weisen Kategorie befreit habt, werdet ihr zuletzt den Titel eines Transzendentalen Buddha verliehen bekommen.“; damit richtet sich das Zen nicht nur gegen die Lehre und Praxis der Theravada-Anhänger, sondern auch gegen jegliches SutraStudium und daher gegen die große Tendenz des Mahayana. Dazu: Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 128 f.; Seng-t`san, Shinjin-Mei, in: Geh den inneren Weg, op. cit., S. 140: „Auch nur ein Wort von richtig und falsch Und der Geist ist in Wirren verloren...“. 138 Wird dieser Sachverhalt erkannt, so ist in Folge leicht einsehbar, weswegen innerhalb der Begrifflichkeit der Prajnāpāramitāhrdayasūtra der Gegenstand der Erkenntnis- und der Willensausrichtung - sei er auch noch so erhaben und absolut – notwendigerweise aufgehoben worden ist, wäre sonst sein begriffliches Vorhandensein identisch mit dem Aufrechterhalten des dritten Skandha, welches eine andere Form seiner eigenen gegenüber setzend (erstes Skandha), diese als leidlos empfände (zweites Skandha), darauf wiederum den Willen ausrichtete (viertes Skandha) und somit zusammen im Bewußtsein (fünftes Skandha) die Bedingungen des Anhaftens an das in dieser Weise selbsthervorgebrachtes Ich weiterhin und auf Grund der konditionaler Wechselwirkung aller Skandhas untereinander mithervorbringen würde389. Wegen der wechselseitigen Konditionalität der Skandhas genügt die Bindung an einen einzigen Begriff, die gesamte Ich-Struktur hervorzubringen und damit die Identifikation mit dem Ich-Bewußtsein aufrechtzuerhalten. Aus aus dem gleichen Grund ist es möglich, so die ZenOrtodoxie weiter, durch die Aufhebung eines der Skandhas die gesamte IchStruktur und damit die Ich-Bindung aufzuheben. Die Wahl des zur Aufhebung vorgesehenen Skandha ist nicht zufällig, sondern wiederum das Ergebnis der Einsicht in ihre Konditionalität, setzt daher die unmittelbare Anwesenheit beim Absoluten voraus, geht somit der Tradition nach auf den historischen Buddha zurück390 und wird wie folgt entfaltet: Die direkte Aufhebung des Körpers (erstes Skandha) ist unmöglich, weil der Wunsch danach immer schon eine Willensäußerung ist. Er setzt damit die Aufrechterhaltung des vierten Skandha voraus und zwar derart, daß die Stärke einer asketischen Übung gleichzeitig eine ebensolche des Willens bedingt. Bei dem Versuch der Aufhebung der Empfindungen (zweites Skandha) und des Willens (viertes Skandha) geschieht dasselbe, sind doch beide Tätigkeiten, also Bedingungen eines Willensaktes. Da aber sowohl der Körper, die Empfindungen wie auch der Willem als solche erkannt werden müssen, bevor sie überhaupt aufgehoben werden können, mithin die Ableitung eines Begriffes zulassen müssen, sind sie notwendige Bedingungen für das Aufrechterhalten des Denkens (drittes Skandha), 389 „ Weil es das Eine gibt (als Begriff), existieren die zwei, doch halt auch nicht fest an dem einen.“ Zitat aus: Seng-t`san, Shinjin-Mei, in Geh den inneren Weg, op. cit., S. 140. 390 Der Aufhebung des Wissens liegt ein Nicht-Wissen zugrunde, welches unmöglich begrifflicher Natur sein kann und deswegen, folgt man der ersten Lehrrede Buddhas, mit der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten identisch sein muß. 139 welches im Vollzug der Begriffsbildung den Inhalt des Bewußtseins (fünftes Skandha) bildet. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Aufhebung der gesamten IchStruktur einzig und allein mit der Aufhebung des Denkens (drittes Skandha) vollziehbar ist, kann nämlich nur dieses der direkten Aufhebung unterzogen werden391, wodurch die Form (erstes Skandha) als begrifflich gesetztes Gegenüber aufhört ein solches zu sein und damit die Bindung der unterschiedlichen Empfindungen aufhebt (zweites Skandha), die wiederum als Zielausrichtung für den Willensakt (viertes Skandha) bestimmt diesen zur Ruhe, somit ebenfalls zur Aufhebung bringen. Weil damit das Bewußtsein (fünftes Skandha), welches immer nur als Bewußtsein eines Begriffes in Erscheinung treten kann, leer ist, wird auch dieses aufgehoben392. Die unmittelbare Anwesenheit bei der absoluten Einheit ist damit der permanente Ist-Zustand der Wirklichkeit, verdeckt durch das Anhaften an nur einer der beiden Weisen ihrer Manifestation393, denn: „Entweder vernachlässigen die Sprecher die Wurzel und reden von den Zweigen, oder sie vernachlässigen die Realität der `illusorischen` Welt und sprechen nur von der Erleuchtung. Oder auch schwatzen sie über kosmische 391 Der Versuch einer direkten Willensaufhebung ist unmöglich, bleibt ein Nicht-Wollen immer ein Wollen, mithin ein Willensakt, der zudem und wie die Formulierung es auch schon andeutet, immer von einer begrifflichen Vorlage abhängig ist, die seine Ausrichtung bestimmt. Deswegen ist ein Wollen ohne ein gleichzeitiges Denken unvorstellbar (weil beides letztlich Begriffe sind), wiewohl das Denken ohne ein Wollen durchaus denkbar ist, wie auch ein Nicht-Denken im Nachhinein! ebenfalls. Dazu: Seng-t`san, Shinjin-Mei, in Geh den inneren Weg, op. cit., S. 140: „Ruhe und Unruhe kommen aus der Illusion, Erleuchtung kennt weder Vorliebe (Wollen) noch Abneigung (Nicht-Wollen).“ 392 Vgl. dazu: Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 118: „Wenn ihr nur jeden einzelnen Gedanken vor dem Aufsteigen zurückhalten könntet, dann würden Erkennen und eure körperlichen Sinne verschwinden zusammen mit ihren Objekten und den Empfindungen, die diesen Objekten ihre Entstehung verdanken.“ 393 Vgl. dazu: Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern, in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 129: „ Als sich die Lotusblume eröffnete und das Universum sich entfaltete, entstand die Dualität des Absoluten und der Welt der Lebewesen, oder besser, das Absolute erschien in zwei Aspekten, welche zusammengenommen die wahre Vollendung ausmachen.(...) Deshalb gibt es für die Lebewesen solche Gegensatzpaare wie Entstehen und Vergehen usw. Hütet euch davor, an einer Hälfte eines Paares zu haften.“ 140 Aktivitäten, die zu Veränderungen führen, während sie die `Substanz`, woraus sie entspringen, vernachlässigen – wahrlich, aus der Diskussion entsteht nie ein Gewinn.“394, während sich im unmittelbaren Gewahrwerden dieser Tatsache das Zen vollzieht395. Ergibt sich aus dem Gesagten, daß die Ausführung des Zen keine vermittelnde Übung sein kann396, da diese, wie auch immer verstanden und umgesetzt, die Anhaftung an der Dualität aufrechterhalten müsste, ist deswegen das Zen und seine Praxis mit dem „Zazen“ identisch397, dessen Ausübung die Tätigkeiten des Alltags398 aus dem Zustand des „NichtDenkens“ vollzieht399, wodurch das Zazen „...nicht das Mittel zur Erleuchtung (ist); Zazen selbst ist das vollendete Handeln Buddhas. Zazen ist reine, natürliche Erleuchtung.“400. Der Begrifflichkeit der Prajnāpāramitāhrdayasūtra folgend ist das Gewahrwerden der „Leerheit“ der eigenen Ich-Struktur identisch mit der 394 Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern in: Meditations-Sutras des MahayanaBuddhismus, op. cit., Bd. II, S. 100. 395 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein, in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 100: „Der Buddha ist nicht erleuchtet, noch sind die lebenden Wesen unwissend, denn diese beiden Extreme haben in der Wahrheit keinen Platz. Und nun solltet ihr beginnen, den geeigneten Weg zur Erweckung, den zen, zu finden.“ 396 Vgl. dazu: Dōgen Zenji, Daigo, in op.cit., Bd. I, S. 60: „ Vor kurzem, während der Sung –Dynastie, gab es Mönche, die ihre Köpfe nicht rasierten und den Buddhismus nicht verstanden, auch wenn sie ihn viele Jahre lang studierten. Sie strebten andauernd danach, ein Buddha zu werden und warteten unaufhörlich auf die Erleuchtung, das für sie das Hauptziel des Buddhismus war. Was für vulgäre Leute! Sie hatten die wahren buddhistischen Lehren niemals kennengelernt und dachten, daß Erleuchtung als ein Resultat ihres Zazen komme.(...) – sie waren faul und nachlässig, verschwendeten ihre Zeit und verstanden den Buddhismus nicht.“ 397 Dōgen Zenji, Zazengi in op. cit., Bd. I, S. 61: „Das Studium des Zen bedeutet die Übung des Zazen.“ 398 Vgl. dazu: Dōgen Zenji, Zazengi in op. cit., Bd. I, S. 6: „Lerne vom Beispiel des fünften Patriarchen Kônin vom Berg Ôbei. Jede seiner Tätigkeiten, Tag für Tag, war eine Übung des Zazen.“ 399 Dōgen Zenji, Zazengi in op. cit., Bd. I, S. 62: „Die Form deines Zazen sollte so fest wie ein Berg sein. Denke `Nicht-Denken`. Wie? Durch Ausüben des `Nicht-Denkens`.“ 400 Dōgen Zenji, Zazengi in op. cit., Bd. I, S. 62. 141 Aufhebung des Denkens, wodurch der scheinbare und deswegen auch substanziell gedachte Zusammenhalt der übrigen Skandhas eben auf die Leerheit hin, weil aus der Leerheit her (Subjekt und Objekt der Handlung werden als identisch erkannt und dadurch aufgehoben), durchschaut wird401. Da aber der Aufhebung der Substanzialität der Ich-Struktur keinesfalls hat eine solche vorliegen können, ist das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten lediglich die Erkenntnis einer irrtümlichen Annahme einer solchen (Skrt. Māyā)402. Diese wird innerhalb des Mahayana als die transzendente, da diskursives Denken übersteigende Weisheit (Skrt. Prajnā) bestimmt und nicht selten gepriesen, während sie bei den ZenMeistern allenfalls ein Schulterzucken hervorruft403, ist nämlich ein Beharren auf „Weisheit“ wiederum nichts anderes als der Vollzug einer erneuten Begriffs- und Identitätsbildung, mithin die Fortsetzung der Aufrechterhaltung des die Dualität stiftenden Ich-Bewußtseins. Ohne die Realisierung der unmittelbaren Anwesenheit bei der „Leerheit“ sind Begriff und Anhaftung im Zen identisch, in seiner Folge das Ich real und die Wirklichkeit dual404. Der Augenblick des Vollzuges dieser ist deshalb wiederum identisch wie auch zeitgleich – da notwendigerweise zeitlos405 – mit der völligen Aufhebung der mit der Tätigkeit der Skandhas 401 Exemplarisch dazu: Dōgen Zenji, Ikkamyôju, in op. cit., Bd. I, S. 46: „ Jedoch erwartete er (der große Meister Sôischi) sicherlich nicht den `goldenen Fisch` (die Erleuchtung) zu fangen, der sich selber fängt.“; Und Seng-t`san, Shinjin-Mei, in: Geh den inneren Weg, op. cit., S. 140: „Das Subjekt ist Subjekt wegen dem Objekt das Objekt ist Objekt wegen dem Subjekt. Das Subjekt vergeht mit dem Objekt, das Objekt vergeht mit dem Subjekt.“ 402 Vgl. dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 60 f.: „ Der Besitz von Merkmalen gehört in die Welt der Illusion. Nur durch Begreifen, daß diese Merkmale keine solche sind, führt zum erkennen des Tathagata (Buddha).“ 403 Vgl. dazu vor allem das erste Koan des Bi-Yän-Lu, op. cit., Bd. I, S. 37 ff. 404 Der Ich-Begriff erzeugt nicht nur die äußere Scheindualität: Ich ein Anderer/ Anderes, sondern auch die innere, wie Leben und Tod. Dazu Zitat aus dem Teisho des Fumon S. Nakagawa, Roshi, in: Zen – weil wir Menschen sind, Berlin 1997, S. 133: „Ein Mönch fragte Unmon Zenji `Der Tod ist gekommen. Wie kann man ihm entgehen?` Unmon sagte: ` Wo gibt es ihn überhaupt? ` . Es ist das Ich des Menschen, daß sich den eigenen Tod mit Angst und Schrecken vorstellt. Aber in Wirklichkeit des jetzigen Augenblicks ist der Tod ein bloßer Begriff und eine Vorstellung jenseits der momentanen Wirklichkeit.“ 405 Zeit in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als das Ergebnis der begrifflichen Anhaftung an Vergangenes oder Künftiges und damit ihre Hervorbringung, immer schon 142 verbundenen Identität, nicht aber mit der Aufhebung der Skandhas an sich, so daß er im freien Gewahrwerden der sich manifestierenden Wirklichkeit seine Vollendung findet406: „Unsere ganze Aktivität hat ihre Wurzeln in der ewigen Natur des alltäglichen Geistes. Wir vergessen dies die meiste Zeit, aber Buddhas sind sich dieser Tatsache immer bewußt. Wenn wir dies nicht verstehen, werden wir nie die wichtige Bedeutung eines Nießens oder jedes anderen, scheinbar kleinen Ereignisses erfassen.“407 2. Der Ich-Begriff der Vijñānavāda-Schule Der zweite Begriff, mit dem innerhalb der Zen-Orthodoxie das Absolute bestimmt wird, ist „Bewußtsein“ (Skrt. Vijñāna) oder „nur Geist“ (Skrt. cittamātra), dessen Verständnis als Lehre (Skrt. Vijñānavāda) identisch ist mit der begrifflichen Entfaltung der Ich-Struktur, weswegen der Entstehungs- wie auch Aufhebungsprozeß der letzten anhand dieser Begrifflichkeit detaillierter und homogener hat nachgedacht werden können408. und immer nur bezogen auf die Aufrechterhaltung einer Ich-Subjektivität, mithin, genau wie diese, ein Irrtum. Ihre Aufhebung und die des Ichs ist daher identisch. Dazu: Dōgen Zenji, Daigo, in op. cit., Bd. I, S. 60: „ Das heißt alles, gerade jetzt, in der ewigen Gegenwart, ist die Große Erleuchtung.“ 406 Der irrtümlich angenommene Wahrnehmende ist aufgehoben worden, keinesfalls jedoch der Wahrnehmungsvollzug. Dazu: Dōgen Zenji, Shinjingakudô, in: op. cit., Bd. I, S. 36: „Dieser Geist kümmert sich nicht um vergangene oder zukünftige Welten – er ist fortwährendes Arbeiten jetzt, in der Gegenwart und beschäftigt sich selbst nur mit jedem neuen Augenblick.(...) Die alten Zeiten sind abgeschnitten und vergangen, Gegenwart und Zukunft existieren zusammen in jedem Moment. Halte deinen Geist in der Gegenwart. Wenn wir immer an das Vergangene denken, wendet sich unser Sehvermögen zur Vergangenheit hin und wird verzerrt.“ 407 Dōgen Zenji, Shinjingakudô, in: op. cit., Bd. I, S. 36. 408 Nimmt man das Lankāvatārasūtra als eines der wichtigsten Werke des Vijñānavāda und die beiden Ŝāstras des Zen-Patriarchen Vasubandhu, das Trisvabhāvanirdeśa und das Vijñaptimātratāsiddhi, als dessen Interpretationen, so stellt man fest, daß die dort entwickelte Erkenntnislehre nicht nur eine Ich-Struktur voraussetzt, sondern als Tätigkeit verstanden identisch mit dem Vollzug dieser ist. Das Lankāvatārasūtra und ihr Kommentar, 143 Versteht sich aber das Zen ausschließlich aus der Tatsache der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit, so kann die Ich-Struktur in ihrer Ganzheit nur dann als solche gesehen und in Folge begrifflich entfaltet werden, wenn diese Einheit, verstanden als Ganzheit, erreicht worden ist. Da die Einheit ihrer Absolutheit wegen weder verlassen noch gedacht werden kann, wird sie im Zen weder außerhalb noch innerhalb der IchStruktur angenommen, noch umgekehrt diese innerhalb oder außerhalb der Einheit vorgestellt, sind beide Konzepte und als solche immer schon Ausdruck der irrtümlichen Annahme einer dualen Wirklichkeit. Aus dieser Einsicht heraus lehrt die Zen-Orthodoxie anhand der Begrifflichkeit der Vijñānavāda-Schule die einzig übrig gebliebene Möglichkeit, nämlich den Vollzug des Absoluten im Relativen und des Relativen im Absoluten, begriffen als die einheitliche Entfaltung des Geistes oder des Bewußtseins409, was gegenüber der Prajnāpāramitā-Literatur einer Präzisierung der Terminologie gleichkommt, benennen die beiden Hauptbegriffe der Vijñānavāda-Schule nicht nur die Tatsache der Überschreitung der bipolaren Logik, sondern die Dynamik ihrer Manifestation aus dem Absoluten selbst410. das Vijñaptimātratāsiddhi des Vasubandhu, sind darüberhinaus nicht nur Bestandteil der Zen-Tradition auf Grund der Tatsache, daß Vasubandhu der Linie der Zen-Patriarchen angehört, sondern ihrer bis in die Gegenwart andauernden Lebendigkeit innerhalb der wichtigsten Zen-Schulen. Und so greift unter anderem die auf Daiun Sôgaku Harada Roshi zurückgehende Schule die oben erwähnte Entfaltung der Ich-Struktur auf und macht sie sich zu Eigen. Vgl. dazu: Anmerkung 371 auf Seite 132 dieser Arbeit. 409 Während das Mahayana durchaus dazu tendiert, die Erleuchtung außerhalb des Alltäglichen zu suchen und damit nicht zuletzt die Dualität aufrechterhält, hebt das Zen auch die äußeren Unterschiede in den „einen Geist“ auf. Exemplarisch dazu: Die Lehre des Huang Po vom UniversalBewußtsein in: Meditations-Sutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 20: „ Ob die Worte Bodhi und Nirwana sie nun auf übernatürliche Weise erreichen oder dies einfach ihrem Glücke gemäß geschieht, so werden sie die Buddhaheit erst nach drei unendlich langen Kalpas der Vorbereitung erlangen. (...). Aber sofort zur Tatsache zu erwachen, daß eurer eigner Geist wirklich der Buddha ist und daß es nichts zu ergreifen oder irgendeine Handlung auszuführen gibt – dies ist der höchste Weg und führt zum Buddha, der nichts anderes als das Absolute ist.“ 410 Lankāvatārasūtra, in: Meditationssutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. I, S. 92 ff. Während die Ich-Struktur der Prajnāpāramitā-Literatur von der Stufe der Skandhas direkt in die Leerheit und umgekehrt führt, ohne den Übergang selber genauer zu erforschen, liegt die Stärke der Vijñānavāda-Schule mitunter in der Benennung der Übergänge im Prozeß der Ich-Struktur Entfaltung. 144 Genau in dieser Art der begrifflichen Differenzierung gegenüber der Prajnāpāramitā-Literatur liegt der Fortschritt der Vijñānavāda-Schule, auf die und deren Konzepte die Zen-Meister mit der Verwendung ihrer Begrifflichkeit zurückgreifen und damit den Begriff der Ich-Struktur wie folgt entfalten: a. Stufe der relativen Ich-Identität Die Wechselwirkung der Skandhas untereinander, die in der Prajnāpāramitā-Terminologie das Ich hervorbringt und aufrechterhält, wird jetzt aus der fünften Skandha, dem Bewußtsein, heraus betrachtet und geordnet, in der Weise, daß den sechs Sinnesorganen, also dem Auge, dem Ohr, der Nase, der Zunge, dem Körper und dem Denken ein korrespondierendes Bewußtsein auf der einen und ein wahrgenommenes Objekt auf der anderen Seite zugeordnet wird. Während aus der Sicht der Zen-Meister die Hīnayāna-Schulen das Vorhandensein der Sinnesobjekte der Wahrnehmung voraussetzen und damit die Dualität aufrechterhalten411, die Prajnāpāramitā-Literatur wegen des alles überragenden Leerheits-Begriffes das Verhältnis dieser zu den Sinnesorganen vernachlässigt412, versteht der Vijñānavāda die Sinnesobjekte als „Manifestationen“ der ihnen entsprechenden Sinnesorgane413. Weil aber die Sinnesorgane im Normalfall der Täuschung unterliegen, den Wahrnehmungsvorgang dual auffassen, indem sie das Wahrgenommene der Wahrnehmung als gegeben voraussetzen und der Wahrnehmung wiederum 411 Eben in der Annahme des Gegebenseins der Objekte liegt bereits der Ansatz für die Aufrechterhaltung der Dualität, die im Kampf gegen diese irrtümliche Annahme nur noch verstärkt werden kann. Das Gleiche gilt demnach auch für die Fixierung auf den Begriff der „Leerheit“ Vgl. dazu: Dhyana Meditation für Anfänger, in: Meditationssutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit.,Bd. I, S. 326.; Schumann, Buddhismus – Ein Leitfaden durch seine Lehren und Schulen, Darmstadt 1973, S. 32 f. 412 Vgl. dazu: Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 86. 413 Dazu: Chu-Ch`an, in: Meditationssutras des Mahayana-Buddhismus, op. cit., Bd. II, S. 136: „Phänomene jeglicher Art existieren nur in dem, was wir, mangels eines besseren Ausdrucks, als Geist bezeichnen.“; vgl. auch: Lankāvatārasūtra, in op. cit., S. 92: „Die Geistessinne und ihr zentralisierter unterscheidender Geist sind mit der äußeren Welt verbunden, welche eine Manifestation desselben ist...“ 145 ein wahrnehmendes Subjekt unterstellen, verkennen sie die Beschaffenheit der erscheinenden Vielheit. Diese nämlich liegt den Sinnesorganen und dem dann in Folge notwendigerweise angenommenen Ich keineswegs zur Anschauung im Sinne eines Gegenüber vor, sondern kann wahrgenommen und unterschieden werden, nur weil sie gleichzeitig hervorgebracht wird. Das Wahrnehmen und Hervorbringen sind damit identisch, weswegen ein Gegenstand und das Sehen, der Ton und das Hören, der Duft und das Riechen, der Geschmack und das Schmecken, der Körper und die Berührung, damit die fünf ersten Sinnesorgane und ihre Entsprechungen, untrennbar zusammengehören und den konditionalen Prozeß der Entstehung der erscheinenden Vielheit erklären414. Wird die Entstehung der Vielheit mit ihrer Wahrnehmung als ein und derselbe Vorgang begriffen und notwendigerweise dynamisch verstanden, so ist die Vielheit ohne die Wahrnehmung und viceversa, die Wahrnehmung ohne die Vielheit nicht denkbar, weswegen eine permanente Entfaltung der Vielheit und die der Bestandteile der Ich-Struktur als identisch gedacht werden müssen415. Kann jedoch innerhalb der beschriebenen Tätigkeiten der ersten fünf Sinnesorgane lediglich von Eindrücken, keinesfalls aber von Erkenntnis die Rede sein, welche die einzelnen Eindrücke übergreifend und damit verknüpfend diesen übergeordnet sein müsste, wird verständlich, weswegen das Denken als sechstes Sinnesbewußtsein, seiner reflektiven Art wegen, die Eindrücke der fünf anderen, aber auch sich selber zum Gegenstand haben kann416. 414 Diese und die folgende Analyse beruhen auf dem Teisho III des mittlerweile zitierten Zen-Meisters Hakuun Yasutani Roshi (op. cit., S. 43 ff.) und untersuchen genauer die dort verwendeten Begriffe. Vgl. deswegen: Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 54.; Dōgen Zenji, Gabyō, op. cit., Bd. I, S. 109 ff. 415 Exemplarisch dazu Dōgen Zenji,Gabyō, op. cit., Bd. I, S. 112: „ So besteht eine Bananenstaude aus Erde, Wasser, Feuer, Wind, Luft, Herz, Geist, Bewußtsein und Weisheit – all das existiert in ihren Wurzeln, Stamm, Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten. (...).“ 416 Vasubandhu, Trisvabhāvanirdeśa, Übertragung von H. W. Schumann, op. cit., S. 95: „Dasjenige, was (als Person) erscheint, ist das Abhängige; (die Objektwelt), wie sie erscheint ist das Vorgestellte. (Das Abhängige) entsteht nämlich abhängig von Voraussetzungen; (das Vorgestellte) hat Dasein nur in der Vorstellung.“; Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 93: „Der unterscheidende Geist ist die Ursache der Geistessinne, ist ihre Stütze und mit deren Hilfe wird seine Tätigkeit fortgesetzt. Er beschreibt eine Welt von Objekten und ist ihr angehangen...“ 146 Und gleich den übrigen Sinnesorganen suggeriert zunächst auch das Denken das Gedachte als sein Gegenüber, damit beides als getrennt voneinander Existierendes417. Besteht aber die Tätigkeit des Denkens in der Ableitung von Begriffen, so ist seine Reflexion der permanent stattfindenden wahrnehmenden Hervorbringung oder hervorbringenden Wahrnehmung der erscheinenden Vielheit immer nur als Begriff möglich. Das gleiche gilt dann im Vollzug seiner Selbstreflexion, indem das sechste Sinnensorgan auf sich selber gewendet sich selber hervorbringt und dadurch gleichzeitig erkennt und als ein Ich begreift 418. Es ergibt sich: der Wahrnehmungs- und Hervorbringungsvollzug der ersten fünf Bewußtseinsorgane kann weder Dualität noch Einheit hervorbringen (wohl aber der Ungenauigkeit wegen vortäuschen), denn diese schließen als Begriffe die Erkenntnis und damit die Tätigkeit des Denkens mit ein. Die erscheinende Vielheit und die fünf Bewußtseinsorgane werden daher als Komponenten der Ich-Struktur erkannt und gleichzeitig als solche hervorgebracht durch die immer schon einer jeden solchen Aussage implizit enthaltenen Tätigkeit des Denkens419. Das Wahrnehmen, Hervorbringen und Erkennen sind daher Momente einer einzigen Bewegung, deren Vollzug, da Reflexion des Denkens, immer schon ein Ich als Begriff direkt hervorbringen (Selbstreflexion) oder indirekt implizieren kann, ist dieses Ich nichts anderes als Eigenname der Selbstreflexion selbst, mithin nur ein Begriff420. 417 Dōgen Zenji, Genjōkōan, op. cit., Bd. I, S. 25: „Desgleichen, wenn du versuchst, die Natur der Erscheinungen nur durch deine eigene verwirrte Vorstellung zu verstehen, wirst du fälschlicherweise annehmen, daß deine Natur beständig ist.“ 418 Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 56: „Dies kommt daher, daß die Unwissenden an Namen, Merkmalen und Ideen hängen. Da sich ihr Geist diesen Wegen entlang bewegt, nährt er sich von einer Menge von Objekten und verfällt dem Begriff einer Ich-Seele, und was dazu gehört,...“ 419 Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 53: „ ...hängen sie (die Unwissenden) an Begriffen von Sein und Nichsein, Einheit und Verschiedenheit, Zweiheit und Nichtzweiheit, Existenz und Nichtexistenz, Ewigkeit und Nichtewigkeit und vermeinen eine eigene Selbstnatur zu besitzen, welches alles von der Unterscheidung des Geistes herstammt...“ 420 Wie bereits aus den vorhergehenden Zitaten ersichtlich, ist dieses Ich-Verständnis nicht nur im Zen, sondern innerhalb der gesamten buddhistischen Tradition von fundamentaler Bedeutung. Deswegen auch hier exemplarisch: „Das Ich - es ist eine ausschließlich theoretische Konstruktion.“ Hakuun Yasutani Roshi, op. cit., S. 36. 147 Daraus resultiert wiederum, daß der Ich-Begriff, gleich allen anderen Begriffen, zunächst als das natürliche Ergebnis einer sich vollziehenden Reflexion des Denkens betrachtet wird, die im Denken allerdings – und das wiederum analog zu allen anderen Begriffen - die Möglichkeit der Annahme einer dem Ich-Begriff entsprechenden Ich-Substanz erlaubt421. Weil der IchBegriff mit dem des Denkens identisch ist und das Denken gleichzeitig Wahrnehmen, Hervorbringen und Erkennen in einem ist, käme die Annahme einer Ich-Substanz innerhalb eines Ich-Begriffes der Annahme einer Wahrnehmung innerhalb einer Wahrnehmung gleich, was absurd ist, weswegen die Zen-Meister für die Kritik dieser Ich-Substanz Annahme die härtesten Worte und Taten nicht scheuen, ist diese Annahme gleichwertig mit der Bindung an sie und dadurch Ursprung der dualen Wahrnehmung, die bei der Voraussetzung einer Substanz, notwendigerweise andere Substanzen voraussetzen und damit hervorbringen muß, können solche überhaupt nur in gegenseitiger Abgrenzung gedacht werden422. Auf dieser Stufe gedacht ist das Ich ein Prozeß der begrifflichen Identifikation und damit Bindung an die Wahrnehmung der selbst hervorgebrachten, jedoch irrtümlich substanziell gedachten Momente seiner eigenen Struktur. Weil aber Bindung an „Leerheit“ unmöglich entstehen kann, müsste nämlich diese als etwas, mithin substantiell gedacht werden, ist das Aufrechterhalten der Ich-Identifikation mühevoll und als solches Leiden, dessen Stärke immer in Proportion zu der Intensität der besagten IchIdentifikation erscheint 423. 421 Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 56: „Da sie töricht sind, verstehen sie nicht, daß alle Dinge wie eine Maya sind, wie die Spiegelung des Mondes im Wasser, daß es keine Ichsubstanz gibt, vorgestellt als eine Ichseele und was zu ihr gehört...“ 422 Die präziseste Ausführung zu diesem Thema enthält vor allem das Sokushinzebutsu des Dōgen Zenji, in op. cit., Bd. I. S. 40 ff., wo die aduale Erkenntnisweise aus der „Ein Geist ist alles“ – Lehre begrifflich entfaltet wird, ohne einen Widerspruch und das heißt Dualität aufkommen zu lassen. Die Verwirklichung besteht eben auch im erkennenden Vollzug der Wirklichkeit, weswegen nur die jeweiligen Extreme gemieden werden sollen, nämlich das „Zuviel denken“, mithin Substanzannahme und „zu wenig denken“ als das „Verpassen“ der Realität. 423 Auf die Tatsache des Leidens ist der gesamte Buddhismus gegründet (Siehe die erste Predigt Buddhas in Benares), wobei dessen Erscheinung sowie Aufhebung vom Zustand der Ich-Identifikation abhängen. Dazu Vasubandhu als Vertreter der besprochenen Schulrichtung: „An dem Kennzeichen, daß sie mit Leiden verbunden sind, sind das Vorgestellte (die Erscheinungen) und das Abhängige (das Ich) zu erkennen. Das Kennzeichen des Freiseins (vom Leiden) aber gilt als das Absolute.“ aus Trisvabhāvanirdeśa, op. cit., S. 98; Hakuun Yasutani Roshi, op. cit., S. 38: „Himmel und Hölle sind Produkte unseres Denkens.(...). Wenn wir aus der Ego-Illusion heraus leben, 148 Gleichzeitig und seiner direkten Berührbarkeit wegen gründet im Leiden die Möglichkeit der Wandlung, die mit der Einsicht in die wahre Beschaffenheit der Ich-Struktur und auf Grund ihrer Identität mit der erscheinenden Vielheit ebenfalls mit der Einsicht in diese identisch ist424. Erscheint damit die Ich-Identität als die Aufrechterhaltung und gleichzeitiges Hervorbringen des Ich-Begriffes in der Weise der Bindung an diese, so kommt die Einsicht in ihre Substanzlosigkeit ihrer Aufhebung gleich. Da der Ich-Begriff aber die unmittelbare Folge der sich vollziehenden Reflexion des Denkens ist, so ereignet sich seine Aufhebung stets mittelbar, als das Ergebnis der Aufhebung derselben425. Mit dem Vollzug dieser Aufhebung wird die als Nirmānakāya verstandene Ich-Identität eines jeden Menschen aus ihrer zeitgebundenen (da Vielheit) Relativität heraus-, in die zeitlose Identität mit ihrem eigenem Ursprung hineinversetzt und als Intuition (Skrt. Manas) beziehungsweise „Universalleib“ (Skrt. Sambhogakāya) bestimmt 426. sind unsere Handlungen egoistisch und alles außerhalb von uns wirkt feindlich. Das ist das Leben in der Hölle.“ 424 Ist das Leiden das Merkmal der Ich-gebundenen Person (vgl. dazu die Legende vom Gautama Buddhas viermaligen Ausritt) und der legendäre, wie auch fast immer der tatsächliche Beginn der Suche (vgl. dazu die Lebensläufe fast aller Zen-Meister), so ist auf Grund der absoluten Einheit die Ich-Erkenntnis mit der Welt-Erkenntnis identisch, daher zeitgleich und durch Ruhe des Geistes gekennzeichnet. Dazu Dōgens berühmte Worte: „Den Buddha-Weg zu erfahren bedeutet, sich selbst zu erfahren. Sich selbst erfahren heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt, sich selbst wahrnehmen – in allen Dingen.“, Genjōkōan, op. cit., S. 24. 425 Hier sei besonders auf die Wandlung der Methode der Ich-Aufhebung hingewiesen. Betonte das Hīnayāna das asketische Mönchtum, die Mahāyāna-Schulen die Rezitation und das Studium der Sutras, so versteht die Zen-Orthodoxie unter der Weltentsagung nichts anderes als die Aufhebung des diskursiven Denkens als Vollzug der Zazen–Übung. Dazu Dōgen Zenji, Shinjingakudō, in op. cit., Bd. I. S. 33. „Vielleicht denken manche Menschen, daß das Entsagen der Welt ein Absondern sei (ein Teilen der Welt in klösterlich und weltlich), aber das Betreten der Priesterschaft sollte ein Transzendieren des analysierenden Geistes sein. Dies ist die Stufe des `Nicht-Denkens`, jenseits aller egoistischen Erkenntnis.“. 426 Innerhalb des Zen erfährt die mahāyānische trikāya-Lehre eine fundamentale Umwandlung. Bezieht sie sich außerhalb des Zen ausschließlich auf die Wirkweisen der Buddhas, so bezeichnet sie innerhalb der Zen-Schulen die drei Stufen der Ich-Identität eines jeden Menschen. Die erste davon wird durch die zwei ersten Weisen des Wissens hervorgebracht, und zwar erzeugen die fünf ersten Wahrnehmungsarten, das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten das „Wissen der Selbstvervollkommnung“, die zusammen mit dem Wissen der Unterscheidbarkeit (sechstes Sinnesorgan) eben den Nirmānakāya darstellen. Die zweite Stufe wird als Identität mit dem universellen Wissen gleichgesetzt 149 b. Stufe der universalen Ich-Identität War die als Nirmānakāya bestimmte Ich-Identität eine zeit- und raumgebundene, weil diese hervorbringende Identifizierung mit dem Prozeß der gleichzeitigen Erzeugung ihrer erkannten Komponenten, so bleibt die Frage nach dem Ursprung der jeweiligen Bewußtseinsinhalte und damit der Ich-Identität deswegen weiterhin offen, suggeriert sie mit den Begriffen der Erzeugung und der Wahrnehmung, ebenso wie mit dem des Wissens ein kausales Verhältnis zu dem jeweils Erzeugten, Wahrgenommenen und Gewußten. Die Kausalität aber setzt Wesenhaftigkeit voraus, womit sie der Einsicht der Anatta-Lehre widerspricht.427 Kann dieser Einspruch mit dem Hinweis auf die absolute Gleichzeitigkeit des nur sprachlich differenzierbaren Vorgangs behoben werden, so setzt ein geschlossenes System wie das der zeitlich begrenzten Ich-Identität, der Konditionalität seiner eigenen Komponenten wegen, aus denen es sich zusammensetzt und, solange diese Wechselwirkung linear vorgestellt wird, eine sich selbst überdauernde Instanz voraus, eben im Begriff dieser Konditionalität selbst. Weil aber der Zeitbegriff, so er weiterhin linear vorgestellt wird, einzig mit dem Vollzug der Aufrechterhaltung des Nirmānakāya gedacht werden kann, ist seine Aufhebung mit der der linear gedachten Zeit identisch. Dieses geschieht auf Grund der Übung des NichtDenkens (Zazen), mit der die als substanziell, deswegen auch notwendigerweise statisch vorgestellte Ich-Identität fallengelassen wird428. (drittes Wissen), dessen Erreichen den als Sambhogakāya begriffenen Leib umfasst. Das vierte Wissen entspricht der Buddhaschaft. Vgl. dazu: Hui Hai, op. cit., S. 164 ff. 427 Vgl. S. 136, Anm. 378. 428 Daß es nur Zeit gibt, oder daß es überhaupt keine Zeit gibt – beide Aussagen haben nur deswegen einen relativen Aussagewert, sind sie jeweils Manifestationen zweier unterschiedlicher Standpunkte und damit Ergebnis einer bereits vollzogenen Identifikation mit einem von diesen und daher immer schon duale Auffassungsweise. Erst mit dem Vollzug der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten wird die wahre Ich-Dimension erfahren, deren Wesen die Nichtbindung auch an die Nichtbindung ist. Im Ergebnis erscheint die Zeit als Vollzug der Gegenwart von Augenblick zu Augenblick. Vgl. zum Thema Zeit: Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern, op. cit., S. 130: „Vermeidet den Irrtum, in Begriffen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu denken. Die Vergangenheit ist nicht verschwunden, die Gegenwart ist jetzt augenblicklich, die Zukunft wird nicht erst kommen.“; Dōgen Zenji, Uji, in: op. cit., Bd. I. S. 92: „Die vergangene Zeit wird in unserer gegenwärtigen Existenz erfahren. Sie scheint vorüberzugehen, aber die 150 Ohne die Annahme eines statisch vorgestellten Subjekts gibt es keinen Fluß der Zeit, wird die Wahrnehmung ihrer Bewegung immer nur gleichzeitig mit der Voraussetzung einer fixierten Bezugs-Identität reflexiver Art ermöglicht429. Der Zustand der Aufhebung der relativen Ich-Identität ermöglicht jetzt die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung aller Komponenten, deren gegenseitige Wechselwirkung mittels der ersten sechs Sinnesorgane alleine auf Grund der Anhaftung an eine vom Geist hervorgebrachte und erkannte Erscheinung, die jeweiligen, als Ich bezeichneten Identitäten aufkommen und vergehen läßt, was als Geboren werden und Sterben empfunden wird430. Das „Universalbewußtsein“ (Skrt. Ālayavijñāna) wird demnach als „Speicherbewußtsein“ – (und) weil zeitlos – (daher) aller jeweils in Erscheinung getretener wie auch noch auftretender Sinneseindrücke bestimmt und als achtes Sinnesbewußtsein verstanden431. Die Verbindung zwischen ihm und dem unterscheidenden Geist (sechstes Sinnesbewußtsein) wie auch den fünf anderen Sinnesorganen wird durch das nicht mehr begriffliche, weil nicht-duale, aber doch eine Art von Wissen und daher als Vergangenheit ist immer fortwährend in der Gegenwart enthalten. (...). Wenn die Zeit wirklich vorbeieilen würde, wäre das eine Trennung zwischen der Zeit und uns. S. 91: „Ein alter Buddha (Zen- Meister Yakusan) sagte einst: „ Sein-Zeit steht auf der höchsten Spitze des Berges und liegt auf dem Grunde des tiefsten Ozans, Sein-Zeit ist die Gestalt der Dämonen und Buddhas, Sein-Zeit ist der Stock eins Mönches, Sein-Zeit ist ein Hossu, Sein-zeit ist eine runde Säule, Sein-Zeit ist eine Steinlaterne, Sein-Zeit ist Taro, Sein-Zeit ist Jiro, Sein-Zeit ist die Erde, Sein-Zeit ist der Himmel.“ 429 Dōgen Zenji, Uji, in op. cit., Bd. I. S. 94: „Geist und Worte sind in Sein-Zeit.(...). Der Geist geht nicht und die Worte sind bereits da; der Geist ist bereits da, und die Worte können nicht gehen. Kommen kommt nicht von außerhalb, Nicht-Kommen ist bis jetzt nicht gekommen. (...). Die ganze Vereinigung von Sein-Zeit ist vollendete Handlung.“ 430 Hakuun Yuasutani Roshi, op. cit., S. 47: „Wenn wir sterben, so ist das lediglich der Tod der ersten sechs shiki, deren wir uns im Leben bedienen. Unser fundamentales shiki, die Quelle, also der Grund der Ich-Identität, geht nicht eine Verbindung mit der Geburt und dem Tod ein. Deswegen, sogar dann, wenn eine Atombombe explodieren würde, shiki sieben und acht wären davon nicht im Geringsten berührt.“ 431 Die Übersetzungen in diesem Zusammenhang entstammen der Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 92, und werden im Weiteren durch die von Hakuun Yuasutani Roshi verwendete Begrifflichkeit präzisiert. Vgl. dazu Anmerkung 371 und 405 dieser Arbeit. 151 Doppelung bestimmte „intuitive Bewußtsein“ Sinnesbewußtsein, Skrt. Manas) aufrechterhalten432. (eben das siebte Seiner verbindenden Funktion zwischen den gespeicherten und erscheinenden Sinneseindrücken wegen erweist es sich als der eigentliche Ursprung aller Phänomene, allen voran der Ich-Identität433. Aus diesem Grund wird bei der Übung der Aufhebung der relativen Ich-Identität die unmittelbare Anwesenheit und damit Identität mit dem intuitiven Bewußtsein als großes Hindernis auf dem Weg der Erlangung der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten gewertet, ist damit der Zugang zum Speicherbewußtsein geöffnet und die Überflutung der sechs ersten Sinnesorgane mit parapsychologischen Phänomenen (jap.makyo) möglich434. Als Doppelung aufgefaßt, ist das intuitive Bewußtsein ebenfalls der Konditionalität unterworfen; indem es nämlich den Inhalt des Speicherbewußtseins erkennt, bringt es diesen hervor und sich selber im Begriff des Universalleibes (Skrt. Sambhogakāya)435. Wird innerhalb der Mahāyāna-Schulen das „Speicherbewußtsein“ mit der absoluten Einheit gleichgesetzt, erfolgt dadurch die begriffliche Annahme einer Doppelung als Absolutes, da selbst im Falle einer konditionalen und nicht mehr kausalen Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Speicherbewußtsein (die Nummer acht) und dem relativen Bewußtsein (die ersten sechs zusammengenommen), vermittelt durch die Tätigkeit des intuitiven Bewußtseins (die Nummer sieben), eben ein solches Verhältnis notwendigerweise gedacht werden muß, das damit die duale Beschaffenheit seiner Komponenten voraussetzt. 432 Begriffübersetzung aus:Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 91; Zum Inhalt vgl. S. 92: „ Manas ist eins mit dem Universalbewußtsein auf Grund seiner Teilnahme am Transzendentalwissen und ist auch eins mit dem Geistsystem durch sein Verständnis für differenziertes Wissen. Manas besitzt keinen eigenen Körper noch irgendwelche Zeichen, durch welche es differenziert werden könnte.“ Darauf aufbauend: Hakuun Yuasutani Roshi, op. cit., S. 48: „Nummer sieben, shiki mana, wird zuweilen das shiki Übertragung genannt.“ 433 Hakuun Yuasutani Roshi, op. cit., S. 48: „ Es ist das shiki nummer sieben, das ein klares und determiniertes Ego-Bild enthält. Selbstverständlich besitzen wir ein Bewußtsein von diesem Ego im shiki nummer sechs, dieses ist aber zeitlich begrenzt.“ 434 Ausführlich dazu: Hakuun Yuasutani Roshi, Täuschende Erscheinungen und Empfindungen, in : P. Kapleau, Die drei Pfeiler des Zen, München 1979. S. 71 ff. 435 Vgl. dazu Anmerkung 397, S. 107 dieser Arbeit 152 c. Stufe der absoluten Ich-Identität Seiner Doppelung wegen kann weder der Begriff des Universalleibes noch der des Universalbewußtseins als Speicher verstanden wie auch die unmittelbare Anwesenheit bei ihnen mit dem Inhalt der Begriffsbestimmung der Mystik gleichgesetzt werden, weswegen die Zen-Orthodoxie auch innerhalb der Begrifflichkeit um eine erneute Präzisierung bemüht ist und es auch sein muß, basiert ihre eigene Tradition des „rechten Denkens“ auf der unmittelbaren Anwesenheit bei der absoluten Einheit und umgekehrt: die Anwesenheit manifestiert sich auch als diese Denkweise436. So differenziert das Zen hier erneut und versteht das von allem unberührte Universalbewußtsein als das Bewußtsein der „reinen und unverfälschten Natur“, beziehungsweise als das Bewußtsein des „wahren Ich“ (jap. shiki anmora und die Nummer neun innerhalb der Stufen der Ich-Identität), dessen Verbindung mit dem Speicherbewußtsein sehr „intim“ ist, auf Grund ihrer Fast-Identität437. Die neunte Bewußseinsstufe, als „Dharmakāya“438 begriffen, wird deswegen mit dem „Ocean“ verglichen, auf dessen Oberfläche und als dessen 436 Vgl. dazu: Hui Hai, op. cit., S. 144: „Abwesenheit von Gedanken bedeutet, sich nicht falschem Denken hinzugeben; es bedeutet nicht, daß kein richtiges Denken stattfinden soll .(...). Nicht-Hängen an diesen (dualen) Begriffen wird rechtes Denken genannt.“ Letztlich aber ist natürlich auch der Begriff des „rechten Denkens“, wie alle anderen auch, dualer Natur, weswegen „rechtes Denken“, Erleuchtung, unmittelbare Anwesenheit beim Absoluten synonym verwendet werden. dazu S. 145: „Rechtes Denken bedeutet nur an die Erleuchtung denken.“, und weil diese weder gedacht noch erreicht werden kann, ist die Ausrichtung der Reflexion des Denkens auf absolute Inhaltslosigkeit mit ihrer Aufhebung identisch. Und wird mit dieser vor allem das Erzeugen der dualen Scheinwirklichkeit durchbrochen, erscheint aus der Einheitsperspektive jedes Denken recht, da es immer nur als der unmittelbare Vollzug dieser erkannt wird. Vgl. dazu auch: Dōgen Zenji, Daigo , in op. cit., Bd. I, S. 59. 437 So Hakuun Yuasutani Roshi in: op. cit., S. 48: „Das Verhältnis zwischen dem shiki nummer acht und dem shiki nummer neun ist sehr nah und intim. Im Grunde genommen sind sie fast das Gleiche.“; während das Lankāvatārasūtra, op. cit., Bd. I, S. 92 ff., weil es diese Differenzierung noch nicht vollzogen hat, Gefahr läuft, im Absoluten Inhalte zu setzen und dadurch Dualität aufrechtzuerhalten. 438 Hui Hai, op. cit., S. 165. und Hakuun Yuasutani Roshi in: op. cit., S. 48. Weil Hui Hai mit dem Begriff des Dharmakāya das Absolute meint und Yasutani dieses mit dem neunten shiki gleichsetzt, erscheint die oben gemachte Verbindung sinnvoll. Vgl. dazu auch: Dōgen Zenji, Shinjingakudō, in op. cit., Bd. I, S. 32. 153 Oberfläche die zeitlose, wie auch relative Ich-Identität und durch diese die gesamte Vielfalt der Phänomene wie „Wellen“ erscheinen und vergehen439. Weil aber Wellen ihrer Eigennatur nach Wasser sind und nur ein anderer Ausdruck für dieses, ist jede Stufe der Ich-Identität nichts anderes als ein anderer Name für die immer gleichbleibende Buddhanatur440. Das Erreichen der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten ist daher identisch mit der sich vollziehenden neunten Bewußtseinsstufe, deren Gewahrwerden als „Buddhawissen“ den Dharmakāya erzeugt441. Ist aber das Absolute auf Grund seiner Erhabenheit über jegliche Doppelung kein Bewußtseinsinhalt und deswegen „absolute Leere und Stille“, so muß der Dharmakāya als das Gewahrwerden des sich vollziehenden Buddhawissens es ebenfalls sein, womit er dann dem Inhalt nach mit dem Leerheitsbegriff der Prajnāpāramitāhrdayasūtra übereinstimmt 442. Aus der Tatsache, daß der Vollzug der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten und das Absolute selber identisch sind und als Nicht-Doppelung bestimmt werden, ergibt sich als Folge für die Übung der Erlangung derselben die Absurdität ihrer Ausübung mit dem oben genannten Ziel443, weswegen diese und das Absolute ebenfalls von Anfang an als ununterschieden gedacht werden müssen444. 439 Das Sprachbild entstammt ebenfalls aus Hakuun Yuasutani Roshi, in: op. cit., S. 48. 440 Hakuun Yuasutani Roshi, in: op. cit., S. 49. 441 Der Form nach, da ebenfalls Begriff und damit Konzept, gilt auch für den Dharmakāya die Vijñānavāda-Begrifflichkeit. Vgl. dazu: Hui Hai, op. cit., S. 165: „Das vollkommene, alles erleuchtende Buddhawissen wird alleine den Dharmakāya erzeugen.“ 442 Hui Hai, op. cit., S. 165. 443 Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern, op. cit., S. 126, Abs. 53: „Wenn ihr behauptet, daß etwas übertragen wurde, so nehmt ihr an, daß der zweite Patriarch das Universalbewußtsein durch Suchen erreichte, doch noch so viel Forschen kann je dorthin führen.“ 444 Dōgen Zenji, Fragen und Antworten, op. cit., Bd. I, S. 176: „Es ist die Ansicht der Ungläubigen, daß Übung und Erleuchtung nicht eins sind. Doch die Übung selbst ist die Erleuchtung, und sogar der erste Entschluß, den Weg zu suchen, enthält bereits schon die vollständige und perfekte Erleuchtung. Es gibt keine Erleuchtung außerhalb der Übung. Dies zu erkennen, ist sehr wichtig. Da die Übung die Erleuchtung ist, hat die Erleuchtung kein Ende und die Übung keinen Anfang.“ 154 Wird die Übung als die Haltung des Nicht-Denkens im Sinne des NichtAnhaftens445 verstanden und aufrechterhalten, so überschreitet sie die begriffliche – und deswegen auch relative, da vom unterscheidenden Wissen hervorgebrachte – Ich-Identität auf die Universale hin, welche zwar nicht eine begriffliche, so doch eine intuitive Ich-Identität hervorbringend voraussetzt. Ist diese wiederum das Ergebnis einer bereits vollzogenen Anhaftung – und weil zeitlos, deswegen auch ihre Voraussetzung –, ereignet sich ihre Überschreitung in der Fortsetzung des Nicht-Anhaftens bis zum „blitzartigen“446, da zeitlosen Gewahrwerden des Absoluten, begriffen als Selbstidentität des Nicht-Anhaftens innerhalb der „Leerheit“. Erfolgt auch hier die Aufrechterhaltung der Übung, so wird zum ersten Male die unmittelbare Anwesenheit bei der erscheinenden Vielheit vollzogen, so ist aus dieser Perspektive betrachtet die erste nichts anderes als die Ermöglichung der zweiten, weswegen ihr Vollzug die Überschreitung im Sinne des Vergessens der ersten voraussetzen muß, um bei der ganzheitlichen Entfaltung der mit dem Leben identischen IchStruktur in der Form ihrer vielfältigen Identitäten und Identifikationen unmittelbar gegenwärtig sein zu können447. 445 Vgl. dazu: Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern, op. cit., 52, S. 126, Abs. 52. 446 „Blitzartig“ aber auch „plötzlich“ sind mit die am meisten Ausdrücke für dieses Ereignis. Exemplarisch dazu: Mumonkan, op. cit., S. 41; Beim Hui Hai ist dieser Begriff bereits im Titel seines, hier oft zitierten Werkes enthalten. 447 Dazu: Dōgen Zenji, Kuge, op. cit., Bd. I, S. 71: „Im wahren Buddhismus ist (...) ein Buddha jemand, der über die Erleuchtung hinaus gegangen ist.(...) Nirvana und Samsara sind die Blumen der Leerheit. Nirvana muß von allen Buddhas, Patriarchen und Schülern erreicht werden. Leben und Tod sind der wahre Körper des Menschen. Die Wurzel, Stengel, Zweige, Blätter, Blüten, Früchte und die Form jeder Blume sind Kuge (Blume der Leerheit). Kuge bringt seine Früchte aus der Leere hervor und pflanzt seinen Samen in den Himmel (der umfassenden Leerheit). Da die drei Welten ein Blumenblatt des blühenden Kuge sind, sind sie nicht verschieden. Kuge ist die wahre Form aller Erscheinungen; die wahre Form einer Pflaume-, Weiden-, oder Pfirsichblüte.“. Eine präzise und detaillierte Beschreibung der Entfaltung der Ich- und Welt-Struktur aus der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten folgt jetzt der umgekehrten Richtung ihrer Aufhebung und findet sich beim Hui Hai, in: op. cit., S. 165: „Fähig zu sein, jedes einzelne Atom ohne Empfinden von Liebe und Haß zu betrachten, bedeutet Leere der Unterscheidungen. Diese Leere der Unterscheidungen ist Universalwissen (Nummer sieben). Fähig zu sein, in die Sphäre sämtlicher Wahrnehmungsformen einzudringen und geschickt zwischen ihnen zu unterscheiden, ohne daß störende Gedanken auftauchen und so Freiheit von Täuschung erringen, bedeutet Wissen durch tiefes Beobachten (Nummer sechs). Fähig zu sein, sämtliche Quellen der Wahrnehmung (die fünf Sinne) zu benutzen, ohne deshalb an die Vielheit der Form zu glauben, bedeutet Wissen der Selbstvollkommenheit.“ 155 3. Ergebnis Obwohl das Zen seinem Inhalt nach einzig auf den Vollzug der unmittelbaren Anwesenheit bei der Einheit ausgelegt ist, erweist sich dieser Inhalt als Prozeß, der mit der begrifflichen wie auch tatsächlichen IchStrukur identisch ist, weil er es sein muß. Andernfalls wäre die begriffliche Behauptung einer absoluten Einheit, geschweige denn der Vollzug einer unmittelbaren Anwesenheit bei ihr, mit dem Setzen auch nur eines einzigen Unterschiedes in sich ein Widerspruch und damit das Zen weder als Mystik bestimmbar noch sein Anspruch universal vertretbar. Aus diesem Grund, der zugleich die Perspektive der Erkenntnis und damit der begrifflichen Entfaltung der Ich-Struktur ist, erklärt sich der einerseits freie, andererseits differenzierte und deswegen auch präzise Umgang der Zen-Meister mit der Ich-Begrifflichkeit ihrer eigenen Tradition, die nur dann eine Umwandlung erfährt beziehungsweise eine neue Darstellung findet448, wenn diese die Ein-Deutigkeit der Ausrichtung, wie auch gleichzeitig die der Entfaltung der absoluten Einheit – zuweilen subtil – so doch außer Acht läßt. Die innerhalb der Zen-Tradition mit der jeweiligen Identitätssstufe keinesfalls identische Darstellung der gesamten Ich-Struktur ergibt folgenden Begriff: Auf Grund der Identität mit dem Absoluten ereignet sich die gesamte IchStruktur als unmittelbares Gewahrwerden des Vollzuges ihrer jeweiligen Identität. 448 Hier sei vor allem auf die kommentierten Zeichnungen der zehn Ochsenbilder des ZenMeisters Kuo-An Shih-Yüan hingewiesen, dessen Wiedergabe der Erlangung der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten die gesamte Ich-Struktur mit ihren jeweiligen Identifikationsstufen bildlich und sprachbildlich darstellt. So entspricht das erste Bild der leidvollen Identifikation mit den erscheinenden Phänomenen, das dritte dem beginnenden Gewahrwerden ihrer Leerheit, das vierte dem Gewahrwerden der Einheit von Allem, verstanden als Identität mit dem zeitlosen Universalwissen, das fünfte bis siebente der Vertiefung dieser Einsicht, das achte der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten begriffen als Leerheit, das neunte der unmittelbaren Anwesenheit bei den erscheinenden Phänomenen und schließlich das zehnte dem Vollzug der eigenen Identität. Vgl. dazu: Die zehn Ochsenbilder, Pfüllingen 1986; Die Kommentare des Daiun Sogaku Harada Roshis zu den Briefen der Yaeko, in Kapleau, op. cit., S. 377 ff. 156 VI. DER VERGLEICH Sieht sich diese Untersuchung der Religionswissenschaft und wie auch der Philosophie verpflichtet, so kann die Wissensentfaltung auch innerhalb des Vergleiches selbst ihr eigenes Prinzip nicht verlassen. Dieses Prinzip, als sicherstes Wissen verstanden, bestimmt sich mit dem Aufkommen der Moderne als die sich vollziehende Selbstreflexion des Denkens, die damit, das „Ich“ als Begriff hervorbringend, das so erzeugte „Ich“ bei der Ableitung aller anderen Begriffe notwendigerweise aufrecht erhält und die Subjekt-Objekt-Spaltung erzeugt. Weil das Subjekt und Objekt Begriffe der sich mit ihnen vollziehenden ein und derselben Reflexion des Denkens sind, sind sie formal betrachtet – da jeweils Begriffe und gleichzeitig auftretend – als Begriffe gleich und aus dem gleichen Grund auch inhaltlich unterscheidbar. Dieser gegenseitigen Angewiesenheit zufolge ist der reine, von der Vielheit getrennt zu denkende Ich-Begriff auf der Stufe dieser Vielheit unmöglich zu vollziehen, ist er nämlich immer schon das Ergebnis der alle anderen Begriffe gleichzeitig ableitenden Reflexion des Denkens und immer nur als Unterschied zu diesen Begriffen denkbar, weswegen er diese gleichzeitig, bewußt oder unbewußt, als gegeben voraussetzen muß. Die selektive Auswahl der selbst abgeleiteten oder übernommenen Begriffe bildet dann den Prozeß der Hervorbringung, Zusammensetzung und Aufrechterhaltung der ihn ausmachenden Identität449. 449 Der von Descartes als „res cogitans“ abgeleitete Ich-Begriff (vgl. dazu Teil I dieser Arbeit), erfährt innerhalb des deutschen Idealismus das „Wie“ seiner Bestimmung. Die Reflexion des Denkens nämlich, von Kant als „Verstandeserkenntis“ bestimmt und der „Vernunft“ unterstellt, unterliegt dieser im Sinne seines eigenen a priori bei jeglichen Begriffsableitungen, so daß die jeweiligen Begriffe und mit ihnen der Ich-Begriff nicht die Ableitung vorhandener Gegenstände sein können, vielmehr sind diese Gegenstände die a priori Setzung der Vernunft und deswegen von der Reflexion des Denkens als Begriffe ableitbar und somit auch erkennbar. Damit existiert der Ich-Begriff, wie alle anderen auch, weder von diesen unabhängig, noch außerhalb der Reflexion des Denkens, die mit ihnen und an ihnen (gleichzeitig) ihr eigenes a priori erkennt und vollzieht. Vgl. Kant, Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, in Kant Werke Bd II, Darmstadt 1998, S. 26: „... weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfordert, dessen Regel ich in mir, noch eher mir Gegenstände gegeben werden, mithin a priori voraussetzen muß, welche in Begriffen a priori ausgedrückt wird, nach denen sich also alle Gegenstände der Erfahrung notwendig richten und mit ihnen übereinstimmen müssen. (...) daß wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen.“ S. 27: „ (...) wenn man annimmt, unsere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, richte sich nicht nach diesen, wie sie uns gegeben werden, richte sich nicht nach diesen, als Dingen an sich selbst, sondern diese Gegenstände vielmehr, als Erscheinungen, richten sich nach unserer Vorstellungsart...“. 157 Wenn dem so ist, kann von Objektivität des Absoluten niemals die Rede sein, ist jegliche Begriffsableitung Reflexion des Denkens und damit die Fortsetzung der Aufrechterhaltung der jeweiligen Ich-Identität, ganz gleich, ob diese wahrgenommen wird oder nicht. Daraus folgt, daß jeder Vergleich auf Grund der Beschaffenheit seiner beiden Konstanten der Reflexion des Denkens und der Begrifflichkeit immer schon die Selbst-Identität des Vergleichenden impliziert, weil er als Vollzug der Reflexion des Denkens diese hervorbringt und damit gleichzeitig auch aufrecht erhält. Eben diese Selbst-Identität des Vergleichenden ist dann, sei sie reflektiert worden oder nicht, das eigentliche tertium comparationis eines jeden Vergleiches450. So zeigt sich innerhalb des wissenschaftlichen Umfeldes der diese Arbeit betreffenden Thematik die implizierte Selbst-Identität in den Begriffen der Religion, der Mystik und in ihrer Folge in dem Begriff der absoluten Einheit, die in der oben beschriebenen Weise, als tertium comparationis, über den Ausgang der bereits unternommenen Vergleiche entschieden hat451. Diesen Sachverhalt differenziert Fichte weiter, und um die durch die Kantsche Setzung einer a priori eröffneten Möglichkeit des regressum ad infinitum zu unterbinden (eine Voraussetzung setzt immer eine Voraussetzung voraus), vereint er die Voraussetzung und den Vollzug in der „Tathandlung“ des Satzes: „Ich bin Ich“, weil das Ich, bevor es tätig erkannt wird, gar nicht existieren kann, muß es in dem zu sich Ich-Sagen erst entstehen. Diese „Tathandlung“ entspräche dem reinen Ich-Denken, das aber deswegen nicht vollzogen werden kann, setzt das Ich mit sich selbst gleichzeitig alles andere als sein Gegenüber mithin als Inhalt seiner Identität. Vgl. dazu: Fichte, Einleitung, S. 5 – 32 und Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, S. 33 – 100, beides in: Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, Hamburg 1975. 450 Unabhängig vom Begriff kann es niemals so etwas wie eine Erfahrung, auch nicht eine sogenannte Grunderfahrung geben, ist das Bewußtwerden einer solchen immer schon mit der Ableitung eines Begriffes identisch, der wiederum immer schon einer Ich-Identität entstammt. Deswegen ist ein oft gut gemeinter Versuch, innerhalb eines Dialoges diesen mit den gemeinsamen Grunderfahrungen beginnen zu lassen, identisch mit einem Dialog über die wie auch immer gemeinten Grundbegriffe. Vgl. dazu: Zur Hermeneutik des christlich-buddhistischen Dialogs vgl.: P. Schmidt-Leukel, Den Löwen brüllen hören, Paderborn 1992 und in Folge ein Kommentar dazu von M.v. Brück und Whalen Lai, in op. cit., S. 238 f. 451 Für die Buddhologen scheint die Ableitung eines tertium comparationis deswegen problematisch zu sein, sind im Buddhismus die philosophische Reflexion und die Religion aufs engste miteinander verbunden, so daß eine Meta-Position aus der Begrifflichkeit der eigenen Tradition wohl nicht ableitbar zu sein scheint. Vgl. dazu: Yoshinori Takeuchi, Das Schweigen des Buddha. Ein Problem der Religionsphilosophie des Buddhismus in: Die Philosophie der Kyôto-Schule, op. cit., S. 419 ff.; So reflektiert beispielsweise Ueda 158 innerhalb seines Vergleiches nicht das tertium comparationis der Selbst-Identität des Vergleichenden, entwickelt in Folge keinen Begriff, in dem die zu Vergleichenden hätten inhaltlich übereinstimmen können, und ist deswegen gezwungen, eine der beiden zu vergleichenden Größen – in seinem Fall das Zen – unbewußt, da eben unreflektiert, zum tertium comparationis seines Vergleiches zu nehmen. Der darauf folgende Vergleich verliert sich auch deswegen in der schwer begründbaren Gegenüberstellung formaler Begriffszusammenhänge, welche, bei der wirklichen Übereinstimmung oder Unterschiedlichkeit iherer Inhalte, niemals in den Rang eines tertium comparationis hätten gelangen dürfen. Die Behauptung: „Sowohl die negativ-theologische Erfassung der Transzendenz als auch die Rückkehr zur Weltwirklichkeit als realer Vollzug zur wahren Transzendenz sind im Zen Buddhismus viel radikaler und konsequenter durchgeführt als bei Meister Eckhart“ verdeutlicht das Gesagte, und ergibt das Urteil über die Radikalisierung einer konkreten Ausführung aus dem Zusammenhang ihrer eigenen begrifflichen Voraussetzung und nicht aus der Abgrenzung gegen ein bereits interpretiertes Fremdes. Ueda, op. cit., S. 146 ff.; Umfangreicher, doch der Struktur nach ähnlich gestalten sich diesbezüglich die Vergleiche D.T. Suzukis, der als Buddhologe ebenfalls kein tertium comparationis entwickelt, sondern innerhalb des Vergleiches des Zen zu Eckhart das tertium comparationis eindeutig mit der zen-buddhistischen Begrifflichkeit gleichsetzt. Weil auch in diesen Vergleichen das Allgemeinste, worin die beiden hätten übereinstimmen oder sich unterscheiden können, nicht bestimmt worden ist, kann niemals ein für beide Seiten annehmbares Ergebnis erzielt werden, indem eine der Konkretionen zugleich das tertium comparationis abgibt. Vgl. dazu: Meister Eckhart und Buddhismus in: Der westliche und der östliche Weg, Frankfurt 1995, S. 13 – 41.; Innerhalb der christlich-abendländischen Positionen ist bezüglich des Themas die Reflexion eines tertium comparationis möglich, ist die abendländische Philosophie doch niemals mit der Theologie des Christentums identisch. So gehört J. Sudbracks Bestimmung des Begriffes der „Meditation“ zu den Versuchen, ein im oben beschriebenen Sinne und damit die eigene Selbstidentität reflektierendes tertium comparationis abzuleiten. Nachdem der Autor den Begriff der Mystik (wegen der „Schwierigkeiten“ und „Voreingenommenheiten“) und den der Kontemplation (seiner christlichen Fixierung wegen) verabschiedet und sich für den der Meditation entscheidet, der „... nicht nur den Gang nach Innen, (...) sondern, ebenso auch das Schauen nach Außen ....“ umfasst, bleibt das eigentliche Problem weiterhin ungelöst. Auch wenn der Inhalt des von J. Sudbrack, auf Grund einer dualen Auffassung des tertium comparationis eine entsprechend andere Sicht, nämlich ebenfalls duale, des Sachverhaltes entfaltet und in Folge zu anderen Ergebnissen kommt, ist dem Ansatz, formal gesehen, zuzustimmen. Vgl. dazu: Meditative Erfahrung – Quellengrund der Religionen? Stuttgart 1994, S. 33 – 40, 128 ff.; Zum dualen Charakter des tertium comparationis: Mystik im Dialog, Würzburg 1992, S. 139 ff.: „Das Ziel des interreligiösen Gesprächs ist der ewige Gott in seinem Geheimnis...“. Es ist nicht vorstellbar, daß die Zen-Meister mit dieser dualen Auffassung, alleine der Form nach (über den Inhalt, also den Gottesbegriff, könnte man noch streiten), einverstanden sein dürften. Auch Lasalle, Zen und christliche Mystik, Freiburg 1986, sucht zunächst den Begriff eines tertium comparationis und greift den der Religion, Philosophie, Psychoanalyse und Mystik auf (S. 21-26), entscheidet sich zwar vor allem für den letzten, den er dann nicht ableitet, sondern am Beispiel der christlichen Mystiker inhaltlich entwickelt und damit unreflektiert voraussetzt (S. 263 ff.). Formal betrachtet lehnt sich sein 159 Ist damit ein Vergleich ohne die implizierte Selbst-Identität nicht möglich, da ihre Aufhebung mit der der Reflexion des Denkens identisch ist und wodurch der Vergleich ebenfalls aufgehoben worden wäre, so gibt es diesbezüglich nur eine entweder-oder Entscheidung: Entweder ist das Vergleichen mangels objektiver Begrifflichkeit zu unterlassen, oder aber es ist vorab die den Vergleich bestimmende Selbst-Identität zu bedenken, die als Prozeß verstanden Veränderungen unterliegen muß, weswegen sie dann um den laufenden Fortschritt der einzelnen Wissenschaften im Allgemeinen wie auch im Besonderen wissend sich der Vorläufigkeit des unternommenen Vergleiches bewußt ist. Aus diesem Grund sind zu Beginn dieser Untersuchung die Begriffe Religion, Mystik und absolute Einheit in der Weise abgeleitet worden, wie es das abendländische Denken zuläßt, weil sie formal wie auch inhaltlich betrachtet die Selbst-Identität des Vergleichenden ausmachen und so verstanden das tertium comparationis dieses Vergleiches bilden. Allem voran und mit der Ableitung des Begriffes der Mystik fand das jetzt als tertium comparationis verstandene Selbst seine begriffliche Identität und ermöglichte damit eine fragende Bewegung auf das eckhartsche Werk und das Zen, die als Konkretionen der Mystik diese Frage haben beantworten können. Daraus resultiert, daß ein sinnvoller Vergleich immer nur in Bezug auf ein zu vergleichendes Drittes vollzogen werden kann, weil dieses immer schon im Sinne der Selbst-Identität des Vergleichenden mitgedacht wird, was für diese Untersuchung - und damit inhaltlich gesehen – bedeutet, daß das eckhartsche Werk als Mystik mit dem Zen (ebenfalls als Mystik begriffen), nicht jedoch mit dem Buddhismus als Religion verglichen werden kann und umgekehrt. Als Folge davon kann das Zen mit dem Werk Eckharts oder Vergleich an die der japanischen Seite, ist das tertium comparationis immer schon die eigene (christliche) Mystik oder - seiner Tätigkeit als Zen-Lehrer wegen – das Zen, mithin eines der zu vergleichenden Teile. Im Ergebnis müssen dann einzelne Begriffe einer direkten Gegenüberstellung standhalten, womit das tertium comparationis, je nach Begriffspaar inhaltlich (da abhängig vom Begriffspaar) und formal (je nach Tendenz der Selbst-Identifikation des Vergleichenden) variiert und gänzlich relativiert wird. So ist beispielsweise der Direktvergleich zwischen der „gnadenhaften“ Erleuchtung (Christentum) und „natürlichem“ Satori (Zen) bereits durch den Gebrauch der Adjektive ein Ergebnis, welches als tertium comparationis einen Gottes- bzw Natur-Begriff voraussetzt, der, ohne eigens reflektiert worden zu sein, den Ausgang des Vergleiches bestimmt hat (S 332 ff.). Ähnliches geschieht mit dem Begriffspaar Zazen-Gebet (S. 457 ff.) 160 einem anderen als Mystik bestimmbaren Werk, keinesfalls jedoch mit dem Christentum begriffen als Religion, in einen sinnvollen Vergleich treten452. Ist aber mit dem Inhalt des Begriffes der Mystik zugleich der Begriff der absoluten Einheit abgeleitet worden, der die gesamte Untersuchung deswegen paradox erscheinen läßt, handelt es sich beim Absoluten zunächst um eine Bestimmung, die als Ergebnis der Reflexion des Denkens Doppelung ist und damit zu ihrem eigenen Inhalt im Widerspruch steht. Das ist die zu Beginn der Untersuchung angedeutete und jetzt gänzlich einsehbare Grenze dieses Vergleiches, bestimmt dieser Widerspruch formal wie auch inhaltlich die Selbst-Identifikation und damit das tertium comparationis dieser Arbeit dadurch, daß sich bislang die abendländische Wissenschaft einzig und alleine mit der Ableitung von Begriffen identifiziert und in Folge als scientia rationalis453 definiert hat. Aus dieser Tatsache resultiert, daß sich das Absolute, da per definitionem über jegliche Doppelung und daher über die scientia rationalis erhaben, niemals von dieser begreifen lassen kann, wiewohl es sich selbst und aus dem gleichen Grund als solche manifestiert. Dieser Gegebenheit wegen entspricht diese Untersuchung einer „Schwarzweißzeichnung“, innerhalb welcher die Zunahme an Wissen Schattierungen herausarbeiten kann, ohne jemals Farbe hinzufügen zu können, und das bei gleichzeitiger Voraussetzung ihrer unmittelbaren Anwesenheit. Weil mit dem Begriff der Mystik ein tertium comparationis hat bestimmt werden können, in dem das eckhartsche Werk und das Zen miteinander übereinstimmen, erscheint der Vergleich der jeweiligen Ich-Strukturen nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll, erfuhr dadurch auch das Allgemeine seine Bestimmung, was die Ableitung der konkreten im Begriff des eckhartschen Werkes und des Zen sich manifestierenden Mystik ermöglichte und in deren Folge ihren Inhalt, als die Weise der begrifflichen Entfaltung der jeweiligen Ich-Struktur offenlegte. Diese Ableitungsstufen legen zugleich die Ordnung des Vergleiches der besagten Ich-Strukturen 452 Exemplarisch für eine solche Verwechslung sei auf den Vergleich D. T. Suzukis hingewiesen. Der religiös gedeutete Begriff der Kreuzigung ist hier einem mystisch gedeuteten Begriff des Satori gegenübergestellt worden. Daß der Vergleich den Unterschied herausarbeiten muß, liegt bereits in der Voraussetzung und nicht im Ergebnis, da unreflektiert Allgemein-Unterschiedliches gegenüber gestellt worden ist, innerhalb dessen dann, im Konkreten also, Gegesetzliches festgestellt werden mußte. 453 Jede bis heute im Abendland definierte scientia, ganz gleich ob sie als scientia divina, humana, naturalis usw. bezeichnet wird, ist aller Bestimmung zuvor, weil auf dem Vollzug der Reflexion des Denkens gründend, immer schon scientia rationalis. 161 fest, sind auch hier die Übereinstimmung oder der Unterschied im Allgemeinen immer schon die Voraussetzung derselben im Konkreten, nicht jedoch umgekehrt. Auf Grund der Tatsache, daß sich der Mystik-Begriff seinem Inhalt nach mit dem der absoluten Einheit als identisch erwiesen hat, übernimmt der Begriff des Absoluten innerhalb des Vergleiches die tragende Funktion. Der Inhalt des Begriffes der absoluten Einheit nämlich läßt per definitionem nur analytische Urteile zu, weil er erhaben über jegliche Synthese, Doppelung, mithin auch Relation sein muß. Aus diesem Grund unterliegt er keinerlei Wandlung oder Veränderung und ist vom jeweiligen Kontext, in dem er erscheint, unabhängig, obwohl er sich der Form nach, und das bedeutet dem Wortlaut nach, innerhalb unterschiedlicher Konkretionen unterscheiden kann. Daraus ergibt sich, daß dieser Begriff, unabhängig vom jeweiligen Zusammenhang seiner Erscheinung, dem Inhalt nach immer gleichbedeutend bleiben muß. Der als Inhalt der allgemeinen Bestimmung der Mystik abgeleitete Begriff der absoluten Einheit muß deswegen identisch sein mit dem der absoluten Einheit innerhalb ihrer Konkretionen und deren Besonderheiten, so er auch dort gedacht wird. Für diesen Vergleich heißt das, daß die in den beiden untersuchten konkreten Erscheinungen der Mystik abgeleiteten Begriffe der `gotheit`, der `Leerheit`, der `Weisheit` oder `nur Geist`, zwar formal, und das heißt phonetisch, wie auch orthographisch unterschiedlich ausgesprochen bzw. geschrieben, niemals jedoch inhaltlich als unterschiedlich gedacht werden können, müsste sich sonst das Absolute der eckhartschen Konkretion gegen das Absolute des Zen oder umgekehrt begrenzen, wäre damit bereits relativ und als solches ein Selbstwiderspruch. Und was für das Allgemeine und Konkrete gilt, muß auch für das Besondere gelten, entsprechen dem Begriff des Absoluten innerhalb der jeweiligen Ich-Bestimmung die Begriffe `Grund der Seele` und `Buddhanatur` oder `reines Ich`, welche ebenfalls Identisches denken müssen. Indem die Bestimmungen der beiden Ich-Strukturen wörtlich genommen im Grunde identisch sind, müssen sie in Folge als die Entfaltung einer und derselben absoluten Einheit gedacht werden, und zwar so, daß sie sich nicht innerhalb dieser – dualer Ansatz! –, sondern als diese manifestieren. Weil der Begriff des Absoluten weder ein Innerhalb noch ein Außerhalb seiner selbst zulassen kann, ist jegliche Erscheinung immer schon seine unmittelbare Manifestation. Und läßt sich die Manifestation des Absoluten als der erkennende Vollzug seiner a priori bestimmten Einheit verstehen, der, weil Doppelung, das Absolute dem Begriff nach voraussetzen muß, so 162 setzt die Erkenntnis der Entfaltungsweise des Absoluten eine Struktur voraus, welche zum einen unmittelbare Anwesenheit bei den Stufen seiner Entfaltung erreichen muß, um zum anderen ein Wissen, mithin einen Begriff davon ableiten zu können. Die erkennende Entfaltung der absoluten Einheit entspricht somit der als Ich bestimmten Struktur454. Weder konnte jedoch gedacht werden, daß die absolute Einheit diese Struktur hervorbringt noch voraussetzt, da beide Konzepte auf Grund ihres dualen Ansatzes dem Begriff des Absoluten widersprächen, noch kann – aus dem gleichen Grund – ihre Unabhängigkeit vom Absoluten gedacht werden, so ist die Ich-Struktur in der Gesamtheit ihrer Dynamik die unmittelbare Manifestation der absoluten Einheit und in diesem Sinne mit ihr identisch. Selbst wenn an dieser Stelle eingewandt werden sollte, daß der Begriff des Absoluten auf Grund seiner Erhabenheit unterschiedliche Entfaltungsweisen als denkbar zulassen muß, so widerspricht dieser Einwand der bisherigen Argumentation deswegen nicht, setzt er doch immer eine Struktur voraus, die diese Entfaltungsweisen erkennt bzw. denkt. Genau diese Struktur als Ich-Struktur begriffen ist der Gegenstand dieser Untersuchung und eben nicht die unendliche Vielheit und damit auch Vielfalt, die diese wahrnehmen und denken kann. Weil sich dieser Begriff der Ich-Struktur aus dem der absoluten Einheit ableiten läßt, der wiederum als Inhalt des Begriffes der Mystik das allgemeine tertium comparationis des Vergleiches ist, muß er genauer untersucht werden, bildet er im Folgenden das tertium comparationis des Vergleiches im Besonderen und ist damit zugleich in diesem Zusammenhang die Selbst-Identität des Vergleichenden. Mußte das Allgemeine im Begriff der Mystik, weil der Religionswissenschaft verpflichtet und im Einklang mit den Prinzipien der Philosophie bestimmt werden, so gilt das Gleiche für die Bestimmung des Besonderen im Begriff der Ich-Struktur. 454 Hier sei auf den Unterschied zwischen dem Ich-Begriff und der Ich-Struktur hingewiesen. Der innerhalb des Begriffes der Mystik gedachte Ich-Begriff ist als Ergebnis der Reflexion des Denkens bereits nur ein Teil der hier gedachten Ich-Struktur, deren ganzheitlichen Vollzug er, bewußt oder unbewußt, voraussetzen muß. Vgl. dazu Kap. III und V dieser Arbeit. 163 1. Der abendländische comparationis Begriff der Ich-Struktur als tertium Gemäß dem „Satz vom zu vermeidenden Widerspruch“ des Aristoteles und damit dem formalen Prinzip der ersten Epoche der abendländischen Philosophie nach,läßt sich immer nur eine Ich-Struktur bestimmen, die entweder als Vielheit oder als Einheit gedacht werden kann, verstieße eine andere Weise ihrer Bestimmung gegen das Prinzip selbst455. Die Bestimmung der Ich-Struktur als Einheit ist innerhalb der Epoche undenkbar, wäre sie damit doch Gott, was auch ihrer Zeitlichkeit widerspricht. So kann sie, weiter innerhalb des Verständnisses der ersten Epoche, nur als Vielheit bestimmt werden, die als Reflexion des Denkens, unabhängig von der Einheit, diese aber voraussetzend, sich selber vollzieht. Das Prinzip der ersten Epoche ermöglicht daher eine Ich-Bestimmung, die auf den zeitlichen, deswegen auch räumlichen Vollzug der Reflexion des Denkens beschränkt bleiben muß, ist sie als Ergebnis seiner Anwendung mit ihm formal und das heißt als Vielheit begriffen auch nur zeitweise identisch456. Der plotinische Begriff des Einen, mithin das Prinzip der zweiten Epoche der abendländischen Philosophie, entfaltet den Begriff der Ich-Struktur aus sich selber heraus und damit genau in umgekehrter Reihenfolge wie der des Aristoteles, der ihn der Vielheit, aus ihr heraus bestimmt, voraussetzt. Dieser formale Akt ist vom Inhalt des Begriffes selbst nicht trennbar und folgt daher einer Notwendigkeit, welche mit der Einführung des Begriffes der absoluten Einheit zusammenhängt. Das Absolute nämlich, in seiner „Über-Fülle“457 die „Quelle des Geistes“458, ist aus der Notwendigkeit seiner selbst im Begriff des Absoluten und in diesem Sinne nicht als Voraussetzung und damit Ursprung (aristotelische Vorgehensweise) der Ich- 455 Vgl. dazu Anmerk. 14 und 15 dieser Arbeit; Aristoteles, Metaphysik 1005a ff.; 1072 a ff. 456 Aristoteles, Metaphysik 1072b, 14 ff: „Sein [des Gottes = der reflektierten Einheit] Leben aber verläuft so, wie es in seiner besten Form uns nur kurze Zeit zuteil wird. Bei ihm herrscht immerwährend dieser Zustand …“ 457 Enneade V 2, 1, 8. 458 Enneade VI, 9, 9, 1. 164 Struktur zu begreifen, sondern als die Fülle ihrer und gleichsam seiner Entfaltung zu benennen459. Weil einerseits das Eine in sich selbst keine Reflexion aufweisen kann, sonst wäre es als Doppelung kein Absolutes mehr, andererseits ein Außerhalb seiner nicht denkbar und gleichzeitig so etwas wie Denken, also das Erscheinen der Doppelung bestimmbar ist, wird die Frage nach dem Zueinander dieser Größen mit der Entfaltung der Ich-Struktur identisch, erkennt alleine diese Struktur den besagten Sachverhalt durch die Tatsache seiner begrifflichen Präsenz. Im Gewahrwerden des Einen nämlich, entsteht der „Geist“, der damit nicht das Eine ist, sondern der Träger dieser Reflexion und der Reflexion überhaupt und in Folge Doppelung und so verstanden „Bild des Einen“460. Der Geist ist seiner unmittelbaren Herkunft wegen Einheit, wie auch gleichzeitig seiner Reflexion wegen Vielheit und in diesem reflexiven Sinne „Logos“461, dessen Inhalt aber nicht das Eine sein kann (sonst wäre es ein Etwas, mithin kein Absolutes), sondern das Sein des Geistes selber, der sich denkend erzeugt und erzeugend denkt, weil Sein und Denken in ihm identisch sind462. 459 Das Absolute muß seinem Begriff nach sowohl überall sein wie auch alles sein, zugleich aber mit nichts identisch, da es sonst als ein Etwas denkbar sein müsste, was ihm widerspräche. Plotin, Enneade III, 9, 4, 1 ff. Übers. Beierwaltes, Plotin, über Ewigkeit und Zeit, Frankfurt 1967, S. 19: „Wie wird nun aus Einem die Vielheit? Weil es überall ist, denn es gibt keine Stätte, wo es nicht wäre. So erfüllt es also Alles; es ist also Vielheit, vielmehr ist es geradezu Alles. Wäre das Eine nämlich nur überall, so wäre es selbst Alles; da es aber auch nirgends ist, entsteht Alles durch das Eine, sofern das Eine überall ist, aber von dem Einen verschieden, sofern dieses nirgends ist. Aber warum muß der Eine nicht nur überall, sondern auch nirgends sein? Weil vor und über Allem ein Eines sein muß; so muß es Alles erfüllen und schaffen und es darf nicht das Alles, was es schaffte auch selber sein.“ 460 Die exakte Bestimmung des Geistes ist deswegen schwierig, weil er zugleich abhängig vom Einen, da dieses kein Außerhalb seiner selbst zulassen darf, und nicht in Beziehung zum Einen gedacht werden muß, da sonst das Eine, Beziehung zulassend, duale Bestimmung zulassen müsste und sich selbst widerspräche. Deswegen kann auch das Eine niemals Träger einer wie auch immer gedachten Reflexion sein, wiewohl diese gleichzeitig niemals „außerhalb“ seiner gedacht werden kann. Dazu: Enneade V, 4, 2, 19 ff.; 6, 5, 16. 461 Enneade VI, 4, 11, 16. 462 Enneade V, 9, 5, 7. 165 Und weil sein Sein inhaltlich mit den „Ideen“463 gleichgesetzt wird, ist ihre Hervorbringung identisch mit ihrer Aufrechterhaltung, die einheitlich – deswegen auch zeitlos im Sinne des a priori – von der als „Vermittlerin“464 gedachten „Seele“465 in der zeitlich sich vollziehenden Reflexion des Denkens als begriffliche Ableitung der durch die Sinne hervorgebrachten Gegenstände erkannt werden466. Weil die ausschließliche Identifizierung mit der untersten der Entfaltungsstufen des Absoluten möglich, jedoch auf Grund der Entzweiung und damit der Haftung am Vergänglichen nicht nur leidvoll, sondern zugleich auch mühevoll ist, vollzieht sich das sich Verschließen gegen die Dynamik der ganzen Struktur doch als eine Daseins-Behauptung contra naturam, muß dem Wissen um die notwendige Voraussetzung der jeweils vorausgehenden Stufe die unmittelbaren Anwesenheit bei dieser folgen können, wäre sonst diese alleinige Identität ein Widerspruch zum Ganzen467. Die Gesamte Ich-Struktur ist damit ein permanenter Prozeß des „Ausfließens“468 des Einen, wie auch der Rückkehr zu sich selbst innerhalb 463 An dieser Stelle wird die eigentliche Konsequenz der Einführung und Entfaltung des Begriffes des Absoluten durch Plotin deutlich. Das bislang Absolute nämlich scheint sowohl bei Platon wie auch bei Aristoteles immer schon als Doppelung gedacht worden zu sein, wenngleich mit unterschiedlicher Gewichtung. So die Selbstreflexion des Denkens des Aristoteles auf der einen und die Ideen des Platon auf der anderen Seite. Indem Plotin im Begriff des Geistes nicht nur beide Stränge zusammenfügt und damit Inhalt (Ideen) und Form (Selbstreflexion) als Momente einer und derselben Bewegung denkt, begreift er diese als das von der sich zeitlich vollziehenden Reflexion des Denkens notwendig vorausgesetzte a priori, welches deswegen, weil Beziehung zulassendes, niemals absolut gedacht werden kann. Dazu: Enneade V, 9, 8, 1 ff.: „Was ist die Idee? Sie ist der Geist und denkendes Sein...“. 464 Enneade I, 2, 3, 26. 465 Den Begriff der „Seele“ entfaltet Plotin ausschließlich anhand ihrer Tätigkeit als Vermittlerin, zwischen dem Geist, dessen Bild sie ist, und der vergänglichen Wirklichkeit, indem sie gesamte Wirklichkeit (Ideen) des Geistes im zeitlichen Nacheinander hervorbringt und discursiv begreift. Enneade V, 1, 3, 7 ff. Sie ist damit weder das eine noch das andere, hat aber an beiden Anteil im Sinne der unmittelbaren Anwesenheit. 466 Vgl. dazu: Enneade VI, 2, 11, 25 ff.; IV, 3, 1, 7 ff. 467 Deswegen kann die „Rückkehr“ niemals als die Vernichtung bzw. Negierung der Vielheit gedacht werden, sondern nur als das Loslassen einer statischen Teil-Identität zu Gunsten des Vollzuges der gesamten. Dazu: Enneade VI, 9, 7, 17.; V, 1, 10, 10. 468 Enneade V, 1, 6, 7. 166 der als Ich-Struktur begriffenen Entfaltung, daher auch aus- und in den: „inneren Menschen“469. Der Tatsache wegen, daß die dem Begriff der Mystik entsprechende IchStruktur sich nur aus dem Begriff der absoluten Einheit entfalten und damit logischerweise ihre Bestimmung innerhalb des Denkens der zweiten Epoche der abendländischen Philosophie finden kann, muß zum Abschluß ihr Verhältnis zum Prinzip der dritten Epoche der abendländischen Philosophie untersucht werden, das bis heute grundlegend ist für die Wissens- und damit die Begriffsentfaltung an sich. Das als „res cogitans“ erkannte Sicherste allen Wissens und damit als Prinzip der neueren Philosophie wirkende ist gleich mit der Festlegung des Begriffes der Ich-Struktur auf den Vollzug ihrer selbst, bestimmt als Reflexion des Denkens. In der Tatsache dieser Identität gründet alleine das sicherste Wissen und erschöpft sich keinesfalls der Anspruch der Totalität des Wissens an sich, mithin auch der Ich-Struktur, um ihrer möglichen Ganzheit gerecht zu werden. Deswegen hebt die „res cogitans“ als Prinzip jener dritten Epoche der abendländischen Philosophie das Prinzip des Einen der Zweiten und in seiner Folge den Begriff der Ich-Struktur in ihrer Ganzheit nicht auf, sondern führt dieses Prinzip und den Begriff des `Einen` in den Status eines Möglichen und nicht mehr Notwendigen über, mit dem Wissen, daß die Weise seiner Entfaltung weder bewiesen noch verworfen werden kann, setzt die Durchführung eines solchen die unmittelbare Anwesenheit bei ihm voraus, somit die Aufhebung der Reflexion des Denkens und damit die des Prinzips selber470. Der aus dem Inhalt des Begriffes der Mystik, mithin aus dem der absoluten Einheit entfaltete Begriff der Ich-Struktur, läßt sich jetzt bestimmen als: Der zeitliche Vollzug der Reflexion des Denkens, der sich und die Vielheit dem Begriff nach ableitet, indem er diese aus der Einheit ihrer notwendigen 469 Enneade V, 1, 10, 10. 470 Die Notwendigkeit einer erweiterten Begriffsbestimmung der Ich-Struktur ergibt sich spätestens mit Kant und seinem Begriff der Aporie. Vgl. dazu: Anmerkung 419, S. 155 dieser Arbeit. Eine genauere Untersuchung der Bestimmung der Ich-Struktur innerhalb der modernen Philosophie sprengt den Rahmen dieser Vorlage, nicht aber unbedingt den der plotinischen Erkenntnisse, kann nämlich das Absolute im Zuge der Zeit und damit innerhalb noch zu erwartetender neuer Prinzipien der allgemeinen Wissensentfaltung vielleicht doch noch bewiesen werden. Auf jeden Fall und unabhängig von jeglicher anerkannten Grundlage der Wissensentfaltung wird das Absolute per definitonem niemals überschritten werden können, ohne ad absurdum geführt zu werden. 167 Voraussetzung entfaltet und der durch seine absolute Selbstaufhebung die unmittelbare Anwesenheit bei dem Einen erreicht, um sich in Folge als dessen unmittelbare Manifestation zu erkennen. Die Angemessenheit dieser Begriffsableitung für die Aufgabe des tertium comparationis gründet zum einen darin, daß sie unabhängig von den zu vergleichenden Denkweisen abgeleitet werden konnte, wobei sie aber gleichzeitig im Einklang mit der Methode der abendländischen Wissensentfaltung und damit mit der Religionswissenschaft steht. Zum anderen und im gleichen Zug reflektiert sie die Selbst-Identität des Vergleichenden, und als unmittelbare Folge davon relativiert sie den Anspruch des Vergleiches an sich, der, obwohl über den Status eines tertium comparationis verfügend, per definitionem niemals den der absoluten Objektivität wird erreichen können. Schematisch dargestellt verhalten sich deswegen die bisher abgeleiteten Begriffe derart zueinander, daß ein Nebeneinader dieser möglich ist. Wichtig dabei ist allerdings – und dies darf keinesfalls außer Acht gelassen werden –, daß die Möglichkeit des Nebeneinanders der jeweiligen IchBegriffe nur dann sinvoll in Bezug gesetzt werden kann, wenn die Ebenen, welche die Dynamik dieser Strukturen bilden, strengstens beachtet werden.471 471 Es ist nämlich auf dem Gebiet der religiösen Vergleiche durchaus üblich geworden, die Inhalte der Religionen in der Weise zueinander in Beziehung zu setzen, als würden sie alle und ausnahmslos einer und derselben Ebene angehören. Dies kann deswegen nicht genug und klar erinnert werden, hat sich nämlich gezeigt, daß das, was unter dem Begriff Gott innerhalb des Christentums verstanden werden kann, weitaus differenzierter zu betrachten ist als oft angenommen. Diese Differenziertheit der Betrachtung wiederum zeigt sich nicht nur in der präzisen Analyse des Sachverhaltes, sondern vor allem in der Ausarbeitung der Folgen, die aus dieser Erkenntnis resultieren können, und hier vor allem in der gewohnten Betrachtung des Absoluten als ein – wie auch immer gedachtes – Gegenüber. Durch die Ernstnahme des Absoluten – allein schon als Begriff – erlebt das bis hierher geglaubte „Gegenüber“ seine stärkste Erschütterung, können nämlich beide Begriffe in keinster Weise in Einklang gebracht werden. 168 Die Ich-Struktur Eckharts Das tertium comparationis Die Ich-Struktur des Zen Die absolute Einheit Gotheit = Grund der Seele Das Eine = der Innere Mensch Leerheit = Buddhanatur = reines Ich Gott = Trinität = Logos Geist = Logos = Zeitlose = gesamte Schöpfung = Selbstreflexion des Denkens zeitlose Selbstreflexion = Ideen = Identität von des Denkens = Identität Denken und Sein = Einheit = S von Denken und Sein = S zeitlose, da einheitliche Ichratio superior = Einheit Identität. = zeitlose, da einE E heitliche Ich-Identität. E E V Speicher-Bewußtsein = S zeitlose E Aufrechterhaltung der H Ideen = zeitlose IchR Identität I L Ratio inferior = L Zeitlicher Vollzug der Verstand = zeitlicher Reflexion des Denkens = E Vollzug der Reflexion E zeitlicher Vollzug der des Denkens = Identität von Denken und zeitlicher Vollzug der Sein = zeitliche Ich-Identität Identität von Denken = Begriffe = erscheinende und Sein = Ich-Begriff Vielheit = Materie. = zeitliche Ich-Identität = Begriffe = Vielheit der Erschei- nungen = Materie. T Reflektiver Vollzug des sechsten T Bewußtseins = Denken = Ich-Begriff = L zeitliche Ich-Identität = Begriffsableitung der U fünf übrigen Sinne = erscheinende Vielheit N = Materie. M K I I G Weil im Bereich des Absoluten keine Unterschiede gedacht werden können, gibt es zwischen den einzelnen Begriffen, die das Absolute innerhalb ihrer Tradition benennen, keine Trennlinien. Aus dem gleichen Grund gibt es diese auch nicht zwischen dem Absoluten und der jeweils formalen 169 M A N A Bestimmung der jeweiligen Ich-Struktur im Begriff der Seele oder im Begriff der Vermittlung, muß jede erkennende Struktur, die den Begriff des Absoluten denkend voraussetzt, sich gleichzeitig als identisch (deswegen keine Trennlinie) und doch getrennt von ihm (unterbrochene Trennlinie) bestimmen. Identisch, weil kein außerhalb seiner denkbar ist, getrennt, weil die Erkenntnis als der Vollzug der Reflexion des Denkens, mithin Doppelung, bereits die Weise des Heraustretens aus der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten ist und in Folge mit dem Verlust dieser gleich. Wird das Absolute als Begriff vorausgesetzt, so muß es, wie bereits gezeigt worden ist, nicht nur formal eine Übereinstimmung in diesem Begriff geben, sondern, wie noch zu zeigen sein wird, auch eine inhaltliche, werden Form und Inhalt im Begriff des Absoluten zunächst vorausgesetzt und dann ineinander aufgehoben und, weil jeweils Doppelung, deswegen auch überschritten. Dem inhaltlichen Vergleich der Begrifflichkeit des Absoluten folgt dann der Vergleich seiner Manifestation im Begriff der äußeren Ich-Struktur, der, wiederum, dem Schema vom Allgemeinen hin zum Konkreten folgend, immer nur dann sinnvoll fortgesetzt werden kann, so die Vergleichbarkeit im Allgemeinen der Vergleichbarkeit im Konkreten zugrunde gelegt werden kann. 2. Das Absolute als Grund der Ich-Strukturen Insofern innerhalb des abendländischen Denkens das Absolute seine begriffliche Bestimmung im plotinischen Einen (έν) gefunden hat, muß diese notwendigerweise als Maßstab aller weiteren Bestimmungen des Absoluten innerhalb der gleichen Tradition herangezogen werden, vor allem dann, wenn jene, dieser nachfolgend, sie damit voraussetzen. Allein schon deswegen kann und muß die eckhartsche Bestimmung des Absoluten im Begriff der `gotheit` am plotinischen Begriff des Einen gemessen werden, wiewohl und gleichzeitig das plotinische Eine auch die Selbstidentifikation des Vergleichenden im Sinne des tertium comparationis formuliert und somit die fragende Hinwendung aus dem Abendland heraus auf den Begriff des Absoluten im Zen-Buddhismus darstellt. 170 Ist damit das plotinische Eine nicht nur ohne Grund und daher völlig gestaltlos („άμορφον“)472, mithin dem Denken kein Gegenüber, sondern gerade als Nicht-Denken bestimmt, über dieses – da dies ein Reflexionsverhältnis – erhaben und in diesem Sinne als Über-Denken („ύπερνόησις“)473 begriffen, das allzeit gegenwärtige Innerste des Menschen („τόν εϊσω άνθρωπον“)474 und sein Grund, so muß die eckhartsche Bestimmung der `gotheit` als Grund der Seele und damit der Ich-Struktur dem Absolutheitsanspruch dieser Definition des Einen genügen. Das entscheidende Merkmal der Bestimmung des Einen bei Plotin ist der Begriff seiner absoluten „Nicht-Bezüglichkeit“475, der dadurch jegliche Möglichkeit einer Verhältnisbestimmung im Ansatz vereitelt, indem er keine Doppelung aufkommen läßt und sich erst so und infolge davon als das Absolute behauptet. Hätte Eckhart dagegen das Absolute - gemäß der Tradition – als Trinität bestimmt, so würde diese Bestimmung notwendigerweise ein doppeltes Verhältnis beinhalten: Zum einen wäre das Eine in sich als ein Verhältnis bestimmt worden, das – zum anderen – eine zweite Verhältnisbestimmung zu der als Ich begriffenen Struktur erforderlich machen würde. Beide Folgen widersprächen der begrifflichen Voraussetzung des Absoluten und damit der Mystik. So ist für Eckhart die Bestimmung des Absoluten im Begriff der `gotheit` ein Durchbrechen der Trinität und der mit ihr identischen ratio superior, die, verstanden als Doppelung, in der Aufhebung ihrer selbst im Akt des NichtWissens die unmittelbare Anwesenheit bei ihrem eigenen Grund, begriffen als `gotheit`, erreicht, der damit und eben weil die Reflexion übersteigend als `Über-Wissen´ benannt, keinerlei Doppelung entfaltend, ebenfalls absolute `Nicht-Bezüglichkeit` ist476. 472 Enneade VI, 9, 3, 39. 473 Enneade VI, 8, 16, 33. 474 Enneade V, 1, 10, 10. 475 Enneade VI, 7, 37 f. Zum eckhartschen Begriff des Nicht-Wissens vgl. Kap. III, 2 dieser Arbeit. 476 171 Damit ist die `gotheit`, begriffen als Grund der Seele in der Weise, wie sie von Eckhart gedacht worden ist, mit dem abendländischen Begriff des Absoluten, wie er durch Plotin seine prinzipielle Bestimmung hat finden können, formal und inhaltlich identisch. Untersucht man aus dieser begrifflichen Selbst-Identifikation heraus die Bestimmung des Absoluten im Zen, und das in den Begriffen der `Leerheit`, der `Buddhanatur` und des `Reinen Ichs`, so ist der Inhalt dieser Begriffe immer schon und immer nur als das Ergebnis der Aufhebung einer ihn verdeckenden Doppelung bestimmt, die mit dem Vollzug der Reflexion des Denkens identisch gesetzt worden ist. Weil aber das Zen, der Vijñānavāda-Terminologie folgend, alle erscheinende Vielheit, welche als Doppelung die Ursache jeglicher Verhältnisbestimmung ist, auf die sich deswegen auch als Doppelung manifestierende Tätigkeit der äußeren Ich-Struktur - in ihrer Grundlage begriffen als siebte Bewußtseinsstufe - zurückführt, kommt das Überschreiten dieser und des Speicherbewußtseins als Akt des NichtDenkens der Bestimmung des Absoluten als einem Nicht-Träger einer Reflexionsseite gleich, das damit in Folge keinerlei Reflexionsverhältnisse eingehend ebenfalls reine Nicht-Bezüglichkeit ist. Aus dem Gesagten folgt, daß der Vergleich der eckhartschen Bestimmung des `Grundes der Seele` und die dem Zen eigene Bestimmung der neunten Bewußtseinsstufe als `Reines Ich` nur drei Ergebnisse haben kann: Entweder können beide als das Absolute im abendländisch-plotinischen Sinn bestimmt und dann entsprechend auch verglichen werden, oder es lassen sich beide nicht unter dieses tertium comparationis subsumieren, so daß dieser Vergleich Grund-los erscheint. Die dritte Möglichkeit bestünde im Nachweis, daß eine der beiden Bestimmungen den Begriff des Absoluten nicht ableitet, womit ein weiterer Vergleich ebenfalls voraussetzungslos wäre. Es konnte jedoch bereits gezeigt werden, daß beide Bestimmungen nicht nur dem Begriff des absolut Einen entsprechen und deswegen auch verglichen werden können, sondern indem sie das Absolute ableiten, auch formal und inhaltlich unmöglich etwas Unterschiedliches denken können, müsste sonst das Absolute in sich Unterschiede aufweisen, was widersprüchlich ist. Die beiden Begriffe meinen damit nicht nur das Gleiche, sondern absolut 172 daßelbe und müssen notwendigerweise, zwar in unterschiedlichen Sprachbildern, so doch Identisches ausdrücken477. Weil im Absoluten per definitionem niemals Unterschiedliches gedacht werden kann, es selbst aber – wie anhand der beiden Traditionen ersichtlich - unterschiedlich zum Ausdruck kommt, so können diese Unterschiede nur innerhalb der als Doppelung verstandenen Manifestation seiner selbst bestimmt werden478. Dieses ist deswegen wahrscheinlich, definiert die Vielheit geradezu am Unterschied ihre jeweilige Identität, wiewohl gleichzeitig zu untersuchen sein wird, inwieweit sie sich dabei 477 Um entscheidenden Mißverständnissen vorzubeugen muß auch hier darauf hingewiesen werden, daß mit dem Absoluten das identische Signifikat und nicht der identische Referent gedacht werden und zwar deshalb, weil das Absolute an sich kein Verhältnis, mithin keine Entsprechung haben kann. 478 Aus dieser Perspektive bleibt der Ansatz S. Uedas (in op. cit. S. 145 ff.) diesbezüglich unpräzise, denn indem er das Werk Eckharts und das Zen dem Begriff nach im Absoluten gegründet weiß (S. 146 oben), bleibt der Einsatzort für die Unterschiede eher willkürlich gewählt als strukturell und damit einer Notwendigkeit folgend bestimmt. Denn seiner Argumentation folgend, daß beide im Absoluten gründen, bleibt unverständlich, weshalb ein Unterschied im Relativen das doch wohl fundamentalere Gegründet-Sein beider im Absoluten außer Kraft zu setzen vermag, so daß Ueda im Ergebnis auf eine prinzipielle Unvereinbarkeit beider Größen plädieren kann. Formal betrachtet ist das Prinzipielle immer schon das Allgemeinere und damit Vorausgehende und in diesem Falle auch Vorausgesetzte, so daß ein Unterschied im Relativen die allgemeinere Übereinstimung niemals außer Kraft zu setzen vermag, vor allem auch deswegen nicht, weil er diese seiner Bestimmbarkeit als Unterschied voraussetzt. Hinzu kommt die Tatsache, daß der Vergleich Uedas nicht nur der Form, auch dem Inhalt nach keinesfalls korrespondierede Begriffe untersucht. Das Heranziehen des Kôans als Bestandteil der spirituellen Zen –Praxis (und eben nicht Reflexion) auf der einen, und eines zweihundert Jahre nach Eckhart datierten Gemäldes bzw. Gedichtes auf der anderen Seite (S. 146 unten) entbehrt einer nachvollziehbaren systematischen Grundlage, so daß unklar bleibt, weswegen gerade diese Exponenten exemplarisch für beide Größen stehen sollen, um den Vergleich zu entscheiden, wird vor allem Eckhart diesbezüglich nicht einmal durch seine ipsissima verba vertreten, die dem Anliegen angemessen wären. Obwohl der spätere Aufsatz Uedas, Eckhart und Zen am Problem Freiheit und Sprache, op. cit., S. 21 – 92, die notwendige Unmittelbarkeit des Absoluten im Akt des Sprechens als Sprechen bestimmt und bei Eckhart wie im Zen nachweist, (S. 53 ff.) und damit letztlich zunächst formale Identität beider innerhalb der Vielheit erkennt, beharrt der Autor weiterhin darauf, die Unmittelbarkeit dieser Manifestation in der Zen-Tradition stärker als bei Eckhart zu finden, um im Egebnis auf einen prinzipiellen Unterschied hinzuweisen (S. 64 ff.). Bezüglich dieser Argumentation sei darauf hingewiesen, daß die Sprache per definitionem Vielheit ist, und wenn sich das Absolute als diese unmittelbar manifestiert – was Ueda für beide Größen nachweist – so kann niemals gedacht werden, daß diese Unmittelbarkeit des Absoluten in der Zen-Tradition, und dort dem Inhalt nach, radikaler ausfällt als bei Eckhart (S. 62), ohne daß das Absolute in Selbstwiderspruch träte. 173 unterschiedlicher Struktur bedient. Es ist nämlich einsichtig, daß die gleiche Struktur als das Allgemeinere Unterschiedliches hervorbringen kann, der Rückschluß aber, wonach Unterschiedliches vom Unterschiedlichen verursacht wird, nur eine mögliche, keinesfalls jedoch notwendige Annahme ist. 3. Der Vergleich der beiden Ich-Strukturen in ihrem Vollzug Wie gezeigt können im Bereich der manifest werdenden Ich-Struktur Unterschiede auftreten, wobei untersucht werden muß, inwieweit diese die Struktur der Erscheinung an sich betreffen oder ausschließlich innerhalb der Bestimmung ihrer jeweiligen Ausformung zu finden sein werden. Denn es ist offensichtlich, daß die Reflexion des Denkens, in ihrem Vollzug verstanden als die Ableitung und Aufrechterhaltung von Begriffen, ganz unabhängig von Signifikaten und Referenten, stets die gleiche Struktur beibehält und in der Lage ist, sich selbst durch die Benennung wie auch Identifizierung mit dem Ich-Begriff geradezu eine Permanenz vorzutäuschen. So gedacht kann die plotinische Entfaltung des Absoluten ihrer Struktur nach in zwei Bereiche unterteilt werden, nämlich in den Bereich des Absoluten und den Bereich des Dualen479. Während der Bereich des Absoluten begrifflich unberührt bleiben muß480, erfährt der Bereich des Dualen - weiterhin seiner Struktur nach - eine erneute Unterteilung in den zeitlich und räumlich manifest werdenden Vollzug seiner eigenen, zeit- und raumlosen Voraussetzung481. Diese Einteilung des Offenbarwerdens des Absoluten rechtfertigt aus folgenden Gründen ihre Bestimmung als Struktur, denn: 479 Enneade III, 7. 480 Der Begriff des Einen (Signifikant), der ja Gegenstand dieser Passage ist, bleibt selbstverständlich unabhängig von seiner Bedeutung (Signifikat) immer schon und immer nur Ausdruck und Vollzug der Vielheit, so daß jegliche Erkenntinis – weil immer Doppelung – diese niemals „verläßt“. Vgl. dazu: Enneade V, 5, 7, 17 ff. 481 Enneade V, 1, 3, 7 ff. 174 - Jegliche Dualität setzt ihrer Selbsterkenntnis als solche zunächst den Begriff (nicht aber zwangsläufig die Existenz) der Einheit voraus, so daß mit dem Aufkommen der Dualität gleichzeitig und notwendig der Einheitsbegriff einhergeht. - Obwohl aus der Bestimmung des Absoluten heraus jede Erscheinung seine unmittelbare Manifestation sein muß, kann das Absolute nicht als die im kausalen Sinne gedachte Ursache der erscheinenden Vielheit gedacht werden, denn als solche bestimmt wäre es als ein Etwas definiert, stünde darüber hinaus in einem Verhältnis zum Verursachten und in Folge, als Träger einer Reflexion, im Widerspruch zum eigenen Absolutheitsanspruch. Diese Überlegung – nicht Erfahrung! – rechtfertigt die Annahme einer Zwischengröße, die als Ursache der zeitlich-räumlichen Erscheinungen von den auf dieser Ebene herrschenden Kategorien unberührt bleiben muß, sonst wäre sie lediglich als das Vorhergehende, nicht aber als die Ursache bestimmbar, wiewohl sie gleichzeitig und aus dem selben Grund – als erste Ursache eben – nicht mit dem Absoluten gleichgesetzt werden kann. Diese Zwischenstufe, die weder als das Viele noch als das Eine seine Bestimmung findet, wird in der plotinischen Tradition mit dem Begriff Geist („νούς“) zur Sprache gebracht482. - Wie das Duale (zusammengesetzt aus dem Vielen und dem einheitlichen Geist) das Absolute dem Begriff nach voraussetzen muß, so erfordert der Begriff der erscheinenden Vielheit die begriffliche Voraussetzung eines einheitlichen Ursprungs, und das immer dann, wenn diese als solche begriffen und bestimmt worden ist483. - In Folge der begrifflich notwendigen Annahme eines Absoluten ist die begriffliche Spaltung seiner Manifestation in das Einheitliche und das Viele ebenfalls das notwendige Ergebnis seiner begrifflichen Überlegenheit. - Weil damit im Ergebnis der Begriff des Absoluten die drei Bereiche seiner Entfaltung voraussetzt und sich gleichzeitig als diese manifestiert, müssen eben diese Bereiche unabhängig von der durch die Kultur bedingten sprachbildlichen Ausprägung und Differenzierung überall dort bestimmbar sein, wo das Absolute als das Absolute hat bestimmt werden können. 482 Exemplarisch dazu: EnneadeVI, 9, 9, 1. 483 Enneade IV, 6, 3, 5 ff. 175 Aus dem so Gedachten resultiert, daß die Einteilung in die besagten drei Bereiche bei gleichzeitiger Voraussetzung eines Absoluten immer schon jeglicher weiteren Differenzierung vorausgeht, so daß sie mit Recht als Struktur bestimmt werden kann. Ist zuvor gezeigt worden, daß sowohl Meister Eckhart wie auch die ZenOrthodoxie, als Mystik begriffen, immer nur das Absolute – mithin auch das Identische - dem Begriff nach denkend voraussetzen müssen, und kann das Absolute, plotinisch-abendländisch gedacht, als Ich-Struktur in einem Dreierschritt begrifflich entfaltet und damit auch bestimmt werden, so ergibt sich für die Fortsetzung des Vergleiches die Notwendigkeit der Überprüfung der Begriffe der jeweiligen äußeren Ich-Strukturen im Denken Eckharts und im Zen auf ihre Entsprechung bezüglich der als tertium comparationis bestimmten Dreierstruktur des Ich-Begriffes hin. Folgt man der mittleren Spalte des Schemas auf S. 170, so entfaltet sich das Absolute (im Begriff des Einen und als erster Bereich in der oberen Spalte) der Struktur nach als die begriffliche Ableitung des sinnlich Hervorgebrachten (der Bereich der Ich-Identität als Ich-Begriff im Vollzug der Spaltung von Sein und Denken, weswegen auch als dritter Bereich in der unteren Spalte aufgeführt) und damit als der zeitlich-räumliche Vollzug der als Ursache vorausgesetzten Einheit von Sein und Denken (der mittlere Bereich bestimmt als `Geist` und dem entsprechend die mittlere Spalte). Seiner absoluten Nicht-Bezüglichkeit wegen besteht zwischen dem ersten Bereich und den beiden folgenden keine Verbindung im Sinne einer Relation, und das nicht etwa, weil das Eine getrennt von seiner Entfaltung gedacht wird, vielmehr wegen der als notwendig gedachten Unmittelbarkeit der Identität von beiden, die als absolute Einheit bestimmt, erhaben über alle Begriffe und deswegen auch a-dual, überhaupt nicht vorstellbar, wohl aber begrifflich voraussetzbar ist. Dagegen und der Ursächlichkeit wegen muß eine Verbindung zwischen dem zweiten und dem dritten Bereich gedacht werden. Diese Verbindung als tätiger Vollzug der Entfaltung des Einheitlichen als Vieles und seiner Rückkehr zu sich selbst im Vollzug der Reflexion des Denkens wird in Anlehnung an Plotin als Seele („ψυχή“)484 begriffen (mittlere Spalte senkrecht links im Schema). Damit unterscheidet sich der Begriff der Seele einerseits von der als zeitliche Ich-Identität sich vollziehenden und 484 Enneade V, 1, 3, 7 ff. 176 begreifenden Reflexion des Denkens, wie auch von der andererseits als einheitlich gedachten Einheit von Sein und Denken begriffen als Geist. So definiert, ist die Seele das tätige Verhältnis der Einheit zu seiner eigenen Entfaltung und in diesem Sinne reine Vermittlung („έρμηνεύς“485 und im Schema mittlere Spalte senkrecht rechts). Vergleicht man hierzu die eckhartsche Struktur der Entfaltung des Absoluten, so deutet bereits seine Benennung als `grund der sêle`486 auf die begriffliche Entfaltung einer solchen, deren Struktur in Bezug auf das äquivalente tertium comparationis nun überprüft werden muß. Indem Eckhart das Absolute (begriffen als ´gotheit` und `grund der sêle`, deswegen auch erster Bereich der Gesamt-Struktur und somit oben links im Schema) als Trinität entfaltet, welche mit der ratio superior identisch gedacht ist, weil sie denkt, und denkt, weil sie ist, wird von ihm dieser Zustand des Hervortretens des Grundes, da im Ergebnis zeit- und raumlos bestimmt, als Einheit begriffen. Diese Einheit entspricht genau der Struktur(Signifikat), wenn auch nicht immer dem Wortlaut nach (Signifikant), dem zweiten, eben als Einheit definierten Bereich der als tertium comparationis bestimmten Vorlage, ist doch die eckhartsche ratio superior, als Synonym für den Logos oder den Sohn und der Konditionalität wegen auch für Gott, keinesfalls das Absolute mehr, ihrer Einheitlichkeit von Sein und Denken aber noch keine Vielheit (Mitte links im Schema)487. Diesbezüglich unterscheidet die Zen-Orthodoxie, vor allem in ihrer terminologischen Anlehnung an die Vijñānavāda-Schule, zwischen dem Absoluten, begriffen als das `Reine Ich` oder `shiki Anmora`, und dem relativen Ich-Begriff als Ergebnis der Reflexion des Denkens (sechster Bewußtseinssinn), eine Zwischengröße, nämlich das Universalbewußtsein (Skrt. Ālayavijñāna) in der Funktion als „Speicherbewußtsein“ (Mitte rechts im Schema). Als Ursprung und Endziel der sinnlichen Hervorbringung und ihrer begrifflichen Erkenntnis – und in diesem Sinne als Speicherbewußtsein verstanden – wird es notwendigerweise zeit- und raumlos gedacht, mithin als Einheit. Selbst dann, wenn die Zen-Orthodoxie bezüglich der Einheit keine weiteren Differenzierungen vorzunehmen scheint, kann festgestellt 485 Enneade I, 2, 3, 26. 486 Exemplarisch dazu: Pred. 71, DW III, S. 225, 8. Und Kap. III, 3 dieser Arbeit. 487 Vgl. dazu Kap. II, 1 und 2 dieser Arbeit. Gegen die Behauptung von Wulf, op. cit., S. 27 ist gezeigt worden, daß Eckhart unmöglich das „Hen mit dem Nus“ identifiziert. Denn gerade darin besteht ja seine Leistung und Fort-schritt gegeüber der traditio, daß er das Eine dem Einheitlichen, also die `gotheit` dem trinitarischen Gott voraussetzt. 177 werden, daß eine solche gedacht wird, womit dem zweiten Bereich der Entfaltung der Ich-Stuktur seitens des Zen ebenfalls entsprochen wird488. Führte die Übereinstimmung im Bereich des Absoluten notwendigerweise auch zur absoluten Identität in diesem Bereich, so scheint die Übereinstimmung im Bereich der Einheit lediglich die Strukturen zu betreffen, wird das Einheitliche innerhalb des tertium comparationis wie auch bei Eckhart als Einheit von Denken und Sein gedacht, während das Speicherbewußtsein solch eine Bestimmung zunächst nicht aufweist. Hinzu kommt, daß ein Unterschied zwischen den Strukturen überhaupt erst ab diesem Bereich denkbar ist, läßt das Einheitliche in beiden Fällen eine Verhältnisbestimmung zu – beispielsweise als Ursache –, weil es bereits selber vom Absoluten unterschieden ist, und nur als Doppelung begriffen kann es als Ursache aller weiteren Doppelungen begriffen werden489. Formal betrachtet ist damit das Aufkommen inhaltlicher Unterschiede ab und daher im Bereich der Einheitlichkeit gerechtfertigt, welche aber, wie bereits gezeigt, immer schon die gleiche Struktur des Ich-Begriffes voraussetzen. Es soll deswegen geprüft werden, worauf der mögliche und auch so scheinende inhaltliche Unterschied zwischen dem eckhartschen Begriff der ratio superior und dem Begriff des Speicherbewußtseins im Zen gründet. Die Untersuchung dieser konkreten Frage kann sich ebenfalls nur im Horizont der fragenden Bewegung aus dem als Selbst-Identifikation bestimmten tertium comparationis heraus ereignen, vor allem dann, wenn der Zen-Orthodoxie eine reflexive und damit dynamische Bestimmung des Einheitlichen fremd zu sein scheint. So ergibt die abendländische Betrachtung des Begriffes des Speicherbewußtseins folgende Ergebnisse490: - 488 Ist das Speicherbewußtsein Ursache aller sich als Zeit und Raum manifestierenden Vielheit, so kann es, als ein `Etwas` bestimmt, weder das Absolute noch ein Vielheitliches sein, wäre es im ersten Fall eine Vgl. dazu: Kap. V, 2, b dieser Arbeit. 489 Der Geist, mithin das Einheitliche ist der Träger einer ersten Verhältnisbestimmung, in der er sich geradezu als Unterschied begreift und niemals als das Eine. Vgl. dazu: Enneade VI, 9, 2, 35. 490 Der folgende Gedankengang interpretiert das Teisho III a und b des Yasutani-Roshi aus op. cit., S. 43 – 59. 178 Doppelung und im zweiten lediglich als ein Vorhergehendes, nicht aber als die Ursache schlechthin bestimmt. - Weil die Zen-Orthodoxie den ersten sechs Bewußtseinssinnen lediglich eine hervorbringende Funktion einräumt, so daß das sinnlich Hervorgebrachte (die ersten fünf Bewußtseinssinne) und begrifflich Reflektierte (sechster Bewußtseinssinn) als der zeitliche Vollzug, mithin auch als Spaltung der ursächlichen Einheitlichkeit gedacht werden, muß das, was gespalten wahrgenommen und vollzogen wird, im Ursprung einheitlich gedacht werden. - Als gespalten aber werden auf der einen Seite die sinnliche Hervorbringung und die Wahrnehmung, auf der anderen Seite die reflexive und damit begriffliche Erkenntnis gedacht, die dann, im Ursprung und daher einheitlich bestimmt, erneut als Einheit von Sein (Sinnliches) und Denken (Erkenntnis) begriffen, notwendigerweise den als gespalten gedachten Vollzug einheitlich zu vollziehen hat. So gedacht kann das Speicherbewußtsein auch inhaltlich mit dem eckhartschen Begriff der ratio superior übereinstimmen, so daß im Ergebnis der Referent und das Signifikat identisch sind, lediglich die Signifikanten Unterschiede aufweisen. Und war im Bereich des Absoluten die absolute Übereinstimmung per definitionem zwingend, so ist sie es im Bereich des Einheitlichen nur noch der Struktur nach, und zwar als Folge der identischen Voraussetzung, weil sie aber zugleich als Doppelung bestimmt Unterschied ist und damit bereits dem Inhalt nach unterschiedlich aufgefasst werden kann, es aber trotzdem nicht muß. Mit der Übereinstimmung der Begriffe im zweiten Bereich der jeweiligen Ich-Struktur ist die begriffliche Grundlage ihrer weiteren Manifestation gelegt, die, abendländisch gedacht, im Begriff der Seele das Einheitliche als das Viele entfaltet und als Vielheit erkannt, und gleichzeitig zum Einheitlichen zurückführt. Dieser als Vielheit bestimmte und zum Vergleich ausstehende dritte Bereich der Ich-Struktur wird innerhalb des tertium comparationis wie folgt genauer entfaltet: Die als Geist gedachte Einheit von Sein und Denken, die als das eine Extremum der Seele verstanden wird491, entfaltet sich - und ist deswegen als 491 Plotinisch gedacht ist der Geist, begriffen als Logos der Ursprung und damit auch die eine Seite der Seele. Vgl. dazu: Enneade III, 2, 2, 17. 179 Tätigkeit der Seele bestimmt - als das sinnlich Wahrnehmbare, weil gleichzeitig sinnlich aus der Einheit Hervorgebrachte und als dessen Erkenntnis im begrifflichen, daher zeitlichen Vollzug der Reflexion des Denkens. Das sinnlich Hervorgebrachte und Wahrgenommene bildet das andere Extremum der Seele492, während die begriffliche und daher reflexive Erkenntnis des Wahrgenommenen als ihre Mitte gedacht wird493. Indem die Reflexion des Denkens, jetzt bestimmt als Teil der seelischen Gesamtdynamik, das sinnlich Wahrgenommene und bildlich Vorgestellte begrifflich erfasst, vollzieht sie im Urteil die einheitliche Grund-Idee des Erscheinenden und damit gleichzeitig die Rückbeugung des Geistes auf sich selbst494. Die als Mitte der Seele definierte Reflexion des Denkens ist auf Grund der Identifikation mit den begrifflichen Ableitungen die zeitliche und daher als Vielheit bestimmte Definition der Ich-Struktur, während in der als Seele gedachten Gesamtdynamik der Entfaltung der Einheit die eigentliche Ursache dieser möglichen Identifikation gründet. Die Seele ist nämlich, aus dem Geist kommend auf diesen ausgerichtet, jedoch ihrer vermittelnden Eigenschaft wegen auf dem Weg dahin zu anderen, und weil nicht einheitlichen, deswegen auch qualitativ minderen Identifikationen fähig495. Der Form nach wird der dritte Bereich der gesamten Ich-Struktur als die Manifestation des Zweiten entfaltet, die nicht einmalig als Akt, sondern weil dynamisch und als Prozeß bestimmt, niemals von seiner Ursache getrennt gedacht werden kann, weswegen beide auf den Begriff der Seele als Vermittlung angewiesen sind. In Bezug dazu und deshalb ebenfalls der Form nach denkt Eckhart im Begriff der ratio inferior die begriffliche Ableitung des bildlich Vorgestellten des zuvor sinnlich Wahrgenommenen, die dadurch im Urteil 492 Das Viele als das Andere des ursprünglich Einheitlichen und als sein Gegenüber gedacht ist das stets qualitativ Niedrigere, weil Zeitliche und das andere Extremum der Seele. Enneade IV, 3, 18, 4. 493 Enneade VI, 6, 1, 1; 42, 24. 494 Die Vereinheitlichung des Vielen auf den Geist ist mit dem Durchdenken seiner Manifestation identisch (Enneade VI, 9, 3, 21) und führt nach „Innen“, also in den zweiten Bereich der als Ich bestimmten Struktur. VI, 9, 11, 38. 495 Enneade III, 2, 8, 9 ff: „τό δέ κείται άνθρωπος έν μέσω θεών (Einheit) καί θηρίων (Sinnliches).“ 180 die Idee verwirklichend, diese gleichzeitig im Reflexionsakt auf sich selbst zurückbeugt. Und indem Eckhart das Absolute als Grund der Seele bestimmt hat, der in seiner zeitlichen Entfaltung als ratio inferior die Manifestation und Rückbeugung seiner eigenen Ursache bestimmt als ratio superior ist, übernimmt er gänzlich die plotinische Vorlage und benennt den Gesamtprozeß mit der gleichen Terminologie, nämlich ebenfalls als Seele496. Analog zu der plotinischen Entfaltung des Geistes und inhaltlich betrachtet ist der eckhartsche Begriff der ratio superior als Ausgang und Ende der Gesamtbewegung das einheitliche eine Extremum der Seele, während die sinnlich erscheinende Vielheit – die extra dei nicht gedacht werden kann – das andere Extremum darstellt. Der Tätigkeit der ratio inferior, bestimmt als zeitlicher Vollzug der Reflexion des Denkens, kommt die mittlere Position zu, ist sie in der Ableitung von Begriffen die Durchdringung des Erscheinenden auf seinen als Idee gedachten Ursprung hin und damit die Rückbeugung der ratio superior auf sich selbst. Die Selbstreflexion der ratio inferior in der Ableitung des Ich-Begriffes und die Identifikation mit diesem im Sinne der Eigenschaft, macht die ratio inferior – ebenfalls in der Anlehnung an Plotin – zum Träger der gemeinhin unter dem Begriff des Menschen verstandenen Identität. Das eckhartsche Denken der Vielheit und ihre Verbindung zur Einheit im Begriff der Seele entspricht der plotinischen Vorlage, so daß, selbst im Fall der Verwendung eines unterschiedlichen Signifikantes – die Begriffe `sêle` und `ψυχή` beispielsweise unterscheiden sich in der Phonetik und Orthographie – das Signifikat, also das jeweils darunter Gedachte, der Form wie dem Inhalt nach übereinstimmt. Im Begriff der Bewußtseinssinne denkt die Zen-Orthodoxie das jeweils Erscheinende, welches wesenlos ist und daher unbeständig, in Folge zeitlich und räumlich begrenzt, was der abendländischen Bestimmung der Vielheit entspricht497. Diese so gedachte Vielheit wird von den jeweiligen Sinnen hervorgebracht und gleichzeitig wahrgenommen, so daß sie bereits im Akt der 496 Ausführlich dazu: Kap. III, 4 dieser Arbeit; aber auch: Pred. 71, DW III, S. 217 ff., wo die Seele immer nur als die Entfaltung der ratio superior als Vollzug der ratio inferior gedacht wird und ihre Extrema bestimmt werden. 497 Ausführlich zu diesem Abschnitt: Kap V, 2 a – c dieser Arbeit. 181 Wahrnehmung dem sechsten Bewußtseinssinn zur begrifflichen Ableitung vorliegt. Ist der Begriff der Hervorbringung der äußerste Aspekt der gesamten Ich-Struktur im Sinne ihrer Entfaltung, so ist der Aspekt der Wahrnehmung, weil Voraussetzung der Reflexion des Denkens, bereits ihr Rückfluß, wird das Denken in der Hierarchie der Bewußtseinssinne der ersten Ursache am nächsten gesetzt. Diese Ursache, als Speicherbewußtsein gedacht, ist der Ursprung und das Ende ihrer eigenen Entfaltung und kann deshalb rein begrifflich als das eine Extremum der gesamten Dynamik verstanden werden, während das andere die Bewußtseinssinne in ihrem hervorbringenden Aspekt darstellt. Wird das Denken keinem der beiden Extreme zugeordnet, jedoch so gedacht, daß es sich, beide voraussetzend, als die Ableitung von Begriffen vollzieht, und wird gleichzeitig die IchIdentität innerhalb der Vielheit als Begriff gedacht, so muß das Denken sowohl die Mitte der Dynamik wie auch der Träger dieser Ich-Identität sein. Der Form nach betrachtet wird das Speicherbewußtsein, bestimmt als Einheit und zweiter Bereich der Ich-Struktur, als Vielheit, mithin ebenfalls als dritter Bereich manifest, und ist daher mit der Vorlage identisch.Und weil das Zen ebenfalls eine Verbindung zwischen den beiden Bereichen im Begriff des siebten Bewußtseinssinnes denkt, muß noch untersucht werden, ob dieser formal dem Begriff der Seele entspricht, die innerhalb des terium comparationis an dieser Stelle gedacht wird. Der als `shiki mana` vorgestellte siebente Bewußtseinssinn, soll er die Einheit als Vielheit entfalten und in sie wieder zurückführen, kann nicht mit einer dieser beiden Seiten gleichgesetzt, noch unabhängig von diesen betrachtet werden, weswegen er, als funktionelle Einheit gedacht und als Vermittler begriffen, den Prozeß der Manifestation in seiner Gesamtheit umfassen muß, weil er dieser Prozeß ist (senkrechte Spalte rechts im Schema). Indem also der siebente Bewußtseinssinn so gedacht wird, daß er den zweiten und den dritten Bereich der Ich-Struktur dergestalt verbindet, daß er als der Vollzug dieser Manifestation bestimmt wird, entspricht er, zunächst formal gesehen, der Struktur der Seele und wird wie diese ebenfalls als die eigentliche Ursache der zeitlichen Ich-Identität angesehen498. Damit beantwortet die innerhalb des Zen gedachte und als Vielheit begriffene Entfaltung des zweiten Bereiches die fragende Hinwendung der abendländischen Selbst-Identität der Form nach positiv. Während diese 498 Vgl. dazu Yasutani Roshi, op. cit., S. 55. Die dort angebrachte Skizze verdeutlicht die Wirkungsweise der Übermittlung und basiert auf der Zeichnung seines Lehres Harada Roshi (P. Kapleau, op. cit., S. 429.) 182 Form, also die Struktur des Ich-Begriffes innerhalb beider als Mystik bestimmten Traditionen identisch gedacht werden muß, kann das Gleiche vom jeweiligen Inhalt ab dem Bereich der als Doppelung bestimmten Einheit nicht mehr mit Notwendigkeit abgeleitet werden, widersprächen die innerhalb der Einheit bestimmbaren Verhältnisse und damit Unterschiede solch einer zwingenden Identität. Weil aber damit die Möglichkeit einer solchen weiterhin besteht – und die für den zweiten Bereich auch bestimmt worden ist - soll diese zum Abschluß innerhalb des dritten Bereiches gedacht werden. Der dritte Bereich der Ich-Struktur innerhalb des Zen konnte in der gleichen Weise wie der eckhartsche als Vielheit bestimmt werden. Inhaltlich - und erneut abendländisch betrachtet - können innerhalb der Vielheit zwei identische Dinge niemals gedacht werden, setzt nämlich dann der Begriff der Identität Unterschied voraus und begibt sich damit – allerdings nur im dritten Bereich – in den Selbstwiderspruch. Die Tatsache aber, daß identische Dinge (Signifikante) nicht gedacht werden können, steht in keinerlei Widerspruch dazu, daß Identisches (Signifikat) sehr wohl gedacht werden kann, worin geradezu der – wiederum abendländische – Gedanke der Vereinheitlichung des Denkens besteht. Indem also das Zen die zeitliche Ich-Identität ebenfalls an den Ich-Begriff koppelt, wird diese (Signifikat) notwendigerweise immer dann gedacht, wenn das Ich-Pronomen (Signifikant) abgeleitet wird. Und weil das unter dem Ich-Pronomen Gedachte und Abgeleitete die Reflexion des Denkens selber ist, denkt das Zen innerhalb des dritten Bereiches der Ich-Struktur das Gleiche, was auch Eckhart an dieser Stelle denkt. Damit ist eine formale wie auch inhaltliche Übereinstimmung der als tertium comparationis vorgedachten plotinischen Ich-Struktur und der auf sie bezogenen eckhartschen wie auch zen-buddhistischen Ich-Struktur gegeben, da sie im Bereich der korrespondierenden Signifikate übereinstimmen. Und weil bei der Voraussetzung der gegebenen Worte diese Übereinstimmung gedacht werden kann, so sind die auftretenden Unterschiede im Bereich der Signifikanten zwar notwendig, in diesem Zusammenhang jedoch zu vernachlässigen. Die Notwendigkeit der Unterschiede ergibt sich nämlich alleine aus der Tatsache, daß der als Signifikant bezeichnete Teil der Sprache, die Phonetik, Grammatik und Orthographie etwa, da zeitlich und räumlich begrenzt, einzig im dritten Bereich der besprochenen IchStruktur auftritt und dort, als Vielheit begriffen, Unterschiede aufweist, weil 183 er per definitionem, eben auf Grund der Unterschiede überhaupt begriffen, mithin erkannt werden kann. Anders formuliert: Innerhalb der Vielheit müssen die Signifikanten immer im Unterschied zueinander gedacht werden, weil das der Voraussetzung ihrer Wahrnehmung und ihrer Erkenntnis zu Grunde liegt. Weil aber innerhalb des Sprachgefüges die Signifikanten niemals ohne die Signifikate und Referenten gedacht, und die Übereinstimmung der korrespondierenden Signifikate innerhalb aller Bereiche der Ich-Struktur hat nachgewiesen werden können, ist der Unterschied im dritten Bereich und bezogen auf die Signifikanten, eben weil notwendiger Teil der Ich-Struktur und damit diese als stets gegebene voraussetzend, der Form nach identisch und deswegen inhaltlich innerhalb dieser Untersuchung zu vernachlässigen499. Die phonetisch, orthographisch und grammatisch unterschiedlichen Signifikanten wie `gotheit`, `Grund der Seele`, `ratio superior und inferior` auf der einen und `Buddhanatur`, `Reines Ich`, `Speicherbewußtsein` und `Denkbewußtsein` auf der anderen Seite, beziehen sich damit entsprechend auf das gleiche Signifikat und denken damit Identisches. 499 Der Schwerpunkt dieser der Religionswissenschaft verplichteten Untersuchung leitet ab und vergleicht die Signifikate, so wie diese es jeweils zulassen. Die Untersuchung der Signifikanten würde den Schwerpunkt dieser Arbeit in den Bereich einer sprachwissenschaftlichen Untersuchung verlegen und den vorgesehnen Rahmen sprengen. 184 VII. SCHLUSSWORT Weil diese Untersuchung der Religionswissenschaft im Besonderen und damit dem abendländischen Wissenschaftsverständnis im Allgemeinen verpflichtet nichts anderes sein kann als der tätige Vollzug der Reflexion des Denkens, ist sie immer schon auf vorhandene Begriffe angewiesen, um diese dann, in Zusammenhängen denkend, aus diesen heraus abzuleiten. Es sind daher Begriffe (Signifikante) auf ihre jeweilige Bedeutung (Signifikate) hin untersucht und die Letzteren miteinander verglichen worden, worin eine Übereinstimmung hat gezeigt werden können. Damit aber ist nicht bewiesen worden, daß der eigentliche Referent beider Ich-Strukturen, das Absolute, identisch ist, kann dieses niemals unmittelbarer Gegenstand der Reflexion des Denkens werden, ohne in Selbstwiderspruch zu treten. Deswegen bewegte sich diese Untersuchung formal und inhaltlich ausschließlich im Bereich der Begriffe, worin, wie gezeigt, durchaus Identitäten gedacht werden können, im Hinblick auf den Begriff des Absoluten (keinesfalls das Absolute selbst) sogar gedacht werden müssen. Und konnte der allgemeinste Begriff dieser Untersuchung als Mystik bestimmt und positiv verglichen werden, so zeigte er sich seinem Inhalt nach mit dem Begriff der Ich-Struktur identisch, die ihrerseits, formal und inhaltlich bestimmt und verglichen, eine strukturelle Identität gezeigt und eine inhaltliche aufgezeigt hat. Jede Befürwortung dieser Untersuchung oder Einwand gegen sie wird sich immer nur im Bereich der als Vielheit bestimmten Reflexion des Denkens bewegen können, so daß dem eigentlichen Inhaltes dieser Arbeit eine Zustimmung oder Ablehnung nur von Personen zukommen kann, welche die unmittelbare Anwesenheit sowohl beim Einheitlichen wie auch beim Einen vollzogen haben. Diese Menschen aber – und diesbezüglich sind sich die Traditionen auf jeden Fall einig – die in der Fülle und aus der Fülle leben – lächeln, wenn sie mit solchen Bemühungen, wie diese Untersuchung es ist, konfrontiert werden, was schon eigentlich Kritik genug ist. 185 NACHWORT Der anfangs gestellten Frage nach der Werte-Hierarche im Zeitalter der Globalisierung ist im Laufe dieser Untersuchung mit der Ich-StrukturAnalyse entgegnet worden, einem Wissen, das gleichermaßen zum Bestandteil der christlichen wie auch der buddhistischen Religiosität zählt, und das mit allergrößten Wahrscheinlichkeit überall dort anzutreffen sein wird, wo die wissende Betrachtung ihren Ursprung – und damit gleichzeitig ihr Ende – in der absoluten Einheit findet. Die Grundlage der Ethik im Zeitalter der spürbar zunehmenden Globalisierung ist damit eben nicht ein Etwas, welches gesucht und gefunden werden kann analog zu den vielen bisher getroffenen Übereinkünften, weil sich herausstellt – natürlich immer dem religiösen Wissen folgend -, daß diese Grundlage identisch mit der unmittelbaren Anwesenheit beim Absoluten sein muß, daher jeglicher Identitätsbildung immer schon vorausgeht und zugrunde liegt, um diese als Prozeß ihrer eigenen Entfaltung zu ermöglichen. So gesehen kann die derzeit verstärkt wahrgenommene und als Globalisierung begriffene Tendenz der Weltbevölkerung bereits als der Vollzug der sich manifestierenden Einheit begriffen werden. Dies um so mehr, als bei der Voraussetzung der absoluten Einheit nicht mehr aus dem gewohnten Zusammenhang gedacht und argumentiert werden kann, wonach das Geschehen innerhalb der Schöpfung im Laufe der Zeit und auf Grund menschlicher Verfehlungen eine vom Schöpfer unabhängige Richtung und damit gar gewisse Eigenständigkeit angenommen habe, denn die Konsequenz aus der dargestellten Perspektive besteht darin, daß jeder Zustand, Einsicht, Ansicht, Verlauf und damit Identität bereits nichts anderes sein können als die unmittelbare Manifestation des Einen selbst im Vollzug, ganz gleich ob dies als angenehm oder unangenehm wahrgenommen wird. Ist dem so, dann muß das Erscheinen und Verschwinden der Identitäten – womit immer nur konkrete Menschen, Organisationen, Völker, Staaten usw. gemeint sind – die Art und Weise der Anwesenheit des Absoluten an sich sein, dessen unmittelbares Gewahrwerden mit der globalen Identität einhergeht. Diese wiederum ereignet sich im „blitzartigen“ Vollzug der völligen Nicht – Identität, da alles andere notwendigerweise bereits ein 186 Etwas, mithin Identität sein muß, und damit niemals die letzte Ursache derselben sein kann. Was kann daraus für den Alltag geschlossen werden? Zunächst: daß der Zugang zu der Globalen Identität in jedem von uns der Struktur nach angelegt ist, weswegen diesbezüglich und von Grund auf völlige Gleichberechtigung unter uns Menschen herrscht. Darüber hinaus erlaubt diese Betrachtungsweise, den Globalisierungsprozess im neuen Licht zu sehen: Es stellt sich nämlich heraus, daß die globale Identität im Zuge der Globalisierung niemals erreicht werden wird, weil sie nicht erreicht werden muß, da sie bereits dieser als Gegenwart und damit als der Ist-Zustand immer schon vorausgeht. Die von uns wahrgenommene Globalisierung bleibt damit in den allermeisten Fällen nichts anderes als die Ausbreitung und Ausdehnung einzelner Identitäten mit der Absicht, die eigene Herrschaft über größere Zusammenhänge herstellen zu wollen. Daß dieser Prozess zuweilen äußerst schmerzhaft ist und mit viel Leid einhergeht, versteht sich von selbst. Die so erreichte globale Dominanz ist – wörtlich betrachtet – die Pervertierung der globalen Identität, die diesen Kampf per definitionem überhaupt nicht nötig zu haben scheint, weiß nämlich die aus dem Bewußtsein der globalen Identität heraus vollzogene Tat oder Handlung – völlig unabhängig von ihrer Größe und Dauer – um ihre grenzenlose Bedeutung. Das innerhalb der Religionen mit dem Begriff der Mystik angedeutete Gewahrwerden der Dynamik der eigenen Ich-Struktur löst ihre erscheinende Oberfläche – nämlich das bunte Treiben unserer Welt – weder auf, noch trägt es sich mit der Absicht, diese verändern zu wollen. Vieles, und vielleicht sogar alles kann und muß bleiben so wie es ist, weil die Ankunft in der unmittelbaren Anwesenheit beim Einen allem zuvor in eine Haltung der Demut und der Liebe gegenüber seinen Manifestationen mündet. 187 LITERATURVERZEICHNIS Primärliteratur 1. Christlich-Abendländische Tradition Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke, hrsg. im Auftrag der deutschen Forschungsgemeinschaft, Stuttgart 1936 ff.: Predigten, in: Deutsche Werke Bd. I – III, hrsg. und übers. von J. Quint, Stuttgart 1958, 1971, 1976. Traktate, in: Deutsche Werke Bd. V, hrsg. und übers. von J. Quint, Stuttgart 1963. Questiones Parisiensis I – V, in: Lateinische Werke V, hrsg. und übers. von B. Geyer, Stuttgart 1936. Prologus generalis in opus tripartitum, in: Lateinische Werke I, hrsg. und übers. von K. Weiß, Stuttgart 1964. Prologus in opus propositionum, in: Lateinische Werke I, hrsg. und übers. von K. Weiß, Stuttgart 1964. Prologus in opus expositionum I und II. in: Lateinische Werke I, hrsg. und übers. von K. Weiß, Stuttgart 1964. Expositio libri Genesis, in: Lateinische Werke I, hrsg. und übers. von K. Weiß, Stuttgart 1964. Liber parabolarum Genesis, in: Lateinische Werke I, hrsg. und übers. von K.Weiß, Stuttgart 1964. Expositio libri Exodi, in: Lateinische Werke II, hrsg. und übers. von K.. Weiß, Stuttgart 1992. Sermones et lectiones super Ecclesiastici, in: Lateinische Werke II, hrsg. und übers. von J. Koch, Stuttgart 1992. Expositio libri Sapientiae, in: Lateinische Werke II, hrsg. und übers.von J. Koch, Stuttgart 1992. Expositio sanc. ev. sec. Iohannem, in: Lateinische Werke III, hrsg. und übers. von K. Christ, B. Decker, J. Koch, H. Fischer, A. Zimmermann, Stuttgart 1994. Sermones, in: Lateinische Werke IV, hrsg. und übers. von E. Benz, B. Decker, J. Koch, Stuttgart 1956. 188 Anselmus Cantuariensis, Proslogion, ed. Fr. S. Schmitt, in: Opera omnia, Tom. I, Stuttgart/Bad Cannstadt 1968, S. 97. Aristoteles, Metaphysica, ed. W. Jaeger, Oxonii 1955. Augustinus, Aurelius, De trinitate, in: Patrologia Latina, Paris 1841 – 1849, Bd. 8, S. 819. In Johannis evangelium; in: Patrologia Latina, Paris 1841 – 1849, Bd. 3, S. 1379. De libero arbitrio, in:Patrologia Latina, Paris 1841 – 1849, Bd. 1, S. 1221. De civitate dei, in Patrologia Latina, Paris 1841 – 1849, Bd. 7, S. 13. Descartes, R., Meditationes de Prima Philosophia, in: Oeuvres de Descartes, ed. Adam & Tannery, Bd. VII, Paris 1996, S. 1. Fichte, J. G., Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, in J. G. Fichte-Gesamtausgabe, hrsg.: R. Lauth und H. Gliwitzky, Stuttgart-Bad Cannstatt 1970, Bd. 4, S. 167. Hegel, G. W .F., Enzyklopädie der philosophischen Grund wissenschaften im Grundrisse, hrsg.: W. Bonsiepen und H.Ch. Lucas, in: Gesammelte Werke Bd. XX, Hamburg 1992. Grundlinien der Philosophie des Rechts, GA ed. H. Glockner, Reprint Stuttgart-Bad Cannstadt 1964, S. 35. Kant, I., Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, hrsg.: Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften, in: Gesammelte Schriften Bd. III, Berlin 1911 S. 7. Plotin, Enneaden, in: Schriften I – VI, übertr. von R. Harder, Hamburg 1956. Thomas Aquinas, Summa theologiae; in: Opera omnia, Romae 18881921, Bd. IV. Summa contra gentiles; in: Opera omnia, Romae 1888-1921, Bd. XIII. 189 2. Buddhistische Tradition Die Angabe der Primärliteratur für den Bereich des Zen bezieht sich ausschließlich auf die Kôans, Mondôs und Teishôs der ZenPatriarchen und der Zen-Meister, die gemäß der Tradition nur auf Grund der vollständigen Übertragung – Inka – den Kanon der ZenOrthodoxie bilden können. Bi – Yan – Lu, Niederschrift von der Smaragdenen Felswand, Bd. I - III, hrsg. von W. Gundert, Leipzig/Weimar 1980. Dogen Zenj`s, Shobogenzo. Die Schatzkammer der Erkenntnis des wahren Dharma, Bd. I und II, Zürich/München/Berlin 1997. Jäger, W., Geh den inneren Weg – Texte der Achtsamkeit und Kontemplation, Freiburg i. Br. 1999. Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Bewußtseinswandel durch den Weg nach innen. Vorträge-Ansprachen-Erfahrungsberichte, Petersberg 1996. Die Suche nach der Wahrheit, Petersberg 1999. Huang-Po, in: Die Lehre des Huang-Po vom Universalbewußtsein, hrsg.: Muralt v. R., Meditationssutras des Mahayana – Buddhismus Bd. II. Zürich 1956. S. 9 – 48. Hui Hai, Der Weg zur blitzartigen Erleuchtung, hrsg.: Muralt v. R., Meditationssutras des Mahayana – Buddhismus Bd. II. Zürich 1956. S. 135. Merzel, D.G., W sercu Zen – oko nigdy nie śpi, Warszawa 1994. Mumonkan – Die torlose Schranke, München 1989. Muralt v. R. Hrsg., Meditationssutras des Mahayana – Buddhismus Bd. I und II. Zürich 1956. Nāgārjuna, Madhyamakakārika, auszugsweise übertragen von E. Frauwallner, Die Philosophie des Buddhismus, Berlin 1994, S. 178; auszugsweise übertragen von Schumann H.W., Mahâyâna – Buddhismus, München 1990, S. 58. Nakagawa, F., Zen – Weil wir Menschen sind, Berlin 1997. 190 Seung Sahn, Strzepując popiól na Buddę, Warszawa 1990. Shâkyamuni Buddha, Majjima-Nikâya, in: Pali Text Society Vol.I, London 1954. Suzuki, S, Zen – Geist Anfänger – Geist, Zürich/München/Berlin 1975. Vasubandhu, Sagâthaka, auszugsweise übertr. von H.W.Schumann, Mahâyâna – Buddhismus, München 1990. S. 75. Trimśikā Vijñaptimātratāsiddahih, auszugsweise übertr. von E. Frauwallner, Die Philosophie des Buddhismus, Berlin 1994, S. 351. Yuasutani, H., Osiem podstaw buddyzmu zen, Gdańsk 1993. Sekundärliteratur P. Antes, Religion in den Theorien der Religionswissenschaft, in: Handbuch der Fundamentaltheologie, hrsg. W. Kern u.a., Bd. I, Freiburg 1985. Bayer, H., Mystische Ethik und empraktische Denkform. Zur Begriffswelt Meister Eckharts, in: Deutsche Vierteljahreschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 50, 1976. Beierwaltes, W., Plotin. Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7). Übers., eingel. und kommentiert Frankfurt a.M. 1967. Beierwaltes, W., Platonismus und Idealismus, Frankfurt 1972. Benz, E., Mystik als Seinserfüllung bei Meister Eckhart, in: Sinn und Sein. Ein philosophisches Symposion, hrsg. von R. Wisser, Tübingen 1960. Zur neuesten Forschung über Meister Eckhart, Zeitschrift für Kirchengeschichte LVII. 1938. Boeder,H., Topologie der Metaphysik, Freiburg-München 1980. Bracken, E. von, Meister Eckhart und Fichte, Würzburg 1943. 191 Brück, M. von, / Lai, W., Buddhismus und Christentum – Geschichte, Konfrontation, Dialog, München 1997. Brück, M. von, Buddhismus. Grundlagen – Geschichte – Praxis, Gütersloh 1998. Ceming, K., Einheit im Nichts. Die mystische Theologie des Christentums, des Hinduismus und Buddhismus im Vergleich. Augsburg 2004. Chatelet, F. Hrsg.,Geschichte der Philosophie Bd. I bis IV, Frankfurt 1973. Chojecki, A., Mowa mowy – o języku wspŏłczesnej humanistiki, Gdańsk 1997. Die zehn Ochsenbilder, Pfullingen 1986. Dietsche, B., Der Seelengrund nach den deutschen und lateinischen Predigten Meister Eckharts, in: Meister Eckhart der Prediger, hrsg. P. M. Nix, R. Oechslin O.P., Freiburg 1960. Dumoulin, H., Geschichte des Zen-Buddhismus, Bd. I und II, Bern/München 1985-86. Eberle, J., Die Schöpfung in ihren Ursachen. Untersuchung zum Begriff der Idee in den Lateinischen Werken Meister Eckharts, Diss. Köln 1972. Egerding, P., Gott bekennen – Strukturen der Gotteserkenntnis bei Meister Eckhart. Interpretation ausgewählter Predigten, Frankfurt/Bern/New York 1984. Enders, M., Denken des Unübertrefflichen, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie I/2002, S. 50 ff. Enders, M., Selbsterkenntnis „im Seelengrund“ in: T. Kobusch, B. Mojsisch, O.F. Summerell (Hrsg.): Selbst – Singularität – Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum deutschen Idealismus, Amsterdam/Philadelphia 2002, S. 203 ff. Enders, M., Ist ‚Religion’ wirklich undefinierbar? Überlegungen zu einem interreligiös verwendbaren Religionsbegriff, in: M. Enders/H. Zaborowski (Hrsg.), Phänomenologie der Religion. Zugänge und Grundfragen, Freiburg/München 2004, S. 49 ff. 192 Enomiya-Lassalle, H. M., Zen und christliche Mystik, Freiburg i. Br. 1986. Zen-Meditatin für Christen, Weilheim 1969 Wohin geht der Mensch? Zürich/Einsiedeln/Köln 1981. Mein Weg zum Zen, München 1988. Erbstösser,M./Werner,E., Ideologische Probleme des mittelalterlichen Plebejertums. Die freigeistige Häresie und ihre sozialen Wurzeln, Berlin 1960. Feil, E. (Hrsg.), Streitfall „Religion“. Diskussionen zur Bestimmung und Abgrenzung des Religionsbegriffs (= Studien zur systematischen Theologie und Ethik 21), Münster 2000. Finke, H., Meister Eckhart und J.G. Fichte, Diss. Greifswald 1934. Flasch, K., Einführung in die Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1987. Die Intention Meister Eckharts, in: Sprache und Begriff. Festschrift B. Liebrucks, Meisenheim a. Glan 1974. Meister Eckhart und die „Deutsche Mystik“ – Zur Kritik eines historiographischen Schemas, in Olaf Pluta ( Hrsg.), Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert – in memoriam Konstanty Michalski, Amsterdam 1988, S. 439. Frauwallner, E., Die Philosophie des Buddhismus, Berlin 2. A. 1958. Goris, W., Der Mensch im Kreislauf des Seins. Vom >Neuplatonismus< zur >Subjektivität< bei Meister Eckhart, in: T. Kobusch/B. Mojsisch/O.F. Summerell (Hrsg.): Selbst – Singularität – Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum Deutschen Idealismus, Amsterdam/Philadelphia 2002, S. 185 ff. Haag, W., Christliche Mystik am Beispiel Jan van Ruusbroec und ungegenständliche Meditation ( Zen ). Diss., München 1991. Haas, A. M., Gottleiden – Gottlieben. Zur volkssprachlichen Mystik im Mittelalter, Frankfurt am Main 1989. Haas, A. M., Zur Frage der Selbsterkenntnis bei Meister Eckhart, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 15, 1968. 193 Haußig, H.-M., Der Religionsbegriff in den Religionen. Studien zum Selbstund Religionsverständnis in Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Islam, Berlin 1999. Hedwig, K., Negatio negationis. Problemgeschichtliche Aspekte einer Denkstruktur, in: Archiv für Begriffsgeschichte 24, 1980. Heidegger, M, Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1985. Heiler, Fr., Die Bedeutung der Mystik für die Weltreligionen, München 1919. Heussi, K., Meister Eckhart. Studien der Luther-Akademie, Neue Folge/ Heft 1, Berlin 1953, S. 5. Hof, H., Scintilla animae. Eine Studie zu einem Grundbegriff in Meister Eckharts Philosophie mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses der Eckhartschen Philosophie zur neuplatonischen und thomistischen Anschauung, Lund/Bonn 1952. Jaspers, K., Die großen Philosophen, München/ Zürich 3. A. 1981. Bd. 1 und 2. Johannes Paul II, Die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Hrsg.: Vittorio Messori, Hamburg 1994. Kapleau, P., Die drei Pfeiler des Zen. Lehre – Übung – Erleuchtung, Bern/München 1979. Karrer, O., Das Göttliche in der Seele bei Meister Eckhart. Abhandlung zur Philosophie und Psychologie der Religion, Würzburg 1928. Katz, N., Buddhist images of human perfection. The Arahant of the SuttaPitaka compared with the Bodhisattva and the Mahâsiddha, Delhi 1982. Kobusch, T., Bedingte Selbstverursachung. Zu einem Grundmotiv der neuplatonischen Tradition, in: T. Kobusch, B. Mojsisch, O.F. Summerell (Hrsg.): Selbst – Singularität – Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum deutschen Idealismus, Amsterdam/Philadelphia 2002, S. 155 ff. Kopper, J., Die Metaphysik Meister Eckharts. Habilitation, Saarbrücken 1955. 194 Manser, G., Das Wesen des Thomismus, Freiburg 1949. Manstetten, R., Esse est Deus: Meister Eckharts christologische Versöhnung von Philosophie und Religion und ihre Ursprünge in der Tradition des Abendlandes, München 1993. McGinn, B., Die Mystik im Abendland, 3 Bde. Aus dem Engl. übers. von Clemens Maaß u.a., Freiburg/Basel/Wien 1994 - 1999. Menke, K. H., Stellvertretung: Schlüsselbegriff christlichen Glaubens und theologische Grundkategorie, Einsiedeln/Freiburg 1992. Merton, T., Weisheit der Stille, Bern/München 1975. Mieth, D., Die Einheit von Vita activa und Vita contemplativa in den deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler – Untersuchungen zur Struktur des christlichen Lebens, Regensburg 1969. Mojsisch, B., Die Theorie des Ich in seiner Selbst – und Weltbegründung bei Meister Eckhart, in: C. Wénin (Hrsg.): L‘ homme et son univers au moyen âge, Louvain-la-Neuve, 1982, Bd. 1, S. 267 – 272. Mojsisch, B., <Dieses Ich>: Meister Eckharts Ich-Konzeption, in: K. Flasch/ U.R. Jeck (Hrsg.): Das Licht der Vernunft. Die Anfänge der Aufklärung im Mittelalter, München 1997, S. 100 ff. Mojsisch, B., Meister Eckhart – Analogie, Univozität und Einheit, Habilitation, Hamburg 1983. Nambara, M., Die Idee des absoluten Nichts in der deutschen Mystik und seine Entsprechungen im Buddhismus. Archiv für Begriffsgeschichte Bd.VI. 1960. Nishitani, K., Was ist Religion? Frankfurt 1992. Notz, K. J., Buddhistische „Sokratik“. Das Schüler-Meister-Verhältnis im Zen, in Didaskalos, Studien zum Lehramt in Universität, Schule und Religion, Festschrift für G. J. Bellinger zum 65 Geburtstag, Hrsg.: H. Horn, Dortmund 1996. 195 Ohashi, R. (Hrsg.), Die Philosophie der Kyoto – Schule. Texte und Einführung, Freiburg/München 1990. Otto, R., Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, München 1917. West-östliche Mystik, Gotha 1926. Das Gefühl des Überweltlichen, München 1932. Panikkar, R., El silencio del Buddha. Una introduccion al ateismo religioso, Madrid 1996. Pfeiffer, F., Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, Bd. II, Meister Eckhart, Leipzig 1857. Radcliff, B. / Radcliff, A., Zen denken – Ein anderer Weg zur Erleuchtung. Freiburg, 1995. Rahner, H., Die Gottesgeburt. Die Lehre von der Geburt Christi im Herzen des Gläubigen, Zeitschrift für katholische Theologie Bd. 59, S. 935. Ruh, K., Meister Eckhart, Theologe. Prediger. Mystiker, München 1985. Die trinitarische Spekulation in deutscher Mystik und Scholastik, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 52, S.271. Geschichte der abendländischen Mystik, Bd I – 4, München 1990 – 1999. Rzepkowski, H., Das Menschenbild bei Daisetz Teitaro Suzuki – Gedanken zur Anthropologie des Zen-Buddhismus, in: Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini Nr. 12, St. Augustin 1971. S. Saussure, F., Grundlagen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1967. Linguistik und Semiologie, Notizen aus dem Nachlaß. Texte, Briefe und Dokumente, Frankfurt 1997. Scheier, C.-A., Die Selbstentfaltung der methodischen Reflexion als Prinzip der neueren Philosophie. Von Descartes zu Hegel. (Symposion Bd. 42) Freiburg/München 1973. Schmid-Leukel, P., Den Löwen brüllen hören. Zur Hermeneutik eines christlichen Verständnisses der buddhistischen Heilsbotschaft, Paderborn 1992. 196 Schneider, U., Der intellektuelle Wortschatz Meister Eckharts, in: Neue deutsche Forschungen, Abt. Philologie, Bd. 1, Berlin 1935. Schneider, U., Einführung in den Buddhismus, Darmstadt 1980. Schulz, W., Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik, Pfullingen 1978. Schumann, H. W., Mahāyāna – Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma – Rades, München 1990. Buddhismus. Ein Leitfaden durch seine Lehren und Schulen, Darmstadt 1973. Sudbrack, J., Meditative Erfahrung – Quellgrund der Religionen? Mainz/Stuttgart 1994. Mystik – Selbsterfahrung – Kosmische Erfahrung – Gotteserfahrung, Mainz/Stuttgart 1988. Suzuki, D.T., Der westliche und der östliche Weg. Über christliche und buddhistische Mystik, Frankfurt a. M. / Berlin 1995. Leben aus Zen: eine Einführung in den Zen-Buddhismus, München 1987. Koan, der Sprung ins Grenzenlose: das Koan als Mittel der meditativen Schulung im Zen, Bern 1988. Wesen und Sinn des Buddhismus. Ur-Erfahrung und Ur-Wissen, Freiburg 1998. Prajna. Zen und die höchste Weisheit, Bern/München/Wien 1990. Shunyata. Die Fülle in der Leere, Bern/München/Wien 1991. Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, Bd. I, Warszawa 1990 Tworuschka, U., Die Religionen der Welt, Gütersloh 1999. Ueda, S., Die Gottesgeburt in der Seele – Die Mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre Konfrontation mit der Mystik des ZenBuddhismus, Gütersloh 1965. Eckhart und Zen am Problem „Freiheit und Sprache“, JoachimWach Vorlesungen der Philipps – Universität Marburg. Hrsg.: M. Kraatz, Leiden 1989. Uhde, B., Erste Philosophie und menschliche Unfreiheit. Studien zur Geschichte der Ersten Philosophie. Teil I: Von den Anfängen bis Aristoteles, Wiesbaden 1976. 197 Uhde, B., „Fiat mihi secundum verbum tuum“. Die Zurücknahme des menschlichen Willens als ein Prinzip der Weltreligionen. Ein religionsphilosophischer Entwurf, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 1/ 2002, S. 87 f. Uhde, B., Gegenwart und Einheit – Versuch über Religion. Unveröff. Habilitationsschrift, Freiburg i. Br. 1982. Uhde, B., Gott der Eine – Dreieinig? Christliche Überlegungen und Anregungen im Gespräch mit Juden und Muslimen, in: Lebendige Seelsorge, 53/2002, S. 19 f. Uhde, B., Judentum: eine „ethnozentrische“ Religion? Eine religionsgeschichtliche Überlegung, in: G. Biemer u.a., Freiburger Leitlinien zum Lernprozeß Christen Juden, Düsseldorf 1981, S. 193 ff. Uhde, B., Katholische Theologie und neuere Philosophie. Zum Verhältnis zweier Wissenschaften, in: G. Stephenson (Hrsg.): Der Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft, Darmstadt 1976, S. 247 ff. Weiß, K., Meister Eckharts Stellung innerhalb der theologischen Entwicklung des Spätmittelalters, in: Studien der Luther-Akademie, Neue Folge/ Heft 1, Berlin 1953, S. 29. Die Seelenmetaphysik Meister Eckharts, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. 52, 1934. Welte, B., Meister Eckhart als Aristoteliker, in: Philosophisches Jahrbuch 69; S. 64. Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg/Basel/Wien 1979. Weiß, B., Der Einfluß Anselms von Cantenbury auf Meister Eckhart, in: Analecta Anselmiana IV/2, Frankfurt 1975. Wilber, K., Eros, Kosmos, Logos. Eine Vision an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend, Franfurt 1996. Wilke, A., Ein Sein – Ein Erkennen. Meister Eckharts Christologie und Śamkaras Lehre vom Atman: Zur (Un-) Vergleichbarkeit zweier Einheitslehren. Bern 1994. 198 Wulf, E., Das Aufkommen neuzeitlicher Subjektivität im Vernunftbegriff Meister Eckharts, Diss. Tübingen 1972. Zapf, J., Die Funktion der Paradoxie im Denken und sprachlichen Ausdruck bei Meister Eckhart, Diss. Köln 1966. Yuasui, T., Christus und Buddha – Versuch einer christologischen Annäherung zum Thema des interreligiösen Dialogs anhand des JohannesEvangeliums und der Schriften des Zen-Meisters Dogen, Diss. Mainz 1981. Lexika Wörterbuch der Religionen, hrsg. Bertholet/Campenhausen/Goldammer, Stuttgart 1976. Das Lexikon des Buddhismus, Freiburg/Basel/Wien 1998. hrsg. K.L.Notz, Bd. I und II, Lexikon der östlichen Weisheitslehren, Bern/München/Wien 1986. Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. W. Kasper u. a., 3.A. Feiburg/Basel/Wien 1998. Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. J.Ritter/K.Gründer, Basel 1976. Ökumene – Lexikon, hrsg. Köger/Löser/Müller-Reinhehl, Frankfurt 1987. 199