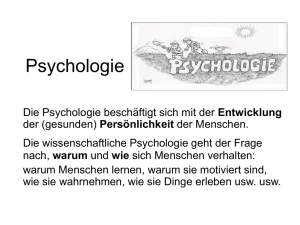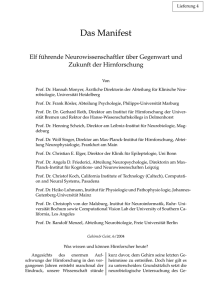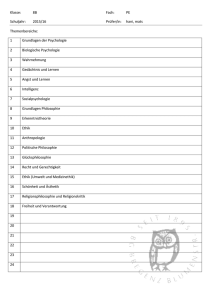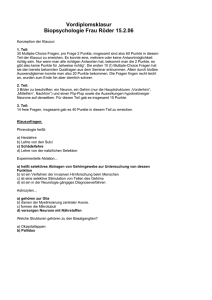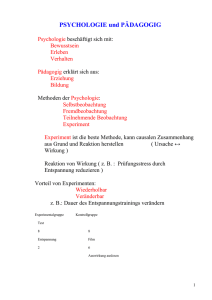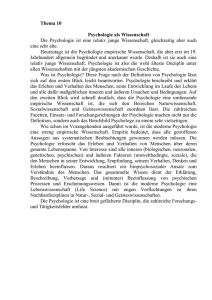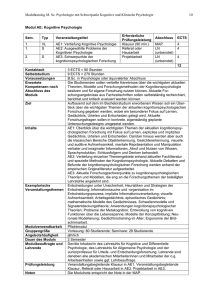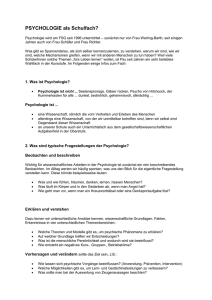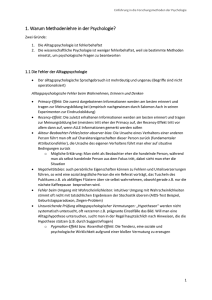Leseprobe - Beck-Shop
Werbung

Atkinsons und Hilgards Einführung in die Psychologie von Edward E Smith, Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L Fredrickson, Geoffrey R Loftus, D.J Bem, S Maren, Joachim Grabowski, J Grabowski Neuausgabe Spektrum Akademischer Verlag 2007 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 8274 1405 2 schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Psychis 15 che Stö rungen D psy ie 1 ch Beh 6 isc he and r S lun tör g un ge n 14 dheit Gesun , ss e tr S ung ig lt ä w und Be rs Pe it 13 hke c i l ön 1 e 17 in e Be al 12 ge nz el li t In zi So g un ss flu 18 nition Kog 1 Emo 1 tion le ozia S 10 Motivation Bio 1 Das Wesen der Psychologie e ess Spr ach e un 9 Ge mung 4 Proz e ch ris nso Se 5 eh Wahrn 6 Bewuss tsein L Ko erne 7 nd n i t ion und ier en log 2 isc der he Gru Psyc n Ps hol dlage yc ogi n hi e sc he 3 En tw ick lu ng dD enk en dä 8 ch tn is ................................ 1 Der Themenbereich der Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Die historischen Wurzeln der Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Die heutigen psychologischen Anstze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Prinzipien psychologischer Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ¤ berblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . im U 38 Das Wesen der Psychologie 1 1 Das Wesen der Psychologie Lesen eröffnet den Zugang zu Bildung und persönlichem Fortschritt. Wie kann man Kinder am besten zum Lesen anhalten? Eine amerikanische Pizzakette glaubt die Antwort zu kennen: Belohne Kinder fürs Lesen! Die Lehrer dieser Kinder setzen monatliche Leseziele fest – in Form von gelesenen Seiten oder Büchern – und geben ihnen Pizza-Gewinn-Coupons, wenn sie diese Ziele erreichen. Ein Kind, das einen solchen Coupon in einem teilnehmenden Restaurant vorzeigt, bekommt eine Pizza umsonst. Eltern und Lehrer geben an, dass dieses Programm funktioniert – es bringt ihre Kinder dazu, mehr zu lesen. Mit Hilfe dieses Programms haben sich Kinder in allen Teilen der USA seit fast 20 Jahren mit ihren Leseaktivitäten Pizzen verdient. Trotz der weiten Verbreitung stellt sich grundsätzlich die Frage, ob dieses Programm auch mit psychologischen Prinzipien vereinbar ist. Was hat die Forschung dazu zu sagen? Auf einen der fundamentalen Lehrsätze der Lerntheorie ist sicherlich jeder schon einmal aufmerksam geworden: Wenn auf ein Verhalten eine Belohnung folgt, verstärkt sich dieses Verhalten. In Kapitel 7 wird sich zeigen, dass Das Gesetz des Effekts dieser mächtige Einfluss besagt, dass sich ein von Belohnungen als GeVerhalten versta¤rkt, setz des Effekts bezeichnet wenn ihm eine Belohwird.1 Wenn man Kinder nung folgt. fürs Lesen mit Pizza belohnt, dann lesen sie mehr. Das klingt doch wie ein großer Erfolg, oder? Betrachten wir andere mögliche Resultate – etwa wie sich Kinder beim Lesen fühlen und ob sie auch dann weiterlesen, wenn das Pizzaprogramm ausläuft. Dutzende von psychologischen Experimenten, von denen viele in Schulklassen durchgeführt wurden, waren auf derartige Fragen gerichtet. In einem klassischen Experiment (Greene, Sternberg & Lepper, 1976)2 sorgten Psychologen dafür, dass die Lehrer den Schülern mehrere neue Rechenspiele beibrachten und dann zwei Wochen lang einfach nur beobachteten, wie viel Zeit die Kinder mit diesen Spielen verbrachten. In der dritten Woche wurden manche Klassen dafür belohnt, dass sie diese MatheSpiele spielten, andere Klassen erhielten keine Belohnung. Erwartungsgemäß erhöhten die Belohnungen die Menge an Zeit, welche die Kinder mit den Spielen verbrachten; das Gesetz des Effekts behielt seine Gültigkeit. Doch was geschah mehrere Wochen später, als die Belohnungen ausgesetzt wurden? Diejenigen Kinder, die Belohnungen erhalten hatten, verloren plötzlich jegliches Interesse an den Rechenspielen und widmeten ihnen praktisch überhaupt keine Zeit mehr. Im Gegensatz dazu spielten diejenigen Kinder, die niemals dafür belohnt worden waren, die Rechenspiele auch dann noch regelmäßig weiter. Dieses Experiment zeigt, wie Belohnungen manchmal nach hinten losgehen und das intrinsische Interesse von Kindern an Tätigkeiten wie Lesen und Rechnen unterminieren. Wenn Menschen merken, dass ihr Verhalten von einem äußeren, in der Situation liegenden Faktor – wie einer Gratispizza – verursacht wird, dann berücksichtigen sie nicht mehr mögliche innere, in ihrer Person liegende Faktoren – wie ihr Ver- 1 2 Im Verlauf dieses Buches werden zentrale Begriffe fett hervorgehoben, und sie werden am Rand definiert. An vielen Stellen im Buch finden sich Literaturangaben, welche durch die Namen der Autoren und die Jahreszahl des Erscheinens der Publikation zitiert werden; sie belegen oder erweitern die dargelegten Aussagen und Behauptungen. Detaillierte Informationen u¤ber die Publikationen dieser Untersuchungen finden sich im Literaturverzeichnis am Ende des Buches. 2 gnügen an dieser Tätigkeit. Wenn sich Kinder also die Frage stellen, warum sie lesen, werden sie sagen, dass sie es um der Pizza willen tun. Und wenn es keine Pizza mehr zu gewinnen gibt, sehen sie keinen besonderen Grund mehr dafür, warum sie jetzt noch lesen sollten. Selbst wenn ihnen das Lesen Spaß Der Effekt der u ¤ bermachte, spielten die Belohma¤igen Rechtfertinungen eine größere Rolle. gung besteht darin, Dieser korrumpierende Eindass man nach einer fluss von Belohnungen ist Belohnung sein Verhalder Effekt der übermäßigen ten mit situationalen Rechtfertigung – man legt Ursachen erkla¤rt und bei der Erklärung des eigedie perso¤nlichen Gru¤nde unterscha¤tzt. nen Verhaltens zu viel Betonung auf offensichtliche situationale Ursachen und misst den persönlichen Gründen zu wenig Bedeutung bei. Man könnte jetzt annehmen, dass die Noten in der Schule ebenfalls Belohnungen für das Lernen darstellen. Führen Noten genauso zu gegenteiligen Effekten wie Pizza-Belohnungen fürs Lesen? Nicht in derselben Weise. Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass die Note, die man in einem Fach bekommt, von der eigenen Leistung abhängt. Forschungsergebnisse zeigen, dass leistungsabhängige Belohnungen mit geringerer Wahrscheinlichkeit das Interesse unterwandern, manchmal sogar interessenssteigernd wirken, weil sie einem die Rückmeldung geben, dass man eine Tätigkeit gut beherrscht (Tang & Hall, 1995). Aber dennoch kann die Konzentration auf Noten das eigentliche Interesse überschatten, das man für einen Gegenstand aufbringt. Es hilft, sich immer wieder daran zu erinnern, dass die beiden Gründe, warum man sich mit seinem Lernstoff befasst, nebeneinander bestehen können: Man will eine gute Note bekommen, und man findet den Lernstoff interessant. Hier kann ein „Sowohl-als-auch“ vorliegen, nicht nur ein „Entweder-oder“. Zum Glück finden die meisten Studenten Psychologie ganz spannend. Das gilt auch für uns, die Autoren, und wir wollen unser Bestes tun, um diese Faszination durch unser Buch zu vermitteln. Die Psychologie interessiert die Menschen, weil sie Fragen stellt, die praktisch jede Facette unseres Lebens berühren: Wie beeinflusst der Erziehungsstil unserer Eltern unseren Umgang mit den eigenen Kindern? Wie kann man Drogenabhängigkeit am besten behandeln? 1 Das Wesen der Psychologie Kann ein Mann genauso gut für einen Säugling sorgen wie eine Frau? Kann man sich unter Hypnose genauer an ein traumatisches Ereignis erinnern? Wie müsste man ein Atomkraftwerk konstruieren, um das Risiko menschlichen Versagens möglichst gering zu halten? Welche Auswirkungen hat andauernder Stress auf das Immunsystem? Ist eine Psychotherapie bei der Behandlung von Depressionen wirksamer als Medikamente? Psychologen forschen, um auf diese und viele weitere Fragen Antworten zu finden. Die Psychologie wirkt sich auf unser Leben auch durch ihren Einfluss auf die Gesetzgebung und die politischen Diskussionen aus. Psychologische Theorien und Forschungsarbeiten haben sich auf Gesetze ausgewirkt, die mit Fragen der Diskriminierung, der Art des Strafvollzugs, der Zeugenvernehmung vor Gericht, der Pornographie, des sexuellen Verhaltens oder der persönlichen Verantwortung für menschliches Handeln befasst sind. Zum Beispiel sind Tests mit dem sogenannten Lügen-Detektor vor Gericht nicht beweisfähig, weil die psychologische Forschung ihre nicht akzeptable Ungenauigkeit nachgewiesen hat. Weil die Psychologie so viele Bereiche unseres Lebens betrifft, müssen viele Berufsgruppen auch dann Kenntnisse über dieses dynamische Gebiet besitzen, wenn sie sich nicht darauf spezialisieren wollen. Ein Einführungsbuch in den Gegenstandsbereich der Psychologie sollte ein besseres Verständnis dafür vermitteln, warum jemand so denkt wie er denkt und so handelt wie er handelt. Es sollte auch Einblicke in die eigenen Einstellungen und Reaktionen ermöglichen. Das vorliegende Lehrbuch will auch dazu beitragen, die vielen Behauptungen, die im Namen der Psychologie aufgestellt werden, sachkundig bewerten zu können. Jeder kennt Schlagzeilen wie diese: Neue Psychotherapieform erleichtert Zugang zu verdrängten Erinnerungen Angst lässt sich durch Selbstregulation von Gehirnströmen steuern Beweis für geistige Telepathie gefunden Babys lernen sprachliche Laute im Schlaf Emotionale Stabilität hängt von Familiengröße ab Süße Getränke steigern die Prüfungsleistung Transzendentale Meditation erhöht die Lebenserwartung 3 Der Themenbereich der Psychologie Sorgen um das eigene Aussehen fordern geistigen Tribut Wie können wir entscheiden, ob solchen Behauptungen zu glauben ist? Um ihre Gültigkeit beurteilen zu können, muss man mindestens zwei Dinge wissen. Erstens muss man wissen, welche psychologischen Sachverhalte schon empirisch gesichert sind. Stimmt eine neue Behauptung mit solchen Fakten nicht überein, besteht Grund zur Vorsicht. Zweitens muss man über das Wissen verfügen, mit dem sich bestimmen lässt, ob die Argumente, die für die neue Behauptung sprechen, den Standards wissenschaftlicher Nachweise entsprechen. Ist dies nicht der Fall, ist wiederum Skepsis geboten. Das vorliegende Buch zielt darauf ab, beiden Anforderungen gerecht zu werden. Erstens vermittelt es einen Überblick über den aktuellen Wissensstand der Psychologie: Es stellt die wichtigsten psychologischen Erkenntnisse, das heißt die gesicherten Fakten dar. Zweitens werden die Grundprinzipien wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns erläutert. Das betrifft zum Beispiel die Frage, wie man in der Psychologie ein Forschungsprogramm entwirft, das starke Belege für oder gegen eine Hypothese liefert. Damit weiß man schon vor der eigentlichen Untersuchung, welche Art von Befunden eine neue Behauptung überhaupt stützen können. Das erste Kapitel des Buches beginnt mit der Betrachtung der Fragestellungen, die in der Psychologie untersucht werden. Nach einem kurzen Überblick über die historischen Wurzeln der Psychologie werden die Ansätze und Perspektiven erläutert, unter denen Psychologen ihre Fragestellungen verfolgen. Danach werden die Forschungsmethoden beschrieben, die bei psychologischen Untersuchungen zum Einsatz kommen, einschließlich der dafür vorgeschlagenen ethischen Richtlinien. Der Themenbereich der Psychologie Psychologie ist die Wissenschaft, die sich mit der Beschreibung und Analyse des Verhaltens und der geistigen Prozesse bePsychologie ist die fasst. Unter diese Definition Wissenschaft vom Verfällt eine erstaunliche Vielfalt halten und den geistivon Themen, wie sich an den gen Prozessen. folgenden Kurzbeispielen erkennen lässt. (Alle diese Themen werden an verschiedenen Stellen im Buch ausführlicher behandelt.) Hirnscha¤den und das Erkennen von Gesichtern. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass es sich auf das Verhalten auswirkt, wenn jemand eine Hirnschädigung erleidet. Was dabei überrascht, ist jedoch, dass sich die Schädigung eines bestimmten Teils des Gehirns nur auf einen bestimmten Aspekt des Verhaltens auswirken kann und auf andere Verhaltensbereiche nicht. Beispielsweise gibt es Fälle, in denen jemand als Folge der Schädigung einer bestimmten Region der rechten Hirnhemisphäre vertraute Gesichter nicht mehr erkennen kann – wobei praktisch alle anderen Leistungen weiterhin normal funktionieren. Dieses Störungsbild heißt Prosopagnosie. Ein be- Prosopagnosie bekannt gewordenes Beispiel zeichnet die Unfa¤higkeit, bekannte Gesichhat der Psychiater Oliver ter zu erkennen, infolge Sacks (1990) in seinem einer Scha¤digung der Buch Der Mann, der seine rechten Hemispha¤re. Frau mit einem Hut verwechselte beschrieben. In einem anderen Fall beschwerte sich ein Mann, der unter Prosopagnosie litt, bei einem Kellner, dass ihn jemand dauernd anstarren würde, um dann zu erfahren, dass er in einen Spiegel blickt! Derartige Fälle geben uns Aufschlüsse darüber, wie das Gehirn im Normalfall funktioniert. Sie lassen erkennen, dass psychische Funktionen – wie das Erkennen von Gesichtern – in bestimmten Teilen des Gehirns lokalisiert sind. Die Zuschreibung von Perso ¤nlichkeitsmerkmalen. Angenommen, in einem überfüllten Kaufhaus nähert sich eine Person, die für eine wohltätige Organisation sammelt, einer Kundin 1 4 (z. B. Druck vom Spendensammler oder durch Zuschauer) Spende 50 € Abb. 1.1 Die Zuschreibung von Traits. Wenn wir entscheiden sollen, ob die Ursache fu¤r eine betra¤chtliche wohlta¤tige Spende einer anderen Person in deren Perso¤nlichkeitsmerkmalen (Traits) oder in den Umsta¤nden der Situation liegt, neigen wir eher zu der Annahme, dass das Perso ¤nlichkeitsmerkmal der ausschlaggebende Faktor war. Dies illustriert den fundamentalen Attributionsfehler. 15 10 5 0 1–3 Fru ¤hkindliche Amnesie. Die meisten Erwachsenen können sich noch an Begebenheiten aus ihrer Kindheit erinnern, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Fast niemand kann sich zuverlässig an Ereignisse aus den ersten drei Lebensjahren erinnern. Dieses Phänomen wird als frühkindliche (oder infantile) Amnesie bezeichnet. BetrachFru ¤ hkindliche Amten wir ein bedeutsames Ernesie (auch: infantile Amnesie) bezeichnet eignis wie die Geburt eines das fehlende ErinneBruders oder einer Schwesrungsvermo¤gen an ter. Wenn wir bei der Geburt Ereignisse der ersten schon drei Jahre oder älter drei Lebensjahre. waren, verfügen wir viel- Situationsdruck Traits (z. B. großzügig, mitfühlend) Mittlere Anzahl beantworteter Fragen und bittet sie um eine Spende; diese gibt ohne große Umschweife 50 Euro für die gute Sache. Würde man deshalb vermuten, dass es sich um eine großzügige Frau handelt? Oder denkt man eher, dass sich die Kundin zu der Spende gedrängt fühlte, weil ihr so viele Menschen zusahen? Experimente, in denen derartige Situationen untersucht wurden, haben gezeigt, dass die meisten Menschen dazu neigen, diese Frau als großzügig einzuschätzen, auch wenn der Situationsdruck so groß war, dass sich jeder andere wohl genauso verhalten hätte. Bei der Erklärung des Verhaltens anderer Menschen neigen wir dazu, den ursächlichen Effekt der Persönlichkeitsmerkmale zu überschätzen und den der Situationsfaktoren zu unterschätzen. Diese Urteilsverzerrung nennen Sozialpsychologen den fundamentalen Attributionsfehler (siehe Abbildung 1.1). Wenn wir diesen Effekt dem Effekt Der fundamentale der übermäßigen RechtfertiAttributionsfehler begung gegenüberstellen (der steht darin, dass wir im Zusammenhang mit BePerso¤nlichkeitsfaktoren lohnungen für Leseleistung u¤ber- und Situationsfaktoren unterscha¤tzen, besprochen wurde), erkennen wir die ersten wichtigen um die Ursachen des Verhaltens anderer Unterschiede zwischen der Menschen zu erkla¤ren. Beurteilung des eigenen Verhaltens und der Beurteilung des Verhaltens anderer. Wenn wir unser eigenes Verhalten rechtfertigen wollen, werden situative Ursachen häufig überschätzt und nicht unterschätzt wie beim fundamentalen Attributionsfehler. – Zeitlich überdauTraits sind zeitlich ernde Persönlichkeitsmerku¤berdauernde Perso¤nmale werden in der Psycholichkeitseigenschaften. logie als Traits bezeichnet. 1 Das Wesen der Psychologie 3–5 5–7 7–9 9+ Alter bei Geburt des Geschwisters Abb. 1.2 Fru ¤he Erinnerungen. In einem Experiment zur fru¤hkindlichen Amnesie wurden studentischen Teilnehmern 20 Fragen ¤uber die Ereignisse im Umfeld der Geburt eines ju¤ngeren Geschwisters gestellt. Die durchschnittliche Anzahl beantworteter Fragen ist als Funktion des eigenen Alters bei der Geburt des Geschwisters abgetragen. Erfolgte die Geburt des Geschwisters vor dem vierten Lebensjahr, konnte kein Teilnehmer irgendetwas davon erinnern; erfolgte die Geburt spa¤ter, stieg das Erinnerungsvermo¤gen mit dem Alter der Teilnehmer zum Zeitpunkt des Ereignisses an. (Nach Sheingold & Tenney, 1982.) 5 Der Themenbereich der Psychologie ¤ bergewicht und Adipositas. 37 Prozent der U deutschen Männer und 26 Prozent der deutschen Frauen waren zu Beginn dieses Jahrtausends übergewichtig; die Tendenz ist steigend. In den USA gelten etwa 35 Millionen Amerikaner als fettleibig (adipös) – das heißt, dass ihr Körpergewicht 30 Prozent oder mehr über dem liegt, was für ihre Statur und KörAdipositas (Fettleibigpergröße angemessen wäre. keit) wird bei einem Übergewicht und Adipositas extrem u¤berho¤hten sind gefährlich – sie erKo¤rpergewicht diagnoshöhen die Anfälligkeit für tiziert. Diabetes, hohen Blutdruck und Herzkrankheiten. Psychologen interessieren sich für die Faktoren, die Menschen dazu veranlassen, zu viel zu essen. Ein Faktor scheint vorangegangener Nahrungsentzug zu sein. Wenn Ratten zunächst Nahrung vorenthalten wird, sie also hungern müssen, und sie danach wieder fressen dürfen, bis sie ihr normales Gewicht erreicht haben, und am Ende so viel fressen dürfen, wie sie wollen, dann fressen sie mehr als Ratten, die zuvor nicht hungern mussten. Das Vorenthalten von BedürfnisbefrieDeprivation bedeutet digungen – in diesem Beidas la¤ngere Vorenthalspiel der Nahrung – nennt ten von Bedu¤rfnisbeman in der Psychologie friedigungen. auch Deprivation. Die Auswirkungen von Gewalt in den Medien auf die Aggressivita¤t von Kindern. Es war lange Zeit eine kontrovers diskutierte Frage, ob das wiederholte Anschauen von Gewaltdarstellungen im Fernsehen Kinder aggressiver macht. Zwar glauben viele Beobachter, dass Fernsehgewalt das Verhalten von Kindern negativ beeinflusst, doch schreiben andere dem Zusehen bei Gewalt- darstellungen auch eine mögliche Katharsis-Wirkung zu. Katharsis heißt, dass sich die aggressiven Verhaltenstendenzen verringern, weil die Kinder ihre Katharsis ist die Abfuhr Aggression beim Fernsehen (ÐReinigung) aggressiver Triebspannung indirekt, also ersatzweise durch Ersatzhandlungen zum Ausdruck bringen und (beispielsweise Zusich dadurch ,von der Seele schauen beim Sport schaffen‘ können. Aus der oder bei Krimis). Forschung ergeben sich jedoch keine Anhaltspunkte für kathartische Wirkungen. In einem Experiment sah eine Gruppe von Kindern gewalttätige Zeichentrickfilme und eine andere im gleichen zeitlichen Umfang gewaltfreie Cartoons. Die Kinder der ersten Gruppe wurden bei ihren Interaktionen mit Gleichaltrigen aggressiver, während sich bei den Kindern, die die gewaltfreien Filme gesehen hatten, keine Verhaltensveränderungen zeigten. Diese Effekte können über längere Zeit anhalten: Je mehr Sendungen mit Gewaltszenen ein Junge im Alter von neun Jahren sieht, desto aggressiver wird er wahrscheinlich mit 19 Jahren sein (siehe Abbildung 1.3). 200 Aggression im Urteil Gleichaltriger (nach 10 Jahren) leicht über ein paar Erinnerungen. Wurde unser Geschwister jedoch geboren, bevor wir drei Jahre alt waren, können wir uns wahrscheinlich gar nicht – oder allenfalls bruchstückhaft – erinnern (siehe Abbildung 1.2). Die frühkindliche Amnesie ist vor allem deshalb so erstaunlich, weil unsere ersten drei Lebensjahre überaus reich an Erfahrungen sind: Wir entwickeln uns von hilflosen Neugeborenen zu krabbelnden und brabbelnden Kleinkindern und weiter zu gehenden und sprechenden Kindern. Diese bemerkenswerten Übergänge hinterlassen in unserem Gedächtnis jedoch nur wenige Spuren. 150 100 50 0 Wenig Mittel Viel Gewaltkonsum in der Kindheit Abb. 1.3 Die Beziehung zwischen Gewaltkonsum im Fernsehen im Kindesalter und Aggression im Erwachsenenalter. Eine klassische Untersuchung zeigt, dass die Vorliebe neunja¤hriger Jungen fu¤r Fernsehsendungen, die Gewaltdarstellungen enthalten, mit ihrem aggressiven Verhalten als 19-Ja¤hrige (in der Einscha¤tzung durch Gleichaltrige) zusammenha¤ngt. (Nach Eron, Huesman, Lefkowitz & Walder, 1972.) 1 6 1 Das Wesen der Psychologie zusammengefasst Psychologie betrifft viele Bereiche unseres Lebens und beeinflusst Gesetze und Politik. Um neue psychologische Behauptungen beurteilen zu ko¤nnen, muss man wissen, (1) welche psychologischen Fakten bereits gut gesichert sind und (2) nach welchen Standards wissenschaftliche Nachweise gefu¤hrt werden. Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und den geistigen Prozessen. Der Einzugsbereich der Psychologie ist gro und umfasst Themen wie das Erkennen von Gesichtern, soziale Urteile, Geda¤chtnisleistungen, ¤ bergewicht, Gewalt und viele andere. U nachgefragt 1. Im Text stehen Beispiele fu¤r psychologische Meldungen in der Presse. Suchen Sie im Internet oder in Zeitungen eine Nachricht, die psychologische Themen behandelt. Glauben Sie den dort dargestellten Behauptungen? Warum beziehungsweise warum nicht? 2. Wann ko ¤nnen Sie einer Nachrichtenmeldung vertrauen? Was mu¤ssten Sie daru¤ber hinaus noch wissen, um die psychologische Behauptung, die Sie in Frage 1 herausgesucht haben, als Tatsache zu akzeptieren? Die historischen Wurzeln der Psychologie Die Wurzeln der Psychologie lassen sich bis zu den großen Philosophen der Antike zurückverfolgen, deren berühmteste Vertreter – Sokrates (469 – 399 v. Chr.), Platon (um 428 – 347 v. Chr.) und Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) – grundlegende Fragen über das geistige Leben aufwarfen: Was ist Bewusstsein? Sind Menschen von Natur aus vernünftig oder nicht? Gibt es wirklich so etwas wie Willensfreiheit? Diese und viele ähnliche Fragen sind heute noch so entscheidend wie vor Jahrtausenden. Sie haben mit dem Wesen des Verstandes und der geistigen Prozesse zu tun, und diese sind die wesentlichen Elemente des kognitiven Ansatzes in der Psychologie. Andere psychologische Fragen betreffen den Zusammenhang zwischen Körper und Verhalten beim Menschen, und ihre Geschichte ist nicht minder lang. Hippokrates, der oft als „Vater der Medizin“ bezeichnet Die Physiologie bewird, lebte etwa zur selben fasst sich mit der UnZeit wie Sokrates. Sein star- tersuchung der Funkkes Interesse galt der Physio- tionen des lebenden logie, der Untersuchung der Organismus und seiner Funktionen des lebenden Bestandteile. Organismus und seiner Bestandteile. Er machte viele Der biologische Anbedeutsame Beobachtungen satz zielt darauf ab, darüber, wie das Gehirn die diejenigen neurobioloverschiedenen Organe des gischen Prozesse zu Körpers steuert. Diese Be- bestimmen, die dem obachtungen bereiteten den Verhalten und den Weg für den biologischen geistigen Prozessen zu Grunde liegen. Ansatz in der Psychologie. Die Anlage-UmweltDiskussion Eine der ältesten Debatten Die Anlage-Umweltüber die menschliche Psyche Debatte dreht sich um wird bis heute mit unver- die Frage, ob die minderter Heftigkeit geführt: menschlichen Fa¤higkeiDie Anlage-Umwelt-Debatte ten angeboren oder erdreht sich um die Frage, ob worben sind. die menschlichen Fähigkeiten angeboren oder durch Der Nativismus geht Erfahrung erworben sind. davon aus, dass der Aus der Sicht des Nativismus Mensch mit einem antritt das menschliche Wesen geborenen Wissensvorrat und mit einem Vermit einem angeborenen Wis- sta¤ndnis der Wirklichsensvorrat und einem ange- keit zur Welt kommt. borenen Verständnis der Wirklichkeit in die Welt. Die frühen Philosophen glaubten, dass man durch sorgfältiges logisches Nachdenken und In-sich-Hineinhören Zugang zu diesem Wissen und Verständnis bekommen könnte. Im 17. Jahrhundert griff Descartes die nativistische Sichtweise auf, indem er behauptete, bestimmte Vorstellungen und Ideen (wie Gott, das Selbst, geometrische Axiome, Vollkommenheit und Unendlichkeit) seien angeboren. Descartes ist außerdem deshalb erwähnenswert, weil er sich den Körper als eine Art Maschine vor- 7 Die historischen Wurzeln der Psychologie stellte, die sich so untersuchen lässt wie andere Maschinen auch. Hier liegt die Quelle für den heutigen Informationsverarbeitungsansatz des menschlichen Geistes. Dieser Ansatz wird im weiteren Verlauf des Kapitels noch besprochen. Aus der Sicht des Empirismus wird Wissen durch Erfahrungen und den Umgang mit der Welt erworben. Obwohl Aus Sicht des Empirisschon einige Philosophen mus wird alles Wissen der Antike diese Ansicht teildurch Erfahrungen und ten, wird sie vor allem mit den Umgang mit der Welt erworben, das einem englischen Philosoheit, in die anfa¤nglich phen des 17. Jahrhunderts unbeschriebene tabula verknüpft: mit John Locke. rasa des menschlichen Locke verglich den AusGeistes eingraviert. gangszustand des menschlichen Geistes zum Zeitpunkt der Geburt mit einer tabula rasa, einer unbeschriebenen Wachstafel, in welche die Erfahrung im Laufe der Entwicklung und Reifung Wissen und Verständnis ,eingraviert‘. Aus dieser Sichtweise – und im Rekurs auf die schon bei Aristoteles formulierten Assoziationsgesetze – entstand die Assoziationspsychologie. Die Assoziationisten bestritten die Existenz angeborener Ideen Die Assoziationsoder Fähigkeiten. Stattdessen psychologie vertritt die behaupteten sie, dass Ideen Annahme, dass Ideen und Vorstellungen nur auf durch die Sinne in den Geist gelangen und dort dem Weg über die Sinne in den Verstand gelangen und nach Prinzipien wie ¤ hnlichkeit und KonA dann nach Prinzipien wie trast assoziiert werden. Ähnlichkeit und Kontrast miteinander assoziiert werden. Die aktuelle Lern- und Gedächtnisforschung hat zahlreiche Annahmen der frühen Assoziationstheorie aufgegriffen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die klassische Debatte zwischen Anlage und Umwelt viel nuancierter. Auch wenn einige Psychologen immer noch behaupten, dass das menschliche Denken und Verhalten entweder hauptsächlich biologisch oder hauptsächlich durch Erfahrung determiniert ist, vertreten die meisten Psychologen einen integrierten Ansatz. Sie erkennen an, dass biologische Prozesse (wie Vererbung oder Prozesse im Gehirn) das Denken, Fühlen und Verhalten beeinflussen, aber sehen auch die Spuren der Erfahrung. So lautet die Frage heute nicht, ob Anlage oder Umwelt die Psyche des Menschen formt, sondern vielmehr, wie Anlage und Umwelt dabei zusammenwirken. Wir wer- 1 > Wilhelm Wundt (1832 -- 1920) gru¤ndete im Jahre 1879 das erste psychologische Labor an der Universita¤t Leipzig, wo man ihn hier im Kreise seiner Mitarbeiter sieht. den der Frage nach Anlage- und Umwelteinflüssen in den weiteren Kapiteln noch mehrfach wiederbegegnen. Die Anfa¤nge der wissenschaftlichen Psychologie Obwohl sich Philosophen und Gelehrte seit dem 17. Jahrhundert intensiv mit den Funktionen von Geist, Seele und Körper beschäftigten, wird der Beginn der wissenschaftlichen Psychologie in der Regel erst auf das Ende des 19. Jahrhunderts datiert. Im Jahre 1879 richtete Wilhelm Wundt an der Universität Leipzig das erste psychologische Labor ein. Wundts labor-experimenteller Ansatz wurzelte in der Überzeugung, dass Geist und Verhalten genauso Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung sein können wie Planeten, Chemikalien oder die Organe des Menschen. Wundts eigene Forschungen betrafen vorrangig die Sinne und hier vor allem das Sehen. Er und seine Mitarbeiter untersuchten aber auch Aufmerksamkeit, Gefühle und Gedächtnisleistungen. Wundt nutzte die Intro- Introspektion ist die spektion als Methode zur Beobachtung und ReUntersuchung geistiger Pro- gistrierung der eigenen zesse. Introspektion bezieht Wahrnehmungen, Gesich auf die Beobachtung danken und Gefu¤hle. 8 1 Das Wesen der Psychologie und Beschreibung der Beschaffenheit der eigenen Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle. Beispielsweise berichten Menschen darüber, wie schwer sie ein Objekt empfinden oder wie hell ihnen ein Lichtblitz erscheint. Die Introspektionsmethode stammte aus der Philosophie, doch Wundt erweiterte sie um eine neue Dimension. Reine Selbstbeobachtung reichte nicht aus; sie musste um Experimente ergänzt werden. In Wundts Experimenten wurde eine physikalische Dimension eines Reizes, beispielsweise seine Intensität, systematisch variiert. Die Introspektion wurde dann zielgerichtet eingesetzt, um zu bestimmen, wie diese physikalischen Veränderungen das bewusste Reizerleben der Versuchsteilnehmer modifizierten. Die wissenschaftliche Aussagekraft der Introspektion erwies sich jedoch insbesondere bei sehr schnell ablaufenden geistigen Prozessen und Ereignissen als äußerst begrenzt. Selbst nach ausgiebigem Introspektionstraining lieferten verschiedene Personen ganz unterschiedliche Introspektionsberichte über einfachste sensorische Erfahrungen; aus diesen Unterschieden ließen sich nur wenige gesicherte Schlüsse ziehen. Deshalb ist die Introspektion für den derzeitigen kognitiven Ansatz in der Psychologie von untergeordneter Bedeutung. Wir werden allerdings noch sehen, dass sich die Entwicklung anderer, neuerer Ansätze zum Teil als Reaktion auf die Introspektion begründen lässt. Strukturalismus und Funktionalismus Im 19. Jahrhundert wurden auf den Gebieten der Chemie und der Physik große Fortschritte erzielt, indem es gelang, komplexe Verbindungen (Moleküle) in ihre elementaren Bestandteile (Atome) zu zerlegen. Diese Erfolge ermutigten die Psychologen, gleichfalls nach elementaren geistigen Einheiten zu suchen, die sich miteinander verbinden und auf diese Weise komplexere Erfahrungen hervorrufen können. So wie Chemiker Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen, so könnten Psychologen vielleicht auch den Geschmack von Limonade (Wahrnehmung) in Elemente wie süß, bitter und kalt (Empfindungen) zerlegen. Als führender Vertreter dieses Ansatzes in den USA gilt E. B. Titchener, der nach einer Ausbildung bei Wilhelm Wundt an der Universität von Cornell tätig war. Zur Im Strukturalismus Beschreibung dieser Heran- werden die geistigen gehensweise an psychische Strukturen zergliedert Phänomene führte Titchener und analysiert. den Begriff des Strukturalismus ein – der die Zergliederung oder Analyse geistiger Strukturen bedeutet. Andere Psychologen lehnten die rein analytische Natur des Strukturalismus jedoch ab. William James, ein berühmter Psychologe an der Harvard-Universität, glaubte, man solle weniger Gewicht auf die Analyse der (statischen) Elemente des Bewusstseins und mehr auf das Verstehen seiner dynamischen und persönlichen Beschaffenheit legen. Sein Der Funktionalismus Ansatz, der Funktionalismus, betont die Frage, wie stellt die Frage in den Mittel- sich der menschliche punkt, wie der Verstand ar- Organismus kraft seibeitet, damit sich ein Orga- nes Geistes an seine nismus an seine Umwelt an- Umwelt anpassen und passen und in ihr funktionie- in ihr funktionieren kann. ren kann. Das Interesse der Psychologen des 19. Jahrhunderts an Fragen der funktionellen Anpassung hing mit Charles Darwins Evolutionstheorie zusammen. Es wurde angenommen, dass sich das Bewusstsein nur deshalb herausgebildet hat, weil es für die Lenkung der Aktivitäten eines Individuums irgendeinen Zweck besitzt. Um herauszufinden, wie sich ein Organismus an seine Umgebung anpasst, müssen Psychologen – so sehen es die Funktionalisten – konkretes Verhalten beobachten. Allerdings betrachteten Strukturalisten wie Funktionalisten die Psychologie weiterhin primär als die Wissenschaft vom bewussten Erleben. Behaviorismus In der Entwicklung der Psychologie des 20. Jahrhunderts spielten Strukturalismus und Funktionalismus wichtige Rollen. Beide Standpunkte waren mit einem systematischen Ansatz und mit jeweils einheitlichen Grundprinzipien bei der Erklärung psychischer Phänomene verbunden und wurden deshalb als konkurrierende psychologische Schulen angesehen. Bis 1920 wurden sie Die historischen Wurzeln der Psychologie jedoch von drei neueren Schulen abgelöst: dem Behaviorismus, der Gestaltpsychologie und der Psychoanalyse. Der Behaviorismus hatte den größten Einfluss auf die nordamerikanische Psychologie. Sein Begründer John B. Watson wandte sich gegen die Auffassung, dass das bewusste Erleben der Zuständigkeitsbereich der Psychologie sei. Bei seinen Untersuchungen zum Verhalten von Tieren und Kleinkindern kam Watson ohne jegliche 9 Annahmen über das Bewusstsein aus. Er betrachtete die Tierpsychologie und die Psychologie des Kindes nicht nur als eigenständige empirische Wissenschaften, sondern sah darin auch einen beispielhaften Ansatz für die Psychologie des Erwachsenen. Watson forderte, dass psychologische Daten einer externen, objektiven Einsichtnahme und Kontrolle ebenso zugänglich gemacht werden müssten wie die Daten jeder anderen Wissen- > John B. Watson, William James und Sigmund Freud waren die Schlu¤sselfiguren in den Anfa¤ngen der Psychologie. James entwickelte den sogenannten funktionalistischen Ansatz, Watson begru¤ndete den Behaviorismus, und von Freud stammen Theorie und Methode der Psychoanalyse. 1 10 schaft, um der Psychologie den Rang einer Wissenschaft zu verleihen. Verhalten ist direkt beobachtbar und objektiv beschreibbar (und damit öffentlich), Bewusstsein ist jedoch subjektiv, nur dem Individuum unmittelbar zugänglich (und damit privat). Wissenschaften sollten nur öffentliche Fakten behandeln. Da die Psychologen der Introspektion zunehmend ablehnend gegenüberstanden, setzte sich der Behaviorismus als neue Alternative schnell durch. Viele jüngere Psychologen in den USA bezeichneten sich als Behavioristen. (Die Forschungen des russischen Physiologen Iwan Pawlow über konditionierte Reaktionen bei Hunden galten zwar auch als wichtiger Beitrag der Verhaltensforschung, doch der weit reichende Einfluss des Behaviorismus geht letztlich vor allem auf Watson zurück.) Nach Watson und anderen, die sich dem Behaviorismus zurechneten, resultiert fast jegliches Verhalten aus KondiIm Behaviorismus wird tionierungsprozessen. Dajegliches Verhalten als bei formt die Umwelt das Ergebnis von KonditioVerhalten durch die Vernierungsprozessen gesestärkung bestimmter Verhen; die Umwelt formt haltensgewohnheiten. Gibt das Verhalten durch man einem Kind beispielsVersta¤rkung. weise einen Keks, damit es aufhört zu quengeln, wird dies die Angewohnheit, auch in Zukunft wieder zu quengeln, verstärken (belohnen). Die konditionierte Reaktion wurde als kleinste Verhaltenseinheit angesehen, aus der komplexere Verhaltensweisen aufgebaut werden können. Alle Arten komplexer Verhaltensmuster, die sich durch Erziehung oder spezielles Training ergeben, wurden als nichts anderes als ein miteinander verknüpftes Gefüge konditionierter Reaktionen angesehen. Behavioristen beschreiben psychische Phänomene gewöhnlich in Form von Reiz-ReaktionsZusammenhängen; abgeleitet von den englischen Begriffen „stimulus“ für Reiz und „response“ für Reaktion entstand so der Begriff S-R-Psychologie. Es ist jedoch zu beachten, dass die S-R-Psychologie an sich zunächst weder eine Theorie noch einen Ansatz darstellt, sondern eine Menge von theoretischen Begriffen umfasst, mit denen man bestimmte psychologische Inhalte präzise vermitteln kann. Die S-R-Terminologie wird auch in der heutigen Psychologie bisweilen noch verwendet. 1 Das Wesen der Psychologie Gestaltpsychologie Um das Jahr 1912, etwa zur gleichen Zeit, als sich der Behaviorismus in den USA durchsetzte, kam in Deutschland die Gestaltpsychologie auf. Der Begriff Die Gestaltpsychoder Gestalt – die Betonung logie konzentriert sich auf die Organisation der der Form und Konfiguration menschlichen Erfahvon Reizen – bezieht sich auf rung und die zu Grunde den Ansatz von Max Wert- liegenden Reizmuster: heimer und seinen Kollegen Das Ganze ist mehr als Kurt Koffka und Wolfgang die Summe seiner Teile. Köhler, die alle drei anfangs an der Berliner Universität arbeiteten und ihrer persönlichen und beruflichen Sicherheit wegen später in die USA emigrierten. Die Gestaltpsychologen interessierten sich zunächst primär für die Wahrnehmung. Ihrer Ansicht nach wird das Wahrnehmungserleben von den Mustern, die durch Reize gebildet werden, und von der Organisation der Wahrnehmung bestimmt. Das, was wir tatsächlich sehen, hängt mit dem Hintergrund zusammen, vor dem ein Objekt erscheint, und auch mit anderen Aspekten des Gesamtmusters der Reizkonfiguration, den sogenannten Gestaltfaktoren (siehe Kapitel 5). Dabei ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile, da das Ganze auch von den Beziehungen zwischen den Teilen abhängt. Betrachten wir zum Beispiel Abbildung 1.4, so erkennen wir ein großes Dreieck – als eine einheitliche Form oder Gestalt – und nicht drei kleinere Winkel. Abb. 1.4 Eine Gestaltfigur. Wenn wir nur die drei Ecken eines gleichseitigen Dreiecks sehen, nehmen wir ein groes Dreieck und nicht drei einzelne Winkel wahr. 11 Die historischen Wurzeln der Psychologie Zu den zentralen Interessen der Gestaltpsychologen gehörten die Bewegungswahrnehmung, die Einschätzung von Größen und das Erscheinungsbild von Farben bei variierender Beleuchtung. Diese Interessen führten sie zu einer Reihe von wahrnehmungszentrierten Erklärungen für Lernen, Gedächtnis und Problemlösen, die auch in der aktuellen kognitionspsychologischen Forschung Beachtung finden. Die Gestaltpsychologen beeinflussten auch wichtige Begründer der modernen Sozialpsychologie – zum Beispiel Kurt Lewin, Solomon Asch und Fritz Heider. Diese erweiterten die Gestaltprinzipien mit Blick auf das Verständnis interpersonaler Phänomene (Jones, 1990). Asch (1946) beispielsweise überführte das Gestaltprinzip, nach dem Menschen jeweils das Ganze und nicht dessen isolierte Teile wahrnehmen, vom einfachen Fall der Objektwahrnehmung in den komplexeren Fall der Personenwahrnehmung (Taylor, 1998). Außerdem betrachteten sie den Prozess, durch den einströmende Reize hinsichtlich ihrer Bedeutung und Struktur interpretiert werden, als außerhalb der bewussten Wahrnehmung liegend. Diese Ansicht der Gestaltpsychologie wirkt sich auch heute noch auf die Erforschung der sozialen Kognition aus (siehe Kapitel 18; Moskowitz, Skurnik & Galinsky, 1999). und Handeln jedoch weiterhin beeinflussen. Unbewusste Gedanken kommen auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck, in Träumen, Versprechern und körperlichen Eigenheiten (zum Beispiel Ticks). Bei der Therapie Bei der freien Assovon Patienten setzte Freud ziation sagt man alles, die freie Assoziation ein, bei was einem in den Sinn welcher der Patient alles sa- kommt, wodurch ungen soll, was ihm in den bewusste Wu¤nsche ins Sinn kommt, wodurch unbe- Bewusstsein gelangen wusste Wünsche ins Be- ko¤nnen. wusstsein rücken können. Die Analyse von Träumen diente bei Freud demselben Zweck. In der klassischen Freud’schen Theorie steht hinter unbewussten Wünschen fast immer ein sexuelles oder aggressives Motiv. Deshalb stieß Freuds Theorie in ihrer Zeit nicht auf allgemeine Zustimmung. In der heutigen Psychologie wird Freuds Theorie nicht in vollem Umfang akzeptiert, aber viele Psychologen würden die Ansicht teilen, dass die Vorstellungen, Ziele und Motive von Menschen zuweilen außerhalb ihres reflektierten Bewusstseins wirksam sein können. Neuere Entwicklungen in der Psychologie des 20. Jahrhunderts Psychoanalyse Die Psychoanalyse wurde von Sigmund Freud Anfang des 20. Jahrhunderts begründet; sie ist sowohl eine PersönlichkeitsSigmund Freud begru¤ntheorie als auch eine psychodete die Psychoanatherapeutische Methode. Im lyse, die zugleich Zentrum der Freud’schen Perso¤nlichkeitstheorie Theorie steht das Konzept und Therapiemethode ist. des Unbewussten – also der Gedanken, Einstellungen, Die Gedanken, EinstelImpulse, Wünsche, Beweglungen, Impulse, Wu¤ngründe und Gefühle, derer sche, Beweggru¤nde und wir uns nicht bewusst sind. Gefu¤hle, zu denen wir Freud nahm an, dass die keinen unmittelbaren inakzeptablen (verbotenen Zugang haben, bilden oder unter Strafe stehenden) das Unbewusste. Wünsche der Kindheit aus dem Bewusstsein verdrängt und Teil des Unbewussten werden, wo sie unser Denken, Fühlen Ungeachtet der wichtigen Beiträge, die die Gestaltpsychologie und die Psychoanalyse zum psychologischen Erkenntnisgewinn beisteuerten, dominierte – insbesondere in der amerikanischen Psychologie – bis zum Zweiten Weltkrieg der Behaviorismus. Nach dem Krieg wuchs das allgemeine Interesse an der Psychologie. Hoch entwickelte Geräte und elektronische Ausrüstungen wurden verfügbar, so dass ein breiterer Bereich an Problemstellungen untersucht werden konnte. Dabei wurden die Grenzen der früheren theoretischen Ansätze offensichtlich. Dieser Eindruck verstärkte sich in den 1950er Jahren durch die Entwicklung von Computern. Computer konnten nun Leistungen realisieren, die zuvor nur Menschen vorbehalten waren – beispielsweise Schach spielen oder mathematische Beweise führen. Für Psychologen erwies sich der Computer als mächtiges Werkzeug zur 1 12 Entwicklung von Theorien über psychische Prozesse. In einer Reihe von Aufsätzen, die Ende der 1950er Jahre erschienen, beschrieben Herbert Simon (der spätere Nobelpreisträger) und seine Mitarbeiter, wie sich psychische Phänomene mit Hilfe des Computers simulieren lassen. Viele psychologische Fragestellungen wurden im Rahmen von Informationsverarbeitungsmodellen neu formuliert. Die Vorstellung, In Modellen der Infordass der Mensch im Wesentmationsverarbeitung lichen Informationen verarwird der Mensch wie ein beitet, erlaubte einen dynaInformation verarbeimischeren Beschreibungsantender Computer konsatz als der Behaviorismus. zipiert. Der Informationsverarbeitungsansatz ermöglichte auch, einige Ideen der Gestaltpsychologie und der Psychoanalyse präziser zu formulieren. Auf diese Weise konnten frühere Vorstellungen über die Natur des Geistes in konkreten Modellen beschrieben und mit empirischen Daten verglichen werden. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass unser Gedächtnis ähnlich funktioniert wie ein Computer, der Informationen speichert und wieder abruft. So wie ein Computer Information aus dem internen Arbeitsspeicher (RAM) in die dauerhaftere Speicherung auf der Festplatte überführen kann, so kann auch unser Arbeitsgedächtnis als Zwischenstation auf dem Weg zum Langzeitgedächtnis fungieren (Atkinson & Shiffrin, 1971a; Raaijmakers & Shiffrin, 1992). Auch die Entwicklung der neueren Linguistik in den 1950er Jahren beeinflusste die Psychologie entscheidend. Linguisten fingen an, die geistigen Strukturen, die das Sprechen und Verstehen einer Sprache ermöglichen, in ihre Theorien einzubeziehen. Als Pionier auf diesem Gebiet gilt Noam Chomsky, dessen Buch Syntactic Structures 1957 erschien (deutsch 1973 als Strukturen der Syntax). Mit der Konzeption der Generativen Transformationsgrammatik stimulierte er die ersten bedeutsamen psychologischen Analysen der Sprache und beförderte maßgeblich die Entwicklung der Psycholinguistik. Zur gleichen Zeit wurden auf dem Gebiet der Neuropsychologie wesentliche neue Erkenntnisse gewonnen, welche die Beziehungen zwischen neurologischen Vorgängen in Gehirn und Nervensystem und geistigen Prozessen verdeutlichten. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Weiterentwicklungen der biomedizinischen 1 Das Wesen der Psychologie Technologie rapide Fortschritte bei der Erforschung dieser Zusammenhänge ermöglicht. Roger Sperry erhielt 1981 den Nobelpreis für seinen Nachweis, dass bestimmte Gehirnregionen mit bestimmten Denk- und Verhaltensprozessen zusammenhängen. (Dies wird in Kapitel 2 behandelt.) Mit der Entwicklung des Informationsverarbeitungsmodells, der Psycholinguistik und der Neuropsychologie entstand ein psychologischer Beschreibungs- und Erklärungsansatz, der sehr stark kognitiv orientiert ist. Das Hauptanliegen dieser Kognitiven Psychologie ist zwar die wissenschaftliche Analyse geistiger Prozesse und Strukturen, doch sie behandelt nicht ausschließlich Denken und Wissen. Vielmehr wurde der Ansatz auf viele andere Bereiche der Psychologie ausgedehnt, darunter Wahrnehmung, Motivation, Emotion, Klinische Psychologie, Persönlichkeit und Sozialpsychologie. Dies wird in diesem Buch an vielen Stellen erkennbar werden. Insgesamt ist der Brennpunkt der Psychologie im Verlauf des 20. Jahrhunderts wieder zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass das bewusste Erleben mit den damals verfügbaren wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden nicht zuverlässig erfasst werden konnte, wandte man sich dem offenen, beobachtbaren Verhalten zu. Heute ist eine erneute theoretische wie empirische Hinwendung zu bislang unbeobachtbaren Aspekten des Geistes zu verzeichnen – jedoch mit neuen und mächtigeren Instrumenten. zusammengefasst Die Wurzeln der Psychologie lassen sich bis ins vierte und fu¤nfte vorchristliche Jahrhundert zuru¤ckverfolgen. Eine der fru¤hesten Debatten u¤ber die menschliche Psyche war auf die Frage gerichtet, ob die menschlichen Fa¤higkeiten angeboren sind oder durch Erfahrung erworben werden (die Anlage-Umwelt-Debatte). Die wissenschaftliche Psychologie entstand im ausgehenden 19. Jahrhundert mit der Vorstellung, dass Geist und Verhalten zum Gegenstand wissenschaftlicher Analyse werden ko ¤nnen. Das erste psychologische Labor wurde von Wilhelm Wundt 1879 an der Universita¤t Leipzig begru¤ndet. 13 Die heutigen psychologischen Ansa¤tze Zu den fru¤hen psychologischen ,Schulen des 20. Jahrhunderts geho ¤ren der Strukturalismus, der Funktionalismus, der Behaviorismus, die Gestaltpsychologie und die Psychoanalyse. Spa¤tere Entwicklungen im 20. Jahrhundert betreffen die Theorie der Informationsverarbeitung, die Psycholinguistik und die Neuropsychologie. nachgefragt 1. Welche Annahmen ¤uber das Wesen des Menschen liegen den verschiedenen historischen Ansa¤tzen der Psychologie zu Grunde? 2. Betrachtet man diese zu Grunde liegenden Annahmen: Welche der historischen Ansa¤tze sind miteinander vereinbar? Welche lassen sich nicht ¤ bereinstimmung bringen? in U Die heutigen psychologischen Ansa¤tze Was ist ein psychologischer Ansatz? Im Wesentlichen handelt es sich um eine Perspektive, unter der psychologische Psychologische AnThemen betrachtet werden. sa¤tze unterscheiden Jedem psychologischen Thedanach, wie sie psyma kann man sich aus ganz chologische Themen unterschiedlichen Blickwinbetrachten. keln nähern. Das gilt beispielsweise für jede beliebige Handlung einer Person. Angenommen, Sie schlagen jemandem, der Sie beleidigt hat, ins Gesicht. Aus biologischer Sicht können wir diese Handlung so beschreiben, dass daran verschiedene Bereiche des Gehirns beteiligt sind und dass Nervenzellen feuern, wodurch die Muskeln aktiviert werden, welche die Armbewegung veranlassen. Aus verhaltenspsychologischer Perspektive kann die Handlung ohne Bezug zu irgendwelchen Vorgängen innerhalb des Körpers beschrieben werden. Hier ist die Beleidigung ein Reiz, auf den man mit einem Faustschlag reagiert. Dabei handelt es sich um eine gelernte Reaktion, die in der Vergangenheit belohnt wurde. Man kann die Handlung auch aus einer kognitiven Perspektive analysieren, wobei man sich auf die geistigen Prozesse bei der Entstehung des Verhaltens konzentriert. Aus kognitiver Sicht könnte man den Faustschlag anhand von Zielen und Plänen erklären: Ihr Ziel besteht vielleicht darin, Ihre Ehre zu verteidigen, und aggressives Verhalten ist ein Teil des Plans, um dieses Ziel zu erreichen. Aus psychoanalytischer Sicht würde man die Handlung vielleicht als Ausdruck eines unbewussten Aggressionstriebs beschreiben. Aus konstruktivistischer Perspektive schließlich lässt sich die aggressive Handlung als eine Reaktion verstehen, mit der die Äußerung des Gegenübers als persönliche Beleidigung interpretiert wird. Jeder psychische Vorgang lässt sich auf vielerlei Art charakterisieren. Die fünf in diesem Abschnitt dargestellten psychologischen Ansätze können jedoch als repräsentativ für die heutige Psychologie gelten (siehe Abbildung 1.5). Da sie im Buch immer wieder angesprochen werden, soll hier jeder Ansatz nur kurz gekennzeichnet werden. Dabei ist zu beachten, dass sich die An- Kognitiver Ansatz Verhaltenspsychologischer Ansatz Psychologie Biologischer Ansatz Konstruktivistischer Ansatz Psychoanalytischer Ansatz Abb. 1.5 Ansa¤tze in der Psychologie. Die Analyse psychologischer Pha¤nomene kann aus mehreren Perspektiven erfolgen. Jeder Ansatz bietet eine etwas andere Erkla¤rung dafu¤r, warum sich ein Mensch so und nicht anders verha¤lt, und jeder Ansatz kann einen Beitrag zu unserer Vorstellung von der Gesamtperso¤nlichkeit leisten. Der griechische Buchstabe Psi () wird oft als Abku¤rzung fu¤r ÐPsychologie verwendet. 1 14 1 Das Wesen der Psychologie sätze nicht wechselseitig ausschließen müssen, sondern unterschiedliche Aspekte ein und desselben komplexen PhänoEklektische Ansa¤tze mens im Blick haben könbedienen sich mehrerer nen. Tatsächlich erfordert theoretischer Perspekdas Verständnis vieler psytiven. chologischer Fragen einen eklektischen Ansatz, der mehrere Theorieperspektiven umfasst. Die neuronale Grundlage des Verhaltens Der biologische Ansatz Das Gehirn des Menschen enthält mehr als zehn Milliarden Nervenzellen und eine unvorstellbar große Zahl an Verbindungen zwischen ihnen. Es könnte sich um die komplexeste Struktur im ganzen Universum handeln. Im Prinzip können alle psychischen Vorgänge mit der Aktivität des Gehirns und des Nervensystems in Verbindung gebracht werden. Im Rahmen des biologischen Untersuchungsansatzes wird das äußere Verhalten des Menschen und anderer Spezies mit elektrochemischen und biochemischen Prozessen innerhalb des Organismus in Beziehung gebracht. Unter dem biologischen Ansatz zielt die Forschung primär darauf, Der biologische Andie neurobiologischen Prosatz zielt darauf ab, zesse näher zu bestimmen, diejenigen neurobiolodie dem Verhalten und den gischen Prozesse zu geistigen Prozessen zu Grunbestimmen, die dem de liegen. Bei der ErforVerhalten und den schung der Depression vergeistigen Prozessen zu Grunde liegen. sucht man aus biologischer Sicht beispielsweise, diese Störung auf pathologische Veränderungen im Konzentrationsspiegel von Neurotransmittern zurückzuführen. Neurotransmitter sind chemische Stoffe, die das Gehirn für die Signalübertragung zwischen Nervenzellen produziert und nutzt (siehe Kapitel 2). Der biologische Ansatz kann am Beispiel eines der bereits beschriebenen Probleme illustriert werden. Defizite beim Gesichtererkennen, die bei Patienten mit Hirnschädigungen beobachtet wurden, ermöglichen Rückschlüsse auf die Re- gionen des Gehirns, die auf das Erkennen von Gesichtern spezialisiert sind. Das Gehirn des Menschen ist in die rechte und linke Hemisphäre unterteilt, wobei die für die Gesichtererkennung relevanten Regionen hauptsächlich in der rechten Hemisphäre zu liegen scheinen. Beim Menschen findet man eine ausgeprägte Spezialisierung der Hemisphären. Beispielsweise ist bei den meisten Rechtshändern die linke Hemisphäre auf das Sprachverstehen und die rechte Hemisphäre auf die Interpretation räumlicher Relationen spezialisiert. Der biologische Ansatz hat auch die Gedächtnisforschung befruchtet. Zahlreiche Untersuchungsbefunde weisen auf die Bedeutung bestimmter Gehirnstrukturen, insbesondere des Hippocampus, für die dauerhafte Speicherung von Gedächtnisinhalten hin. Die frühkindliche Amnesie könnte zumindest teilweise auf einen unreifen Hippocampus zurückzuführen sein; diese Gehirnstruktur ist erst ein bis zwei Jahre nach der Geburt voll entwickelt. 3 Der verhaltenspsychologische Ansatz Wie im historischen Überblick bereits erwähnt, konzentriert sich der verhaltenspsychologische Ansatz auf beobachtbare Reize und Reaktionen und Der verhaltensbetrachtet die meisten Ver- psychologische Ansatz konzentriert sich haltensweisen als Ergebnis auf beobachtbare Reize von Konditionierung und und Reaktionen und Verstärkung. So könnte sich betrachtet die meisten eine Verhaltensanalyse unse- Verhaltensweisen als res Soziallebens beispielswei- Resultat von Konditiose darauf konzentrieren, mit nierung und Versta¤rwelchen Menschen wir um- kung. gehen (die sozialen Reize), welche Arten von Reaktionen wir diesen Menschen gegenüber ausführen (ob wir uns belohnend, bestrafend oder neutral verhalten), welche Reaktionen diese Menschen daraufhin uns gegenüber zeigen (positiv, negativ oder neutral) und wie diese Reaktionen die Interaktion aufrechterhalten oder unterbrechen. 15 Die heutigen psychologischen Ansa¤tze Der Verhaltensansatz lässt sich anhand unserer Problembeispiele weiter illustrieren. Beim Übergewicht könnte es etwa so sein, dass manche Menschen nur in Gegenwart bestimmter Reize (etwa beim Fernsehen) zu viel essen (also die spezifische Reaktion ausführen). Viele Programme zur Gewichtskontrolle zielen darauf, diese Reize vermeiden zu lernen. Aggressive Verhaltenstendenzen – zum Beispiel ein anderes Kind zu schlagen – werden Kinder mit höherer Wahrscheinlichkeit zeigen, wenn ihre aggressiven (Re-) Aktionen belohnt werden (das andere Kind gibt klein bei), als wenn sie eine Bestrafung nach sich ziehen (das andere Kind schlägt zurück). Im strikten Verhaltensansatz des klassischen Behaviorismus fanden die geistigen Prozesse des Menschen keine Berücksichtigung. Auch die heutigen Behavioristen stellen im Allgemeinen keine Mutmaßungen über geistige Prozesse an, die zwischen Reiz und Reaktion vermitteln. Abgesehen von den strengen Behavioristen werden Psychologen aber meistens (in Form eines verbalen Berichts) aufzeichnen, was eine Person über ihr bewusstes Erleben sagt, und aus diesen subjektiven Daten Rückschlüsse auf ihre geistigen Aktivitäten ziehen. Viele neuere Entwicklungen in der Psychologie gehen auf Arbeiten der frühen Behavioristen zurück (Skinner, 1981). Dennoch würden sich heute nur wenige Psychologen als strenge Behavioristen bezeichnen. Der kognitive Ansatz Der moderne kognitive Ansatz ist einerseits durch eine Rückwendung zu den kognitiven Wurzeln der Psychologie gekennzeichnet und stellt andererseits eine Reaktion auf die Begrenztheit des Behaviorismus dar, der komplexe menschliche Aktivitäten wie logisches Denken, Planen, Entscheiden und Kommunizieren in der Regel vernachlässigte. Wie schon im 19. Jahrhundert beschäftigt sich der heutige kognitive Ansatz mit geistigen Prozessen Der kognitive Ansatz wie dem Wahrnehmen, Erinbefasst sich mit geistinern, logischen Denken, Entgen Prozessen wie dem scheiden und Problemlösen. Wahrnehmen, Erinnern, Anders als im 19. Jahrhunlogischen Denken, Entdert beruht der aktuelle Koscheiden und Problemgnitivismus allerdings nicht lo ¤sen. mehr auf Introspektion. Stattdessen wird angenommen, dass (1) nur durch die Untersuchung geistiger Prozesse wirklich verstanden werden kann, was Organismen tun, und dass sich (2) geistige Prozesse auf objektive Weise untersuchen lassen, indem man (wie Behavioristen) spezifische Verhaltensweisen betrachtet, diese dann jedoch mit Bezug auf die zu Grunde liegenden geistigen Prozesse interpretiert. Bei derartigen Interpretationen haben sich kognitive Psychologen oft auf eine Analogie zwischen Geist und Computer gestützt. Die einströmende Information wird vom Organismus auf verschiedene Weise verarbeitet: Aus der Menge der insgesamt verfügbaren Informationen wird Information ausgewählt, mit anderen – bereits im Gedächtnis gespeicherten – Informationen verglichen und kombiniert, verändert, neu zusammengestellt und so weiter. Nehmen wir das am Anfang des Kapitels angesprochene Phänomen der frühkindlichen Amnesie. Vielleicht können wir Ereignisse aus den ersten Lebensjahren deshalb nicht erinnern, weil sich die Art und Weise, wie wir unsere Erfahrungen im Gedächtnis organisieren, entwicklungsbedingt verändert. Um das dritte Lebensjahr könnten solche Veränderungen besonders ausgeprägt sein, wenn unsere sprachlichen Fähigkeiten sehr stark anwachsen und die Sprache eine neue Möglichkeit bietet, Gedächtnisinhalte zu organisieren. Der psychoanalytische Ansatz Sigmund Freud entwickelte in Wien die psychoanalytische Konzeption etwa zur selben Zeit, in der auch der Behaviorismus entstand. In mancher Hinsicht handelt es sich bei der Psychoanalyse um eine Mischung aus (Kognitions-) Psychologie und Physiologie auf dem Stand des 19. Jahrhunderts. Insbesondere kombinierte Freud kognitive Vorstellungen von Bewusstsein, Wahrnehmung und Gedächtnis mit der Annahme biologisch begründeter Triebe, um daraus eine kühne neue Theorie des menschlichen Verhaltens zu Nach dem psychoanalytischen Ansatz beentwickeln. ruht das Verhalten auf Die Grundannahme des unbewussten U¤berzeupsychoanalytischen Ansatzes gungen, A¤ngsten und besteht darin, dass das Ver- Wu¤nschen. 1 16 1 Das Wesen der Psychologie halten aus unbewussten Prozessen resultiert. Damit sind Überzeugungen, Ängste und Wünsche gemeint, von denen ein Mensch eigentlich nichts weiß und die sein Verhalten dennoch beeinflussen. Freud glaubte, dass sich viele Impulse, die im Verlauf der Kindheit von den Eltern und der Gesellschaft verboten oder unter Strafe gestellt wurden, aus angeborenen Trieben ableiten. Da wir alle mit diesen Verhaltensimpulsen geboren werden, üben sie einen weit reichenden Einfluss aus, mit dem wir irgendwie zurechtkommen müssen. Sie nur zu verbieten, verdrängt sie aus dem Bewusstsein ins Unbewusste. Dort verschwinden sie jedoch nicht. Sie können als emotionale Probleme und Symptome von Geisteskrankheiten zu Tage treten oder aber als sozial gebilligtes Verhalten, beispielsweise in Form von künstlerischen oder literarischen Tätigkeiten. Wenn man sich beispielsweise über seinen Vater sehr ärgert, mit dem man sich ein Zerwürfnis aber nicht leisten kann, dann wird der Ärger vielleicht ins Unbewusste verdrängt und äußert sich möglicherweise in einem Traum, in dem der Vater bei einem schlimmen Unfall zu Schaden kommt. Freud nahm an, dass wir von denselben Grundinstinkten getrieben sind wie Tiere (vorrangig Sexualität und Aggression) und dass wir uns permanent mit einer Gesellschaft herumschlagen müssen, die großen Wert darauf legt, dass diese Triebimpulse kontrolliert bleiben. Der psychoanalytische Ansatz schlägt somit andere und neue Wege vor, wie man einige der zuvor dargestellten Probleme erklären kann. So behauptete Freud etwa, dass aggressives Verhalten einem angeborenen Trieb folgt. Diese Annahme findet in der Humanpsychologie zwar keine breite Akzeptanz, stimmt aber mit der Sichtweise einiger Biologen und Psychologen überein, die Aggression bei Tieren untersuchen. Der konstruktivistische Ansatz Im konstruktivistischen Ansatz ha¤ngt das Verhalten nicht von der objektiven Welt, sondern von ihrer subjektiven Wahrnehmung ab. Der konstruktivistische Ansatz behauptet, das menschliche Verhalten sei eine Funktion der Welt, so wie sie wahrgenommen wird, und nicht eine Funktion der objektiven Realität. Wie der kognitive Ansatz ging auch der konstruktivistische Ansatz von der Gestaltpsychologie aus und reagierte auf die Einengung des Behaviorismus. Trotz der Nähe zur kognitiven Psychologie war der Konstruktivismus vor allem in der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie sehr einflussreich. Um das Sozialverhalten von Menschen zu verstehen, müssen wir dieser Sichtweise zufolge die einer Person eigene Situationsdefinition erfassen, welche in Abhängigkeit von Kultur, persönlicher Biographie und dem aktuellen Motivationszustand unterschiedlich ausfallen kann. Somit ist dieser Ansatz am stärksten für kulturelle und individuelle Unterschiede offen, wie auch für Wirkungen von Motivation und Emotion. In gewisser Weise spricht die Vorstellung, dass Menschen aktiv ihre eigenen subjektiven Wirklichkeiten konstruieren, für introspektive Methoden. Dennoch stützen sich Konstruktivisten nicht ausschließlich auf subjektive Selbstberichte, weil sie weiterhin annehmen, dass es Menschen nicht gelingt, ihre subjektiven Wirklichkeiten als persönliche Konstruktionen zu betrachten. Dieser naive Realismus beschreibt die Neigung von Menschen, Der naive Realismus ihre konstruierten, subjekti- beschreibt die Tendenz, ven Wirklichkeiten für ge- die konstruierte subjektive Wirklichkeit fu¤r treue Wiedergabe einer ob- ein getreues Abbild jektiven Welt zu halten. Des- einer objektiven Welt zu halb umfasst ein konstrukti- halten. vistischer Ansatz auch die systematische Beobachtung von Urteilen und Verhaltensweisen. Eine konstruktivistische Sichtweise lässt sich durch eine frühe klassische Untersuchung illustrieren, nach der die Teilnehmer die physikalische Größe von Münzen stärker überschätzen, wenn sie einen höheren Nennwert besitzen. Diese Tendenz ist bei armen Kindern stärker ausgeprägt (Bruner & Goodman, 1947; man beachte, dass Münzgeld in der 1940er Jahren vermutlich generell wertvoller erschien als heute). Betrachten wir noch einmal das Problem der Zuschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen. Die Untersuchung darüber, wie sich Menschen die Handlungen anderer Menschen erklären (im obigen Beispiel eine Spende von 50 Euro), entstand aus der Betonung der Frage, wie eine Situation von den Menschen definiert wird, die sich in dieser Situation befinden (Heider, 1958) – eine durchaus konstruktivistische Herange- 17 Die heutigen psychologischen Ansa¤tze hensweise. Eine heutige Erklärung für die durchgehende Tendenz, die Handlungen anderer Menschen ihren Persönlichkeitseigenschaften zuzuschreiben, geht davon aus, dass es Angehörigen des westlichen Kulturkreises oft nicht gelingt, den Einfluss der Situation zu erkennen, weil in diesen Kulturen seit Langem die persönliche Handlungsveranlassung betont wurde (Nisbett, Peng, Choi & Norenzayan, 2001; siehe Kapitel 18). In analoger Weise geht eine konstruktivistische Sicht auf die Verknüpfung zwischen Gewalt in den Medien und Aggression davon aus, dass der gewohnheitsmäßige Umgang mit gewalthaltigen Medien aggressive Schemata und Skripts aufbaut und verstärkt, anhand derer in der Folge zwischenmenschliche Begegnungen definiert werden (Anderson & Bushman, 2001). ¤ berblick Konzepte im U Fu ¤nf Ansa ¤tze der Psychologie. Biologischer Ansatz Die Ausrichtung auf das Versta¤ndnis der neurobiologischen Prozesse, welche dem Verhalten und den geistigen Prozessen zu Grunde liegen. Verhaltenspsychologischer Ansatz Die Ausrichtung auf das Versta¤ndnis beobachtbaren Verhaltens anhand von Konditionierung und Versta¤rkung. Kognitiver Ansatz Die Ausrichtung auf das Versta¤ndnis geistiger Prozesse wie Wahrnehmen, Erinnern, logisches Denken, Entscheiden und Problemlo¤sen sowie ihrer Beziehungen zum Verhalten. Psychoanalytischer Ansatz Die Ausrichtung auf das Versta¤ndnis des Verhaltens anhand unbewusster Motive, die von sexuellen und aggressiven Triebimpulsen herru¤hren. Konstruktivistischer Ansatz Die Ausrichtung auf das Versta¤ndnis des Verhaltens und der geistigen Prozesse anhand der subjektiven Wirklichkeiten, die sich Menschen aktiv konstruieren. Die neuronale Grundlage des Verhaltens Beziehungen zwischen psychologischen und biologischen Ansa¤tzen Die behavioristischen, kognitiven, psychoanalytischen und konstruktivistischen Ansätze basieren alle rein auf psychologischen Konzepten (wie Wahrnehmung, Unbewusstes und Attributionen). Zwar bieten diese Ansätze manchmal unterschiedliche Erklärungen für dasselbe Phänomen an, doch handelt es sich dem Wesen nach immer um psychologische Erklärungen. Der biologische Ansatz ist anders. „Neben psychologischen Konzepten baut er auch auf Konzepten aus der Physiologie und anderen Zweigen der Biologie auf (wie Neurotransmitter und Hormone). In gewisser Weise knüpft der biologische Ansatz jedoch direkt an die psychologischen Ansätze an. Biologisch orientierte Forscher haben das Ziel, psychologische Konzepte und Prinzipien anhand ihrer biologischen Pendants zu erklären. So kann man beispielsweise versuchen, die normale Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, ausschließlich mit Neuronen und ihren Verschaltungen in einer bestimmten Gehirnregion zu erklären. Solche Versuche werden als Reduktionismus bezeichnet, weil sie darauf abzielen, psychologische Phänomene auf die ihnen zu Grunde liegenden biologischen Reduktionismus ist Strukturen und Prozesse zu- der Versuch, psychologische Pha¤nomene auf rückzuführen. Immer wieder biologische Strukturen werden sich in diesem Buch und Prozesse zuru¤ckBeispiele finden, bei denen zufu¤hren. sich ein derartiger Reduktionismus als erfolgreich erweist: Was zunächst nur auf psychologischer Ebene betrachtet wurde, lässt sich – zumindest teilweise – auf biologischer Ebene erklären. Warum sollte man sich dann noch mit psychologischen Erklärungsversuchen herumschlagen, wenn der Reduktionismus zum Erfolg führen kann? Hat die Psychologie ihre Aufgabe und Funktion nur so lange, bis die Biologen alles herausgefunden haben? Die Antwort ist ein eindeutiges „Nein“. 1 18 Erstens leiten psychologische Befunde, Konzepte und Prinzipien die biologische Forschung. Das Gehirn enthält ja Milliarden von Nervenzellen und unzählige Verbindungen zwischen diesen Zellen. Folglich kann ein Biologe kaum darauf hoffen, irgendetwas Interessantes herauszufinden, wenn er willkürlich beliebige Gehirnzellen auswählt und diese untersucht. Vielmehr muss er seine Bemühungen auf relevante Gruppen von Gehirnzellen richten. Hierfür können psychologische Befunde als Orientierungshilfe dienen. Beispielsweise deutet die psychologische Forschung darauf hin, dass unsere Fähigkeit, gesprochene Wörter voneinander zu unterscheiden, anderen Prinzipien gehorcht als unsere Fähigkeit, verschiedene räumliche Positionen zu unterscheiden. Dementsprechend werden Biopsychologen wohl in verschiedenen Gehirnregionen nach der neuronalen Grundlage dieser Diskriminationsfähigkeiten suchen (in diesem Fall in der linken Hemisphäre für die Wortunterscheidung und in der rechten Hemisphäre für die Diskrimination räumlicher Positionen). Ein anderes Beispiel: Wenn die psychologische Forschung herausfindet, dass das Erlernen einer motorischen Fähigkeit ein langsamer Prozess ist, der sich nur schwer rückgängig machen lässt, dann werden biologische Psychologen ihre Aufmerksamkeit auf solche Prozesse im Gehirn richten, die relativ langsam verlaufen, die Verbindungen zwischen Nervenzellen jedoch dauerhaft verändern (Churchland & Sejnowski, 1988). Zweitens verlaufen unsere biologischen Prozesse nicht unabhängig von unseren vergangenen und gegenwärtigen Umgebungsbedingungen. Beispielsweise kann Fettleibigkeit (1) aus einer genetischen Veranlagung zur Gewichtszunahme (einem biologischen Faktor) oder (2) aus der Aneignung schlechter Essgewohnheiten (einem psychologischen Faktor) resultieren oder aber (3) eine Reaktion auf kulturellen Druck in Richtung extremer Schlankheit darstellen (ein sozio-kultureller Faktor). Der Biologe kann den erstgenannten Faktor zu erklären versuchen; es bleibt aber immer noch Aufgabe des Psychologen, die vorausgehenden Erfahrungen und die aktuellen Begleitumstände zu erforschen, welche die Essgewohnheiten einer Person beeinflussen. Trotz allem gewinnt die reduktionistische Forschungsstrategie zunehmend an Einfluss. Für viele psychologische Fragestellungen liegen so- 1 Das Wesen der Psychologie wohl psychologische Erklärungen vor als auch Erkenntnisse darüber, wie die entsprechenden psychologischen Konzepte im Gehirn verankert sind und ausgeführt werden (zum Beispiel, welche spezifischen Teile des Gehirns beteiligt sind und wie sie miteinander in Verbindung stehen). Die verfügbaren biologischen Erkenntnisse reichen für einen vollständigen Reduktionismus in der Regel nicht aus, dennoch sind sie außerordentlich bedeutsam. In der Gedächtnisforschung wurden beispielsweise seit langem Arbeits- und Langzeitgedächtnis unterschieden. Dabei handelt es sich um psychologische Konzepte. Jetzt weiß man aber auch etwas darüber, dass und in welcher Weise diese beiden Gedächtniskomponenten im Gehirn tatsächlich unterschiedlich repräsentiert sind. Für viele in diesem Buch behandelte Themen werden deshalb Befunde und Erkenntnisse sowohl auf biologischer als auch auf psychologischer Ebene herangezogen. So ist es ein zentraler Gegenstand dieses Buches (wie überhaupt der gesamten gegenwärtigen Psychologie), dass man psychische Phänomene sowohl auf psychologischer als auch auf biologischer Ebene beschreiben und erklären kann. Dabei gibt die biologische Analyse Hinweise darauf, wie sich die psychologischen Annahmen auf der Ebene des Gehirns darstellen lassen. Ganz eindeutig bedarf es beider Analyseebenen, wenngleich auch bei einigen Themen – vor allem im Bereich sozialer Interaktionen – die biologischen Analysen erst ganz am Anfang stehen. 3 Wichtige Teilgebiete der Psychologie Bislang ging es darum, durch die Darstellung von Themen und Ansätzen ein allgemeines Verständnis vom Wesen der Psychologie zu bekommen. Dieses Verständnis wird vertieft, wenn man verschiedene psychologische Tätigkeitsfelder näher betrachtet und auch darauf blickt, welche Gebiete in der Psychologie des 21. Jahrhunderts zunehmende Bedeutung erlangen (siehe den Beitrag „Forschung aktuell“). Die heutigen psychologischen Ansa¤tze Ein Teil der Absolventen eines Psychologiestudiums – und ein Großteil derjenigen mit weiteren wissenschaftlichen Qualifikationen wie Promotion und Habilitation – arbeitet in Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Neben den Lehraufgaben wenden sie zum Teil auch viel Zeit für Forschung oder Beratung auf. Andere Psychologen arbeiten in Schulen, Kliniken, Forschungsinstituten, Beratungsstellen oder Behörden, in der Industrie, beim TÜV oder bei der Polizei. Andere wiederum haben Privatpraxen und bieten ihre Dienstleistung öffentlich und gegen Bezahlung an. Hier folgt nun eine kurze Beschreibung einiger psychologischer Teilgebiete, in der sich auch die kanonisierte Untergliederung des Psychologiestudiums an deutschen Universitäten widerspiegelt. Biologische Psychologie. Biologische Psychologen (auch: Physiologische Psychologen) suchen nach Beziehungen zwischen Biologische Psycholobiologischen Prozessen und gen untersuchen die dem Verhalten. Beziehungen zwischen biologischen Prozessen und Verhalten. Allgemeine Psychologen untersuchen mit Hilfe von experimentellen Methoden, wie Menschen und andere Lebewesen auf sensorische Reize reagieren, die Welt wahrnehmen, lernen, erinnern, denken und fu¤hlen. Entwicklungspsychologen befassen sich mit der menschlichen Entwicklung und den Faktoren, die das Verhalten von der Geburt bis ins Alter formen. Allgemeine Psychologie. Allgemeine Psychologen forschen meist auf der Grundlage eines behavioristischen oder kognitiven Beschreibungs- und Erklärungsansatzes. Sie verwenden vorrangig experimentelle Methoden, um zu untersuchen, wie Menschen (und andere Spezies) auf sensorische Reize reagieren, die Welt wahrnehmen, lernen und erinnern, denken und emotional reagieren. Entwicklungspsychologie. Entwicklungspsychologen befassen sich mit der Entwicklung des Menschen und den Faktoren, die das Verhalten von der Geburt bis ins hohe Alter formen. Dabei untersuchen sie bestimmte Fähigkeiten, beispielsweise den Spracherwerb bei Kindern, oder bestimmte Lebensabschnitte, etwa die frühe Kindheit. 19 Sozial- und Perso ¤nlichkeitspsychologie. Sozialpsychologen sind daran interessiert, wie Menschen ihre soziale Umwelt wahrnehmen und interpre- Sozialpsychologen interessieren sich dafu¤r, tieren und wie ihre Überzeuwie Menschen ihre sogungen, Gefühle und Verhal- ziale Umwelt wahrnehtensweisen durch die reale men und interpretieren oder vorgestellte Gegenwart und wie die reale oder anderer Menschen beein- imaginierte Gegenwart flusst werden. Sie befassen anderer ihre U¤berzeusich auch mit dem Verhalten gungen, Gefu¤hle und von Gruppen und mit sozia- Verhaltensweisen beeinflusst. len Beziehungen zwischen Menschen. Persönlichkeitspsychologen Perso¤nlichkeitsuntersuchen die Gedanken, psychologen unterGefühle und Verhaltenswei- suchen die Gedanken, sen, die den persönlichen Gefu¤hle und VerhalStil ausmachen, mit dem tensweisen, die den ein Individuum mit der perso¤nlichen Stil im Umgang mit der Welt Welt interagiert. Dement- ausmachen. sprechend interessieren sie sich für Unterschiede zwischen Menschen, und sie versuchen auch, alle psychischen Prozesse zu einem integrierten Ansatz der gesamten Person – der Persönlichkeit – zusammenzufügen. Klinische Psychologie. Die meisten Psychologen sind Klinische Psychologen; sie wenden psychologische Prinzipien bei der Diagnose und Behand- Klinische Psycholung psychischer und ver- logen diagnostizieren und behandeln psychihaltensbezogener Probleme sche und verhaltensbean – beispielsweise bei Geis- zogene Probleme nach teskrankheiten, Drogenab- psychologischen Prinzihängigkeit und Konflikten pien. in Ehe und Familie. Während diese Tätigkeiten überwiegend in Kliniken und psychotherapeutischen Einrichtungen und Praxen ausgeübt werden, nehmen Psychologen sehr ähnliche Funktionen auch in Beratungsstellen wahr, wobei sie jedoch mit weniger schwerwiegenden oder anders gearteten Problemen konfrontiert sind, die sich auch außerhalb einer klinischen Behandlung bearbeiten lassen. Auch die psychologischen Beratungsstellen an Universitäten und Hochschulen fallen in diesen Bereich. 1 20 1 Das Wesen der Psychologie Forschung aktuell Psychologie im 21. Jahrhundert In zunehmendem Ausma verknu¤pfen Psychologen mehrere Teilgebiete in ihren Forschungen, gehen auch u¤ber die Psychologie hinaus und arbeiten mit Forschern anderer Disziplinen zusammen. Diese themenu¤bergreifenden und interdisziplina¤ren Ansa¤tze haben zu Beginn des 21. Jahrhunderts betra¤chtliche Impulse erhalten und du¤rften sich in den kommenden Jahrzehnten als wichtig erweisen. Besonderes Interesse gilt der kognitiven Neurowissenschaft, der Evolutionspsychologie, der kulturvergleichenden Psychologie und der Positiven Psychologie. Diese Ansa¤tze werden hier in Ku¤rze beschrieben, und die jeweiligen Forschungsstrategien werden an Beispielen illustriert. Kognitive Neurowissenschaft Die kognitive Neurowissenschaft konzentriert sich auf kognitive Prozesse, wobei sie sich in starkem Ausma auf neurowissenschaftliche Methoden und Befunde stu¤tzt. (Neurowissenschaft ist der Zweig der Biologie, der sich mit dem Gehirn und dem Nervensystem befasst.) Im WesentliDie kognitive Neurochen geht es der kognitiven Neuwissenschaft will verrowissenschaft darum herauszustehen, wie geistige finden, wie geistige Aktivita¤ten Aktivita¤ten im Gehirn im Gehirn realisiert werden. realisiert werden. Die Grundidee besteht darin, dass die kognitive Psychologie Hypothesen u¤ber spezifische kognitive Funktionen und Fa¤higkeiten liefert -- wie etwa das Erkennen von Gesichtern -- und die Neurowissenschaft Ideen beisteuert, wie diese spezifischen Funktionen im Gehirn implementiert sein ko ¤nnten. Ein besonderes Kennzeichen der kognitiven Neurowissenschaft besteht in der Nutzung neuer Techniken zur Untersuchung des Gehirns von normalen Probanden (im Vergleich zu Hirngescha¤digten) wa¤hrend der Ausfu¤hrung einer kognitiven Aufgabe. Dazu za¤hlen bildgebende Verfahren (Neuro-Imaging, Brain-Scans). Sie erzeugen visuelle Darstellungen des Gehirns in Aktion und zeigen an, welche Hirnregionen bei einer bestimmten Aufgabe am aktivsten sind. Als Beispiel ko ¤nnen Untersuchungen daru¤ber dienen, wie sich Menschen Information fu¤r entweder kurze oder lange Zeitabschnitte merken. Wenn man sich etwas nur fu¤r ein paar Sekunden merken soll, zeigt sich ein Anstieg der Nervenaktivita¤t in Regionen des Frontalhirns; soll Information fu¤r la¤ngere Zeit aufrechterhal- ten werden, steigt die Aktivita¤t in einer ganz anderen Hirnregion an, na¤her zur Gehirnmitte. Somit scheinen bei der Kurzzeitspeicherung von Information andere Mechanismen wirksam zu sein als bei der Langzeitspeicherung (Smith & Jonides, 1995; Squire, Knowlton & Musen, 1993). Die Verbindung von Psycholo- Die affektive Neurogie und Neurowissenschaft ist wissenschaft unternicht auf die kognitive Psycho- sucht die Ausfu¤hrung logie beschra¤nkt. Psychologen emotionaler Prozesse im Gehirn. haben auch eine affektive Neurowissenschaft ins Leben gerufen (Panksepp, 1998), um die Aus- Die sozial-kognitive fu¤hrung emotionaler Prozesse Neurowissenschaft im Gehirn zu untersuchen, sowie versucht herauszufineine sozial-kognitive Neurowis- den, wie soziale Pha¤nosenschaft (Ochsner & Lieber- mene (Stereotypenbilman, 2001), die sich damit be- dung, Einstellungen, fasst, wie Stereotype, Einstel- Personenwahrnehmung lungen, Personenwahrnehmung oder Selbstrepra¤sentaoder das Wissen ¤uber sich selbst tion) im Gehirn realisiert werden. im Gehirn repra¤sentiert sind. Evolutionspsychologie Die Evolutionspsychologie befasst sich mit dem biologischen Ursprung kognitiver Mechanismen. Neben der Psychologie und der Biologie sind an diesem Ansatz auch die Anthropologie und die Psychiatrie beteiligt. Der Grundgedanke der Evolutionspsychologie besteht darin, dass sich psychische Mechanismen genauso wie biologische Mechanismen im Verlauf von Jahrmillionen durch einen Prozess der natu¤rlichen Auslese entwickelt haben mu¤ssen. Somit geht die Evolutionspsychologie davon aus, dass psychologische Mechanismen eine genetische Grundlage besit¤ berlebens- und Rezen und in der Vergangenheit die U produktionschancen unserer Vorfahren erho¤ht haben. Zur Illustration betrachte man die Vorliebe fu¤r Su¤es: Eine solche Vorliebe kann man sich als einen psychologischen Mechanismus vorstellen, der eine genetische Basis besitzt. Zudem haben wir die Pra¤fe¤ berlebenschancen unserenz fu¤r Su¤es, weil sie die U rer Vorfahren erho¤ht hat: Die Fru¤chte, die am su¤esten schmeckten, hatten den ho¤chsten Na¤hrwert; a man sie, erho¤hte dies die Chancen fu¤r das weitere ¤ berleben der eigenen Gene (Symons, 1992). U Die Einnahme einer evolutiona¤ren Perspektive kann die Untersuchung psychologischer Fragen auf vielfa¤ltige Weise beeinflussen. Zum einen erscheinen 21 Die heutigen psychologischen Ansa¤tze 1 bestimmte Themen aus evolutiona¤rer Sicht beson¤ berleben oder der erders wichtig, weil sie mit dem U folgreichen Reproduktion zusammenha¤ngen. Darunter fa¤llt zum Beispiel, wie wir unsere Partner auswa¤hlen oder wie wir denken und uns verhalten, wenn wir bestimmte Gefu¤hle erleben (Buss, 1991). Eine Evolutionsperspektive kann auch zu bereits bekannten Themen neue Einsichten beisteuern; dies la¤sst sich am Beispiel der Fettleibigkeit illustrieren. Wie schon erwa¤hnt, kann zuru¤ckliegender Nahrungsentzug zu u¤berma¤igem Essen in der Zukunft fu¤hren. Die Evolutionspsychologie ha¤lt fu¤r dieses Pha¤nomen eine Interpretation bereit: Bis vor Kurzem -- gemessen an der Geschichte der Menschheit -- erlebten Menschen einen Nahrungsmangel nur dann, wenn die Nahrung knapp war. Ein Anpassungsmechanismus fu¤r den Umgang mit Nahrungsknappheit besteht darin, so viel wie mo¤glich zu essen, wenn gerade einmal Nahrung vorhanden ist. Somit ko ¤nnte die Evolution diejenigen Individuen begu¤nstigt haben, die dazu neigen, nach Nahrungsentzug ¤uberma¤ig viel zu essen. Kulturvergleichende Psychologie Die wissenschaftliche Psychologie des Westens hat oft die Annahme vertreten, dass Menschen kulturu¤bergreifend identische psychische Prozesse aufweisen. Diese Annahme wird durch Vertreter der kulturvergleichenden Psychologie mehr und mehr in Frage gestellt. Dabei handelt es sich um ein interdisziplina¤res Wissenschaftsgebiet, mit dem sich Psychologen, Anthropologen, Soziologen und andere Sozialwissenschaftler bescha¤ftigen. Die kulDie kulturvergleiturvergleichende Psychologie bechende Psychologie fasst sich damit, wie sich die befasst sich mit den Kultur, in der jemand lebt (TradiEinflu¤ssen der Traditiotionen, Sprache und Weltsicht), nen, Sprache und Weltauf die mentalen Repra¤sentatiosicht in der Lebenswelt nen und die psychischen Proeines Menschen auf die zesse dieser Person auswirkt. mentalen Repra¤sentaDas folgende Beispiel soll tionen und psychischen dies illustrieren: In der westliProzesse. chen Welt -- in Nordamerika und in den meisten Teilen Nord- und Westeuropas -- sehen wir uns selbst als separat und autonom Handelnde mit eigenen Fa¤higkeiten und Perso ¤nlichkeitszu¤gen. Im Gegensatz dazu betonen viele o¤stliche Kulturen -- beispielsweise in Indien, China und Japan -die Beziehungen und Verflechtungen zwischen Menschen und nicht ihre Individualita¤t. Daru¤ber hinaus neigt man in der o ¤stlichen Welt dazu, sozialen Situationen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als im Westen. Diese Unterschiede fu¤hren dazu, dass man das Verhalten einer anderen Person in der o¤stlichen Welt anders interpretiert als im Westen. Anstatt eine Verhaltensweise auf stabile Perso¤nlichkeitseigenschaften zuru¤ckzufu¤hren, erkla¤rt sie ein Angeho ¤riger ¤stlicher Kulturen auch anhand der sozialen Situation, o in der sie aufgetreten ist (Nisbett et al., 2001). Dies wiederum hat weit reichende Implikationen fu¤r die Zuschreibung von Perso¤nlichkeitseigenschaften (die wir als Problembeispiel am Anfang dieses Kapitels angesprochen haben). Solche Unterschiede zwischen Ost und West bei der Verhaltenserkla¤rung schlagen sich auch in Erziehung und Ausbildung nieder. Auf Grund der Betonung des Kollektivismus gegenu¤ber dem Individualismus arbeiten asiatische Schu¤ler ha¤ufiger zusammen als amerikanische Schu¤ler. Das Arbeiten und Lernen in Gruppen ist sicher eine sinnvolle und nu¤tzliche Methode und mo¤glicherweise eine der Ursachen, warum asiatische Schu¤ler amerikanischen Schu¤lern in Mathematik leistungsma¤ig ¤uberlegen sind. Es kommt hinzu, dass einem amerikanischen Schu¤ler, der Schwierigkeiten in Mathematik hat, diese Schwierigkeiten sowohl von ihm selbst als auch von seinem Lehrer seiner individuellen (Un-) Fa¤higkeit zugeschrieben werden. Hingegen ist es bei einem vergleichbaren Fall in einer japanischen Schule viel wahrscheinlicher, dass sich sowohl Schu¤ler als auch Lehrer bei der Erkla¤rung der schlechten Leistungen auf die Situation beziehen, das heit auf die Interaktion zwischen Schu¤ler und Lehrer im Kontext des Unterrichts (Stevenson, Lee & Graham, 1993). Positive Psychologie Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Psychologie -- insbesondere die Klinische Psychologie -- eine Wissenschaft, die sich der Heilung widmete. Sie u¤bernahm ein Krankheitsmodell der menschlichen Funktionen von der Medizin und zielte darauf ab, Pathologien zu beheben. Auch wenn dieser Blickwinkel immense Fortschritte fu¤r das Verstehen und die Behandlung psychischer Krankheiten hervorbrachte (siehe die Kapitel 15 und 16), trug er wenig zu der Frage bei, was das Leben lebenswert Die Positive Psychomacht. Die Positive Psychologie logie stellt einer an entstand, um dem differenzierKrankheit und Heilung ten wissenschaftlichen Verorientierten Psycholosta¤ndnis psychischer Krankheigie eine Psychologie ten ein genauso differenziertes des Wohlergehens gewissenschaftliches Versta¤ndnis genu¤ber. des menschlichen Wohlerge" hens gegenu¤berzustellen (Selig- 22 man, 2002). Die Positive Psychologie teilt mit der fru¤heren humanistischen Psychologie das Thema der Entwicklung hin zur Entfaltung des vollen Potenzials eines Menschen; doch sie unterscheidet sich durch den starken Ru¤ckgriff auf empirische Forschungsmethoden. Die Positive Psychologie zielt auf psychische Pha¤nomene auf unterschiedlicher Ebene -- von der Untersuchung positiver subjektiver Erfahrungen wie Glu¤ck und Optimismus ¤uber die Untersuchung positiver Perso¤nlichkeitszu¤ge wie Courage und Weisheit bis zur Untersuchung positiver Institutionen (sozialer Strukturen, welche zur Kultivierung der Zivilisation beitragen und verantwortungsvolle Staatsbu¤rger hervorbringen; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Ein Beispiel fu¤r die Kombination der beiden ersten genannten Analyseebenen stammt aus den aktuellen Forschungen u¤ber positive Emotionen (Kapitel 11). Wa¤hrend negative Emotionen die Einscha¤tzung der eigenen Handlungsmo¤glichkeiten einengen (zum Beispiel Kampf oder Flucht), erwiesen sich positive Emotionen als Erweiterung der menschlichen Vor- Pa¤dagogische Psychologie und Schulpsychologie. Während an deutschen Schulen immer seltener speziell qualifizierte Schulpsychologen zu finden sind, arbeiten in den USA Schulpsychologen schon an vielen Grundschulen, da ernste emotionale Probleme oft schon in den ersten Schuljahren zu Tage treten. Diese Psychologen sind speziell in Fragen der Kindesentwicklung, der Erziehung und der KliniSchulpsychologen schen Psychologie ausgebilarbeiten mit den det. Schulpsychologen arbeipsychischen Problemen ten mit den Kindern, um deund Lernschwierigren psychische Probleme keiten von Kindern. und Lernschwierigkeiten einzuschätzen und nach Pa¤dagogische PsyMöglichkeit durch geeignete chologen sind SpeziaInterventionen zu überwinlisten fu¤r Prozesse des den. Pädagogische PsycholoLernens und Lehrens. gen sind hingegen Spezialisten für Lernen und Lehren. Sie arbeiten zwar auch an Schulen, aber häufiger an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, wo sie beispielsweise Lehrmethoden erforschen und an der Lehrerausbildung beteiligt sind. 1 Das Wesen der Psychologie stellungspalette; sie ermutigen zur Entdeckung neuer Denk- oder Handlungsmo¤glichkeiten. Freude beispielsweise erzeugt das Bedu¤rfnis zu spielen, und Interesse erzeugt einen Erkundungsdrang. Ein zentrales Resultat dieser erweiterten Vorstellungsmo ¤glichkeiten besteht in der Zunahme an perso¤nlichen Ressourcen: Wenn ein Individuum neue Ideen und Handlungen entdeckt, baut es physische, intellektuelle, soziale und psychische Ressourcen auf. Empirische Untersuchungen unterstu¤tzen diese neue Theorie, dass positive Emotionen ressourcenerweiternd und -aufbauend wirken, indem sie zeigen, dass positive Emotionen durch ihre denkerweiternden Wirkungen Perso¤nlichkeitseigenschaften anregen, die fu¤r Entwicklungs- und Wachstumsprozesse vorteilhaft sind, beispielsweise Resilienz und Optimismus (Fredrickson, 2001). Die Positive Psychologie vermittelt uns also die Botschaft, dass es sich lohnt, positive Gefu¤hle zu kultivieren -- nicht nur als Zielzustand an und fu¤r sich, sondern auch als Mittel, um Prozesse hin zu psychischem Wachstum und Gedeihen auszulo¤sen. Arbeits- und Organisationspsychologie. Organisationspsychologen (manchmal auch: Industriepsychologen) arbeiten typischerweise für ein Unter- Organisationspsychonehmen. Sie sind beispiels- logen sind an der Perweise mit der Personalaus- sonalauswahl oder der strukturellen Entwickwahl befasst oder gestalten lung einer Organisation Strukturen, die für Zusam- beteiligt. menarbeit und Teamwork günstig sind. Arbeitspsychologen (auch: Ingenieurpsychologen) versuchen, die Beziehung zwischen Mensch und Maschine zu verbessern. Zum Arbeitspsychologen Beispiel verbessern sie die versuchen, die Beziehung zwischen MenMensch-Maschine-Interaktischen und Maschinen on, indem sie Maschinen ge- zu verbessern. stalten, bei denen die Bedienungsfelder und die Kontrollvorrichtungen so angeordnet und platziert werden, dass sie die Arbeitsleistung, die Betriebssicherheit und den Bedienungskomfort erhöhen. 23 Prinzipien psychologischer Forschung zusammengefasst Psychologischen Fragen kann man sich aus unterschiedlichen Perspektiven na¤hern. Fu¤nf derzeit aktuelle Perspektiven sind der biologische Ansatz, der verhaltensbezogene Ansatz, der kognitive Ansatz, der psychoanalytische Ansatz und der konstruktivistische Ansatz. Der biologische Ansatz unterscheidet sich von den anderen Ansa¤tzen dahingehend, dass seine Prinzipien zum Teil aus der Biologie stammen. Biologische Forscher versuchen ha¤ufig, psychologische Prinzipien anhand biologischer Prinzipien zu erkla¤ren; dies bezeichnet man als Reduktionismus. Die wichtigsten Teilgebiete der Psychologie sind die Biologische Psychologie, die Allgemeine Psychologie, die Entwicklungspsychologie, die Sozial- und Perso¤nlichkeitspsychologie, die Klinische Psychologie, die Schulpsychologie, die Pa¤dagogische Psychologie und die Arbeitsund Organisationspsychologie. Viele neue Forschungsgebiete wie die kognitive Neurowissenschaft (auch mit ihren affektiven und sozialen Aspekten), die Evolutionspsychologie, die kulturvergleichende Psychologie und die Positive Psychologie umfassen mehrere der traditionellen Teilgebiete und Fachdisziplinen. nachgefragt 1. Betrachten Sie die Frage: ÐWas sind die Determinanten fu¤r die sexuelle Orientierung eines Menschen? Wie wu¤rden die verschiedenen Ansa¤tze, die in diesem Kapitel skizziert wurden, an diese Frage herangehen? 2. Viele der neueren Ansa¤tze in der Psychologie des 21. Jahrhunderts (beschrieben im Exkurs ÐForschung aktuell) fu¤hren unterschiedliche Ansa¤tze integrativ zusammen oder fu¤llen vormals bestehende Lu¤cken. Welche weiteren Neuerungen zeichnen sich am Horizont der modernen Psychologie ab? Welche weiteren Mo ¤glichkeiten wu¤rden Sie erwarten, wo sich Ansa¤tze integrieren und bestehende Lu¤cken fu¤llen lassen? Prinzipien psychologischer Forschung Wir besitzen jetzt eine gewisse Vorstellung davon, mit welchen Themen sich Psychologen befassen und aus welchen Blickwinkeln sie dies tun. Nun können wir uns den Forschungsstrategien zuwenden, die dabei zum Einsatz kommen. Auf allgemeinster Ebene umfasst das Forschen zwei Schritte: (1) das Aufstellen einer wissenschaftlichen Hypothese und (2) das Prüfen dieser Hypothese. Hypothesenbildung Bei jedem Forschungsvorhaben besteht der erste Schritt darin, zu der interessierenden Fragestellung eine Hypothese – eine überprüfbare Behauptung – zu formulieren. Eine Hypothese ist eine Wenn wir uns beispielsweise pru¤fbare Behauptung. mit der frühkindlichen Amnesie befassen, könnten wir die Hypothese aufstellen, dass man sich an Ereignisse aus der Kindheit besser erinnern kann, wenn man an den ursprünglichen Ort des Geschehens zurückkehrt. Wie kommt ein Forscher zu einer solchen Hypothese? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Ein scharfsinniger Beobachter alltäglicher Situationen ist dabei vielleicht im Vorteil. So könnte einem zum Beispiel auffallen, dass man sich an seine Gymnasialzeit besser erinnert, wenn man sich in der Stadt befindet, in der man zur Schule ging. Diese Beobachtung mag dann zu der erwähnten Hypothese führen. Hilfreich ist auch, wenn man sich in der relevanten Fachliteratur, das heißt in den schon vorliegenden Büchern und Aufsätzen über das jeweilige Interessengebiet, gut auskennt. Die wichtigste Quelle für eine wissenschaftliche Hypothese ist jedoch nicht selten eine wissenschaftliche Theorie. Eine Theorie ist eine zusammenhängende Menge von Aussagen über ein Eine Theorie ist eine bestimmtes Phänomen. Bei- zusammenha¤ngende spielsweise nimmt eine Menge von Aussagen Theorie der sexuellen Orien- u¤ber ein bestimmtes Pha¤nomen. tierung (siehe Kapitel 10) an, 1 24 1 Das Wesen der Psychologie dass es eine genetische Veranlagung für Heterosexualität oder Homosexualität gibt. Dies führt zu der prüfbaren wissenschaftlichen Hypothese, dass eineiige Zwillinge – die identische Gene besitzen – mit höherer Wahrscheinlichkeit dieselbe sexuelle Orientierung aufweisen sollten als zweieiige Zwillinge, bei denen nur etwa die Hälfte ihrer Gene übereinstimmt. Eine konkurrierende Theorie hebt dagegen Erlebnisse in der Kindheit als Quelle der sexuellen Orientierung hervor. Daraus resultieren alternative Hypothesen, die sich ebenfalls prüfen lassen. Es wird sich im Verlauf des Buches zeigen, dass die Prüfung von Hypothesen, die aus konkurrierenden Theorien abgeleitet wurden, zu den stärksten Mitteln wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns gehört. Der Ausdruck „wissenschaftlich“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Daten mit Forschungsmethoden erhoben Wissenschaftliche wurden, die (a) unvoreinForschungsmethoden genommen sind, also nicht sind unvoreingenomvon vornherein eine der Hymen und zuverla¤ssig. pothesen bevorzugen, und (b) zuverlässig (reliabel) sind, so dass die Beobachtungen zu einem anderen Zeitpunkt beziehungsweise von (qualifizierten) Dritten wiederholt werden können und zu denselben Ergebnissen führen. Die im Folgenden behandelten Methoden besitzen diese beiden Kennzeichen. Jede Methode lässt sich unter jedem der dargestellten psychologischen Beschreibungs- und Erklärungsansätze verwenden, wobei allerdings einige Methoden für bestimmte Ansätze besser geeignet sind als andere. Experimente Die aussagekräftigste wissenschaftliche Methode ist das Experiment. Experimente erlauben die stärksten Prüfungen von Ursache-Wirkungs-HypotheExperimente erlauben sen. Dabei werden die Rand-- unter sorgfa¤ltig konbedingungen – oft in einem trollierten Untersuchungsbedingungen -Labor – sorgfältig kontroldie Pru¤fung von Hypoliert und Messungen vorgethesen u¤ber ursa¤chliche nommen, um die kausalen Beziehungen zwischen Beziehungen zwischen VaVariablen. riablen aufzudecken. Eine Variable ist eine Größe, die unterschiedliche Werte annehmen kann (siehe Übersichtstabelle). So mag in einem Experiment Eine Variable ist eine untersucht werden, ob die Gro¤e, die unterschiedSchlafdauer Gedächtnisver- liche Werte annehmen änderungen verursacht (also kann. beispielsweise, ob man Kindheitserlebnisse bei Schlafmangel schlechter erinnern kann). Falls das Experiment zeigt, dass sich die Gedächtnisleistung systematisch mit der Schlafdauer verändert, kann man von einer gesicherten kausalen Beziehung zwischen diesen beiden Variablen ausgehen. Die Methode des Experiments unterscheidet sich von anderen Methoden der wissenschaftlichen Beobachtung dadurch, dass man eine Variable präzise kontrollieren kann. Besteht die zu prüfende Hypothese beispielsweise darin, dass Personen bei einer Mathematikaufgabe bessere Leistungen erbringen, wenn ihnen mehr Geld für gute Leistungen geboten wird, kann der Experimentator die Teilnehmer nach Zufall einer von drei Bedingungen zuweisen: Einer Gruppe wird gesagt, dass jeder für gute Leistungen zehn Euro bekommt; die zweite Gruppe bekommt für gute Leistungen fünf Euro; die dritte Gruppe bekommt für ihre Leistungen kein Geld. Dann werden die tatsächlichen Leistungen aller drei Gruppen gemessen und miteinander verglichen. Auf diese Weise lässt sich erkennen, ob mehr Geld ( = die Ursache gemäß der Hypothese) tatsächlich zu besseren Leistungen ( = die Wirkung gemäß der Hypothese) führt. Bei diesem Experiment ist das angebotene Geld die unabhängige Variable, weil ihre Ausprägungen nicht davon abhängen, was die Versuchsteilnehmer tun. Tatsächlich wird die unabhängi- Die Auspra¤gungen der unabha¤ngigen Variabge Variable vom Versuchs- len sind unabha¤ngig leiter völlig kontrolliert, in- vom Verhalten der Verdem ihre Ausprägungen will- suchsteilnehmer; sie kürlich hergestellt werden. In werden vom Versuchseinem Experiment stellt die leiter gesetzt. unabhängige Variable gemäß der überprüften Hypothese Die Auspra¤gungen der die „Ursache“ dar. Die ge- abha¤ngigen Variablen mäß der Hypothese erwar- sind die gemessenen tete „Wirkung“ in einem Leistungen der TeilnehExperiment zeigt sich auf mer; sie ha¤ngen von den der abhängigen Variable; von gesetzten Bedingungen ihr wird angenommen, dass ab. Prinzipien psychologischer Forschung ¤ berblick Konzepte im U Die Terminologie experimenteller Forschung. Hypothese Eine u¤berpru¤fbare Behauptung u¤ber Ursache und Wirkung. Experiment Die Pru¤fung einer UrsacheWirkungs-Hypothese unter stark kontrollierten Bedingungen. Variable Eine messbare Gro¤e, die verschiedene Werte (Auspra¤gungen) annehmen kann. Unabha¤ngige Variable Eine Variable, die fu¤r die angenommene Ursache steht; ihre Auspra¤gungen werden vom Versuchsleiter exakt kontrolliert und sind unabha¤ngig davon, was die Versuchsteilnehmer tun. Abha ¤ngige Variable Eine Variable, die fu¤r die angenommene Wirkung steht; ihre Werte ha¤ngen letztlich von den Auspra¤gungen der unabha¤ngigen Variable ab. Experimentalgruppe Eine Untersuchungsgruppe, in der die angenommene Ursache vorliegt. Kontrollgruppe Eine Untersuchungsgruppe, in der die angenommene Ursache nicht vorliegt. Randomisierung Ein System fu¤r die Zuweisung der Teilnehmer zu Experimentalund Kontrollgruppen, bei dem jeder Proband dieselbe Chance besitzt, jeder der Gruppen zugewiesen zu werden. Messung Ein System fu¤r die Zuordnung von Zahlenwerten zu den verschiedenen Auspra¤gungen (Werten) von Variablen. Statistik Mathematische Verfahren fu¤r die Bestimmung der Gewissheit (oder Wahrscheinlichkeit), mit der sich aus einer Datenstichprobe Schlu¤sse oder Verallgemeinerungen ziehen lassen. 25 sie von der jeweiligen Ausprägung der unabhängigen Variable abhängt. Im vorliegenden Beispiel ist die abhängige Variable die Leistung bei den Mathematikaufgaben. Der Versuchsleiter manipuliert (setzt, verändert) die unabhängige Variable und beobachtet die abhängige Variable, um den Ausgang des Experiments in Erfahrung zu bringen. Die abhängige Variable ergibt sich fast immer aus der Messung eines Verhaltensaspekts der Teilnehmer. Man verwendet häufig den Ausdruck „ist eine Funktion von“, um die Abhängigkeit der einen Variable von der anderen zu kennzeichnen. Im Falle des Experimentalbeispiels könnte man sagen, dass die Leistung der Teilnehmer bei den Mathematikaufgaben eine Funktion der Geldsumme ist, die ihnen angeboten wurde. Die beiden Gruppen, denen Geld angeboten wurde, wären die Experimentalgruppen; in ihnen liegt die angenommene Ursache vor. Die Gruppe ohne In der ExperimentalGeldangebot wäre die Kon- gruppe liegt die angenommene Ursache fu¤r trollgruppe; hier ist die ange- das gemessene Verhalnommene Ursache nicht ge- ten vor. geben. Im Allgemeinen dient die Kontrollgruppe als StanIn der Kontrollgruppe dardbedingung, mit der die liegt die angenommene Experimentalgruppen vergli- Ursache nicht vor; sie chen werden können. dient als VergleichsEin wichtiges Kennzei- oder Standardbedinchen des gerade beschriebe- gung. nen Experiments besteht darin, dass die Teilnehmer den Bedingungen nach Zufall zugewiesen werden. Dieses Verfahren heißt Randomisierung ; es bedeutet, dass jeder Teilneh- Randomisierung bedeutet eine Zufallsvermer mit gleicher Wahrteilung der Teilnehmer scheinlichkeit der einen auf die Versuchsbedinoder einer anderen Bedin- gungen. gung zugewiesen werden kann. Ohne die randomisierte Zuweisung der Probanden zu den Bedingungen könnte der Experimentator nicht sicher sein, ob die Unterschiede zwischen den Bedingungen nicht auch durch etwas anderes als die jeweilige Ausprägung der unabhängigen Variable hervorgerufen wurden. So sollte man die Teilnehmer niemals selbst wählen lassen, welcher Gruppe sie angehören wollen. Die meisten Probanden würden wohl am liebsten in der höchstbezahlten Gruppe sein. Es kann aber auch Personen geben, die unter Druck nervös werden und sich deshalb die ungezwungene, le- 1 26 gere Gruppe ohne Bezahlung aussuchen. So oder so entsteht dann das Problem, dass die Gruppen aus Personen mit systematisch unterschiedlichen Eigenschaften zusammengesetzt sind, so dass für mögliche Leistungsunterschiede zwischen den Gruppen nicht mehr die Höhe der angebotenen Geldsumme, sondern die Persönlichkeit der Probanden ursächlich sein könnte. Oder man nehme an, dass der Experimentator zuerst die bezahlten Gruppen testet und danach die Gruppe ohne Bezahlung. Daraus könnten vielfältige Probleme resultieren. Vielleicht variiert die Leistung als Funktion der Tageszeit (morgens, mittags, abends); oder diejenigen Studenten, die erst gegen Ende des Experiments teilnehmen, stehen – anders als die Studenten zu Beginn des Experiments – kurz vor einem Examenstermin. Über diese unkontrollierten Variablen hinaus können noch viele weitere verzerrende Einflussgrößen auf das Ergebnis bestehen, deren sich der Versuchsleiter nicht bewusst ist. Alle derartigen Probleme lassen sich beheben, indem man die Teilnehmer den Experimentalbedingungen per Zufall zuweist. Nur nach einer Randomisierung kann man sicher sein, dass alle untersuchungsfremden Variablen – die Persönlichkeit der Probanden, die Tageszeit, der Zeitpunkt im laufenden Semester – in allen Bedingungen gleichermaßen ausgeprägt sind und deshalb wahrscheinlich keine systematischen Ergebnisverzerrungen hervorrufen. Die zufällige Zuweisung von Probanden zu Bedingungen ist der wichtigste Bestandteil eines Experiments. Die Methode des Experiments kann auch außerhalb des Labors zum Einsatz kommen. Bei der Erforschung der Fettleibigkeit zum Beispiel lassen sich die Effekte verschiedener Methoden zur Gewichtskontrolle untersuchen, indem man die Methoden an getrennten, aber ähnlich zusammengesetzten Gruppen übergewichtiger Personen testet. Die Experimentalmethodik ist eine Frage der Logik, nicht notwendigerweise der Laborumgebung. Gleichwohl finden die meisten Experimente im Labor statt, vor allem weil es in einer Laborumgebung möglich ist, Verhalten präziser zu messen und die beteiligten Variablen umfassender zu kontrollieren. Und wiederum spielt oft die Randomisierung eine entscheidende Rolle: Wenn in zwei Kliniken Übergewicht mit unterschiedlichen Methoden behandelt wird und damit unterschiedliche Ergebnisse erzielt 1 Das Wesen der Psychologie werden, kann daraus nicht zuverlässig geschlossen werden, dass die verschiedenen Gewichtsreduktionsmethoden der maßgebliche Faktor sind. Vielleicht sind die Kliniken mit ihren spezifischen Angeboten und Gewichtsreduktionsprogrammen für jeweils verschiedene Personenkreise attraktiv oder haben unterschiedliche Auswahlkriterien für ihre Mitarbeiter. In den bislang skizzierten Experimenten wurde der Effekt einer unabhängigen Variable auf eine abhängige Variable untersucht. Manche Fragestellungen würden jedoch zu sehr eingeschränkt, bliebe die Untersuchung auf eine einzige unabhängige Variable begrenzt. Deshalb kommen in der psychologischen Forschung häufig multivariate Experimente zum Einsatz, bei denen mehrere unabhängige Variablen gleichzeitig manipuliert werden. So könnte in der fikti- In multivariaten Exven Untersuchung zum Ein- perimenten werden mehrere unabha¤ngige fluss von Geldsummen auf Variablen gleichzeitig die Bearbeitung von Mathe- manipuliert. matikaufgaben etwa auch der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben variiert werden. Damit ergäben sich sechs Teilnehmergruppen, bei denen jeweils eine der drei Geldbedingungen mit einem von zwei Schwierigkeitsgraden der zu bewältigenden Anforderung (leichte versus schwierige Mathematikaufgaben) kombiniert wäre. Messung. Beim Experimentieren ist es oft notwendig, Aussagen über Ausmaße, Größen, Anteile oder Häufigkeiten zu treffen. Manchmal lassen sich Variablen direkt in physikalischen Größen messen – zum Beispiel die Anzahl der Stunden mit Schlafentzug oder die Dosierung eines Medikaments. In anderen Fällen können Variablen nur so skaliert werden, dass ihre Ausprägungen eine Rangreihe bilden. Bei der Einschätzung der aggressiven Gefühle eines Patienten könnte ein Therapeut beispielsweise eine Fünf-PunkteSkala verwenden, die von „nie“ über „selten“, „manchmal“ und „oft“ bis zu „immer“ reicht. Zum Zweck der präzisen Mitteilung von Ergebnissen Messung ist ein systeerfordern Experimente somit matisches Verfahren, eine Form der Messung – ein mit dem den Auspra¤System, mit dem den Aus- gungen von Variablen prägungen von Variablen Werte zugeordnet werden. Werte zugeordnet werden. 27 Prinzipien psychologischer Forschung In Experimenten werden meistens an mehreren Personen Messungen durchgeführt und nicht nur an einer. Deshalb bestehen die Ergebnisdaten aus einer Menge von Zahlenwerten, die zusammengefasst und interpretiert werden können. Für diese Aufgabe benötigt man die Statistik – sie befasst sich damit, wie man aus einer Population von IndiviDie Statistik erlaubt duen Datenstichproben erRu¤ckschlu¤sse von Dahebt und daraus Rücktenstichproben auf die schlüsse auf die gesamte PoGesamtpopulation. pulation zieht. Statistik spielt nicht nur bei der experimentellen Forschung, sondern auch bei anderen Methoden eine wichtige Rolle.3 Die geläufigste Statistik ist das arithmetische Mittel – so lautet der Fachausdruck für den Durchschnitt oder Das arithmetische Mittelwert, der als Summe Mittel (der Durcheiner Menge von Messwerschnittswert) berechnet ten, geteilt durch die Anzahl sich als Summe einer der Messwerte, berechnet Messwertreihe, geteilt wird. In Untersuchungen durch die Anzahl der mit einer ExperimentalMesswerte. und einer Kontrollgruppe müssen zwei Mittelwerte verglichen werden: der Mittelwert der Messwerte bei den Teilnehmern der Experimentalgruppe und der entsprechende Mittelwert für die Kontrollgruppe. Natürlich ist es der Unterschied zwischen diesen beiden Mittelwerten, der den experimentellen Forscher interessiert. Ist dieser Unterschied groß, würde man ihn vielleicht ohne weitere Prüfung gelten lassen. Aber was ist bei einem kleinen Mittelwertsunterschied? Sind die verwendeten Maße vielleicht fehlerbehaftet? Sind vielleicht nur ein paar wenige Extremfälle (sogenannte Ausreißerwerte, die den Bereich, in dem die meisten Messwerte liegen, auffällig über- oder unterschreiten) für den Unterschied verantwortlich? Solche Fragen beantwortet die Statistik dadurch, dass sie Tests entwickelt hat, mit denen sich die statistische Bedeutsamkeit – die Signifikanz – eines Mittelwertunterschieds bestimmen lässt. Wenn es heißt, der Unterschied zwischen der Experimentalgruppe und der Kon- 3 Die Ero¤rterung an dieser Stelle soll in die experimentellen Werkzeuge der Messung und Statistik lediglich einfu¤hren. Eine eingehendere Darstellung findet sich im Anhang. trollgruppe sei statistisch Statistische Signifisignifikant, so bedeutet dies, kanz nach Anwendung dass ein statistischer Test eines statistischen auf die Daten angewandt Tests bedeutet, dass ein wurde, wonach es unwahr- beobachteter Unterscheinlich ist, dass der beob- schied nicht nur durch achtete Unterschied nur Zufall zustande gekommen ist. durch Zufall oder auf Grund einiger weniger Extremfälle zustande kam. Korrelation Nicht alle Fragestellungen lassen sich ohne weiteres experimentell untersuchen. In vielen Situationen hat der Untersuchende keine Kontrolle darüber, welche Teilnehmer sich in der einen oder der anderen Bedingung befinden. Wenn wir beispielsweise die Hypothese prüfen wollen, dass Menschen, die an Magersucht leiden, Geschmacksveränderungen stärker empfinden als Normalgewichtige, können wir nicht eine Gruppe Normalgewichtiger auswählen und von der Hälfte verlangen, sie möge eine Essstörung ausbilden! Vielmehr wählen wir Probanden aus, die bereits magersüchtig beziehungsweise normalgewichtig sind, und schauen, ob sie sich auch in ihrer Geschmacksempfindlichkeit unterscheiden. In verallgemeinerter Form heißt das: Man kann die Korrelationsmethode einsetzen, um zu bestimmen, ob eine beliebige Variable, die nicht unter unserer Kontrolle steht, mit einer anderen interessierenden Variable korreliert, das heißt in Beziehung steht. In dem Gewichtsbeispiel hatte die Variable nur zwei Ausprägungen: magersüchtig und normalgewichtig. Üblicherweise besitzt jede Variable jedoch viele Ausprägungen, und man bestimmt das Ausmaß, in dem die Werte der einen Variable mit den Werten der anderen Variable zusammenhängen. Dies erreicht man mit dem Korrelationskoeffizienten, einem deskriptiven statistischen Maß. Der Korrelationskoeffizient wird mit „r“ bezeich- Der Korrelationskoefnet; er schätzt das Ausmaß fizient scha¤tzt das des Zusammenhangs zwi- Ausma des Zusammenhangs zwischen schen zwei Variablen und zwei Variablen. wird als Zahl zwischen – 1 und +1 angegeben. Im (eher seltenen) Falle eines maximalen Zusammenhangs zwischen zwei Va- 1 28 riablen nimmt r den Wert j1j an (+1 bei einem positiven und – 1 bei einem negativen Zusammenhang). Wenn zwischen zwei Variablen kein Zusammenhang besteht, ergibt die Korrelation den Wert 0. Von 0 bis 1 (beziehungsweise von 0 bis – 1) erhöht sich die Stärke des Zusammenhangs. Wie schon angeführt, kann eine Korrelation positiv oder negativ sein. Das Vorzeichen der Korrelation (+ oder – ) gibt an, ob die Werte der beiden Variablen gemeinsam größer oder kleiner werden ( = positive Korrelation) oder ob sich der Wert der einen Variable erhöht, wenn sich der Wert der anderen Bei positiver KorreVariable verringert ( = negalation zwischen zwei tive Korrelation). Zum BeiVariablen werden ihre spiel möge die Anzahl der Werte gemeinsam Fehlstunden eines Schülers gro ¤er oder kleiner. im Unterricht mit seiner AbBei negativer Korreschlussnote mit r = – .40 korlation erho¤ht sich der relieren (je mehr AbwesenWert der einen Variable, heit, desto schlechtere wenn sich der Wert der Note). Umgekehrt betrage anderen verringert. die Korrelation zwischen der Anzahl der besuchten Stunden und der Endnote r = +.40. Die Stärke des Zusammenhangs ist in beiden Fällen identisch; das Vorzeichen hängt davon ab, ob wir die Fehlzeiten oder die Anwesenheitszeiten betrachten.4 Um sich ein klareres Bild von Korrelationskoeffizienten zu verschaffen, betrachte man die hypothetische Untersuchung in Abbildung 1.6. Abbildungsteil (a) zeigt die Ergebnisse einer Untersuchung an zehn Patienten mit einer spezifischen Hirnschädigung, die das Gesichtererkennen beeinträchtigt (Prosopagnosie). Dabei interessiert, ob das Ausmaß des Defizits beim Gesichtererkennen, also die Fehlerzahl, mit der Menge des zerstörten Hirngewebes anwächst. Jeder Punkt in der Graphik steht für den prozentualen Fehleranteil eines Patienten bei einem Gesichtererkennungstest. Beispielsweise hatte ein Patient mit zehn Prozent Schädigung der kritischen Hirnregionen in diesem Test eine Fehlerquote von 15 Prozent; ein anderer Patient mit 55 Prozent geschädigtem Gewebe zeigte eine Fehlerrate von 4 Die numerische Methode zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten wird im Anhang beschrieben. 1 Das Wesen der Psychologie 75 Prozent. Falls die Fehleranzahl beim Gesichtererkennen immer mit zunehmendem Ausmaß der Hirnschädigung ansteigt, müssten die Punkte in der Graphik von links nach rechts auf der Abszisse stetig höhere Ordinaten-Werte annehmen. Würden alle Punkte auf der Diagonalen liegen, betrüge die Korrelation r = 1.0. In diesem Fall läge ein maximaler positiver Zusammenhang zwischen beiden Variablen vor. Aus der Abbildung ist jedoch ersichtlich, dass einige Punkte von der Diagonalen abweichen. Die Korrelation beträgt etwa .90. Eine so hohe Korrelation zeigt an, dass zwischen dem Ausmaß der Hirnschädigung und der Fehlerrate beim Gesichtererkennen ein sehr starker Zusammenhang besteht. Die Korrelation in Abbildung 1.6 (a) ist positiv, das heißt, mit zunehmender Schädigung der kritischen Hirnregion gehen mehr Fehler einher. Wenn man sich nicht auf die Fehler konzentriert, sondern den Anteil korrekter Reaktionen beim Gesichtererkennungstest abträgt, erhält man das Diagramm in Abbildung 1.6 (b). Jetzt ist die Korrelation negativ (etwa – .90), weil weniger korrekte Antworten mit einem größeren Ausmaß an Hirnschädigung einhergehen. Die Diagonale in 1.6 (b) ist einfach die Umkehrung der Diagonalen in 1.6 (a). Zum Schluss betrachten wir noch Abbildung 1.6 (c). Hier sind die Fehler im Gesichtererkennungstest als Funktion der Körpergröße der Patienten abgetragen. Natürlich gibt es keinen Grund, warum zwischen Körpergröße und Gesichtererkennung ein Zusammenhang bestehen sollte, und dies zeigt sich auch in der Graphik. Steigenden Werten auf der Abszisse sind weder kontinuierlich steigende noch kontinuierlich fallende Ordinaten-Werte zugeordnet. Die Ordinaten-Werte oszillieren hingegen um eine waagerechte Gerade. Die Korrelation beträgt in diesem Fall 0. In der psychologischen Forschung wird ein Korrelationskoeffizient von .60 oder größer als recht hoher Zusammenhang angesehen. Korrelationen im Bereich von .20 bis .60 sind für Theorie und Praxis bedeutsam und können für Vorhersagen genutzt werden. Korrelationen zwischen 0 und .20 müssen mit Vorsicht betrachtet werden; für Vorhersagen sind sie nur von minimalem Nutzen. 29 Prinzipien psychologischer Forschung (b) Negative Korrelation (a) Positive Korrelation 100 Korrekte Antworten beim Gesichtererkennen (Prozent) Fehler beim Gesichtererkennen (Prozent) 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 Anteil der Hirnschädigung in kritischen Regionen (Prozent) (c) Nullkorrelation Fehler beim Gesichtererkennen (Prozent) 100 80 1 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 Anteil der Hirnschädigung in kritischen Regionen (Prozent) a) Die Patienten sind auf der Abszisse nach dem Ausma ihrer Hirnscha¤digung angeordnet, wobei der Patient, der durch den Punkt ganz links abgebildet ist, den geringsten Anteil an gescha¤digtem Gewebe (10 Prozent) und der Patient, der durch den Punkt ganz rechts abgebildet ist, den ho ¤chsten Anteil (55 Prozent) aufweist. Der Ordinaten-Wert jedes Punktes steht fu¤r den Testwert des jeweiligen Patienten in einem Test zum Gesichtererkennen. Die Korrelation ist positiv mit r = .90. 60 b) Dieselben Daten, aber jetzt als prozentualer Anteil korrekter Antworten (und nicht, wie zuvor, als Fehlerrate). Nun ist die Korrelation negativ mit -- .90. 40 c) Die Leistung im Gesichtererkennungstest als Funktion der Ko ¤rpergro¤e der Patienten. Hier betra¤gt die Korrelation 0. 20 0 64 66 68 70 72 Größe des Patienten (in Inches) Abb. 1.6 Diagramme zur Illustration der Korrelation. Diese hypothetischen Daten beruhen auf zehn Patienten mit Scha¤digungen in den Regionen des Gehirns, die am Erkennen von Gesichtern beteiligt sind. 30 Tests. Üblicherweise wird die Korrelationsmethode bei Tests eingesetzt, mit denen Begabungen, Leistungen oder andere psychologische Merkmale (beispielsweise die Fähigkeit zum Gesichtererkennen) gemesEin Test bietet eine sen werden. Ein Test bietet einheitliche Situation für eine Gruppe von Persofu¤r eine Gruppe von nen, die sich in einer beProbanden mit unterstimmten Eigenschaft unterschiedlichen Eigenscheiden (Ausmaß an Hirnschaftsauspra¤gungen. schädigung, mathematische Fähigkeiten, manuelle Geschicklichkeit oder Aggression), eine einheitliche, standardisierte Situation. Unterschiede der beim Test erreichten Punktwerte können mit Unterschieden bei einer anderen Variablen korreliert werden. Zum Beispiel kann man den Punktwert in einem mathematischen Fähigkeitstest mit späteren Zeugnisnoten in Mathematik korrelieren. Ist die Korrelation hoch, kann man die Testwerte heranziehen, um aus einer neuen Schülergruppe diejenigen auszuwählen, die einem speziellen Förderkurs (oder aber einem Fortgeschrittenenkurs) zugewiesen werden. Korrelation und Kausalita¤t. Zwischen experimentellen Untersuchungen und Korrelationsstudien besteht ein gravierender Unterschied. In einem typischen Experiment wird eine Variable (die unabhängige Variable) systematisch manipuliert, um ihren ursächlichen (kausalen) Effekt auf eine andere Variable (die abhängige Variable) zu bestimmen. Solche Beziehungen zwischen Ursache und Effekt lassen sich aus Korrelationsstudien nicht ableiten. Zum Beispiel haben Untersuchungen gezeigt, dass Jungen umso aggressiver sind, je mehr Gewaltdarstellungen sie im Fernsehen sehen. Aber verursacht der Gewaltkonsum im Fernsehen die Aggression, oder schauen aggressive Jungen mehr Gewaltsendungen? Wenn wir nur den korrelativen Zusammenhang kennen, können wir nicht sagen, welche Variable die Ursache und welche Variable die Folge ist. (An früherer Stelle wurde jedoch schon erwähnt, dass in anderen Untersuchungen auch ein kausaler Zusammenhang zwischen Gewaltkonsum im Fernsehen und aggressiven Verhaltenstendenzen nachgewiesen wurde. Dort konnten die Forscher die unabhängige Variable kontrollieren und die Teilnehmer den Bedingungen randomisiert zuweisen.) 1 Das Wesen der Psychologie Zwei Variablen können auch korreliert sein, ohne dass überhaupt eine die andere verursacht. Zum Beispiel wurde schon viele Jahre, bevor sorgfältige medizinische Experimente nachwiesen, dass Rauchen tatsächlich Krebs erzeugt, eine Korrelation zwischen Rauchen und Lungenkrebs nachgewiesen. Das heißt, man wusste bereits, dass Raucher mit größerer Wahrscheinlichkeit an Krebs erkranken als Nichtraucher. Doch ließ diese Korrelation die Möglichkeit offen, dass irgendeine dritte Variable diesen Zusammenhang verursacht – und die Tabakindustrie wurde nicht müde, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Wenn beispielsweise Menschen, die in versmogten städtischen Gebieten wohnen, häufiger Raucher sind als Menschen aus ländlichen Gegenden mit sauberer Luft, könnte die stärkere Luftverschmutzung für die höhere Krebsrate bei Rauchern verantwortlich sein und nicht das Rauchen selbst. Kurzum: Wenn zwei Variablen korreliert sind, kann die Variation der einen möglicherweise die Ursache für die Variation der anderen sein. Ein korrelativer Zusammenhang ist sogar eine Voraussetzung für eine Verursachungsbeziehung. Ohne weitere Experimente ist ein solcher Kausalschluss aus Korrelationsstudien jedoch nicht gerechtfertigt, weil Korrelation eben nicht notwendigerweise auch Kausalität impliziert. Beobachtung Direkte Beobachtung. In einem frühen Untersuchungsstadium kommt man einer Phänomenerklärung am ehesten dadurch näher, dass man das Phänomen in seinem natürlichen Auftreten einfach direkt beobachtet. Die sorgfältige Beobachtung menschlichen und tierischen Verhaltens bildet den Ausgangspunkt für einen Großteil psycholo- Direkte Beobachtung richtet sich auf ein gischer Forschungen. Zum Pha¤nomen in seinem Beispiel vermittelt uns die natu¤rlichen Auftreten. Beobachtung von Primaten in ihrer natürlichen Lebensumgebung Aufschlüsse über ihre soziale Organisation. Diese Kenntnisse sind dann bei späteren Laboruntersuchungen von Nutzen. Filmaufzeichnungen von Neugeborenen bringen Details ihrer Aktivität gleich nach der Geburt zu Tage und zeigen, auf welche Art von Reizen sie reagieren. Allerdings Prinzipien psychologischer Forschung bedarf es eines speziellen Trainings, um natürlich auftretendes Verhalten akkurat beobachten und aufzeichnen zu können, ohne dass eigene Voreingenommenheiten die Beobachtungsberichte verzerren oder beeinträchtigen. Beobachtungsmethoden können natürlich auch im Labor eingesetzt werden. Sofern der untersuchte Verhaltensbereich durch die Herauslösung aus seiner natürlichen Umgebung stark beeinträchtigt zu werden droht, kann man sich beispielsweise auf die Beobachtung seiner biologischen Komponenten konzentrieren. So entwickelten William Masters und Virginia Johnson in ihrer klassischen Untersuchung zu den physiologischen Aspekten der menschlichen Sexualität (1966) eigene Techniken, um sexuelle Reaktionen im Labor direkt zu beobachten. Ihre Daten umfassten (1) Verhaltensbeobachtungen, (2) Aufzeichnungen physiologischer Veränderungen und (3) Antworten auf Fragen zu den Empfindungen der Teilnehmer vor, während und nach sexueller Stimulation. Zwar stimmen die Forscher darin überein, dass die Sexualität des Menschen neben dem biologischen Aspekt noch viele andere Dimensionen besitzt, doch erwiesen sich die Beobachtungen der anatomischen und physiologischen Aspekte sexueller Reaktionen als außerordentlich hilfreich, um das Wesen der menschlichen Sexualität besser zu verstehen und um sexuelle Probleme und Schwierigkeiten zu behandeln. Befragung. Manche Fragestellungen, die sich durch direkte Beobachtung nur schlecht untersuchen lassen, kann man auf dem Wege indirekter Beobachtung untersuchen, und zwar mit Hilfe von Fragebögen und Interviews. Man beobachtet die Menschen also nicht bei einem bestimmten Verhalten, so wie sie es normalerweise ausführen. Vielmehr fragen Forscher die Menschen einfach, ob das in Frage stehende Verhalten auf sie zutrifft. Diese Methode der Befragung ist für Verzerrungen jedoch anfälliger als die direkte Beobachtung. Beispielsweise versuchen Menschen zuweilen, in einem günstigeren Licht zu erscheinen, als es der Realität entspricht; man nennt dies die Tendenz Bei Methoden der Bezur sozialen Erwünschtheit. fragung geben PersoSo geben sie beispielsweise nen Ausku¤nfte ¤uber ihr an, mehr Sport zu treiben, Verhalten. als sie es tatsächlich tun. 31 Dennoch haben Befra- Die Tendenz zur sogungsmethoden wichti- zialen Erwu¤nschtheit ge Erkenntnisse vermit- bringt manche Mentelt. Bevor beispielsweise schen dazu, sich durch Masters und Johnson ihre Selbstausku¤nfte in ihre Forschungen über ein gu¤nstiges Licht zu die sexuellen Reaktionen setzen. des Menschen durchgeführt hatten, stammte der größte Teil der verfügbaren Information über das reale menschliche Sexualverhalten (im Gegensatz zu den Verhaltensmaßgaben durch Gesetze, Religion und gesellschaftliche Normen und Konventionen) aus umfangreichen Umfragen, die Alfred Kinsey und seine Kollegen 20 Jahre zuvor erhoben hatten. Tausende von Interviews wurden für die beiden Pionierarbeiten ausgewertet, die 1967 unter den Titeln Das sexuelle Verhalten des Mannes und Das sexuelle Verhalten der Frau auch auf Deutsch erschienen sind (Original: Sexual behavior in the human male; Kinsey, Pomeroy & Martin, 1948; Sexual behavior in the human female, Kinsey, Pomeroy, Martin & Gebhard, 1953). Umfragen wurden auch eingesetzt, um etwas über die politischen Einstellungen von Menschen, ihre Produktpräferenzen, ihre Bedürfnisse bei der Gesundheitsvorsorge oder Ähnliches herauszufinden. In Deutschland beruht beispielsweise der von den Kommunen regelmäßig herausgegebene Mietspiegel auf Umfrageergebnissen; bekannt sind auch die Wahlprognosen der großen Umfrageinstitute und die regelmäßigen Beliebtheitsskalen von Politikern. Für eine angemessene und methodisch abgesicherte Umfrage muss ein sorgfältig vorgetesteter Fragebogen einer Stichprobe von Personen vorgelegt werden, und diese Stichprobe muss nach geeigneten Kriterien und mit geeigneten Methoden so ausgewählt werden, dass sie für die größere Population, über die etwas ausgesagt werden soll, repräsentativ ist. Fallgeschichten. Eine weitere Form indirekter Beobachtung besteht darin, eine Fallgeschichte aufzustellen – eine Teilbiographie einer bestimmten Person. Dazu lässt man sie wichtige Erfahrun- Eine Fallgeschichte gen und Erlebnisse aus ihrer beschreibt einen Teil Vergangenheit wiedergeben. der Biographie einer Wenn es beispielsweise um Person. 1 32 1 Das Wesen der Psychologie die Bedingungen in der Kindheit als Vorläufer einer Depression im Erwachsenenalter geht, beginnt der Untersuchende damit, Fragen über frühe Lebensereignisse zu stellen. Solche Fallgeschichten sind Biographien, die speziell für wissenschaftliche Zwecke vorgesehen sind. Sie bilden eine wichtige Datenquelle für die psychologische Untersuchung von Einzelpersonen. Fallgeschichten sind in ihrer Aussagekraft dadurch begrenzt, dass sie auf den Erinnerungen einer Person und ihren Rekonstruktionen früherer Ereignisse beruhen; diese sind häufig getrübt, verzerrt oder unvollständig. Manchmal kann man andere Daten hinzuziehen, um die mit einer Fallgeschichte gewonnenen Daten zu untermauern. Zum Beispiel können bestimmte Jahreszahlen mit Hilfe von Dokumenten, etwa Todesurkunden, nachgeprüft werden, oder man befragt Verwandte der interviewten Person nach ihren eigenen Erinnerungen an die in Frage stehenden Ereignisse. Dennoch sind Fallgeschichten wegen der genannten Präzisionsmängel wenig geeignet, um eine Theorie oder eine Hypothese zu prüfen. Sie tragen eher zur Bildung von Hypothesen bei, die man dann auf strengere Weise oder an einer größeren Stichprobe überprüfen kann. Folglich nutzen Wissenschaftler Fallgeschichten in ähnlicher Weise wie Ärzte oder Therapeuten, die versuchen, Personen zu diagnostizieren und geeignete Behandlungsmethoden auszuwählen. Literaturu ¤bersichten Ein weiterer Weg, wie psychologische Forschung betrieben wird, ist die Erstellung von Literaturübersichten. Dabei handelt es sich um eine wissenschaftliche ZusammenfasLiteraturu ¤ bersichten sung der vorliegenden Forgeben eine wissenschungsergebnisse zu einem schaftliche Zusammenbestimmten Thema. Weil fassung der vorliegendas Gebiet der Psychologie den Forschungsergebsehr schnell wächst, sind nisse zu einem beLiteraturübersichten auf akstimmten Thema. tuellem Stand ein unverzichtbares Mittel, um in den sich anhäufenden wissenschaftlichen Belegen für oder gegen eine bestimmte psychologische Hypothese oder Theorie die relevanten Muster zu erkennen. Literaturübersichten gibt Ein narrativer Literaes in zwei Varianten. Eine turu¤berblick ist eine Form ist der narrative Über- verbale Beschreibung blick, bei dem die Autoren und Diskussion des mit Worten Untersuchungen Forschungsstandes auf beschreiben, die bereits einem Gebiet. durchgeführt wurden, und die Stärke der vorhandenen psychologischen Belege kritisch diskutieren. Studierende in höheren Semestern schreiben zuweilen als Seminararbeit narrative Literaturübersichten zu ausgewählten Themen. Ein anderer Typ von Literaturübersicht, der immer beliebter wurde, ist die MetaAnalyse. Dabei werden vorliegende Untersuchungen mit Hilfe von statistischen Verfahren zusammen- Bei einer Meta-Analyse gefasst, woraus sich die ent- werden vorhandene Untersuchungen mit sprechenden Schlüsse ablei- statistischen Methoden ten lassen. Wie wir gesehen zusammengefasst, um haben, werden in jedem ein- den Forschungsstand zu zelnen Experiment die Pro- beurteilen. banden als „Fälle“ betrachtet; jeder Teilnehmer trägt seine eigenen Daten bei, welche dann statistisch zusammengeführt werden. Bei einer Meta-Analyse werden dagegen die einzelnen Untersuchungen als „Fälle“ behandelt; jede Untersuchung trägt ihre eigenen zusammengefassten Daten bei, welche dann auf einer höheren Analyseebene (der Meta-Ebene) weiter zusammengefasst werden. Man kann sich leicht vorstellen, dass Meta-Analysen gegenüber narrativen Literaturübersichten das Potenzial besitzen, systematischer und ausgewogener zu sein. Im Verlauf dieses Lehrbuchs greifen wir oft auf Meta-Analysen zurück, um den Forschungsstand bei psychologischen Theorien und Hypothesen darzustellen. Ethische Prinzipien psychologischer Forschung Da Psychologen Lebewesen untersuchen, dürfen sie ethische Fragen nicht vernachlässigen, die sich bei der Durchführung ihrer Forschungen stellen können. Entsprechend haben die deutschen psychologischen Dachverbände – wie auch der amerikanische Psychologenverband APA und vergleichbare Verbände in anderen Ländern – Prinzipien psychologischer Forschung Richtlinien für den Umgang mit menschlichen Versuchsteilnehmern und mit Versuchstieren aufgestellt und etabliert (DGPs, 1998; American Psychological Association, 1990). In den USA muss qua Bundesgesetz jede Institution, die öffentlich geförderte Forschungen durchführt, eine interne Kommission einsetzen, die die Forschungsvorhaben begutachtet, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer korrekt behandelt werden. In Deutschland muss bei der Beantragung öffentlicher Gelder (beispielsweise bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft) ebenfalls zum Umgang mit Versuchspersonen und Versuchstieren Stellung genommen werden, wobei örtliche Ethikkommissionen nicht in der Weise obligatorisch sind wie in den USA; bei Untersuchungen an Schulen übernimmt aber beispielsweise das zuständige Oberschulamt diese Rolle. Forschungen an Menschen. Der ethische Umgang mit menschlichen Versuchsteilnehmern ist erstens durch das Prinzip des minimalen Risikos geleitet. Dieses besagt, dass Nach dem Prinzip des in den meisten Fällen die minimalen Risikos soll für die Forschungsdurchfühdie Gefa¤hrdung durch rung antizipierten Risiken ein Forschungsvorhanicht größer sein sollten als ben die Risiken des die Risiken des normalen Alltags nicht u¤bersteiAlltagslebens. Ganz offengen. sichtlich soll eine Person keinen körperlichen Schäden oder Verletzungen ausgesetzt werden. Weniger eindeutig ist dagegen die Entscheidung, wie viel psychischer Stress in einem Forschungsprojekt ethisch noch zu rechtfertigen ist. Im täglichen Leben kann eine Person natürlich unhöflich sein, lügen oder anderen Menschen Angst einjagen. Unter welchen Umständen ist es jedoch für einen Forscher ethisch zu rechtfertigen, einen Versuchsteilnehmer in dieser Weise zu behandeln, um den Zielen seines Forschungsprojekts näher zu Informierte Einwillikommen? Solche Fragen gung bedeutet, dass müssen die EthikkommissioProbanden, nachdem nen von Fall zu Fall entsie u¤ber alle relevanten scheiden. Aspekte informiert wurden, freiwillig an Das zweite ethische Leiteiner Untersuchung prinzip für den Umgang teilnehmen und diese mit Menschen in Untersujederzeit ohne Nachchungen ist die informierte teile abbrechen ko¤nnen. Einwilligung. Danach müs- 33 sen den Teilnehmern im Voraus alle Aspekte der Untersuchung mitgeteilt werden, die ihre Kooperationsbereitschaft beeinträchtigen könnten. Nach dieser Information müssen sich die Teilnehmer freiwillig in die Untersuchung begeben und dürfen diese zu jedem Zeitpunkt und ohne persönlichen Nachteil abbrechen, wenn sie es wünschen. Wie beim Prinzip des minimalen Risikos lässt sich auch die informierte Einwilligung nicht immer ohne weiteres umsetzen. Insbesondere steht die informierte Einwilligung manchmal zu einer anderen häufigen Anforderung an Forschungen im Widerspruch: Die Teilnehmer sollen sich der untersuchten Hypothesen nicht bewusst sein. Wenn ein Forscher plant, eine Gruppe von Teilnehmern Listen mit bekannten Wörtern und eine andere Gruppe von Teilnehmern Listen mit unbekannten Wörtern lernen zu lassen, um sie dann zu vergleichen, wirft das kein ethisches Problem auf, wenn man den Teilnehmern vorab verrät, dass sie Wortlisten lernen werden: Sie müssen die Variation der Wortlisten ja nicht kennen. Auch ergeben sich keine ernsthaften ethischen Fragen, wenn überraschenderweise Wörter abgefragt werden, die die Teilnehmer nicht erwartet hatten. Aber wie sieht es aus, wenn der Forscher Probanden vergleichen möchte, die beim Wörterlernen im einen Fall neutral und im anderen Fall verärgert oder verlegen gestimmt sind? Die Untersuchung würde sicher keine aussagekräftigen Schlussfolgerungen zulassen, wenn man den Teilnehmern vorab mitteilen müsste, dass sie mit Absicht geärgert (indem man sie grob behandelt) oder in Verlegenheit gebracht werden (indem man sie glauben lässt, sie hätten versehentlich ein Laborgerät kaputt gemacht). Für solche Fälle besagt die Richtlinie, dass – falls eine solche Untersuchung überhaupt zugelassen wird – die Teilnehmer zumindest im Anschluss an die Untersuchung schnellstmöglich informiert und aufgeklärt werden müssen. Bei dieser postexperimentellen Aufklärung werden die Gründe In der Phase der postdafür, warum Probanden in experimentellen AufUnkenntnis gelassen oder so- kla¤rung werden den gar getäuscht wurden, Probanden etwaige schlüssig dargelegt. Mit mög- Ta¤uschungen und Inforlichen andauernden Gefühls- mationsdefizite aufgereaktionen muss man so um- deckt und mit Blick auf gehen, dass die Probanden das Untersuchungsziel erkla¤rt. die Untersuchung mit unbe- 1 34 1 Das Wesen der Psychologie kontrovers Sind wir von Natur aus egoistisch? Wir sind von Natur aus egoistisch George C. Williams, Staatsuniversita¤t von New York, Stony Brook Ja, wir sind egoistisch, und zwar in einem bestimmten biologischen Sinn, der sehr wichtig ist und den man nicht vergessen sollte, wenn man das Menschsein, die philosophische Ethik und verwandte Themen diskutiert (Williams, 1996, Kapitel 3 und 9). Wir sind egoistisch in einer speziellen Weise, die unsere Gene verlangen. Sie sind sogar maximal egoistisch, weil wir sonst nicht existieren wu¤rden. Die Gene, die u¤ber viele Generationen weitergegeben werden, sind diejenigen, denen es am besten gelungen ist, weitergegeben zu werden. Dazu mu¤ssen sie besser sein als jede andere Alternative, wenn es darum geht, einen menschlichen oder sonstigen Ko ¤rper herzustellen, der die Gene wiederum mit gro¤erer Vehemenz und Durchsetzungskraft weitergibt als die anderen Mitglieder der Population. Individuen ko ¤nnen diesen genetischen Wettbewerb hauptsa¤chlich dadurch gewinnen, dass sie bis zur Geschlechtsreife u¤berleben und dann erfolgreich um die Ressourcen ka¤mpfen (Nahrung, Nistpla¤tze, Partner et cetera), die sie fu¤r ihre eigene Reproduktion beno¤tigen. In diesem Sinne sind wir notwendigerweise egoistisch, was nicht heien muss, dass wir nicht auch uneigennu¤tzig handeln ko ¤nnen. Individuen haben die Fa¤higkeit, andere dabei zu unterstu¤tzen, Ressourcen zu erschlieen und Verluste oder Gefahren zu vermeiden, und setzen sie auch ha¤ufig ein. Um derartiges Verhalten biologisch zu verstehen, mu¤ssen die Randbedingungen, unter denen das scheinbar wohlwollende Verhalten auftritt, analysiert werden. Das offensichtlichste Beispiel fu¤r helfendes Verhalten u¤ben Eltern gegenu¤ber ihrem Nachwuchs aus. Die einleuchtende Erkla¤rung dieses Verhaltens besteht darin, dass Eltern ihre Gene nicht erfolgreich weitergeben ko ¤nnten, wenn sie ihren eigenen Jungen nicht auf artgerechte Weise helfen wu¤rden: Sa¤ugetiermu¤tter mu¤ssen ihre Babys sa¤ugen; Vo ¤gel mu¤ssen ihren Nestlingen Futter bringen; eine Pflanze muss jeden Samen mit einer optimalen Menge an Na¤hrstoffen ausstatten. Dabei handelt es sich jedoch nie um eine generalisierte Hilfsbereitschaft von Erwachsenen gegenu¤ber Jungen. Vielmehr gibt es Me- chanismen, mit denen Eltern ihren eigenen Nachwuchs identifizieren ko ¤nnen und ihre Hilfsbereitschaft dann ausschlielich auf ihn beschra¤nken. Wenn die Reproduktion ausschlielich auf sexuellem Wege erfolgt und die Partner in der Regel nicht eng miteinander verwandt sind, besitzt jeder Nachkomme die Ha¤lfte der Gene eines jeden Elternteils. Aus der Sicht eines Elternteils ist ein Sohn oder eine Tochter genetisch halb so wichtig wie er selbst, und die Reproduktion eines Nachkommen ist halb so wichtig wie die eigene, wenn es darum geht, die eigenen Gene weiterzugeben. Die partielle genetische ¤ bereinstimmung gilt jedoch fu¤r alle Verwandten, U nicht nur fu¤r den eigenen Nachwuchs. So kann es dem genetischen Egoismus eines Individuums auch dienen, sich gegenu¤ber Verwandten generell hilfreich zu verhalten und nicht nur gegenu¤ber dem eigenen Nachwuchs. Solche Verhaltensweisen entstehen durch die sogenannte Verwandtschaftsselektion, die natu¤rliche Selektion fu¤r den adaptiven Gebrauch von Hinweisreizen, die das Ausma und die Wahrscheinlichkeit von Verwandtschaftsbeziehungen anzeigen. In welchem Ausma Hinweise auf eine genealogische (das heit Stammes-) Verbindung auch vor¤gen, ein Individuum wird Verwandte gegenliegen mo u¤ber Nicht-Verwandten und nahe Verwandte (Eltern, Nachwuchs, Geschwister) gegenu¤ber entfernteren Verwandten bevorzugen. Ein ma¤nnlicher Vogel, dessen Partnerin Eier in sein Nest legte, kann einen Evolutionsvorteil erzielen, wenn er die Eier ausbru¤tet und spa¤ter die ausgeschlu¤pfte Brut fu¤ttert. Aber was ist, wenn er mo ¤glicherweise betrogen wurde? Kann er wirklich sicher sein, dass seine Partnerin nicht von einem Nachbarma¤nnchen befruchtet wurde, so dass eines oder mehrere der Eier gar nicht seinen eigenen Nachwuchs enthalten? Paarungen der Partnerin auerhalb der Partnerschaft kommen, mit oder ohne Duldung, bei vielen Arten vor. Die Ma¤nnchen solcher Arten passen auf das Verhalten ihrer Partnerinnen ganz besonders auf und sind sehr eifrig, wenn es darum geht, rivalisierende Ma¤nnchen aus ihrem Territorium zu verjagen. Es ist zu erwarten, dass sich Ma¤nnchen von Arten, bei denen durchschnittlich zehn Prozent der Eier von Rivalen befruchtet werden, weniger gewissenhaft um ihre Nestlinge ku¤mmern als von Arten, in denen auerpartnerschaftliche Seitenspru¤nge niemals vorkommen. Prinzipien psychologischer Forschung 35 1 Die Verwandtschaftsselektion ist ein ursa¤chlicher Faktor fu¤r das uneigennu¤tzige oder sogenannte altruistische Verhalten. Ein weiterer Faktor ist das Gegenseitigkeitsprinzip zwischen nicht verwandten Individuen, bei dem jeder Teilnehmer sofort oder zuku¤nftig von diesem Verhalten profitiert. Zu den genannten Faktoren geho ¤rt auch die egoistische Ta¤uschung beziehungsweise die Manipulation der Instinkte eines anderen Individuums, die auf Verwandtschaftsselektion oder andere altruistische oder kooperative Verhaltensweisen gerichtet sind. Wie die Ma¤nnchen ko ¤nnen sich auch die Vogelweibchen nicht sicher sein, dass die Nestlinge ihre eigenen sind, weil das Eierablegen (Sayler, 1992), bei dem ein Ei im Nest eines anderen Vogels abgelegt wird, wa¤hrend dessen Besitzer kurz zum Fressen abwesend ist, bei vielen Arten vorkommt. In genetischer Hinsicht gewinnt ein Weibchen, wenn es die elterlichen Instinkte eines anderen ausnutzt. Die Spezies, bei der Ta¤uschung und Manipulation am weitesten entwickelt sind, ist -- dank unserer Sprachfa¤higkeit -- unsere eigene. Shakespeare zufolge sprach Heinrich V. seine Armee mit Ðwir Schar von Bru¤dern an. Feministinnen sprechen von ÐSchwesternschaft. Die Ta¤uschung und Manipulation der Gefu¤hle anderer kann natu¤rlich aus ehrenwerten oder aus weniger ehrenwerten Gru¤nden erfolgen. Wir sind nicht von Natur aus egoistisch Frans B. M. de Waal, Emory Universita¤t ÐWie selbstbezogen man sich den Menschen auch vorstellen mag, gibt es doch offensichtlich einige Prinzipien in seinem Wesen, die ihn am Glu¤ck anderer interessiert sein lassen und ihre Zufriedenheit ihm zum Bedu¤rfnis machen, wenn er auch nichts daraus gewinnt als die Freude, dessen ansichtig zu werden. Adam Smith, 1759 Als Lenny Skutnik 1982 in Washington (DC) in den eiskalten Potomac eintauchte, um ein Opfer eines Flugzeugunglu¤cks zu retten, oder als holla¤ndische Zivilisten im Zweiten Weltkrieg ju¤dische Familien versteckten, nahmen sie im Interesse von vo ¤llig fremden Personen lebensbedrohliche Risiken auf sich. In ¤ahnlicher Weise rettete Binti Jua, ein Tieflandgorilla aus dem Brookfield-Zoo in Chicago, einen bewusstlosen Jungen, der in ihr Gehege gefallen war, wobei sie eine Handlungsfolge ausfu¤hrte, die ihr zuvor nicht beigebracht wurde. Solche Beispiele rufen vor allem deshalb einen tiefen Eindruck hervor, weil sie Mitgliedern unserer eigenen Spezies zugute kommen. In meinen Arbeiten zur Evolution von Empathie und Moral habe ich jedoch so vielfa¤ltige Belege dafu¤r gefunden, dass Tiere fu¤reinander sorgen und wechselseitig auf ihre Sorgen und Lei¤ berleben den reagieren, dass ich ¤uberzeugt bin, das U ha¤ngt nicht nur von der Sta¤rke im Kampf ab, sondern zuweilen auch von Kooperation und Gu¤te (de Waal, 1996). Beispielsweise ist es unter Schimpansen u¤blich, dass sich ein Zuschauer dem Opfer eines Angriffs na¤hert und ihm behutsam einen Arm um die Schulter legt. Trotz dieser fu¤rsorglichen Neigungen werden Menschen und andere Lebewesen von Biologen regelma¤ig als vollsta¤ndige Egoisten dargestellt. Der Grund dafu¤r ist theoretischer Natur: Jegliches Verhalten soll sich herausgebildet haben, um den eigenen Interessen des Handelnden zu dienen. Die Annahme, dass Gene, die ihrem Tra¤ger nicht nu¤tzen, im Prozess der natu¤rlichen Selektion benachteiligt sind, erscheint logisch. Aber ist es angemessen, ein Tier nur deshalb egoistisch zu nennen, weil sich sein Verhalten zum eigenen Nutzen entwickelt hat? Der Prozess, der ¤uber Jahrmillionen der Evolution zur Herausbildung einer bestimmten Verhaltensweise gefu¤hrt hat, verliert seine Relevanz, wenn es um die Erkla¤rung geht, warum sich ein Tier hier und jetzt in einer bestimmten Weise verha¤lt. Tiere sehen nur die unmittelbaren Folgen ihrer Handlungen, und selbst diese sind ihnen nicht immer klar. Wir nehmen an, dass eine Spinne ein Netz baut, um Fliegen zu fangen; aber das stimmt so nur auf funktionaler Ebene. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Spinnen irgendeine Idee haben, wofu¤r Netze gut sind. Mit anderen Worten: Der Zweck eines Verhaltens sagt nichts u¤ber die ihm zu Grunde liegenden Motive aus. Erst ku¤rzlich wurde das Konzept des Egoismus (englisch: selfishness) seiner umgangssprachlichen Bedeutung beraubt und kam auch auerhalb des psychologischen Bereichs zur Anwendung. Auch wenn der Begriff nunmehr von einigen synonym mit ÐEigennutz verwendet wird, impliziert der Egoismus auch die Absicht (Intention), sich selbst zu nu¤tzen, also das Wissen um den mo ¤glichen Gewinn aus einem " 36 1 Das Wesen der Psychologie ¤ konomie. Der Untersophen und Vater der O schied zwischen eigennu¤tzigen Handlungen und egoistischen Motiven wird auch darin deutlich, dass Smith, der fu¤r seine Betonung des Eigeninteresses als Leitprinzip der Volkswirtschaft bekannt ist, in seinen Schriften auch die universelle menschliche Fa¤higkeit zur Sympathie behandelte. Die Urspru¤nge dieser Neigungen liegen nicht im Dunkeln. Alle Arten, die auf Kooperation angewiesen sind, zeigen Gruppenloyalita¤t und Hilfeleistungstendenzen. Diese Tendenzen entwickelten sich im Kontext eines eng verflochtenen sozialen Lebens, in dem sie den Verwandten und den Weggefa¤hrten zugute kamen, die in der Lage waren, sich fu¤r Gefa¤lligkeiten zu revanchieren. Der Impuls zu helfen war deshalb niemals ¤ berlebenswert fu¤r diejenigen, die ohne U > Ein erwachsener ma¤nnlicher Schimpanse, der in einem ihn zeigten. Aber der Impuls wurde von Kampf mit einem Rivalen besiegt wurde, schreit auf, wa¤hrend den Konsequenzen abgetrennt, die seine er von einem Jungtier mit einer Umarmung getro¤stet wird. SolEntwicklung bedingt haben. Folglich konnte che tro ¤stende Gesten wurden bislang bei anderen Tieren nicht er auch dann auftreten, wenn Gegenleistunberichtet. Das Verhalten erscheint als eine Form der Empathie gen unwahrscheinlich waren, beispielsweise ohne greifbaren Nutzen fu¤r den Ausfu¤hrenden. gegenu¤ber Fremden. Jegliches Verhalten egoistisch zu nennen, bestimmten Verhalten. Ein Rebstock kann seinen ist, als ob man alles Leben auf Erden als umgewaneigenen Interessen dienen, indem er einen Baum delte Sonnenenergie bezeichnet. Beide Aussagen mo¤u¤berwuchert; aber da es Pflanzen an Absichten und gen von allgemeinem Wert sein, sind aber wenig hilfWissen fehlt, ko ¤nnen sie nicht egoistisch sein, es reich, um die Vielfalt zu erkla¤ren, die wir um uns herum sei denn in einem bedeutungsleeren, metaphorischen erleben. Manche Tierarten ¤uberleben durch ru¤ckSinn. Aus demselben Grund ko ¤nnen Gene nicht egoissichtslosen Wettbewerb, andere durch wechselseitige tisch sein. Hilfe. Ein Rahmenkonzept, das keinen Raum bietet, Charles Darwin verwechselte Anpassung niemals um die beteiligten gegensa¤tzlichen ,Geisteshaltungen mit individuellen Zielen, und er billigte altruistische zu unterscheiden, mag fu¤r die Evolutionsbiologie von Motive. Darin folgte er Adam Smith, dem MoralphiloNutzen sein: In der Psychologie ist es fehl am Platz. einträchtigter Würde und mit einem tieferen Verständnis für die Ziele der Untersuchung verlassen. Die Kommission muss davon überzeugt werden, dass das Informations- und Aufklärungsverfahren für diese Zwecke geeignet und angemessen ist. In Deutschland wird das Prinzip der informierten Einwilligung – vor allem bei der Arbeit mit studentischen Stichproben – weniger strikt gehandhabt. Hier hat der Forscher augenscheinlich mehr Freiheit, aber ihm obliegt damit auch mehr Verantwortung. Im Allgemeinen geben die Teilnehmer dem Versuchsleiter – unbeschadet ihres Rechts, ihre Teilnahmebereitschaft jederzeit zu widerrufen – einen gewissen Vertrauensvorschuss und dürfen dafür erwarten, ethisch vertretbar behandelt und am Ende der Untersuchung wie beschrieben informiert und aufgeklärt zu werden. Ein drittes ethisches Forschungsprinzip besteht in Versuchsteilnehmer bedem Recht auf Geheimhal- sitzen ein Recht auf tung. Jegliche Information, Geheimhaltung; alle die im Verlauf einer Unter- erhobenen Informatiosuchung über eine Person er- nen mu¤ssen vertraulich bleiben. hoben wird, muss vertraulich 37 Prinzipien psychologischer Forschung bleiben und darf Dritten ohne explizite Einwilligung des Teilnehmers nicht zur Kenntnis gegeben werden. Dieses Prinzip wird häufig so umgesetzt, dass man den Namen und andere Informationen, aus denen einzelne Teilnehmer anhand der Daten identifiziert werden können, vom Datensatz abtrennt. Die Daten werden dann nur noch durch einen Kode oder durch eine Teilnehmernummer gekennzeichnet. Auf diese Weise hat niemand außer dem Versuchsleiter Zugang zu den Antworten und Reaktionen eines bestimmten Teilnehmers. Eine weitere gängige Praxis besteht darin, nur aggregierte Daten zu berichten – also beispielsweise die durchschnittlichen Werte aller Teilnehmer einer Bedingung oder Versuchsgruppe. Dadurch wird die Anonymität einzelner Untersuchungsteilnehmer zusätzlich geschützt. Auch bei Einhaltung all dieser ethischen Bedingungen muss der Forscher noch die Kosten der Untersuchung gegen ihren möglichen Nutzen abwägen – dabei geht es hier nicht um die ökonomischen Kosten, sondern um die Kosten für den Menschen. Muss man wirklich eine Untersuchung konzipieren, in der die Teilnehmer getäuscht oder in Verlegenheit gebracht werden? Nur wenn sich der Forscher und gegebenenfalls das Entscheidungskomitee sicher sind, dass die Untersuchung – in praktischer oder theoretischer Hinsicht – lohnenswerte Informationen zu Tage bringen wird, kann das Forschungsvorhaben gerechtfertigt werden. Forschungen an Tieren. Ein weiterer Bereich, in dem ethische Standards beachtet werden müssen, sind Forschungen mit Tieren. Etwa sieben Prozent der psychologischen Untersuchungen arbeiten mit Tieren; dabei handelt es sich zu 95 Prozent um Ratten, Mäuse und Vögel. Psychologen forschen mit Tieren vor allem aus zwei Gründen. Zum einen kann das Verhalten von Tieren an sich interessant und untersuchungswürdig sein. Zum anderen können die Systeme von Tieren als Modell für menschliche Systeme herangezogen werden, so dass die Forschung an Tieren Erkenntnisse bringt, die man an Menschen nicht oder nicht auf ethisch vertretbare Weise gewinnen könnte. So haben Tierexperimente eine zentrale Rolle für das Verstehen und die Behandlung psychischer Probleme im Zusammenhang mit Angst, Stress, Aggression, Depression, Drogenmissbrauch, Essstörungen, Bluthochdruck und Alzheimer-Erkrankung gespielt (Carroll & Overmier, 2001). Trotz der andauernden Debatte über das ethische Für und Wider von Forschungen an Tieren unterstützen in den USA die meisten Psychologen (80 Prozent) und psychologischen Studienabsolventen (72 Prozent) die Verwendung von Tieren in der Forschung (Plous, 1996a, 1996b). Bei dieser breiten Befürwortung bleibt jedoch die Besorgnis über die kleine Untergruppe von Tierexperimenten mit schmerzhaften oder gesundheitsschädlichen Verfahren. Um dieser Besorgnis gerecht zu werden, fordern die Tierschutzgesetze wie auch die Richtlinien der psychologischen Verbände, dass sich jegliche schmerzhafte oder die Gesundheit beeinträchtigende Untersuchung an Tieren nur nach sorgfältiger Abwägung der Erkenntnisse, die sich aus der Untersuchung ziehen lassen, rechtfertigen lässt. Zu den ethischen Leitlinien gehört auch die Betonung der moralischen Verpflichtung von Forschenden, Tiere würdig wie Lebewesen zu behandeln und Schmerz und Leiden möglichst gering zu halten. Spezielle Regeln und Gesetze über die Lebensbedingungen und die Haltung von Labortieren bestimmen, wie diese moralische Verpflichtung einzuhalten ist. Neben diesen speziellen Richtlinien besteht ein zentrales Prinzip der Forschungsethik darin, dass die Teilnehmer an psychologischen Untersuchungen als gleichwertige Partner betrachtet werden. Einige der in diesem Buch behandelten Forschungen wurden durchgeführt, bevor die oben beschriebenen Richtlinien erstmals formuliert waren, und würden von den meisten Kommissionen heute nicht mehr zugelassen werden. zusammengefasst Die Durchfu¤hrung psychologischer Forschungsarbeiten umfasst die Formulierung einer Hypothese und ihre anschlieende Pru¤fung mit Hilfe einer wissenschaftlichen Methode. Zu den wichtigsten Begriffen, um psychologische Experimente zu verstehen, geho ¤ren unabha¤ngige und abha¤ngige Variablen, Experimental- und Kontrollgruppen, Randomisierung, Messung und Statistik. 1 38 1 Das Wesen der Psychologie Wenn Experimente nicht durchfu¤hrbar sind, kann man mit der Korrelationsmethode bestimmen, ob eine natu¤rlich auftretende Variable mit einer anderen zusammenha¤ngt. Das Ausma dieses Zusammenhangs wird mit dem Korrelationskoeffizienten r gemessen, der positiv (bis maximal +1) oder negativ (bis minimal -- 1) ausfallen kann, je nachdem, ob die Werte auf der einen Variablen mit steigenden Werten der anderen Variable ansteigen (+) oder fallen ( -- ). Forschung erfolgt auch mit Hilfe der Beobachtungsmethode, entweder durch direkte Beobachtung, durch Befragungen oder durch Fallstudien. Schlielich wird Forschung auch durch Literaturu¤bersichten betrieben, wobei narrative Zusammenfassungen und statistische Meta-Analysen zu unterscheiden sind. Die grundlegenden ethischen Richtlinien fu¤r einen ethischen Umgang mit menschlichen Teilnehmern sind minimales Risiko, informierte Einwilligung und das Recht auf Geheimhaltung. Jegliches schmerzhafte oder gesundheitsscha¤dliche Verfahren gegenu¤ber Tieren muss eingehend gerechtfertigt werden durch die mo¤glichen Erkenntnisse einer Untersuchung. nachgefragt 1. Abbildung 1.3 zeigt die Ergebnisse einer klassischen Untersuchung, aus der hervorging, dass die Pra¤ferenz neunja¤hriger Jungen fu¤r Gewaltsendungen im Fernsehen mit ihrem aggressiven Verhalten im Alter von 19 Jahren zusammenha¤ngt. Warum erbringt diese Untersuchung nicht den Nachweis, dass es der Fernsehkonsum ist, welcher die Jungen aggressiver macht? Welche Art von Belegen bra¤uchte man fu¤r eine solche Behauptung? 2. Angenommen, ein Forscher findet eine Korrelation von +.50 zwischen den Symptomen einer Esssto ¤rung und der intensiven Bescha¤ftigung mit dem eigenen Aussehen. Was la¤sst sich daraus schlieen? Wie ko¤nnte man diese beobachtete Zusammenhangsbeziehung erkla¤ren? Versuchen Sie, eine Hypothese u¤ber Ursache und Wirkung zu formulieren! Wie wu¤rden Sie diese Hypothese pru¤fen? ¤ berblick im U 1. Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und den geistigen Prozessen. 2. Die Wurzeln der Psychologie lassen sich bis ins vierte und fünfte Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen. Die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles formulierten grundlegende Fragen über den Geist, während Hippokrates, der ,Vater der Medizin‘, zu wichtigen Beobachtungen darüber kam, wie das Gehirn andere Organe steuert. Eine der ersten Debatten über die Psychologie des Menschen galt der Frage, ob die menschlichen Fähigkeiten angeboren (die nativistische Sicht) oder durch Erfahrung erworben (die empiristische Sicht) sind. 3. Die wissenschaftliche Psychologie entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Grundgedanken, dass sich Geist und Verhalten zum Gegenstand wissenschaftlicher Analysen erheben lassen. Das erste psychologische Experimentallabor hat Wilhelm Wundt 1879 an der Universität Leipzig gegründet. 4. Zu den ersten psychologischen ,Schulen‘ im 20. Jahrhundert gehören der Strukturalismus (die Analyse geistiger Strukturen), der Funktionalismus (die Untersuchung, wie der Geist so arbeitet, dass sich ein Organismus an seine Umwelt anpassen und in ihr funktionieren kann), der Behaviorismus (die Untersuchung des Verhaltens auf Umweltreize ohne Rekurs auf Bewusstsein), die Gestaltpsychologie (die sich auf die von Reizen gebildeten Muster und die Organisation von Erfahrungen konzentriert) und die Psychoanalyse (welche die Rolle unbewusster Prozesse bei der Persönlichkeitsentwicklung und als Beweggründe unseres Handelns hervorhebt). 5. Zu den neueren Entwicklungen in der Psychologie des 20. Jahrhunderts gehören die Theorie der Informationsverarbeitung, die Psycholinguistik und die Neuropsychologie. 6. Dem Studium der Psychologie kann man sich aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Der biologische Ansatz führt Handlungen auf Ereignisse innerhalb des Körpers, insbesondere in Gehirn und Nervensystem, zurück. Der verhaltenspsychologische Ansatz berücksichtigt ¤ berblick im U nur äußere Aktivitäten, die sich beobachten und messen lassen. Der kognitive Ansatz thematisiert geistige Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis, logisches Denken, Entscheiden und Problemlösen und stellt einen Zusammenhang zwischen diesen Prozessen und dem Verhalten her. Der psychoanalytische Ansatz betont unbewusste Motive, die aus sexuellen und aggressiven Triebimpulsen stammen. Der konstruktivistische Ansatz konzentriert sich darauf, wie Menschen ihre sozialen Umwelten aktiv konstruieren und interpretieren, was in Abhängigkeit von ihrer Kultur, ihrer persönlichen Biographie und ihrem aktuellen Motivationszustand variiert. Eine bestimmte psychologische Fragestellung lässt sich meistens unter mehr als nur einem dieser Ansätze analysieren. 7. Der biologische Ansatz unterscheidet sich von den anderen Perspektiven darin, dass er seine Prinzipien zum Teil aus der Biologie ableitet. Oft versuchen Biologen, psychologische Prinzipien anhand biologischer Mechanismen zu erklären; dies nennt man Reduktionismus. Verhaltensphänomene können zunehmend sowohl auf psychologischer als auch auf biologischer Ebene analysiert und erklärt werden. 8. Die wichtigsten Teilgebiete der Psychologie sind die Biologische (oder Physiologische) Psychologie, die Allgemeine und Experimentelle Psychologie, die Entwicklungspsychologie, die Sozial- und Persönlichkeitspsychologie, die Klinische Psychologie, die Schulpsychologie, die Pädagogische Psychologie und die Arbeits- und Organisationspsychologie. Viele der neueren Forschungsbereiche, deren Impulse die Psychologie im 21. Jahrhundert kennzeichnen, übergreifen die traditionellen Teilgebiete. Dazu gehören die kognitive Neurowissenschaft (einschließlich der affektiven und sozialen kognitiven Neurowissenschaft), die Evolutionspsychologie, die kulturvergleichende Psychologie und die Positive Psychologie. 9. Zum Ablauf psychologischer Forschung gehört, eine Hypothese aufzustellen und diese dann unter Einsatz einer wissenschaftlichen Methode zu prüfen. Nach Möglichkeit wird dabei die Methode des Experiments bevorzugt. Damit sollen alle Variablen außer den gerade untersuchten kontrolliert oder konstant gehalten werden, wodurch sich Hypothesen über 39 Ursache und Wirkung prüfen lassen. Die unabhängige Variable ist die Variable, die der Experimentator manipuliert; die abhängige Variable, die meistens in der Messung eines Verhaltensaspekts der Versuchsteilnehmer besteht, wird untersucht, um herauszufinden, ob sie durch die Variation der unabhängigen Variable beeinflusst wird. In einem einfachen Experimentaldesign manipuliert der Experimentator eine unabhängige Variable und beobachtet ihren Effekt auf eine abhängige Variable. 10. In vielen Experimenten ist die unabhängige Variable eine Bedingung, die entweder vorliegt oder nicht. Das einfachste Experimentaldesign besteht aus einer Experimentalgruppe (einer Gruppe von Teilnehmern, in der die angenommene Ursache vorliegt) und einer Kontrollgruppe (anderen Teilnehmern, bei denen die angenommene Ursache nicht gegeben ist). Ein unabdingbares Element von experimentellen Designs ist die zufällige (randomisierte) Zuweisung der Probanden zu Experimental- und Kontrollgruppe. Wenn die Manipulation der unabhängigen Variable bei der abhängigen Variable zu einem statistisch bedeutsamen (signifikanten) Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppe führt, können wir davon ausgehen, dass die Experimentalbedingung einen reliablen Effekt hatte und der gefundene Unterschied nicht auf Zufallsfaktoren oder einige wenige Extremfälle zurückgeführt werden kann. 11. In Situationen, in denen Experimente nicht durchführbar sind, kann man die Korrelationsmethode einsetzen. Damit wird bestimmt, ob ein auf natürliche Weise auftretender Unterschied mit einem anderen interessierenden Unterschied zusammenhängt. Das Ausmaß des korrelativen Zusammenhangs zwischen zwei Variablen misst man mit dem Korrelationskoeffizienten r, einer Zahl zwischen – 1 und +1. Wenn keinerlei systematische Beziehung besteht, beträgt die Korrelation 0, ein perfekter Zusammenhang wird durch den Wert 1 angezeigt. Von 0 bis 1 steigt die Stärke des Zusammenhangs. Der Korrelationskoeffizient kann positiv oder negativ sein, je nachdem, ob die Ausprägungen der einen Variable mit den 1 40 Ausprägungen der anderen Variable ansteigen (+) oder ob höhere Ausprägungen der einen Variable mit geringeren Ausprägungen der anderen Variable einhergehen ( – ). 12. Forschungen kann man auch mit der Beobachtungsmethode durchführen, wobei das interessierende Phänomen gezielt beobachtet wird. Akkurates Beobachten und Aufzeichnen muss geübt und trainiert werden. Phänomene, die sich nur schwer oder gar nicht direkt beobachten lassen, kann man indirekt beobachten; dazu dienen Befragungen (Fragebögen und Interviews) oder die Rekonstruktion einer Fallgeschichte. 1 Das Wesen der Psychologie 13. Drei grundlegende ethische Prinzipien leiten den ethisch vertretbaren Umgang mit menschlichen Versuchspersonen oder Teilnehmern einer Untersuchung: minimales Risiko, informierte Einwilligung und das Recht auf Geheimhaltung. Schmerzhafte oder schädigende Verfahren, die an Tieren zum Einsatz kommen, müssen gerechtfertigt werden, indem sie gegen die aus der Untersuchung zu gewinnenden Erkenntnisse gewissenhaft abgewogen werden. 16 Die Be psychis handlung cher Stö rungen So zia 1 le Be 7 ein flu ssu ng eit 14 undh ng s igu e , G lt ess wä Str d Be un 15 rungen che Stö is h c sy P 2 on iti 18 ogn K le a it rsö 13 n l ich ke Pe zi So 1 sen ie We Das cholog Psy der z Inte 12 llige n 2 Biologische Grundlagen der Psychologie P 11 Emotion sych 3 e En Mo isch twi 10 on ti tiva Sp Se ra ns ch or isc ng 4 Pr oz 5 es se g e tsein un hm rne h Wa 6 Bewuss 9 D d un en ke n is 8 ch tn ed ä 7 Lern e n Kondit und ioniere n G he cklu Biologische Grundlagen der Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Neurone -- die Bausteine des Nervensystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Neurotransmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ............................ 53 ................................... 72 Evolution, Gene und Verhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 im berblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Der Aufbau des Nervensystems Das endokrine System 2 Biologische Grundlagen der Psychologie 2 Im Jahre 1848 widerfuhr Phineas Gage, einem freundlichen und besonnenen Mann, ein schrecklicher Unfall, der ihn von Grund auf verändern sollte. Gage war ein 25-jähriger Vorarbeiter für die Rutland und Burlington Eisenbahngesellschaft in Neuengland. Seine Mannschaft und er arbeiteten mit Sprengstoff, um den Weg für eine neue Eisenbahnstrecke durch eine Felswand zu bahnen. Als Gage gerade dabei war, einen Teil des Felsens zu sprengen, fiel ihm aus Versehen seine Eisenstange, die er zum Stopfen des Sprengstoffs benutzte, herunter. Das Eisen schlug mit solcher Wucht auf den Felsen, dass sich der Sprengstoff entzündete. Die folgende Explosion schleuderte die über einen Meter lange Eisenstange direkt durch Gages Kopf. Ihre Spitze bohrte sich durch seine linke Wange und wanderte hinter seinem linken Auge entlang, bis sie an der oberen Vorderseite seines Kopfes wieder aus Schädel und Gehirn austrat. Die blutverschmierte und mit Teilen seines Gehirns bedeckte Stange fand man mehrere Meter weit entfernt. Erstaunlicherweise überlebte Gage diese schreckliche Verletzung. Seine Mannschaft brachte ihn zurück zu seiner Unterkunft, wo ein ansässiger Arzt seine Kopfwunde säuberte und versorgte. Solange die ärztliche Behandlung durchgeführt wurde, war Gage bei vollem Verstand und unterhielt sich mit seinen Kameraden. Und obwohl seine Blutung sehr stark war, hörte sie zwei Tage nach dem Unfall auf, und Gages Verfassung schien sich zu stabilisieren. Sein Gehirn war allerdings sehr mitgenommen, und er verfiel in einen komaartigen Zustand. Mehr als einen Monat lang siechte er – fast stumm – vor sich hin. Doch wie durch ein Wunder begann sich seine Verfassung zu verbessern, und schließlich erholte sich Gage so gut, dass er nach Hause entlassen werden konnte. Aber Gage war „nicht länger Gage“ (Harlow, 1868). Der sonst so freundliche und zurückhal- tende Mann war nun stürmisch und impulsiv. Eine der auffälligsten Veränderungen seiner Persönlichkeit bestand darin, dass er sich jetzt sehr schnell zu groben und vulgären Flüchen hinreißen ließ. Er war unbeherrscht und hatte all seinen früheren sozialen Anstand verloren. Es verwundert daher nicht, dass er keine feste Anstellung mehr fand. Er schlug sich umherziehend mit Gelegenheitsjobs durch und versuchte, bei einem neuen Eisenbahnprojekt in Chile Arbeit zu finden. Nach acht Jahren in Südamerika, noch immer im Besitz der Eisenstange, die ihm seine frühere Persönlichkeit geraubt hatte, kehrte er nach Kalifornien zurück. Dort starb er 1860 an Epilepsie. So grauenhaft Gages Unfall auch war, eröffnete er uns sehr viele Erkenntnisse darüber, wie im Gehirn komplexe psychische Prozesse entstehen (Damasio, Grabowski, Frank, Galaburda & Damasio, 1994). Dieses Kapitel wird uns zeigen, dass so gut wie alle Aspekte des Verhaltens und der geistigen Funktionen besser verstanden werden können, wenn man über die zu Grunde liegenden biologischen Prozesse Bescheid weiß. Als Erstes werden wir uns mit der zellulären Basis des Nervensystems befassen. Neurone -- die Bausteine des Nervensystems Die grundlegende Einheit des Nervensystems ist das Neuron. Neurone sind spezialisierte Zellen, die Nervenimpulse beziehungsweise Botschaften zu anderen Neuronen, Drüsen und Muskeln übertragen. Ein Neuron ist eine spezialisierte Zelle, die Neurone bilden den Schlüs- Nervenimpulse zu ansel zum Verständnis der Ar- deren Neuronen, beitsweise des Gehirns und Drsen und Muskeln damit auch der Grundlagen bertrgt. 44 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Dendriten Synaptische Endknöpfchen Abb. 2.1 Schemazeichnung eines Neurons. Die Pfeile zeigen die Richtung der Nervenimpulse. Manche Axone sind verzweigt; die Verzweigungen nennt man Kollaterale. Die Axone vieler Neurone sind von einer isolierenden Myelinscheide umgeben. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Nervenimpulse erhht. (Nach Gaudin & Jones, 1989.) Zellkörper unseres Bewusstseins. Wir kennen die Rolle der Neurone bei der Übertragung von Nervenimpulsen. Wir wissen auch um die Arbeitsweise einiger neuronaler Schaltkreise. Aber wir stehen erst am Anfang, ihre komplexen Funktionen bei Gedächtnisleistungen, im emotionalen Geschehen und bei Denkvorgängen zu begreifen. Die zahlreichen Typen von Neuronen im Nervensystem unterscheiden sich stark in Größe und Erscheinungsbild, aber sie besitzen alle bestimmte gemeinsame Merkmale (siehe Abbildung 2.1). Vom Zellkörper oder Ein Dendrit empfngt Soma gehen mehrere verneuronale Impulse von zweigte Fortsätze aus, die benachbarten NeuroDendriten (abgeleitet vom nen. griechischen Wort „dendron“ für „Baum“), welche Ein Axon ist eine Nervenimpulse von benachschlanke, vom Zellkrbarten Neuronen empfanper ausgehende Rhre; gen. Das Axon stellt eine es leitet neuronale schlanke Röhre dar, die sich Impulse an andere vom Zellkörper ausgehend Neurone, Muskeln oder Drsen weiter. ausdehnt und diese Impulse an andere Neurone (oder Muskeln oder Drüsen) weiterleitet. An seinem Ende verzweigt sich das Axon wie ein Baum in winzige Ästchen, die in kleinen Verdickungen, den synaptischen Endknöpfchen, enden. Diese Endknöpfchen berühren den Zellkörper oder die Dendriten des Empfangsneurons nicht direkt. Vielmehr besteht an dieser Schaltstelle, Zellkern Myelinscheide Ranvier-Schnürringe Axon (umgeben von der Myelinscheide) Richtung des Aktionspotenzials der Synapse, ein kleiner Spalt, Eine Synapse ist die der dementsprechend synap- Schaltstelle zwischen tischer Spalt genannt wird. den Endknpfchen Gelangt ein Nervenimpuls eines Senderneurons über ein Axon zu einer Syn- und dem Zellkrper apse, löst er dort die Aus- oder den Dendriten schüttung eines Neurotrans- eines Empfangsneurons. mitters aus, eines chemischen Stoffes, der durch den synaptischen Spalt diffundiert und Neurotransmitter sind das empfangende Neuron chemische Substanzen, die durch den synaptistimuliert. Dadurch wird schen Spalt diffundieder Impuls von einem Neu- ren und das empfanron auf das andere übertra- gende Neuron stimuliegen. An den Dendriten und ren. am Zellkörper jedes Neurons bilden die Axone vieler anderer Neurone Synapsen (siehe Abbildung 2.2). Alle Neurone gleichen sich zwar in diesen allgemeinen Eigenschaften, unterscheiden sich aber sehr stark nach Größe und Form (siehe Abbildung 2.3). Das Axon eines Rückenmarkneurons kann bis zu einem Meter lang sein und vom Wirbelausgang bis zu den Muskeln des großen Zehs reichen. Das Axon eines Neurons im Gehirn kann dagegen nur den Bruchteil eines Millimeters lang sein. Neurone werden in Abhängigkeit von ihren allgemeinen Funktionen in drei Gruppen eingeteilt. Sensorische Neurone übertragen Impulse von den Rezeptoren der Sinnesorgane zum Zentralnervensystem. Rezeptoren sind spezialisierte Zel- 45 Neurone -- die Bausteine des Nervensystems Dendriten 2 Zellkörper Synaptische Endknöpfchen Synaptische Endknöpfchen Axon Kollaterale Abb. 2.2 Synapsen am Zellkrper eines Neurons. Viele verschiedene Axone, die sich mehrfach verzweigen, haben synaptische Kontaktstellen auf den Dendriten und Zellkrpern eines Neurons. Jede Endverzweigung eines Axons mndet in eine Verdickung, das prsynaptische Endknpfchen, welches die Neurotransmitter enthlt. Durch Ausschttung von Neurotransmittern werden die Nervenimpulse ber die Synapse zu den Dendriten oder dem Zellkrper der Empfangszelle bertragen. len in den Sinnesorganen, den Muskeln, der Haut und den Gelenken, die auf physikalische oder chemische Änderungen ansprechen und diese Reize in neuronale Impulse umwandeln, die dann von den sensorischen Neuronen weitergeleitet werden. Motoneurone (motorische Neurone) übertragen die vom Gehirn oder Rückenmark ausgehenden Signale zu den Muskeln und Drüsen. Interneurone erhalten Signale von den sensorischen Neuronen und senden Impulse an andere Interneurone oder Motoneurone. Interneurone gibt Ein Nerv ist ein Bndel von lang erstreckten es nur im Gehirn, in den AuAxonen, die zu Hundergen und im Rückenmark. ten oder Tausenden von Ein Nerv ist ein Bündel Neuronen gehren. von lang erstreckten Axonen, die zu Hunderten oder Tausenden von Neuronen gehören. Ein einzelner Nerv kann aus Axonen von sensorischen und motorischen Neuronen bestehen. Im Allgemeinen bilden die Zellkörper der Neurone im Nervensystem Gruppen. Im Gehirn und im Rückenmark werden solche Gruppen von Neuronen als Nuclei (Singular: Nucleus) Nuclei sind Gruppen bezeichnet, außerhalb des neuronaler Zellkrper im Gehirn und RckenGehirns und des Rücken- mark; auerhalb von marks heißen sie Ganglien Gehirn und Rckenmark (Singular: Ganglion). heien solche Gruppen Außer Neuronen besitzt Ganglien. das Nervensystem noch eine große Anzahl von Stützzellen, die keine Nervenzel- 46 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Neuron in der Retina des Auges Neuron im Cortex Dendrit Dendrit Zellkörper Axon Zellkörper Neuron im olfaktorischen Cortex Axon zahlenmäßig im Verhältnis 9:1 und bilden mehr als die Hälfte des Gehirnvolumens. Die Bezeichnung „glia“ ist von dem griechischen Wort für „Leim“ abgeleitet und verweist auf eine ihrer Funktionen – nämlich die Neurone an ihrem Platz zu halten. Zusätzlich versorgen Gliazellen die Neurone mit Nährstoffen, sammeln Abfallprodukte im Gehirn und beseitigen abgestorbene Neurone sowie fremde Substanzen. Dadurch halten sie die Signalleitfähigkeit der Neurone aufrecht (Haydon, 2001). Auf diese Weise unterstützen Gliazellen die Neurone so wie der Trainer einer Sportmannschaft, der während eines Spiels dafür sorgt, dass seine Spieler stets genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Aktionspotenziale Dendrit Zellkörper Neuron im Rückenmark Dendrit Zellkörper Axon Axon Abb. 2.3 Formen und relative Gre von Neuronen. Das Axon eines Neurons im Rckenmark, das in der Abbildung nicht vollstndig gezeigt wird, kann ber einen Meter lang sein. Gliazellen sind nichtneuronale Sttzzellen, die sehr zahlreich im Nervensystem vorkommen. len sind: die Gliazellen. Sie befinden sich zwischen den Neuronen und umschließen diese oft. Die Gliazellen überwiegen die Neurone Information breitet sich entlang eines Neurons in Form eines Aktionspotenzials aus – eines elektrochemischen Impulses, der vom Zellkörper bis zum Ein Aktionspotenzial ist ein elektrochemiEnde des Axons verläuft. Jescher Impuls, der von des Aktionspotenzial resul- den Dendriten bis zum tiert aus Bewegungen elekt- Ende des Axons verrisch geladener Moleküle, luft. der Ionen, in ein Neuron hinein oder aus ihm heraus. Um zu verstehen, wie ein solches Aktionspotenzial entsteht, muss man sich Folgendes klarmachen: Neurone sind normalerweise äußerst wählerisch, wenn es darum geht, welche Ionen in die Zelle hineinoder aus ihr herausströmen können. Die Zellmembran eines Neurons ist halb durchlässig (semipermeabel), so dass einige Ionen sie leicht durchwandern können, während sie für andere unpassierbar ist. Eine besondere Situation ergibt sich, wenn spezielle Durchgangsstellen in der Membran geöffnet sind. Diese Durchgangsstellen, porenförmige Proteinmoleküle, Ionenkanle sind werden Ionenkanäle genannt porenfrmige Proteinund verteilen sich über die molekle, die als Durchgangsstellen dieZellmembran (siehe Abbil- nen und sich ber die dung 2.4). Diese Protein- gesamte Zellmembran strukturen regulieren das verteilen. Ein- und Ausströmen von Ionen wie Natrium (Naþ), Kalium (Kþ), Kalzium (Caþþ) und Chlor (Cl). Jeder Ionenkanal ist 47 Neurone -- die Bausteine des Nervensystems selektiv, das heißt, er erlaubt im geöffneten Zustand nur den Durchfluss einer Ionenart. Wenn ein Neuron gerade kein Aktionspotenzial erzeugt, wird es als Neuron im Ruhezustand bezeichnet. Während dieses Ruhezustandes ist die Zellmembran für Naþ-Ionen undurchlässig, die man daher in hoher Konzentration außerhalb des Neurons findet. Im Gegensatz dazu ist die Membran für Kþ-Ionen durchlässig, welche sich vermehrt innerhalb des Neurons konzentrieren. Spezielle Proteinstrukturen, sogenannte Ionenpumpen, sind bei Neuronen im Ruhezustand maßgeblich daran beteiligt, diese ungleiche Verteilung der Ionen auf beiden Seiten der Zellmembran aufrechtzuerhalten, indem sie das Ein- und Ausströmen der Ionen regulieren. Wenn beispielsweise Naþ in das Neuron eingeströmt ist, dann transportieren es die Ionenpumpen wieder hinaus. Umgekehrt werden Kþ-Ionen wieder in das Neuron transportiert, wenn sie zuvor ausgeströmt waren. Auf diese Weise wird bei einem Neuron im Ruhezustand eine hohe Konzentration von Naþ außerhalb der Zelle und eine niedrige Konzentration innerhalb der Zelle aufrechterhalten. Insgesamt bewirken Ionenkanäle und Ionenpumpen eine elektrische Polarisierung der Zellmembran des Neurons im Ruhezustand. Infolgedessen ist ein Neuron innen negativer geladen als außen. Die elektrische Ladung eines Ionen Offener Ionenkanal Neurons im Ruhezustand wird als Ruhepotenzial bezeichnet und reicht von – 50 bis – 100 Millivolt. Dabei ähnelt das Ruhepotenzial eines Neurons vom Unter einem RuhePrinzip her der Ladung einer potenzial versteht man die elektrische Ladung Batterie: In beiden Fällen eines Neurons im Ruwird ein elektrochemisches hezustand. Gefälle zur Energiespeicherung verwendet. Die Energie der Batterie wird eingesetzt, um elektrische Geräte wie etwa tragbare Radios zu betreiben, während die Energie eines Neurons zur Erzeugung von Aktionspotenzialen dient. Bei Stimulation des Neurons durch einen erregenden Reiz verringert sich die Spannung, das heißt die Ladungsdifferenz zwischen den beiden Seiten der Zellmembran. Dieser Prozess heißt Depolarisation und wird durch Neurotransmitteraktivität an den Rezeptoren der Dendriten verursacht. Auf dem Axon befinden sich spannungssensitive Na+-Ionenkanäle. Wenn das Ausmaß der Depolarisation groß genug ist, öffnen sich diese Kanäle kurz, und Na+-Ionen strömen in die Zelle. Da sich gegensätzliche Ladungen elektrisch anziehen, kann das positiv geladene Natrium in das negativ geladene Zellinnere gelangen. Danach ist an dieser Stelle des Axons die Ladung an der Innenseite relativ zur Außenseite positiv. Benachbarte Natriumkanäle reagie- Pore eines Ionenkanals Lipidmoleküle in der Membran Außenseite der Zelle Innenseite der Zelle Geschlossener Ionenkanal Abb. 2.4 Ionenkanle. Chemische Stoffe wie Natrium, Kalium, Kalzium und Chlor durchwandern die Zellmembran ber porenfrmige Proteinmolekle, die sogenannten Ionenkanle. 2 48 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Aktionspotenziale können sich auf dem Axon – abhängig von seinem Durchmesser – mit einer Geschwindigkeit von ungefähr drei bis zu 400 Kilometer pro Stunde fortbewegen; dabei leiten dickere Axone im Allgemeinen schneller. Die Geschwindigkeit hängt aber auch davon ab, ob das Axon mit einer Myelinscheide umhüllt ist. Eine solche Scheide besteht aus speziellen Gliazellen, die sich um das Axon wickeln und dabei kleine Lücken zwischen sich lassen (siehe noch einmal Abbildung 2.1). Diese Teilungen werden Ranvier-Schnürringe genannt. Diese Isolierung durch die Myelinscheide ermöglicht die saltatorische Erregungsleitung, bei Als saltatorische welcher der Impuls von Erregungsleitung beeinem Ranvier-Schnürring zeichnet man das zum nächsten springt (be- Springen eines Nervennannt nach dem lateinischen impulses von einem Wort „saltare“ für „sprin- Ranvier-Schnrring zum gen“). Dadurch wird die nchsten. ren auf diesen Spannungsabfall und öffnen sich, wodurch der angrenzende Bereich auf dem Axon depolarisiert wird. Dieser Prozess der Depolarisation, der sich über die gesamte Länge des Axons hinweg wiederholt, ist ein Aktionspotenzial. Während das Aktionspotenzial das Axon entlangwandert, schließen sich die Natriumkanäle unmittelbar dahinter, und die zahlreich vorhandenen Ionenpumpen werden aktiviert, um das Ruhepotenzial an der Zellmembran möglichst schnell wiederherzustellen (siehe Abbildung 2.5). Die Bedeutung der Natriumkanäle zeigt sich an der Wirkung örtlicher Betäubungsmittel wie Procain, die standardmäßig zum Einsatz kommen, um während zahnärztlicher Eingriffe die Mundregion zu betäuben. Solche Wirkstoffe verhindern die Öffnung der Natriumkanäle, stoppen somit das Aktionspotenzial und unterbrechen die Weiterleitung eines sensorischen Signals an das Gehirn (Catterall, 2000). – – Natriumionen + + + Reiz n embra Axonm – – – – s- g Ladun fluss + + + (a) Natriumionen – + – + – + + + Reiz embra Axonm – – – – Kaliumionen + + + n gs- Ladun fluss (b) Abb. 2.5 Aktionspotenziale. (Nach Starr & Taggart, 1989.) (a) Mit der Auslsung eines Aktionspotenzials ffnen sich die Natriumkanle. Infolgedessen wandern Natriumionen in das Axon. Dabei transportieren sie positive Ladungen. (b) Nachdem ein Aktionspotenzial an einer bestimmten Stelle auf dem Axon entstanden ist, schlieen sich die Natriumkanle an dieser Stelle und ffnen sich am nchsten Punkt. Sobald sich die Natriumkanle schlieen, ffnen sich die Kaliumkanle, und Kaliumionen strmen aus dem Axon heraus. Auch sie transportieren positive Ladungen. 49 Neurone -- die Bausteine des Nervensystems Sendeneuron 2 Empfangsneuron Axon Sendeneuron Neuronaler Impuls Endknöpfchen Synaptische Vesikel Synaptischer Spalt Bindungsstelle Postsynaptische Membran Molekül eines Neurotransmitters Geschwindigkeit der Erregungsleitung entlang des Axons deutlich erhöht. Myelinscheiden sind besonders dort zu finden, wo es auf eine schnelle Weiterleitung des Aktionspotenzials ankommt, beispielsweise entlang der Axone, welche die Muskulatur aktivieren. Bei der Multiplen Sklerose, deren erste Symptome typischerweise im Alter zwischen 16 und 30 Jahren auftreten, greift das Immunsystem das körpereigene Myelin an und zerstört es, was die Reizleitung stört und schwere sensorische und motorische Funktionsstörungen hervorruft. Synaptische bertragung Der synaptische Spalt zwischen Neuronen ist besonders wichtig, da die Neurone an dieser Stelle Signale übertragen. Ein einzelnes Neuron feuert ein Aktionspotenzial, sobald die Erregung, die es über mehrere seiner Synapsen erhält, eine gewisse Schwelle überschreitet. Das Neuron feuert dabei in einem einzigen, kurzen Impuls und Abb. 2.6 Ausschttung von Neurotransmittern in einen synaptischen Spalt. Die Neurotransmitter werden von synaptischen Vesikeln zu der prsynaptischen Membran transportiert. Die Vesikel verschmelzen mit der Membran und entleeren sich in den synaptischen Spalt. Die Neurotransmitter diffundieren durch den Spalt und binden sich an die Rezeptormolekle der postsynaptischen Membran. (Nach Sternberg, 1995.) bleibt dann für ein paar Tausendstel Sekunden inaktiv. Aktionspotenziale sind immer gleich stark und können nur von Reizen ausgelöst werden, welche die Erregungsschwelle überschreiten. Als Reaktion auf jegliche synaptische Eingangssignale kann ein Neuron also lediglich entweder ein Aktionspotenzial feuern oder nicht, und wenn, dann stets mit der gleichen Stärke. Dies nennt man das Alles-oder-nichts-Prinzip der neuronalen Aktivität. Neuronale Aktionspotenziale kann man sich als binäre Signale vorstellen mit den beiden Ausprägungen 0 und 1, wie sie auch in Computern zur Steuerung von Softwarebefehlen zum Einsatz kommen: Neurone feuern entweder Aktionspotenziale (1) oder sie tun es nicht (0). Einmal ausgelöst, wandert das Aktionspotenzial am Axon entlang zu dessen zahlreichen präsynaptischen Endknöpfchen. Wie schon erwähnt, gibt es an einer Synapse keine direkte Berührung zwischen den Neuronen: Jedes Signal muss den synaptischen Spalt überwinden (siehe Abbildung 2.6). Gelangt ein Aktionspotenzial über das Axon zu einem synaptischen Endknöpfchen, aktiviert es die dort vor- 50 handenen synaptischen Vesikel – kleine Bläschen, die Neurotransmitter enthalten. Bei einer Stimulation schütten sie Neurotransmitter in den synaptischen Spalt aus. Die Neurotransmitter diffundieren vom präsynaptischen oder sendenden Neuron durch den synaptischen Spalt und binden an Rezeptoren; das sind Rezeptoren sind ProProteine in der dendritischen teine, welche in der Membran des Empfangs- beMembran des postsynziehungsweise postsynaptiaptischen Neurons lieschen Neurons. Dabei passen gen. Neurotransmitter und Rezeptoren zusammen wie Schlüssel und Schloss. Die Bindung der Neurotransmitter an Rezeptoren ändert unmittelbar die Durchlässigkeit der Ionenkanäle im postsynaptischen Neuron. Einige Neurotransmitter wirken erregend (exzitatorisch): Positiv geladene Ionen wie Naþ können in das postsynaptische Neuron strömen und es somit depolarisieren – das Innere der Zelle wird im Vergleich zum Äußeren positiver. Andere Neurotransmitter haben einen hemmenden (inhibierenden) Effekt. Sie negativieren das Innere eines Neurons im Vergleich zum Äußeren (mit anderen Worten, sie hyperpolarisieren die Zellmembran) – entweder durch Ausströmen positiv geladener Ionen wie Kþ oder durch Einströmen negativ geladener Ionen wie Cl. Kurz gesagt: Erregung erhöht, Hemmung senkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Empfangsneuron feuern wird. Jedes einzelne Neuron kann Neurotransmitter aus Tausenden von Synapsen mit anderen Neuronen aufnehmen, darunter sowohl erregende als auch hemmende Neurotransmitter. Je nach der Impulsfrequenz, mit der die verschiedenen Axone feuern, setzen sie ihre Neurotransmitter zu unterschiedlichen Zeitpunkten frei. Wenn an einer bestimmten Stelle der Zellmembran des Empfangsneurons zu einem bestimmten Zeitpunkt die erregende Wirkung größer als die hemmende wird, kommt es zur Depolarisation und damit zu einem Aktionspotenzial nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Nachdem ein Neurotransmitter ausgeschüttet und durch den synaptischen Spalt diffundiert ist, muss er seine Wirkung in Bei der Wiederaufnahsehr kurzer Zeit entfalten, me resorbieren die um eine genaue Steuerung prsynaptischen zu ermöglichen. Bei einigen Endknpfchen den Neurotransmittern wird die berschssigen NeuroSynapse durch Wiederauftransmitter. 2 Biologische Grundlagen der Psychologie nahme sofort wieder gereinigt, indem der überschüssige Neurotransmitter von den präsynaptischen Endknöpfchen, die ihn ausgeschüttet hatten, resorbiert wird. Die Wiederaufnahme unterbricht die Wirkung des Neurotransmitters und erspart den präsynaptischen Endknöpfchen, weitere Beim Prozess des AbTransmittersubstanz synthe- baus reagieren Enzyme tisieren zu müssen. Bei ande- mit dem Neurotransmitter im synaptischen ren Neurotransmittern wird Spalt, wodurch dieser die Wirkung durch Abbau chemisch gespalten und unterbrochen: Im entspre- deaktiviert wird. chenden synaptischen Spalt reagieren Enzyme mit dem Neurotransmitter, um ihn chemisch zu spalten und ihn so zu deaktivieren. zusammengefasst Die grundlegende Einheit des Nervensystems ist das Neuron. Neurone erhalten chemische Signale an Verzweigungen, die man Dendriten nennt, und bertragen elektrochemische Potenziale entlang eines rhrenfrmigen Fortsatzes, des Axons. Chemische Neurotransmitter werden an den Synapsen ausgeschttet und bermitteln Informationen zwischen zwei Neuronen. Neurotransmitter entfalten ihre Wirkung, indem sie an Rezeptorproteine anbinden. Bei ausreichend hoher Depolarisation eines Neurons erzeugt dieses ein Aktionspotenzial nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Dieses Aktionspotenzial wandert das Axon hinab und bewirkt an den synaptischen Endknpfchen, dass Neurotransmitter freigesetzt werden. nachgefragt 1. Nur etwa ein Zehntel der Zellen in unserem Gehirn sind Neurone. Der Rest sind Gliazellen. Bedeutet dies, dass wir beim Denken nur zehn Prozent unseres Gehirns benutzen? Oder wie knnte man diesen Sachverhalt interpretieren? 2. Lokalansthetika, wie Zahnrzte sie verwenden, wirken durch die Blockierung von Na+-Kanlen in den Neuronen, die nahe am Injektionsort liegen. Im Allgemeinen injizieren ˜rzte ein Betubungsmittel natrlich dort, wo der Schmerz sitzt. Was wrde die Injektion eines solchen Mittels in das Gehirn bewirken? Wird es auch dort ausschlielich die Schmerz- und Berhrungsempfindungen blockieren, oder htte es eine andere Wirkung? Neurotransmitter Neurotransmitter Bisher wurden mehr als 70 Neurotransmitter identifiziert. Weitere werden sicherlich hinzukommen. Einige Neurotransmitter können an mehr als nur einen Rezeptortypen binden, wodurch sie in der Lage sind, bei verschiedenen Typen von Rezeptoren ganz unterschiedliche Wirkungen hervorzurufen. Der Neurotransmitter Glutamat beispielsweise kann mindestens zehn Arten von Rezeptormolekülen aktivieren. Neurone können dadurch sehr unterschiedlich auf diesen Neurotransmitter reagieren (Madden, 2002). Bestimmte Neurotransmitter wirken an manchen Bindungsstellen exzitatorisch und an anderen inhibitorisch, weil dabei zwei unterschiedliche Typen von Rezeptormolekülen beteiligt sind. Natürlich können in diesem Kapitel nicht alle bisher gefundenen Neurotransmitter besprochen werden. Vielmehr konzentrieren wir uns auf einige wenige, die für das Verhalten des Menschen besonders bedeutsam sind. Acetylcholin. Acetylcholin kommt im Nervensystem an vielen Synapsen vor. Im Allgemeinen wirkt es erregend, aber es kann in Abhängigkeit vom Typ des Rezeptormoleküls in der Membran des postsynaptischen Neurons auch hemmend wirken. Besonders verbreitet ist Acetylcholin in einer Region des Vorderhirns, dem Hippocampus, der bei der Bildung neuer Gedächtnisinhalte eine wichtige Rolle spielt (Eichenbaum, 2000). Acetylcholin spielt auch bei der Alzheimer-Erkrankung eine wichtige Rolle, einer verheerenden Störung des Gedächtnisses und anderer kognitiver Funktionen, die vorrangig alte Menschen befällt. Neurone im Vorderhirn, die Acetylcholin produzieren, degenerieren bei Alzheimer-Patienten, was eine verringerte Acetylcholinproduktion zur Folge hat. Je weniger Acetylcholin erzeugt wird, desto schwerer ist der Gedächtnisverlust. Acetylcholin wird auch an jeder Synapse ausgeschüttet, an der ein Neuron an einer Skelettmuskelfaser endet. Das Acetylcholin gelangt auf kleine Strukturen der Muskelzellen, die (motorischen) Endplatten. Die Endplatten sind mit Rezeptormolekülen bedeckt, die bei Aktivierung durch Acetylcholin eine molekulare Verbindung innerhalb der Muskelzellen herstellen, wodurch 51 diese kontrahieren. Einige chemische Stoffe, die auf Acetylcholin wirken, können Muskellähmungen erzeugen. Beispielsweise liegt dem Botulismus – einer Lebensmittelvergiftung, die durch Bakterien in schlecht abgefüllten Nahrungsmittelkonserven hervorgerufen wird – die Blockierung der Acetylcholin-Ausschüttung an den Nerv-Muskel-Synapsen durch Botiliumtoxin zu Grunde. Wird dabei die Atemmuskulatur gelähmt, kann Botulismus zum Tode führen. Einige Nervengase, die für militärische Zwecke entwickelt wurden, sowie viele Pestizide zerstören die Enzyme, die das Acetylcholin nach dem Feuern des Neurons abbauen. Ohne diesen Abbauprozess erfolgt eine unkontrollierte Synthese von Acetylcholin im Nervensystem, wodurch eine normale synaptische Erregungsübertragung nicht mehr möglich ist. Noradrenalin. Noradrenalin (auch: Norepinephrin) ist ein Neurotransmitter aus der Klasse der Monoamine und wird hauptsächlich durch Neurone im Hirnstamm produziert. Kokain und Amphetamin verlängern die Wirkung des Transmitters durch eine Verlangsamung des Wiederaufnahmeprozesses. Dadurch bleiben die Empfangsneurone länger aktiviert, was letztlich die psychostimulierenden Effekte solcher Drogen hervorruft. Im Gegensatz dazu beschleunigt Lithium die Wiederaufnahme von Noradrenalin, wodurch sich eine depressive Stimmung einstellt. Jede von außen herbeigeführte Zu- oder Abnahme von Noradrenalin geht mit einer entsprechenden Veränderung in der Stimmungslage der betreffenden Person einher. Dopamin. Dopamin, ebenfalls ein Monoamin, ist dem Noradrenalin chemisch sehr ähnlich. Die Ausschüttung von Dopamin in einzelnen Teilen des Gehirns erzeugt positive Hochgefühle. Die gegenwärtige Forschung untersucht die Rolle des Dopamins bei der Entstehung von Sucht. Zu viel Dopamin in einigen Regionen des Gehirns kann zu Schizophrenie führen, und zu wenig in anderen Regionen führt zur Parkinson-Krankheit. Wirkstoffe zur Behandlung von Schizophrenie wie etwa Chlorpromazin oder Clozapin blockieren die Dopamin-Rezeptoren. L-DOPA dagegen, eine Substanz, die häufig zur Behandlung der Parkinson-Erkrankung verabreicht wird, erhöht den Dopaminspiegel im Gehirn. 2 52 Serotonin. Serotonin ist ein weiteres Monoamin. Es spielt wie Noradrenalin eine große Rolle bei der Regulation unserer Stimmung. Niedrige Niveaus von Serotonin werden beispielsweise mit depressiven Zuständen in Verbindung gebracht. Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer sind Antidepressiva, die den Serotoninspiegel im Gehirn erhöhen, indem sie die Wiederaufnahme des Neurotransmitters blockieren. Das Präparat Fluctin mit dem Wirkstoff Fluoxetin, der in den USA unter dem Handelsnamen Prozac weit verbreitet ist, stellt einen solchen Serotonin-WiederaufnahmeHemmer dar und wird häufig zur Behandlung von Depression eingesetzt. Da Serotonin ebenso für die Regulation von Schlaf und Appetit wichtig ist, wird damit auch die Essstörung Bulimie behandelt. Interessanterweise entfaltet die halluzinogene Droge Lysergsäurediethylamid (LSD) ihre Wirkung, indem sie an Serotoninrezeptoren im Gehirn bindet. Glutamat. Der erregende Neurotransmitter Glutamat, eine Aminosäure, ist in mehr Neuronen des zentralen Nervensystems vertreten als alle anderen Neurotransmitter. Glutamat wirkt exzitatorisch, da es bei Neuronen, an denen es ausgeschüttet wird, eine Depolarisation hervorruft. Es existieren mindestens drei Subtypen von Glutamat-Rezeptoren, von denen man annimmt, dass sie Lernen und Gedächtnis beeinflussen. Dies gilt insbesondere für den sogenannten NMDA-Rezeptor, der nach der chemischen Substanz (N-Methyl-D-Aspartat) benannt wurde, mit deren Hilfe man diesen Rezeptortyp nachweisen kann. Neurone im Hippocampus, einer Region in der Nähe des Gehirnzentrums, sind besonders reich an NMDA-Rezeptoren, und diese Region scheint maßgeblich an der Bildung neuer Gedächtnisinhalte beteiligt zu sein (Eichenbaum, 2000; siehe Kapitel 7). Störungen in der glutamatvermittelten neuronalen Erregungsübertragung wurden mit Schizophrenie in Verbindung gebracht. GABA. Ein anderer wichtiger, hemmend wirkender Aminosäure-Neurotransmitter ist die Gamma-Amino-Buttersäure, abgekürzt GABA (von gamma-aminobutyric acid). Die meisten Synapsen im Gehirn benutzen GABA. Der Wirkstoff Picrotoxin, welcher GABA-Rezeptoren blockiert, erzeugt Krämpfe, weil Muskelbewe- 2 Biologische Grundlagen der Psychologie gungen ohne den hemmenden Einfluss von GABA nicht kontrolliert werden können. Die beruhigende Wirkung bestimmter angstlösender Arzneimittel, der sogenannten Benzodiazepine, beruht auf der hemmenden Wirkung von GABA (siehe Kapitel 15). Die Funktionen dieser Neurotransmitter sind in der Tabelle „Konzepte im Überblick“ zusammengefasst. Konzepte im berblick Neurotransmitter und ihre Funktionen. Neurotransmitter Funktion Acetylcholin Acetylcholin ist beteiligt an Gedchtnis und Aufmerksamkeit; Abnahme steht in Zusammenhang mit der Alzheimer-Erkrankung. Es bertrgt auch Signale zwischen Nerv und Muskel. Noradrenalin (Norepinephrin) Noradrenalin wird durch Psychostimulanzien erhht. Niedrige Konzentrationen tragen zu Depression bei. Dopamin Dopamin vermittelt die Wirkungen von natrlicher Belohnung (beispielsweise Essen und Sex) und von Substanzmissbrauch. Serotonin Serotonin spielt eine wichtige Rolle bei der Stimmung und dem Sozialverhalten. Medikamente zur Linderung von Depression und Angst erhhen die Serotoninkonzentration in den Synapsen. Glutamat Glutamat ist der Hauptvertreter der erregenden Neurotransmitter im Gehirn und ist an Lern- und Gedchtnisvorgngen beteiligt. GABA GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im Gehirn. Arzneimittel zur Angstlinderung erhhen die GABA-Aktivitt. zusammengefasst Zu den wichtigsten Neurotransmittern gehren Acetylcholin, Noradrenalin (oder Norepinephrin), Dopamin, Serotonin, Gamma-Amino-Buttersure (GABA) und Glutamat. 53 Der Aufbau des Nervensystems Neurotransmitter ben entweder exzitatorische (erregende) oder inhibitorische (hemmende) Wirkungen auf Neurone aus. Welche Wirkung eintritt, hngt dabei vom Typ des postsynaptischen Rezeptors ab, an den die Neurotransmitter binden. nachgefragt 1. Es gibt verschiedene Neurotransmittersysteme im menschlichen Gehirn. Was knnte wohl der Grund fr eine solche neurochemische Vielfalt sein? 2. Welche Vorteile bietet die chemisch gesteuerte Signalbertragung im Gehirn? Welche Nachteile gibt es? Der Aufbau des Nervensystems Die Einteilung des Nervensystems Alle Teile des Nervensystems sind miteinander verknüpft, aber typischerweise geht man von einer Aufteilung in zwei Hauptbereiche aus (siehe Abbildung 2.7). Das Zentralnervensystem besteht aus allen Neuronen im GeDas Zentralnervenhirn und im Rückenmark. system umfasst alle Das periphere Nervensystem Neurone im Gehirn und wird durch die Nerven geRckenmark; das peribildet, die das Gehirn und phere Nervensystem besteht aus den Nerven, das Rückenmark mit den die Gehirn und Rckenanderen Teilen des Körpers mark mit anderen Teilen verbinden. Das periphere des Krpers verbinden. Nervensystem wiederum Zentralnervensystem Nervensystem Peripheres Nervensystem wird in das somatische System Die Verbindungen zu und das autonome System den Sinnesrezeptoren, eingeteilt. Das somatische den Muskeln und der System überträgt Botschaften Krperoberflche bilden von und zu den Sinnesrezep- das somatische Systoren, den Muskeln und der tem; das autonome Körperoberfläche. Das auto- System stellt die Verbindungen zu den innenome System stellt die Ver- ren Organen und den bindung zu den inneren Or- Drsen her. ganen und den Drüsen her. Die sensorischen Nerven des somatischen Systems leiten Informationen über äußere Reizungen der Haut, der Muskeln oder der Gelenke zum Zentralnervensystem. Durch sie fühlen wir Schmerz, Druck und Temperaturänderungen. Die motorischen Nerven des somatischen Systems leiten Impulse vom Zentralnervensystem zu den Muskeln, wo sie Aktivität auslösen. Sie sind für alle Muskeln zuständig, die wir bei willkürlichen Bewegungen oder bei der unwillkürlichen Steuerung des Körpergleichgewichts und der Körperhaltung benutzen. Die Nerven des autonomen Systems, die von und zu den inneren Organen verlaufen, regulieren Prozesse wie Atmung, Herzschlag und Verdauung. Das autonome System sowie seine zentrale Funktion bei Emotionen werden in diesem Kapitel an späterer Stelle behandelt. Die meisten Nervenfasern, welche die verschiedenen Teile des Körpers mit dem Gehirn verbinden, laufen im Rückenmark zusammen, wo die knöcherne Wirbelsäule sie schützt. Das Rückenmark ist ziemlich kompakt; es hat etwa den Durchmesser des kleinen Fingers. Einige der einfachsten Reiz-Reaktions-Reflexe werden über das Rückenmark realisiert. Ein Beispiel ist der Kniesehnenreflex. Wird die Kniesehne durch Druck gereizt, streckt sich der zugehörige Muskel, und die in diesen Muskel eingebetteten sensori- Gehirn Rückenmark Somatisches System Autonomes System Abb. 2.7 Der Aufbau des Nervensystems. 2 54 2 Biologische Grundlagen der Psychologie schen Zellen senden ein Signal über sensorische Neurone zum Rückenmark. Dort sind die sensorischen Neurone synaptisch mit motorischen Neuronen verbunden. Diese leiten Impulse zum selben Muskel zurück, wodurch der Muskel kontrahiert und das Bein gestreckt wird. Obwohl diese Reaktion ohne jegliche Signale des Gehirns allein über das Rückenmark erfolgt, kann sie durch Signale von höheren Nervenzentren beeinflusst werden. So wird beispielsweise die Streckbewegung verstärkt, wenn man seine Hände vor dem Schlag auf das Knie verschränkt und kräftig auseinanderzieht. Und wenn man sich direkt, bevor der Arzt auf die Sehne klopft, vorstellt, das eigene Knie sei bewegungsunfähig, kann man den Reflex unterdrücken. Der Aufbau des Gehirns Man kann das Gehirn nach unterschiedlichen Kriterien einteilen. Der Ansatz in Abbildung 2.8a unterscheidet drei Gehirnbereiche anhand ihrer räumlichen Lage: (1) Das Rautenhirn umfasst alle Strukturen im hinteren (posterioren) Teil des Gehirns, ganz in Das Rautenhirn umder Nähe des Rückenmarks. fasst alle Strukturen im (2) Das Mittelhirn, direkt hinteren Teil des Gevor dem Rautenhirn gelegen, hirns, das Vorderhirn befindet sich nahe der Mitte alle Strukturen im vordes Gehirns. (3) Das Vorderderen Teil des Gehirns. Dazwischen liegt das hirn schließt alle Strukturen Mittelhirn. ein, die sich im vorderen (anterioren) Teil des Gehirns Der zentrale Kern oder befinden. Der kanadische Forscher Paul MacLean Hirnstamm steuert unwillkrliches Verhalten schlug eine andere Sichtweise wie Husten und Niesen vor, in der die Gehirnstruksowie primitive willkrturen nicht nach ihrem Ort, liche Verhaltensweisen sondern nach ihrer Funktion wie Atmen, Schlafen unterteilt werden (MacLean, oder Trinken. 1973). MacLean nahm drei konzentrisch angeordnete Das limbische System Schichten für das Gehirn dient zur Steuerung unan: (1) Der zentrale Kern reserer Emotionen. guliert unser unwillkürliches Verhalten. (2) Das limbische Das Grohirn ist System steuert unsere Emozustndig fr unsere tionen. (3) Das Großhirn ist intellektuellen Profür unsere intellektuellen zesse. Prozesse zuständig. Abbil- dung 2.8b zeigt, wie diese Schichten angeordnet sind. Bei der Diskussion von Gehirnstrukturen und deren Funktionen folgen wir der Konzeption von MacLean. Der zentrale Kern Der zentrale Kern steuert unwillkürliches Verhalten wie Husten, Niesen und Schlucken sowie ,einfaches‘ willkürlich kontrolliertes Verhalten wie Atmen, Erbrechen, Schlafen, Essen, Trinken, die Temperaturregulation und das Sexualverhalten. Zum zentralen Kern – auch Hirnstamm genannt – gehören neben allen Strukturen des Rautenhirns und Mittelhirns auch zwei Strukturen des Vorderhirns, nämlich der Hypothalamus und der Thalamus. Damit erstreckt sich der zentrale Kern vom Rautenhirn bis zum Vorderhirn. Dieses Kapitel befasst sich mit fünf Strukturen des Hirnstamms, welche die einfachsten, überlebenswichtigen Verhaltensweisen regulieren: Medulla oblongata, Kleinhirn, Thalamus, Hypothalamus und Formatio reticularis. Die Tabelle in Abbildung 2.8d enthält die Funktionen dieser fünf Strukturen sowie die Funktionen des cerebralen Cortex, des Balkens (Corpus callosum), des Hippocampus und der Amygdala. Die erste leichte Verdickung des Rückenmarks beim Eintritt in den Schädel ist die Medulla oblongata (verlängertes Rü- Die Medulla oblongata ckenmark), eine schmale (verlngertes RckenStruktur, welche die Atmung mark) steuert die Atund einige Reflexe, die für mung und einige Refledie aufrechte Körperhaltung xe fr die aufrechte wichtig sind, steuert. An die- Krperhaltung. ser Stelle kreuzen sich auch die wichtigsten Nervenbahnen, die vom Rückenmark kommen, so dass die rechte Seite des Körpers mit der linken Seite des Gehirns und die linke Seite des Körpers mit der rechten Seite des Gehirns verbunden ist. Das Kleinhirn. Die gefaltete Struktur des Kleinhirns – oder Cerebellums – befindet sich gleich über der Medulla ob- Das Kleinhirn oder longata an der Rückseite Cerebellum ist vor aldes Hirnstamms. Sie ist vor lem fr die Bewegungsallem für die Bewegungsko- koordination zustndig. ordination zuständig. Bestimmte Bewegungen können auch auf höherer Gehirnebene ausgelöst werden, aber die Koordi- 55 Der Aufbau des Nervensystems Gehirn Rautenhirn Medulla Brücke Formatio reticularis Das Mittelhirn ist in der Mitte des Gehirns lokalisiert Kleinhirn Thalamus Das Vorderhirn umfasst alle Strukturen im anterioren Teil des Gehirns Das Rautenhirn schließt alle Strukturen ein, die im posterioren Teil des Gehirns liegen Abb. 2.8 (a) Der rumliche Aufbau des Gehirns. 2 Vorderhirn Mittelhirn Hypothalamus Limbisches System Hypophyse nierung solcher Bewegungen erfolgt durch das Kleinhirn. Schädigungen des Kleinhirns erzeugen ruckartige, unkoordinierte Bewegungen. Neben der Bewegungskoordination ist das Cerebellum aber auch wichtig, um neue motorische Reaktionen zu lernen (Thompson & Krupa, 1994; siehe Kapitel 7). Direkte neuronale Verbindungen zwischen dem Kleinhirn und frontalen Teilen des Gehirns sind an Sprache, Planung und Schlussfolgern beteiligt (Middleton & Strick, 1994). Diese neuronalen Verbindungen sind beim Menschen viel stärker ausgeprägt als bei Affen und anderen Tieren. Derartige Belege lassen darauf schließen, dass das Kleinhirn eine wichtige Rolle sowohl bei der Steuerung und Koordinierung höherer mentaler Funktionen als auch bei der Koordinierung von Bewegungen spielt. Großhirn Cerebraler Cortex Limbisches System Thalamus Zentraler Kern Kleinhirn Abb. 2.8 (b) Der funktionale Aufbau des menschlichen Gehirns. Cerebraler Cortex Hirnstamm 56 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Corpus callosum Großhirn Thalamus Hypothalamus Epiphyse Hypophyse Mittelhirn Brücke Kleinhirn Medulla Diese Grafik zeigt die wichtigsten Strukturen des Zentralnervensystems. (Vom Rückenmark ist nur der obere Teil zu sehen.) Rückenmark Abb. 2.8 (c) Das Gehirn des Menschen im mittleren Lngsschnitt. Struktur Funktion Cerebraler Cortex Die cortikalen Areale umfassen das primre motorische Areal, den primren somatosensorischen Cortex, den primren visuellen Cortex, den primren auditorischen Cortex und die Assoziationsareale. Corpus callosum Das Corpus callosum -- der Balken -- verbindet die beiden Hemisphren des Grohirns. Hippocampus Der Hippocampus hat eine wichtige Funktion fr das Gedchtnis, insbesondere fr das episodische Gedchtnis. Amygdala Die Amygdala ist beteiligt an der Vermittlung von Emotionen, vor allem von Furcht. Thalamus Der Thalamus leitet die einlaufende Information von den sensorischen Rezeptoren zum Grohirn; er hilft auch bei der Regulation von Schlaf und Wachsein. Hypothalamus Der Hypothalamus vermittelt Essen, Trinken und Sexualverhalten. Er reguliert die endokrine Aktivitt und hlt die Homostase aufrecht. Darber hinaus spielt er eine Rolle beim emotionalen Geschehen und bei der Stressreaktion. Kleinhirn Das Kleinhirn -- oder Cerebellum -- ist fr die Bewegungskoordination und fr das Erlernen von Bewegungsablufen zustndig. Formatio reticularis Die Formatio reticularis spielt eine Rolle bei der Erregungskontrolle und bei der Fokussierung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize. Medulla oblongata Die Medulla oblongata steuert die Atmung und einige Reflexe, die den Krper in aufrechter Position halten. Abb. 2.8 (d) Wichtige Teile des menschlichen Gehirns und ihre Funktionen. 57 Der Aufbau des Nervensystems Der Thalamus. Unmittelbar über dem Mittelhirn jeder Hemisphäre befinden sich zwei eiförmige Ansammlungen von Der Thalamus dient als Nuclei: der Thalamus. Der sensorische UmschaltThalamus dient als sensoristation und leitet Inforsche Umschaltstation, welmation von den Sinche die einlaufende Informanesrezeptoren (wie etwa Sehen und Hren) tion von den sensorischen Rezeptoren (wie etwa Sehen zum Grohirn weiter. Ebenso wichtig ist seine und Hören) zum Großhirn Rolle bei der Regulation weiterleitet. Er spielt ebenso von Schlaf- und Wacheine wichtige Rolle bei der zustnden. Regulation von Schlaf- und Wachzuständen. Hypothalamus. Der Hypothalamus ist eine viel kleinere Struktur direkt unter dem Thalamus. Er reguliert motivierte Verhaltensweisen wie Essen, Trinken und Sexualverhalten. Der Hypothalamus steuert auch die Körpertemperatur, die Pulsfrequenz und den Blutdruck, die alle Homostase bezeichBestandteile der Homöostase net den normalen sind. Darunter versteht man Funktionszustand eines das normale Gleichgewicht gesunden Organismus. zwischen den physiologischen Systemen des Körpers. Ist ein Organismus Belastungen ausgesetzt, wird die Homöostase gestört, und Prozesse zur Korrektur des entstandenen Ungleichgewichts werden in Gang gesetzt. So schwitzen wir, wenn es uns zu warm ist, und wir zittern, wenn es uns zu kalt ist. Beide Prozesse sind darauf ausgerichtet, die Normaltemperatur wieder herzustellen; sie werden durch den Hypothalamus gesteuert. Der Hypothalamus spielt auch eine wichtige Rolle beim emotionalen Geschehen und bei unseren Reaktionen auf Stress erzeugende Situationen. Eine schwache elektrische Reizung bestimmter Regionen des Hypothalamus erzeugt angenehme Gefühle; eine Stimulation benachbarter Regionen führt zu unangenehmen Gefühlen. Auch steuert der Hypothalamus über seinen Einfluss auf die Aktivität der Hypophyse, die direkt unter ihm liegt (siehe Abbildung 2.8), das endokrine System und damit die Produktion von Hormonen. Diese Kontrolle ist in Gefahrensituationen besonders wichtig, wenn der Körper sehr rasch Der Hypothalamus reguliert motivierte Verhaltensweisen wie Essen, Trinken und Sexualverhalten. Er steuert aber auch die Krpertemperatur, die Pulsfrequenz und den Blutdruck. einen ganzen Komplex von physiologischen Prozessen mobilisieren muss, der als Angriff-oderFlucht-Reaktion bezeichnet wird. Dieser Funktion entsprechend wird der Hypothalamus auch als das Stresszentrum des Gehirns bezeichnet. Formatio reticularis. Die Die Formatio retiFormatio reticularis ist ein cularis ist ein Netz Netz von Neuronen, das von Neuronen, welches sich vom unteren Hirn- insbesondere fr die stamm bis zum Thalamus er- Steuerung von Erregung streckt und dabei eine Reihe zustndig ist. anderer Strukturen des zentralen Kerns durchkreuzt. Dieses neuronale Netzwerk dient insbesondere zur Erregungssteuerung. Wenn die Formatio reticularis einer Katze oder eines Hundes mit einer bestimmten Wechselstromfrequenz über implantierte Elektroden gereizt wird, schläft das Tier ein. Die Stimulation mit einem höherfrequenten Signal weckt das schlafende Tier wieder auf. Die Formatio reticularis hat auch eine wichtige Funktion für unsere Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize zu fokussieren. Alle sensorischen Rezeptoren besitzen Nervenfasern, die in die Formatio reticularis führen, welche als Filter zu fungieren scheint. Einige sensorische Signale werden von ihr zum Cortex durchgelassen (das heißt, sie werden bewusst), andere werden dagegen abgeblockt. Das limbische System Um den zentralen Kern des Gehirns und eng verbunden mit dem Hypothalamus liegt das limbische System. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von Strukturen, die zusätzliche Kontrolle über instinktives Verhalten auszuüben scheint, das ansonsten vom Hypothalamus und dem Hirnstamm reguliert wird (siehe noch einmal Abbildung 2.8). Tiere wie beispielsweise Fische und Reptilien, die nur ein rudimentäres limbisches System besitzen, zeigen bei Aktivitäten wie Füttern, Angriff, Flucht und Paarung nur stereotype Verhaltensweisen. Bei Säugetieren scheint das limbische System einige dieser instinktiven Verhaltensmuster zu hemmen. Dadurch wird der Organismus flexibler und kann sich besser an Veränderungen in der Umwelt anpassen. 2 58 Ein Teil des limbischen Systems, der Hippocampus, besitzt eine wichtige Funktion für das Gedächtnis. Die Bedeutung dieser Funktion wurde entdeckt, als man in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts Menschen zur Behandlung ihrer Epilepsie diese Gehirnstruktur chirurgisch entfernte. Nach der Erholung von einer solchen Operation sind Patienten leicht in der Lage, alte Freunde zu erkennen oder frühere Erlebnisse zu berichten; sie können lesen und Dinge tun, die sie lange vor der Operation erlernt haben. Dagegen haben sie Schwierigkeiten, über Ereignisse zu berichten, die sie im Jahr vor der Operation erlebt haben. An Erlebnisse nach ihrer Operation haben sie gar keine Erinnerung. So erkennen solche Patienten zum Beispiel eine Person am Nachmittag nicht wieder, mit der sie einige Stunden am Vormittag verbracht haben. Sie können ein Puzzlebild jede Woche wieder zusammenlegen, ohne sich daran zu erinnern, dass sie es schon einmal getan haben, und sie können dieselbe Zeitung immer wieder lesen, ohne sich an den Inhalt zu erinnern (Squire & Kandel, 2000). Das limbische System ist auch am emotionalen Verhalten beteiligt. Die Amygdala, eine mandelförmige Struktur tief im InAls Amygdala bezeichnern des Gehirns, ist entnet man eine manscheidend für Emotionen delfrmige Teilstruktur wie etwa Furcht (Maren, des limbischen Sys2001). Zum Beispiel zeigen tems; sie ist entscheidend fr Emotionen wie Affen mit Schädigung der Amygdala einen deutlichen zum Beispiel Furcht. Rückgang an Furcht (Klüver & Bucy, 1937). Menschen mit solchen Schädigungen sind nicht in der Lage, Gesichtsausdrücke von Furcht zu erkennen oder neue Reaktionen auf Furcht zu erlernen (Bechara et al., 1995). Die Beschreibung des Gehirns auf der Basis von drei konzentrischen Strukturen – dem zentralen Kern, dem limbischen System und dem Großhirn (siehe dazu den nächsten Abschnitt) – darf nicht dazu verleiten, diese Teile als voneinander unabhängig zu sehen. Sie sind mit einem Netzwerk von Computern zu vergleichen. Jeder übernimmt spezielle Funktionen, aber sie müssen zusammenarbeiten, um das beste Ergebnis zu erreichen. Ähnlich erfordert die Analyse der Sinnesinformation bestimmte Verarbeitungspro- Der Hippocampus ist ein Teil des limbischen Systems; er besitzt eine wichtige Funktion fr das Gedchtnis. 2 Biologische Grundlagen der Psychologie zesse und Entscheidungen (für die das Großhirn zuständig ist), die sich von denen unterscheiden, die für die (vom limbischen System ausgeübte) Steuerung von sequenziellem, reflexhaftem Verhalten erforderlich sind. Die Feinsteuerung der Muskeln (beim Schreiben oder beim Spielen eines Musikinstruments) erfordert wiederum eine andere Art der Steuerung, die durch den primären motorischen Cortex im Vorderhirn geleistet wird. Alle diese Aktivitäten werden als integriertes System realisiert, so dass der Organismus reibungslos funktioniert. Das Grohirn Das Großhirn ist beim Menschen viel höher entwickelt als bei jedem anderen Organismus. Die äußere Schicht des Großhirns wird cerebraler Cortex (oder einfach Cortex) genannt. Die Bezeichnung ist Der cerebrale Cortex ist die uere Schicht vom lateinischen Wort für des Grohirns. „Rinde“ abgeleitet. Der Cortex eines konservierten Gehirns erscheint grau, weil er hauptsächlich aus Nuclei und Fasern ohne Myelinscheide besteht – daher auch der Name „graue Substanz“. Das Innere des Großhirns, unterhalb des Cortex, besteht vor allem aus myelinisierten Axonen und erscheint weiß (auch „weiße Substanz“ genannt). Jedes Sinnessystem sendet Informationen an spezifische Areale des Cortex. Motorische Reaktionen oder Bewegungen der Körperteile werden von einem anderen Areal des Cortex gesteuert. Der Rest des Cortex, der weder für sensorische noch für motorische Information zuständig ist, besteht aus Assoziationsarealen. Diese Areale nehmen den größten Teil des menschlichen Cortex ein und dienen Gedächtnis-, Denk- und Sprachfunktionen. Das Großhirn besteht aus zwei Hemisphären auf der linken und der rechten Seite des Gehirns, welche durch den Balken Das Grohirn besteht (das Corpus callosum) ver- aus zwei Hemisphren bunden sind. Sie sind im auf der linken und der Großen und Ganzen sym- rechten Seite des Gemetrisch und durch eine tiefe hirns, die miteinander Furche getrennt, die von durch den Balken (das vorn nach hinten läuft. Wir Corpus callosum) versprechen deshalb von der bunden sind. 59 Der Aufbau des Nervensystems (a) Scheitel- oder Parietallappen (b) Stirn- oder Frontallappen Zentralfurche Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre Frontallappen Längsfurche 2 Zentralfurche Insel (nicht sichtbar unter der Oberfläche) Hinterhaupts- Schläfen- oder Sulcus oder Okzipital- Temporallappen lateralis lappen Cortex Scheiteloder Parietallappen Subcortikales Gewebe Furche (c) Hinterhaupts- oder Okzipitallappen Scheitel- oder Parietallappen (d) Hinterhaupts- oder Okzipitallappen Frontallappen Kleinhirn Schläfen- oder Temporallappen Abb. 2.9 Okzipitallappen. Jede cerebrale Hemisphre besteht aus mehreren Lappen, die durch Furchen getrennt sind. Zustzlich zu den groen sichtbaren Lappen liegt eine groe innere Falte, die Insula, tief in der lateralen Furche. (a) Seitenansicht. (b) Ansicht von oben. (c) Querschnitt durch den cerebralen Cortex. Man beachte den Unterschied zwischen der grauen Substanz im Oberflchenbereich und der tiefer liegenden weien Substanz. (d) Fotographie des menschlichen Gehirns. (Nach Gaudin & Jones, 1989.) Jede Hemisphre lsst sich in vier Lappen einteilen: den Frontallappen, den Parietallappen, den Okzipitallappen und den Temporallappen; alle Lappen sind groe Regionen des cerebralen Cortex mit unterschiedlichen Funktionen. rechten und der linken Hemisphäre. Jede Hemisphäre ist in vier Lappen eingeteilt – große Regionen des cerebralen Cortex mit unterschiedlichen Funktionen (siehe Abbildung 2.9): den Stirnlappen (Frontallappen), den Scheitellappen (Parietallappen), den Hinterhauptslappen (Okzipitallappen) und den Schläfenlappen (Temporallappen). Der Stirnlappen ist vom Scheitellappen durch die Zentralfurche (Sulcus centralis) getrennt, die vom Scheitel seitwärts zu den Ohren verläuft. Die Grenze zwischen dem Scheitellappen und dem Hinterhauptslappen verläuft weniger eindeutig. Für unsere Zwecke genügt, dass sich der Scheitellappen unter dem Schädeldach und hinter der Zentralfurche befindet, während der Hinterhauptslappen im hinteren Teil des Gehirns liegt. Der Schläfenlappen ist durch eine tiefe Fur- 60 2 Biologische Grundlagen der Psychologie che an der Seite des Gehirns, den Sulcus lateralis, abgesetzt. Bewegungen der linken Körperhälfte erfolgen durch die rechte Hemisphäre. Der primre motorische Cortex. Der primäre motorische Cortex, unmittelbar vor der Zentralfurche gelegen, steuert die Willkürbewegungen des Körpers (siehe Abbildung 2.10). Eine elektrische Stimulation bestimmter Stellen des motorischen Cortex ruft die Bewegung bestimmter Körperteile hervor, dagegen führt eine Schädigung eben dieser Stellen zu Störungen der entsprechenden Bewegungen. Auf dem motorischen Cortex ist der Körper ungefähr auf dem Kopf stehend abgebildet. Bewegungen der Zehen werden durch Areale gesteuert, die sich oben befinden, für Bewegungen der Zunge und des Mundes sind jedoch Areale im unteren Bereich des motorischen Cortex zuständig. Bewegungen der rechten Seite des Körpers werden durch den motorischen Cortex der linken Hemisphäre bewirkt; Der primre somatosensorische Cortex. Im Parietallappen liegt ein Areal, das durch die Zentralfurche vom motorischen Cortex abgetrennt ist und bei elektrischer Reizung Sinnesempfindungen auf der entgegengesetzten Seite des Körpers auslöst. Wird dieses Areal stimuliert, dann fühlt es sich an, als ob ein Körperteil berührt oder bewegt würde. Daher wird dieser Bereich primärer somatosensorischer Cortex („Soma“ ist der Körper, „sensorisch“ betrifft die Sinne) genannt, das Areal der Körpersinne. Die Empfindungen von Wärme, Kälte, Berührung, Schmerz und die Empfindung von Körperbewegungen sind in diesem Teil des Cortex repräsentiert. Die meisten Fasern der Nervenbahnen, die vom somatosensorischen und vom motorischen Cortex ausgehen und zu ihnen hinführen, wech- Zentralfurche Primärer motorischer Cortex Primärer somatosensorischer Cortex BrocaAreal Gyrus angularis Sulcus lateralis Vorderseite des Gehirns Primärer auditorischer Cortex WernickeAreal Primärer visueller Cortex Abb. 2.10 Funktionsteilung in der linken Hemisphre. Ein groer Teil des Cortex ist an der Steuerung von Bewegungen und an der Analyse sensorischer Inputs beteiligt. Diese Areale (dazu gehren der motorische, der somatosensorische, der visuelle, der auditive und der olfaktorische Cortex) sind auf beiden Seiten des Gehirns vorhanden. Andere Funktionen finden sich nur auf einer Seite des Gehirns. So sind das Broca- und das Wernicke-Areal an der Produktion und dem Verstehen von Sprache beteiligt. Der Gyrus angularis hilft beim Vergleich der visuellen Form des Wortes mit seiner auditorischen Reprsentation. Diese Funktionen existieren nur in der linken Hlfte des Gehirns. 61 Der Aufbau des Nervensystems seln die Körperseite. So gehen sensorische Impulse von der rechten Seite des Körpers zum linken somatosensorischen Cortex, und die Muskeln des rechten Fußes und der rechten Hand werden durch den linken motorischen Cortex gesteuert. Im Allgemeinen ist die Größe der Fläche auf dem somatosensorischen Cortex, die mit einem bestimmten Teil des Körpers assoziiert ist, proportional zur Empfindlichkeit und zum Einsatz dieses Körperteils. Beispielsweise besitzt der Hund unter den vierbeinigen Säugetieren für seine Vorderpfoten nur einen kleinen cortikalen Bereich. Beim Waschbär dagegen, der seine Vorderpfoten ausgiebig zur Erkundung und Manipulation seiner Umgebung einsetzt, ist der cortikale Bereich für die Steuerung seiner Vorderpfoten viel größer ausgeprägt, wobei sogar einzelnen Fingern eine eigene Region zugeordnet ist. Die Ratte lernt sehr viel über ihre Umgebung durch ihre empfindsamen Barthaare und verfügt daher für jedes Barthaar über einen separaten cortikalen Bereich. Der primre visuelle Cortex. Am hinteren Ende der beiden Okzipitallappen befindet sich der primäre visuelle Cortex. Abbildung 2.11 zeigt die Fasern des Sehnervs und die Nervenbahnen von beiden Augen bis zum visuellen Cortex. Dabei ist zu beachten, dass ein Teil der Fasern des Sehnervs vom rechten Auge zur rechten Hemisphäre führt, während die restlichen Fasern beim Chiasma opticum (der Sehkreuzung) zur linken Hemisphäre wechseln. Analog gilt dies auch für das linke Auge. Genau betrachtet führen die Fasern von der rechten Seite beider Augen in die rechte Hemisphäre, und die Fasern von der linken Seite der Augen gehen in die linke Hemisphäre. Diese Zusammenhänge sind manchmal für die Lokalisierung eines Hirntumors oder anderer Sehstörungen nützlich. Zum Beispiel verursacht eine Schädigung des visuellen Cortex in der linken Hemisphäre blinde Flecken in den jeweiligen linken Hälften der beiden Augen, was einem Verlust des rechten Gesichtsfelds entspricht. Der primre auditorische Cortex. Der primäre auditorische Cortex befindet sich an der Oberfläche des Temporallappens an der Seite jeder Hemisphäre. Er ist an der Analyse komplexer akustischer Signale beteiligt, insbesondere an der Ana- Linkes Auge Rechtes Auge Sehnerv Chiasma opticum Visueller Cortex Abb. 2.11 Die Sehbahnen. Nervenfasern von der inneren oder nasalen Hlfte der Retina kreuzen sich beim Chiasma opticum und gehen zur anderen Seite des Gehirns. So werden die Signale von Reizen, die auf die jeweils rechte Seite der Retina fallen ( = linkes Gesichtsfeld), zur rechten Hemisphre bertragen. Entsprechend werden Signale von Reizen, die auf die linke Seite jeder Retina fallen ( = rechtes Gesichtsfeld), zur linken Hemisphre bertragen. (Nach Gaudin & Jones, 1989.) lyse der zeitlichen Strukturierung von Schallsignalen wie etwa der menschlichen Sprache. Beide Ohren sind im auditorischen Cortex beider Hemisphären repräsentiert, wobei jedoch die Verbindungen zur gegenüberliegenden Seite des Cortex stärker sind. Demnach sendet das rechte Ohr Informationen zum primären auditorischen Cortex sowohl der rechten als auch der linken Hemisphäre, wobei aber mehr Information in die linke Hemisphäre übertragen wird. Beim linken Ohr verhält es sich entsprechend umgekehrt. Der Assoziationscortex. Diejenigen Bereiche des cerebralen Cortex, die weder für sensorische noch für motorische Prozesse zuständig sind, bilden, wie schon erwähnt, den Assoziationscortex. Die frontalen Assoziationsfelder (Teile des Frontallappens vor dem motorischen Cortex) scheinen eine wichtige Rolle bei den Gedächtnisleistungen zu spielen, die für erfolgreiches Problemlösen erforderlich sind (Miller & Cohen, 2001). Bei Affen führt zum Beispiel eine Schädigung der Frontallappen dazu, dass ihre Fähigkeit zur Lösung von Problemen verloren geht, bei denen eine Reakti- 2 62 2 Biologische Grundlagen der Psychologie on nach einer Zeitverzögerung ausgeführt werden muss. Bei einem solchen Problem wird für den Affen sichtbar Futter in eine von zwei Schalen gelegt, die anschließend mit zwei identischen Objekten zugedeckt werden. Dann wird ein undurchsichtiger Schirm zwischen den Affen und die zugedeckten Schalen gestellt. Nach einer gewissen Zeit wird der Schirm entfernt, und der Affe darf eine der Schalen wählen. Gesunde Affen können sich noch nach mehreren Minuten an die richtige Schale erinnern, Affen mit Schädigungen der Frontallappen sind schon nach einigen Sekunden nicht mehr dazu in der Lage. Gesunde Affen haben im Frontallappen Neurone, die während der Verzögerungszeit Aktionspotenziale erzeugen. Dadurch bleibt möglicherweise die Erinnerung an ein Ereignis erhalten (Goldman-Rakic, 1996). Die posterioren Assoziationsfelder befinden sich in der Nähe der verschiedenen primären sensorischen Areale. Sie scheinen aus Teilfeldern zu bestehen, die jeweils für eine bestimmte Art von Sinneseindrücken zuständig sind. So hängt der untere Teil des Temporallappens mit der visuellen Wahrnehmung zusammen. Läsionen (Gehirnschäden) in diesem Bereich rufen Defizite bei der Wiedererkennung und Diskrimination von Formen hervor. Eine Schädigung an dieser Stelle des Cortex beeinträchtigt hingegen nicht das visuelle Auflösungsvermögen, wie es bei einer Läsion im primären visuellen Cortex des Okzipitallappens der Fall wäre. Vielmehr vermag ein Patient die Form zu ,sehen‘ und die Umrisse nachzuzeichnen, er kann die Form aber nicht identifizieren oder von anderen Formen unterscheiden (Gallant, Shuop & Mazer, 2000; Goodglass & Butters, 1988). Bilder vom lebenden Gehirn Hoch entwickelte Computermethoden, die erst seit Kurzem verfügbar sind, ermöglichen es, für den Patienten schmerzfrei und ohne weitere Beeinträchtigung oder gar Schädigung detaillierte Bilder vom lebenden menschlichen Gehirn zu erhalten. Vor der Ausarbeitung dieser Techniken konnte eine präzise Lokalisierung und Identifikation der meisten Gehirnverletzungen nur durch einen explorativen neurochirurgischen Eingriff, eine komplizierte neurologische Diagnose oder eine Autopsie nach dem Tod des Patienten vorgenommen werden. Eine dieser Techniken ist die Computer-Tomographie (CT). Dabei wird ein schmaler Röntgenstrahl durch den Kopf des Patienten geschickt. Gemessen wird der Anteil der Eingangsstrahlung, der auf der anderen Seite des Kopfes noch ankommt. Das entscheidend Neue an dieser Technik war, dass Hunderttausende solcher Messungen mit verschiedenen Orientierungen (oder Achsen) des Strahls durch den Kopf vorgenommen werden können. Auf der Grundlage dieser Messungen berechnet der Computer ein Querschnittsbild des Gehirns, das fotographiert oder auf einem Monitor gezeigt werden kann. Solche scheibenweisen Querschnittsbilder („tomo“ ist ein altes griechisches Wort und bedeutet „Scheibe“ oder „Schnitt“) können für jeden gewünschten Orientierungswinkel und jede Schnittebene erstellt werden. Eine neuere und noch leistungsfähigere Methode ist die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT). Scanner benutzen hierbei starke Magnetfelder, Die Magnet-Resonanzhochfrequente elektrische Tomographie erlaubt Impulse und Computer zur Bildaufnahmen vom lebenden Gehirn. Scanner Berechnung eines Bildes. benutzen starke MagBei diesem Verfahren liegt netfelder, hochfrequender Patient in einer Röhre, te elektrische Impulse die von einem großen Mag- und Computer zur Beneten umgeben ist, der ein rechnung eines Bildes. starkes Magnetfeld erzeugt. Wird ein ausgewählter Teil des Körpers in ein starkes Magnetfeld gebracht und einem elektrischen Impuls mit einer bestimmten Frequenz ausgesetzt, sendet das Gewebe ein messbares Signal aus. Wie mit der CT können Hunderttausende solcher Messungen gemacht werden. Der Computer berechnet aus diesen vielen Messungen ein zweidimensionales Bild des untersuchten Körperteils. Wissenschaftler bezeichnen diese Technik als „magnetische Kernresonanz“, weil man Veränderungen im Energieniveau von Wasserstoffkernen misst, die durch die hochfrequenten Impulse verursacht werden. Viele Mediziner lassen jedoch den Begriff „Kern“ weg, weil sie befürchten, dass die Öffentlichkeit einen Zusammenhang mit radioaktiver Strahlung sehen könnte. Der Aufbau des Nervensystems 63 2 > So sieht die Bildgebung bei einer MRT-Untersuchung aus. Die hellen Bereiche stehen fr maximale, die dunklen fr minimale Gehirnaktivitt. Oft werden die Aktivierungsunterschiede auch farblich markiert. Im Vergleich zur CT bietet die MRT bei der Diagnose von Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks eine größere Präzision. So sind beispielsweise in einem MRT-Querschnittsbild des Gehirns typische Merkmale einer Multiplen Sklerose zu erkennen. Eine CT kann dies nicht. Früher erforderte die Diagnose der Multiplen Sklerose einen Krankenhausaufenthalt und das Einspritzen eines Kontrastmittels in den Rückenmarkskanal. Die MRT hilft auch beim Auffinden von Veränderungen im Rückenmark und an der Schädelbasis, beispielsweise bei Bandscheibenvorfällen, Tumoren oder angeborenen Fehlentwicklungen und Missbildungen. Zusätzlich zu den anatomischen Details des Gehirns, wie CT und MRT sie zu liefern vermögen, hätte man oft auch gern Informationen über die neuronale Aktivität verschiedener Gehirnteile. Dies gelingt mit einer computergesteuerten Abtasttechnik, der sogenannten Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Diese Technik nutzt aus, dass jede Körperzelle für ihre Stoffwechselprozesse Energie benötigt. Die Neurone im Gehirn verwenden als Energiequelle vor allem Glucose, das dem Blutstrom entnommen wird. Glucose wird mit einer schwach radioaktiven Substanz vermischt, so dass jedes Glucosemolekül eine kleine radioaktive Markierung erhält. Wird diese Mischung in den Blutstrom injiziert, ver- wendet das Gehirn diese markierten Glucosemoleküle nach wenigen Minuten genau so wie normale Glucose. Die besonders aktiven Neurone brauchen besonders viel Glucose und sind deshalb auch am stärksten radioaktiv. PET ist eine hoch empfindliche Methode zur Messung dieser Radioaktivität. Die Messergebnisse werden durch einen Computer ausgewertet, der ein Quer- > Die Positronen-Emissions-Tomographie zeigt drei Bereiche in der linken Hemisphre, die whrend einer sprachlichen Aufgabe aktiv sind. 64 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Forschung aktuell Das Gehirn wchst weiter Das Bild, das uns in diesem Kapitel von der Neuroanatomie gezeigt wurde, mag uns schlieen lassen, dass es sich beim Nervensystem um ein statisches und fest verdrahtetes System handelt, ganz so wie ein Fernsehgert. Aber ist die Anatomie der Neurone wirklich so unvernderlich? Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass dem nicht so ist. Tatschlich scheint das Gehirn ein hochdynamisches System zu sein, das whrend der Entwicklung und infolge von Erfahrungen, die wir als Erwachsene machen, ber enorme plastische Wandlungsfhigkeit verfgt. Die vielleicht aufregendste neue Entdeckung ist die, dass sich whrend Lernphasen nicht nur die Synapsen anpassen, indem sie wachsen und schrumpfen, sondern dass im Gehirn eines Erwachsenen in der Folge ganz unterschiedlicher Erfahrungen sogar Neurone neu entstehen. Neu entstehende Neurone? Ja, tatschlich. Die Entstehung neuer Nervenzellen wird Neurogenese genannt. Bei Sugetieren bilden sich die meisten Neurone schon frh in der embryonalen Entwicklung, wenn der Fetus sich noch in der Gebrmutter befindet. Diese unreifen Neurone wandern durch das sich entwickelnde Gehirn und steuern ein Ziel an, das ihnen sagt, dass sie hier den Rest ihres Daseins verbringen werden. Wenn sie an diesem Bestimmungsort angekommen sind, bleiben die Neurone dort und differenzieren sich nach Form und Gre in eine der vielfachen Mglichkeiten aus, die in Abbildung 2.3 zu sehen sind. Im Normalfall verlieren die Neurone die Fhigkeit zur Zellteilung, sobald sie ihre Spezialisierung abgeschlossen haben. Mit anderen Worten: Die Zellen, die einmal entstanden sind und an ihren Bestimmungsort wandern, werden spter im Leben nicht durch neue Zellgenerationen ersetzt. Die jngsten Forschungsergebnisse haben jedoch den lange etablierten Standpunkt, das erwachsene Gehirn sei unfhig, neue Generationen von Nervenzel- len zu bilden, in Frage gestellt. In einer aktuellen Studie injizierte eine Forschergruppe Ratten ein unter dem Namen BRDU gelufiges Prparat, das erst krzlich entstandene Neurone markiert. Nachdem den Ratten das Mittel gespritzt wurde, wurde mit den Tieren eine klassische Konditionierungsaufgabe einstudiert, die den Hippocampus beansprucht. Die Forscher fanden heraus, dass die Ratten, die das Training in der Konditionierungsaufgabe absolvierten, einen signifikanten Anstieg der Menge an markierten Neuronen im Hippocampus aufwiesen (Gould, Beylin, Tanapat, Reeves & Shors, 1999). Interessanterweise stand eine hnliche Konditionierungsaufgabe, die aber keine Anforderungen an den Hippocampus stellt, nicht in Verbindung mit der Herausbildung neuer Neurone im Hippocampus. Besagte Forschergruppe hat ganz aktuell herausgefunden, dass Substanzen, welche die hippocampale Neurogenese blockieren, die Konditionierung des Lidschlagreflexes beeintrchtigen (Shors et al., 2001). In ihrer Gesamtheit legen diese Untersuchungen nicht nur nahe, dass Lernvorgnge mit der Neubildung von Neuronen im Gehirn in Zusammenhang stehen, sondern auch, dass die Neurogenese selbst eine unverzichtbare Grundlage fr erfolgreiches Lernen darstellt. Erstaunlicherweise entstehen neue Neurone nicht nur durch komplizierte Lernaufgaben. Forscher am Salk-Institut entdeckten, dass man die Menge an neu herausgebildeten hippocampalen Neuronen allein dadurch erhhen kann, dass man Tieren die Gelegenheit gibt, sich auszutoben (van Praag, Kempermann & Gage, 1999). Diese Neurone entwickeln und verhalten sich genau so wie ausgereifte Neurone (van Praag et al., 2002). Wer tglich Sport treibt, hlt sich also nicht nur krperlich fit -- man strkt damit auch die Lernfhigkeit des eigenen Gehirns. Also nichts wie los: Das beste Gehirntraining besteht darin, tatschlich ein paar Kilometer zu joggen! schnittsbild des Gehirns berechnet. Mit unterschiedlichen Farben werden die verschiedenen Niveaus der neuronalen Aktivität dargestellt. Die Messung der Radioaktivität basiert auf der Emission von Positronen, welche positiv geladene Teilchen sind – daher der Name des Verfahrens. Gehirnerkrankungen wie Epilepsie, Blutgerinnsel und Gehirntumore können mit dieser Technik identifiziert werden. PET-Bilder, welche die Gehirne Schizophrener mit solchen von gesunden Personen verglichen, zeigten Unterschiede im Stoffwechselniveau bestimmter Gehirnareale (Schultz et al., 2002). Mit der PET-Technik wurde auch untersucht, welche Gehirnareale bei höheren kognitiven Funktionen – Musik hören, Mathematikaufgaben bearbeiten oder sprechen – aktiviert sind, mit dem Ziel, die beteiligten Gehirnstrukturen zu identifizieren (Posner, 1993). Der Aufbau des Nervensystems CT, MRT und PET erweisen sich bei der Analyse des Zusammenhangs von Gehirn und Verhalten als wertvolle Werkzeuge. Sie sind ein Beispiel dafür, wie Fortschritte in einem Feld der Wissenschaft auf der Grundlage neuer technischer Entwicklungen in einem anderen erreicht werden (Pechura & Martin, 1991; Raichle, 1994). So kann man mit der PET beispielsweise Unterschiede in der neuronalen Aktivität der beiden Hemisphären untersuchen: die Gehirnasymmetrien. Asymmetrien des Gehirns Auf den ersten Blick sehen die beiden Hemisphären wie Spiegelbilder aus. Die Ausmessung des Gehirns nach einer Autopsie zeigt aber, dass die linke Hemisphäre fast immer etwas größer ist als die rechte. Auch enthält die rechte Hemisphäre sehr viele lange Nervenfasern, die weit entfernte Bereiche des Gehirns verbinden, während die linke Hemisphäre viele kürzere Nervenfasern besitzt, die ein dichtes Netz von Verbindungen innerhalb kleiner Areale bilden (Hellige,1993). Schon 1861 untersuchte der französische Arzt Paul Broca das Gehirn eines verstorbenen Patienten mit Sprachverlust. Er fand eine Schädigung eines Bereichs in der linken Hemisphäre, genau über dem Sulcus lateralis im Frontallappen. Diese Region des Gehirns, die als Broca-Areal bekannt wurde (siehe Abbildung 2.10), ist an der Sprachproduktion beteiligt. Eine Zerstörung der entsprechenden Region in der rechten Hemisphäre führt normalerweise nicht zu einer Sprachstörung. Auch die Regionen, die am Sprachverstehen sowie am Schreiben und am Verstehen geschriebener Sprache beteiligt sind, befinden sich meistens in der linken Hemisphäre. Ein Schlaganfall, der die linke Hemisphäre schädigt, verursacht mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Sprachstörung als ein solcher, der sich lediglich auf die rechte Hemisphäre beschränkt. Das Sprachzentrum liegt nicht bei allen Menschen in der linken Hemisphäre; einige Linkshänder haben ihr Sprachzentrum in der rechten Hemisphäre. Obwohl nun die Rolle der linken Hemisphäre für die Sprache seit Langem bekannt ist, gibt es erst seit Kurzem die Möglichkeit zu untersuchen, was jede Hemisphäre allein leisten kann. Bei einer gesunden Person bilden die Gehirnfunktionen 65 ein integriertes Ganzes; die Information in einer Hemisphäre wird sofort über ein breites Band von Nervenfasern, das Corpus callosum (den Balken), in die andere Hemisphäre weitergegeben. Der Balken bildet bei einigen Formen der Epilepsie ein Problem, weil ein Anfall, der in einer Hemisphäre ausgelöst wird, über diesen Balken die Entladung einer großen Anzahl von Neuronen in der anderen Hemisphäre auslöst. Um solche generalisierten Anfälle zu verhindern, haben Neurochirurgen bei Patienten mit schwerer Epilepsie den Balken durchtrennt. Durch diese sogenannten Split-Brain-Patienten erhielt man wichtige Erkenntnisse über die Funktionsweise von linker und rechter Hemisphäre. Split-Brain-Forschung. Wir haben gesehen, dass die Motonerven beim Austritt aus dem Gehirn die Seite wechseln, so dass die linke Hemisphäre die rechte Hälfte des Körpers und die rechte Hemisphäre die linke Körperhälfte steuert. Auch haben wir festgestellt, dass die Region für die Sprachproduktion (das Broca-Areal) in der linken Hemisphäre lokalisiert ist. Darüber hinaus sollte man sich vergegenwärtigen, dass Bilder links vom Fixationspunkt durch beide Augen in die rechte Hemisphäre und Bilder rechts vom Fixationspunkt zur linken Hemisphäre geleitet werden, wenn die Augen auf die Mitte des Gesichtsfeldes fixiert sind (siehe Abbildung 2.12). Folglich bekommt jede Hemisphäre ein Bild von der Hälfte des visuellen Feldes, in dem ,ihre‘ Hand normalerweise agiert. Die linke Hemisphäre sieht zum Beispiel die rechte Hand im rechten visuellen Feld. Im gesunden Gehirn gelangen die Reize, die eine Hemisphäre erreichen, auch sehr schnell in die andere Hemisphäre; ein ganzheitliches Funktionieren des Gehirns ist gesichert. Wir wollen nun unter Berücksichtigung dieser drei Tatsachen über das Gehirn sehen, was geschieht, wenn das Corpus callosum durchtrennt ist und die Hemisphären in diesem gespaltenen Gehirn („split brain“) nicht mehr miteinander kommunizieren können. Roger Sperry, der diese Forschungsrichtung begründet hat, erhielt 1981 den Nobelpreis. In einer seiner Testsituationen sitzt ein SplitBrain-Patient so vor einem Schirm, dass er seine Hände nicht sehen kann (siehe Abbildung 2.13a). Die Augen sind auf einen Punkt in der Mitte des Schirms gerichtet. Für eine Zehntelsekunde wird 2 66 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Linkes Rechtes Gesichtsfeld Gesichtsfeld Fixationspunkt L R Rechte Hand Linke Hand Riechen linkes Nasenloch Sprache Schreiben Sprachzentrum Rechnen Riechen rechtes Nasenloch Raumvorstellung Nichtverbale Vorstellung Rechtes Linkes Gesichtsfeld Gesichtsfeld Durchtrenntes Corpus callosum Abb. 2.12 Sensorische Inputs in die beiden Hemisphren. Sind die Augen auf den Mittelpunkt des Sehfeldes fixiert, werden Reize links vom Fixationspunkt in die rechte Hemisphre und Reize rechts vom Fixationspunkt in die linke Hemisphre projiziert. Die linke Hemisphre steuert die Bewegungen der rechten Hand und die rechte Hemisphre die der linken Hand. Auch beim Hren kreuzen sich die sensorischen Inputs, allerdings gehen einige der Schallreprsentationen auch zu der Seite, auf der das aufnehmende Ohr liegt. Die linke Hemisphre ist fr geschriebene und gesprochene Sprache sowie fr mathematische Berechnungen zustndig. Die rechte Hemisphre kann nur einfache Sprache verstehen. Ihre hauptschliche Funktion liegt im Umgang mit rumlichen Strukturen und mit Mustern. (Aus Nebes & Sperry, 1971.) das Word „Mutter“ auf der linken Seite des Schirms dargeboten. Dieses Signal geht bekanntlich zur rechten Hemisphäre, welche die linke Seite des Körpers steuert. Mit der linken Hand kann diese Person leicht eine Schraubenmutter aus der für sie nicht sichtbaren Objektmenge ertasten und auswählen. Sie kann aber das Wort nicht angeben, da die Sprache durch die linke Hemisphäre gesteuert wird und das Bild des Wortes „Mutter“ wegen des durchtrennten Balkens nicht in diese Hemisphäre transferiert werden konnte. Auf Nachfrage scheint ihr auch nicht bewusst zu sein, was ihre linke Hand gerade tut. Da der sensorische Input von der linken Hand zur rechten Hemisphäre gelangt, erhält die linke Hemisphäre keine Information darüber, was die linke Hand fühlt oder macht. Die ganze Information wird zur rechten Hemisphäre zurückgemeldet, in die auch der ursprüngliche visuelle Reiz „Mutter“ projiziert wurde. Bei diesem Versuch darf das Wort nicht länger als eine Zehntelsekunde auf dem Bildschirm dargeboten werden. Bei längerer Darbietung können sich die Augen der Person bewegen, und das Wort wird dann auch in die linke Hemisphäre projiziert. Wenn sich die Augen frei bewegen können, erreichen die Informationen beide Hemisphären. Deshalb werden die Defizite, die als Folge der Durchtrennung des Corpus callosum auftreten können, im Alltagsverhalten einer Person auch kaum sichtbar. Weitere Experimente lassen erkennen, dass Split-Brain-Patienten sprachlich nur darüber kommunizieren können, was die linke Hemisphäre verarbeitet hat. Abbildung 2.13b zeigt eine andere Testsituation. Auf dem Bildschirm wurde das Wort „Hutband“ so dargeboten, dass das Wort „Hut“ in die rechte und das Wort „Band“ in die linke Hemisphäre projiziert wurde. Fragt man, was die Person gesehen hat, so antwortet sie „Band“. Wenn sie dagegen nach der Art des Bandes gefragt wird, so erhält man alle möglichen Kombinationen – „Gummiband“, „Rockband“, „Laufband“ und anderes. „Hutband“ wird nur mit Ratewahrscheinlichkeit genannt. Tests mit anderen zusammengesetzten Wörtern (zum Beispiel „Handtasche“ und „Aktentasche“) führten zu ähnlichen Ergebnissen. Was die rechte Hemisphäre wahrnimmt, kann nicht ins Bewusstsein der linken Hemisphäre gelangen. Mit einem durchtrennten Corpus callosum scheint jede Hemisphäre vom Zugang zu den Erfahrungen der anderen Hemisphäre abgeschnitten zu sein. Verbindet man Split-Brain-Patienten die Augen und gibt ihnen ein bekanntes Objekt (beispielsweise einen Kamm, eine Zahnbürste oder einen Schlüsselbund) in die linke Hand, so scheinen sie zu wissen, worum es sich handelt, und können die Funktion des Objekts durch Gesten demonstrieren. Sie können dieses Wissen aber 67 Der Aufbau des Nervensystems ? Mutter Sprache Linke Hand Sprache Band Buch Band Linke Hand Hut Linke Hand Sprache Mutter Tasse Band (a) Hut (b) Buch (c) Abb. 2.13 Die Fhigkeiten der beiden Hemisphren. (a) Ein Split-Brain-Patient kann ein Objekt mit der linken Hand richtig ertasten, wenn der Name kurzzeitig zur rechten Hemisphre projiziert wird. Er kann aber das Objekt weder benennen, noch kann er seine Handlung beschreiben. (b) Das Wort ,,Hutband wird kurzzeitig so dargeboten, dass ,,Hut in die rechte Hemisphre und ,,Band in die linke Hemisphre gelangt. Der Patient berichtet, dass er das Wort ,,Band sieht, kann aber nicht angeben, welche Art von Band gemeint ist. (c) Eine Liste gebruchlicher Objekte (zum Beispiel sind ,,Buch und ,,Tasse enthalten) wird beiden Hemisphren gezeigt. Ein Wort der Liste (,,Buch) wird dann zur rechten Hemisphre projiziert. Bei entsprechender Aufforderung beginnt die linke Hand, das Wort zu schreiben. Der Patient wei aber nicht, was seine linke Hand geschrieben hat, und rt ,,Tasse. nicht sprachlich ausdrücken. Fragt man sie während der Manipulation des Objekts, was sie gerade machen, so haben sie keine Ahnung. Dieser Zustand hält an, solange keine sensorischen Inputs vom Objekt zur linken (sprachverarbeitenden) Hemisphäre gelangen können. Sobald aber die rechte Hand des Patienten das Objekt versehentlich berührt oder vom Objekt charakteristische Geräusche ausgehen (etwa das Klappern eines Schlüsselbunds), kann die linke Hemisphäre sofort die richtige Antwort geben. Die rechte Hemisphäre ist zwar nicht zur Sprachproduktion in der Lage, doch hat sie einige sprachliche Fähigkeiten. Sie kann die Bedeutung des Wortes „Mutter“ aus unserem ersten Beispiel erkennen, sie kann auch ein wenig schreiben. In Abbildung 2.13c ist ein Experiment dargestellt, bei dem Split-Brain-Patienten zuerst eine Liste gebräuchlicher Wörter wie „Tasse“, „Messer“, „Buch“ oder „Glas“ gezeigt wird. Diese Liste wird so lange dargeboten, dass die Wörter in beide Hemisphären gelangen können. Danach wird die Liste entfernt. Eines der Wörter (beispielsweise „Buch“) wird dann kurzzeitig auf die linke Seite des Schirms und damit in die rechte Hemisphäre projiziert. Nach der Aufforderung, das Gesehene aufzuschreiben, beginnt die linke Hand auch tatsächlich, das Wort „Buch“ zu schreiben. Die Pa- tienten können aber nicht angeben, was ihre linke Hand geschrieben hat, und raten irgendein Wort der zuvor gesehenen Liste. Sie wissen schon, dass sie etwas geschrieben haben, weil sie die Schreibbewegungen über ihren Körper wahrnehmen. Da aber zwischen der rechten Hemisphäre, die das Wort gesehen und geschrieben hat, und der linken Hemisphäre, welche die Sprache steuert, keine Kommunikation stattfindet, können sie nicht angeben, welches Wort sie geschrieben haben (Sperry, 1968, 1970; siehe auch Gazzaniga, 1985; Hellige, 1990). Spezialisierung der Hemisphren. Die Untersuchungen an Split-Brain-Patienten zeigen die funktionale Spezialisierung der beiden Hemisphären. Die linke Hemisphäre leitet die Fähigkeit, uns durch Sprache auszudrücken. Sie kann komplizierte logische Schlüsse und mathematische Denkoperationen ausführen. Die rechte Hemisphäre kann nur sehr einfache Sprache verstehen. Sie kann beispielsweise auf einfache Substantive mit der Wahl eines Objekts, etwa einer Mutter oder eines Kamms, reagieren; sie kann aber keine abstrakteren sprachlichen Formen verstehen. Auf einfache Aufforderungen wie „winken“, „jemandem zunicken“, „den Kopf schütteln“ oder „lächeln“ reagiert sie meistens nicht. 2 68 Dafür besitzt die rechte Hemisphäre hoch entwickelte Fähigkeiten für die Raumwahrnehmung und die Mustererkennung. Sie ist der linken Hemisphäre bei der Konstruktion geometrischer und perspektivischer Zeichnungen überlegen. Sie kann viel besser als die linke Hemisphäre farbige Klötze so anordnen, dass ein vorgegebenes Muster entsteht. Wenn Split-Brain-Patienten aufgefordert werden, eine solche Aufgabe mit der rechten Hand auszuführen, machen sie viele Fehler. Manchmal fällt es ihnen sogar schwer, die linke Hand daran zu hindern, diese Fehler der rechten Hand automatisch zu korrigieren. Untersuchungen mit gesunden Personen bestätigen die unterschiedliche Spezialisierung der beiden Hemisphären. Wenn verbale Informationen wie Wörter oder sinnfreie Silben kurzzeitig der linken Hemisphäre (über das rechte Gesichtsfeld) dargeboten werden, werden sie schneller und korrekter erkannt als bei Projektion in die rechte Hemisphäre. Im Unterschied dazu können Gesichter, charakteristische emotionale Gesichtsausdrücke, die Orientierung von Linien oder Stellen, an denen sich Punkte befinden, schneller erkannt werden, wenn diese Reize der rechten Hemisphäre dargeboten werden (Hellige, 1990). Auch zeigen Untersuchungen der elektrischen Gehirnaktivität mit dem Elektroencephalogramm (EEG), dass sich diese Aktivität während einer verbalen Aufgabe in der linken Hemisphäre erhöht, während die Aktivität bei einer räumlichen Aufgabe in der rechten Hemisphäre zunimmt (Kosslyn, 1988; Springer & Deutsch, 1989). Diese Ergebnisse bedeuten nicht automatisch, dass die beiden Hemisphären unabhängig voneinander arbeiten. Vielmehr ist gerade das Gegenteil der Fall. Die Hemisphären unterscheiden sich in ihren Spezialisierungen, aber sie integrieren ihre Aktivitäten fortwährend. Erst dieses Zusammenspiel macht es möglich, dass das Gehirn umfassendere und auch andere mentale Prozesse ausführen kann als jede Hemisphäre allein. Diese Unterschiede sind in den verschiedenen Anteilen jeder Hemisphre an den kognitiven Aktivitten zu erkennen. Wenn eine Person eine Geschichte liest, spielt die rechte Hemisphre eine besondere Rolle bei der Dekodierung der visuellen Information, bei der Aufrechterhaltung der integrierten Struktur der Geschichte, beim Verste- 2 Biologische Grundlagen der Psychologie hen der emotionalen und humoristischen Inhalte, beim Ableiten der Bedeutung aus erworbenen Assoziationen und beim Verstehen metaphorischer Ausdrcke. Die linke Hemisphre spielt dagegen eine besondere Rolle beim Verstehen der Syntax, bei der berfhrung der geschriebenen Wrter in eine phonetische Reprsentation und bei der Ableitung der Bedeutung aus komplexen Relationen zwischen den Begriffen und der Syntax. Es gibt aber keine Aktivitt, an der nur eine Hemisphre beteiligt ist oder zu der nur eine Hemisphre einen Beitrag leistet (Levy, 1985, S. 44). Sprache und Gehirn Ein großer Teil der Information über die Gehirnmechanismen für Sprache stammt aus der Beobachtung von Patienten mit Schädigungen des Gehirns. Solche Schädigungen können die Folge eines Tumors, einer Kopfwunde oder eines Risses in einem Blutgefäß sein. Eine Aphasien sind Sprachstörung, die durch Sprachstrungen infoleine Schädigung des Gehirns ge von Schdigungen hervorgerufen wurde, nennt des Gehirns. man Aphasie. Wie schon berichtet, beobachtete Broca, dass die Schädigung einer bestimmten Gehirnregion an der Seite des linken Frontallappens mit einer Sprachstörung einhergeht, die expressive Aphasie (auch Broca-Aphasie oder motorische Aphasie) genannt wird. Personen mit geschädigtem BrocaAreal haben Schwierigkeiten, Wörter korrekt auszusprechen, und können nur mühevoll und langsam sprechen. Ihre Sprache ergibt Sinn, besteht aber nur aus Stichwörtern. Substantive werden generell im Singular ausgesprochen; Adjektive, Adverbien, Artikel und Konjunktionen werden häufig weggelassen. Diese Personen haben aber keine Schwierigkeiten beim Verstehen gesprochener oder geschriebener Sprache. 1874 berichtete der deutsche Wissenschaftler Carl Wernicke, dass die Schädigung einer anderen Region, zwar ebenfalls in der linken Hemisphäre, aber im Temporallappen gelegen, in Beziehung zu einer anderen Sprachstörung steht, der rezeptiven Aphasie (Wernicke-Aphasie, sensorische Aphasie). Personen mit einer Schädigung dieser Region, die auch als Wernicke-Areal bezeichnet wird, sind unfähig, Wörter zu verstehen: Der Aufbau des Nervensystems Sie können Wörter zwar hören, aber verstehen ihre Bedeutung nicht. Sie können Wortfolgen ohne Schwierigkeit und in korrekter Artikulation produzieren, aber sie machen Fehler bei der Verwendung der Wörter, so dass ihre Sprache sinnleer erscheint. Indem er diese Störungen analysierte, entwickelte Wernicke ein Modell, mit dem erklärt werden sollte, wie das Gehirn Sprache produziert und versteht. Trotz des Alters von 100 Jahren scheint dieses Modell in seinen allgemeinen Merkmalen noch zuzutreffen. Norman Geschwind baute auf diesen Ideen auf und entwickelte eine Theorie, die als Wernicke-Geschwind-Modell bekannt wurde (Geschwind, 1979). Nach diesem Modell speichert das Broca-Areal artikulatorische Kodes für die Sequenz der Muskelbewegungen, die für die Aussprache eines Wortes gebraucht wird. Wenn diese Kodes zum motorischen Cortex übertragen werden, aktivieren sie von dort die Muskeln der Lippen, der Zunge und des Kehlkopfs in der richtigen Abfolge. Im Ergebnis wird ein gesprochenes Wort produziert. Im Wernicke-Areal werden dagegen auditorische Kodes und die Bedeutungen von Wörtern gespeichert. Um ein Wort auszusprechen, muss der auditorische Kode im Wernicke-Areal aktiviert und zum Broca-Areal übertragen werden. Dort aktiviert er den zugehörigen artikulatorischen Kode. Der artikulatorische Kode wiederum wird in das motorische Areal übertragen, um die Muskeln zu aktivieren und das gesprochene Wort zu produzieren. Damit ein Wort, das eine andere Person ausspricht, verstanden wird, muss es vom auditorischen Cortex zum Wernicke-Areal übertragen werden. Dort wird für die gesprochene Form des Wortes der passende auditorische Kode gesucht und auf der Grundlage dieses Abgleichs die Wortbedeutung aktiviert. Wurde ein geschriebenes Wort dargeboten, erfolgt zuerst eine Repräsentation im visuellen Cortex. Diese wird dann zum Gyrus angularis übertragen, in dem die visuelle Wortform mit dem auditorischen Kode im Wernicke-Areal assoziiert wird. Wenn dieser auditorische Kode gefunden ist, dann ist auch die Bedeutung aktiviert. Die Bedeutungen der Wörter sind also zusammen mit ihren auditorischen Kodes im Wernicke-Areal gespeichert. Das Broca-Areal speichert die artikulatorischen Kodes. Der Gyrus angularis setzt die visu- 69 elle Wortform mit ihrem auditorischen Kode in Beziehung. Weder das eine noch das andere Areal speichert jedoch Information über die Wortbedeutungen. Die Bedeutung eines Wortes wird nur dann abgerufen, wenn der entsprechende akustische Kode im Wernicke-Areal aktiviert ist. Das Wernicke-Geschwind-Modell erklärt viele der Sprachstörungen von Aphasikern. Schädigungen des Broca-Areals stören die Sprachproduktion, haben aber nur einen geringen Einfluss auf das Verstehen geschriebener und gesprochener Sprache. Schädigungen des Wernicke-Areals stören alle Aspekte des Sprachverstehens; die Personen können aber auf Grund des intakten Broca-Areals noch Wörter richtig artikulieren (wenn auch das produzierte Ergebnis keine sinnvolle Bedeutung aufweist). Das Modell sagt auch präzise vorher, dass Personen mit Schädigungen im Gyrus angularis nicht lesen können, aber keine Schwierigkeiten beim Sprechen und Verstehen gesprochener Sprache haben. Ist schließlich die Schädigung auf den auditorischen Cortex beschränkt, kann eine Person normal lesen und sprechen, aber sie kann keine gesprochene Sprache verstehen. Das autonome Nervensystem Wie bereits erwähnt, besteht das periphere Nervensystem aus zwei Teilen. Das somatische System reguliert die Skelettmuskulatur und erhält Informationen von der Haut, den Muskeln und verschiedenen Sinnesorganen. Das autonome System steuert die Tätigkeit der Drüsen und der glatten Muskulatur einschließlich des Herzens, der Blutgefäße, des Magens und der Eingeweide. Die Bezeichnung „glatt“ rührt daher, dass diese Muskeln unter dem Mikroskop glatt aussehen. (Die Skelettmuskeln sehen dagegen aus, als würden sie aus Streifen bestehen – hier spricht man von der „gestreiften“ Muskulatur.) Der Name „autonomes Nervensystem“ leitet sich von der Tatsache ab, dass viele der von diesem System gesteuerten Aktivitäten, darunter Verdauung und Blutkreislauf, als autonom oder selbstregulierend charakterisiert werden können. Die Steuerung dieser Vorgänge wird selbst dann fortgesetzt, wenn eine Person schläft oder bewusstlos ist. 2 70 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Tränendrüse Auge Mittelhirn Nasenschleimhaut Gaumen Rachen Ohrspeicheldrüse Medulla oblongata Auge Nasenschleimhaut Ohrspeicheldrüse Unterzungen- und Unterkieferspeicheldrüsen Unterzungen- und Unterkieferspeicheldrüsen Lungen Lungen Bronchien Bronchien Th1 Herz Herz Leber Parasympathisch Sympathisch Leber Magen Bauchspeicheldrüse Milz Th12 Magen L1 Dünndarm Dickdarm Dünndarm Niere Dickdarm Autonomer Plexus Niere Autonomer Plexus S2 Nebennierendrüse Dickdarm Dickdarm Rectum Genitalien Ureters Harnleiter Harnblase Rectum Beckeneingeweidenerven Harnleiter Harnblase Genitalien Abb. 2.14 Motorische Fasern des autonomen Nervensystems. Das sympathische Teilsystem ist rechts, das parasympathische Teilsystem links vom Rckenmark dargestellt. Durchgezogene Linien stehen fr prganglionre Fasern; gestrichelte Linien fr postganglionre Fasern. Neurone des sympathischen Teilsystems beginnen im Brustund Lendenwirbelbereich. Sie bilden synaptische Schaltstellen mit Ganglienzellen auerhalb des Rckenmarks. Neurone des parasympathischen Teilsystems gehen von der Medullaregion des Gehirnstamms und vom unteren sakralen Teil des Rckenmarks aus. Sie werden auf Ganglien umgeschaltet, die in der Nhe der stimulierten Organe liegen. Die meisten inneren Organe werden durch beide Teilsysteme antagonistisch beeinflusst. 71 Der Aufbau des Nervensystems Das autonome Nervensystem besteht aus zwei Teilsystemen, dem sympathischen und dem parasympathischen NervenDas sympathische system. Die Wirkungen der Nervensystem domibeiden Teilsysteme sind niert whrend Phasen weitgehend antagonistisch. von Erregung, whrend Das sympathische Nervendas parasympathische Nervensystem in system dominiert üblicherweise während Phasen starRuhephasen die Steueker Erregung, das parasymrung bernimmt. pathische Nervensystem steht dagegen in enger Verbindung mit Ruhe. Abbildung 2.14 zeigt die gegensätzlichen Effekte der beiden Teilsysteme auf die verschiedenen Organe. Das parasympathische System verengt die Pupille des Auges, regt den Speichelfluss an und senkt die Herzschlagfrequenz. Das sympathische System hat in diesen Fällen dagegen die jeweils gegenteilige Wirkung. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Teilsystemen hält den Normalzustand des Körpers aufrecht (irgendwo zwischen extremer Erregung und vegetativer Entspanntheit). Der sympathische Teil scheint als Gesamtheit zu agieren. In einem emotionalen Erregungszustand werden simultan die Herzschlagfrequenz erhöht, die Arterien der Skelettmuskeln und des Herzens erweitert, die Arterien der Haut und der Verdauungsorgane verengt und Schwitzen ausgelöst. Bestimmte endokrine Drüsen werden zur Hormonsekretion veranlasst, wodurch das Erregungsniveau weiter steigt. Im Unterschied zum sympathischen Teilsystem beeinflusst das parasympathische System zu jedem Zeitpunkt nur ein Organ; in Phasen der Ruhe obliegt ihm die Vorherrschaft. Es ist an der Regulation der Verdauung beteiligt und verwaltet und schützt ganz allgemein die Ressourcen des Körpers. Eine verminderte Herzschlagfrequenz und verlangsamte Atmung, die beide durch das parasympathische Teilsystem aufrechterhalten werden, erfordern beispielsweise weit weniger Energie als ein erhöhter Puls und eine schnelle Atmung, die wiederum das Ergebnis einer Aktivierung des sympathischen Teilsystems sind. Obwohl das sympathische und das parasympathische Teilsystem in der Regel antagonistisch wirken, gibt es bestimmte Ausnahmen. So dominiert zum Beispiel das sympathische System bei Furcht und Erregung; eine keineswegs unge- wöhnliche Furchtreaktion des parasympathischen Systems ist jedoch die unwillkürliche Entleerung der Blase oder des Darms. Ein anderes Beispiel stellt die Regulation des männlichen Sexualverhaltens dar, die darin besteht, dass einer parasympathisch gesteuerten Erektion eine sympathisch gesteuerte Ejakulation folgt. 2 zusammengefasst Das Nervensystem lsst sich einteilen in das zentrale Nervensystem (bestehend aus Gehirn und Rckenmark) und das periphere Nervensystem (die Nerven, die das Gehirn und Rckenmark mit anderen Regionen des Krpers verbinden). Das periphere Nervensystem ist weiterhin unterteilt in das somatische System, das Informationen zu den Sinnesrezeptoren, den Muskeln und der Krperoberflche und von dort zurck bertrgt, und das autonome System, welches die Verbindung zu den inneren Organen und den Drsen herstellt. Das Bndel von Nervenfasern, das die beiden Hemisphren des Gehirns miteinander verbindet, wird Balken oder Corpus callosum genannt. Eine Schdigung des Balkens resultiert in deutlichen Unterschieden in der Funktionsweise beider Hemisphren. Die linke Hemisphre ist gebt in sprachlichen und mathematischen Fhigkeiten. Die rechte Hemisphre kann dagegen zwar ein wenig Sprache verstehen, Kommunikation ber Sprache ist ihr allerdings nicht mglich. Dafr sind in ihr rumliches Vorstellungsvermgen und Mustererkennungsfhigkeit hoch entwickelt. Das autonome System besteht aus dem sympathischen und dem parasympathischen Teilsystem. Das sympathische System ist whrend Phasen von Erregung aktiv, das parasympathische System dominiert bei Ruhe. nachgefragt 1. Warum ist unser Gehirn symmetrisch (in dem Sinn, dass die rechte und die linke Hlfte gleich aussehen)? Wir besitzen einen linken und einen rechten motorischen Cortex, einen linken und einen rechten Hippocampus, ein linkes und ein rechtes Kleinhirn und so weiter. In jedem Fall ist die linke Seite ein Spiegelbild der rechten Seite, so wie das linke Auge zum Beispiel ein Spiegelbild des rechten Auges ist. Warum besitzt das Gehirn wohl diese Symmetrie? 72 2 Biologische Grundlagen der Psychologie 2. Bei Split-Brain-Patienten, deren Corpus callosum durchtrennt ist, scheinen die rechte und die linke Hlfte des Gehirns nach der Operation unabhngig zu arbeiten. Eine Hlfte, der ein Wort gezeigt wird, kann das Wort lesen und darauf reagieren, ohne dass die andere Hlfte etwas davon wei. Hat eine solche Person zwei Geistes- und Gedankenwelten, die jeweils Unterschiedliches wissen und tun? Oder haben solche Patienten trotzdem nur einen Verstand? Das endokrine System Man kann sich das Nervensystem als eine Instanz vorstellen, die durch eine direkte Aktivierung der Muskeln und Drüsen die schnellen Änderungen von Aktivitäten des Körpers steuert. (Die Drüsen sind überall im Körper verteilte Organe, die Substanzen wie Schweiß, Milch oder ein bestimmtes Hormon erzeugen und abgeben.) Das endokrine System ist in seiner Wirkung wesentlich langsamer. Es beeinflusst die Aktivitäten von Zellgruppen überall im Körper nur indirekt. Diese Beeinflussung erfolgt über die Hormone. Hormone sind chemische Stoffe, die Hormone sind chemivon den endokrinen Drüsen sche Stoffe, die von den in den Blutstrom abgegeben endokrinen Drsen in und so zu anderen Teilen den Blutstrom abgedes Körpers transportiert geben werden und in werden, wo sie spezifische anderen Teilen des Effekte auf diejenigen Zellen Krpers spezifische Wirkungen hervorrufen. haben, die ihre Botschaft ,verstehen‘ (siehe Abbildung 2.15). Hormone wirken auf unterschiedliche Zelltypen verschieden. Jede Zielzelle ist mit Rezeptoren ausgestattet, die nur diejenigen Hormonmoleküle erkennen, die für diese Zelle Botschaften tragen. Die Rezeptoren entnehmen dem Blutstrom die Hormonmoleküle und bringen sie in das Zellinnere. Einige endokrine Drüsen werden durch das Nervensystem aktiviert, andere durch Änderungen im inneren chemischen Zustand des Körpers. Eine der wichtigsten endokrinen Drüsen ist die Hypophyse oder Hirnanhangdrüse. Diese Drüse ist eine Ausstülpung des Gehirns und befindet sich direkt unter dem Hypothalamus (siehe Abbildung 2.8c). Sie wird auch die „zentrale Drüse“ genannt, weil sie die größte Anzahl unter- schiedlicher Hormone produziert und die Sekretionsaktivität von anderen endokrinen Drüsen reguliert. Eines der Hypophysenhormone, das sogenannte Wachstumshormon, hat die wichtige Aufgabe, das Körperwachstum zu steuern. Zu wenig von diesem Hormon führt zu Zwergwuchs, zu viel erzeugt Riesenwuchs. Andere Hormone der Hypophyse lösen die Aktivität von endokrinen Drüsen wie etwa der Schilddrüse, den Gonaden oder der äußeren Schicht der Nebennieren aus. Bei vielen Tieren beruhen die Verhaltensweisen beim Werben beziehungsweise Balzen, bei der Paarung und bei der Fortpflanzung auf einer komplexen Wechselwirkung zwischen der Aktivität des Nervensystems und dem Einfluss der Hypophyse auf die Geschlechtsdrüsen. Die Beziehung zwischen der Hypophyse und dem Hypothalamus veranschaulicht die komplexen Interaktionen. Bestimmte Neurone im Hypothalamus schütten bei Stress (Furcht, Angst, Schmerz, emotionale Ereignisse und so weiter) das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) aus, das durch eine kanalähnliche Struktur zur Hypophyse gelangt. CRH stimuliert die Hypophyse zur Freisetzung des adrenocorticotropen Hormons (ACTH), des wichtigsten Stresshormons des Körpers. ACTH wiederum wird über den Blutstrom zu den Nebennieren und anderen Organen gebracht, in denen es die Freisetzung von etwa 30 Hormonen auslöst. Jedes dieser Hormone hat eine Funktion bei der Einstellung des Körpers auf eine Gefahrensituation. Beispielsweise steigt der zelluläre Glucosebedarf in einem Zustand von Gefahr, und das Nebennierenhormon Kortisol, das während Stressphasen ausgeschüttet wird, fördert die Freisetzung von Glucose aus Fettspeichern im Körper. Interessanterweise übt Kortisol auch eine Wirkung auf kognitive Funktionen aus: In niedriger Konzentration steigert es Gedächtnisleistungen, hoch konzentriert führt es jedoch zu Gedächtnisbeeinträchtigungen sowie zum Absterben von Neuronen. Die Nebennieren beeinflussen die Stimmung einer Person, ihr Energieniveau und ihre Fähigkeit zum Umgang mit Stress. Der innere Teil der Nebennieren, das Nebennierenmark, setzt Adrenalin (Epinephrin) und Noradrenalin (Norepinephrin) frei. Adrenalin versetzt den Organismus in Bereitschaft für eine Gefahrensituation. Zusammen mit dem sympathischen 73 Das endokrine System Teil des autonomen Nervensystems wird die Tätigkeit der glatten Muskulatur und der Schweißdrüsen beeinflusst. Adrenalin erzeugt auch eine Verengung der Blutgefäße des Magens und der Eingeweide sowie eine Erhöhung der Herzschlagfrequenz. Auch Noradrenalin (Norepinephrin) bereitet den Organismus für den Umgang mit einer Gefahrensituation vor. Es stimuliert die Hypophyse zur Ausschüttung eines Hormons, das auf die äußere Schicht der Nebennieren, die Nebennierenrinde, wirkt. Dieses Hormon wiederum regt in 2 Hypothalamus Hypophyse Epiphyse Nebenschilddrüse auf der Rückseite der Schilddrüse Schilddrüse Thymusdrüse Nebennierendrüse Ovarien (bei Frauen) Hoden (bei Männern) Abb. 2.15 Einige endokrine Drsen. Die Ausschttung von Hormonen durch endokrine Drsen ist fr die Integration der Aktivitt des Organismus genauso wichtig wie das Nervensystem. Die beiden Systeme unterscheiden sich aber in der Geschwindigkeit, mit der sie agieren beziehungsweise reagieren knnen. Ein Nervenimpuls kann den Krper in einigen Hundertstel Sekunden durchwandern. Die endokrinen Drsen brauchen Sekunden oder sogar Minuten, um einen Effekt zu erzielen. Die ausgeschtteten Hormone mssen ber den Blutstrom zu den Zielorten wandern. Dieser Prozess dauert bedeutend lnger. 74 2 Biologische Grundlagen der Psychologie der Leber die Erhöhung des Zuckerspiegels an, um dem Körper die nötige Energie für eine schnelle Reaktion zur Verfügung zu stellen. Die Hormone des endokrinen Systems und die Neurotransmitter der Neurone dienen ähnlichen Funktionen. Beide übermitteln Botschaften zwischen den Zellen. Ein Neurotransmitter überträgt Botschaften zwischen benachbarten Neuronen; seine Wirkungen sind daher örtlich sehr begrenzt. Demgegenüber kann ein Hormon lange Wege im Körper zurücklegen und auf viele verschiedene Zelltypen unterschiedlich wirken. Trotz dieser Unterschiede üben einige dieser chemischen Botenstoffe beide Funktionen aus. So wirken Adrenalin und Noradrenalin als Neurotransmitter, wenn sie von einem Neuron freigesetzt werden, und als Hormone, wenn sie von den Nebennieren ausgeschüttet werden. zusammengefasst Die endokrinen Drsen schtten Hormone in den Blutkreislauf aus. Diese wandern durch den Krper und knnen auf verschiedene Zelltypen in unterschiedlichster Weise wirken. Die Hypophyse steuert die Sekretionsaktivitt anderer endokriner Drsen. nachgefragt 1. Wenn Hormone in den Blutkreislauf sekretiert werden, sind sie in der Lage, jede Zelle des Krpers zu erreichen. Wie ist es dann mglich, dass die Hormone bei bestimmten Gewebearten im Krper selektive Wirkungen ausben? Sind Analogien zur synaptischen bertragung im Gehirn denkbar? 2. Im Winter erwrmt die Heizung die Luft im Innern eines Hauses, und der Thermostat erkennt, wenn die Temperatur der Luft im Haus das vorgegebene Niveau erreicht. Auf welche Weise knnte sich das endokrine System dieses Prinzip zu Nutze machen, um die Hormonkonzentrationen im Blutkreislauf aufrechtzuerhalten? Welche zentrale Drse knnte wohl als ,,Thermostat des endokrinen Systems fungieren? Evolution, Gene und Verhalten Um die biologischen Grundlagen der Psychologie wirklich verstehen zu können, brauchen wir sowohl Wissen über evolutionäre und genetische Einflüsse als auch über biologische Strukturen und Prozesse. Alle biologischen Organismen haben sich über Jahrmillionen hinweg entwickelt, und dabei spielten Umweltfaktoren eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Aufbau und Funktion der jeweiligen Nervensysteme. Charles Darwin nannte den Prozess, mit dem sich evolutionsbedingte Veränderungen erklären lassen, natürliche Selektion; sie spielt bei der Ausformung sowohl des Verhaltens als auch des Gehirns eine entscheidende Rolle. Das Gebiet der Verhaltensgenetik verbindet die Methoden der Genetik und der Psy- Die Verhaltensgenetik untersucht die Vererchologie, um den Einfluss bung psychischer der Vererbung von Verhal- Merkmale. tensmerkmalen zu untersuchen (Plomin, Owen & McGuffin, 1994). Es ist bekannt, dass viele physische Merkmale – beispielsweise Körpergröße, Knochenstruktur, Haar- und Augenfarbe – vererbt werden. Die Verhaltensgenetik möchte herausfinden, in welchem Ausmaß auch psychische Merkmale wie geistige Fähigkeiten, Temperament und emotionale Stabilität von den Eltern auf die Nachkommen vererbt werden (Bouchard, 1984, 1995). Eine Forschungsgruppe unter Robert Plomin am Institut für Psychiatrie in London hat chromosomale Marker identifiziert, die zur Ausprägung von Intelligenz beitragen (Fisher et al., 1999). Allerdings sind solche Ergebnisse nicht als endgültig zu betrachten. Im nächsten Abschnitt wird deutlich werden, dass Umweltbedingungen einen großen Einfluss darauf haben, wie sich genetische Faktoren auf die Entwicklung eines Individuums auswirken. Evolution, Gene und Verhalten Verhaltensevolution Jede Betrachtung von Verhalten darf nicht bloß die unmittelbaren Ursachen des Verhaltens einschließen wie etwa das Feuern von Motoneuronen im Rückenmark, welches den Kniesehnenreflex auslöst, sondern auch die eigentlichen Ursachen. Eigentliche Ursachen von Verhalten erklären dieses in seinem evolutionären Kontext. Während unmittelbare Ursachen uns verraten, „wie“ ein Verhalten entsteht, verhelfen uns die eigentlichen Ursachen in erster Linie zu dem Verständnis, „warum“ eine Verhaltensweise überhaupt existiert – das heißt, warum sie durch natürliche Selektion entstanden ist. Betrachten wir uns zum Beispiel das männliche Aggressionsverhalten (siehe den Exkurs am Ende dieses Kapitels). Sowohl bei Menschen als auch bei anderen Säugetieren sind die männlichen Individuen typischerweise aggressiver als die weiblichen (Buss & Shackelford, 1997); dies gilt insbesondere bei gleichgeschlechtlichen Interaktionen. Bei Säugetierarten, deren sexuelle Fortpflanzung jahreszeitabhängig gesteuert wird, ist die Aggression zwischen den Männchen während der Paarungszeit besonders stark ausgeprägt. Bei Rotwild und Seeelefanten zum Beispiel versuchen die Männchen, für die Paarung kleine Gruppen von Weibchen („Harems“) unter ihrer Kontrolle zu halten, und reagieren aggressiv auf andere Männchen, die den Versuch unternehmen, sich mit einem dieser Weibchen zu paaren. Die unmittelbaren Ursachen für aggressives Verhalten sind ziemlich gut erforscht. Beispielsweise ist die Blutkonzentration des Geschlechtshormons Testosteron mit aggressivem Verhalten korreliert. Ebenso hat man herausgefunden, dass eine Schädigung subcortikaler Gehirnareale bei Tieren das Auftreten von aggressiven Verhaltensweisen reduzieren oder auch erhöhen kann. Neuere Befunde weisen darauf hin, dass Serotonin eine wichtige Rolle bei aggressivem Verhalten spielt (Nelson & Chiavegatto, 2001) und dass zumindest bei Nagetieren das männliche Aggressionsverhalten durch Geruchshinweisreize vermittelt wird (Stowers, Holy, Meister, Dulac & Koenteges, 2002). Darüber hinaus moduliert der soziale Kontext sehr stark die Art und das Muster aggressiver Handlungsweisen. Während der Paarungszeit bauen sich Rothirsche und See- 75 elefanten-Bullen vor männlichen Konkurrenten auf und greifen diese an, wenn sie sich zu nahe heranwagen; sie attackieren aber nicht die paarungsfähigen Weibchen. Weshalb gibt es jedoch überhaupt aggressives Verhalten und die zu Grunde liegenden neuronalen und hormonalen Regulationsmechanismen? Was sind die eigentlichen Ursachen von Aggression? Aus einer evolutionären oder funktional ausgerichteten Perspektive kann man männliches Aggressionsverhalten bei der Paarung als adaptiv bezeichnen: Es gewährleistet Erfolg bei der Fortpflanzung, und erfolgreiche Fortpflanzung unterstützt das Fortbestehen jener Gene, die das aggressive Verhalten steuern. Aggressive Rothirsche können sich empfängnisbereite Weibchen eher sichern und sich mit ihnen paaren; dadurch erhöht sich der Anteil der Männchen in der nachfolgenden Generation, welche die Gene für Aggressivität besitzen. Wenig aggressive Rothirsche haben dagegen nur geringe Chancen, sich ein zur Paarung geeignetes Weibchen zu ,reservieren‘; ihre Gene werden folglich in der Rotwildpopulation immer seltener. Dies bedeutet nicht, dass aggressives Verhalten aus ethischer oder moralischer Sicht ,gut‘ ist, sondern es ist adaptiv im Kontext der Evolution. Da aggressives Verhalten durch Wettbewerb um Paarungsgelegenheiten ausgelöst wird, bezeichnet man es auch als Unter sexueller Seleksexuell selektiert. Sexuelle tion versteht man einen Selektion stellt einen Spezial- Spezialfall der natrlifall der natürlichen Selektion chen Selektion. Sie dar. Sie bringt im Geschlecht bringt im Geschlecht mit der potenziell größeren mit der potenziell Reproduktionsrate Eigen- greren Reproduktischaften hervor, die eine er- onsrate Eigenschaften folgreiche Fortpflanzung be- hervor, die eine erfolgreiche Fortpflanzung günstigen. Bei Rotwild ist begnstigen. die Reproduktionsrate der Weibchen durch ihre Trächtigkeit und Stillzeit begrenzt. Für die Männchen wird die Möglichkeit sich fortzupflanzen dagegen allein durch die Anzahl der verfügbaren Weibchen beschränkt. Bei einigen Vogelarten ist die männliche Fortpflanzungsrate geringer als die weibliche, weil die Männchen im Nest bleiben, um die Eier auszubrüten, während die Weibchen auf die Suche nach weiteren männlichen Partnern gehen, mit denen sie sich dann paaren. In diesem Fall zeigen die Weibchen ein ausgeprägteres Aggressionsver- 2 76 2 Biologische Grundlagen der Psychologie halten als die Männchen. Generell werden beim Geschlecht mit der größeren Fortpflanzungsrate stets diejenigen Eigenschaften selektiert, mit deren Hilfe man sich seine Paarungspartner besser sichern kann. Diese Eigenschaften sind nicht nur auf Verhaltensneigungen wie etwa Aggression begrenzt, sondern schließen auch körperliche Merkmale wie beispielsweise Körpergröße und Färbung ein. P P D C P P D T A P D D P T AD P Chromosome und Gene Natürliche Selektion funktioniert über Gene. Gene sind Segmente auf Molekülen der Desoxyribonukleinsäure (DNA), welche die elementaren Erbkomponenten bilden. Die Gene, die wir von unseren Eltern erhalten und an unsere Nachkommen weitergeben, befinden sich auf Strukturen im Kern jeder Körperzelle, den Chromosomen. Die meisten menschlichen Körperzellen haben 46 Chromosome. Jedes Individuum erhält bei der Befruchtung 23 Chromosome von den Spermien des Vaters und 23 Chromosome von der Eizelle der Mutter. Diese 46 Chromosome bilden 23 Paare, die sich bei jeder Zellteilung verdoppeln Abb. 2.16 Chromosome. Diese Fotographie zeigt in starker Vergrerung die 46 Chromosome einer Frau. Bei einem Mann wren die Paare 1 bis 22 die gleichen, aber das Paar 23 wre beim Mann ein XY-Paar und nicht, wie bei der Frau, ein XX-Paar. D G P D A D T P P D G C D P D C P G D P D P P A T D P Abb. 2.17 Die Struktur eines DNA-Molekls. Jeder Strang des Molekls besteht aus einer alternierenden Abfolge von Desoxyribose (D) und Phosphat (P). Die Sprossen der verdrehten Leiter setzen sich aus den Basen (Adenin A, Guanin G, Thymin T, Cytosin C) zusammen. Die Doppelnatur der Helix und die Einschrnkungen bei den mglichen Paarungen der Basen ermglichen die Selbstreplikation der DNA. Im Prozess der Zellteilung treffen sich die beiden Strnge der DNA, wobei sich die Basenpaare aufspalten: Je ein Element eines Paares bleibt bei einem Strang. Jeder Strang bildet dann einen neuen komplementren Strang, indem er berschssige Basen benutzt, die in der Zelle zur Verfgung stehen. Dabei binden sich immer nur die Basen A und T sowie C und G wechselseitig. Durch diesen Prozess entstehen zwei identische DNA-Molekle. (siehe Abbildung 2.16). Ein DNA-Molekül sieht wie eine verdrehte Leiter oder eine Spirale aus zwei Strängen (Doppel-Helix) aus (siehe Abbildung 2.17). Jedes Gen übergibt ko- Ein Gen ist ein Segment dierte Instruktionen an die eines DNA-Molekls Zelle, wodurch diese zur und bildet die basale Ausübung einer bestimmten Einheit des ErbmateFunktion (gewöhnlich die rials. Evolution, Gene und Verhalten Herstellung eines bestimmten Proteins) angeleitet wird. Obwohl jede Körperzelle dieselben Gene besitzt, ist jede einzelne Zelle spezialisiert, da stets nur fünf bis zehn Prozent der Gene in einer Zelle aktiv sind. Im Laufe der Entwicklung aus der befruchteten Eizelle schaltet jede Zelle einige Gene ein und die restlichen aus. Wenn beispielsweise ,Nervengene‘ aktiv sind, entwickelt sich die Zelle zu einem Neuron. Diese Gene weisen die Zelle an, diejenigen Stoffe herzustellen, die für die Übernahme neuronaler Funktionen notwendig sind. Diese Entwicklung wäre nicht möglich, wenn nicht irrelevante Gene wie etwa ,Muskelgene‘ abgeschaltet wären. Gene bilden wie Chromosome Paare. Ein Gen eines Paares kommt von einem Chromosom einer Spermienzelle, das anChromosome sind dere Gen kommt von einem Strukturen im Kern jeChromosom der Eizelle. Auf der Krperzelle. diese Weise erhält ein Kind von jedem Elternteil nur die Hälfte der jeweiligen Chromosome. Die Gesamtzahl der Gene in einem menschlichen Chromosom liegt bei etwa 1000, vielleicht auch darüber. Da die Anzahl der Gene so groß ist, ist es extrem unwahrscheinlich, dass zwei Menschen den gleichen Satz an Genen erben, selbst wenn sie Geschwister sind. Die einzige Ausnahme bilden eineiige Zwillinge mit exakt gleichen Genen, weil sie sich aus einem einzigen Ei entwickelt haben. Dominante und rezessive Gene. Jedes der Gene eines Paares kann dominant oder rezessiv sein. Sind beide Gene eines Paares dominant, so treten bei dem Individuum die Merkmale auf, die durch diese Gene bestimmt sind. Wenn ein dominantes Gen zusammen mit einem rezessiven Gen ein Paar bildet, so bestimmt wiederum das dominante Gen die auftretenden Merkmalsausprägungen des Individuums. Nur wenn beide Elternteile rezessive Gene zu einem Paar beitragen, setzt sich die rezessive Form der Merkmale durch. Betrachten wir beispielsweise die Gene für die Augenfarbe. Blau ist dabei rezessiv, und braun ist dominant. Ein Kind mit blauen Augen kann also zwei Elternteile mit jeweils blauen Augen haben oder ein Elternteil mit blauen und ein Elternteil mit braunen Augen (das zugleich ein rezessives Gen für blaue Augen trägt) oder aber zwei Elternteile mit braunen Augen (jedes hat dann auch ein rezessives Gen 77 für blaue Augen). Ein Kind mit braunen Augen hat dagegen niemals zwei Elternteile mit jeweils blauen Augen. Einige weitere Merkmale, die durch rezessive Gene übergeben werden, sind Kahlköpfigkeit, Albinismus, Hämophilie und Allergie gegen den kletternden Giftsumach (Toxicodendron radicans), eine Efeuart. Die meisten Merkmale eines Menschen sind nicht durch ein einzelnes Genpaar bestimmt. Es gibt allerdings einige wichtige Ausnahmen, bei denen ein einziges Gen eine große Rolle spielt. Von besonderer Bedeutung sind aus psychologischer Sicht Krankheiten wie die Phenylketonurie (PKU) und die Chorea Huntington oder Huntington-Krankheit, die beide mit einer Degenerierung des Nervensystems und damit verbundenen Verhaltensproblemen sowie kognitiven Defiziten einhergehen. Die Gene, die diese Störungen hervorrufen, sind von Genetikern mittlerweile identifiziert worden. Die PKU geht auf die Wirkung eines rezessiven Gens zurück, das von beiden Elternteilen vererbt wurde. Der Säugling kann eine bestimmte Aminosäure (Phenylalanin) nicht verdauen, die sich dann im Körper ansammelt, das Nervensystem vergiftet und irreversible Gehirnschäden hervorruft. Kinder mit PKU sind hochgradig retardiert und leben gewöhnlich nicht länger als 30 Jahre. Wenn die Erkrankung schon bei der Geburt entdeckt wird und der Säugling dann unverzüglich eine Diät einhält, die den Phenylalaninspiegel im Körper niedrig hält, stehen die Chancen gut, bei guter Gesundheit und intakter Intelligenz alt zu werden. Als die Lokalisation des PKU-Gens noch nicht bekannt war, konnte die Erkrankung frühestens drei Wochen nach der Geburt diagnostiziert werden. Ein einziges dominantes Gen verursacht die Huntington-Krankheit. Der langfristige Verlauf der Krankheit zeigt sich in der Degeneration bestimmter Gehirnareale sowie in einer voranschreitenden Zustandsverschlechterung über zehn bis 15 Jahre hinweg. Personen mit dieser Krankheit verlieren nach und nach die Fähigkeit, zu sprechen und ihre Bewegungen zu kontrollieren. Sie zeigen einen deutlichen Gedächtnisverlust und einen Abbau ihrer geistigen Fähigkeiten. Die Krankheit bricht im Allgemeinen im Alter von 30 bis 40 Jahren aus; davor gibt es keine Anzeichen für die Erkrankung. 2 78 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Da das Huntington-Gen mittlerweile ebenfalls isoliert werden konnte, kann das Erkrankungsrisiko einer Person bestimmt werden, indem man diagnostiziert, ob sie das Gen trägt oder nicht. Nach heutigem Stand kann die Erkrankung nicht geheilt werden; allerdings wurde zumindest das Protein identifiziert, das durch dieses Gen produziert wird. Dies könnte ein Schlüssel für eine Behandlung der Erkrankung sein. Geschlechtsgebundene Gene. Eine gesunde Frau besitzt zwei ähnlich aussehende Chromosome im Paar 23, die sogenannten X-Chromosome. Beim Mann enthält das Paar 23 nur ein X-Chromosom; das zweite Chromosom sieht etwas anders aus und wird Y-Chromosom genannt (siehe Abbildung 2.16). Daher bezeichnet man das normale weibliche Chromosomenpaar mit XX und das männliche Paar mit XY. Frauen mit ihren beiden X-Chromosomen sind vor rezessiven Merkmalen auf diesem Chromosom geschützt. Bei Männern, die ein X- und ein Y-Chromosom tragen, kommen mehr rezessive Merkmale zum Ausdruck, weil ein Gen, das sich auf einem der beiden Chromosome befindet, keine Gegenwirkung eines dominanten Gens auf dem anderen Chromosom erfährt. Genetisch bedingte Merkmale und Funktionsstörungen, die mit dem 23. Chromosomenpaar verbunden sind, werden als Geschlechtsmerkmale oder geschlechtsgebundene Funktionsstörungen bezeichnet. Ein rezessives geschlechtsgebundenes Merkmal ist beispielsweise die Farbenblindheit. Ein Mann ist farbenblind, wenn das X-Chromosom, das er von seiner Mutter erhielt, das Gen für Farbenblindheit trägt. Unter Frauen kommt Farbenblindheit seltener vor, da eine farbenblinde Frau sowohl einen farbenblinden Vater als auch eine Mutter haben muss, die entweder auch farbenblind ist oder ein rezessives Gen für Farbenblindheit trägt. Genetische Verhaltensstudien Manchmal legen einzelne Gene bestimmte Merkmale fest, aber die meisten menschlichen Merkmale resultieren aus einem Zusammenspiel vieler Gene: Sie sind polygenetisch festgelegt. Merkmale wie Intelligenz, Körpergröße und Emotionalität lassen sich nicht in klar unterscheidbare Kategorien einteilen, sondern variieren kontinuierlich. Die meisten Menschen sind weder ausgesprochen dumm noch besonders klug; Intelligenz ist über einen breiten Bereich verteilt, wobei sich die meisten Menschen etwa in der Mitte befinden. Es kommt zwar vor, dass ein bestimmter genetischer Defekt zur geistigen Retardierung führt, aber im Allgemeinen beeinflusst eine große Anzahl verschiedener Gene diejenigen Faktoren, die den verschiedenen Fähigkeiten einer Person zu Grunde liegen und die somit ihr geistiges Potenzial bestimmen. Wie wir im Folgenden noch erörtern werden, hängt es aber natürlich von Umweltfaktoren ab, was aus diesem genetischen Potenzial letztlich wird (Plomin, Owen & McGruffin, 1994). Selektive Zchtung. Eine Untersuchungsmethode zur Merkmalsvererbung bei Tieren ist die selektive Züchtung. Dabei werden solche Tiere miteinander gepaart, die übereinstimmend besonders Bei der selektiven hohe oder aber niedrige Aus- Zchtung werden Tiere miteinander gepaart, prägungen auf einem Merkdie entweder besonders mal ihres Verhaltens oder ih- hohe oder besonders rer körperlichen Beschaffen- niedrige Ausprgungen heit aufweisen. In einer älte- auf einem Merkmal ihren Untersuchung zur Lern- res Verhaltens oder ihfähigkeit wurden weibliche rer krperlichen BeRatten, die beim Erlernen schaffenheit aufweisen. eines Labyrinths schlecht abschnitten, mit männlichen Ratten gepaart, die ebenfalls keine gute Lernleistung erzielt hatten. Umgekehrt wurden weibliche Tiere mit guten Lernresultaten mit entsprechenden männlichen Tieren gepaart. Die Nachkommen dieser Paare wurden mit dem gleichen Labyrinth getestet. Nach einigen Generationen war ein ,kluger‘ und ein ,dummer‘ Rattenstamm gezüchtet (siehe Abbildung 2.18). Solch eine Züchtung bringt aber nicht zwangsläufig mehr oder weniger intelligente Tiere hervor. Von einem Tier mit weniger starker Furchtausprägung beispielsweise würde man eine bessere Leistung in der Labyrinthaufgabe erwarten, da es die Vorrichtung wahrscheinlich intensiver erkunden würde. Mit selektiver Zucht konnte die Erblichkeit mehrerer Verhaltensmerkmale belegt werden. Solche Zuchtergebnisse führten zu besonders 79 Evolution, Gene und Verhalten 300 Mittlerer Fehler 250 "Dumme" Ratten "Kluge" Ratten 200 150 100 1 2 3 4 5 6 Generationen Abb. 2.18 Vererbung beim Labyrinthlernen von Ratten. Mittlere Fehlerraten von ,klugen und ,dummen Ratten im Laufe eines selektiven Zchtungsprozesses. (Nach Thompson, 1954.) reizbaren oder aber besonders lethargischen Hunden, zu besonders aggressiven oder sexuell sehr aktiven Küken, zu Fruchtfliegen, die sich vom Licht mehr oder weniger angezogen fühlen, und schließlich zu Mäusen, die Alkohol gerne mögen oder aber gerade nicht mögen. Wenn ein Verhaltensmerkmal durch Vererbung beeinflusst wird, dann sollte es durch selektive Züchtung auch verändert werden können. Wir können umgekehrt davon ausgehen, dass ein Merkmal, das durch Züchtung nicht verändert werden kann, vor allem von Umweltfaktoren abhängt (Plomin, 1989). Zwillingsstudien. Da es offensichtlich unethisch ist, Züchtungsexperimente mit Menschen in Erwägung zu ziehen, müssen wir uns hier auf Ähnlichkeiten im Verhalten von verwandten Personen stützen. Es gibt Merkmale, die in bestimmten Familien immer wieder auftreten. Familienmitglieder sind aber nicht nur genetisch verwandt, sondern sie teilen auch die gleiche Umwelt. Wenn eine musikalische Begabung ,in der Familie liegt‘, wissen wir nicht, ob es sich dabei um ein vererbtes Merkmal handelt oder ob der Einfluss darin besteht, dass die Eltern auf Musik besonderen Wert legen. Die Söhne alkoholkranker Väter werden häufiger alkoholkrank als andere Menschen. Geht dies hauptsächlich auf genetische Faktoren oder auf Umweltbedingungen zurück? Um solche Fragen beantworten zu können, haben sich Psychologen der Untersuchung von Zwillingen zugewandt. Von besonderem Interesse sind dabei adoptierte Zwillinge, die in verschiedenen Umwelten aufgewachsen sind. Eineiige Zwillinge entwickeln sich aus einer einzigen befruchteten Eizelle. Daher tragen sie auch exakt identische Gene. (Sie werden auch als monozygotische Zwillinge bezeichnet. „Zygote“ bedeutet „befruchtetes Ei“.) Zweieiige (dizygotische) Zwillinge entwickeln sich aus zwei verschiedenen Eizellen. Sie sind sich daher genetisch nicht ähnlicher als normale Geschwister. Durch den Vergleich von eineiigen mit zweieiigen Zwillingen lassen sich die Einflüsse der Vererbung und der Umwelt trennen. Eineiige Zwillinge sind sich in ihrer Intelligenz ähnlicher als zweieiige Zwillinge, selbst wenn sie bei Geburt getrennt wurden und in unterschiedlichen familiären Umwelten aufgewachsen sind (siehe Kapitel 13). Eineiige Zwillinge sind sich auch in einigen Persönlichkeitsmerkmalen und in der Anfälligkeit für Schizophrenie ähnlicher als zweieiige Zwillinge (siehe Kapitel 15). Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Menge an grauer Substanz im Gehirn, wie sie etwa durch MRT gemessen werden kann, bei eineiigen Zwillingen stärker korreliert ist als bei zweieiigen und dass sie darüber hinaus auch mit Intelligenz in Zusammenhang gebracht werden kann (Thompson et al., 2001). Mit anderen Worten: Klügere Menschen haben mehr graue Substanz in ihren Gehirnen, und die vorhandene Menge scheint tatsächlich stark mit genetischen Faktoren zusammenzuhängen (Plomin & Kosslyn, 2001). Ein überraschendes Ergebnis aus Studien mit adoptierten Kindern weist darauf hin, dass genetische Einflüsse mit zunehmendem Alter stärker werden. Die psychischen Eigenschaften von Kleinkindern sind weder denen ihrer biologischen Eltern noch denen ihrer Adoptiveltern sehr ähnlich. Mit zunehmendem Alter wäre durchaus zu erwarten, dass sich Merkmale wie die allgemeinen geistigen und verbalen Fähigkeiten denen ihrer Adoptiveltern angleichen und die Ähnlichkeit mit den diesbezüglichen Eigenschaften der biologischen Eltern eher sinkt. Entgegen dieser Erwartung werden adoptierte Kinder, wenn sie sich dem Alter von 16 Jahren nähern, ihren biologischen Eltern in diesen Eigenschaften 2 80 2 Biologische Grundlagen der Psychologie kontrovers Beruht aggressives Verhalten auf biologischen Faktoren oder auf Umweltfaktoren? Aggressives Verhalten kann biologische Grundlagen haben L. Rowell Huesmann, Universitt von Michigan Die Auftrittswahrscheinlichkeit von aggressivem Verhalten wird von neuroanatomischen, neurophysiologischen, endokrinen und anderen physiologischen Anomalien beeinflusst. Obwohl diese Faktoren aggressives Verhalten nicht direkt hervorzurufen scheinen, interagieren die biologischen Unterschiede von Kindern mit ihren frhen Erfahrungen in unterschiedlichen Lernumwelten (ihren biosozialen Interaktionen) und erzeugen interindividuelle Unterschiede im Sozialverhalten. Die biosozialen Erfahrungen in der Frhphase des Lebens scheinen besonders entscheidend fr die Entwicklung von gewohnheitsmigem aggressivem Verhalten zu sein. ˜rger wird schon weit vor Beendigung des ersten Lebensjahres erfahren, und physische Aggression (schlagen, stoen) ist bei Zweijhrigen verbreitet. Im Allgemeinen gilt: Je aggressiver sechs-, sieben- oder achtjhrige Kindern sind, desto aggressiver sind sie als Erwachsene (Huesmann, Eron, Lefkowitz & Walder, 1984). Biologische Unterschiede beeinflussen sowohl das Verhalten und Lernen der Kinder als auch die Art und Weise, wie Individuen emotional auf bestimmte Situationen reagieren, die hufig mit der Auslsung von Gewaltttigkeiten in Verbindung gebracht werden. Was sind nun die biologischen Faktoren, die einige Menschen fr aggressives Verhalten anfllig machen? Erstens scheint eine Vielzahl von neuroanatomischen Unterschieden die Aggression zu beeinflussen. Zusammen mit dem prfrontalen Cortex scheinen der Hypothalamus und die Amygdala besonders wichtige Orte fr anatomische Unterschiede zu sein, die sich auf die Aggression auswirken. Elektrische Reizung und Lsionen in diesen Nuclei knnen die Neigung zu aggressivem Verhalten beeinflussen (siehe Moyer, 1976). Anatomische Unterschiede in jedem dieser Areale, hervorgerufen beispielsweise durch ein Trauma oder einen Tumor, verndern die aggressiven Tendenzen. Ob sich jedoch tatschlich bemerkenswerte Vernderungen der Aggressivitt einstellen, hngt auch von situativen Faktoren ab. So haben beispielsweise elektrische Stimulationen bei Tieren gezeigt, dass dieselbe Stimulation, die Aggression gegen einen kleinen Gegner auslst, nicht auch Aggression gegenber einem greren Gegner hervorruft. Zweitens scheint es so zu sein, dass Individuen mit einem niedrigeren Serotoninspiegel -- einem Neurotransmitter, der an der Inhibition von impulsiven Reaktionen auf Frustrationen beteiligt ist -- ein erhhtes Risiko aufweisen, sich aggressiv zu verhalten (Knoblich & King, 1992). Wenn das Serotonin im Krper durch eine Dit oder durch Medikamente verringert wird, werden die behandelten Tiere im Verhalten aggressiver. Linnoila et al. (1983) fanden, dass Mnner, die wegen triebhaften gewaltttigen Verhaltens im Gefngnis waren, geringere Serotoninspiegel haben als nichttriebhafte Gewalttter. Darber hinaus verhalten sich Kinder mit niedrigem Serotoninspiegel mit grerer Wahrscheinlichkeit aggressiv (siehe Knoblich & King, 1992). Drittens scheint ein erhhter Testosteronspiegel, sowohl vor der Geburt als auch in der frhen Kindheit, zur Entwicklung einer Neurophysiologie zu fhren, die fr die Auslsung aggressiven Verhaltens prdisponiert ist. Ein hherer Testosteronspiegel scheint zu jedem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit zu erhhen, dass ein Individuum in eben diesem Moment aggressiv reagiert. Reinisch (1981) fand, dass Mdchen, deren Mtter whrend der Schwangerschaft mit einem testosteronhnlichen Hormon behandelt worden waren, mit einer greren Tendenz zu aggressivem Verhalten aufwuchsen als vergleichbare Kontrollpersonen. ˜hnlich reagieren mnnliche Jugendliche bei einer Provokation aggressiver, wenn sie mehr Testosteron haben (Olweus et al., 1988). Die Effekte gehen aber nicht nur in eine Richtung. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Beherrschung eines anderen oder Aggression gegen andere den Testosteronspiegel bei Mnnern erhht (Booth et al., 1989). Evolution, Gene und Verhalten Unzweifelhaft spielen neben den drei Faktoren, die ich erwhnt habe, noch andere biologische Faktoren eine Rolle bei der Aggression (wie etwa das typische Erregungsniveau). Diese drei Faktoren illustrieren aber sehr gut, wie die Biologie ber die Interaktion mit der Umwelt die Aggressivitt beeinflusst. Wodurch werden die biologischen Unterschiede hervorgerufen? Die genetische Variation ist sicher wichtig. Untersuchungen an Zwillingen, die von Geburt an getrennt aufgewachsen sind, zeigen bei eineiigen Zwillingen eine hhere Korrelation ihrer Aggressivitt als bei zweieiigen gleichgeschlechtlichen Zwillingen (beispielsweise Tellegen et al., 1988). Groe Lngsschnittstudien mit Jungen, die bei der Geburt adoptiert wurden, haben ergeben, dass der biologische Vater und der adoptierte Sohn oft darin bereinstimmen, einer Gewalttat berfhrt worden zu sein (Mednick, Reznick, Hocevar & Baker, 1987). Diese genetischen Einflsse knnen sich gut durch die diskutierten biologischen Unterschiede -- Testosteron, Serotonin oder die Neuroanatomie des limbischen Systems -- oder auch durch einen anderen Mechanismus ausdrcken. Was auch die genaue Ursache sein mag, diese biologischen Prdispositionen haben ohne Zweifel einen Einfluss darauf, wie die Interaktion mit der Umwelt die sozialen Skripte, berzeugungen und Schemata des Kindes formt und wie Menschen auf provokative und frustrierende Umweltreize kognitiv und emotional reagieren. Aggressives Verhalten kann auf Umweltfaktoren beruhen Russell Geen, Universitt von Missouri-Columbia Die Rolle der erlernten und angeborenen Faktoren bei der menschlichen Aggressivitt kann nicht als ein Entweder-Oder beschrieben werden. Praktisch jeder Psychologe, der sich mit diesem Problem beschftigt, erkennt an, dass beide Faktoren eine Rolle spielen und dass Unterschiede in den Standpunkten mit einer unterschiedlichen Gewichtung des einen oder des anderen Faktors einhergehen. Belege fr die Bedeutung des Lernens bei der Aggression kommen vor allem aus zwei Quellen. Die eine besteht aus kontrollierten Untersuchungen des Verhaltens in natrlichen und experimentellen 81 Umgebungen. Experimentelle Studien haben gezeigt, dass aggressives Verhalten auf Belohnung und Bestrafung genauso anspricht wie anderes operantes Verhalten. Zustzlich variiert die menschliche Aggression noch in Abhngigkeit davon, wie stark die Erwartung des Aggressors ist, dass aggressives Verhalten auch zu dem gewnschten Ergebnis fhrt, und wie hoch er den Nutzen dieses Ergebnisses einschtzt (Perry, Perry & Boldizar, 1990). Es ist eine seit Langem akzeptierte Prmisse der sozialen Lerntheorie, dass Verhalten eine Funktion der Erwartung von Belohnungen und des Wertes dieser Belohnungen ist. Die Forschung hat zeigen knnen, dass aggressives antisoziales Verhalten auf frhe Erfahrungen mit den eigenen Familienmitgliedern zurckgeht. Ein Gruppe von Forschern, die dieses Problem untersucht haben, kam zu dem Schluss, dass ,,das grundlegende Einben von antisozialen Verhaltensmustern vor der Adoleszenz in der Familie stattfindet und dass die Familienmitglieder die primren Trainer sind (Patterson, Reid & Dishion, 1992). Kinder lernen zuerst, dass Schlagen, Schimpfen oder Wutanflle effektive Mittel zur Erlangung der erwnschten Dinge von anderen Familienmitgliedern sind. Ein solches Verhalten kann schlielich zu umfassenderem antisozialen Verhalten innerhalb und auerhalb der Familie generalisieren. Die andere Belegquelle fr das soziale Lernen von Aggression findet sich in Untersuchungen, die Unterschiede in der Gewaltttigkeit in Abhngigkeit von kulturellen und sozialen Faktoren aufdecken. Es gibt beispielsweise betrchtliche Belege fr eine systematische Variation des Auftretens von gewaltttigen Handlungen zwischen verschiedenen Kulturen. Auch haben die Einwohner einiger Lnder im Vergleich zu Personen anderer Lnder die strker vorherrschende Meinung, dass Gewaltanwendung ein Mittel zur Lsung von Problemen sei (Archer & McDaniel, 1995). Andere Untersuchungen weisen wiederum innerhalb der USA regionale subkulturelle Unterschiede in der Aggression nach. Die Mordrate unter weien, nicht-hispanischen mnnlichen Personen, die in lndlichen Umgebungen oder kleinen Stdten im Sden des Landes leben, ist hher als die entsprechenden Raten in anderen Regionen mit ansonsten vergleichbaren Verhltnissen. Dieses Ergebnis wurde mit den unterschiedlichen regionalen Normen fr aggressives Verhalten erklrt (Cohen & Nisbett, 1994). Wenn in der Diskussion um die menschliche Aggression die Anlagefaktoren gegen die Umweltfaktoren gesetzt werden, so ist das eine falsche " 2 82 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Dichotomie. Geen (1990) hat darauf hingewiesen, dass Lernen und Vererbung am besten als Hintergrundvariablen verstanden werden, die ein Potenzial fr Aggression festlegen knnen, ohne sie als unmittelbare Verursachungsfaktoren anzusehen. Aggressives Verhalten ist eine Reaktion auf situative Bedingungen, die eine Person erregen und einen Angriff provozieren. Selbst wenn eine Person eine Disposition zu aggressivem Verhalten besitzt und zu dessen Ausfhrung fhig ist, muss eine spezifische Situation das Verhalten auslsen. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines solchen Verhaltens wie auch dessen Intensitt variieren in Abhngigkeit von der Art der Provokation und dem Potenzial fr aggressives Verhalten, das durch mehrere Hintergrundvariablen bestimmt wird. Es ist sicher so, dass Personen, die mit einer Disposition zur Gewaltttigkeit geboren wurden, bei Angriffen aggressiver reagieren als Personen ohne eine solche Disposition. Ebenso werden Personen, die durch soziales Lernen starke Aggressionsneigungen erworben haben, aggressiver reagieren als Personen mit anderen Lernerfahrungen. Vererbung und soziales Lernen sind komplementre Faktoren bei der menschlichen Aggression. ähnlicher als ihren Adoptiveltern (Plomin, Fulker, Corley & Defries, 1997). Die genetischen Einflüsse gewinnen demnach mit dem Alter an Gewicht. auch dazu, im Vergleich zu anderen Personen mehr Endorphin auszuschütten (ein natürlicher Neurotransmitter aus der Gruppe der Opiate, der mit Belohnungen zusammenhängt), wenn sie Alkohol trinken (Gianoulakis, Krishnan & Thavundayil, 1996). Dies weist auf eine mögliche biologische Prädisposition für Alkoholabhängigkeit hin. Solche Analysen können aber auch falsch interpretiert werden und müssen mit Vorsicht bewertet werden. So wurde beispielsweise einmal behauptet, dass ein Gen für den D2-Dopaminrezeptor nur bei Personen mit schwerer Alkoholabhängigkeit auftritt und deshalb eine genetische Basis für Alkoholismus darstellt. Neuere Untersuchungen dieses Gens zeigen aber, dass es auch bei Personen zu finden ist, die anderen Arten (zweifelhafter) Vergnügungen nachgehen. So könnte das Gen auch in Verbindung mit Drogensucht, Fettsucht, Spielsucht und anderen Formen ,ungezügelten Verhaltens‘ stehen (Blum, Cull, Braverman & Comings, 1996). Was wir von der Rolle dieses Gens und seiner Beziehung zum Verhalten zu wissen glauben, hat sich in den wenigen Jahren seit seiner Identifizierung verändert und wird sich in dem Maße weiter verändern, in dem neue Anhaltspunkte verfügbar werden. All diese Studien unterstreichen, dass man besser auf weitere bestätigende Befunde warten sollte, bevor man auf die genetische Basis eines Verhaltensmerkmals schließt. In einigen Fällen hat sich das, was zunächst als eine eindeutige genetische Erklärung eines Verhaltens erschien, später als unhaltbar erwiesen. Molekulargenetik des Verhaltens. In jüngster Zeit haben einige Forscher darauf hingewiesen, dass bestimmte Merkmale des Menschen, beispielsweise einige Persönlichkeitsaspekte, durch spezifische Gene bestimmt werden, indem diese – so wird angenommen – einzelne Rezeptoren von Neurotransmittern beeinflussen (Zuckerman, 1995). In den meisten Untersuchungen dieser Art werden Familienmitglieder mit einem bestimmten Merkmal identifiziert und dann mit Familienmitgliedern verglichen, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Mit molekulargenetischen Verfahren wird versucht, Gene oder Chromosomensegmente zu finden, die mit der Manifestation des Merkmals korreliert sind. So scheint für eine Kombination von Merkmalen, die als ,Suche nach neuen Reizen‘ bezeichnet wird (die durch Persönlichkeitsfragebögen ermittelte Neigung zu Impulsivität, Exploration und cholerischem Temperament), ein Gen verantwortlich zu sein, das die D4-Rezeptoren für Dopamin festlegt (Benjamin et al., 1996). Hin und wieder wurden solche Analysen auch auf sehr spezifische Verhaltensmerkmale angewandt. Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass die Söhne von alkoholabhängigen Vätern mit größerer Wahrscheinlichkeit ebenfalls alkoholabhängig werden als zufällig ausgewählte Vergleichspersonen. Söhne von Alkoholikern neigen 83 im berblick Umwelteinflsse auf die Genexpression. Das vererbte Potenzial, mit dem ein Kind die Welt betritt, wird stark durch die Umwelt beeinflusst, auf die es trifft. Ein Beispiel dafür ist Diabetes. Die Neigung zu Diabetes ist vererbt, wobei der exakte Mechanismus der Übertragung noch unbekannt ist. Bei Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse nicht genug Insulin, um Kohlehydrate zu verbrennen und damit Energie für den Körper zu liefern. Wissenschaftler nehmen an, dass die Insulinproduktion genetisch bestimmt ist. Die Krankheit tritt allerdings nicht bei allen Personen auf, die das genetische Potenzial für Diabetes haben. Wenn ein Zwilling Diabetes hat, tritt die Krankheit bei dem anderen Zwilling nur in 50 Prozent der Fälle auf. Es sind nicht alle Umweltfaktoren bekannt, die zum Ausbruch der Krankheit beitragen, aber mit ziemlicher Sicherheit gehört die Fettleibigkeit dazu. Eine übergewichtige Person braucht zur Verbrennung der Kohlehydrate mehr Insulin als eine normalgewichtige Person. Folglich bricht die Krankheit bei einer Person mit einer genetischen Disposition für Diabetes mit größerer Wahrscheinlichkeit aus, wenn sie Übergewicht hat. Eine ganz ähnliche Situation besteht auch bei der Schizophrenie. Überzeugende Belege lassen vermuten, dass diese Krankheit eine Vererbungskomponente besitzt (siehe Kapitel 15). Wenn ein (eineiiger) Zwilling schizophren ist, dann ist die Chance groß, dass auch der andere Anzeichen einer geistigen Störung zeigt. Ob der andere Zwilling aber eine voll ausgeprägte Schizophrenie ausbildet, hängt von einer Reihe von Umweltfaktoren ab. Gene können also bestimmen, ob eine Person für Schizophrenie anfällig ist; aber die Umwelt, in der ein Individuum aufwächst, trägt dazu bei, was am Ende tatsächlich passiert. zusammengefasst Chromosome und Gene (Segmente von DNAMoleklen, die genetische Information tragen) bermitteln die Erbanlagen eines Individuums. Verhalten hngt von der Interaktion zwischen Anlage und Umwelt ab: Die Gene eines Individuums begrenzen das persnliche Potenzial, doch was mit diesem Potenzial tatschlich geschieht, hngt von der Umwelt ab, in der dieser Mensch aufwchst. nachgefragt 1. Es scheint so, als wrde jedes Jahr die Entdeckung eines neuen Alkoholismusgens, eines Gens fr Drogenabhngigkeit, Schizophrenie, sexuelle Orientierung, Impulsivitt oder ein anderes komplexes psychisches Merkmal berichtet. Aber es stellt sich oft durch weitere Untersuchungen heraus, dass die Gene zwar bei einigen Personen zum jeweiligen Merkmal in Beziehung stehen, aber eben nicht bei allen. Oft erweisen sich auch Zusammenhnge mit anderen Merkmalen als dem, mit dem es zuerst in Verbindung gebracht wurde. Warum knnten Gene psychische Merkmale in dieser Art und Weise beeinflussen? Mit anderen Worten: Warum gibt es keine strenge Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen dem Vorhandensein eines Gens und dem Ausprgungsgrad eines bestimmten psychischen Merkmals? 2. Gene haben einen wichtigen Einfluss auf das Gehirn und das Verhalten. Doch sind es wirklich die Gene, die fr alles verantwortlich sind, oder kann man sich auch Beispiele fr ein Verhalten vorstellen, das nicht genetisch vorprogrammiert ist? Wie wird ein solches Verhalten ber verschiedene Generationen hinweg weitergegeben? im berblick 1. Die grundlegende Einheit des Nervensystems ist ein spezialisierter Zelltyp, das Neuron. Vom Zellkörper eines Neurons gehen kleine Fortsätze, die Dendriten, sowie ein dünner, röhrenförmiger Fortsatz, das Axon, aus. Eine Reizung der Dendriten und des Zellkörpers führt zu einem neuronalen Impuls, der das Axon entlangwandert. Sensorische Neurone übertragen Signale von den Sinnesorganen zum Gehirn und zum Rückenmark; Motoneurone übertragen Signale von Gehirn und Rückenmark zu den Muskeln und Drüsen. Ein Nerv ist ein Bündel von lang erstreckten Axonen, die zu Hunderten oder Tausenden von Neuronen gehören. 2. Ein Reiz bewegt sich in einem Neuron als elektrochemischer Impuls von den Dendriten zum Ende des Axons. Dieser wandernde Impuls, das Aktionspotenzial, wird durch den elektro- 2 84 3. 4. 5. 6. chemischen Prozess der Depolarisation hervorgerufen. Er verändert die Ladungsdifferenz an aufeinanderfolgenden Punkten auf dem Weg durch das Neuron mit Hilfe eines Zellmechanismus. Einmal gestartet, wandert das Aktionspotenzial das Axon entlang bis zu vielen kleinen Verdickungen am Ende, den synaptischen Endknöpfchen. Diese Endknöpfchen setzen chemische Substanzen frei, die Neurotransmitter, die für die Übertragung des Signals von einem Neuron zum nächsten verantwortlich sind. Die Neurotransmitter diffundieren durch die Synapse, einen schmalen Spalt an der Verbindungsstelle der beiden Neurone, und binden sich an Neurorezeptoren in der Zellmembran des Empfangsneurons. Einige Neurotransmitter wirken erregend und andere erregungshemmend. Wenn die erregende Wirkung auf das empfangende Neuron im Vergleich zur hemmenden Wirkung hinreichend groß wird, findet eine Depolarisation statt, und das Neuron feuert einen Alles-oder-nichts-Impuls. Es gibt viele verschiedene Arten der Neurotransmitter-Rezeptor-Interaktion, die zur Erklärung einer ganzen Reihe psychologischer Phänomene beitragen. Die wichtigsten Neurotransmitter sind Acetylcholin, Noradrenalin (Norepinephrin), Dopamin, Serotonin, GABA und Glutamat. Das Nervensystem wird eingeteilt in das Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) und das periphere Nervensystem (die Nerven, die das Gehirn und das Rückenmark mit anderen Teilen des Körpers verbinden). Das periphere Nervensystem gliedert sich in das somatische System (das Botschaften von und zu den Sinnesorganen, Muskeln und der Körperoberfläche überträgt) und das autonome System (das die Verbindung mit den inneren Organen und den Drüsen herstellt). Das menschliche Gehirn besteht aus drei funktionalen Teilbereichen: dem zentralen Kern, dem limbischen System und dem Großhirn. Den zentralen Kern bilden die Medulla oblongata, die für die Atmung und die Haltungsreflexe zuständig ist; das Kleinhirn, das die motorische Koordinierung gewährleistet; der Thalamus als Umschaltstation für ankommende sensorische Information und der Hy- 2 Biologische Grundlagen der Psychologie 7. 8. 9. 10. 11. pothalamus, der für Emotionen und die Aufrechterhaltung der Homöostase wichtig ist. Die Formatio reticularis, die einige der anderen Teile des zentralen Kerns durchzieht, reguliert den Erregungs- und Bewusstseinszustand des Organismus. Das limbische System steuert einen Teil des Instinktverhaltens, das durch den Hypothalamus geregelt wird. Dazu gehören Nahrungsaufnahme, Angriffs- und Fluchtverhalten und Fortpflanzung. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei Emotionen und Gedächtnis. Das Großhirn ist in die beiden Hemisphären unterteilt. Die gefaltete Oberfläche dieser Hemisphären, der cerebrale Cortex, besitzt eine entscheidende Funktion für höhere mentale Prozesse wie Denken, Lernen und Entscheidungsfindung. Bestimmte Bereiche des cerebralen Cortex sind für die Verarbeitung spezieller sensorischer Inputs oder die Steuerung bestimmter Bewegungen verantwortlich. Der Rest des Cortex besteht aus Assoziationsarealen, die mit Gedächtnis, Denken und Sprache befasst sind. Es gibt mittlerweile Techniken, um detaillierte Bilder vom Gehirn des Menschen zu erhalten, ohne den Patienten Stress auszusetzen oder ihn zu verletzen. Dazu gehören die Computer-Tomographie (CT), die MagnetResonanz-Tomographie (MRT) und die Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Wenn das Corpus callosum (ein Streifen von Nervenfasern, der die beiden Hemisphären verbindet) beschädigt ist, können deutliche Unterschiede in der Funktionalität der beiden Hemisphären beobachtet werden. Die linke Hemisphäre ist besonders stark bei sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten. Die rechte Hemisphäre kann Sprache zu einem gewissen Grad verstehen, aber nicht sprachlich kommunizieren. Sie ist besonders entwickelt für räumliches Denken und Mustererkennung. Der Begriff Aphasie wird zur Beschreibung von Sprachdefiziten benutzt, die durch Hirnschäden hervorgerufen werden. Personen mit einer Schädigung des Broca-Areals haben Schwierigkeiten bei der korrekten Aussprache von Wörtern und können nur langsam und sehr mühsam sprechen. Personen mit geschädigtem Wernicke-Areal kön- im berblick nen Wörter hören, aber verstehen ihre Bedeutung nicht. 12. Das autonome Nervensystem besteht aus dem sympathischen und dem parasympathischen Teil. Es ist besonders wichtig für emotionale Reaktionen, weil es die glatte Muskulatur und die Drüsenaktivität steuert. Das sympathische System ist besonders aktiv bei Erregung, und das parasympathische System dominiert in Ruhezuständen. 13. Die endokrinen Drüsen schütten Hormone ins Blut aus. Mit dem Blut wandern die Hormone durch den Körper und wirken auf unterschiedliche Zelltypen auch jeweils unterschiedlich. Die Hypophyse wird auch als Hauptdrüse bezeichnet, weil sie die sekretorische Aktivität der anderen endokrinen Drüsen steuert. Die Nebennieren sind für die Stimmung, das Energieniveau und die Stressbewältigung wichtig. 14. Die Erbmasse eines Menschen, die über die Chromosome und die Gene weitergegeben wird, beeinflusst die psychischen und physischen Merkmale. Gene sind Segmente von 85 DNA-Molekülen, welche die genetische Information tragen. Einige Gene sind dominant, einige rezessiv, und einige sind geschlechtsgebunden. Die meisten Merkmale des Menschen sind polygenetisch kodiert; das heißt, sie sind durch das Zusammenwirken vieler Gene bestimmt. 15. Selektive Züchtung (die Paarung von Tieren, die ein Merkmal in besonders hoher oder niedriger Ausprägung besitzen) ist eine Methode, um den Einfluss der Vererbung zu untersuchen. Ein anderes Mittel besteht darin, die Effekte der Umwelt und der Vererbung durch Zwillingsstudien zu trennen. Dabei werden eineiige Zwillinge (deren Gene identisch sind) mit zweieiigen Zwillingen (deren genetische Ähnlichkeit nicht höher ist als die normaler Geschwister) verglichen. Verhalten hängt von der Interaktion zwischen Umwelt und Vererbung ab: Die Gene eines Individuums setzen die Grenzen für sein Potenzial. Die Umwelt, in der das Individuum heranwächst, bestimmt aber, was aus diesem Potenzial wird. 2 http://www.springer.com/978-3-8274-1405-2