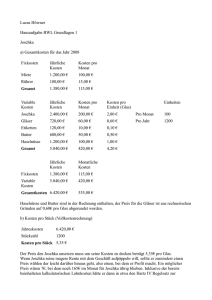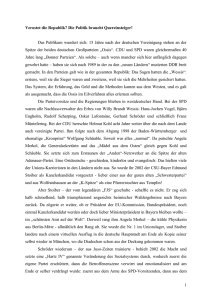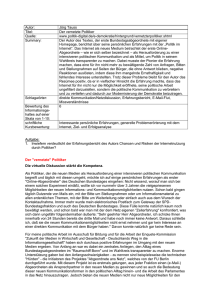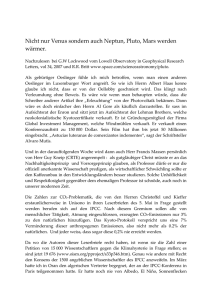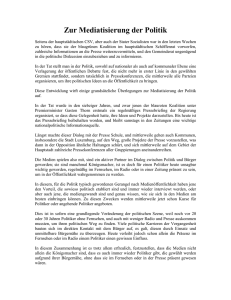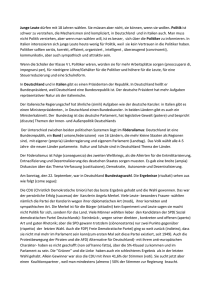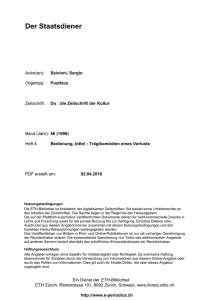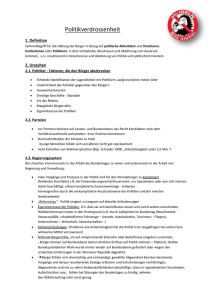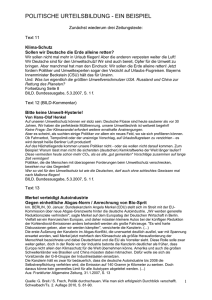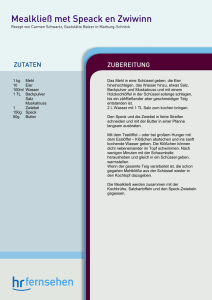Politik, Werbung und Unterhaltung – Politiker als unfreiwillige
Werbung

Politik, Werbung und Unterhaltung – Politiker als unfreiwillige Werbehelfer Werbung will wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung ist gesichert, wenn ein Werbebild schockiert oder den Betrachter auf andere Weise irritiert. Vor einigen Jahren hat die Schockwerbung von Benetton Aufsehen erregt. Jetzt sind es immer häufiger Bilder von Politikern, die für Werbezwecke eingesetzt werden und den Betrachter vor allem deswegen irritieren, weil die Nutzung ersichtlich ohne Zustimmung der Betroffenen erfolgt. Das Publikum fragt sich bei derartigen Werbeaktionen, wie so etwas möglich ist und wie die Politiker damit umgehen, dass ein Unternehmen ihr Bild ungefragt für die eigenen Werbezwecke einsetzt. Damit ist dann das Werbeziel erreicht: Alle Welt spricht – je nach Standpunkt – über den gelungenen Gag oder den unerhörten Missbrauch der Bekanntheit des betroffenen Politikers. Und wenn sich dann auch noch die Gerichte der Sache annehmen, wird das werbende Unternehmen und das beworbene Produkt auch weiterhin ein Gesprächsthema bleiben. Der Autovermieter Sixt ist der Vorreiter der Werbung mit Politikern. So war vor einigen Jahren die Fotomontage von Angela Merkel, die mit wehenden Haaren als Cabrio-Fahrerin gezeigt wurde, ein allgemeiner Lacherfolg. Als dann Oskar Lafontaine im Frühjahr 1999 bereits nach wenigen Wochen als Bundesfinanzminister zurücktrat, schaltete Sixt eine Werbeanzeige, die sämtliche Mitglieder der damaligen Bundesregierung mit Lafontaine als „Mitarbeiter in der Probezeit“ zeigte. Der Springer Verlag übernahm dieses Werbemuster für eine Plakat- und Anzeigenserie, die mit dem Slogan „Big News. Small Size“ für die Tabloid-Ausgabe der Zeitung „Die Welt“ warb und diesen Slogan dadurch visualisierte, dass die Gesichter prominenter Personen (wie z.B. Joschka Fischer) per Morphing in „Babyfaces“ verwandelt wurden. Während der Fußballweltmeisterschaft gab es dann in Österreich einen weiteren Fall von Politikerwerbung: Mit dem Slogan „Österreich isst Weltmeister“ und einem Bild, das den damaligen österreichischen Bundeskanzler Schüssel mit Fanschal und aufgeschminkten Nationalfarben auf beiden Wangen zeigte, warb McDonald’s für seine Produkte. Und schließlich erschien im Dezember des vergangenen Jahres im „Dummy“-Magazin eine Werbeanzeige, die ein Foto der Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen im Kreise ihrer Kinder mit dem Schriftzug eines Dessous-Herstellers verknüpft, um so auf ironische Weise die Wirkung von Dessous darzustellen. Sixt-Werbung mit Angela Merkel. Werbung von McDonald’s Österreich mit Bundeskanzler Schüssel sowie der Dessous-Firma Blush mit Bundesfamilienministerin von der Leyen mit ihren Kindern. Interessant ist, dass sowohl Angela Merkel als auch Wolfgang Schüssel und die Bundesfamilienministerin darauf verzichtet haben, für die Werbung mit ihrem Konterfei Schadensersatz zu verlangen. Joschka Fischer und Oskar Lafontaine haben dagegen die Gerichte bemüht und hohe Entschädigungsforderungen eingeklagt. Diese unterschiedliche Reaktion ist sicher kein Zufall. Angela Merkel war zum Zeitpunkt der Sixt-Werbeaktion eine aufstrebende Politikerin mit einer vielversprechenden Zukunft. Dasselbe gilt derzeit für Ursula von der Leyen. Und Wolfgang Schüssel war während der Fußballweltmeisterschaft als Bundeskanzler noch in Amt und Würden und außerdem gerade im Wahlkampf. Dagegen hatte Joschka Fischer sein Amt als Außenminister verloren, als der Springer-Verlag die Werbeaktion „Big News. Small Size“ startete, und Oskar Lafontaine war vor Beginn der Sixt-Kampagne als Finanzminister zurückgetreten. Während daher Merkel und Schüssel mit einem für sie wichtigen Imagegewinn rechnen konnten, wenn sie sich als humorvolle und tolerante Politiker zeigten, die auf gerichtliche Maßnahmen verzichteten, konnten sich Fischer und Lafontaine von den Werbeaktionen nach dem vorläufigen Ende ihrer Politikerlaufbahn nichts mehr versprechen, so dass für sie auch keine Veranlassung zur Zurückhaltung bestand. Die gegensätzliche Reaktion der Betroffenen verdeutlicht, wo das Problem liegt. Politik, Werbung und Unterhaltung sind längst keine getrennten Veranstaltungen mehr, sondern in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark miteinander verzahnt. Politiker nutzen gerne Talkshows und andere Unterhaltungssendungen, um ihre Popularität zu steigern, und sie haben auch kein Problem damit, wenn ihre Popularität wiederum dazu genutzt wird, um im Vorspann zu solchen Sendungen oder in den eingeschobenen Werbeblöcken für bestimmte Produkte zu werben. Da die Politiker selbst die Grenzen zur Unterhaltung und Werbung immer wieder überspringen, wenn sie sich davon einen Imagevorteil versprechen, kann es kaum verwundern, dass auch die Werbung und die Unterhaltung ihrerseits immer häufiger die Grenze zur Politik überschreiten und Politiker in Werbeaktionen einbeziehen oder zum Gegenstand des allgemeinen Entertainments machen. Solche Grenzüberschreitungen sind Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung, die auch von den Gerichten nicht ignoriert werden kann. Im Fall Lafontaine hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Problem erkannt und die Regeln für die „Zweckehe“ zwischen Politik, Werbung und Unterhaltung teilweise neu definiert. In den ersten beiden Instanzen war der ehemalige Bundesfinanzminister mit seiner Klage gegen die Sixt-Werbung noch erfolgreich. Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht Hamburg sprachen ihm eine Entschädigung von 100.000 Euro zu. In der Revisionsinstanz scheiterte er jedoch mit seiner Klage, weil die Sixt-Werbeanzeige nach Auffassung des BGH zulässig war. Zur Begründung heißt es in dem BGH-Urteil vom 26. Oktober 2006 (Az. I ZR 182/04), dass Werbeanzeigen, die über den reinen Werbezweck hinaus auch ein politisches Statement in Form der Satire enthalten, durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 GG) gedeckt sind. Zwar brauchten es sich Politiker normalerweise nicht gefallen zu lassen, dass ihr Bild von Dritten für irgendwelche Werbkampagnen eingesetzt wird. Wenn aber die Werbung nicht ausschließlich den Geschäftsinteressen des werbenden Unternehmens diene, sondern darüber hinaus einen Informationsgehalt aufweise, der für die Allgemeinheit von Interesse sei, dann müsse man das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und das Recht des Werbenden auf freie Meinungsäußerung gegeneinander abwägen. Ziele die Werbung vorrangig darauf ab, den Image- oder Werbewert des abgebildeten Politikers auszunutzen und den Eindruck zu erwecken, der Abgebildete identifiziere sich mit dem beworbenen Produkt, dann müsse man dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten regelmäßig den Vorrang gegenüber dem Veröffentlichungsinteresse des Werbenden einräumen. Wenn es dagegen – wie bei der Sixt-Werbeanzeige mit dem Lafontaine-Bild – ersichtlich nicht darum gehe, den Image- oder Werbewert des abgebildeten Politikers auf das beworbene Produkt zu übertragen, und wenn stattdessen die satirisch-spöttische Auseinandersetzung mit einem politischen Tagesereignis im Vordergrund stehe, dann müsse das Interesse des Politikers, nicht ohne seine Erlaubnis in einer Werbeanzeige abgebildet zu werden, gegenüber dem Recht des Werbenden auf freie Meinungsäußerung zurücktreten. Sixt-Werbung mit Oskar Lafontaine. Der BGH trägt mit dieser Entscheidung der Tatsache Rechung, dass Politik und Werbung keine voneinander abgeschotteten Bereiche sind. Politische Aussagen können in den Mantel der Werbung gekleidet sein, so wie auch umgekehrt scheinbar politische Äußerungen eines Prominenten oftmals nur der Eigenwerbung und der eigenen Imageförderung dienen. Deshalb ist nicht jede Werbung mit dem Bild eines Politikers unzulässig, vielmehr ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob es vorrangig um die Erzielung eines Werbeeffekts geht oder ob eine politische Aussage, die möglicherweise in eine satirisch-spöttische Form gekleidet ist, im Vordergrund steht. Kann man daraus ableiten, dass auch die Werbung mit dem „Babyface“ von Joschka Fischer zulässig war? So einfach ist es wohl nicht, denn im Fall Fischer ging es – anders als in dem Fall Lafontaine – nicht um einen satirisch-politischen Kommentar zu einem aktuellen Ereignis, an dem der frühere Außenminister beteiligt war. Der Springer-Verlag wollte mit der Abbildung des früheren Außenministers ganz klar Werbung in eigener Sache betreiben und nicht etwa zum politischen Geschehen Stellung nehmen. Deshalb hat das Landgericht Hamburg die Werbemaßnahme in seiner Entscheidung vom 27. Oktober 2006 (Az. 324 O 381/06) für unzulässig erklärt und Joschka Fischer eine Entschädigung in Höhe von 200.000 Euro zugesprochen. Nach Auffassung des Gerichts wurde das Konterfei des Politikers ausschließlich als Blickfang eingesetzt, um damit einen Kaufanreiz für das beworbene Produkt zu schaffen. Werbung für die Zeitung WELT KOMPAKT mit Joschka Fischer Die Argumentation des Landgerichts klingt zunächst plausibel, erweist sich aber bei näherem Hinsehen als ein Fehlgriff. Auch wenn bei der Springer-Anzeige die Werbung für das neue Zeitungsformat im Vordergrund gestanden haben mag, steht diese Werbemaßnahme allein deswegen, weil es um die Werbung für ein Presseprodukt geht, unter dem Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit. Zur Pressefreiheit gehört, dass für ein Presseerzeugnis Werbung betrieben werden darf, weil die Werbung den Absatz fördert und so zur Verbreitung der Informationen beiträgt. Wenn daher eine Zeitung für sich selbst wirbt, muss sie die gleichen Freiheiten haben wie bei der redaktionellen Berichterstattung. Das bedeutet, dass in der Werbung die Bilder gezeigt werden dürfen, die auch redaktionell verwendbar sind. Die Abbildung von Joschka Fischer hätte aber ohne weiteres für redaktionelle Zwecke verwendet werden können, und zwar auch in der digital verfremdeten Form, denn ein Politiker muss es hinnehmen, dass eine Zeitung ihn im redaktionellen Teil in karikierender oder satirischer Form abbildet. Wenn aber die Wiedergabe der Abbildung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zulässig gewesen wäre, dann kann für die Eigenwerbung der Zeitung angesichts der Tatsache, dass diese Werbung unter dem Schutz der Pressefreiheit steht, nichts anderes gelten. Die Entscheidung des Landgerichts Hamburg lässt das unberücksichtigt. Erschienen in PHOTOPRESSE Nr. 4/07