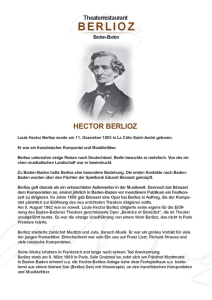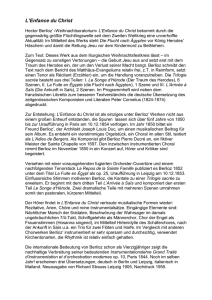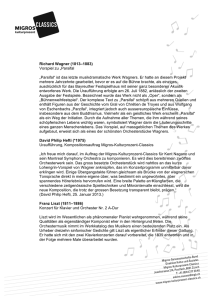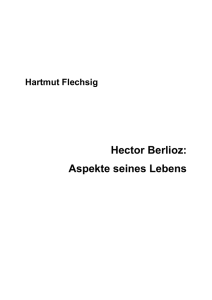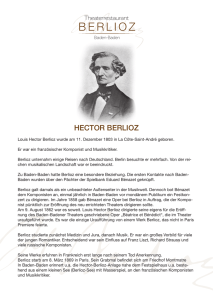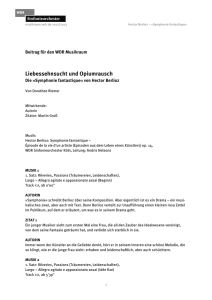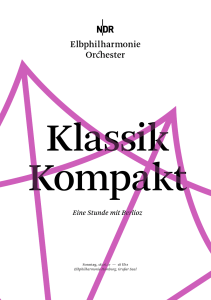Hector Berlioz: Ouvertüren Alle Kompositionen des ungestümen
Werbung
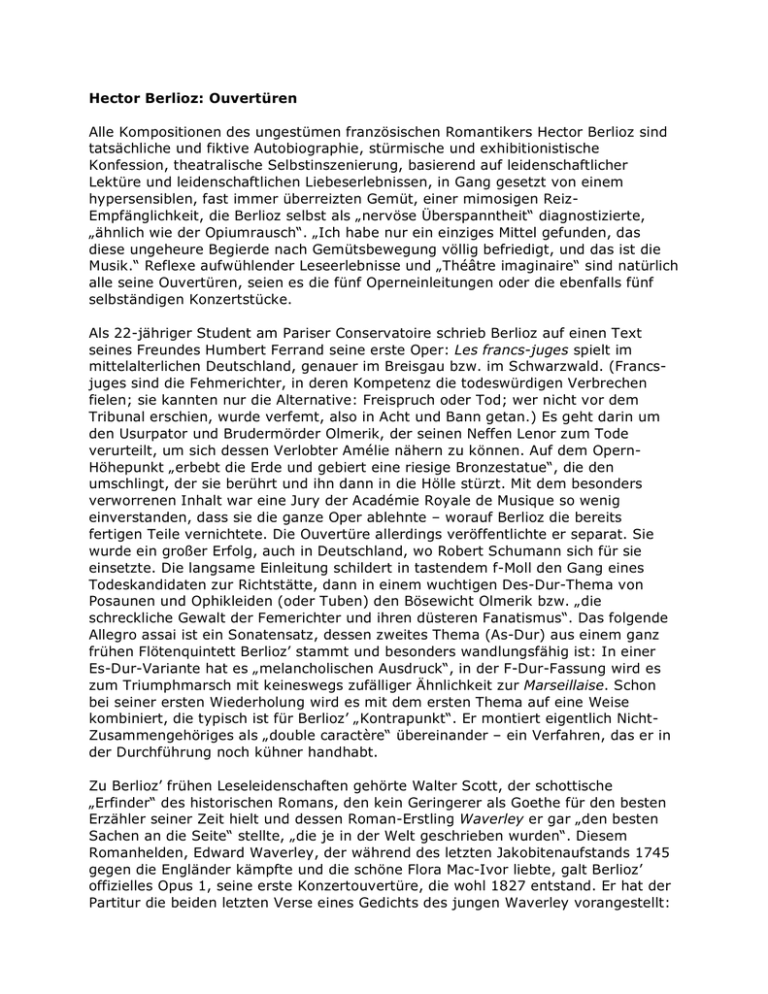
Hector Berlioz: Ouvertüren Alle Kompositionen des ungestümen französischen Romantikers Hector Berlioz sind tatsächliche und fiktive Autobiographie, stürmische und exhibitionistische Konfession, theatralische Selbstinszenierung, basierend auf leidenschaftlicher Lektüre und leidenschaftlichen Liebeserlebnissen, in Gang gesetzt von einem hypersensiblen, fast immer überreizten Gemüt, einer mimosigen ReizEmpfänglichkeit, die Berlioz selbst als „nervöse Überspanntheit“ diagnostizierte, „ähnlich wie der Opiumrausch“. „Ich habe nur ein einziges Mittel gefunden, das diese ungeheure Begierde nach Gemütsbewegung völlig befriedigt, und das ist die Musik.“ Reflexe aufwühlender Leseerlebnisse und „Théâtre imaginaire“ sind natürlich alle seine Ouvertüren, seien es die fünf Operneinleitungen oder die ebenfalls fünf selbständigen Konzertstücke. Als 22-jähriger Student am Pariser Conservatoire schrieb Berlioz auf einen Text seines Freundes Humbert Ferrand seine erste Oper: Les francs-juges spielt im mittelalterlichen Deutschland, genauer im Breisgau bzw. im Schwarzwald. (Francsjuges sind die Fehmerichter, in deren Kompetenz die todeswürdigen Verbrechen fielen; sie kannten nur die Alternative: Freispruch oder Tod; wer nicht vor dem Tribunal erschien, wurde verfemt, also in Acht und Bann getan.) Es geht darin um den Usurpator und Brudermörder Olmerik, der seinen Neffen Lenor zum Tode verurteilt, um sich dessen Verlobter Amélie nähern zu können. Auf dem OpernHöhepunkt „erbebt die Erde und gebiert eine riesige Bronzestatue“, die den umschlingt, der sie berührt und ihn dann in die Hölle stürzt. Mit dem besonders verworrenen Inhalt war eine Jury der Académie Royale de Musique so wenig einverstanden, dass sie die ganze Oper ablehnte – worauf Berlioz die bereits fertigen Teile vernichtete. Die Ouvertüre allerdings veröffentlichte er separat. Sie wurde ein großer Erfolg, auch in Deutschland, wo Robert Schumann sich für sie einsetzte. Die langsame Einleitung schildert in tastendem f-Moll den Gang eines Todeskandidaten zur Richtstätte, dann in einem wuchtigen Des-Dur-Thema von Posaunen und Ophikleiden (oder Tuben) den Bösewicht Olmerik bzw. „die schreckliche Gewalt der Femerichter und ihren düsteren Fanatismus“. Das folgende Allegro assai ist ein Sonatensatz, dessen zweites Thema (As-Dur) aus einem ganz frühen Flötenquintett Berlioz’ stammt und besonders wandlungsfähig ist: In einer Es-Dur-Variante hat es „melancholischen Ausdruck“, in der F-Dur-Fassung wird es zum Triumphmarsch mit keineswegs zufälliger Ähnlichkeit zur Marseillaise. Schon bei seiner ersten Wiederholung wird es mit dem ersten Thema auf eine Weise kombiniert, die typisch ist für Berlioz’ „Kontrapunkt“. Er montiert eigentlich NichtZusammengehöriges als „double caractère“ übereinander – ein Verfahren, das er in der Durchführung noch kühner handhabt. Zu Berlioz’ frühen Leseleidenschaften gehörte Walter Scott, der schottische „Erfinder“ des historischen Romans, den kein Geringerer als Goethe für den besten Erzähler seiner Zeit hielt und dessen Roman-Erstling Waverley er gar „den besten Sachen an die Seite“ stellte, „die je in der Welt geschrieben wurden“. Diesem Romanhelden, Edward Waverley, der während des letzten Jakobitenaufstands 1745 gegen die Engländer kämpfte und die schöne Flora Mac-Ivor liebte, galt Berlioz’ offizielles Opus 1, seine erste Konzertouvertüre, die wohl 1827 entstand. Er hat der Partitur die beiden letzten Verse eines Gedichts des jungen Waverley vorangestellt: Dreams of love and lady’s charms Give place to honour and to arms. Es geht darin – nach langsamer Einleitung mit Cellokantilene und unheildrohendem Paukensolo – so chevaleresk, stürmisch und anschaulich zu, dass die Zeitgenossen den „rauen Klang der Dudelsäcke zu hören“ glaubten, „wie sie die altschottischen Krieger zur Schlacht rufen“. Und wieder zeigte sich Robert Schumann beeindruckt, der seine Rezension in der Neuen Zeitschrift für Musik mit dem Fazit schloss, die Ouvertüre sei „trotz aller Jugendschwächen durch die Größe und Eigentümlichkeit der Erfindung das Hervorragendste, was uns Frankreich an Instrumentalmusik neuerdings hervorgebracht“. „Shakespeare ... traf mich wie ein gewaltiger Blitzschlag, dessen Strahl mir mit überirdischem Getöse den Kunsthimmel eröffnete und mich bis in seine weitesten Fernen blicken ließ. Ich erkannte die echte dramatische Größe, Schönheit und Wahrheit. ... Ich sah, verstand, fühlte, dass ich lebte, dass ich aufstehen sollte und wandeln.“ Dieses wundersame Erweckungserlebnis hat für Berlioz’ Komponieren und den Gang der Musikgeschichte bekanntlich entscheidende Auswirkungen gehabt: Nicht nur die Symphonie fantastique – deren Entstehungsgrund die eher tragikomische Liebe zur Shakespeare-Darstellerin Harriet Smithson war – und ihre Fortsetzung Lélio, auch natürlich Roméo et Juliette, die Oper Béatrice et Bénédict (nach Viel Lärm um Nichts) und die Ouvertüre Le Roi Lear gehen auf den englischen Dramatiker zurück. Zur Vorgeschichte dieses Opus 4 gehört Berlioz’ Gewinn des berühmten Rompreises, der nach den Satzungen der Pariser Akademie vorsah, dass von dem damit erlangten fünfjährigen Stipendium zwei Jahre in der italienischen Hauptstadt verbracht werden durften bzw. mussten. Berlioz ertrug die Pflichtzeit in der Villa Medici nur mühsam – vor allem, weil Italien ihm musikalisch nichts zu bieten hatte; aber auch, weil er sein eigenes privates Eifersuchts-Melodram in Paris zu inszenieren gedachte: den geplanten Tripelmord an seiner Verlobten Camilla Moke, ihrer Mutter und dem von ihr meuchlings bestimmten künftigen Mann Camille Pleyel (Sohn des Komponisten Ignaz Pleyel). Die blutigen Absichten waren schon in Nizza verflogen, wo er drei Wochen blieb und seine emotionalen Überschüsse für die Transformation seiner jüngsten Leseerlebnisse in Musik verwendete – unter anderem eben den King Lear, in dessen Gemüts- und Affektzustände er sich besonders gut versetzen konnte. Das weit ausholende rezitativische Thema der Einleitung ist zweifellos Lears Ansprache an seine drei Töchter, und die 20 solistischen Paukentakte am Ende dieser Introduktion hat Berlioz aus alten französischen Königsritualen übernommen. Dagegen repräsentieren beide Oboenthemen in Einleitung und Sonatensatz die milde Cordelia, die von ihrem Vater so gründlich verkannt wird. Dessen ausbrechendem Wahnsinn entspricht die zunehmende Verzerrung und Destruktion des „Königsthemas“. Die Ouvertüre Rob Roy – genauer: Intrata di Rob- Roy Mac Gregor – ist ebenfalls eine Komposition der Rom- und Nizza-Zeit, gehörte zu den „Envois de Rome“, also den Pflichtstücken, die die Stipendiaten regelmäßig zur Begutachtung nach Paris zu schicken hatten. Und es ist nach Waverley Berlioz’ zweite Ouvertüre nach einem Roman Walter Scotts: Rob Roy ist ein schottischer Rebell mit Robin Hood-Zügen, dessen musikalische Charakterisierung Authentizität aus der Verwendung einer schottischen Weise bezieht, die ab Takt zehn – zunächst im Hornquartett – erklingt und über die Berlioz sich in einem Zeitungsartikel äußerte: „Die Melodie des Mac Gregor-Clans ‚We are Scots‘ ist vortrefflich; auch ohne die Worte dieses Gebirglerliedes zu hören, erkennt man den Hochländer, der sich seiner Kraft und Freiheit freut.“ Andere instrumentale Hauptdarsteller sind die Harfe und das Englischhorn, die zweimal besonders eindrucksvoll miteinander dialogisieren. Beide Themen hat Berlioz später vom schottischen Hochland in die italienischen Abruzzen verlegt, sie aus der erfolglosen Ouvertüre in seine Bratschen-Sinfonie Harold in Italien hinübergerettet. Ein später Reflex des Italien-Aufenthalts war Berlioz’ Oper um den abenteuernden Florentiner Renaissancekünstler Benvenuto Cellini. Die Uraufführung 1838 war ein Debakel, dessen Ursachen Berlioz ausschließlich im Desinteresse des Dirigenten Habeneck sah – woraus er in seinen Mémoires den Schluss zog: „Arme Komponisten! Ihr tätet gut daran, das Dirigieren zu lernen. [...] denn vergesst nicht, dass euer gefährlichster Interpret der Dirigent ist [...]“ Berlioz hielt Teile seiner Oper am Leben – die Ouvertüre, eine Cavatine, Arien von Ascanio und Cellini –, indem er sie gelegentlich in seinen Konzerten aufführte. Außerdem verwendete er Opernmaterial für eine eigenständige Konzertouvertüre, die er Römischer Karneval nannte. Nach kurzem Saltarello-Vorspann setzt die berühmte Englischhorn-Melodie ein, die das Liebesduett Cellini-Teresa zitiert. Die Musik des Allegro vivace entstammt zu großen Teilen dem Saltarello der „Tänzer von Trastevere“, mit dem der Opern-Karneval eröffnet wird. Bei der Uraufführung 1844 befolgte Berlioz den eigenen Ratschlag, dirigierte selbst und errang einen Triumph unter Bedingungen, die allerdings schwer vorstellbar sind: Die einzige Probe fand am Morgen der Uraufführung ohne die Bläser statt (die Dienst in der Nationalgarde hatten). Sie spielten vermutlich vom Blatt und hatten als einzige Präparation die ihnen von Berlioz zugeraunte Allerwelts-Empfehlung, auf seinen Taktstock zu achten und die Pausen gut zu zählen. Zudem war Berlioz’ Todfeind Habeneck zugegen, um sich an der bevorstehenden Katastrophe zu ergötzen. Aber: „Nicht ein einziger Fehler wurde gemacht. Ich warf das Allegro in dem wirbelnden Tempo der Tänzer jenseits des Tiber hin. Das Publikum schrie da capo [...] Und als ich das Foyer wieder betrat, wo sich Habeneck, etwas betreten, aufhielt, richtete ich im Vorübergehen die vier Worte an ihn: ‚So wird das gemacht!‘“ Lord Byron, „Erfinder“ von Dandyismus und Weltschmerz, ein Apoll mit Klumpfuß, Mann der Exzesse zwischen Askese und Wolllust, Propagandist des unumschränkten Rechts der Persönlichkeit auf Freiheit und Liebe, hat einer ganzen Epoche den Namen gegeben: „Byronismus“ betrieben neben den Literaten der französischen und russischen Romantik und des Jungen Deutschland auch viele Komponisten von ähnlicher Wesensart, darunter – natürlich – Hector Berlioz. Der fand nichts dabei, es sich während seines Rom-Aufenthalts 1831 in Sankt Peter mit einem Band Byron „in einem Beichtstuhl bequem“ zu machen, „und im Genuss der Kühle, der heiligen Stille [...] folgte ich den kühnen Fahrten des Korsaren; ich verehrte aufs Tiefste diesen zugleich unerbittlichen und zärtlichen, mitleidlosen und edelmütigen Charakter, in dem sich in wundersamer Weise zwei scheinbar entgegengesetzte Gefühle zusammen- finden, der Hass gegen die Gattung und die Liebe zu einer einzigen Frau.“ Sicherlich entstand damals schon die Idee zur Vertonung der Beichtstuhl-Lektüre, Byrons Verserzählung The corsair, doch der Weg zur Ouvertüre Le corsaire war lang und dem Sujet angemessen abenteuerlich. Die Kurzfassung: 1831 erste Skizzen in einem Wohnturm (mit Meeresblick) in Nizza; 1845 Komposition der Ouvertüre in demselben Turm, weshalb er sie La Tour de Nice nannte; 1852 Umarbeitung und Umbenennung in Le corsaire rouge, in Anlehnung an James Fenimore Coopers Roman The Red Rover („Der rote Freibeuter“); 1855 Umarbeitung und Umbenennung in Le corsaire. Doch welcher Pirat – also der kühne, aber edelmütige, nur durch widrige gesellschaftliche Umstände ins Seeräuberleben gezwungene „outlaw“ – auch immer gemeint war: er ist eine Projektion von Berlioz’ Ego, dem missverstandenen, einzelgängerischen, von der Gesellschaft gar ausgestoßenen, aber unverdrossen um seine Anerkennung kämpfenden Künstler.