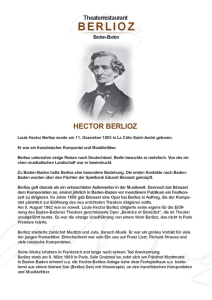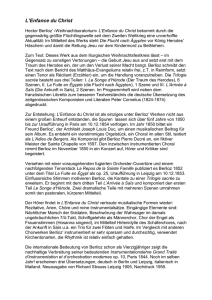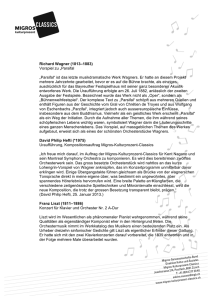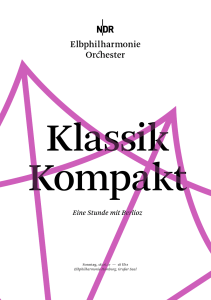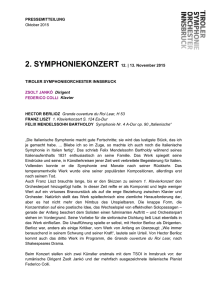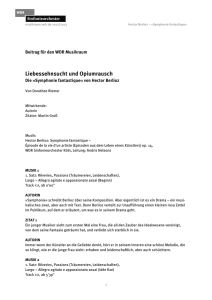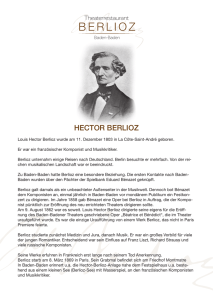Hector Berlioz - Schulmusik online
Werbung

Hartmut Flechsig Hector Berlioz: Aspekte seines Lebens I Eine CD mit einer interessanten Musik möchte ich mir kaufen – für mich oder auch für jemand anderes – und betrete meinen „Schallplattenmarkt“ (der immer noch so heißt). Wonach suche ich eigentlich, woran orientiere ich mich? Da gibt es auf Extraständern verbilligte Sonderangebote. Andere Angebote nehmen Bezug auf Konzerte, die gerade stattgefunden haben, oder auf Jahrestage, die an Komponisten oder auch Dirigenten erinnern; die meisten CD’s aber sind schlicht alphabetisch geordnet, das ist am übersichtlichsten. Alle diese Anordnungen helfen mir beim Aussuchen eigentlich nicht. Ich muss schon selber und im voraus wissen, was ich möchte, was sich als Geschenk eignen oder was mir ganz persönlich zusagen könnte. Alle Ständer sind mir gleich gut zugänglich. Es liegt an mir, bei welchem ich verweile. Das bin ich Kein Händler käme auf den Gedanken, die angebotene Musik nach der Entstehungszeit zu ordnen. Wer wüsste denn auch auf Anhieb, ob Wagner jünger oder älter ist als Liszt oder welchen linken und welchen rechten Nachbarn Hector Berlioz im Regal hätte? „Von den wenigen Spezialisten, die das wissen, könnte ich ohnehin nicht leben!“ würde der Kritiker einwerfen. „Die ganze Anordnung wäre ja doch völlig unsinnig! Musik und ihre Geschichte, das ist doch nicht eine Abfolge von Ereignissen, sondern eher ein imaginäres Museum. Die unterschiedlichsten Dinge sind – nach dem neuesten Stand der Technik – konserviert und warten nun darauf, dass jemand sich ihnen zuwendet, sie erwirbt und zu neuem Leben erweckt. Bei der Auswahl dessen, was einem zusagt, möchte sich niemand gern dreinreden lassen.“ 2 Da hat der Händler recht. Wir alle als die Teilhaber am „postmodernen“ Denken betrachten Geschichte als wohlgeordnetes Repertoire, als Angebot an Möglichkeiten, die grundsätzlich, von uns aus gesehen, alle gleich weit entfernt sind, und das nicht nur im Schallplattenmarkt. Ob sie uns näher rücken oder nicht, liegt allein an uns, und das betrifft Shakespeare ebenso wie Goethe; Christoph Willibald Gluck hatte ein große Bedeutung für Berlioz’ Musikauffassung, und doch sind beide, davon ganz unabhängig, uns Heutigen gleichermaßen fern oder nah. Nun ist der Blickwinkel, unter dem der postmoderne Liebhaber sog. klassischer Musik die Geschichte betrachtet, durchaus nicht alternativlos. Der jugendliche Popmusikhörer würde das Verhältnis zwischen seiner eigenen, leibhaftigen Gegenwart und der näheren oder ferneren Vergangenheit ganz anders darstellen: So vielleicht: Musikproduktion und Hörereinstellung sieht er als beständige Entwicklung, hin zum Aktuellen, in welchem er selbst sich aufhält, solange, bis es seinerseits von neuer Aktualität überboten sein wird. Nun aber eine überraschende Einsicht: Geschichte als eine stetige Aufwärtsentwicklung; im Gegenwort als Höhepunkt, in dessen Licht alles Frühere zur bloßen Vorstufe herabsinkt; die (heute aberwitzig anmutende) Meinung, menschliches Handeln sei als ununterbrochener Fortschritt zu begreifen, diese Sichtweise beanspruchte in Berlioz’ Lebenszeit (und darüber hinaus) unangefochtene Gültigkeit – zumindest in jenen Kreisen, die sich der „Avantgarde“ zugehörig wussten; Schriftsteller, Maler, Musiker, Zeitungsleute, Kunstsammler, Konzertbesucher, die sich 3 untereinander kannten und ihre Zugehörigkeit im Gespräch bestätigten. Berlioz sprach von ihnen, durchaus hochmütig, als dem „wahren Publikum“. Ferdinand von Hiller, scharfsinniger Beobachter des Musiklebens in Leipzig, Dresden, Köln, zuvor: 1828-35 in Paris, schrieb jedoch: „Hector Berlioz gehört nicht in unser musikalisches Sonnensystem – er gehört nicht zu den Planeten, weder zu den großen noch zu kleinen. Ein Komet war er, - weithin leuchtend, etwas unheimlich anzuschauen, bald wieder verschwindend; - seine Erscheinung wird aber unvergessen bleiben.“ (zitiert nach: W. Dömling, Hector Berlioz in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei Hamburg 1977, S. 141) II Die meisten Komponisten beginnen ihre Arbeit mit einem Entwurf: In jeder Notenzeile sind mehrere Orchester – oder Singstimmen zusammengezogen, hier z. B. von Richard Wagner zum mehrstimmigen, orchesterbegleiteten Gesang der Blumenmädchen aus „Parsifal“. Notenbeispiel Parsifal 4 Man kann den Entwurf gut am Klavier überprüfen und verbessern. Danach erst werden die Stimmen auf die verschiedenen Instrumente mit ihren charakteristischen Klangfarben verteilt. Hectors Vater, ein angesehener Arzt, ermöglichte seinem Sohn Unterricht auf der Gitarre und der Flöte, nicht am Klavier: Das hätte ihn vielleicht zu stark fasziniert und zu sehr von einem „ordentlichen“ Beruf abgelenkt. (Viele Väter dachten damals so.) Hector Berlioz komponierte auch später nicht vom Klavier aus und fertigte auch keine Klavierskizzen an. Er ging sogleich mit den Klängen und Klangfarben des ganzen Orchesters um; das, was andere Komponisten Instrumentation nannten, war für ihn deshalb die eigentliche Arbeit, auch noch aus einem anderen Grund: Musik solle nicht glatt und gefällig klingen, ausbalanciert zwischen den Instrumenten und Instrumentengruppen, sie habe vielmehr Gefühle und Leidenschaften auszudrücken – kontrastreich, farbig, durchaus mit plötzlichen Wendungen und heftigen Aisbrüchen. Berlioz’ Absicht, Instrumentation in den Dienst des Ausdrucks zu stellen, rechtfertigt den Versuch, umgekehrt, den Verlauf der Gefühlsregungen in einer Klangfarbenpartitur darzustellen: möglichst nicht gegenständlich, sondern intuitiv, mit sichtbaren Farben. Der Lehrer mag entscheiden, ob und wann er dazu die der Komposition beigefügten Texte heranzieht und verwendet. Zeichne den Verlauf des III. Satzes der Symphonie fantastique beim Hören nach! Versuche zu zeigen, wie sich die Klangfarbe ändert und an welcher Stelle dies geschieht! (nach wieviel Minuten und Sekunden?) Hirtenweise; ein 2. Hirte antwortet aus dem Hintergrund heraus. Hirtenweise; der andere Hirte antwortet nicht mehr. ideé fixe 5 Über den III. Satz „Szene auf dem Lande“ der Symphonie fantastique schrieb Berlioz: Als er Wer? Berlioz selbst? sich eines Tages auf dem Land oder ein anderer, ähnlich befindet, hört er empfindender Künstler? zwei Hirten spielen. Liebesgedanken und durch nicht nur der Text fordert Hoffnung, verdüstert geradezu Vergleiche mit Beet- dunkle Vorahnungen hovens VI. Symphonie heraus? (1830) Oboe I derrière la scène, hinter der Bühne; nicht nur in der Instrumentation (z. B. durch den Einsatz der Harfen), auch mit solchen, Raum suggerierenden Effekten nimmt die Symphonie Elemente der Oper auf. Aus dem Text des „Programmes“ in der Partitur von 1845/46: Das Duo der beiden Hirten, das leise Rauschen der sanft vom Wind bewegten Bäume – all dies bringt seinem Herzen einen ungewohnten Frieden und verleiht seinen Gedanken eine heitere Färbung. Er sinnt über seine Einsamkeit nach: er hofft, bald nicht mehr allein zu sein. Doch wenn sie ihn täuschte! Fernes Donnergrollen ... Einsamkeit ... Stille ... Aus dem Text des „Programmes“ in der Partitur von 1855 (und später): ... Da erscheint sie auf’s Neue; sein Herz stockt, Ist sie’s wirklich? Oder schmerzliche Ahnungen taucht lediglich ihr Bild aus steigen in ihm auf: seiner Erinnerung auf? Wenn sie ihn hinterginge! vgl. dazu die folgende Darstellung zur idée fixe! 6 idée fixe: Damit ist in der Pathologie eine Zwangsvorstellung gemeint. Berlioz übernahm die Bezeichnung und meinte mit ihr einen Gedanken, der ihn vollständig beherrschte, von dem er sich durch nichts abbringen ließ, obwohl die Vorstellung mit der Wirklichkeit überhaupt nicht übereinstimmte: Berlioz bewunderte Harriet Smithson, die mit einer englischen Theatergruppe auftrat und das Publikum für Shakespeare begeisterte (dessen Dramen bis dahin in Frankreich nahezu unbekannt waren). Berlioz war ihr in „infernalischer Leidenschaft“ verfallen, versuchte, sie auf sich aufmerksam zu machen, wollte ihr gegenüber als geachteter Komponist gelten, der seine eigene Befindlichkeit darzustellen vermag, nur: Sie ahnte davon nichts. Die Sehnsucht trieb ihn weiter an, bis es ihm tatsächlich gelang, ihr vorgestellt zu werden. Er heiratete sie – und durchlebte eine unglückliche Ehe, in der die gegenseitige Zuneigung bald erloschen war. Harriet Smithson als Ophelia, aus: Dömling, S. 51 Dass eine charakteristische Melodie an eine Person erinnert, die momentan gar nicht sichtbar ist, das ist eine in der Oper wohlvertraute Technik. Berlioz überträgt auch sie auf die Sinfonie: Immer wieder in den verschiedenen Sätzen erinnert eine Melodie – nicht an die ohne ihr Wissen verehrte Schauspielerin, sondern an das Bild, das der unglücklich Verliebte sich von ihr macht. Während er, in der Realität und in der 7 Phantasie, verschiedene Situationen durchlebt, stellt diese „double idée fixe“1, hörbar und im Traum sichtbar, zwischen ihnen und ihm selbst immer wieder neue Zusammenhänge her. Als melodische Gestalt wandelt sie sich jedes Mal, doch kann man sie jederzeit wiedererkennen. Im III. Teil der Symphonie hat sie folgende Gestalt: 1 aus dem Programmtext der Partitur (1. Auflage, 1845/46): „Infolge einer eigentümlichen Bizarrerie erscheint dem Künstler das geliebte Bild stets nur in Verbindung mit einem musikalischen Gedanken, in dem er einen gewissen leidenschaftlichen, aber noblen und schüchternen Ausdruck findet, wie er ihn dem geliebten Wesen zuschreibt. Dieses musikalische Abbild und sein Modell verfolgen ihn ununterbrochen wie eine doppelte fixe Idee. Dies ist der Grund, warum das Anfangsthema des ersten Allegro in allen Sätzen der Symphonie beständig wieder auftaucht.“ 8 III Vom wohlausgestatteten Elternhaus war bereits die Rede gewesen, betrachten wir es nun einmal als Umrissgestalt eines Bürgertums, das sich anschickt, nunmehr auch dem neu etablierten Adel dessen Privilegien streitig zu machen. Das Bürgertum hat sich eine Position selbst erarbeitet (nicht, wie der Adel, ererbt), und auch die erworbenen Bildungsgüter betrachtet es als ein Kapital: Sie gewährleisten, dass man sich seiner selbst vergewissern und mit seinesgleichen sich verständigen kann. Stoffe, die einen – in Frankreich – damals geläufig zu sein hatten und mit denen auch Berlioz sich beschäftigte, waren Orpheus, Doktor Faust, Aeneas (in Vergils Epos), Kleopatra; vom soeben wiederentdeckten Shakespeare: King Lear, Hamlet (Berlioz verliebte sich in die Darstellerin der Ophelia), Der Sturm, Romeo und Julia. Die Vertrautheit mit diesen Stoffen eröffnet auch für die Musik und ihr bürgerliches Publikum neue Möglichkeiten: Musik wird nicht mehr (möglichst unauffällig) durch Konstruktion zusammengehalten, sondern durch innewohnende Bedeutungen. Aber wie soll das geschehen? Kann denn eine Symphonie auf eine literarische Gestalt verweisen, ohne deren Geschichte zu erzählen? Und das in einer „Sprache“, der jede Eindeutigkeit in Wortwahl und Syntax abgeht? Bei der jeder dasjenige heraushören wird, das seiner eigenen Lebenserfahrung am besten entspricht? Die Schwierigkeit nimmt zu, wenn der Komponist die Vorlagen benutzt, um autobiographische Erfahrungen in ihnen abzuspiegeln oder assoziativ zu reihen. Hier bereits liegt es nahe, das Herstellen von Bedeutungszusammenhängen durch beigefügte Texte (durch ein „Programm“) behutsam zu steuern. Erst recht mag dies angemessen erscheinen, wenn auf ein literarisches Leitbild ganz verzichtet wird und ein 27jähriger, wohl etwas überschwänglicher, bisher eher als Dirigent hervorgetretener Musiker auf seine nur ihm eigene Lebens- und Phantasiewelt verweist – – als jemand, der im Träumen den Sinn für die Wirklichkeit verliert, bis hin zur Entfremdung von der realen Gesellschaft; – den niemand verstehen kann, nicht einmal jemand, dem er innig zugetan ist; – in einer Einsamkeit, die sich gleichgültig zeigt gegenüber dem unausgesprochenen Vorwurf, ungestüm, sprunghaft, launisch zu sein, in der 9 Übersteigerung eigenen Empfindens den Anspruch anderer nicht mehr wahrnehmen zu können. Im Vergleich hierzu bezeichnet man heute ganz andere Erfahrungen als „romantisch“. Es lohnt sich, sie als Kontrast in einem Wortfeld zusammenzustellen. unbeschwert, unalltäglich in gelöster Atmosphäre in angenehmer Umgebung (Blumenwiese, Kuschelmusik) stimmungsvoll (Kerzenlicht) IV Musik enthält Bedeutungen und wird durch sie zusammengehalten. Was die Musik dabei mitteilt, ist nicht eindeutig, aber eindringlich, bedeutsam. Sollte sie es dann bei der Übermittlung persönlicher Befindlichkeit bewenden lassen? Oder aber die romantische Egozentrik überwinden, Fragen aufwerfen, die die Gesellschaft im Ganzen, den Staat, die Zukunft angehen? Sich mitteilen in den jähen Umbrüchen zwischen Revolutionen und der Restauration? Partei ergreifen – das erscheint vielen zu riskant angesichts der raschen Veränderung der Verhältnisse. (Dass Berlioz ein glühender Verehrer Napoleons III. war, wussten wohl nur wenige.) Was jedoch immer ankommt und kaum Anstoß erregt, wer auch immer politisch das Sagen haben mag: die Oper: große Aufmachung, raffinierte Raumwirkung, elegante Körpersprache im Ballett; verfeinerte Virtuosität im Konzert, dazu die geistreiche Soirée mit den Künstlern, wenn man Glück hat mit Liszt, Chopin, Paganini; alles in allem also: Paris sucht höchste Perfektion, ist jedoch misstrauisch gegenüber unerwarteten Wendungen. Da passt Berlioz nicht so richtig hinein; zu sprunghaft ist 10 er, zu wenig berechenbar; zu wenig bemüht um ein Publikum, welches er eher verachtet; unhöflich, oft schroff – wie seine Musik. Über die Oper „Benvenuto Cellini“, 1836-38 entstanden, von einem romantischgenialen Außenseiter handelnd: Das Finale des ersten Aktes sei eine „Scene voller Bewegung, voller Leidenschaft, Aufregung, voller Gegensätze zwischen Helle und Dunkel, zwischen heiterem Lachen und dem Röcheln des Sterbens, zwischen üppigem Leben und schnellem Tod, zwischen Liebe und Mord, Zorn und Feigheit – eine Scene, in der die Menge zum ersten Mal mit ihrer großen und tosenden Stimme spricht.“ (zitiert nach: W. Dömling, a. a. O., S. 64) Berlioz hätte gern ein staatliches Amt gehabt, als Hochschullehrer z. B., aber es reichte nur zur – schlecht bezahlten – Stelle eines Bibliothekars (1839), daneben schrieb er Musikkritiken für verschiedene Zeitungen. Die Kompositionen, die er trotz ständigen Zeitmangels fertig stellen konnte, waren gleichwohl recht erfolgreich. Aber in seinen Briefen reißen die Klagen über Geldmangel nicht ab. Auch heute gibt es Veranstaltungen, Musiksendungen (z. B. im Fernsehen) oder auch Zeitungsberichte, die vom politischen Gespräch eher ablenken als sich daran zu beteiligen. Viele Menschen finden das auch gar nicht schlimm; Ablenkung sei notwendig, um sich erholen oder entspannen zu können. Was ist davon zu halten? 11 Obwohl er in Deutschland und England große Anerkennung als Dirigent findet, hat er Sehnsucht nach Paris – und hasst die Stadt, sobald er sie wieder erreicht hat: „Unsere finde Hauptstadt ich allem wieder vor mit materiellen Interessen beschäftigt, unaufmerksam und gleichgültig gegen das, was die Dichter und die Künstler begeistert... Ich finde wieder... ihre gelangweilten Gestalten und verdrießlichen Gesichter, ihre entmutigten Künstler, erschöpften Denker, die wimmelnde Menge an Dumm- köpfen, die entkräfteten, ausgehungerten, ster- benden toten oder Theater...“ Berlioz dirigiert ein Konzert der Société Philharmonique. Karrikatur von Gustave Doré, 1850; aus: Dömling, S. 101 Düsternis legte sich über den letzten Abschnitt seines Lebensweges. Auch seine zweite Frau und sein Sohn starben vor ihm, Krankheiten quälten ihn. 1869 starb er selbst, verbittert, vereinsamt. Berlioz, der Außenseiter, passte nicht in das „musikalische Sonnensystem“ (F. v. Hiller, s. o.): Zwischen den „Planeten“ bilden sich Bezüge und Beziehungen heraus; sie geben sich so, wie man es von ihnen erwarten kann – verlässlich, solide. Sie suchen in ihrem Umkreis nach gleichermaßen berechenbaren Partnern. Ihre Äußerungen, auch die musikalischen, gründen sich auf einen akzeptierten Standard, mit welchem sie allerdings brillant und virtuos umzugehen verstehen. Berlioz 12 hingegen offenbart schon in der Ausgestaltung der Melodik sein Bedürfnis nach individuellem Ausdruck, nach „expression passionée“; intensiver, als die „gültigen“ Regeln des Tonsatzes und die traditionellen Gattungsnormen es zulassen, oft den literarischen Leitbildern oder auch einer dramatisch sich entfaltenden, subjektiven Wahrheit verpflichtet. Die Einbeziehung räumlicher Wirkungen gehört dabei ebenso zu seinem Repertoire wie der Einbruch des Unvorhersehbaren in den rhythmischen Strom, bis hin zur Verzerrung und zur kalkulierten Schockwirkung. Verständnislosigkeit bei den Zuhörern ist indessen als ein Risiko stets mehr oder weniger präsent; ihm entgegenzuwirken hätte es der Hinwendung zu einer geeigneten Gattung bedurft, oder aber der abmildernden Zugeständnisse. Zu ersterem, als Opernprojekt immerhin denkbar, fehlte es an Gelegenheit, auch an Kraft, sich der Resignation zu widersetzen. Die andere Möglichkeit tritt im Spätwerk hervor, welches mehr und mehr in den Sog des Klassizismus gerät. Hierzu bemerkt Christian Berger in der neuen MGG: Berlioz habe zu erkennen gegeben, „wie wenig es ihm möglich war, das Entwicklungspotential, das in seinen satztechnischen „Qualitäten“ angelegt war, weiterzuführen. So ist es doch in erster Linie der revolutionäre Aufbruch der 1830er Jahre mit seinen radikalen satztechnischen und gedanklichen Neuansätzen, der unser Bild von Berlioz in besonders nachhaltiger Weise geprägt hat, und nicht das klassizistische Spätwerk der 1850er Jahre.“ Wahrhaftigkeit des Ausdrucks, diese Absicht verbindet Berlioz mit dem Werk des von ihm hochverehrten Christoph Willibald Gluck, ebenso aber auch mit der expressionistischen Motivation in der Malerei, der Literatur und der Musik des 20. Jahrhunderts. Das trägt dazu bei, dass Berlioz’ Musik trotz allem heute nachvollziehbar und verständlich ist, während ihre Inhalte der Gefahr, subjektiv und belanglos zu bleiben, nicht immer entgehen. 13