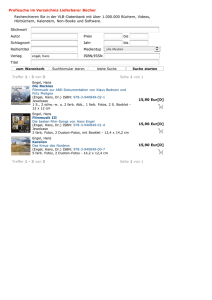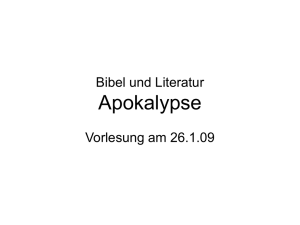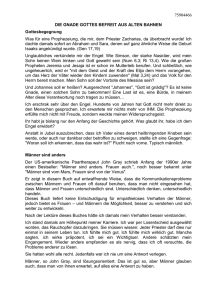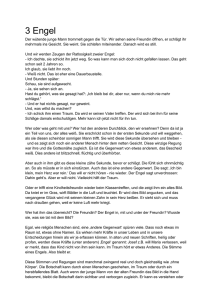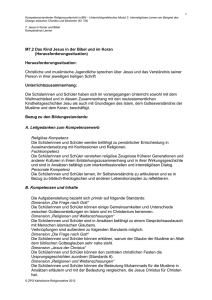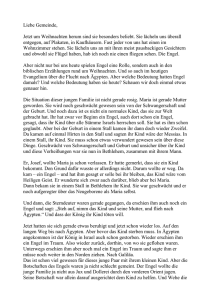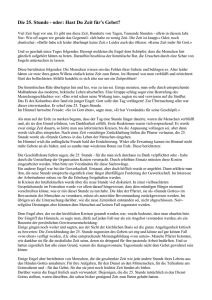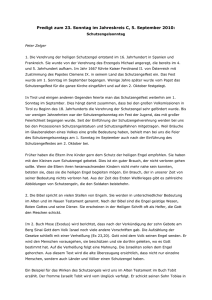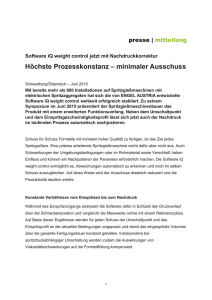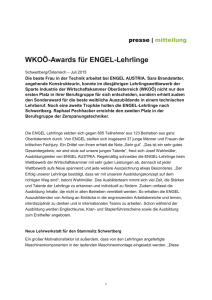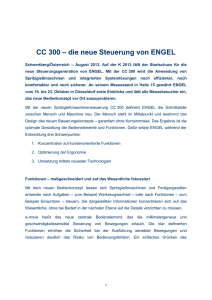Gesellschaft und Seele (äußerer und innerer Anderer)
Werbung

Kategorien der Sozialphilosophie, II. Teil, Kapitel 2 Inhalt Kategorien der Sozialphilosophie, II. Teil, Kapitel 2 2.1 Gesellschaftsleben und Seelenleben 2.2 Seelen-Leiden 2.3 Der Strukturwandel von Individualität 2.4 Mitte, Mit 2.5 Mittler – Engel z.B. 2.6. Differenz und Verführung / Ereignis 2.8 Das Labyrinth 2.9 Nomadistik 7 7 21 26 84 96 117 185 197 Der erste Teil dieses Werks erschien 2002 in einem Verlag, der seine Aktivitäten mittlerweile eingestellt hat. Ich habe mich daher entschlossen, diesen zweiten Teil im Internet auf meiner Heimatseite zu veröffentlichen und den potentiellen Lesern auf diese Weise unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Ohnehin mußte ich verschiedentlich erleben, daß Ergebnisse meiner Forschungen von anderen ohne Quellenangabe benutzt und verwertet wurden. Da erschien es mir nur folgerichtig, meine Erkenntnisse und Einsichten von vornherein zur allgemeinen Verfügung freizugeben.1 Für mich selbst hat diese Publikationsform den Vorteil, die Ergebnisse kapitelweise ins Netz stellen zu können und nicht die angesichts befristeter Lebenszeit ungewisse Vollendung des Ganzen abwarten zu müssen. Gleichwohl hat das Ganze einen Plan und seine potentielle Vollendung ist daher absehbar, obwohl vielleicht dann nicht mehr erwartbar. Der üblicherweise notwendigen Revision früherer Kapitel 1 Zur Problematik des sogenannten „Geistigen Eigentums“ s.: Die Debatte um geistiges Eigentum. Interdisziplinäre Erkundungen, hrsg. v. Th. Eimer, K. Röttgers u. B. VölzmannStickelbrock. BieIelefeld 2010, und insbes. meinen Beitrag darin: Eigentum am Text, p. 181-210. durch spätere Erkenntnisfortschritte werde ich dadurch Rechnung tragen, daß bei gegebenem Anlaß revidierte Fassungen der einzelnen Kapitel erscheinen werden. Revisionen werden dann durch Versionsnummern und Daten erkennbar sein. 2. Gesellschaft und Seele (äußerer und innerer Anderer) 2.1 G ESELLSCHAFTSLEBEN UND S EELENLEBEN In diesem Kapitel wird es um die Frage gehen, inwieweit man – ausgehend von der sozialen Medialität des kommunikativen Textes – von einer Korrespondenz der Innenwelt des Psychischen und der Außenwelt der sozialen Beziehungen sprechen kann. Man kann diese Frage noch etwas präziser formulieren, indem man die Richtungen der Sinn-Dimension des kommunikativen Textes einbezieht. Insofern wäre zu fragen, inwieweit die epistemischen und die moralischen Strukturen im Inneren eines Selbst, d.h. zu dem inneren Anderen eines Selbst, denjenigen zu seinem äußeren Anderen entsprechen. Der moderne Individualismus hatte eine radikale Inkongruenz dieser beiden Sphären behauptet, angefangen von Mandevilles These der „private vices“ als „public benefits“1 bis zu Homanns These, daß die klassische Ethik des individuellen Verzichts den Bedingungen der Marktgesellschaft der gemeinsamen Steigerung von Vorteilsnahmen nicht mehr entspreche. 2 Der Inkongruenz-These konnte in der Moderne unter zwei Hinsichten widersprochen werden: Entweder man sagte: Da die Gesellschaft (angeblich!) aus Menschen bestehe, könne im Sozialen nur gefunden werden, was in den Menschen angelegt sei, sowohl in ihren Handlungsstrukturen als auch in ihren Erkenntnisstrukturen. Angesichts der kaum mehr zu ignorierenden Dominanz des Medialen hat es eine solche anthropozentrische Sicht zunehmend schwer, sich noch überzeugend zur Geltung zu 1 Anonymus (d.i. B. de Mandeville): The Fable of the Bees: or, Privates Vices, Publick Benefits. London 1714. 2 K. Homann: Taugt die abendländisch-christliche Ethik noch für das 21. Jahrhundert.- In: ders.: Anreize und Moral. Münster 2003, p. 3-25. bringen. Oder aber man redete von der sozialen Bedingtheit der Erkenntnis- und Handlungsstrukturen. In der Pädagogik entfaltete sich der Widerspruch der zwei Lager in der Kontroverse: angeboren – anerzogen. Heute versuchen die Epigenetiker3 einen Kompromiß zu formulieren, der aber im Grunde schon bei Marx vorformuliert war, als dieser davon sprach, daß die Menschen zwar die Geschichte „machen“ – aber nicht aus freien Stücken. Es ist aber doch eben die Frage, ob die Kontroverse um die Inkongruenz-These unausweichlich ist, oder ob nicht die medialitätszentrierte Postmoderne andere Perspektiven auf den Zusammenhang von Innen und Außen eröffnet. Dann wäre nicht mehr zu entscheiden, ob Wissen und Werte von den Individuen oder den Gesellschaften „produziert“ werden, in Übereinstimmung oder auch nicht, sondern dann wäre zu fragen nach der Stellung, nach dem Ort von Wissen und Werten im kommunikativen Text, d.h. dem prozessual begriffenen Verhältnis der Funktionspositionen von Selbst und (innerem und äußerem) Anderen. 2.1.1 Neuformulierung der Begriffe „Seele“ und „Gesellschaft“ Wir gehen also im folgenden vom kommunikativen Text als dem Zwischenbereich aus. Kommunikativer Text, also Text, soll dieser Bereich deswegen heißen, weil er erstens syntagmatisch (prozessual) ist (im Unterschied zum Paradigma oder Sprachsystem), weil er zweitens tatsächlich sprachlich (kulturell) verfasst ist (im Unterschied zur bloßen Leib-Vermittlung (als welche gewisse Phänomenologen diesen Zwischenbereich als Leitbegriff genommen haben) und weil er drittens von Anfang an ein soziales Phänomen ist. Der kommunikative Text entfaltet sich also zugleich in den drei Dimensionen der Zeit, des Sinns und des Sozialen. So wie aber Zeitlichkeit sich von Anfang an in zwei entgegengesetzte Richtungen entfaltet (Zukunft und Vergangenheit), von der Aktualität, d.h. der Gegenwart des Textes aus gesehen, so stehen im Diskursiven (der Dimension des Sinns) sich die beiden Richtungen des Epistemischen (bei Kant die „Kritik der reinen Vernunft“) und des Normativen (bei Kant die „Kritik der praktischen Vernunft“) entgegen. Im Sozialen wollen wir diese zwei Pole nach der Innen/Außen-Differenz markieren.4 Das Selbst im kommunikativen Text ist mit seinem Inneren und mit seinem Äußeren konfrontiert, wobei das Selbst den Indifferenzpunkt bezeichnet, dem in der Zeitdimension die Gegenwart entspricht. Hier den Husserlschen Zeitanalysen zu folgen, heißt aber auch, zwei Formen von Vergangenheit auseinanderzuhalten: die mit der Gegenwart mitgegebene Retention und die durch eine eigene Intention konstituierte Reproduktion. Die Mitgegebenheit können 3 B. Kegel: Epigenetik. Wie unsere Erfahrungen vererbt werden. 2. Aufl. Köln 2009. 4 Cf. D. Wyss: Mitteilung und Antwort. Göttingen 1976, p. 147-189. wir unter der Bedingung als Nähe bezeichnen, daß wir nicht eine vermeintlich objektiv vorgegebene Zeit als Maß von Nähe und Distanz verwenden, sondern die Qualität eines ungebrochenen Kontinuums. Die Reproduktion als eigener intentionaler Akt dagegen setzt immer eine über die Wahrnehmungsgegenwart und ihre Nähe der Retentionen hinausgehende zweite Intention voraus, die sich zu der ersten als ein Bruch verhält. Durch die Reproduktion wird die Nähe des Kontinuums gebrochen und zu einer neuen (konstruierten) Kontinuität zusammengefügt. Das gleiche gilt für die Zukunft: protentional mitgegebene Zukunft, also (in der klassischen Harmonik) das Schon-Erwarten des auflösenden Grundakkords beim Erklingen des Quintseptakkords einerseits, die explizite Vorstellung zukünftigen Geschehens andererseits: wird er mich nach dem Konzert zu einem Drink einladen? Beide Erwartungen können enttäuscht werden, da ja die Zukunft offen ist, aber sie ist in beiden verschiedenen Erwartungen auf verschiedene Weise offen. Diese Analyse-Struktur (bidirektional und gebrochen/ungebrochen) lässt sich nun auch auf die anderen beiden Dimensionen des kommunikativen Textes erfolgreich übertragen, wobei uns hier im Moment nur die soziale Dimension zu interessieren braucht. Begrifflich können wir dabei folgende Analoga feststellen: Dem Begriff der Gegenwart (bezogen auf den kommunikativen Text) lassen wir den Begriff des Selbst entsprechen, beide sind nichts anderes als zentrierende Funktionsorte für die Differenzierung der Richtungen. Diesem Konzeptualisierungsvorschlag zufolge muß dem Selbst jegliche Substantialisierung oder feste Verbindung mit einer Substanz abgesprochen werden. So wie Gegenwart nicht heißt 7.30 Uhr, oder allenfalls zweimal am Tag (wenn man die Zuordnung auf eine objektive Zeit einen Moment für zulässig erklärt), so heißt „Selbst“ natürlich nicht Kurt Röttgers (nicht einmal Peter Handke5), ja sogar das Fichtesche Ich oder das Subjekt der Moderne können hier nicht eintreten. So wie die Gegenwart von eben, was den substantiellen Gehalt betrifft, jetzt Vergangenheit ist, so ist auch das Selbst abgeschattet in sein Anderes, den relationalen Gegenbegriff zum Selbst. Der temporalen Nicht-Gegenwart entspricht das Andere des Selbst, das mit diesem zusammen changiert. So wie wir aber keine Mühe haben, in der Nicht-Gegenwart Zukunft und Vergangenheit als zwei Richtungen auseinander zu halten, obwohl doch beide nicht zuhanden sind, haben wir ebenfalls keine Probleme, den Anderen als einen inneren und als einen äußeren Anderen des (wechselnden) Selbst zu betrachten. Wenn wir diese beiden Richtungen des Nicht-Selbst wiederum nach „ursprünglichem“ Kontinuum und reflektierter Kontinuität differenzieren, so entstehen uns vier zu besetzende Begriffsfelder. Den äußeren Anderen nach Nähe und Distanz zu differenzieren, ist nicht besonders schwierig, weil Ferdinand Tönnies mit seiner Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft 5 Anspielung auf P. Handkes Roman: Mein Jahr in der Niemandsbucht. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1994, in dem das mit Abstand häufigste Wort des Buches lautet: „Ich“. den entscheidenden begrifflichen Unterschied eingeführt hat, der in seiner Differenziertheit und vor allem in ihrer funktionalen Begründung durch „Willens“-Manifestationsformen von der Kommunitarismus-Debatte überhaupt noch nicht eingeholt worden ist, vor allem aber auch weil diese sich des Abgleitens in substanzmetaphysische Begründungen oft nicht zu erwehren weiß. Etwas schwieriger wird es – wie sollte es auch anders sein –, wenn wir nach innen blicken. Zuvor aber noch eine Vorbemerkung zur obigen Verwendung des Wortes „ursprünglich“. Ursprünglichkeit ist nicht Unmittelbarkeit, sondern eine hoch vermittelte Fiktion. Wir kommen nicht aus dem Heil (aus dem biblischen Paradies, der Rousseauschen Natur o.ä.), sondern wir leben (vielleicht notwendigerweise) in und aus dem Glauben, wir kämen aus dem Heil. Damit ist der Ursprung nichts Ursprüngliches, sondern der Reflexionsinhalt „Unreflektiertes“. Schon an dem Begriff der Retention ließe sich das aufweisen. Das retentional Mitgegebene einer intentionalen Wahrnehmungsgegenwart liegt außerhalb des Intendierten (Husserl spricht vom „Hof“ der Gegenwart, wie vom Hof des Mondes). Erst die Reflexion darauf fördert diese „ursprüngliche“ Vergangenheit zu Tage. – So darf auch die soziale Analyse von Gemeinschaft nicht zu dem Irrtum verleiten, sie sei die Grundlage aller sozialen Beziehungen.6 Wenn wir uns nun auf die Suche nach der Begrifflichkeit für den inneren Anderen machen, so können wir vielleicht diesen insgesamt als „Seele“ bezeichnen, aber so wie dieser Begriff in der heutigen Psychologie weitgehend verfemt oder ignoriert ist, so läßt uns die Psychologie in der begrifflichen Erschließung dieser DimensionsRichtung des kommunikativen Textes weitgehend allein. Es sei daher vorgeschlagen, für die Nähefunktion des Seelischen den alten deutschen Begriff des Gemüts wieder einzuführen.7 Nach Auskunft der Etymologen bezeichnet das seit dem 9. Jahrhundert 6 So H. Plessner: Grenzen der Gemeinschaft.- In: ders.: Gesammelte Schriften, hrsg. v. G. Dux, O. Marquard u. E. Ströker. Frankfurt a. M. 1980ff. V, p. 7-133; anders dagegen J. Dewey, der von der „Great Community“ (statt von der Great Society) sprach, dem folgen heute die Kommunitaristen; s. T. Schultz: Die „Große Gemeinschaft“. Essen 2001. 7 Daß es auch eine untergründige philosophische Tradition des Redens von Gemüt gibt, speziell in der Mystik seit Meister Eckart, darauf verweist H. Emmel/Red.: Gemüt.- In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter Bd. III. Basel, Stuttgart 1974, Sp. 258-262; bemerkenswert für den begriffsgeschichtlichen Übergang von dem umfassenden Kollektiv-Begriff für Seelisches zum heutigen eingeengten Begriff ist ein dort angeführtes Zitat von F. Schlegel: „Sinn, der sich selbst sieht, wird Geist; Geist ist innre Geselligkeit, Seele ist verborgene Liebenswürdigkeit. Aber die eigentliche Lebenskraft der innren Schönheit und Vollendung ist das G.[emüt].“ (zit. Sp. 259, folgende Zitate dort) – in seiner Charakteristik Lessings dagegen bezeichnet Schlegel Gemüt als „lebendige Regsamkeit und Stärke des innersten, tiefsten Geistes“ (F. Schlegel: Kritische Ausg., II, München, Paderborn, Wien, Zürich 1967, p. 106. belegte Wort als Kollektivbildung zu „Mut“ anfänglich „die Gesamtheit aller Sinnesregungen und seelischen Kräfte“, eine Einengung der Bedeutung auf affektive Regungen sei erst seit ca. dem 18. Jahrhundert vonstattengegangen. Diese Sprachverwendung folgt nicht vollständig dem älteren Sprachgebrauch, wo Gemüt oftmals lateinisch mens entspricht, was dann heute eher mit „Geist“ wiedergegeben wird. Man vergleiche jedoch Meister Eckhart: „Ein kraft ist in der sêle, diu heiʒet das gemüete …“ Und an anderer Stelle spricht er sogar vom Gemüt als „dem innersten wesen der sêle“, der Ort, an dem Gott zur Seele spricht. Wenn also Gemütskrankheit ziemlich eindeutig die deutsche Bezeichnung für Melancholie ist, so handelt es sich vermutlich um eine Störung der inneren Nahbeziehungen, die natürlich mit Störungen äußerer Nahbeziehungen eines Selbst in Verbindung stehen kann und oft stehen wird. Wir wollen in Absetzung davon die auf einem Kontinuitätsbruch und auf Reflexion beruhenden Seelen-Teile Selbstbewußtsein nennen. In dem Begriff deutet sich auch die (explizite) Bezogenheit des inneren Anderen auf ein Selbst an, zugleich aber bleibt deutlich mit der gesamten philosophischen Tradition der Reflexionstheorie, daß reflektierendes und reflektiertes Selbst nie identisch sind, so daß Selbstbewußtsein etwas ganz anderes ist als die Bewußtheit (von etwas) eines Selbst. Andererseits bleibt in der Bezogenheit aufeinander deutlich, daß es sich nicht um Substanzen handelt, sondern um wechselbare Positionen in der sozialen Dimension des kommunikativen Textes. Nun baut sich aber die soziale Welt, nicht aus Dyaden oder Dyadenverkettungen auf. Diesem Grundirrtum unterliegen Kontraktualismus und Anerkennungstheorie in gleicher Weise. Keine Gesellschaftsstruktur läßt sich aus lauter Zwischenmenschlichkeit aufgebaut denken. Erst die Figur des Dritten,8 der mehr ist als bloß ein weiterer Anderer, konstituiert das Soziale. Er stört, er vermittelt, er verbindet, er trennt, er wird eingeschlossen, er wird ausgeschlossen. Auf jeden Fall begründet er eine weitere Ebene: Er beobachtet und beurteilt die Beziehung von Selbst und Anderem und gegebenenfalls interveniert er. Aber es gibt keinen Grund, nun voreilig den Egalitarismus zu verabschieden und sich etwa einem hierarchischen Schema zu verschreiben. Denn der Dritte ist ebenso wenig substantiell festgelegt wie Selbst und Anderer. Insofern wechselt auch die Position des Dritten. In der Ehe scheint das Kind, als Neuankömmling einer weiteren Generation, der Dritte zu sein. Achtet man jedoch auf die vorgeburtlichen und nachgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehungen, so scheint eher der 8 M. Serres: Der Parasit. Frankfurt a. M. 1981; G. Simmel: Soziologie. Frankfurt a. M. 1992 (= GSG XI), p. 63-159; K. Röttgers: Kategorien der Sozialphilosophie. Magdeburg 2002, p. 245-271; Th. Bedorf: Dimensionen des Dritten. München 2003; P. Delhom: Der Dritte. München 2000. Vater der Dritte zu sein. Achtet man auf Geschlechtsgenossenschaft etwa eines Sohnes, dann ist die Mutter die Dritte; achtet man auf die ödipalen Verhältnisse, kehrt sich letzteres um. An diesem Punkt kann aber auch die strikte Trennung von Innen und Außen nicht aufrechterhalten bleiben.9 Denn in die innere Selbst-Beziehung kann sehr wohl ein äußerer Dritter intervenieren. Alle Erziehungsprozesse,10 insofern sie sich nicht extrem rousseauistisch selbst mißverstehen, sind von der Art der Intervention in die Beziehung eines Selbst zu seiner Seele. Und wenn ein Selbst seine Beziehung zu einem Anderen „selbst-kritisch“ prüft, dann tut es nichts anderes, als in die äußere Beziehung von der Position eines inneren Dritten aus zu intervenieren. Wenn wir aber einen allgemeinen Begriff des Dritten im Inneren bilden wollen, so versagt unsere Sprache darin ebenso wie bei dem äußeren Dritten, von dem wir auch nur sagen konnten, daß es die sozialkonstitutive Funktion ist. Einmal ist es das Kind in der Ehe, ein andermal ist es der Richter über Konflikten, wieder ein anderes Mal ist es die (ausgeschlossene) Geliebte. So wie die Rollen, das heißt die Funktionen im Äußeren verschieden besetzt werden können, so auch hier im Inneren. Und wie es im Äußeren zu Umbesetzungen von Rollen kommen kann (erst wird zur Beilegung ehelicher Spannungen ein Kind gezeugt, und wenn sich dieser Dritte als unzulänglich 9 Kritisch dazu bereits Novalis: Schriften II, hrsg. v. R. Samuel. Darmstadt 1965, p. 419: „Nach Innen geht der geheimnißvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt…“ (= Athenäumsfragment Nr. 17) Und: „Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren. Wo sie sich durchdringen, ist er in jedem Punkte der Durchdringung.“ (ibd., Ath.fragm. Nr. 20) Und ferner: „in sich zurückgehn, bedeutet bey uns, von der Außenwelt abstrahiren. Bey den Geistern heißt analogisch, das irdische Leben eine innere Betrachtung, ein in sich Hineingehn, ein immanentes Wirken. So entspringt das irdische Leben aus einer ursprünglichen Reflexion, einem primitiven Hineingehn, Sammeln in sich selbst, das so frey ist, als unsere Reflexion. Umgekehrt entspringt das geistige Leben in dieser Welt aus einem Durchbrechen jener primitiven Reflexion. Der Geist entfaltet sich wiederum, geht aus sich selbst wieder heraus, hebt zum Theil jene Reflexion wieder auf, und in diesem Moment sagt er zum erstenmal Ich. Man sieht hier, wie relativ das Herausgehn und Hineingehn ist. Was wir Hineingehn nennen, ist eigentlich Herausgehn, eine Wiederannahme der anfänglichen Gestalt.“ (l. c., p. 431, Ath.fragm. 43) 10 Erwähnt seien Befehl, Ermahnung und Appell, s. O. F. Bollnow: Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung. 2. Aufl. Stuttgart 1959; was wir den Interventionscharakter nennen, also der Identitätsbildung durch Ereignis (K. Röttgers: Identität als Ereignis. Bielefeld 2016), faßt Bollnow unter den Begriff des Unstetigen, zur Ermahnung speziell s. p. 60-77. erweist, wird die Scheidungsrichterin aufgesucht, vielleicht vorher die Geliebte), so kommt es auch bei der Besetzung des inneren Dritten zu unterschiedlichen Besetzungen. Es können das Gewissen (wie ein Richter), es können die Phantasie (wie eine Geliebte), es können aber auch Repräsentationen äußerer Anderer und Dritter im Inneren die Rolle des Dritten spielen, um die Ausweglosigkeit des Narzißmus auf ein echtes und reiches Seelenleben hin zu durchbrechen. Die Psychoanalyse hatte bei Freud das Über-Ich, bei Lacan den „Namen des Vaters“ in dieser Position entdeckt.11 Wir wollen aber auf eine dritte Figur des Sozialen hinweisen und nach ihren psychischen Analoga fragen. Es ist dieses die Gestalt des Fremden. Und unter Fremdem wollen wir etwas anderes verstehen als nur einen Anderen, der noch ein bißchen mehr anders ist als andere Andere. Die xenologische Beziehung eines Selbst ist etwas anderes als bloß eine Steigerung der Alteritätsbeziehung, so daß wir bei entsprechender Gutwilligkeit jeden Fremden als einen Anderen behandeln und verstehen könnten, also gewissermaßen ein-andern könnten. Anders als im Zusammenhang von „ursprünglichem Kontinuum“ und rekonstruierter Kontinuität liegt zwischen Eigenem und Fremdem ein nicht überbrückbarer Abgrund, ein Grenzland. Zur Herausbildung des Bewußtseins von Eigenheit (inklusive Eigentum) gehört die Ausgrenzung des Fremden. Zwar kann jeder konkrete (vormalige) Fremde verstanden und damit zu einem Anderen gemacht werden, mit einer solchen Einzelmaßnahme erübrigt sich aber nicht die Notwendigkeit der Unterscheidung von Eigenem und Fremdem und damit die Aufrechterhaltung irgendeiner Art von Abgrenzung. Das „Fremdeln“ ist unverzichtbar für die Begründung und Erhaltung von Eigenheitsbewußtsein. Der/das oder die Fremde12 ist das Jenseits der Grenze des Verstehens, es ist zugleich bedrohlich, weil es die Gestalt der Frage an das Selbstverständliche ist, aber darin genau ist es auch faszinierend und verführerisch. Diese Wilden13 stehen außerhalb des kommunikativen Textes, in dem sich die Positionen von Selbst und Anderem bewegen. Das Wichtige ist aber hier, wie bisher schon, daß es nicht substantiell festmachbare Eigenschaften sind, die den Fremden zum Fremden machen. Denn fremd ist er ja immer nur in Bezug auf eine Sphäre der Eigenheit. Ob er sich selbst oder seinesgleichen fremd ist, eben das wissen wir genau deswegen nicht, weil wir seine Fremdheit-zu-uns nicht verstehend an-eignen können – … wenn er denn noch ein Fremder ist. Da aber diese Fremdheitsgrenze weder substantiell festliegt noch auch in modernen und postmodernen Gesellschaften stabil ist, kann die Grenze auch plötzlich ganz 11 Zur philosophischen Interpretation der Lacanschen Psychoanalyse s. A. Jurainville: Lacan und die Philosophie. München 1990, zur väterlichen Metapher insbes. p. 193-204. 12 Die Fremde, hrsg. v. K. Röttgers u. M. Schmitz-Emans. Essen 2007. 13 K. Röttgers: Wildnis und Wahn.- In: dass., p. 97-112; s.u. auch zu der Fremdheitsanmutung durch die Nomaden, besonders krass in Kafkas Darstellung der „Nomaden aus dem Norden“ s.u.). in der Nähe auftauchen. So kann es sein, daß uns die Lebensgefährtin, mit der wir jahrelang Tisch und Bett in großer Vertrautheit geteilt haben, jäh ganz fremd erscheint. Wir glaubten sie zu kennen und zu verstehen, und plötzlich ist sie uns faszinierend oder bedrohlich fremd. Eine solche Plötzlichkeit der Begegnung ist unter anderem der Grund, warum es unangemessen erscheint, Fremdheit als Steigerung von Alterität zu begreifen. Mit den gesellschaftlichen Anderen sind wir in einen Text eingebunden, in dem Verträge, Normen etc. die gegenseitigen Erwartungen steuern und absichern. Mit dem oder der Fremden und Fremdbleibenden ist nur etwas Atextuelles möglich: Sex oder Gewalt – in ihren textualitätsfreien Formen, das heißt als sinnlose Gewalt und als liebelose Leidenschaft, wobei in der Tat die Beziehungen der Nähe eher durch zügellosen Sex, die gesellschaftlichen Beziehungen eher durch terroristische Gewalt bedroht zu sein scheinen. 2.1.2 Soziologie und Sozialphilosophie zur Frage der Normen und Werte Die „Deutsche Gesellschaft für Soziologie“ bekennt sich in § 1 ihrer Gründungsurkunde von 1910 zum Prinzip der Wertfreiheit und distanziert sich genau damit von der Sozialphilosophie, die mit Stammler die Wertbezogenheit der philosophischen Erkenntnis betont hatte.14 Diese Distanz von „wertfreier“ Soziologie und „moralisierender“ Sozialphilosophie ist von der Soziologie immer wieder abgrenzend betont und von der Sozialphilosophie bereitwillig akzeptiert worden, hatte sie doch damit neben der „wissenschaftlichen“ Soziologie ihre Existenzberechtigung, die ihr als phänomenologisch bloß beschreibender Disziplin strittig gemacht worden wäre und ist. Die Soziologie meinte damit die Sozialphilosophie aus der wissenschaftlichen Seriosität hinausdefiniert zu haben. Aber genau an dieser Stelle ist Differenzierung geboten. In Deutschland war seit den Tagen der ungefähr gleichzeitig entstehenden Soziologie und Sozialphilosophie so etwas wie ein Umspielen der Abgrenzung möglich, wofür vor allem die Sozialphilosophie Georg Simmels das hervorragendste Beispiel abgibt. Zwischen Soziologie und Psychologie hatte schon Georg Simmel mit seinem letzten Exkurs in der großen „Soziologie“ von 1908 einen als sozialphilosophischen 14 R. Stammler: Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Eine sozialphilosophische Untersuchung. Leipzig 1896; s. auch K. Röttgers: 100 Jahre Sozialphilosophie.- In: ders.: Sozialphilosophie. Macht – Seele – Fremdheit. Essen 1997, p. 59106, zu Stammler p. 59-64; jetzt auch in gleichem Sinne F. Fischbach: Manifest für eine Sozialphilosophie. Bielefeld 2016. Weg bezeichneten Mittelweg gesucht und eine „Analogie der individualpsychologischen und soziologischen Verhältnisse“ statuiert.15 Um diese Analogie feststellen zu können, bedürfe es eines Gesichtspunkts außerhalb von Soziologie und Psychologie. Denn alles kann Gegenstand der Soziologie werden, weil die Soziologie nicht „die“ Gesellschaft zum Gegenstand hat, d.h. einen bestimmten, wohl ausgegrenzten Ausschnitt aus der Wirklichkeit, sondern eine Perspektive einnimmt, unter der die gesamte Wirklichkeit ihr Gegenstand werden kann. Ähnliches gilt für die Psychologie, auch sie behandelt die Wirklichkeit unter einem bestimmten Aspekt. Der Widerspruch, in den diese beiden Wissenschaften geraten können, ist daher einer der Aspekte, ist folglich auf dieser Ebene der Konfrontation nicht aufzulösen. Wir müssen daher einen Gesichtspunkt einnehmen, der außerhalb dieser beiden Disziplinen liegt. Dieser Gesichtspunkt ist die Sozialphilosophie. Nach Simmel ist diese sozialphilosophische Perspektive eine, deren „Inhalt nicht die Erkenntnis der Gesellschaft, sondern die eines allgemeinen Zusammenhanges ist, der an der sozialen Form nur eines seiner Beispiele findet.“16 Ähnliches gilt wiederum für die Psychologie, die sich nicht ein vermeintliches Objekt namens „Seele“ zum Gegenstand erwählt, sondern die an der psychischen Form nur eines ihrer Beispiele findet. Und wegen des formalen Charakters liest sich eine erste Formulierung der „Analogie“ folgendermaßen: nämlich „daß sich die Individuen innerhalb einer Gesellschaft vielfach zueinander in den gleichen Formen verhalten, wie die seelischen Bestandteile innerhalb eines Einzelgeistes.“17 Da es sich bei Simmel um eine formale Soziologie handelt, sind hier weder unter „Individuen“ noch unter „seelischen Bestandteilen“ substantielle Letzteinheiten zu verstehen, aus denen das komplexere Ganze aufgebaut wäre, sondern Teil und Ganzes sind korrelativ zueinander. Daher setzt er auch in diesem philosophischen Exkurs die Analogie auf einer relativ abstrakten Ebene an. Er spricht von „regelmäßig sich wiederholenden Verhältnisformen“. Und er stellt fest, daß in beiden Verhältnisformen ein relativ homogenes Ganzes sich nur unter der Bedingung zu einer Differenzierung und Erweiterung entwickeln kann, daß die Elemente in sich selbständig seien und von anderen höher differenziert seien. Diese Selbstständigkeit aber gerät mit in gleicher Weise höher entwickelter Selbständigkeit der differenten anderen Elemente zwangsläufig in Konflikt, in „einer Art Kampf ums Dasein.“ Durch den Aspektwechsel auf Philosophie hofft Simmel den „allgemeinen Verhältnistypen“ ein „tieferes Fundament“, wie er sich ausdrückt, geben zu können.18 15 G. Simmel: Exkurs über die Analogie der individualpsychologischen und der soziologischen Verhältnisse.- In: ders.: Soziologie, p. 850-855. 16 l. c., p. 850. 17 ibd. 18 ibd. Das enthebt nicht von der Aufgabe, die unmittelbaren Relationen zwischen Seele und Gesellschaft zu erforschen, weil ja gar nicht auszuschließen sei, daß die Kategorien analoger Verhältnistypen ein fundamentum in re, will sagen, in einer einseitigen oder wechselseitigen Bestimmung haben. Simmel, für den der kantisch-fichtesche Begriff der „Wechselwirkung“ (im Englischen als interaction, im Deutschen dann als Interaktion übersetzt) eine so bedeutende Rolle spielt, votiert natürlich für die Untersuchung in beide Richtungen. Als Beispiel wählt er den Begriff der „Parteiung“: „Die Interessen im Individuum bekämpfen sich unzählige Male, wie die Individuen sich bekämpfen.“19 In beiden Dimensionen sammeln sich zum Beispiel Interessen um Leitvorstellungen, beziehungsweise Individuen um Führerfiguren. Er veranschaulicht die Parallelität an weiteren Merkmalen, auf die hier nicht einzugehen ist. In der einen Richtung spricht er von „inneren Erfahrungen“, die für die Wahrnehmung gesellschaftlicher Vorgänge als Apriori wirkten und von den Vorbereitungen von Handlungen durch seelische Vorgänge. In der anderen Richtung spricht er davon, daß die Beobachtung äußerer Vorgänge das Schema zur Interpretation des Inneren bildeten: „Das Äußere wird durch das Innere, das Innere aber durch das Äußere gestaltet und verstanden, in Abwechslung, aber sicher auch oft im Zugleich.“ 20 Mehr als bloße Hinweise auf einen gewichtigen Zusammenhang stellen die fünf Seiten des Exkurses innerhalb der circa 850 Seiten der „Soziologie“ nicht dar. Und es ist weniger eine Zusammenfassung als die Markierung eines Forschungsfeldes, wenn der letzte Satz lautet: „Die uns unmittelbar nicht ergreifbare, nicht ausdrückbare Einheit des Individuums und der Gesellschaft offenbart sich darin, daß die Seele das Bild der Gesellschaft und die Gesellschaft das Bild der Seele ist“21, aber immerhin eines, das sich lohnt weiterzuverfolgen und Anknüpfungen an es zu suchen.22 Es läßt sich nämlich in einer Sozialphilosophie des kommunikativen Textes dazu etwas mehr sagen als die Feststellung einer bloßen „Analogie“. Jenes von Simmel angesprochene „tiefere Fundament“ kann angesehen werden als die Medialität des Zwischen, und zwar eines Zwischen zwischen dem Selbst und dem äußeren Anderen, gemeinschaftlich oder gesellschaftlich, und zwischen dem Selbst und dem inneren Anderen, gemüthaft oder selbstbewußt. Dieses Zwischen ist gefüllt als der kommunikative Text, also als der soziale Prozeß, der die Funktionspositionen von Selbst und 19 l. c., p. 851. 20 l. c., p. 853. 21 l. c., p. 855. 22 Eine solche Anknüpfung haben Wolfgang Mack und Kurt Röttgers versucht: W. Mack, K. Röttgers: Gesellschaftsleben und Seelenleben. Anknüpfungen an Gedanken von Georg Simmel. Göttingen 2007. Anderem allererst organisiert. Als reine Medialität ist der Prozeß zwar kein „Gegenstand“ einer objektorientierten Wissenschaft, gleichwohl hat er eine Gestalt, die sich aus dem Zusammen der drei Dimensionen der Zeit, des Sozialen und des Sinns figuriert. Durch Ausführungen im Rahmen einer Sozialphilosophie des kommunikativen Textes dazu kommen wir weiter als bloß zur Feststellung einer Analogie. Historisch gesehen, war die Sozialphilosophie zunächst in ihrer methodischen Ausrichtung von der kritischen Philosophie Kants ausgegangen, bei Simmel, aber vor allem auch bei Rudolf Stammler, jenem anderen Gründervater der Sozialphilosophie in den 1890er Jahren,23 und stellte sich ihr daher vorrangig das Problem der Zugehörigkeit zur theoretischen oder zur praktischen Vernunft. War dann diese Einseitigkeit bei O. Spann erstmals durchbrochen worden24 und schließlich bei Horkheimer eine Anbindung an die dialektische Philosophie Hegels, sowie an die empirische Soziologie erreicht worden,25 so gibt es seit Alfred Schütz’ und insbesondere seit Hermann Zeltners Arbeiten eine erneute Umorientierung und eine Rückbeziehung der Grundlagen der Sozialphilosophie auf die phänomenologische Intersubjektivitätstheorie E. Husserls.26 Jedoch wurden frühzeitig die Beschränkungen gesehen, die eine egologisch-transzendentalphilosophische Phänomenologie jeder philosophischen Bemühung um das Soziale entgegensetzt. Daher gewannen einerseits phänomenologische Ansätze an Interesse, die nicht von der Einsamkeit eines transzendentalen Ego ausgingen, wie etwa die leibzentrierte Phänomenologie Maurice Merleau-Pontys,27 andererseits aber wurde in dieser Hinsicht einer verstärkten Kooperation zwischen Phänomenologie und Marxismus eine methodische Erweiterung der Möglichkeiten der Sozialphilosophie zugetraut. Diese Kooperation nahm Gestalt an in den vier Bänden „Phänomenologie und Marxismus“, die von Bernhard Waldenfels, Jan M. Broekman 23 R. Stammler: Die Theorie des Anarchismus. Berlin 1894; ders.: Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. 24 O. Spann: Kantische und Marxische Sozialphilosophie.- In: Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung 2(1911), p. 128-134. 25 M. Horkheimer: Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung.- In: ders.: Sozialphilosophische Studien. Frankfurt a. M. 1972, p. 33-46. 26 H. Zeltner: Ich und die Anderen.- In: Zs. f. philosophische Forschung13 (1959), p. 288313; ders.: Sozialphilosophie. Die Kategorien der menschlichen Sozialität. Stuttgart 1979; A. Schütz: Gesammelte Aufsätze. 3 Bde. Den Haag 1971. 27 Eine frühe Rezeption Merleau-Pontys in Deutschland verdankt sich Erich Christian Schröder, s. sein Buch: Abschied von der Metaphysik? Trier 1969. und Ante Pažanin herausgegeben worden sind.28 B. Waldenfels etwa sieht in den immanenten Entwicklungen von Marxismus einerseits, Phänomenologie andererseits ein Konvergieren beider philosophischer Forschungsrichtungen in Richtung auf eine Sozialphilosophie, die sowohl den Status einer bloßen regionalen Subdisziplin der Philosophie als auch spezifische methodologische Restriktionen längst verlassen hat. Auf diese Weise wird letztlich die Sozialphilosophie zur prima philosophia,29 zur Grund- und Leitdisziplin, die die neuzeitliche Tradition einer am Bewußtsein orientierten Philosophie zugunsten einer Perspektivierung auf das Soziale aufgibt. Als Leitdisziplin hätte Sozialphilosophie die Sprachphilosophie (des sogenannten „linguistic turn“) nicht ersetzt, sondern integriert. Denn das Soziale stellt sich dar als ein Symbolisches (und sein Gegenteil: ein Diabolisches); sein Medium ist Text, genauer der kommunikative Text, (oder wie Waldenfels es früh benannt hatte: das „Zwischenreich des Dialogs“30), der sich in den Dimensionen der Sprache, der Zeit und des Sozialen entfaltet. Sozialphilosophie thematisiert vor dem Hintergrund von Zeitlichkeit (Vergangenheit und Zukunft) und von Diskursivität vorrangig die Sozialität des kommunikativen Textes. Handeln geschieht im kommunikativen Text und Kontext. In den kommunikativen Text geht der Begriff des sozialen Anderen ebenso konstitutiv ein, wie derjenige des Sinns und auch derjenige der Zeit. Er ist derjenige Begriff, der die Errungenschaften der Sprachphilosophie als prima philosophia (im linguistic turn, seit Wittgenstein) und diejenigen der Sozialphilosophie als prima philosophia (in der sozialphilosophischen Wende, seit Waldenfels) zu integrieren versucht. Das Soziale ist weitgehend ein Symbolisches; daher umfaßt der Begriff des kommunikativen Textes als medialer Grundstruktur die drei Dimensionen des sprachlich verfaßten Sinns, des Sozialen und des Zeitlichen. Der kommunikative Text als Präsenz gedacht, unterscheidet sich von der jeweiligen Absenz nicht durch vorab bestimmte Grenzen, aber man und als Prozeß wird er Grenzen ziehen müssen. Im Zeitlichen unterscheidet sich eine sich vollziehende Gegenwart, und zwar als ausgedehnte Gegenwart mit nicht vorab definierten, aber definierbaren Grenzen von den Zeitekstasen der Nicht-Präsenz: Zukunft und Vergangenheit. Vermutlich gilt auch für die soziale Dimension genau das gleiche: auf der Unterschiedenheit von einem Gegenwärtigen („Ich/Wir selbst“) eine Unterscheidung des sozialen Anderen einerseits und des Anderen in uns („Seele“). Für die Gegenwart des Textes sind in der Absenz die zwei Richtungen des 28 B. Waldenfels, J. M. Broekman, A. Pažanin: Phänomenologie und Marxismus. 4 Bde. Frankfurt a. M. 1977ff. 29 B. Waldenfels: Sozialphilosophie im Spannungsfeld von Phänomenologie und Marxismus.- In: Contemporary Philosophy. New Survey, vol III. The Hague, Boston, London 1982, p. 219-242. 30 Ders.: Das Zwischenreich des Dialogs. Den Haag 1971. epistemischen und des normativen Diskurses anzunehmen. Nur in der steten Beziehung aufeinander aber können die jeweiligen Dimensionen realisiert erscheinen. So ist der Gegenstand einer semiologisch (spurenkundlich) inspirierten Sozialphilosophie nicht die Dimension des Anderen als solchen (wie bekanntlich die Levinasianer glauben); was sollte man auch über eine bloße Dimension für Aussagen erwarten; ihr Gegenstand ist vielmehr der kommunikative Text; und der Andere ist nur eine seiner Dimensionierungen, nicht separierbar und schon gar nicht ontologisch unabhängig. – Darüber hinaus läßt sich die Dimension des Sozialen auch keineswegs auf Binaritäten wie Ego und Alter aufbauen. Es braucht ersichtlich des Dritten, um zum Sozialen zu kommen, sei er eingeschlossener, sei er ein ausgeschlossener Dritter.31 Die von Stammler ausgehende und von Habermas einflußreich vertretene normativitätsorientierte oder mit Normativität durchmischte Sozialphilosophie wurde in Deutschland zuletzt am nachhaltigsten formuliert in den Theorien der Anerkennung, etwa bei Axel Honneth u.a.. Das generelle Problem der Anerkennungstheorien für eine Sozialphilosophie ist allerdings, daß Anerkennung eine duale Beziehung ist, die schwerlich weiter reicht als bis zu Intersubjektivitätstheorien. Dagegen ist zweierlei einzuwenden. Erstens beginnt das Soziale nicht in einer Zweierbeziehung, sondern erst dort, wo der Dritte ins Spiel kommt. Die triadische, um nicht zu sagen trinitarische Beziehung begründet das Soziale: es ist qualitativ anderes als eine Verkettung von Intersubjektivitäten. Zweitens und ebenso gravierend: Intersubjektivitätstheorien wie die Theorien der Anerkennung sind immer noch gegründet auf eine Subjektzentrierung und noch nicht – was eine Phänomenologie und Ontologie des Sozialen erfordern würden – auf eine Zentrierung auf das Soziale selbst hin, d.h. genauer: auf den Zwischenraum zwischen denjenigen Positionen im Netz des Sozialen, das erst (sozialphilosophisch) begreifbar werden läßt, was es heißt, im Sozialen ein Subjekt zu sein oder allererst zu werden. Beide Einwände seien noch etwas weiter erläutert. Der Dritte, der über die reinen Dualitäten der Intersubjektivität in Richtung auf das Soziale hinausführt, kann nicht begriffen werden als eine substantiell festgelegte Position im Sozialen. Täte man nämlich das, dann liefe die Sozialphilosophie des Dritten auf nichts anderes hinaus als auf eine Erweiterung der Intersubjektivität durch noch eine weitere Intersubjektivität. Drittigkeit wäre dann mit der Behauptung verbunden, daß der Dritte bloß Supplement einer Zweierbeziehung sei. Will man dergleichen Einseitigkeiten vermeiden, dann bleibt nichts, als den Dritten als eine bloße Position und nicht als eine bestimmte Person oder Institution zu beschreiben, deren Besetzung ebenso durch Umbesetzung wechseln kann wie die Besetzung der anderen beiden Positionen, nämlich des Ersten (traditionell: Ich; oder in der Theorie des kommunikativen Textes: Selbst) und des Zweiten (traditionell: Du; oder des Anderen). Sind wir erst bei dieser Einsicht in die 31 Theorien des Dritten, hrsg. v. Th. Bedorf, J. Fischer, G. Lindemann. München 2010. Beschränktheiten der auf Intersubjektivität und intersubjektive Anerkennung gegründeten „Sozial“philosophie angekommen, dann bleibt für eine ernst zu nehmende Sozialphilosophie in der Tat nur ein Theoriedesign, das die Positionen im Text des Sozialen als reine Funktionspositionen beschreiben läßt, deren Besetzung dann erst noch geklärt, bzw. festgelegt werden müßte. Im Rahmen der Sozialphilosophie des kommunikativen Textes werden diese Positionen, wie gesagt, benannt als Selbst, Anderer und Dritter. Der Zwischenraum des Sozialen ist in seiner Konkretheit als ein (kommunikativer) Text anzusehen, dessen Dimensionen die Zeit, das Soziale und der Sinn sind. Die Position des Selbst im Text ist derjenige, der spricht und damit linguistisch als „ich“-Sagender bezeichnet wird; denn „ich“ ist niemand Bestimmtes, sondern jeweils der, der redend seine Position als „ich“ markiert. Die Position des Anderen ist diejenige des Angesprochenen – oder wenn man auch seine Position als mit einer Aktivität verbunden denkt – des Zuhörenden (bekanntlich will auch aktives Zuhören gelernt sein: es ist ein aktives Reden-Lassen). Und der Dritte ist die Position desjenigen, der dieses (aktiv) beobachtet und sich gegebenenfalls die Intervention vorbehält. Selbst und Anderer dürfen, ja müssen sich beobachtet wissen. Im Fall der eintretenden Intervention spätestens wird klar, daß es sich bei Selbst-Anderer-Dritter um reine Funktionspositionen im kommunikativen Text handelt. Denn wer interveniert, wechselt aus der Position des Dritten in die des redenden Selbst. Das gleiche gilt jedoch auch schon für Selbst und Anderen im Akt der Wortergreifung des Anderen. Im Fall der Frage ist es eindeutig, daß der Wechsel vorgesehen ist; aber auch sonst ist die permanente Besetzung einer Position durch ein bestimmtes Subjekt eine Pathologie des kommunikativen Textes. Die Rollentheorie hat versucht, die Defizite reiner Intersubjektivität aufzufangen und von den verschiedenen Rollen ein und desselben Subjekts zu sprechen. Die Subjektzentrierung der spätmodernen Theorien ist aber damit nur notdürftig repariert, nicht aber aufgegeben. Es ist unstrittig, daß subjektzentrierte Begründungen für eine Psychologie und für eine Anthropologie angemessen sein können, nicht desgleichen aber für eine Sozialphilosophie; und daß die Sozialphilosophie auf diese Theorien gegründet oder auch nur auf sie angewiesen wäre, ist keinesfalls evident, sondern eher fraglich. Die Ontologie des Sozialen kann keine von Subjekten oder gar von „dem“ Menschen sein, sondern ihre Ontologie ist eine Ontologie des sozialen Zwischen, so daß eine Begründung der Philosophie des Sozialen durch Psychologie oder gar Anthropologie auf einen Kategorienfehler hinausläuft. Für das Zwischen des Sozialen sind Kategorien wie Nähe und Distanz, Abstand und Verbindung etc. grundlegend. Heidegger hat in sehr glücklicher Weise dafür den Begriff der Fuge verwendet:32 In der Fuge berühren sich Zwei, lassen aber immer auch einen Abstand, der ein Abgrund ist. Der Abgrund ist als gründender Abgrund zugleich das dritte Element in dieser noch nicht auf Textualität bezogenen Bildlichkeit. In ihr bleibt der Abgrund (der nach Heidegger auch „oben“ sein kann) als das dritte Element ein Abgrund, er tritt nicht ein in die Verfügung/Verfugung. Diesen theoretischen Schritt leistet allein die medialitätszentrierte Sozialphilosophie des kommunikativen Textes. Eine rein auf Intersubjektivität, d.h. auf Dualität setzende Theorie kann allerdings eine Philosophie des Politischen sein, die mit der Dichotomie von Freund und Feind eine Reduktion oder Präparierung des Sozialen leistet.33 2.2 S EELEN -L EIDEN Was das nun für den inneren Anderen (d.h. die Seele: Gemüt und Selbstbewußtsein) bedeutet, sei am Beispiel der Seelen-Leiden im folgenden näher untersucht. Wir greifen dabei speziell den Komplex der Melancholie/Depression heraus, weil hier die Chance besteht, die Verbindungen des inneren Anderen zum äußeren Anderen herausarbeiten zu können.34 War für die Antike die Melancholie die Berufskrankheit, ja Berufsqualifikation des Philosophen, so gilt Depression, der Nachfolgebegriff, als ein pathologischer Befund, dessen Ursprung entweder im Inneren, allerdings verstanden als organisches Inneres, oder im sozialen Umfeld des Leidenden gesucht wird. Ja, manchmal, insbesondere von Journalisten, wird die ganz normale Trauer als „Depression“ bezeichnet. Der so oder so Leidende stilisiert sich selbst als einen Patienten, 32 M. Heidegger: Der Spruch des Anaximander.- In: ders.: Gesamtausg. V: Holzwege. Frankfurt a. M. 1977, p. 321-373: „Dieses Zwischen ist die Fuge, der gemäß von Herkunft her zu Weggang hin das Weilende je gefügt ist.“ (p. 355) In Übereinstimmung damit stellen die „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)“ heraus, daß diese vorerst nur vom „Er-eignis“ sprechen und noch nicht von der „freien Fuge der Wahrheit des Seyns“ (Gesamtausg. LXVI. Frankfurt a. M. 1989, p. 4). Als solche käme der Philosophie die Aufgabe zu, Fuge innerhalb des Seienden zu sein: „Die Philosophie ist eine Fuge im Seienden als die sich dem Seyn fügende Verfügung über seine Wahrheit.“ (p. 45) Dieses Sprechen aus dem Seyn macht auch einen Unterschied zum Gedanken eines Systems aus, was Heidegger in seiner Schelling-Vorlesung von 1936 ausführlich erläutert hat am Gedanken der Problematik der Verbindung Freiheit und System bei Schelling (Gesamtausg. XLII. Frankfurt a. M. 1988) Die Schicksalsfrage des anderen Anfangs der Philosophie ist dann aber. „Ob das Seiende aber sich in die Fuge des Seyns fügt…“ ( LXVI, p. 228) 33 K. Röttgers: Flexionen des Politischen.- In: Das Politische und die Politik, hrsg. v. Th. Bedorf u. K. Röttgers. Berlin 2010, p. 38-67. 34 Zu diesem Syndrom s. J. Kristeva: Die neuen Leiden der Seele. Hamburg 1994; dies.: Schwarze Sonne. Depression und Melancholie. Frankfurt a. M. 2007. dem pharmakologisch oder durch psychotherapeutischen Beistand aufgeholfen werden müsse. Um solch ein Patient werden zu können, manövriert ein Subjekt sich selbst aus der Funktionsposition eines Selbst in die des Anderen hinein. Wenn ich, so scheint er über sich sagen lassen zu wollen, in der Ansprache, zu der sein Leiden einlädt, schon nicht geliebt werden kann, so erwarte ich als Hörender doch professionelle Hilfe.35 Doch blicken wir zunächst zurück. Über den Charakter als ein seelisches Leiden hinsichtlich der Depression besteht heute weder unter Patienten noch unter Therapeuten ein Zweifel. Das war, wie gesagt, allerdings nicht immer so. Unter dem Namen Melancholie gibt es eine Jahrtausende währende philosophische Diskussion dieser Gestimmtheit. Für Aristoteles beispielsweise ist Melancholie keine Krankheit, sondern zusammen mit Genialität die Grundstimmung eines Philosophen. Das steht auch im Zusammenhang mit der aristotelischen Seelen-Lehre, die es für unmöglich hält, daß die Seele leidet oder sich freut. Es leidet der Mensch, und die Seele ist nichts anderes als ein Begriff für den Funktionszusammenhang eines (hier eines menschlichen) Organismus, sein Wesen, seine oüsía, oder sein Lebensprinzip. Da aber Leben verschiedene Aspekte hat (Stoffwechsel, Wachstum, Informationsverarbeitung, Bewegung, Fortpflanzung …), gibt es auch verschiedene Seelen-Funktionen, später hat man gesagt: Vermögen, facultates animi, was eine Substantialisierung von Funktionen ist, die die aristotelische Seelenlehre noch vermieden hatte.36 Schon Cicero hatte auf ein Problem bei der Selbstdiagnose von Seelen-Leiden aufmerksam gemacht: Wenn der Körper erkrankt ist, ist es die Seele, die dieses erkennt, weiß und beurteilt. Wenn aber die Seele krank ist, kann uns weder der Körper eine Erkenntnis darüber liefern noch auch die kranke Seele, da ihrem Urteil aufgrund der Krankheit zu mißtrauen ist, was dann in die schier uferlose Diskussion von Hypochondrie mündet. In der Diskussion um die Seelen-Leiden hat es zwei entgegengesetzte Standpunkte gegeben, die ich den philosophischen und den medizinischen nennen möchte. Der philosophische besteht darin, Seelen-Leiden als Vernunft-Mangel zu diagnostizieren. Den Kranken muß man zur Vernunft bringen, beziehungsweise er muß sich selbst anstrengen, zur Vernunft zurückzufinden. Dieser Begriff macht Gebrauch von der Doppeldeutigkeit des lateinischen „passiones“ als Leiden und als Leidenschaften. Ein vernünftiges, philosophisches Leben bestünde darin, die passiones in beiderlei Bedeutung zu besiegen oder zu zügeln. Die theologische Literatur stößt in die gleiche Richtung vor: für sie ist Melancholie als Sünde gewertet; denn die Traurigkeit kann nur daher rühren, daß die Seele – nun längst nicht mehr als das Funktionsprinzip eines Organismus begriffen, sondern als das Unsterbliche im Menschen – den Kontakt zu 35 Zum Zusammenhang von „aimez moi“ und „aidez moi“ als ersten Worten des Menschen s. J.-J. Rousseau: Essai sur l’origine des langues, ed. C. H. Porset. Paris 1969, p. 131. 36 Zur aristotelischen Seelen-Lehre s. H. Busche: Die Seele als System. Hamburg 2001. Gott verloren hat. Ja, Melancholie ist ein Ärgernis für Gott, weil die Melancholiker sich der Schwachheit ergebende Schwächlinge sind. Nach der Lehre der Stoa ist der Weise von den Leidenschaften und daher von den Leiden, die die Seele befallen könnten, frei (apathia). Indem sich der Weise einfügt in den Logos des Kosmos, konvergieren Vernünftigkeit und Gesundheit (selbst die Gesundheit des Körpers) in ihm. Der Weise kann demnach nicht seelisch krank sein, weil seine Tugenden, virtutes, Kräfte, alle Schwächlichkeiten besiegen. Diese Lehre hat man mit einem Terminus von Cicero37 auch als „medicina animi“ als Funktion der Philosophie bezeichnet. Diese Diskussion findet ihr Ende in Kants kleiner Schrift „Streit der Fakultäten“, 3. Abschnitt,38 der der Frage nachgeht, ob man durch „bloßen Vorsatz“ seiner „krankhaften Gefühle“ Herr werden kann. Sein Gegner in dieser Frage ist der Mediziner Hufeland, der beabsichtigte, die ganze Natur des Menschen, inklusive der physischen, „als ein auf Moralität berechnetes Wesen darzustellen …“. Auf diese Weise wird der „Praktischen Philosophie“ eine medizinisch-therapeutische Aufgabe zugewiesen. Kant bestreitet mit guten Gründen die Effektivität eines solchen Verfahrens und greift als Beispiel die Hypochondrie („Grillenkrankheit [hypochondria vaga]“) heraus, und zwar mit einem Argument, das demjenigen Ciceros von der Selbstbezüglichkeit gleicht: der Hypochonder wäre kein Hypochonder, wenn er sich auf diese Weise durch eigenen Vorsatz selbst heilen könnte, selbst wenn es somatische Auslöser für seine Erkrankung (Kant nennt hier Blähungen und Verstopfungen) gegeben haben mag. Der philosophischen Lehre, die bei Kant ihr Ende fand, steht die medizinische entgegen, nach der die Seelen-Leiden von einem Austoben der Leidenschaften herrühren, die wiederum oftmals von einer Störung des somatischen Gleichgewichts herrühren. Insbesondere seit man Melancholie Depression nannte, wurde sie zum Objekt einer, vorwiegend pharmakologischen, Behandlung. Unterstellt wird dabei, daß Seelen-Leiden Symptome organischer, insbesondere chemischer Fehlfunktionen sind, die man daher – weil unerwünscht – mit Einsatz chemischer Mittel korrigieren kann und muß. Es ist dieser Zusammenhang, der Julia Kristeva fragen ließ: „Gibt es noch eine Seele?“39 Wo immer sich heute so etwas zeigte, was man früher „Seele“ nannte, eröffnete sich das Wirkungsfeld der Neurochemie. Gegen Schlafstörungen, selbst wenn sie biographisch mit einer unabgegoltenen Schuld verknüpft sind, gibt es Tabletten; gegen Angst, selbst wenn sie begründet ist, gibt es andere Tabletten; selbst für diverse Glücksgefühle gibt es jeweils einschlägige Drogen. Unterstützt werden 37 M. T. Cicero: Tusculanarum ad M. Brutum disputationes, 3, 1-6. 38 I. Kant: Gesammelte Schriften, hrsg. v. d. Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1910ff., VII, p. 95ff. 39 J. Kristeva: Die neuen Leiden der Seele, p. 9. diese chemischen Praktiken der Einwirkung auf den psychosomatischen Zusammenhang durch medial aufbereitete Berichte über angebliche „Erkenntnisse“, tatsächlich aber Dummheiten, der Hirnforschung, daß bestimmte Stimmungen oder Gefühle „nichts anderes“ seien als bestimmte, durch Eingriffe chirurgischer oder pharmakologischer Art steuerbare physiologische Vorgänge. Dem, der solche Dummheiten, weil Kategorienfehler, verbreitet, sollte man antworten: da freut sich mein Hirn, und meine Leber lacht! Depressionen antworten auf eine bedrohliche Situation. In solchen Situationen kann man im Prinzip dreierlei tun: sich der Herausforderung stellen und kämpfen, der Herausforderung ausweichen und fliehen, oder, wenn beides nicht möglich ist, das heißt die Situation ausweglos ist, sich tot stellen in der Hoffnung, daß die Herausforderung verschwindet. Heute, wo Problemsituationen in der Regel in vielfältigen Bedingungsnetzen auftauchen und verschwinden, ohne daß die Betroffenen kämpfend oder fliehend darauf Einfluß nehmen könnten, ist das Sich-Totstellen eine durchaus rationale Einstellung. Aber so wie Kampf nicht unbedingt Gewalt heißt, sondern nur aktive Auseinandersetzung, und so wie Flucht nicht unbedingt ein körperliches Davonlaufen ist, sondern auch das Ausweichen auf eine andere Ebene der Auseinandersetzung, zum Beispiel Simulation oder Reflexion, so gibt es auch für das Sich-Totstellen spezifische Kulturformen. Und in der Hinsicht macht es schon einen großen Unterschied aus, ob die Verlangsamung als Melancholie in Literatur und Kunst (zum Beispiel der Blues) gepflegt oder als Depression nur noch als Objekt pharmakologischer Zugriffe erscheint. Der melancholische Text ist „normal“ unter Bedingungen, unter denen man wahnsinnig werden könnte, weil weder Flucht noch Kampf etwas hülfen. Wenn also klassisch die Melancholie eine unzureichende Herrschaft der Vernunft war, so ist doch nicht der Melancholiker derjenige, der von sich heraus weiß, daß er einer ist. Das Syndrom Melancholie muß man ihm zur Verfügung stellen. Durch die Bereitstellung eines Syndroms zum Zweck der Interpretation und der Erzeugung eines Selbstbildes und durch Vergleich mit seinesgleichen kann ihm eingebildet werden, ein Melancholiker zu sein, der dann einer philosophischen „medicina animi“ oder einer pharmakologischen Behandlung zugeführt werden kann. Aus den genannten Zusammenhängen erhellt mindestens folgendes: Der melancholisch/depressive Zusammenhang überschreitet die reine Psychosomatik in Richtung auf das Soziale hin. M.a.W. auch dort, wo anscheinend der einfache Kommerz Körper-Seele Thema ist, ist, sowohl in der Seele als auch im Körper, das Soziale involviert. Und die medizinische Sicht auf die kranke Seele, die Naturalisierung der Seele, ist selbst ein sozial induziertes Prozeßresultat. Die heutige wissenschaftliche Sicht trennt zunächst sauber die reaktive Depression, die neurotische Depression und die endogene Depression. Im Grunde kann man auch sagen: Manchmal wissen wir, warum der „Melancholiker“ traurig ist, weil ihm nämlich Trauriges widerfuhr (reaktive Depression), manchmal wissen wir zwar nicht, warum der Melancholiker melancholisch ist (das heißt welche identifizierbaren Einzelereignisse zur melancholischen Verarbeitungsform der Situationsherausforderung geführt haben), aber wir haben Vorstellungen davon, wie ihm „geholfen“ werden kann durch (therapeutisch wirksames) Verständnis und Zuwendung, das heißt die Intensivierung der Einbindung in den kommunikativen Text, mit anderen Worten daß Kampf oder Flucht und ihre kulturellen Sublimationen immer noch sinnvoll sind. Und manchmal haben die Experten keine Ahnung, dann nennen wir das eine endogene Depression und vermuten Stoffwechselstörungen im Gehirn als „Ursache“ von Traurigkeit. (Ich bin dann traurig darüber oder dadurch, daß Serotonin nicht lange genug an den Kontaktstellen in meinem Gehirn gespeichert werden kann.) Das ist aber auch nichts anderes als ein bestimmter sozialer Zugriff auf den Körper-Seele-Zusammenhang, einer, der mehr Ratlosigkeit hinsichtlich des kommunikativen Textes verrät und daher in seinem reduktiven Zugriff auf den Körper sich der stummen Gewalt der Medikamente anvertraut. Insofern ist diese Klassifikation von Typen von Melancholikern nichts anderes als die Exekution einer Grenzziehung zwischen Kultur und Natur (immer von Seiten der Kultur aus natürlich). Und einiges, und das nennt man dann „endogene Depressionen“, wird durch eine soziale Praxis aus der Kultur hinausdefiniert und einer naturwissenschaftlich zu definierenden und therapeutisch zu traktierenden Natur zugeordnet. Wir dürfen also im Rahmen einer Sozialphilosophie des kommunikativen Textes sehr wohl von einem Inneren sprechen, nämlich als der einen Richtung des Anderen eines Selbst, die sich dann in der Nähe als Gemüt und in der reflektierten Distanz als Selbstbewußtsein auslegt. Als Oberbegriff für beides fand der Begriff der Seele erneut Verwendung. Diesem theoretischen Design steht entgegen eine ganz andere und starke Tradition von Sozialphilosophie und Soziologie, deren Ausgangsunterscheidung diejenige von „Individuum“ und „Gesellschaft“, und manchmal in kommunitaristischen Anwandlungen als „Individuum“ und „Gemeinschaft“ lautet. Begleitet wird diese theoretische Grundorientierung zumeist von demjenigen methodologischen Individualismus, der sich bemüßigt fühlt, schnell hinzuzufügen, daß aber im Grunde „die Gesellschaft“ aus Individuen „bestehe“, so daß als Grundbaustein des Sozialen hier allemal „das Individuum“ dient. Aber was ist das eigentlich – das „Individuum“; denn man sollte es doch tunlichst vermeiden, diesen problematischen Begriff sofort mit den ebenso problematischen Begriffen wie „der Mensch“, „die Person“ oder „das Subjekt“ zu identifizieren oder zu kontaminieren. Diese Appellationen an umgangssprachlich „klare“ Begriffe sollte man, solange eine theoretische Klärung fehlt, tunlichst vermeiden. 2.3 D ER S TRUKTURWANDEL VON I NDIVIDUALITÄT Die spätmoderne sogenannte Sozialphilosophie, die die Sozialität aus der Voraussetzung eines Individuums und der Individualität ableiten wollte, benötigte dazu selbstverständlich einen starken, einen stark aufgeladenen Begriff des Individuums. Dieser soll im folgenden historisch hergeleitet, in seiner historischen Bedingtheit und Einschränkung gezeigt und in seiner Leistungskraft für eine postmoderne, medialitätszentrierte Sozialphilosophie kritisch in Zweifel gezogen werden. 2.3.1 Das Individuum: unteilbar und unendlich Geht man analog zur Alltagsorientierung vom ursprünglichen Wortverständnis aus, so ist ein Individuum ein Unteilbares. Bekanntlich wurde der Begriff in diesem Sinne von Cicero als Übersetzung von griechisch Átomon40 eingeführt. Dieser Begriff ist zunächst ganz unspektakulär. Er besagt nichts anderes, als daß die Teilbarkeit der Dinge der Welt eine Grenze hat in den unteilbaren kleinsten Elementen, aus denen alles Teilbare zusammengesetzt ist.41 In der Konstitution des Zusammengesetzten, Teilbaren können die einzelnen Atome sich gegenseitig ersetzen und sind daher untereinander austauschbar und jedes einzelne durch andere ersetzbar. Noch in Platons Seelenlehre im „Phaidon“ spiegelt sich diese Auffassung wieder: die Seele ist ein Atom, ein Unteilbares.42 Der Gedanke der Austauschbarkeit gerade begründet hier, daß die Seele mit dem Körper nicht auf notwendige Weise verbunden ist und also die Seele den Körper (im Tod) ohne Schwierigkeiten verlassen kann. Erst bei Aristoteles, aber mehr noch durch die Aufwertung der Seelenvorstellung im Christentum entwickelt sich der Gedanke des Individuums zum Begriff dessen, was einzig und unersetzbar ist. In Monty Pythons Film „Das Leben des Bryan“ predigt Bryan der Menge: Ihr seid alle unverwechselbare Individuen; stumpf antwortet die Masse im Chor: Wir sind alle unverwechselbare Individuen. Die ihnen zugesprochene Unverwechselbarkeit macht sie in dieser Unverwechselbarkeit alle gleich und verwechselbar. In dem 40 M. T. Cicero: De finibus I, 17; Werkausg. Der Loeb Classoical Library. Cambridge/Mass., London 1983, p. 18; Cicero bezieht sich an dieser Stelle auf die Atomtheorie Demokrits, griechisch Átomon wird erläutert als „corpora individua propter soliditatem“; cf. auch A. G. M. van Melsen: Atomtheorie.- In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter u.a. Basel, Stuttgart 1971ff., I, Sp. 606-611, und Th. Kobusch, L. Oeing-Hanhoff, T. Borsche: Individuum, Individualität.- In: dass. IV, Sp. 300-323. 41 Die Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. v. H. Diels. 6. Aufl. Berlin 1952, II, p. 79, wo diese Lehre Leukipp, Demokrit und Diogenes von Smyrna zugeschrieben wird. 42 Platon: Phaidon 78c, Sämtliche Dialoge, hrsg. v. O. Apelt 2. Aufl. ND Hamburg 1988, II, Phaidon, p. 65f. Film freilich widerspricht ein Einzelner dieser homogenen Unverwechselbarkeit, indem er in paradoxer Weise sagt: ich nicht! Was sollen wir von diesem halten? Ist er vielleicht, weil er nicht in den homophonen Chor einstimmt, in paradoxer Weise das einzige unverwechselbare Individuum. Oder soll man seiner Beteuerung Glauben schenken und ihn für den einzigen Verwechselbaren halten, aber mit wem ist er dann als Einziger noch verwechselbar? Diese Paradoxie enthüllt schlagartig die Paradoxien des Begriffs des Individuums als eines solchen. Die Moderne hält für diese Paradoxie eine Lösung bereit. Absolut unverwechselbare Individuen hätten auch keine gemeinsame Sprache, keine wechselseitig anschließbaren Empfindungen, ja sensu stricto keine gemeinsamen Nachkommen. Also unterstellt die Moderne sehr wohl Gemeinsamkeiten, Vergleichbarkeiten und letztlich Verwechselbarkeiten; diese Homogenisierung kompensierend, wird ihnen eine innere Unendlichkeit, also innere Unvergleichbarkeit zugesprochen. Mag zwischen den einzelnen Bestimmungen oder Qualitäten der Individuen noch so viel Vergleichbarkeit herrschen, die die Kundenkarten und die User-Verwaltungen zu Profilbildungen einlädt, in ihrem Inneren seien sie quasi residual unendlich: individuum est ineffabile. Die Durchforschung dieses Inneren allerdings ist ebenfalls unersättlich, bis das Individuum am Ende resignierend sagt: ich habe nichts zu verbergen. Die Herkunft des Satzes „individuum est ineffabile“ ist dunkel. Goethe verwendet ihn in einem Brief,43 als sei es ein geläufiger Spruch. Aber es ist der Forschung bisher nicht gelungen, die Herkunft aufzuklären. Der Satz, der speziell Leitsatz des Individualismus der Moderne wurde, beinhaltet, daß das Individuum als Residuum in der Unendlichkeit seiner Bestimmungen weder ausgesprochen werden kann noch sich selbst aussprechen kann. Jenseits aller Gleichartigkeit wird eine transzendente unendliche Verschiedenheit angesetzt. Seit der Romantik sind zunächst Genies und dann Menschen allgemein von dieser Individualitätstranszendenz befallen. Ihr unauslotbarer Reichtum im Inneren läßt jeden Begriff, der ja stets aufs Allgemeine zielt, zerschellen. Vom Individuum gibt es keinen Begriff, wohl aber, wird man heute in der Postmoderne hinzufügen müssen, ein medialitätsvermitteltes Profil. Das hatte schon Aristoteles gedanklich vorbereitet, das Individuum ist zwar nicht begrifflich erfaßbar oder definierbar, weil es in seiner Zusammensetzung kontingent ist. Wissenschaft aber kann es nur von Allgemeinem und notwendig Seiendem geben. Daraus scheint sich die Paradoxie zu ergeben, daß zwar einerseits nur das Individuelle real sein kann, aber von ihm eine sicheres Wissen nicht möglich ist; postmoderne Profile aber erheben gar keinen Anspruch ein sicheres Wissen zu sein, ihnen reicht die Wahrscheinlichkeit, die sich aus zufälligen Bekundungen des Individuellen 43 Goethe in einem Brief an Lavater vom 20.9.1780: „Hab‘ ich dir das Wort ‚individuum est ineffabile‘, woraus ich eine Welt ableite, schon geschrieben?“ Cf. F. Jannidis: Individuum est ineffabile.- In: Aufklärung 9 (1996), p. 77-110. ergibt. Nicht sicheres Wissen, sondern virtuelle Simulation in hinreichend großer Zahl ergibt dann eine empirisch verwertbare und technisch nutzbare Wahrscheinlichkeit. Und wenn dann ein Profil Fehler enthält und falsche Prognosen zuläßt, wen kümmert es, da es ja nicht auf Wahrheit, sondern wahrscheinliche Verwertbarkeit ankommt. Für Aristoteles aber ist, weil Wahrheit des Individuellen nicht möglich ist, jedes Individuelle von allen anderen unterschieden, aber auf eine Weise, die dem Individuellen selbst verborgen bleiben muß, weil es unteilbar und d.h. nicht differenzierbar ist. Erst Leibniz überwand diese klassisch-aristotelische Lehre, indem er Individualität als das Einheitsprinzip einer Substanz faßte. 2.3.2 Das Individuationsprinzip Dem materiell Seienden wird in der Folge von Aristoteles und der arabischen Aristoteles-Rezeption seit Albertus Magnus ein Individuationsprinzip zugesprochen.44 Individuation und folglich Individuum meint hier das Vereinzelte: „materia sola principium individuationis et nihil singulare nisi materia vel per materiam.“45 Das vermag die Materie allerdings nicht von sich aus, sondern nur als geformte Materie. Die mit jeder Individuation einhergehende doppelte Negation wird besonders von Heinrich von Gent hervorgehoben. Diese doppelte Negation schließt die Identität mit anderem ebenso aus wie die Differenz zum eigenen Wesen. Die Folge der doppelten Negation durch das Individuationsprinzip ist die Wesensidentität einerseits, die Erscheinungsdiversität andererseits. Die Wesensidentität und die Verhinderung jeglicher Diversität in dieser Hinsicht widersprechen der modernen Auffassung von Individualität in eklatanter Weise. Infolge dieser Auffassung kann es in der „Geisterwelt“ nicht mehrere Individuen derselben Art geben. So gerät diese Auffassung von Individuation in Konflikt mit der Angelologie; es war nur folgerichtig, daß diese Lehre 1277 von Stephan Tempier als Irrlehre verworfen wurde. Ironischerweise hat also die Angelologie den Anlaß für die Entwicklung der neuzeitlichen Lehre vom Individuum abgegeben, obwohl natürlich diese Konsequenzen im 13. Jahrhundert noch nicht gezogen werden konnten. Allerdings stand die Individuationslehre mit der Einheit alles Geistigen bei Thomas von Aquin nicht im Widerspruch zur Angelologie, weil diese bei ihm die Vorstellung von den „angenommenen“ Körpern der Engel enthielt. Weil die Engel einen Körper nur angenommen haben, wenn sie den Menschen erscheinen, sind sie 44 J. Hüllen: Individuation, Individuationsprinzip.- In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter u.a. Basel, Stuttgart 1971ff., IV, Sp. 295-299. 45 Albertus Magnus: Metaphysik III, 3, 10. für uns individuiert, nicht aber ihrem eigenen Wesen nach.46 Im Nominalismus dagegen wird die Lehre von einem eigenen Individuationsprinzip abgelehnt: Seiendes ist immer schon individuiert, es bedarf keiner eigenen Annahme eines Prinzips dafür. Bei Suárez wird daraus die starke Behauptung, daß das Individuum sein Individuationsprinzip selbst immer schon in sich birgt: „Unaquaeque entitas est per se ipsam individuationis principium.“47 Dem wird sich dann Leibniz anschließen. Der Individuation in der Gesellschaft sekundiert eine zivilisatorische Versittlichung der Einzelnen. Damit geht allerdings einher der Abbau der Solidarität mit den Mitmenschen. Die Individuen werden in der Masse einsam, dafür gibt eine Abhilfe, deren eine Seite eben die verstärkte soziale Kontrolle, jetzt nicht mehr in der Gemeinschaft, in der man lebt, sondern nun der Gesamtgesellschaft, verbunden mit einem sozialen Netz der Betreuung (Sozialarbeit) und krypto-gewalthafter Zwangsintegration. Das führt zu einem Verlust des Geschmacks an den Reizen des Fremdartigen: Exotismus ja, aber gefälligst nicht zu nah, Perser als Teppiche willkommen, aber nicht als Flüchtlinge. 2.3.3 Die Einzigkeit des Individuums Der Begriff des Individuums, wie er von Leibniz geprägt worden ist, kann sich auf die Lehre von der Einzelsubstanz in Buch VII der Metaphysik des Aristoteles stützen. Aber Leibniz gestaltet sie radikal um: er will dem Gedanken vorbeugen, daß die Welt in lauter voneinander unabhängige Einzelsubstanzen zerfällt. So sind bei ihm der Begriff des Individuums (Monas) und der Weltbegriff aufeinander bezogen. 48 Nach der aristotelischen Lehre sind individuelle Substanzen solche, die voneinander nach Art und Gattung nicht wesentlich unterschieden sind. Aber nach Leibniz ist der Begriff so bestimmt, daß Individuum und Begriff insofern identisch werden, als beide auf unendliche Weise bestimmbar sind.49 Aber diese Übereinstimmung von Allgemeinbegriff und individueller Substanz kann, da sie ein vollständiges Wissen aller möglichen Prädikate voraussetzte, nur ein göttliches Wissen sein. Für das menschliche Wissen ergibt sich die Beschränkung, daß der Begriff eines Individuums letztlich unbestimmbar bleibt, obwohl es zugleich auf letztlich uneinsehbare Weise, quasi in 46 „Corpora assumant“, lautet die Formel bei Thomas: Summa theol. I, qu 51,2. 47 F. Suárez: Disp. Met V, sect. 6, n. 1. 48 Zum folgenden s. E. Rudolph: Entelechie, Individuum und Zeit bei Leibniz.- In: Zeit und Logik bei Leibniz, hrsg. v. C. F. v. Weizsäcker u. E. Rudolph. Stuttgart 1989, p. 101-126. 49 Rudolph verweist darauf, daß so die thomistische Bestimmung der reinen Intelligenzen, d.h. der Engel, auf alles individuell Seiende übertragen wird, nämlich daß „omne individuum sit species infina“, p. 113) einer docta ignorantia, um mit Cusanus zu sprechen (und Leibniz kannte seinen Cusanus bestens), auf die Welt aller Individuen bezogen ist. Im Unterschied zur ontologischen Begründung der Undefinierbarkeit der individuellen Substanz bei Aristoteles, gibt es bei Leibniz die Voraussetzung der Bestimmbarkeit durch die Totalität aller Individuen, epistemisch aber ist diese für den Menschen unerreichbar. Rudolph prägt für die monadologische Hintergrundvoraussetzung bei Leibniz den Begriff des Individuums „als exklusiver Mikrokosmos“ 50. Die Umdeutung, die Leibniz dem Begriff des Individuums beilegt, ist entscheidend und prägend für die gesamte anschließende Theorieentwicklung gewesen. Die „substance individuelle“, für die er den Begriff der Monade einführt und die er auch „beseelte Punkte“ oder „substanzielle Atome“ nennt, ist für ihn – abweichend von der aristotelischen Tradition, die, wie gesagt, die individuellen Substanzen nicht durch Art oder Gattung zu unterscheiden vermochte – etwas, das unendlich bestimmbar ist. Der für Engel gültige Grundsatz, von Thomas von Aquin ausformuliert und von Leibniz zitiert, nämlich „quod ibi omne individuum sit species infima“51 wird von Leibniz auf jegliche Art individueller Substanzen ausgedehnt: „est vrai de toutes les substances“. Also unterscheidet sich ein Individuum von einem anderen nicht nur kardinal, sondern wesensmäßig unendlich spezifizierbar. Wenn aber die Monade definiert ist durch die Unendlichkeit ihrer Spezifikationen, dann gibt es nur ein vollständiges Wissen von ihr, und das ist das göttliche. Leibniz erläutert: “…nous pouvons dire que la nature d’une substance individuelle ou d’un estre complet, est d’avoir une notion si accomplie qu’elle soit suffisante à comprendre et à en faire deduire tous les predicats du sujet à qui cette notion est attribuée. Au lieu que l’accident est un estre dont la notion n’enferme point tout ce qu’on peut attribuer au sujet à qui on attribue cette notion. Ainsi la qualité de Roy qui appartient à Alexandre le Grand, faisant abstraction du sujet, n’est pas assez determinée à un individu, et n’enferme point les autres qualités du même sujet, ny tout ce que la notion de ce Prince comprend, au lieu que Dieu voyant la notion individuelle ou hecceïté d’Alexandre, y voit en même temps le fondement et la raison de tous les predicats qui se peuvent dire de luy | veritablement, comme par exemple qu’il vaincroit Darius et Porus …“ 52. Der Grund dafür liegt darin, daß es bei Aristoteles eine wesensmäßige Bestimmung des Seienden ist, sowohl sein als auch nicht sein zu können; denn nur so lassen 50 l. c., p. 125. 51 G. W. Leibniz: Discours de métaphysique §9.- In: ders.: Philosophische Schriften, hrsg. v. C. I. Gerhardt. Berlin 1875ff., IV, p. 433. 52 ibd., §8. sich für ihn Entstehen und Vergehen, d.h. jegliches Werden, erklären. Anders Leibniz: Für Gottes Wissen ist Sein oder Nichtsein zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden. Daraus ergeben sich allerdings epistemische Probleme: Für Aristoteles ist zukünftiges Sein oder Nichtsein aufgrund der Vergänglichkeit offen und das heißt nicht wißbar. Für Leibniz ist es ontisch festgelegt, aber epistemisch ungewiß. Genau das hat aber Folgeprobleme für die epistemische Bestimmung und Abgrenzung eines Individuums.53 Leibniz‘ Philosophie des Individuums hat weitreichende Folgen, die bis in die Goethezeit genau als Folgen der Leibnizschen Metaphysik des Individuellen bewußt waren, z.B. bei Schelling.54 Und er benennt diesen Aspekt als die Vereinigung von Idealem und Realem „in mir“, in „meiner Natur“, die sich bereits in Leibniz‘ Begriff der Individualität kristallisiere.55 Leibniz nannte bekanntlich diese individuellen Letzteinheiten Monaden, durch welche Benennung das Einzigkeitsprinzip verstärkt akzentuiert wird (monas = einzig). Auf diese Weise rekonstruiert Leibniz den Gedanken strengen und notwendigen Wissens von den Substanzen; denn jede Monade spiegelt auf einzigartige Weise den Gesamtzusammenhang der Welt in ihrer Notwendigkeit, verbunden mit dem Gedanken der Einzigkeit und Unteilbarkeit. Von den Monaden, von den Individuen also, ist, im Gegensatz zu Aristoteles, eine Wissenschaft deswegen möglich, weil sie in ihrer Einzigkeit eben gerade nicht Produkte des Zufalls sind. In der Folge von Leibniz, speziell seit Kant, gerät der Begriff des Individuums in eine vielfältige Spannung zum Begriff des Subjekts. Während die Transzendentalphilosophie den erkenntnis- und handlungskonstitutiven Charakter des Subjekts herausstellt, der, da er objektive Erkenntnis und sittliches, d.h. allgemeingültiges Handeln ermöglichen soll und daher seiner Struktur nach ein allgemeiner sein muß, setzen Herder und Goethe, quasi in Leibniz-Nachfolge, im Begriff des Individuums dessen innere Unendlichkeit und damit begriffliche Unauslotbarkeit entgegen. Diese Unaussprechlichkeit des Individuums kann sowohl als unergründbares Geheimnis der Tiefen der Seele, das sich allenfalls in vieldeutigen Bildern ausdrücken läßt, als aber 53 Cf. E. Rudolph: Entelechie, Individuum und Zeit bei Leibniz, p. 118; zum Individuationsprinzip bei Leibniz: De principio individui. Cum Deo §2, IV, p. 17; sowie die Leipziger Disputation „Disputatio metaphysica de principio individui“ , Philosophische Schriften IV, 15-26. 54 F. W. J. Schelling: Ideen zu einer Philosophie der Natur als Einleitung in das Studium dieser Wissenschaft.- In: ders.: Ausgewählte Werke: Schriften von 1794-1798. Darmstadt 1975, p. 344: „Die Zeit ist gekommen, da man seine Philosophie wiederherstellen kann.“ 55 l. c., p. 361. auch als Geschichtlichkeit, die sich ebenfalls einer eindeutigen Bestimmbarkeit entzieht, ausdrücken, weil das Individuum kein Seiendes, sondern eine Werdendes ist, das in jedem Moment seines Aussprechens schon ein anderes geworden ist: „Spricht die Seele, so spricht ach! schon die Seele nicht mehr.“56 Auf diese doppelte Weise ist der Begriff des Individuums ungeheuer aufgewertet worden. Zwar gilt immer noch, daß es unteilbar ist, aber nicht weil es das Einfachste wäre, sondern im Gegenteil weil so ungeheuer komplex ist und jede Abtrennung einer Einzelbestimmung den komplexen Gesamtzusammenhang auflöste. Außerdem gilt immer noch, daß es einzig ist, aber nicht weil seine Einzelbestimmungen so einzig wären, sondern weil die Art der Verknüpfung der Einzelbestimmungen unvergleichlich ist. Bei diesem enormen Wandel des Begriffs taucht natürlich die Frage auf, ob der Mensch ein Individuum ist und in welchem Sinne, oder ob Individualität im Sinne der letzteren Bestimmungen des Begriffs selbst nur als ein historisches Produkt erscheinen kann, nämlich als ein Produkt der bürgerlichen Ära und folglich nach deren Ende auch wieder verschwinden wird. Es ist zu berücksichtigen, daß in den Gesellschaftstheorien der Moderne der Begriff des Individuums schon immer eine zweifelhafte Rolle gespielt hat. In den Gesellschaftsvertragstheorien diente er z.B. als ideologische Grundlage, die es erlaubte anzunehmen, daß „die“ Gesellschaft aus Individuen „bestehe“, d.h. aus Atomen, die gegenseitig in einem Konfliktverhältnis stehen und zum Zweck der Selbsterhaltung vertragsförmige Beziehungen miteinander eingehen. Diese Gesellschaftsatome namens Individuen, so wird in diesen Theorien postuliert, sind einander absolut gleich hinsichtlich der Partizipationsrechte an dieser ihrer Gesellschaft. Ein solches Postulat ist als kontrafaktisches unendlich schwer einsichtig zu machen, insbesondere wenn sie faktisch Gegenseitigkeit überhaupt nicht vorsehen kann, wie z.B. in der Intergenerationendifferenz. Ein zweiter Zweifel setzt nicht bei der Inter-Individualität an, sondern bei der Intra-Individualität. Sind wir wirklich unteilbar? Dieses Bedenken hat Nietzsche in provozierender Deutlichkeit vorgetragen, als er feststellte, wir seien nicht In-dividuen, sondern immer schon Dividuen.57 Ist nicht – fragte auch Novalis – im Inneren ein Universum auch?58 Friedrich Nietzsche begründete seine Zweifel im Rahmen seiner Theorie des Willens zur Macht. Der Wille zur Macht tritt nicht nur zwischen den Individuen als Überwältigung auf, sondern auch im Inneren des Individuums, ja die sogenannte Einheit des Individuums erscheint unter diesem Aspekt als das Resultat antagonistischer Kräfte, unter denen sich einzelne als stärker erweisen als andere. So 56 F. Schiller: Tabulae votivae.- In: ders.: Werke in drei Bden., hrsg. v. H. G. Göpfert. München, Wien 1966, II, p. 729-735, hier p. 734. 57 F. Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausg., hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari. München, Berlin, New York 1980, II, p. 76. 58 Novalis: Schriften, p. 417/419. ist das Individuum nicht eine Voraussetzung, sondern selbst als ein voraussetzungsreiches und letztlich fragiles Resultat eines Willens zur Macht im Inneren des Individuums. Summa summarum: es gibt ein Individualitätsspiel, das die Menschen der modernen, bürgerlichen Ära zu spielen gelernt haben. Ihnen selbst stellt sich dieses Spiel des Scheins von Individualität allerdings dar als eine Realität, bzw. zuweilen auch als zu realisierendes Projekt. Der Reichtum des Individuums ist somit die historisch voraussetzungsreiche, besondere Gewordenheit. „Individualität ist die konkrete Konfiguration, in die geschichtliche Prozesse münden. Es ist diese Individualität, über die wir im Normalfall einzelne voneinander unterscheiden…“59 Insofern kann man, wenn Individualität als gefährdet angesehen wird, durchaus auf den Gedanken kommen, sie über Geschichten und den in ihnen wirksamen Mechanismus der Besonderung in Einzelnes retten zu wollen. Wenn man so verfahren möchte, dann wird zu fragen sein, was an den erzählten Geschichten für die Besonderung verantwortlich ist; ist es der Gestus des Erzählens, sind es die erzählten Inhalte, oder ist es beides zusammenwirkend? Wissenschaft geht auf das Allgemeine, wissen wir seit Aristoteles; und wenn es in den Geschichten um Besondertes ginge, könnte es keine Wissenschaft von Historischem geben. Seit der Historisierung unserer Kultur im 18. Jahrhundert wurde jedoch eine solche Auskunft nicht mehr akzeptiert. Man suchte daher nach Gesichtspunkten, unter denen der Allgemeinheitsanspruch von Vernunft und Wissenschaft mit dem inneren Reichtum des durch Geschichten Besonderten verträglich gemacht werden könnte. Der zunächst naheliegende Gedanke war, daß der Mechanismus der Besonderung eben keine wilde Zufälligkeit und regellose Chaotik war, sondern seinerseits Gesetzen unterlag. Für die Ontogenese individuellen Geistes machte man das am Begriff der Bildung fest. Auch wenn jeder einzelne Organismus sich von einem anderen seiner eigenen Spezies prägnant unterscheide, so sagte man, unterliegt doch die Art, wie diese Unterschiede zustande kommen, allgemeinen Gesetzen, die genau dadurch ihre ungeheure Produktivität erwiesen. Ähnliches gelte dann für die phylogenetischen Hervorbringungen mit ihren Besonderheiten wie Sprache und Dichtung. Eine Sprache besteht aus einer begrenzten Zahl von Wörtern und einer begrenzten Zahl von Regeln; dennoch lassen sich unendlich viele Sinngehalte mit diesen Mitteln aussagen. Sprachen erzeugen die unendliche Vielfalt jedoch nicht nur durch rekursive Anwendung der Regeln, sondern ebenso sehr durch tolerable Regelverletzungen. Solche sinnproduktiven Regelverletzungen können wir Ereignisse nennen. Aber auch die Autonomie bei Kant, die die Sittlichkeit ausmacht, ist, mit Rücksicht auf die Totalität heteronomer Regeln der Verhaltenssteuerung eine absolute Regelverletzung, 59 E. Angehrn: Geschichte und Identität. Berlin, New York 1985, p. 267, mit Rückgriff auf H. Lübbe: Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Basel, Stuttgart 1977, p. 146ff. die in dieser Verletzung freilich (nach Kant) die Realität einer ganz anderen Regularität (nämlich aus Pflicht zu handeln) beweist und damit gerade nicht individualitätsgenerierend wirkt, sondern Zeugnis einer überlegenen Allgemeinheit des vernünftigen Subjekts darstellt. Kant macht sozusagen einen Bogen um das Problem der Individualität und redet nur von den allgemeinen Strukturen des vernünftigen Subjekts. Die Individualität jedoch nennt er „unerforschlich“.60 Einige Ereignisse können als Taten handelnder Subjekte interpretiert werden. Und Hegel verlegt tatsächlich die Individualität in die Tat. In seiner Auseinandersetzung mit der Physiognomik, die versucht hatte, zwischen dem Aussehen eines Menschen, besonders seiner Kopfform, und seinem Charakter Parallelen herzustellen, immerhin verdankten sich ja beide einem individualisierenden und vielleicht parallel verlaufenden Bildungsprozeß, insistiert Hegel (mit Lichtenberg) darauf, daß die Wirklichkeit eines Menschen nicht sein Aussehen etwa des Gesichts sei. Das bei Hegel angeführte Lichtenberg-Zitat61 läßt sogar die Interpretation zu, das Gesicht als solches für eine Maske zu halten, d.h. gerade für eine Verbergung der Wirklichkeit. Hegel sagt: „… das wahre Sein des Menschen ist vielmehr seine Tat, in ihr ist die Individualität wirklich …“62 Die Tat also ist es, die vereinzelt und den Täter mit ihr in seiner Individualität ausweist. Die Tat ist nach Hegel der Stoff, aus dem Geschichte und die Besonderheit der Geschichten gemacht sind; das aber heißt auch, daß die Individualität des Täters der Tat nicht vorausgeht. Geschichte ist nach Hegel nicht das Summen-Resultat subjektiven und kontingenten Wollens und Meinens. In der geschichtlichen Tat setzt sich vielmehr die Objektivität des Geistes als Prozeß durch; die Tat ist es, die den Täter zum Täter macht und nicht umgekehrt. Individualität ist historisches Produkt, nicht Voraussetzung der Geschichte. Th. W. Adorno hat der Hegelschen Philosophie vorgeworfen, daß sie kein Interesse daran habe, „daß eigentlich Individualität sei.“ 63 Dieser Befund gelte trotz des Leitbildes des „Individuums in der individualistischen Gesellschaft.“ Denn ihr principium individuationis ist das der Tauschgesellschaft, in der das Individuum nur dadurch bestimmt ist, daß es Tauschpartner sein kann. So sind die Individuen nichts 60 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft B 567; cf. ferner in der Religionsschrift die „Tiefe des Herzens“ ist ebenfalls „unerforschlich“, Ges. Schriften VI, p. 51. 61 G. Chr. Lichtenberg: Schriften und Briefe III, hrsg. v. W. Promies. München 1972, p. 258; cf. I, p. 549 (= F 647): hier sagt Lichtenberg, daß die entlarvende Absicht der Physiognomiker, hinter der Physiognomie den wahren Charakter aufzudecken, irreleitend sei: „Darin besteht eigentlich der Mensch, so wie er sich ganz ermorden kann, so kann er auch Leidenschaften ermorden. Er kann jeden Zug des Gesichts töden.“ 62 G. W. F. Hegel: Schriften. Frankfurt a. M. 1970ff., III, p. 242. 63 Th. W. Adorno: Negative Dialektik. Frankfurt a. M. 1966, p. 334. anderes mehr als „Ausführungsorgane des Allgemeinen.“64 Adorno spricht daher von einer „Dekomposition des Individuums“. Das dekomponierte Individuum ist zugleich eines, das die Leidenschaft des Widerspruchs nicht mehr kennt, weil die Anpassungsleistung nicht mehr nur äußerlich bleibt und die Kontrolle der Anpassung ins Individuum selbst verlegt wurde. „Das Individuum überlebt sich selbst.“65 Die Frage aber, die Hegel artikuliert hatte, nämlich die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Allgemeinem ist nicht überlebt. Denn nach Adorno ist das Individuum ein solches nur durch das Denken, Denken aber ist Denken des Allgemeinen. Also ist es nicht die Anpassung eines Individuell-Kontingenten an das Allgemeine der Vernunft, um die es geht, sondern das Allgemeine hat nur Bestand als vom Individuum Gedachtes, und nur im Denken des Allgemeinen bewährt sich das Individuum, nicht etwa durch Flucht oder durch ohnmächtige Anpassung. „Durch Erfahrung und Konsequenz ist das Individuum einer Wahrheit des Allgemeinen fähig, die dieses, als blind sich durchsetzende Macht, sich selbst und den anderen verhüllt.“66 Für Adorno ist daher das Individuum der eigentliche Hort der Kritik. Wenn Hegel dem Individuum seine Kontingenz und Partikularität vorhielt, so ist das nur erklärlich als der Versuch, „das kritische Moment zu entmächtigen, das mit individuellem Geist sich verknüpft.“67 Dabei sind sich Hegel und Adorno doch in einem einig: das Individuum ist nicht das substantielle Unmittelbare. Es ist vielmehr selbst der Ort der Vermittlung des Allgemeinen. Denn als reine Kontingenz gedacht, wäre das Individuum ohne alle Begriffe, die alleine der individuellen Erfahrung Kontinuität geben können. „Zum Subjekt wird das Individuum, insofern es kraft seines individuellen Bewußtseins sich objektiviert, in der Einheit seiner selbst wie in der seiner Erfahrungen …“68 Noch radikaler lesen sich die Bemerkungen Adornos in den „Minima moralia“. Dort wird die Liquidation des Individuums als zu optimistische Diagnose bezeichnet.69 In Wahrheit besteht es fort in seiner Einzigkeit, doch nun mit Kuriositätswert: „Ein Ausstellungsstück wie die Mißgeburten.“ „Die ihre Individualität feilhalten, machen als ihr eigener Richter freiwillig den Urteilsspruch sich zu eigen, den die Gesellschaft über sie verhängt hat.“70 Ökonomisch jedoch ist Individualität längst überlebt; in der Frühphase der Markt- 64 ibd. 65 l. c., p. 335. 66 ibd. 67 l. c., p. 52. 68 ibd. 69 Th. W. Adorno: Minima moralia.- In: ders.: Gesammelte Schriften. Darmstadt 1998, IV, p. 153. 70 l. c., p. 154. orientierung hatte Individualität auf einem lokalen Markt durchaus ihren Sinn. Tatsächlich ist die Form des Individuums nur ein Effekt und eine Reflexionsform von gesellschaftlichen Prozessen, nicht aber hat sie einen Rückhalt in organischen Substraten. Unter der Gesellschaftsform der Arbeitsteilung werden vereinzelte Individuen als Bedingungen des Austauschs arbeitsteilig erzeugter Produkte hervorgebracht. Nun aber, im Zeitalter des Verfalls von Individualität, tritt gerade unter den Formen des Verfalls ein Menschliches hervor.71 Individualität ist per se nicht repräsentierbar; denn die Sprache der repräsentierenden Begriffe ist eine identifizierende Sprache, die das Einzelne stets verfehlt. Sie kann im Bezeichneten immer nur das Allgemeine, das mit anderem Identische, aussagen, nicht das, was sich als Individualität, als Differenz zu allem anderen festhält. Gerade die Vielfalt der Differenzen und Abweichungen, Devianzen, macht den Reichtum von Individualität aus, nicht aber irgendeine inhaltliche kompakte Fülle. Nur als Differenzen nach außen und diesen entsprechende innere Differenziertheit manifestiert sich Individualität, nicht durch eine Sättigung in sich selbst. Auch Emmanuel Lévinas geht davon aus, daß sich Individualität dem Begreifen in terminis eines Allgemeinen entzieht. Das Allgemeine formiert bei ihm unter dem Begriff der Totalität.72 Er kann sich jedoch das im Individuum sich der Allgemeinheit Entziehende weder in kognitiven noch in volitiven Akten oder Beziehungen denken. „Das Individuelle und Persönliche sind notwendig, damit das Unendliche sich als Unendliches ereignen kann“73, nämlich als etwas, das jenseits der Totalität des Wollens und Erkennens sich erstreckt. 2.3.3 Die Gesellschaftlichkeit des Individuums Halten wir also fest: Auch wenn der Rückgriff auf den Begriff des Individuums einen Reichtum von Bestimmungen meint, ist dieser Reichtum im Inneren doch ein gesellschaftlich ermöglichter und erzeugter Reichtum, er ist weder Natur noch ein Residuum dessen, was sich gesellschaftlichen Zugriffen und Begriffen entzöge als organische Bedürfnisstruktur oder als metaphysisch-transzendentes Konglomerat von „Wesenskräften“.74 Deshalb steht Individualität nicht, wie es teilweise in der Geschichte des Bildungsbegriffs gedacht worden ist, am „Ursprung“ eines quasi-ästhetischen Selbstschöpfungsprozesses, sondern ist selbst das Resultat eines Lernprozesses. Ein Individuum zu sein, wird dann gesellschaftlich zugemutet; man kann dieser Zumutung 71 l. c., p. 169ff. 72 E. Lévinas: Totalität und Unendlichkeit. Freiburg, München 1987, p. 314ff. 73 l. c., p. 316. 74 Cf. E. Durkheim: Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt a. M. 1981, p. 499ff. nicht von Natur aus genügen, sondern man muß es einüben. Das läßt sich vor allem an denjenigen Attributen von Individualität zeigen, die moralischer Natur sind, also an der Gewissenskultur. In seinen moralgenealogischen Schriften hat Nietzsche gezeigt, wie das Gewissen als „schlechtes Gewissen“ entsteht und wie dieses im Laufe eines langen und schmerzhaften Prozesses dem Leib inokuliert wird. Wenn man nun aber, Nietzsche folgend, die Frage aufwirft, ob eine Inokulation von Individualität eigentlich notwendig ist, dann kann die Antwort entweder aus der Perspektive des Individuums am Ende seines Individualisierungsprozesses erfolgen oder aus der Perspektive der Gesellschaft. Unter der Perspektive des Individuums ist das Resultat eigentlich klar: das Individuum fühlt sich bereichert und leidet zugleich unter dieser Bereicherung. Wenn es aber genügend demjenigen Typ von Individualisierung entspricht, der uns als bürgerliches Genie vom Typ Werther bis Kafka bekannt ist, dann wird es selbst sein erhöhtes Leidensniveau als Bereicherung empfinden. Aus der Perspektive der Gesellschaft erscheint der Ertrag ebenfalls durchaus ambivalent. Einerseits dient die Individualisierung der Stabilisierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dann nämlich wenn die Kontrolle geltender Normen den Individuen als Pflicht der Lebensführung auferlegt werden kann. Autonomie wird dieser Zwangsmechanismus genannt; dem Individuum wird gesellschaftlich zugemutet, Subjekt zu sein. Aber die Stabilisierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch die Subjektivität der Individuen ist zugleich prekär. Denn jedes Gesetz, sei es autonom sei es heteronom, führt als Kehrseite seiner Gesetzeskraft seine Übertretung und seine Überschreitung stets mit sich. Ist die Gesetzeskraft 75 eine soziale Kraft, dann ist auch die Übertretung ein sozialer Akt, der – gemeinsam oder repräsentativ vorgenommen – die Sanktion ebenfalls als sozialen Akt nach sich führt. Insofern stabilisieren Übertretung und Sanktion nur als Zusammenspiel das soziale Band. Es benötigt die Internalisierung der Normen oder Gesetze ins Innere des Individuums nicht. Wird das Gesetz jedoch ins Innere des Subjekts verlagert, dann erscheint die Gesetzeskraft jetzt als moralische Kraft (bei Kant als „Achtung“ vor dem Sittengesetz). Eine Übertretung dieses imaginierten Gesetzes führt aber keineswegs oder nur kontingenterweise zu einer Stabilisierung des sozialen Bandes, vielmehr lediglich über das schlechte Gewissen zu einer weiteren Differenzierung von Individualität. Die soziale Unzuverlässigkeit des moralisch hochsensiblisierten Individuums führte denn auch in der Frühzeit des bürgerlichen Genies zu mannigfachen Thematisierungen, z.B. bei Schiller („Verbrecher aus verlorener Ehre“ oder die Gestalt des Karl Moor in den „Räubern“). Sie führte aber auch dazu, daß man Moral und Recht 75 Zu diesem Begriff im Ausgang von Benjamin und Derrida s. P. Gehring: Gesetzeskraft und mystischer Grund.- In: Einsätze des Denkens, hrsg. v. H.-D. Gondek u. B. Waldenfels. Frankfurt a. M. 1997, p. 226-255. in sozialer Evolution immer stärker differenzierte und schließlich der individualisierten Moral immer weniger an sozialer Bindungskraft zutraute und immer mehr – zuvor nur sozial-moralisch geregelte Beziehungen, z.B. der Intimsphäre – für rechtlich regelungsbedürftig hielt. Selbst absurde Meinungen wie die Leugnung des Holocaust stehen seit 1994 unter Strafe. Man kann das mit Habermas als eine „Kolonisierung der Lebenswelt“ durch Systemstrukturen kritisieren, man könnte aber auch umgekehrt eine Überfrachtung und Überforderung des Rechtssytems befürchten. So wird die gesellschaftliche Reproduktion zunehmend von einer, nur noch einer ästhetischen Logik folgenden, um sich greifenden Individualisierung abgekoppelt. Insbesondere in hochdifferenzierten Gesellschaften der Spätmoderne und Postmoderne kann die gesellschaftliche Reproduktion nicht von so etwas Kontingentem und Fragilem wie hochdifferenzierten Individuen abhängig gemacht werden. Auf der anderen Seite paralysiert sich diese Differenziertheit auch selbst. Die Individuen werden für sich selbst und einem kleinen Kreis von Mitbetroffenen zu „schwierigen“ Individuen und haben dann mit sich selbst, mit ihrer Selbstfindung und Selbstverwirklichung so unendlich viel zu tun, daß sie gesamtgesellschaftlich nur noch so weit stören, wie diese Gesellschaften die Störungen zur Selbststabilisierung benötigen. All diese psychisch Halbkranken, die sich in Selbstfindungs- und Wohlfühl„therapien“, wie z.B. der „Bioenergetik“, einfinden, versammeln und tummeln, sind Indizien dieser radikalen Veränderung der Funktion von Individualität. Sie bedienen einen gesellschaftlichen Krankheitsbedarf. Selbst für die Kunst, die dort gepflegt wird, ist deren ästhetische Originalität nur noch ein pathographisches Sonderphänomen. Nichts mehr hängt von ihm ab. Nach dem Bericht der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages befinden sich in solchen Gruppen zu 69% Frauen, und zwar vorwiegend der oberen Bildungsschichten (Durchschnittsalter 45), d.h. Personen, die keine „wirklichen“ Probleme haben, sondern eben diejenigen sind, die am stärksten dem Individualisierungsdruck ausgesetzt sind und unter ihm leiden. 76 Die sozialen Funktionen, die eine reiche innere Vielfalt des Individuums für die Moderne hatte, bestehen auch in der Postmoderne fort, jedoch so, daß nicht mehr auf die Einheit des Individuums zurückgegriffen werden müßte. Individuen werden nun offenkundig zu dem, was sie immer schon subkutan waren: Dividuen. Die dividuell medial erzeugten Profile der früher Unverwechselbaren sind beliebig, d.h. einem ökonomischen Diktat folgend, austauschbar und rekombinierbar geworden, weil nun nicht mehr Individuen mit unauslotbaren Tiefen im Inneren gefragt sind, sondern die Dividualitäten, die die immer noch so genannten Individuen bei sich führen. 2.3.4 Der Wert des Individuums – Dauer oder Verlust? 76 Abschlußbericht der Enquête-Kommission „Sogenannte Sekten und Psychogruppen“, hrsg. v. Deutschen Bundestag, Ref. Öffentlichkeitsarbeit. Bonn 1998, p. 94. Es wird allenthalben gefragt, ob der Wert des Individuums unter diesen, den postmodernen Bedingungen droht verloren zu gehen, und ob das nicht ein beklagenswerter Verlust wäre. Allerdings ist die Klage über eine mangelnde oder unzureichende Berücksichtigung des Eigenwerts des Individuums nicht ganz neu. Das sei an einem einzigen Fall exemplarisch gezeigt, nämlich der Klage, daß Kant in seiner Philosophie das Individuum und das Individuelle nicht genügend berücksichtigt hätte. Dieser Vorwurf datiert seit der Romantik und Hegel, in den Blick genommen sei hier jedoch die Neuanknüpfung an Kant im Neukantianismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, speziell bei Georg Simmel, der diese Klage prägnant vorgetragen hat. In der 16. seiner Kant-Vorlesungen sagt er eingangs: „Die prinzipiellen Lebensprobleme der Neuzeit bewegen sich im wesentlichen um den Begriff der Individualität; wie sich ihre Selbständigkeit gegenüber der Macht oder dem Rechte der Natur und der Gesellschaft gewährleisten läßt oder wie sie sich diesen beiden unterzuordnen hat, wird in allen denkbaren Kombinationen und Maßverhältnissen durchprobiert. Einer der umfassendsten Lösungsversuche dieses Problems ist die spezifische Leistung des 18. Jahrhunderts, das auch nach dieser Seite hin in Kant gipfelt…“ 77 Und diesen Begriff des Individuums, den das 18. Jahrhundert herausbildete, charakterisiert er mit folgenden paradoxen Worten: „… der allgemeine Mensch, der doch zugleich Individuum ist. Der Mensch soll schlechthin auf sich stehen, für sich allein verantwortlich sein, im schärfsten Gegensatz gegen alle Normen, die den Menschen nur als Glied einer Einung, Element einer Kollektivität, Subjekt einer überindividuellen Allmacht kannten – aber dieser Mensch ist seinem Kerne und seinem Rechte nach immer nur einer und derselbe … Es ist, als ob die Isolierung des Menschen gegen den Menschen, die die Freiheitsfunktion dieses Individualitätsbegriffs mit sich brachte, in der qualitativen Gleichsetzung der Individuen ihre Ausgleichung und Erträgtlichkeit gefunden hätte.“ 78 Obwohl konsequentester Ausdruck eines Individualismus und einer absoluten Souveränität gegenüber aller Heteronomie durch Natur, Gesellschaft und Geschichte, ja selbst Sprache, ist das Kantische Subjekt dennoch seiner Struktur nach ein allgemeines und gerade nicht spezifisch individualisiertes. Jedes Subjekt, bestimmt als absolut souveränes Individuum, ist doch gerade in seinem Subjektcharakter allen anderen Subjekten gleich. Anders gesagt, dieses „Individuum“ bei Kant ist bar aller Individualität, weil frei von jeder inhaltlichen Bestimmtheit seiner Einzelnheit. Die Freiheit dieses „Individuums“ konnte als eine absolute postuliert werden, weil sie die „Freiheit wesentlich gleichgearteter Individuen“ war. Es konnte – so Simmel – nicht 77 G. Simmel: Gesamtausg. IX. Frankfurt a. M. 1997, p. 215. 78 l. c., p. 217. zugestanden werden, „daß die theoretisch-praktische Anlage der Menschen in ihrem letzten, absoluten Grunde eine verschiedene sein könnte.“79 In seiner Spätphilosophie der „Lebensanschauung“ von 1918 führt Simmel diese Kant-Kritik konsequent fort. Er hält nun fest, daß bei Kant nicht dem Individuum das Pflichtgebot auferlegt ist, sondern demjenigen Teil des unteilbaren Individuums (d.h. eben doch Dividuums), das seine überindividuelle Vernunft repräsentiert.80 Bei Kant könne es demnach gerade nicht das Individuum sein, das sich autonom selbst sein Gesetz gibt, sondern, so stellt Simmel nunmehr fest, der Befehlsgeber des kategorischen Imperativs ist eine Instanz jenseits des Individuums. Dann aber handele es sich, gerade nicht um Selbstgesetzgebung (Autonomie), sondern der kategorische Imperativ ist ein dem Individuum gegenüber Heteronomes. Wir wissen, und Simmel weiß es auch, wie Kant sich aus dieser Theorie-Falle befreit hat; Simmel erklärt es so: die vernünftige Subjektivität mache „das Wesen unseres Wesens“ aus. Denkt man jedoch wie Simmel, nicht vom Subjekt-Begriff, sondern vom Begriff des Individuums aus, dann erscheint die Auszeichnung dieses vernünftigen Teils des Individuums als das wesentlich Wesentliche, als sein Eigentliches, als ein reiner Willkürakt theoretischen Bestimmens. Denkt man freilich wie Kant vom Begriff des Subjekts aus, dann erscheint das von Simmel in seiner Kant-Kritik formulierte „individuelle Gesetz“ anstelle der Allgemeinheit der Vernunft als ein Einfalltor für Beliebigkeit. 2.3.5 Fremdheit und Individualität Individualität als der Reichtum der Bestimmung des Einzelnen und als Kultur der Differenziertheit ist bewußter und damit angeeigneter Reichtum. Als solcher ist er wesentlich Resultat einer Reflexion auf Eigenheit und Eigentum. Damit ist er in Gegensatz gesetzt zur Fremdheit. Individualität und ihre Aneignung zu Eigenheit und Eigentum erscheint damit nach außen hin immer als Abgrenzung von einer Sphäre des Nichteigenen, und genau das ist Fremdheit. In dieser Abgrenzung oder Ausgrenzung ist der Fremde jenseits derjenigen Grenze, durch die wir die Individualität unserer Eigenheit bestimmt wissen. Fremdheit ist niemals substantiell bestimmt; Fremde sind Fremde-für-uns und weil wir es so wollen.81 Sich selbst oder seinen Nachbarn, den Anderen-für-ihn, ist er gar nicht fremd, sondern nur uns. Gab es eine Tendenz, die Kategorie des Fremden in die des Anderen, des Anderen eines Selbst, aufzulösen, d.h. eines, von dem uns keine Grenze der Verstehbarkeit trennt, so ist seit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ in der deutschen Bevölkerung auch ein Umschwung des Sinnes zu beobachten, daß die Fremden gefälligst Fremde bleiben sollen und wir bestimmen, was ein solcher ist, dessen Fremdheit nicht ange- 79 l. c., p. 219. 80 l. c. XVI, p. 355f. 81 K. Röttgers: Sozialphilosophie. Macht – Seele – Fremdheit. Essen 1997, p. 175-186. eignet werden soll: Muslime gehören dieser Logik zufolge nicht in „unsere“ Kultur. Hatte man vorher geglaubt, daß die Religionen voneinander lernen können und daher Toleranz in unserem eigenen Interesse liege – so noch Lessing in seinem Drama „Nathan der Weise“, vor allem in seiner Ring-Parabel –, so macht sich bei den selbsternannten „Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes“ die Überzeugung breit, daß wir nicht wissen wollen sollten, was Fremdheit für Lern- und Entwicklungschancen bereithält. Gewiß, Toleranz und Lernbereitschaft sind etwas anderes als Multikulti-Gleich-Gültigkeit. Das Bewußtsein der Eigenheit und der Abgrenzung vom Fremden ist eine Bedingung für Lernchancen. Die multikulturelle Gleichgültigkeit tendiert zu einer Nivellierung von Eigenheit und Individualität. Wenn menschenrechtlich-universalistisch alle Menschen Brüder und Schwestern sein sollen, dann verliert sich Eigenbestimmtheit. Der totale Überwachungsstaat bzw. die Überwachungsweltgesellschaft der Geheimdienste will eine solche Gleichbehandlung aller Individualität, nämlich nicht alle Menschen als Brüder, sondern alle Menschen als tendenziell Verdächtige und potentielle Terroristen zu behandeln. In der Universalität des Verdachts löst sich Eigenbestimmtheit auf. Der Fremde ist nur noch übergangsweise, solange noch nicht genügend Erkenntnisse über ihn vorliegen, ein Fremder. Durch die möglichst lückenlose Überwachung wird ihm seine Fremdheit genommen werden und in ein Profil des Verdachts eingefügt; aber genau damit werden Eigenheit und Individualität ebenso zerstört. Nicht mehr das unendlich differenzierte Individuum oder das darin verborgene autonome Subjekt dirigieren die Geschichte, sondern das Medium. Der Kulturimperialismus der Auflösung von Fremdheit und der Kulturrelativismus, auch wenn sie sich zu bekämpfen scheinen, widersprechen sich doch nur scheinbar; im Grunde sind sie sich einig, daß Fremdheit nicht sein soll, keine Abgrenzung/Diskriminierung. Tatsächlich sind sie zwei Seiten desselben Syndroms. Und insgeheim sind sie sich auch einig in der Ignoranz der Tatsache, daß mit dem Verlust von Fremdheit82 ein Verlust an individueller Eigenheit einhergeht. Daher sind die imperialistische und die relativistische Ent-fremdung und der Verlust an Eigenheit zusammengehörig. Der Verlust aber von Individualität und Eigenheit sind nicht Erfindungen einer kulturkritisch-nörgelnden Litanei, sondern sind mit der Herrschaft des Medialen ein objektiver Tatbestand. Diese Kapitulation des Individualismus vor der Medialität drückt sich im Bewußtsein der Betroffenen in der Affirmation aus: ‚Wer nichts zu verbergen hat, braucht die Tendenz zum sogenannten gläsernen Bürger nicht zu scheuen; wer aber diese Furcht hat, der hat offenbar etwas zu verbergen und bestätigt genau dadurch, daß er zu recht verdächtigt und überwacht wird.‘ Die universalistische Tendenz der 82 ders.: Der Verlust des Fremden.- In: Transkulturelle Wertekonflikte, hrsg. v. K. Röttgers u. P. Koslowski. Heidelberg 2002, p. 1-16. Menschheitsverbrüderung oder der globalen Durchsetzung der „Menschenrechte“ und der „Demokratie“ organisiert eine allgemeine Zustimmungsfähigkeit und -bereitschaft, der sich dann niemand mehr in seine Individualität soll zurückziehen dürfen. Eine absolute Transparenz, von der ja bereits Rousseau geträumt hatte, eine grenzenlose Weltöffentlichkeit soll jedes Vergehen gegen Menschenrechte und Demokratie und kapitalistisch-„freien“ Markt schonungslos verfolgen können. Wer sich diesem universalisierten guten Willen entziehen wollte, soll keine Schlupflöcher der Verfolgungsfreiheit mehr finden können. Schon jeder Verstoß gegen die „political correctness“, z.B. die Weiterverwendung des Wortes „Neger“, oder die Verweigerung des grammatikpolitischen Feminismus macht einen Sprecher verdächtig, jedenfalls kein guter Mensch zu sein, wenn nicht gar Schlimmeres von ihm zu befürchten ist. Die um sich greifende Güte fordert ihren Tribut im historischen Übergang zur Postmoderne als Korrosion des geheimnisvollen, gefährlich-verführerischen Fremden ebenso wie der der reichen Individualität der folgenlosen Besonderheiten.83 Der beschriebene Individualitätsverlust ist zu unterscheiden von dem anderwärts diagnostizierten und auch wohl beklagten „Tod des Subjekts“. 84 In der Spätmoderne des 19. Und 20. Jahrhunderts sind beide Vorstellungen als wechselseitig ergänzungsbedürftig und beidseitig steigerbar angesehen worden, so daß z.B. Georg Simmel das Bedürfnis seiner Zeit auf die Formel gebracht hat „Kant und Goethe“85, soll heißen: Subjektzentrierung und Individualität. Das Selbst aber in der medialitätszentrierten Sozialphilosophie des kommunikativen Textes ist nichts als eine Funktionsposition, bar jeden Abgrunds von Individualität und jeder Verallgemeinerbarkeit vernünftiger Subjektzentrierung, es ist nichts anderes als seine Bezüglichkeit auf den Anderen. 2.3.6 Individualität als Abweichung In der Moderne ist das Individuum das Einzelne, das aus dem unzerstörbaren Reichtum seiner Einzelbestimmungen besteht. Diesen Reichtum kann man auch privativ deuten. Dann erscheint Individualität als Abweichung sowohl vom Normalen als auch von den Normen, d.h. auch als Überschreitung. Der große Kriminelle (Dostojewskis Raskolnikov), ebenso wie das Genie (Hölderlin oder Kleist), der von seinen Obsessionen Gejagte, mancher Bohémien und schließlich der Satan selbst sind hoch individualisierte Figuren.86 Die Spießer, die Durchschnittlichen und hoch Angepaßten und hoch Angesehenen sind dagegen vergleichsweise weniger individuell. 83 Ein Terminus von Hermann Lübbe. 84 Die Frage nach dem Subjekt, hrsg. v. M. Frank, G. Raulet, W. v. Reijen. Frankfurt a. M. 1987; Tod des Subjekts?, hrsg. v. H. Nagl-Docekal u. H. Vetter. Wien, München 1987. 85 G. Simmel: Kant und Goethe.- In: ders.: Gesamtausg. X, XXX p. 119-166. 86 K. Röttgers: Teufel und Engel. Bielefeld 2005. Ist in der Genetik die Mutation schließlich nur ein Abschreibfehler der Gene,87 so sind auch diese unangepaßten Individuen nur Abschreibfehler des Normensystems. Ein solcher Kopierfehler kann sowohl eine Chance zur Höherentwicklung als auch schlicht eine Fehlentwicklung sein: defizitär oder deviant. Genetische individuelle Abweichung ist allerdings nur das Grundmodell, für die kulturwissenschaftliche Abweichung muß dieses Modell zweifellos erweitert werden. Auch in der Kultur erscheint Individualisierung zunächst als kontingente Abweichung von normativen und kulturellen Normalitätsmustern, als Un-sinn in der Diskursivität.88 Dieses Deutungsmodell von Individualität gibt Anlaß zu der Vermutung, daß eine solche Abweichung des Individuums nicht ein unkontrollierter Ausbruch aus einer unauslotbaren Reichtumsquelle im Inneren des Individuums ist, sondern eine kontingente, ja zuweilen schicksalhafte Abweichung vom Normalen, die sich vielleicht fremd- oder eigenverstärkt (aus dem Anderen!) zu einem Habitus stabilisiert. Ein eher triviales Beispiel: Jemand kommt rein zufällig dazu, in seiner Handschrift zur Wiedergabe des „z“ das entsprechende Sütterlinzeichen „ʓ“ zu verwenden. Die Lesbarkeit seiner Handschrift für ihn und andere nimmt zu, es bleibt dabei und wird zum unverwechselbaren Kennzeichen seiner individuellen Handschrift. Dergleichen ist nicht rational planbar, es geschieht. Man kann aus dieser individuellen, erfolgreichen Abweichung keine allgemeine Vorschrift ableiten, daß alle Welt so verfahren sollte, weil andere Handschriften vielleicht ganz andere Wiedererkennungsprobleme haben mögen. Das Ensemble von – seiner Entstehung nach – zufälligen, jedoch singulär funktionalen Abweichungen macht ein Individualitätsprofil aus, nicht eine Eruption aus den substantiell bestehenden Tiefen. Mit anderen Worten: die Quelle quillt, und es gibt keine Quelle hinter der Quelle, die das Quellen der Quelle verursachen würde. Schon die Romantik fand z.T. die Vorstellung der verursachenden Tiefe des Individuums auch als etwas Bedrohliches, als einen Abgrund. „Jede Individualität aber ist ein Abgrund von Abweichungen, eine Nacht; die nur sparsam von dem Licht allgemeiner Begriffe erleuchtet wird.“89 2.3.7 Die Dialektik von Globalisierung und Regionalisierung 87 R. Dawkins: The Selfish Gene. Oxford 1989. 88 Cl. Geertz: The Impact of the Culture on the Concept of Man.- In: The Interpretation of Cultures. New York 1973, p. 33-54, bes. p. 51ff.; A. Hetzel: Zwischen Poesis und Praxis. Würzburg 2001. 89 K. v. Günderode: Sämtliche Werke und ausgew. Studien, hrsg. v. W. Morgenthaler. Frankfurt a. M. 1990, I, p. 354. Aus all dem ist ersichtlich, daß der vermeintlich als Substanz abgesicherte Reichtum des Individuums kein Gegenhalt oder gar Prophylaxe gegen die seit dem 20. Jahrhundert um sich greifenden Totalitarismen sein kann. Noch Georg Simmel hatte nämlich geglaubt, daß Individualität der Vermassung entgegenstünde, weil das Individuum stets reicher sei als der kleinste gemeinsame Nenner, der festlegt, der irgendeine soziale Verbindung oder Wechselwirkung, oder gar der Massen einen könnte. Gegenüber dieser antinomischen Struktur Individuum vs. Masse macht Hermann Lübbe geltend, daß die weltweite Vernetzung, und Homogenisierung im Zuge der Globalisierung begleitet ist von einer Pflege der Kultur der Regionen und der Lokalisierung.90 Diese beiden Bewegungen sind dialektisch aufeinander bezogen und sind im Zusammen geeignet, die Vermassung als Fundament der Totalitarismen hinter sich zu lassen. Gibt man die Fiktion einer Substanz inneren Reichtums des Individuums auf, droht keineswegs automatisch das Schreckgespenst einer allgemeinen Nivellierung. Das Allgemeine und das Besondere begegnen sich nämlich auf den vielfältigsten Ebenen, so daß die Antinomie entweder Individuum oder Vermassung viel zu kurz greift. Die Vereinzelung und die globale Vernetzung sind konkomitante Prozesse, die wechselseitig aufeinander verweisen, ja geradezu aufeinander angewiesen sind.91 Wenn man das aber einmal begriffen hat, dann ist das heroische Pathos, das mit der Besonderung die Heroik der Einsamkeit glaubt bezahlen zu müssen, unangebracht. So ist Nietzsches Pathos der Einsamkeit der Unzeitgemäßen nicht länger angesagt. Die gelobte Vornehmheit ist eben keine Qualität einzelner Individuen, denen sie dann zum Schicksal der Einsamkeit geriete, weil die „Herde“ diese Besonderung angeblich weder nachvollziehen kann noch soll. 2.3.8 Die Freiheit der Individuums Der historische Prozeß der Individualisierung hat mit sich einen emphatisch aufgeladenen Begriff der Freiheit des Individuums geführt, wie er sich auch in der paradoxen Formel „In Ketten: frei“ ausdrückt. Die Genese dieser Formel, ihre Probleme und ihre mögliche Auflösung seien daher zunächst dargestellt. 2.3.8.1. Der Begriff der sozialen Freiheit In vielen und dominanten Teilen der philosophischen Literatur der Gegenwart wird Freiheit zumeist reduziert wahrgenommen, nämlich als innere, philosophische, bzw. 90 H. Lübbe: Netzverdichtung.- In: Zs. f. philosophische Forschung 50 (1996), p. 133-150. 91 Die Skepsis darüber eint, bei allen sonstigen Unterschieden, die Zivilisationskritiker von A. de Tocqueville über J. Ortega y Gasset bis zu den diversen Spielarten des Kommunitarismus. transzendentale Freiheit oder aber als bloß politische Freiheit. Die ersteren Konzeptionen setzen sich einem wie immer auch begründeten Determinismus entgegen. 92 In den letzten 200 Jahren waren es vor allem zwei Spielarten eines solchen „Determinismus“, die die Freiheitsphilosophen beschäftigten und die sie sich zu widerlegen anstrengten; beide waren raffinierter als der vorangehende mechanistische Determinismus, gegen den die Freiheitsphilosophen des 19. Jahrhunderts noch angetreten waren: Kant, Fichte, Schelling, Secrétan, Lequier, Renouvier u.a.93 Diese beiden raffinierteren Spielarten waren die Philosophien von Marx und von Freud. Nimmt man das dialektische Moment in Marx’ Philosophie ernst, dann ist sie eben durch das freiheitsphilosophische Argument nicht ausgehebelt, daß – wenn doch alles durch die ökonomische Basis bestimmt sei – es nichts zu tun gebe, da ja alles kommen werde, wie es kommen muß, und daß man folglich, um handeln zu können, Freiheit annehmen müsse. Ähnliche Probleme wirft Freuds Nachweis der Abhängigkeit menschlichen Verhaltens von einer unbewußten Triebbasis auf. Der Gedanke, den die Philosophien der Freiheit dagegen setzen, ist begründet in einer Abstraktion sowohl von der Sozialität als auch von der Animalität des Menschen. Resultat solcher Abstraktion ist dann das transzendentalfreie Subjekt, das – wie J. Rhemann in seiner „Einführung in die Sozialphilosophie“ es putzigerweiser formulierte – „nur sekundär den Naturgesetzen“ gehorcht.94 Wir können nicht annehmen, so sagen die Freiheitsphilosophen, daß die Handlungen eines Subjekts durch eine Kausalität oder – wo diese nicht herrscht – durch absolute 92 Cf. aus der älteren, durch die Erfolge der Physik inspirierten Diskussionstradition M. Planck: Vom Wesen der Willensfreiheit. Leipzig 1936; E. Cassirer: Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik. Goeteborg 1937; M. Planck: Determinismus oder Indeterminismus? Leipzig 1938. Noch innerhalb dieser Diskussionsstränge bleiben W. Stegmüller: Kausalitätsprobleme, Determinismus und Indeterminismus. 2. Aufl. Berlin 1983, sowie: Determinismus, Indeterminismus: philosophische Aspekte physikalischer Theoriebildung, hrsg. v. W. Marx. Frankfurt 1990. Weiter dagegen ist gefaßt: Seminar: Freies Handeln und Determinismus, hrsg. v. U. Pothast. Frankfurt a. M. 1978. 93 Ausführlicher dazu s. K. Röttgers: Freiheit: liberalistisch – pluralistisch.- In: Politik und Kultur nach der Aufklärung. Fs. H. Lübbe, hrsg. v. K. Röttgers u.a. Basel 1992, p. 36-68, hier bes. p. 47-49; zur Begriffsgeschichte s. auch R. Spaemann: Freiheit.- In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v.- J. Ritter u. K. Gründer, Bd. II. Basel, Stuttgart 1972, Sp. 1065-1098; I. Fetscher: Freiheit.- In: Marxismus im Systemvergleich, hrsg. v. C. D. Kernig. Frankfurt a. M., New York 1973, Politik I, Sp. 275-300; M. Galceran Huguet: Freiheit.- In: Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, hrsg. v. H. J. Sandkühler. Hamburg 1990, II, p. 157-180. 94 J. Rhemann: Einführung in die Sozialphilosophie. Darmstadt 1979, p. 20. Zufälligkeit bestimmt seien. Viel zu viele unserer sozialen Praxen haben das Bild des in seinem Kern freien Subjekts zur Grundlage. Zu allem Geschehen meinen wir uns einen Handlungsurheber hinzudenken zu müssen, und nur so glauben wir anscheinend Verantwortung und Schuld, Verdienst und Strafen zurechnen zu dürfen, und nur so könnten wir erziehen. Im Hinblick auf zukünftige Handlungen heißt das, daß das Bewußtsein von Alternativen, die Notwendigkeit von Entscheidungen und die Möglichkeit der Entwicklung von Intentionen des Handelnden und der Verläßlichkeit des Vertrauens in die Moralität anderer Handelnder nicht schon in seinem Grundsatz eine Illusion sein dürfte. Dabei spielt die metaphysische Begründung für diese Annahme keine so wichtige Rolle, sie kann – um nur zwei Extreme herauszugreifen – sowohl existenzphilosophisch (Sartre) als auch indeterministisch (Ayer, Popper) ausfallen.95 A. Hauriou, um nur auf ein beliebiges Beispiel Bezug zu nehmen, begründet die Annahme der Freiheit auf zwei Sorten von Gründen: • • die Annahme eines durchgehenden Determinismus alles Naturgeschehens sei nicht haltbar; mit der Emergenz des Lebens trete zweierlei Neues auf: erstens das Prinzip der Selbstbehauptung lebendiger Organismen, das die Entstehung und Verteidigung von „Individuellem“ ermöglicht, zweitens aber die Kreativität.96 Die ungeklärte Frage bleibt allerdings übrig, ob sich nicht Freiheit und Kreativität auch ohne den Bezug auf derartige Ursprungsmythen denken lassen. Denn die Ursprungsmythen werfen ja doch immer das Problem auf, das bereits Friedrich Nietzsche anläßlich der Frage diskutierte, ob die Entstehung der Vernunft selbst ein vernünftiger oder aber ein unvernünftiger Vorgang gewesen sei; 97 wenn Vernunft daran beteiligt gewesen wäre, hätte es sie eben in einem früheren Ursprung schon geben 95 J.-P. Sartre: L’être et le néant. Paris 1943; A. J. Ayer: Philosophical Essays. London 1954; K. R. Popper: The Open Universe. An Argument for Indeterminism, hrsg. v. W. W. Bartley. Bd. III. London 1982. 96 A. Hauriou: Réfléxions sur les statuts épistémologiques réspectives du pouvoir et de la liberté.- In: Revue du Droit Publique et de la Science Politique 90 (1974), p. 643-662, bes. p. 661. 97 F. Nietzsche: Morgenröthe II, 123.- In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausg. III, p. 116: „Vernunft. – Wie die Vernunft in die Welt gekommen ist? Wie billig, auf eine unvernünftige Weise, durch einen Zufall. Man wird ihn errathen müssen, wie ein Räthsel.“ müssen. Ebenso kann man hier fragen: verdankt sich diese Entstehung der Freiheit selbst der Freiheit oder dem Determinismus. Max Planck dagegen, um eine weitere klassische Position des 20. Jahrhunderts zu bemühen,98 unterscheidet einen durchgängigen kausalen Determinismus in Natur und Geisteswelt von dem Problem der Willensfreiheit auf eine erkenntnistheoretische Weise. Der durchgängige Determinismus ist einsichtig allein für einen im Prinzip allwissenden (oder alles wissen Könnenden) und auf das praktische und sich einmischende Machen von Erfahrungen nicht angewiesenen, rein theoretischen Geist. Selbst in den Naturwissenschaften hat diese Vorstellung lediglich heuristischen Wert und ist nicht das Resultat einer empirischen Einsicht. Wie in Grenzbereichen der Naturwissenschaften bereits die Empirie (das Experiment) gar nicht anders kann, als das Beobachtete durch den Akt der Beobachtung selbst zu verändern, so ist humanwissenschaftliche Erkenntnis überhaupt gar nicht anders möglich als durch Eingriff (Exploration, Befragung, Deutung etc.). Daher kann auch ein Entscheidungen für die Zukunft treffendes Handlungssubjekt sich niemals vollständig als durch seine Triebe und Motive determiniert wissen (auch wenn es jener idealisierte rein-theoretische Beobachter könnte, für den das Handeln des Handelnden vollständig aus seinen Trieben und Motiven deterministisch ableitbar wäre). Denn das Wissen des Handelnden über seinen Motivationshaushalt verändert diesen bereits. „Wir nehmen also an, daß auch der menschliche Wille kausal determiniert ist, d.h., daß in jedem Falle, wo jemand in die Lage kommt, entweder spontan, oder auch nach längerer Überlegung einen bestimmten Willen zu äußern oder eine bestimmte Entscheidung zu treffen, ein hinreichend scharfsinniger, aber sich vollkommen passiv verhaltender Beobachter imstande ist, das Verhalten des Betreffenden vorauszusehen.“99 Die Lösung sieht bei Planck folglich so aus: „... Die Antwort auf die Frage, ob der Wille kausal gebunden ist oder nicht, lautet verschieden, je nach dem Standort, der für die Betrachtung gewählt wird. Von außen, objektiv betrachtet, ist der Wille kausal gebunden; von innen, subjektiv betrachtet, ist der Wille frei. Oder anders gefaßt: Fremder Wille ist kausal gebunden, jede Willenshandlung eines andern Menschen läßt sich, wenigstens grundsätzlich, bei hinreichend genauer Kenntnis der Vorbedingungen, als notwendige Folge aus dem Kausalgesetz verstehen und in allen Einzelheiten vorausbestimmen. Inwieweit das praktisch geschehen kann, ist lediglich eine Frage der Intelligenz. Der eigene 98 s. vor allem seinen oben erwähnten Vortrag: Vom Wesen der Willensfreiheit. 99 l. c., p. 7. Wille dagegen ist nur für vergangene Handlungen kausal verständlich, für zukünftige Handlungen ist er frei, eine eigene zukünftige Willenshandlung läßt sich unmöglich, auch bei noch so genauer Selbsterkenntnis, rein verstandesmäßig aus dem gegenwärtigen Zustand und den Einflüssen der Umwelt ableiten.“100 Im Hinblick auf vergangene Handlung verweist der transzendentalphilosophische Freiheitsbegriff auf das Bewußtsein, anders, als geschehen, gehandelt haben zu können; dieses Bewußtsein könne doch keine Illusion sein, sagen die Freiheitsphilosophen. Zwar gibt es, sozial vorgesehen, immer wieder Exkulpationsstrategien, etwa im Strafverfahren, in denen Nachweise vorgesehen sind, daß man für seine Handlung eben doch nicht voll verantwortlich gewesen sei, weil man entweder grundsätzlich (Debilität) oder nur momentan in der fraglichen Handlungssituation eben nicht so frei war, sondern wenigstens partiell determiniert; aber solche Exkulpationen sind pathologische Ausnahmefälle, sie werden von für Pathologien zuständigen Gutachtern (Medizinern, Psychologen etc.) attestiert. Solch eine soziale Praxis ist freilich philosophisch sehr unbefriedigend, weil sie Freiheit und Determiniertheit auf einer und derselben Realitätsebene ansiedelt und damit zu einem empirisch zu klärenden mehr oder weniger an Freiheit und Determiniertheit macht.101 Im Vergleich dazu war die Kantische Lösung für das philosophische Freiheitsproblem zwischen absoluter Freiheit und absoluter Determiniertheit mit Sicherheit die befriedigendere Lösung. Immerhin kann ja doch der Gutachter, der die verminderte Schuldfähigkeit und damit die eingeschränkte Freiheit attestiert, nicht die transzendentale Freiheit als solche bestreiten oder auch nur einschränken. Diese transzendentale Freiheit ist gedacht als eine der kausalen Determiniertheit allen Geschehens entgegengesetzte. Somit führt die Exkulpation zu einer Spaltung des philosophischen Freiheitsbegriffs, die lediglich behaupten kann, daß das angeklagte und beurteilte Wesen zu der fraglichen Zeit äußerlich nicht frei war, seine innere, transzendentale Freiheit zu ergreifen: Zwangshandlungen sind demnach transzendental frei, weil nicht determiniert, und sie sind doch wiederum nicht frei, weil nämlich unter irgendwelchen Zwängen stehend, frei gekettet. 100 l. c., p. 20f. 101 Zur Kritik der von der Neurobiologie und Hirnforschung ausgehenden Infragestellung des Strafrechts s. P. Gehring: Die Hirnforschung und die Macht: Von der Willensfreiheit zur Strafrechtspolitik.- In: dies.: Was ist Biomacht? Frankfurt a. M., New York 2006, p. 184202. „Schuld ist gerade keine ‚empirische‘ Kategorie. Das Recht arbeitet vielmehr mit der Vorstellung einer ‚Zurechnung‘ der Tat, und es straft auch so: Es mutet die Strafe kontrafaktisch zu. Das Strafrecht tut dies, indem es sich immer schon gleichsam zur Normativität, zum Spielregelcharakter seiner Kategorien bekennt.“ (p. 196) Kant dagegen unterscheidet die transzendentale Freiheit, die man notwendigerweise annehmen müsse, damit reine Vernunft überhaupt praktisch sein kann, die man aber wiederum nicht erkennend nachweisen kann, die also für die theoretische Vernunft undurchdringlich ist, von der komparativen Freiheit, die der Gutachter meint und die Kant an einer Stelle ironischerweise die „Freiheit eines Bratenwenders“ nennt.102 Auf diese Weise kann Kant eine durchgängige Kausalität allen Naturgeschehens zulassen, als einer Kategorie, mittels derer die theoretische Vernunft Erscheinungen als Erfahrungen verknüpft, ohne daß dadurch die Möglichkeit von Freiheit unter Aspekten der praktischen Vernunft in irgendeiner Weise tangiert wäre. 103 Die strikt aspektive Scheidung, dieser Perspektivismus Kants, 104 führt allerdings selbst in der praktischen Philosophie zu Paradoxien, z.B. derjenigen, daß das Handeln aus freier Selbstbestimmung der Vernunft zwar ausnahmslos geboten ist, und da es geboten ist, auch stets möglich ist, daß aber andererseits kein einziger empirischer Fall nachweisbar ist, nicht einmal für den Handelnden selbst, wo aus einer solchen Freiheit heraus gehandelt worden wäre und nicht etwa den Antrieben der Sinnlichkeit in der Bestimmung des Willens gefolgt worden wäre, mit anderen Worten: es ist zwar feststellbar, ob eine Handlung pflichtgemäß ausgefallen ist, aber es ist überhaupt nicht nachweisbar, ob sie aus Pflicht geschehen sei. Letztlich ist das aber auch für die praktische Philosophie gar nicht so wichtig; sie befaßt sich mit dem Sollen, für das Sollen aber ist der Freiheitsbegriff absolut gewiß. Es gäbe nämlich gar keine Sollensansprüche, wenn es Freiheit nicht gäbe. In der Sphäre der praktischen Geltungen ist das Subjekt notwendigerweise frei. Paradox formuliert, das Subjekt ist unter diesem Aspekt gar nicht frei, nicht frei zu sein.105 Seinem Wesen als transzendentales Subjekt nach kann es nicht nicht-frei sein. D.h. das Subjekt, das Zweck an sich selbst 102 In der „Kritik der praktischen Vernunft“ spricht er von einer „Freiheit eines Bratenwenders“, „der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seine Bewegungen verrichtet.“ I. Kant: Gesammelte Schriften V, p. 97. 103 l. c. VIII, p. 370: „Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objectiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen, und es ist offenbare Ungereimtheit, nachdem man diesem Pflichtbegriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, daß man es doch nicht könne.“ 104 Zu einer solchen Kant-Deutung s. insbesondere F. Kaulbach: Philosophie des Perspektivismus I. Tübingen 1990, p. 11-136; dazu: Perspektiven des Perspektivismus. Gedenkschr. F. Kaulbach, hrsg. v. V. Gerhardt u. N. Herold. Würzburg 1992. 105 Cf. dazu theoretisch unerschrocken U. J. Wenzel: Anthroponomie. Kants Archäologie der Autonomie. Berlin 1992, z. B. p. 281: „Ist die Bestimmung des Menschen seine Selbstbestimmung als Zweck an sich selbst, dann ist er nicht frei, sich nicht zu bestimmen.“ Wenzel spricht auch von einem „Bestimmungszwang“ (ibd.). ist, unterliegt paradoxerweise einem Zwang zur Freiheit. Diesen Aspekt der Unausweichlichkeit von Freiheit hat später dann Sartre dann weiter radikalisiert. Dem philosophischen, transzendentalen Freiheitsbegriff steht ein politischer Freiheitsbegriff gegenüber. In ihm geht es nicht um transzendentalfreie, sich zum Handeln überhaupt erst bestimmende Subjekte, sondern es geht um Menschen und um deren Rechte, ihre Angelegenheiten selbst zu bestimmen und nicht von anderen bestimmen zu lassen. Damit wird Freiheit weitgehend identisch mit dem Begriff der Souveränität, der das Recht und die Macht beinhaltet, in einer eigenen Sphäre Herr zu sein. John Locke, dem wir wesentliche Fundamente dieser Tradition der Diskussion der Freiheit verdanken, kennt gleichwohl auch eine metaphysische Begründung der politischen Freiheit. Für ihn ist Freiheit die Macht, zwischen Handlungsmöglichkeiten zu präferieren: „to act or not to act according as we shall choose or will“. 106 Diese Qualität ist keine Eigenschaft des Willens, sondern sie ist mit dem Willen selbst identisch. Es geht bei Locke folglich nicht um die Freiheit oder Unfreiheit des Willens; es geht um die Freiheit des Menschen, nämlich Präferenzen zu bilden und gemäß Präferenzen handeln zu können, und diese Fähigkeit heißt Wille. Daher ist auch bei Locke der Begriff einer Freiheit des Willens eigentlich ein Nonsensbegriff; denn einen unfreien Willen gibt es gar nicht, weil sowohl der Wille als auch die Freiheit in nichts anderem bestehen als in der Macht des Geistes, Handlungen zu präferieren: zu fragen, ob der Wille frei sei, gleicht damit der Frage, ob die Freiheit ihrerseits frei sei.107 In politischen Zusammenhängen operiert dieser Freiheitsbegriff vor der Folie von Naturzustands-Phantasien und Gesellschaftsvertrags-Theorien. Im Naturzustand besteht die Freiheit des Menschen in der unbeschränkten Ausübung der metaphysisch begründeten Freiheit und äußert sich konkret in zwei Formen, der Selbsterhaltung und der Abwehr und Bestrafung von Angriffen auf diese Selbsterhaltung. 108 Letzterem Zweck dient das Recht, es ermöglicht jedem Menschen die Verfolgung seiner 106 J. Locke: Works. Neudr. Aalen 1963, I, p. 252; ähnlich auch Voltaire: „En quoi consiste donc votre liberté, si ce n’est dans le pouvoir que votre individu a exercé de faire ce que votre volonté exigeait d’une nécessité absolue? ... Votre volonté n’est pas libre, mais vos actions le sont. Vous êtes libre de faire quand vous avez le pouvoir de faire.“ Dictionnaire philosophique, ed. R. Naves. Paris 1954, p. 275, 277 (Art. „Liberté (de la)“) 107 l. c., p. 245; ähnlich übrigens sogar bemerkenswerterweise G. W. F. Hegel im Zusatz zu § 4 der Rechtsphilosophie: „Die Freiheit ist ... ebenso eine Grundbestimmung des Willens, wie die Schwere eine Grundbestimmung der Körper ist. ... Das Schwere macht den Körper aus und ist der Körper. Ebenso ist es mit der Freiheit und dem Willen, denn das Freie ist der Wille. Wille ohne Freiheit ist ein leeres Wort, so wie die Freiheit nur als Wille, als Subjekt wirklich ist.“ Werke, VII, p. 46. 108 J. Locke: Works, p. 413. eigenen Zwecke und Interessen, insbesondere schützt das Recht das durch eigene Arbeit zum Zweck der Selbsterhaltung erworbene Eigentum. Die Freiheit des Menschen als Bürger eines Staatsverbandes ist hier also die Freiheit seines Eigentums. Unter den Begriff des Eigentums fallen aber nicht nur die materiellen Güter des Besitzes, sondern der Kern des Ganzen, die Integrität der Person und ihre grundlegenden Freiheiten und Rechte. So wie in der Metaphysik Freiheit und Wille identisch waren, so in der bürgerlichen Gesellschaft Freiheit und Eigentum. Das Recht ist der Mechanismus, diese Identitäten zu schützen. Nun ist in der Geschichte mehrfach die Notwendigkeit empfunden worden, den philosophischen und den politischen Freiheitsbegriff miteinander zu vermitteln, obwohl sie ja eigentlich auf sehr unterschiedlichen Argumentationsebenen angesiedelt sind. Das abstrakte Handlungssubjekt des philosophischen Freiheitsbegriffs ist nämlich auch „in Fesseln frei“.109 Dagegen ist der Mensch, der in der bürgerlichen Gesellschaft das Unglück hat, kein Eigentümer zu sein, schon genau damit im eigentlichen Sinne unfrei. Wenn – so Kant – Freiheit gar kein empirischer Begriff ist, dann ist er genau damit auch als ein Begriff der politischen Philosophie untauglich. In der politischen Öffentlichkeit können wir widerspruchsfrei annehmen, daß alles dort beobachtbare Handeln heteronom bestimmt sei, daß die im glücklichen Falle beobachtbare Gesetzesförmigkeit überall bloße Legalität und keine Moralität sei, d.h. bloß pflichtgemäß und nicht aus Pflicht geschehen sei. Ist das aber der Fall, dann ist Gesetzesübereinstimmung immer nur Zufall und folgt nicht einem zwingenden Prinzip, wie es allein die Sittlichkeit gewährleisten würde. Dann aber ist auch die im Gesellschaftsvertrag gedachte Übereinstimmung aller (selbst als Übereinstimmung, Sittliches zu wollen) nicht hinreichend. Es bedarf, wie Kant sagt, einer „vereinigenden Ursache“, als etwas, das den empirischen Willen der Subjekte zwingt. „Freilich ist das Wollen aller einzelnen Menschen, in einer gesetzlichen Verfassung nach Freiheitsprincipien zu leben (die distributive Einheit des Willens Aller), zu diesem Zweck nicht hinreichend, sondern daß Alle zusammen diesen Zustand wollen (die collective Einheit des vereinigten Willens), diese Auflösung einer schweren Aufgabe, wird noch dazu erfordert, damit ein Ganzes der bürgerlichen Gesellschaft werde, und da also über diese Verschiedenheit des particularen Wollens Aller noch eine vereinigende Ursache desselben hinzukommen muß, um einen gemeinschaftlichen Willen herauszubringen, welches Keiner von Allen vermag: so 109 So die Formel, die Chr. F. D. Schubart in einem Brief an seine Frau vom 29.4.1784 verwendete, zit. nach J. Schlumbohm: Freiheit – Die Anfänge der bürgerlichen Emanzipationsbewegung in Deutschland im Spiegel ihres Leitwortes. Düsseldorf 1975, p. 74. ist in der Ausführung jener Idee (in der Praxis) auf keinen andern Anfang des rechtlichen Zustandes zu rechnen, als den durch Gewalt, auf deren Zwang nachher das öffentliche Recht gegründet wird...“110 So liegt in allem Ursprung des Rechts die Gewalt.111 Auf den vom Ursprung des Rechts in Gewalt herkommenden Zwang muß sich die Geltung des Rechts gründen lassen. Das heißt nicht, daß der Inhalt des Rechts Gewalt sein müsse: im Gegenteil hat nach Kant der Herrscher bei seiner Ausübung des Rechts die moralische Pflicht, die Spuren des Gewaltursprungs des Rechts sukzessive zu tilgen. Aber was nützt uns diese moralische Verpflichtung des Herrschers, wenn doch für alle, selbst für Herrscher, gilt, daß die Moralität von Handlungen nie gewiß sein kann, die Legalität aber doch bereits mit der Übereinstimmung mit dem Gesetz gegeben ist, so daß wir nie die Gewähr haben werden, daß die Entscheidungen des Herrschers tatsächlich sittlich sein werden. Hier hilft als Ausweg eben nur die Unterscheidung zwischen dem Sittengesetz und seinen unnachgiebigen Forderungen einerseits, dem geltenden Recht andererseits. Das geltende Recht kann, das ist Kants Überzeugung, zwar seinen his- 110 I. Kant: Ges. SchriftenVIII, p. 371; in seiner Geschichtsphilosophie macht gerade dieser Umstand es nötig, das Motiv zur Versittlichung des Menschen als in seiner Natur angelegt zu deuten, und nicht selbst noch einmal durch die Freiheit motiviert sein zu lassen: „Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Da nur in der Gesellschaft und zwar derjenigen, die die größte Freiheit, mithin einen durchgängigen Antagonism ihrer Glieder und doch die genauste Bestimmung und Sicherung der Grenzen dieser Freiheit hat, damit sie mit der Freiheit anderer bestehen könne, ... so muß eine Gesellschaft, in welcher Freiheit unter äußeren Gesetzen im größtmöglichen Grade mit unwiderstehlicher Gewalt verbunden angetroffen wird ... die höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattung sein, weil die Natur nur vermittelst der Auflösung und Vollziehung derselben ihre übrigen Absichten mit unserer Gattung erreichen kann. In diesen Zustand des Zwanges zu treten, zwingt den sonst für ungebundene Freiheit so sehr eingenommenen Menschen die Noth; und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche sich Menschen unter einander selbst zufügen, deren Neigungen es machen, daß sie in wilder Freiheit nicht lange neben einander bestehen können. ... Alle Cultur und Kunst, welche die Menschheit ziert, die schönste gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genöthigt wird sich zu discipliniren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu entwickeln.“ l. c., p. 22 (Hervorhebg. von mir, K. R) 111 Cf. auch H. v. Hentig: Machiavelli. Studien zur Psychologie des Staatsstreichs und der Staatsgründung. Heidelberg 1924, s. speziell das unpag. Vorwort. torischen Geltungsgrund in der Gewalt finden, nicht aber seine Gültigkeitsbedingungen. Gewalt an sich ist sinnlos112 und kann keine Handlungsperspektiven, keine Handlungssicherheit gewähren, und damit weder die Freiheit noch die Macht des Herrschers absichern. Genauer: Gewalt läßt ratlos, wie es weitergehen soll, nämlich nach dem Gewaltakt. In diesem Sinne ist eine nicht an der Möglichkeit von Sittlichkeit orientierte Politik, gerade im Sinne von Kant, ratlos. Das zukünftige Geschehen ist unkalkulierbar („... d.i. die Vernunft ist nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu übersehen, die den glücklichen oder schlimmen Erfolg aus dem Thun und Lassen der Menschen nach dem Mechanism der Natur mit Sicherheit vorher verkündigen ... lassen.“113). Weder die Gewalt, noch die an Präferenzen oder Interessen orientierte Klugheit in der Politik kann uns lehren, was die Zukunft bringen, welche Folgen und Nebenfolgen eine an präferierten Zielen orientierte Politik zeitigen wird. Und selbst wenn sie uns prognostisch zeigen könnte, was die Zukunft bringen wird, kann sie uns niemals sagen, was wir selbst in Zukunft tun sollen. („Was man aber zu thun habe, um im Gleise der Pflicht ... zu bleiben, dazu und hiemit zum Endzweck leuchtet sie uns überall hell genug vor.“114) Also gibt es im Sinne von Kant hier eine einzige Zielorientierung, die unzweifelhaft ist, nämlich die Orientierung an der Sittlichkeit und d.h. für die politische Praxis: die Übernahme der Pflicht, die Spuren des Ursprungs des Rechts in der Gewalt zu tilgen. Und es gibt es zweites Kriterium: nämlich das Publizitätskriterium der Rechtmäßigkeit. Im zweiten Anhang seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ erklärt Kant: „Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publicität verträgt, sind unrecht.“115 Dieses Öffentlichkeitskriterium hält Kant zugleich für eines der entscheidendsten Kriterien aufgeklärter Vernunftpraxis, wie er es selbst programmatisch in der Anmerkung zur 1. Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ formuliert hat: „Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß. Religion, durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf 112 K. Röttgers: Im Angesicht von Gewalt.- In: Sprache und Gewalt, hrsg. v. U. Erzgräber u. A. Hirsch. Berlin 2001, p. 43-67. 113 I. Kant: Ges. Schriften VIII, p. 370. 114 ibd. 115 l. c. VIII, p. 383; dazu auch K. Röttgers: Öffentlichkeit und Geheimnis – ein spannungsreiches Verhältnis.- In: Kommunikationsmanagement, hrsg. v. G. Bentele, M. Piwinger, G. Schönborn. Aktualisierungslieferung Nr. 117. Neuwied 2016, Nr. 8.82, p. 1-33. unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können."116 Mit dieser Separierung einer transzendentalen, philosophischen von einer politischen Freiheit haben wir uns nicht nur das schwierige Problem der Vermittlung beider eingehandelt (Lösungen: Kant,117 Hegel,118 u.v.a.m.), sondern, indem wir dieses als die einzige Alternative ansehen, tun wir so, als lebten wir noch in der mittelalterlichen oder der frühneuzeitlichen societas civilis, in der Staat und Gesellschaft ununterscheidbar waren und in der infolgedessen der Mensch – der aristotelischen Tradition zufolge – als „animal sociale seu politicum“ begriffen werden konnte. Seit der bürgerlichen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts ist eine solche Undifferenziertheit nicht mehr möglich. Für den Freiheitsbegriff sind allerdings daraus bisher keine Konsequenzen gezogen worden. Das heißt, es gibt zwar einen transzendentalphilosophischen Begriff der Freiheit und einen politischen Begriff der Freiheit, aber es gibt keinen von beiden unterschiedenen Begriff sozialer Freiheit. Erste Schritte, das zu ändern, sollen im folgenden gemacht werden, dabei kann aber allerdings durchaus an eine untergründige (zugleich unterminierende) Tradition angeknüpft werden. Es geht also darum, einen postmodern-anarchistischen Begriff sozialer Freiheit zu konfigurieren.119 Er unterscheidet sich von der politischen Freiheit, die immer 116 I. Kant: Ges. Schriften IV, p. 9 Anm. 117 Kant stellt fest (l. c. VIII, p. 23), daß dieses „Problem ... zugleich das schwerste und das [sei], welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöset wird.“ Denn: „... ob er gleich als vernünftiges Geschöpf ein Gesetz wünscht, welches der Freiheit Aller Schranken setze: so verleitet ihn doch seine selbstsüchtige thierische Neigung, wo er darf, sich selbst auszunehmen. Er bedarf also einen Herrn, der ihm den eigenen Willen breche und ihn nöthige, einem allgemeingültigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen.“ (ibd.) 118 Bei Hegel wird bekanntlich im Staate die Konkretion der Freiheit gedacht. Darin sind der hier so genannte philosophische und der politische Freiheitsbegriff zur Koinzidenz gebracht. 119 Von „sozialer Freiheit“ sprach auch F. Steinbach: Der geschichtliche Weg des wirtschaftenden Menschen in die soziale Freiheit und politische Verantwortung. Köln, Opladen 1954. Allerdings wird der Begriff nicht erläutert, er wird vor allem nicht von einem politischen oder einem philosophischen Freiheitsbegriff unterschieden, sondern meint so in etwa diejenige Freiheit, die vor einem christlichen sozialethischen Gewissen „im Kampf gegen Materialismus und Vermassung“ Bestand hat: „Der wirtschaftende Mensch steht heute auf der Kommandobrücke des Schiffes, das die Kulturfracht und die sozialen Errungenschaften aus Jahrtausenden geladen hat. Wenn die Besten aus der Welt der Arbeit und der Wirtschaft die Freiheit im Staat, trotz des Staates, vielleicht auch durch den Staat und seine Friedens- und Rechtsgarantien ist, und er unterscheidet sich auch von der solitären Freiheit eines Christenmenschen oder eines transzendentalen Subjekts. Eine begriffsgeschichtliche Zwischenbemerkung zum Begriff der sozialen Freiheit ist jedoch geboten, damit nicht allzu naiv begonnen wird. Der erste, der diesen Begriff gebraucht zu haben scheint, ist Franz von Baader, der romantische Sozietätsphilosoph. Voraussetzung der Möglichkeit dieses Begriffs war allerdings eine Bedeutungsverschiebung im Begriff des Sozialen selbst, deren wesentlicher Wegbereiter J. J. Rousseau war. Rousseau war der erste, der den Grundvertrag der Gesellschaftsvertrags-Theoretiker einen „contrat social“ nannte. Durch ihn wird die natürliche Freiheit im Naturzustand von einer sozialen Freiheit im bürgerlichen Zustand getrennt. Er vereinigt die Einzelwillen der Individuen zu einer volonté générale, durch die dann wiederum mit der ganzen vereinigten Kraft die Person und das Eigentum des Einzelnen geschützt sind, ohne daß er im so konstituierten Gesellschaftszustand seine Freiheit einzubüßen brauchte: seine „natürliche“ Freiheit ist in die bürgerliche Freiheit aufgegangen. Das Soziale dieses „contrat social“ besteht vor allem darin, daß vorher eine Gleichheit der Menschen faktisch unmöglich ist, weil sie ja von Natur aus (z. B. an Kräften) verschieden sind; erst durch das Aufgehen der Einzelwillen in die „volonté générale“ wird Gleichheit als Rechtsgleichheit unter den Menschen hergestellt.120 Daß es hier eine Rechtsgrundlage gibt, die gleichwohl weder die Natur noch der Wille Gottes sind, sondern die Gesellschaft, also etwas Konventionelles, das setzt im Anschluß an Rousseau eine völlig neue Redeweise vom Sozialen frei.121 Während in der gesamten vorherigen Tradition das Soziale entweder als identisch mit dem Politischen begriffen wurde oder als einer seiner Spezialaspekte, wird bei Rousseau klar, daß das Politische erst durch das Soziale konstituiert wird. Rousseau ist der erste, der das so ausspricht: „par le pacte social nous avons donné l’existence et la vie au corps politique...“ 122 Insbesondere war auch Rousseaus Ge- ihre Verantwortlichkeit mit ebenso viel Mut, Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit wahrnehmen wie die Heiligen und Helden der Vergangenheit, wird die Menschheit nicht im Materialismus und in der Vermassung versinken. ... Nicht über der Wirtschaft, sondern in der Wirtschaft und aus der Wirtschaft muß die Elite wachsen, welche die Not unserer Zeit wenden kann.“ (p. 47) 120 Cf. dazu im Kontext der Begrifflichkeit politischer Freiheit J.-F. Spitz: La Liberté Politique. Paris 1995, insbes. p. 311-465. 121 Red. (= K. Röttgers): Sozial; das Soziale.- In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter u. K. Gründer. Bd. IX. Basel, Stuttgart 1995, Sp. 1113-1121. 122 J.-J. Rousseau: Du contrat social, ed. M. Halbwachs. Mesnil 1943, p. 168. genüberstellung von „social“ und „civil“ von gewaltigem Einfluß, stellte er doch damit die begrifflichen Mittel bereit, die sich abzeichnende Differenzierung zwischen Staat und Gesellschaft zu bezeichnen. Als Baader dann 1831 den Begriff der „sozialen Freiheit“ verwendete, da setzte er ihn der von den Revolutionären gemeinten Freiheit entgegen, die er als die Freiheit „unter der Form der Anarchie“ bezeichnete und damit ihren bloß politischen Charakter meinte, eine Einschätzung, die sich ja auch bei Marx in der Deutung der Französichen Revolution als einer einseitig politischen Revolution (im Gegensatz zu einer anstehenden sozialen Revolution) fortsetzt. Despotismus und Servilität oder „Hoffart“ und „Niederträchtigkeit“ sind nämlich die zwei Seiten ein und derselben Fehlentwicklung. „Woraus man begreift, warum das Christentum, indem es die Gesellschaft von der antisozialen Sündenlust befreit, die Religion der sozialen Freiheit ... ist.“123 Die Zeitschrift „Avenir“, um deren Charakterisierung es ihm geht, hatte seiner Ansicht nach begriffen, „daß die Welt nur durch die soziale Freiheit wieder zu Gott kommen, daß aber diese Freiheit ihr nur durch Gott (die Religion) zuteil werden könne.“124 Hier – und an anderen Stellen bei Baader125 – wird deutlich, daß dieser Begriff einer sozialen Freiheit in Kontraposition zu einem Begriff politischer Freiheit gesetzt ist und daß er als der grundlegendere Begriff aufgefaßt wird, auch wenn man die religiöse Fundierung heute eher befremdlich finden mag. Die erste Selbstartikulation des Sozialen erfolgte also im Kontext der Gesellschaftsvertragstheorien, die sich dem Absolutismus, aber ebenso sehr dem fürsorgenden Paternalismus der Landes-„Väter“, die wie Hausväter für die Ihren zu sorgen sich vornahmen oder vorgaben, entgegensetzten. Das, was uns dem Staat verbindet, sind weder Familienbande noch Gottes Ordnungswille, sondern es ist unser eigenes Interesse. Die politischen Subjekte sind als Kleinunternehmer ihrer als Individuen ihnen zukommenden Interessen tätig. Als solche schließen sie Verträge, Tauschverträge und Verträge zugunsten Dritter. Unter diesem Wandel wandelte sich auch der Begriff des Polizeystaats im Sinne des Staats allseitiger Fürsorge für das Wohlergehen der Untertanen zu dem des Polizeistaats, der sich um all das kümmert, was ihn nichts angeht.126 123 F. v. Baader: Über die Zeitschrift Avenir und ihre Prinzipien.- In: ders.: Vom Sinn der Gesellschaft, hrsg. v. H. A. Fischer-Barnicol. Köln 1966, p. 215-229, hier p. 219. 124 ibd. 125 Weitere Belege, die auch die Behauptung stützen oder wenigstens nahelegen, daß Baader der erste gewesen sei, der diesen Begriff prägte, finden sich bei L. H. A. Geck: Das Eindringen des Wortes „sozial“ in die deutsche Sprache. Göttingen 1963, p. 33f. 126 S. vor allem H. Maier: Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre. 2. Aufl. München 1980; M. Stolleis: Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. I: Reichspublizistik und Polizeiwissenschaft 1600-1800. München 1988. Aber das Soziale – darin irrten diese Bürgerlichen des ausgehenden 18. Jahrhunderts – ist nicht nur nicht identisch mit dem Staatlichen, es ist auch nicht identisch mit der Sphäre der Kaufleute, die ihre Beziehungen über Tausch und Verträge miteinander regeln. Und wenn diese frühen Liberalisten glaubten, nur das sei legitim, was öffentlichkeitsfähig ist – so ja auch Kant – und wenn sich diese Vorstellung bis heute in der Trivialkultur von Talkshows und dem dort normierten Outen von Privatestem fortsetzt, so wußten es bereits die prorevolutionären Frühromantiker besser: es gibt die Intimität, und es gibt die Geheimnisse, die nicht nur den Polizey/PolizeiStaat, sondern auch die „Öffentlichkeit“ aufgeklärter Bürger nichts angehen. Es gibt soziale Beziehungen, die nicht vertragsförmig sind. Diesen Punkt sehen übrigens sich „Republikanisch-Liberale“ Nennende, sich der Diskursethik verpflichtet Fühlende teilweise ganz anders. Peter Ulrich spricht z.B. von der „öffentlichen Konstitution des Privaten“ und meint damit, daß sich die Sphäre der Privatheit durch ein „hinreichendes Maass an öffentlicher Transparenz“ auszeichnen müsse, um einer „regelmässigen Überprüfbarkeit“ hinsichtlich der „Sozial- und Umweltverträglichkeit“ zugänglich zu sein.127 F. Tönnies hat die bereits von den Romantikern formulierte Einsicht in die analytische Unterscheidung von „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ eingebracht. 128 Der Zweifel, daß der Vertrag die Grundfigur aller sozialen Verhältnisse sei, macht den Ausgangspunkt für die Überlegungen von Tönnies aus. Es ist dieses, verallgemeinernd gesprochen, auch der Zweifel, daß die Freiheit des Eigentums und die Freiheit, bzw. das Recht der beliebigen Verfügung über Eigentum, den Grundbegriff von Freiheit ausmacht: der possessive Individualismus hat Freiheit nie begriffen. Das wird deutlich z.B. an den theoretischen Gewaltsamkeiten, die man begehen muß, wenn man familiale Verhältnisse als „im Grunde“ Rechtsverträge beschreiben muß. Daher nimmt Tönnies nicht diese eine, sondern zwei Grundtypen des Sozialen an: Gemeinschaft und Gesellschaft. Daß es nur zwei Grundtypen sein können, aus denen sich dann alle anderen als Mischformen ableiten lassen, begründet sich bei Tönnies durch ein schon bei Aristoteles zu findendes Argument, nämlich daß es zwischen Teil und Ganzem genau zwei Formen der Beziehung geben kann: eine als organisch, natürlich interpretierte und ausgestaltete Beziehung und eine als artifiziell oder auch mecha- 127 P. Ulrich: Integrative Wirtschaftsethik. Bern, Stuttgart, Wien 1997, S. 315. 128 F. Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. 3. Aufl. des Neudr. d. 8. Aufl. Darmstadt 1991; zwar kennt Tönnies auch die Freiheit im Sinne des „Kürwillens“, der die Gesellschaft konstituiert, als das Verfügungsrecht über Eigentum, aber den eigentlichen Freiheitsbegriff entwickelt er anhand seiner Beschreibung des die Gemeinschaft konstituierenden Wesenwillens (p. 122f., 155). nisch interpretierte und ausgestaltete. Die Gemeinschaft ist als organisch interpretiert, die Gesellschaft als künstlich. Die organische Interpretation setzt eine soziale Verbindung als real gegebene voraus, die in ihr vorfindliche Freiheit ist eine natürlicherweise zukommende Freiheit. Die mechanische Interpretation setzt eine soziale Verbindung als ein gemäß einer Idee entworfenes Konstrukt, ihre Freiheit ist eine durch Konstruktion gewährleistete Freiheit. Über diese Dichotomie hinausgehend, wird man wohl doch eine dritte Beziehungssorte neben dem Gemeinschaftlichen und dem Gesellschaftlichen annehmen müssen.129 Der Grund dafür ist folgender. Die Gemeinschaft ist die Sozialform, die auf ein Kontinuum der Beziehungen gegründet ist. Die Gesellschaft ist diejenige Sozialform, für die man ein solches Kontinuum gerade nicht voraussetzen kann, die aber gleichwohl auf der Diskontinuität eine neue Kontinuität begründet. Um ein von Adam Smith eingeführtes und vielzitiertes Beispiel heranzuziehen: Wenn ich von meinem Metzger ein Stück Fleisch bekommen möchte, dann ist es gut so, daß ich nicht auf sein Wohlwollen angewiesen bin, sondern mich allein auf sein Interesse verlassen darf, das Stück Fleisch zu einem für ihn günstigen Preis zu verkaufen. Zu Hause aber am Mittagstisch – ich setze jetzt dieses Beispiel über Smith hinaus fort – ist das Wohlwollen der einzig ausschlaggebende Grund, hier darf gerade nicht ein Feilschen einsetzen. Wir haben also einerseits das Kontinuum von Nähe und Ferne in Beziehungen des Typs „Gemeinschaft“, andererseits eine auf der Grundlage einer Diskontinuität durch Übereinkunft begründete neue Kontinuität. Aber das sind ersichtlich nicht die einzigen Möglichkeiten: die aufrechterhaltene Diskontinuität ist eben auch eine soziale Beziehung (auch von Tönnies wird sie erwähnt, aber nicht weiter berücksichtigt). Ich nenne diesen Typus des Sozialen das Differentielle. Sein Grundtypus ist der Fremde, sei es als Gast, sei es (politisch) als Feind. Wenn das Soziale allgemein uns in diesen drei Erscheinungsformen entgegentritt, dem Gesellschaftlichen, dem Gemeinschaftlichen und dem Differentiellen, dann muß auch die soziale Freiheit wenigstens in diese drei Momente geschieden werden. Die Freiheit kann als Freiheit in der Gemeinschaft, als Freiheit durch die Gemeinschaft und als Freiheit von der Gemeinschaft erscheinen. Die Freiheit von der Gemeinschaft ist die Befreiung von dem in einer Gemeinschaft herrschenden Intimitätsund Konformitätsdruck. Es ist die Freiheit, anders sein zu können und Abstand halten zu dürfen gegenüber einem normativen Gefüge, einer zufällig herrschenden Moral. Freiheit in der Gemeinschaft ist dagegen diejenige Freiheit, die eine Gemeinschaft bereitstellt, sich normativ so selbst zu bestimmen, wie es das Gefüge der Gemeinschaft vorsieht. Diese Freiheit ist die dem herrschenden Individualismus am schwersten verständliche Freiheit. Ausgestattet mit dem Bild des Präferierenden und seine 129 Zur Genossenschaft als einer Form, die zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft steht, s.u. Präferenzen frei wählenden Individuums, kann dieser Individualismus nicht zugestehen oder ignoriert schlicht, daß es Unwählbarkeiten gibt, ohne die wir nicht wären, was wir sind, und die gleichwohl die Handlungsmöglichkeiten gegenüber dem abstrakten Individuum vervielfältigen: dazu gehören Eigennamen, Sprache und bestimmte Grundeinstellungen der Lebensführung (z. B. Optimismus/Pessimismus, Urvertrauen/Urangst, Realismus/Nominalismus u. ä.). Die Freiheit durch die Gemeinschaft ist diejenige Freiheit, die wir anderswo genießen, die wir aber nur aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft haben können. Ähnliches gilt für das Differentielle und für das Gesellschaftliche, ohne daß das hier im einzelnen durchdekliniert werden müßte. Wir gehen vielmehr zu der für einen Begriff der sozialen Freiheit wichtigeren Fragen über, die in folgendem besteht: wer ist das Subjekt dieser Freiheit, wobei hier zunächst unter „Subjekt“ nichts anderes zu verstehen ist als das grammatische Subjekt von Aussagen, die Freiheit zusprechen sollen: im X = frei vom durch das Gemeinschaftlichen Differentiellen Gesellschaftlichen Wenn wir nach dem Subjekt in diesen Zusammenhängen fragen, dann bieten sich durch die Tradition mehrere Antworten an, die zu prüfen wären: • • • • Das (transzendentale) Subjekt, das Ich – oder in der pluralen Version: das transzendentale Wir (Frühromantik) oder die unbegrenzte Kommunikationsgemeinschaft (Transzendentalpragmatik); das Individuum – oder Kollektivindividua wie Nationen; das Selbst; das Eigentum/die Eigenheit. Die These wird im folgenden sein, daß der Begriff der sozialen Freiheit einer ist, der primär auf der sozialontologischen Ebene des Selbst anzusiedeln ist, während die philosophische Tradition es auf der Ebene der Subjektivität (Freiheit vs. Determiniertheit) vermutete, die politische Tradition dagegen auf der Ebene der Eigenheit/des Eigentums (possessiver Individualismus). Mit der Begrifflichkeit der Freiheit eines sozialen Selbst wird zugleich die Innen/Außen-Differenz unterlaufen. Auszugehen ist dabei von dem Begriff kommunikativen Textes, wie ich ihn verschiedentlich eingeführt und expliziert habe.130 In ihm werden aufeinander bezogen gedacht drei Dimensionen der Welt- und Handlungsorientierung, nämlich Temporalität, Sozialität und Diskusivität. Anders als ein Großteil der liberalistischen Tradition das gesehen hat, sind Macht und Freiheit keine Gegensatzbegriffe mehr.131 Aber es kann sehr wohl zu einer immanenten Begrenzung kommen, dann nämlich, wenn eine weitere Machtsteigerung der in ihrem Wesen unersättlichen Macht nur auf Kosten einer Richtungskonstanz (Souveränität oder Autonomie) gewonnen werden kann. Dann macht sich der Mächtige in immer stärkerem Maße von den Machtbetroffenen abhängig und verzichtet dafür partiell darauf, die Richtungen oder Ziele seines Handelns selbst zu bestimmen. Das heißt, der Mächtige wird unfrei. Im Feld von Selbst und Anderem heißt das, daß Freiheit nicht mehr gegenüber dem Anderen, sondern nur noch gemeinsam mit ihm gegenüber anderen Anderen erhalten werden kann. Jede Machtsteigerung kommt aber zwangsläufig immer an diese Punkte. Das heißt – und das ist enorm wichtig –: je weiter in die Zukunft hinein die Handlungskontinuität gesichert werden soll, desto mehr muß Freiheit als gemeinsame, und nicht mehr als individuelle Freiheit verstanden werden, d.h. auch als Freiheit im Möglichkeitsraum eines Medialen, des kommunikativen Textes also. Damit hat der Begriff der sozialen Freiheit gegenüber demjenigen der individuellen oder auch persönlichen Freiheit Vorrang gewonnen: individuelle Freiheit ist immer nur Residualfaktor der sozialen Freiheit. 132 130 Zuerst in K. Röttgers: Geschichtserzählung als kommunikativer Text.- In: Historisches Erzählen, hrsg. v. S. Quandt u. H. Süssmuth. Göttingen 1982, p. 29-48; ferner ders.: Der kommunikative Text und die Zeitstruktur von Geschichten; erweitert wurde das Konzept in ders.: Die Handlungszeit vor ihrem Hintergrund.- In: Das Rätsel der Zeit, hrsg. v. H. M. Baumgartner. Freiburg, München 1993, p. 213-251; ferner in ders.: Die Seele und der Fremde als Selbstdistanzierungskonzepte; sowie ders.: Die Lineatur der Geschichte. 131 Von einer Konvergenz von Freiheit und Macht spricht auch B. Taureck: Die Zukunft der Macht. Würzburg 1983, S. 25-29. Allerdings ist sein Freiheitsbegriff deutlich derjenige der individuellen Freiheit, weswegen die gesellschaftlich notwendige Freiheitseinschränkung durch das rationalistische Alteritätsschema gedacht wird: Die Selbstbeschränkung resultiert aus der aus einem Analogieschluß gewonnenen Vorstellung von der Freiheit des Anderen: „Selbstbeschränkung meiner zur Achtung fremder Freiheit“ (p. 28). Dazu, daß dieser Macht-Begriff unzureichend ist, s. jetzt K. Röttgers: Modale Macht im Rahmen einer Praxis des Zwischen. 132 Daß der Begriff der sozialen Freiheit nicht identisch ist mit dem 1954 von I. Berlin eingeführten Begriff der „positiven Freiheit“ (von ihm in Gegensatz gebracht zu einer „negativen Freiheit“, die in vielleicht nichts anderem besteht als dem Fehlen äußeren Zwangs) Diese Abhängigkeit läßt sich auch umgekehrt ausdrücken: Je mehr Freiheit als Freiheit des Individuums aufgefaßt wird, desto mehr verfällt Macht als Handlungsmodalisierung; und entsprechend dem Machtverfall tritt an die Stelle der Handlungsmodalisierung, sprich Macht, dort, wo ein anderes Handeln betroffen sein soll, die pure Gewalt oder Gegengewalt (und sei sie auch durch das Recht legitimiert). Somit ist die Gewaltbereitschaft eine sozio-logische Konsequenz der Freiheitsindividualisierung. Ich glaube, auch die empirische Evidenz dieser Behauptung liegt auf der Hand. Die individualistische Freiheitsauffassung kann die Macht des Anderen stets nur als Freiheitseinschränkung der eigenen individuellen Freiheit verstehen.133 Die Postmoderne hat in einigen ihrer Manifestationen der Vorstellung Vorschub geleistet, als würde in ihr Freiheit mit Beliebigkeit koinzidieren. Wenn das alles wäre am postmodernen Begriff von Freiheit, dann müßte denjenigen recht gegeben werden, die immer schon sagten, die Postmoderne sei nur ein neuer Name für die eigentlichen Tendenzen der Moderne. Die pluralistische Beliebigkeit in der Präferierung von Werten ist ja doch ein typisches Merkmal der Moderne.134 Eine sozialphilosophisch begründete Postmoderne135 dagegen würde ihren Ausgang nicht im Fetisch des beliebig präferierenden Subjekts nehmen. Sie würde vielmehr sowohl – sit venia verbo – sub-subjektivisch sein als auch hyper-subjektivisch ansetzen. Im Subjekt und den Kräftespielen seiner Seele, sowie zwischen den Subjekten ist Freiheit konstituiert, nicht durch Subjektivität. Dadurch erscheint dann Macht nicht mehr als eine Eigenschaft oder ein Eigentum des Subjekts (oder Individuums), sondern als modal ausgeprägter Möglichkeitsraum im Zwischen. Und als Vermittlung zwischen beiden Dimensionen bedarf es nicht der Einheit des Subjekts, quasi als Modem, durch das alles Innere und Äußere hindurch müßte, kann an dieser Stelle nur festgehalten, nicht aber en detail begründet werden. I. Berlin: Two Concepts of liberty.- In: ders.: Four Essays on Liberty. London 1969, p. 118-172. Auch der Begriff der positiven Freiheit ist ein individualistischer Begriff; cf. J.-F. Spitz: La Liberté Politique, p. 83-121; Ch. Taylor: Negative Freiheit? Frankfurt a. M. 1988, p. 118-144. 133 Ähnlich auch A. Wilden: System and Structure. London 1977, p. 263, der die Vorstellung, daß vom Anderen notwendigerweise eine Unterdrückung des Selbst ausgehe, ebenso kritisiert wie die darauf antwortende „liberale“ Toleranz und gegenseitige Achtung der individualiserten Freiheiten. Für ihn ist ein „ethisches“ Miteinander genauso natürlich, wie es klar ist, daß eine Moralisierung der Beziehung zum Anderen ein Ort der Ausbeutung ist. 134 s. J. Kekes: The Morality of Pluralism. Princeton 1993 135 Zum Begriff einer sozialphilosophischen Wende (in begrifflicher Analogie zum linguistic turn) s. B. Waldenfels: Sozialphilosophie im Spannungsfeld von Phänomenologie und Marxismus; und im Anschluß daran K. Röttgers: Sozialphilosopie. Macht - Seele – Fremdheit. um auf der anderen Seite in eine eigene Verständlichkeit dekodiert zu werden. Das freie Spiel innerer Kräfte erscheint vielmehr, ohne die Einheit des Subjekts vermittelt, auf der äußeren Ebene des intersubjektiven Zwischenraumes. Angst, Beklemmung, Peinlichkeit sind unmittelbar real, ohne gewußt zu sein, und zwar keineswegs nur für das Ungeborene im Leib der Mutter und für den Hund an Herrchens Seite, sondern für jegliche Sozialität. Weil Freiheit und Macht sich nicht widersprechen müssen, wäre es naiv, mit den frühen Liberalen Macht als solche abzulehnen und gar, wo sie begegnet, vor der Öffentlichkeit zu entlarven. Ein postmoderner An-archismus136, wenn er als abgeklärte Tendenz eines Tages möglich sein sollte, wird lediglich eine Theorie der Herrschaftsfreiheit sein, nicht aber eine Theorie der Machtfreiheit sein können. Denn anders als die liberalen Machtkritiker suggerierten, ist nicht die Macht das an und für sich Böse. Ein radikaler Verzicht auf Macht kann lediglich in eine generelle Handlungsunfähigkeit der Subjekte im Möglichkeitsraum münden. Es bleibt dann, wenn man alle Macht minimalisieren möchte, und das heißt natürlich auch die je eigene, nichts übrig, als die kontinuierliche Verkürzung aller temporalen Handlungsorientierungen, die auf nichts anderes hin konvergiert als auf die terroristische Gewalt des Augenblicks,137 und diese ist gewiß nicht in der Lage, moderne oder postmoderne Gesellschaften insgesamt zu strukturieren, auch wenn sie immer ein begleitendes Merkmal der Politik in der Neuzeit gewesen ist. Wegen ihrer regressiven Tendenz endete die ältere anarchistische Tradition (bei den russischen Anarchisten etwa) beim reinen Faktum der geworfenen Bombe – ohne Rücksicht auf die Folgen, die der Gewaltakt in der Zukunft haben könnte, und ohne Rücksicht auch darauf, ob sich an ihn irgendeine Form des eigenen Handelns würde anschließen lassen. Diese Anarchisten standen auf dem Standpunkt der Freiheit, sie konnten (ihrer moralischen Überzeugung folgend) nicht anders, und kein Gott half ihnen. Komplexe Gesellschaften am Ende der Moderne haben vermutlich keine anderen Mittel, wenn sie ihre Freiheit nicht mit Regression erkaufen wollen, d.h. auch nicht 136 K. Röttgers: Die Möglichkeit einer an-archischen Praxis. 137 Daher ist es nur folgerichtig, daß der Terrorist der Gegenwart vor allem als Selbstmordattentäter agiert. Er verzichtet in seiner Tat bereits auf den Anspruch, seinem Handeln eine Kontinuität geben zu können, Daß der IS diese Verzweiflungsoption gewählt hat, hat natürlich seine Ursachen darin, daß eine Kontinuitätsoption durch die Politik des „Westens“ nicht mehr möglich war: Überfall der USA auf den Irak und Zerschlagung der staatlichen Struktur zugunsten der Ökonmischen Interessenshalter (Öl) und die militärische Unterstützung aller opposiotionellen Bewegungen der arabischen Welt (sogenannter „Frühling“). Die Usurpation und Dominanz aller Kontinuitäten ließ nur die terroristische Verzweiflungstat der Gewalt als Option übrig. mit politisierender und moralisierender Regression, als Macht zu modalisieren, d.h. zu steigern. Macht genauso wie die List erfindet Auswege: sie verläßt die Einzigkeit des moralisch-politisierten, des einzig möglichen Standpunkts; denn sie kann immer auch noch ganz anders. Ja, das ist ihr Prinzip in der Postmoderne geworden: anderes und mehr anderes heute und später können zu wollen: Modalisierung statt Moralisierung.138 Und so wird eine anspruchsvolle Orientierung an zwischenmenschlicher Herrschaftsfreiheit sich nicht in die einfachen Sozialzustände zurückwünschen können, als es die Herrschaft noch nicht gab, sondern nur die Freiheit in der Gemeinschaft, und wo – nota bene – die Gewalt alle Probleme lösen half. Sie wird sich auch nicht zufrieden geben können mit einem von dem possessiven Individualismus der bürgerlichen Gesellschaft figurierten Begriff der individuellen Freiheit. Sie wird vielmehr vorausblicken in die plural vernetzten Zustände der Zukunft, für die Herrschaft (sei es des Staates, sei es des Marktes) ein viel zu einfacher Mechanismus der Koordination des Handelns ist und in der Freiheit nur als soziale Freiheit im Medium denkbar ist. 2.3.8.2 „In Ketten: frei“ In der vorbürgerlichen, zwar schon modernen aber noch feudal organisierten Gesellschaft war der Begriff der Freiheit verstanden worden als ständische Freiheiten, d.h. als Inbegriff von Privilegien, verliehenen Rechten, bzw. Vorrechten. Daher kam Freiheit in der Regel nur als Plural, eben als Freiheiten vor. Diese konnten inhaltlich sehr Unterschiedliches beinhalten, für das es keinen allgemeinen Begriff zu geben brauchte. Diese Vielheiten von Freiheiten waren insgesamt unübersichtlich und nicht auf einen allgemeinen Begriff von Freiheit an sich zu beziehen. Freiheit bedeutete daher Ungleichheit; Freiheit und Gleichheit waren geradezu inkompatibel. Mit Sieyès‘ Schrift über den dritten Stand war jedoch das Ende der ungleichen Freiheiten eingeläutet. Er schrieb: „On n’est pas libre par des privilèges, mais par les droits qui appartiennent à tous.“139 Und aus Deutschland widerhallte es: „Wo Freiheiten sind, ist keine Freiheit; und wo Gerechtigkeiten sind, ist keine Gerechtigkeit.“140 138 Kritik der Moralisierung, hrsg. v. R. Großmaß u. R. Anhorn. Wiesbaden 2013. 139 E. J. Sieyès: Qu’est ce que le tiers état, ed. critique par E. Champion. Paris 1888, p. 32. 140 J. G. Seume: Prosaschriften. Köln 1962, p. 1338; den Unterschied hielt auch Campes Wörterbuch fest zum Stichwort „Freiheit“ fest: Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. J. H. Campe. 5 Bde. Braunschweig 1807-1811, II, p. 159: „Das Recht, vermöge dessen man in einzelnen Fällen durch gewisse Einschränkungen nicht gebunden ist … Im bürgerlichen Dieser Übergang von den Privilegien-Freiheiten zur Freiheit des Menschen als eines solchen ungeachtet des Standes blieb nicht unwidersprochen. So hieß es etwa 1790 in einer deutschen Quelle: Die französische Nationalversammlung raube „unter dem Scheine der Freiheit Freiheiten und Rechte.“141 Und als die Revolutionstruppen die Rheinlande überfielen, da hieß es, daß die Menschen dort ihre „bisher genossenen Freiheiten“ durch die „französische Freiheit“ verlören, Freiheit im Singular, d.h. Freiheit des Menschen, wurde als eine bedrohliche, aus Frankreich kommende Kapriole interpretiert.142 Aber die mit der bürgerlichen Revolution erfolgte Formulierung und Formierung eines solchen abstrakteren Freiheitsbegriffs zerstörte nachhaltig den Begriff der als Privilegien gewährten Einzelfreiheiten im Plural, die logischerweise immer eine ungleiche Verteilung implizierten, und setzte frei und postulierte zugleich politisch eine allgemeine Freiheit, die jedem Bürger, ja jedem Menschen in gleicher Weise zukomme. Daß damit nicht alles klar ist, insbesondere nicht in der Bestimmung des Verhältnisses von Freiheit und Gleichheit, ist offensichtlich; und Wieland sagte dementsprechend in seinen „Gesprächen unter vier Augen“: „…das große Losungswort der Jakobiner, Sansculotten und Anarchisten, Freiheit und Gleichheit, ist ein ganz unnötiger, oder vielmehr ein bloß zu ihren geheimen Faktionsabsichten nötiger Pleonasmus; denn mit dem Worte Freiheit ist schon alles gesagt.“ 143 Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, wie die Übersicht über die Kontroversen zur Füllung des allgemeinen Begriffs zeigt; was Wieland außerdem hier unterschlägt, ist der dritte, der problematischste Begriff in der Trias der Revolutionsrhetorik: Fraternité. 144 Denn das Interessante ist, daß das Schlagwort der Freiheit in der Zeit kurz vor 1800 sich so sehr durchgesetzt hatte, daß selbst die Gegner der bürgerlichen Revolution es affirmativ benutzten mit der erwartbaren Folge, daß jeder unter „Freiheit“ etwas anderes verstand. Johann Benjamin Erhard, der revolutionäre Kantianer stellte Leben sind Freiheiten Rechte, durch welche die höchste Obrigkeit eine Person oder Sache vor andern begünstiget (Privilegia).“ 141 Zit. bei J. Schlumbohm: Freiheit, p. 50. 142 Zit. ibd. 143 Zit. l. c., p. 55. 144 Cf. dazu K. Röttgers: Fraternité und Solidarität in politischer Theorie und Praxis – Begriffsgeschichtliche Beobachtungen.- In: Solidarität. Ein Prinzip des Rechts und der Ethik, hrsg. v. H. Busche. Würzburg 2011, p. 19-53 und dort angeführte Literatur. fest, daß es zu seiner Zeit (1795) vier verschiedene und unvereinbare Freiheitsverständnisse gebe:145 Die Aristokraten verstünden unter Freiheit lediglich die Abschaffung der persönlichen Frondienste, die Demokraten dagegen die vollständige Beseitigung aristokratischer Privilegien, die sogenannten „Moderantisten“ (wir würden heute sagen: die Wirtschaftsliberalen à la FDP), daß der Mensch das Recht hat reich zu werden und mit seinem Reichtum zu tun, was ihm beliebt; und schließlich nennt er den jakobinischen Freiheitsbegriff, der „keine Rechte respektiert, als die von ihm stammen, und dies nur solange, als … [er] sie anerkennen will.“ Der mährisch-jüdische Revolutionär, der sich Lucius-Junius Frey nannte (alias Moses Dobruschka, alias Franz Thomas, Edler von Schönfeld146) definierte in seiner anonym erschienenen „Philosophie sociale dédiée au peuple François, par un Citoyen de la République Françoise, ci-devant du Roule“147 Freiheit integral: „Liberté est égalité de droits.“ Alles, was diesem, im Kern jakobinischen Freiheitsbegriff entgegensteht, nennt er eine „liberté liberticide“, auf die nur die Todesstrafe antworten könne, weil sie ein Verbrechen gegen die Gesamtgesellschaft sei („le grand tout“).148 Sein Freiheitsverständnis erfüllt damit genau das, was Erhard als den jakobinischen Freiheitsbegriff bezeichnet hatte. Woher die Freiheiten im Plural kamen, war klar: von der Obrigkeit; wie aber sollte man sich den Ursprung jener abstrakten allgemeinen Freiheit denken? Hier war Metaphysik, ja zuweilen Religion, gefragt, eine befriedigende Antwort zu finden, wenn man sich nicht mit dem jakobinischen, doch recht willkürlich auftretenden Freiheitsverständnis zufrieden geben wollte. In Opposition zu den Exzessen jakobinischer Freiheit entwickelte sich in Deutschland ein Freiheitsbegriff, der geeignet zu 145 J. B. Erhard: Über das Rechts des Volks zu einer Revolution.- In: ders.: dass. u.a. Schriften. München 1970, p. 7-98, hier p. 88f. 146 Zu dieser schillernden Gestalt des Moses Dobruschka, der zunächst jüdischer Schriftsteller war, dann Mitbegründer des mystischen und sabbatianischen Freimaurerordens der „Asiatischen Brüder in Europa“, dann Heereslieferant für die österreichische Armee, als solcher vom Kaiser in den Adelsstand erhoben, der sich dann in Straßburg für die Revolution und den Jakobinerclub begeisterte, der daraufhin seinen Namen in Gottlieb Siegmund Junius Frey änderte, später Lucius-Junius Frey, der als österreichischer Spion verdächtigt und angeklagt wurde, was allerdings nicht beweisbar war, der dann vom Wohlfahrtskomité angeklagt wurde, an einer (erfundenen) Verschwörung beteiligt zu sein und der am gleichen Tag wie Danton hingerichtet wurde, s. G. Scholem: Ein Frankist: Moses Dobruschka und seine Metamorphosen.- In: Max Brod. Ein Gedenkbuch 1884-1968, hrsg. v. H. Gold. Tel Aviv 1969, p. 77-92. 147 Anonym: Philosophie sociale dédiée au peuple François, par un Citoyen de la République Françoise, ci-devant du Roule. Paris 1793, p. 175. 148 l. c., p. 182, 222. sein schien, der bloß politischen, d.h. bloß äußerlichen Freiheit der Franzosen einen die deutsche Kulturrevolution sekundierenden, innerlichen Freiheitsbegriff entgegenzusetzen. Dieser hatte mehrere Quellen. Zum einen konnte er sich auf einen im Luthertum fortlebenden Bezug auf Johannes, Kapitel 8, 31ff. stützen. Dort sagt Jesus zu Juden, die an ihn glauben: „So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen.“ Das verstehen seine jüdischen Jünger nicht, sie entgegnen. „Wir sind … niemals jemandes Knechte gewesen; wie sprichst du denn: ‚Ihr sollt frei werden‘?“ Da formuliert Jesus jenen Freiheitsbegriff, der im Grunde auch noch die Essenz sogar des Kantischen Freiheitsbegriffs ausmacht: „Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht … So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei.“ Es ist dieser spirituelle Freiheitsbegriff, der mehr zu sein beansprucht als die Freiheit von Ketten und Knechtschaft, eine Freiheit, die dann auch Luther in seiner 1520er Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ bewegt. Luther formuliert dort erstmals jene Paradoxie, die dem Freiheitsbegriff seither anhaftet und die die Formulierung „In Ketten frei“ ermöglicht. Er stellt nämlich zwei Sätze auf, die sich zu widersprechen scheinen, die aber beide gleich gültig seien: 1) „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.“ 2) „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ 149 Luther löst die Paradoxie auf, indem er den „inwendigen geistlichen Menschen“ von dem leiblichen, äußerlichen unterscheidet. „Was hilft’s der Seele, daß der Leib ungefangen, frisch und gesund ist, isset, trinkt, lebt, wie er will? Wiederum, was schadet das der Seele, daß der Leib gefangen, krank und matt ist, hungert, dürstet und leidet, wie er nicht gern wollte? Dieser Dinge reichet keines bis an die Seele, sie zu befreien oder fangen, fromm oder böse zu machen.“ 150 Bei einer solchen Trennung ist es nur konsequent, wenn Luther ein Jahr später seine „treue Vermahnung zu allen Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung“ in die Welt schickt.151 Denn diese äußerlichen Aufstände haben gar nichts zu tun mit jener wahren, innerlichen Freiheit, auf die es allein ankommt. Dem entspricht später bei Kant die absolute Ablehnung jeglichen Widerstandsrechts. 149 M. Luther: Studienausg., hrsg. v. K. G. Steck. Frankfurt a. M., Hamburg 1970, p. 81. 150 l. c., p. 82 151 Darin heißt es: „Es ist eitel unsre Schuld alles, was der Papst mit den Seinen an unserm Gut, Leib und Seele getan hat. Darum mußt du zuvor die Sünde bekennen und ablegen, ehe du der Strafe und Plage willst los sein.“ (l. c., p. 108) Aber diese Luthersche, die Moderne insgesamt leitende Auflösung des Widerspruchs ist zu einfach. Wenn, wie wir uns in der Postmoderne überzeugen mußten, das Soziale, das uns medial verbindet, ein kommunikativer Text ist, dann versagt an diesem Zwischen die simple Trennung von Innen und Außen, von wahrer, innerer Freiheit und bloß äußerlicher Freiheit, letztere bei Kant gar karikiert als „Freiheit eines Bratenwenders“.152 Die simple Trennung verdankt sich einer Subjektzentrierung in der Sozialphilosophie, die aber in der Postmoderne einer Medialitätszentrierung weichen mußte. Es gibt keinen vorgängigen, authentischen oder wahren Text im Inneren eines Menschen oder Subjekts hinter dem kommunikativen Text, so wie es – nach einem Bild von Ute Guzzoni153 – hinter der Quelle keine Quelle gibt, die bewirkt, daß die Quelle quillt. Oder mit Nietzsche154: das Geschehen ist alles; es wäre eine unsinnige ontologische Verdopplung, dahinter einen Ur-heber oder eine Ur-sache zu vermuten und zu suchen. Es gibt nicht erst den Blitz, der dann verursachte, daß es blitzt. Was wäre das für ein Ich, das behaupten könnte, es wäre Verursacher seines Denkens? Die Trennung der Freiheit eines Christenmenschen resp. Transzendentalen Subjekts von einer bloß äußerlich und ihr nachgeordneten Freiheit des Leibes ist sehr gekünstelt. Gleichwohl geschieht sie, und daher fragt sich, wo und warum. Es gibt ein Reversum jener Paradoxie, und das ist der Befehl „Sei frei“. Die imperiale, quasi napoleonische Philosophie Fichtes zelebriert diesen Gestus eines Zwangs zur Freiheit.155 Entzog sich die „Freiheit eines Christenmenschen“ den äußerlichen Ketten und konnte in den Ketten der Leiblichkeit frei sein, so auferlegt 152 I. Kant: Gesammelte Schriften V, p. 96. 153 U. Guzzoni: Wasser. Berlin 2005, p. 87. 154 F. Nietzsche: „… es giebt kein ‚Sein‘ hinter dem Thun, Wirken, Werden; ‚der Thäter‘ ist zum Thun bloss hinzugedichtet, – das Thun ist Alles. Das Volk verdoppelt im Grunde das Thun, wenn es den Blitz leuchten lässt, das ist ein Thun-Thun: es setzt dasselbe Geschehen einmal als Ursache und dann noch einmal als deren Wirkung.“ F. Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausg., V, p. 279. 155 Explizit ausgesprochen wird dieser Befehl in den Vorträgen von 1813 über die „Thatsachen des Bewußtseins“.- In: J. G. Fichte: Werke, hrsg. v. I. H. Fichte. ND Berlin 1971, IX, p. 503. Fichte prüft in diesem Vortrag die Frage, wie „die absolute Freiheit des Ich“ (p. 496) in die empirische Welt gelangen kann, d.h. er stellt sich – auf seine Weise – durchaus dem Problem der zwei Freiheiten. Damit die „absolute Freiheit des wahren Ich“ zur Realität werde, bedarf es der Umsetzung des Zwangs des Gesetzes, unter dem das „wahre Ich“ steht, in die Zwecksetzungen des empirischen Ichs. Das leistet der Begriff der Einbildungskraft, die die Einsicht in die Willensbildung umsetzt: „Die Anforderungen an die Freiheit sind darum das Bildungsmittel der Menschheit, so wie des einzelnen Menschen. Sei frei, diese „absolute Freiheit des wahren Ich“ das Gesetz einer innerlichen Kette, frei sein zu sollen. Die Paradoxie der Freiheit und der Freiheit wurde in der deutschen, der kulturellen Revolution auch in verschiedenen anderen Flexionen durchgespielt. Einige dieser paradoxen Verknüpfungen seien hier angeführt, einige waren eher quietistisch, andere eher ungeduldig. In Goethes „Werther“ liest man: „… daß alle Beruhigung … nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und leichten Aussichten bemalt …“ 156 Jener Freiheitsvorstellung eines gewissen Liberalismus, der sich als Freiheit für die Wirtschaft und die Wirtschaftssubjekte tarnt, erteilt Georg Forster, damit die ökonomischen Entscheidungen der Französischen Revolutionsregierung interpretierend und rechtfertigend, eine heftige Abfuhr: „Sie hat der Habsucht, der Gewinnsucht, dem Geitze, mit Einem Worte, der ärgsten Knechtschaft, zu welcher der Mensch herabsinken könnte, der Abhängigkeit von leblosen Dingen, einen tödtlichen Streich versetzt. Die Finanzoperationen des National-Konvents zweckten schrittweise dahin ab.“157 Hier also finden wir, nebenbei gesagt, eine Version des Topos 158 „in Ketten frei“, die auch heute noch bedenkenswert erscheinen möchte. Im Rahmen des globalisierten Wirtschaftsliberalismus, der die Menschen in ihren verwertbaren Profilen einfängt, dürfen die sich die so degradierten Konsumenten und User tatsächlich frei fühlen. Während es in der revolutionären und dann staatssozialistischen DDR für einen Bedarf genau ein einziges, im Rahmen der Möglichkeiten optimal gestaltetes Produkt gab, hat der Konsument in den ganz anderen Fesseln des Kapitalismus die freie Entscheidung, zwischen Omo und Dalli wählen zu können und hält das dann für die ihm vom ökonomischen Liberalismus gewährte und von den „Volks“-Parteien garantierte Freiheit von allen Ketten. Liberale gingen nie so weit wie später die Sozialisten, im Zweifelsfall der Gleichheit gegenüber der Freiheit Priorität einzuräumen. Auf der anderen Seite war und ist kann ich also sagen, d.h. verstehe es nur, und wolle es ernstlich; dann wird dir diese Erkenntniß deiner Freiheit werden ein Mittel zur Erlangung der wahrhaften Freiheit [d.i. im Jenseits eines „künftigen Lebens“] Darum ist jedes Bildungsmittel zugleich eine solche Anforderung an die Freiheit des Menschen.“ (p. 503). „... diese Unterwerfung unter das höhere Gesetz zu vollenden, ist ja das Ziel des ganzen Erdenlebens unserer Gattung; und ein künftiges Leben kann von dem gegenwärtigen sich nur dadurch unterscheiden, daß diese Unterwerfung und Durchdringung vollendet ist…“ (ibd.) 156 J. W. Goethe: Werke, hrsg. v. H. Düntzer u. F. Strehlke. Berlin o.J., XIV, p. 22f. 157 J. G. Forster: Parisische Umrisse.- In: Friedens-Präliminarien. 1. Stck. Berlin 1793, 317365, hier p. 344; auch in: ders.: Mensch und Staat. Berlin o. J., p. 208. 158 Zur Toposforschung im Anschluß an E. R. Curtius s. O. Pöggeler: Dichtungstheorie und Toposforschung.-In: Toposforschung. Darmstadt 1973, p. 22-135. unübersehbar, daß die Forderung des Abbaus von wirtschaftlichen Privilegien des Feudalstaats und das alleinige Vertrauen in den Marktmechanismus der bürgerlichen Gesellschaft zu neuen Ungleichheiten der Verteilung von Freiheiten führten. Auch die Förderung von „Frei“handelsabkommens wie CETA oder TTIP macht ja nicht die Individuen freier, sondern die Unternehmen und damit vielleicht die Individuen sogar unfreier, weil abhängiger vom globalen Kapitalismus. Die kritische Frage lautet daher: Wieviel an Ungleichheit von Freiheiten kann man hinnehmen, ohne die Freiheit jedes Individuums zu gefährden; denn absolute Gleichheit, gerade auch in ökonomischer Hinsicht galt dem Liberalismus immer als eine unerträgliche Einschränkung der Freiheit der Individuen. In diesem Sinne haben Liberale wie z.B. Rotteck Rechtsungleichheiten, etwa auch des Wahlrechts und sogar des Strafrechts als unanstößig hingenommen. Die optimistische Voraussetzung, die dahinter stand, war, daß ein Vermögen und damit das Enthobensein von drängender Sorge um die Subsistenz zur Möglichkeit der Vernunft befreit, während diese drängende Sorge um die Subsisitenz zu einer kurzschlüssigen Verfolgung eines egoistischen Eigeninteresses nötige. Deutlich wird dieses Problem einer Spannung zwischen Freiheit und Gleichheit bereits bei dem frühen Liberalen Condorcet. Einerseits war er der Überzeugung, daß es aufgeklärter Vernunft entspreche, daß es eine absolute Gleichheit der Partizipation an den demokratischen Entscheidungsprozessen von Repräsentativgremien geben müsse. Andererseits weiß er, daß nicht bereits jetzt die Menschen sich in ihren Entscheidungen von aufgeklärter Vernunft allein leiten lassen, so daß es bei Anwendung des Gleichheitsprinzips zu absolut unvernünftigen Entscheidungen kommen könne, die, wie wir erlebt haben, sogar zur Abschaffung eben jener rationalen Grundlagen der Entscheidungsprozeduren in Repräsentativgremien kommen kann. Condorcet hat durch verschiedene Kalküle der Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahlrechtsmodalitäten zu erfinden sich bemüht, die gewährleisten könnten, daß die Wahrscheinlichkeit rationaler Entscheidungen auf der Grundlage des Gleichheitsprinzips für Repräsentativgremien möglichst groß wird. Diese Kalküle sind mehr ein Indiz des Problems als bereits seine Lösung. Umgekehrt hat Georg Forster in seinen „Parisischen Umrissen“ die (zeitweilige) Herrschaft des unvernünftigen Exzesses in der Revolution durch die immense Größe und Wichtigkeit der revolutionären Aufgabe zu rechtfertigen versucht. Und Friedrich Schlegel, der durch Forster und vor allem durch seine Schwägerin Caroline (geb. Michaelis) mit dem Geist der Revolution bestens vertraut war, brachte das Problem auf folgende Formel: „… innerhalb der Gesetzgebung der Freiheit und Gleichheit müßte das Gebildete das Ungebildete überwiegen und leiten, und alles sich zu einem absoluten Ganzen organisieren.“159 Stichwortgeber derjenigen, die einen unaufhebbaren Gegensatz zwischen der Gebundenheit in Ketten und der Freiheit aufstellten, war für das Zeitalter der „Contrat social“ des Jean-Jacques Rousseau, in dem es bereits im ersten Satz geheißen hatte: „L’homme est né libre, & par-tout il est dans les fers.“160 Rousseaus Parole hat Schiller signifikant umgebogen: „Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, und würd er in Ketten geboren…“161 Abgesehen von dem schiefen Bild eines Geburtsvorgangs in Ketten, bricht die Einführung der Unterscheidung von „frei geschaffen“ und möglicherweise „in Ketten geboren“ dem Rousseauschen Kampfruf die Spitze: auch der in Ketten Geborene ist doch als Geschaffener „frei“ – also er ist „in Ketten: frei“. Das sah Herder bereits anders. In seinen „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ hatte er geschrieben: „Man kann es als einen Grundsatz der Geschichte annehmen, daß kein Volk unterdrückt wird, als das sich unterdrücken lassen will, das also der Sklaverei werth ist. Nur der Feige ist ein geborner Knecht…“ Und weiter: „Das edelste Volk verliert unter dem Joch des Despotismus in kurzer Zeit seinen Adel, das Mark in seinen Gebeinen wird ihm zertreten … was Wunder, daß es sich endlich an sein Joch gewöhnt, es küßt und mit Blumen umwindet?“162 Trotz dieser Diagnose der Depravierung durch Despotismus kommt Herder schließlich zu der abschließenden Aussage, ganz auf der Linie Luthers. „Ueberhaupt ist das Loos des Menschen und seine Bestimmung zur irdischen Glückseligkeit weder ans Herrschen noch ans Dienen geknüpft. Der Arme kann glücklich, der Sklave in Ketten kann frei sein; der Despot und sein Werkzeug sind meistens, und oft in ganzen Geschlechtern, die unglücklichsten und unwürdigsten Sklaven.“ 163 Völlig unvorbereitet traf Herder die beißende Kritik seines einstigen Lehrers Kant in dessen Rezension des Herderschen Werks. Allerdings war diese Kritik begründet in einer Opposition Herders gegenüber Kants Schrift „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“. Im „sechsten Satz“ dieser Schrift hatte Kant geschrieben: „… der Mensch ist ein Thier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nöthig hat.“164 159 F. Schlegel: Athenäumsfragment 214.- In: ders.: Kritische Friedrich-Schlegel-Aug. II, p. 198; zur spiritualistischen Wendung des Freiheitsbegriffs s. auch p. 258: „Frei ist der Mensch, wenn er Gott hervorbringt oder sichtbar macht…“ (Ideen Nr. 29). 160 Anonym: Du Contrat social, ou principes du droit politique. Paris 1791, p. 3. 161 F. Schiller: Die Worte des Glaubens.- In : ders.: Werke in drei Bden., hrsg.v. H. G. Göpfert. München, Wien 1966, II, p. 706. 162 J. G. Herder: Werke, hrsg. v. H. Düntzer. Berlin o. J. X, p. 133f. 163 l. c., p. 135. 164 I. Kant: Gesammelte Schriften VIII, p. 23. Herder hatte diesen Grundsatz „leicht“, aber „böse“ genannt und polemisch kommentiert: „Kehre den Satz um: ‚Der Mensch, der einen Herrn nöthig hat, ist ein Thier; sobald er Mensch wird, hat er keines eigentlichen Herrn mehr nöthig.‘“ Die Umkehrung kommentiert Kant in seiner Rezension zwar nicht, aber gesteht zu, daß der Grundsatz „leicht“ sei, „weil ihn die Erfahrung aller Zeit und an allen Völkern bestätigt…“, verwahrt sich aber dagegen, daß dieser Grundsatz „böse“ sei. Kants nun in der Tat böse Rezension von Herders Geschichtsphilosophie war nicht der einzige Widerstand, dem diese sich ausgesetzt sah, stand doch in seinem Entwurf zu dem 4. Kapitel des neunten Buches („Die Regierungen…“) ursprünglich, daß diese für „Freiheit, Aufklärung und Glückseligkeit der Menschen“ zu sorgen hätten, d.h. für die Beförderung der Humanität, ja daß die Regierungen daran mitwirken müßten, daß „das Volk … sich selbst zu regieren“ könne und daß so durch Selbstregierung der ganze zum Despotismus neigende Staatsapparat überflüssig werden würde.165 Das konnte der Minister (Goethe) so nicht stehen lassen; er verfügte, „daß füglich kein Wort davon stehen bleiben könnte…“166 In einem Brief an Knebel schildert Herder den Vorfall so: „Mit meinen leidigen ‚Ideen‘ stockt’s abermals; ich habe wieder weggeworfen, was ich geschrieben habe, oder muß es tun, und doch kann ich nichts Besseres schreiben. Die Rücksichten auf die Regierungen placken mich auf unerhörte Weise. Lügen will und kann ich nicht, darum wende und drehe ich mich, und ihr Faden durch die ganze Geschichte bleibt doch, was er ist, für die beeinträchtigte Menschheit. Der Pontifex maximus (zu deutsch oberste Wegaufseher und Straßenkehrer) Goethe soll den Ausschlag geben.“167 Trotz des ministeriellen „Straßenkehrers“ ist freilich in diesem Kapitel geblieben eine Kritik an den Erbregierungen: „Die Natur teilt ihre edelsten Gaben nicht familienweise aus, und das Recht des Blutes, nach welchem ein Ungeborner über den andern Ungebornen, wenn Beide einst geboren sein werden, durchs Recht der Geburt zu herrschen das Recht habe, ist für mich eine der dunkelsten Formeln der menschlichen Sprache.“168 Wie kam es also zu den Erbregierungen trotz dieser offensichtlichen Absurdität? Nur durch Krieg und unterdrückende Gewalt. Die Monarchen dieser Regierungen 165 J. G. Herder: Sämmtliche Werke, hrsg. v. B. Suphan. Berlin 1877, XIII, p. 456. 166 Zit. nach J. G. Herder: Briefe, hrsg. v. W. Dobbek. Weimar 1959, p. 464. 167 l. c., p. 254. 168 J. G. Herder: Werke, hrsg. v. H. Düntzer X, p. 131. nennt er daher „Ungeheuer der Eroberung“, „Helden, d.i. ehrsüchtige, mit Gewalt begabte oder listige und unternehmende Menschen“169. Den An-archismus freier Humanität also mußte Herder streichen, geblieben aber sind seine entschiedenen Vorbehalte gegen despotische Regierungen und sein Widersprechen gegen den Grundsatz „in Ketten: frei“. In den Ketten des kriegerischen Despotismus wird die Seele ihrer besten Eigenschaften beraubt und zu einer knechtischen Seele herabgewürdigt. Kant dagegen konnte den Abscheu vor Ketten nur psychologisierend einem bestimmtenMenschentyp zurechnen, vermutlich war für ihn Herder ein solcher; diese Phobie vor Ketten „von den vergoldeten, die man am Hofe trägt, bis zu den schweren Eisen des Galeerensklaven“ sei eine Eigentümlichkeit des Menschen „von melancholischer Gemüthsverfassung“.170 So hatte Kant einen ganz und gar innerlichen und spiritualistischen Gebrauch des Begriffs der Ketten und der Freiheit von Ketten, für den Ketten der Adeligen und Ketten der Galeerensklaven keinen großen Unterschied machen. Das ist manifest auch beispielsweise in seiner Interpretationen von Leidenschaften. „Leidenschaften … wünscht sich kein Mensch. Denn wer will sich in Ketten legen lassen, wenn er frei sein kann?“ Von diesen innerlichen Ketten sich zu befreien, sei das Bestreben eines vernünftigen Wesens, schreibt er in seiner Anthropologie.171 In § 80f. heißt es dort: „Man sieht leicht ein, daß Leidenschaften … der Freiheit den größten Abbruch thun…Leidenschaften sind Krebsschäden für die reine praktische Vernunft und mehrentheils unheilbar: weil der Kranke nicht will geheilt sein und sich der Herrschaft des Grundsatzes entzieht, durch den dieses allein geschehen könnte. … Daher sind Leidenschaften nicht blos … unglückliche Gemüthsstimmungen, …sondern auch ohne Ausnahme böse…“172 Die Hervorhebung einer innerlichen Freiheit des Individuums als primär und diese als Voraussetzung äußerer Befreiung von Ketten zu machen, ist das, was noch Fichte ungeachtet aller Freiheitsemphase und Verteidigung der Französischen Revolution für Deutschland empfahl. Erst wer sich von den inneren Ketten befreit hat, hat sich bereit und würdig gemacht für die äußere Freiheit. Im Grunde ist er schon von Ketten frei, auch wenn es noch anders erscheinen mag. Also: Kulturrevolution vor der politischen, oder noch deutlicher: Pädagogik vor Politik. Kritisch könnte man das auch so sehen: Pädagogik statt Politik, Selbstveränderung statt Weltveränderung – Langhans statt Dutschke, Esoterik anstelle von Exoterik. Diese Position legitimierte 169 l. c., p. 133. 170 I. Kant: Gesammelte Schriften II, p. 221. 171 l. c., p. VII, p. 252. 172 l. c., p. 265ff. sich durch die Überzeugung, daß eine bloß äußerliche Freiheit ohne die innere scheitern werde und müsse, wie man u.a. an der Entwicklung der Französischen Revolution sehen könne. Für viele, die sich anfangs ohne Einschränkung für die Revolution begeisterten, wie z.B. Forster, der durchaus den Terreur noch rechtfertigte, weil die Revolution ein absolutes Novum in der Geschichte darstelle, das mit traditionellen Maßstäben nicht gemessen werden könne, war dann die Hinwendung der Revolution zur neuen, napoleonischen Unfreiheit Grund genug, die deutsche, die Gesinnungsfreiheit zu favorisieren. Diese Wendung zu einer innerlichen, ja zuweilen transzendent-religiösen Vorstellung „wahrer Freiheit“ konnte den Herrschenden, quasi den Ketten-Verwaltern, nur recht sein. Die Religion sei „die trefflichste Bildnerin zur wahren Freiheit, so wie sie das Gefühl der einzigen Gleichheit, die allen bürgerlichen Verhältnissen trotzt, in dem Gemüt des Ärmsten und Verlassensten nährt.“ 173 Lavater dichtete. „Sei frei – und fühle: Unentbehrlich der Freiheit ist Religion!“ Angesichts solcher begrifflichen Verwirrungen konnte es nicht ausbleiben, daß einer, nämlich Mathias Claudius, schrieb: „Freiheit und Knechtschaft sind wohl zwei; doch oft im Grunde einerlei…“174 Dagegen hatte schon der Tempelherr in Lessings „Nathan der Weise“ (4. Akt, 4. Auftritt) eingewandt: „Der Aberglaub‘, in dem wir aufgewachsen, verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum doch seine Macht nicht über uns. – Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.“175 Wenn man die äußere Freiheit an eine innere Freiheit als Bedingung anbindet, dann wird es möglich, diejenigen, die offensichtlich oder auch nur vermuteterweise der inneren Freiheit entbehren und eine äußere Freiheit gleichwohl in Anspruch nehmen möchten, zu bekämpfen und ihnen den Anspruch auf ihre ungegründete Freiheit strittig zu machen. Dann gilt für sie: Keine Freiheit für die Feinde unserer Freiheit! Diese Parole reiht sich dann ein in den globalen, manichäischen Kampf gegen das Böse und die Bösen, die Schurken dieser Welt. Wer auf Seiten des von uns Guten definierten Bösen steht, der hat damit seinen Anspruch auf Freiheit verwirkt, er gehört in Ketten, in denen er dann, weil er keine innere Freiheit von dem Bösen hat, nicht mehr behaupten kann, er sei auch in Ketten frei. Da er auch innerlich in den Ketten des Bösen liegt, sind die äußerlichen Ketten wohlverdient. Im Zuge der amerikanisierten Globalisierung als ökonomischer Globalisierung sind diese Bösen die Gegner der freien Marktwirtschaft und ihrer Akteure. Daß auch diese manichäische Freiheitsvorstellung politisch paradox wird, zeigte nicht zuletzt die Feier des „arabi- 173 J. Schlumbohm: Freiheit, p. 79. 174 Beides zit. l. c., p. 82. 175 G. E. Lessing: Werke in drei Bden., hrsg. v. H. G. Göpfert. München, Wien 1982, I, p. 694. schen Frühlings“ durch die Ideologen des kapitalistischen, „freien“ Westens, der eigentlich nur in Tunesien zu einer wenngleich labilen, freiheitlichen Demokratie geführt hat. Ganz offensichtlich fehlte diesen Völkern diejenige innere Befreiung von Ketten, die sie zu politischen Verbündeten des „freien“ Westens hätte machen können. Sartres radikal begriffene Freiheit ist die Freiheit vor dem Hintergrund des Nichts als permanenter Möglichkeit der menschlichen Existenz. Sie ist keine Eigenschaft, die dem Menschen oder seinem Willen zukäme (oder auch nicht). Für Sartre ist das Sein des Menschen gleichursprünglich mit seiner Freiheit, so daß er nicht erstens ist und ihm zweitens Freiheit zukäme. Dasein ist Dasein-in-Freiheit. Solche Freiheit ist in nichts begründet; sie selbst begründet vielmehr, daß der Mensch seine Existenz zu ergreifen und zu entwerfen habe. Frei ist der Mensch, noch bevor er sein Wesen entworfen hat. Für Sartre „erscheint die Freiheit als eine unanalysierbare Totalität; Motive, Antriebe und Zwecke wie auch die Art, Motive, Antriebe und Zwecke zu erfassen, sind im Rahmen dieser Freiheit vereinigend organisiert und müssen von ihr aus verstanden werden.“176 Man muß also die klassische Frage nach der Freiheit des Willens umkehren: es ist unanalysierbar die Freiheit, die eine Willensstaffage kreiert. Das ist deswegen so, weil in dieser ontologischen Perspektive die Freiheit mit dem Sein (des Für-sich) identisch ist: „… die menschliche-Realität ist genau in dem Maß frei, wie sie ihr eigenes Nichts zu sein hat.“177 Freiheit ist die Negation der Faktizität, oder anders gesagt: der Bestimmung des Wesens durch die Existenz. Und diese Bestimmung hat die Form einer Wahl. Diese Freiheit der puren Existenz trotzt sowohl der Vergangenheit, d.h. der faktischen Gewordenheit, als auch den Umständen. Das hat zur paradoxen Konsequenz, daß ich nicht frei bin, nicht frei zu sein. Also selbst in Ketten bin ich dieser existentialen Freiheit nicht ledig. Auch bei Sartre gilt also: „In Ketten: frei“. Denn die Ketten sind Teil jener Bestimmtheiten, die der Mensch frei wählen kann. Insofern sind jene Ketten eben durch meine existentiale Freiheit meine Ketten. Die für Sartre entscheidenden programmatischen Sätze finden sich bereits im ersten Kapitel von „L’être et le néant“178, und zwar im Abschnitt über „L’origine du néant“. Dort wird das Nichts durch die Negation begründet. Die Negation ihrerseits beruht auf der Möglichkeit der Frage: Mit der Frage nach dem Sein entsteht zugleich die Negation: „Nous avons alors dû reconnaître que, si la négation n’existait pas, 176 J.-P. Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbek 1994 (=Gesammelte Werke. Philos. Schriften 1), p. 785. 177 ibd. 178 J.-P. Sartre: L’être et le néant. aucune question ne saurait être posée, en particulier celle de l’être.“ 179 Aber diese Negation verweist auf das Nichts als ihren Ursprung und Grund. Gebunden an die Frage nach dem Sein und deren Negationsmöglichkeit, ist das Nichts nicht im Jenseits des Seins beheimatet, sondern „au cœur de l’Être“180. Sartre spitzt diese Erkenntnis weiter zu: „L’être par qui le Néant arrive dans le monde doit neantiser le Néant dans son Être …“, und weiter: das Sein nichtet das Nichts im Hinblick auf eben sein Sein: „L’être par qui le Néant arrive dans le monde est un être en qui, dans son Être, il est question du Néant de son Être: l’être par qui le Néant vient au monde doit être son propre Néant.“181 Diese paradoxe Konsequenz, daß das Sein sein eigenes Nichts ist, allerdings vermittelt durch die Befragung des Seins durch den Menschen (!), hat nun Folgen für den Freiheitsbegriff. Sartre findet diese radikale Konsequenz bereits bei den Stoikern und bei Descartes, nämlich die Abtrennung eines Nichts durch die Realität des Menschen Freiheit zu nennen. Näherhin heißt das für die Existenz des Menschen: „La liberté humaine précède l’essence de l’homme et la rend possible, l’essence de l’être humain est en suspens dans sa liberté.“ 182 Also sind Freiheit und das Sein der menschlichen Realität ununterscheidbar. Der Mensch ist nicht erst, und dann auch noch frei, „mais il n’y a pas de différence entre l’être de l’homme et son ‚être-libre‘.“183 Menschsein heißt – vor aller Bestimmung von Wesen und Wesenseigenschaften – Freisein. Diese existentielle Freiheit – wie gesagt – vor allen Wesenseigenschaften und erst recht vor allen kontingenten Bestimmungen „zwingt“ den Menschen zum Freisein: er kann aus dem Grund seiner Existenz heraus sich nicht dazu bestimmen, unfrei zu sein. Er ist zur Freiheit verurteilt. Also auch in den Ketten seines wie immer verlaufenden Schicksals bleibt er existentiell frei. Diese existentielle Freiheit ist fundamentaler als jegliche politische Bestimmung von Freiheit, aber auch sogar fundamentaler als die sogenannte Handlungsfreiheit der philosophischen Tradition. Denn ob er handelt oder nicht handelt, ob er handeln kann oder könnte oder auch nicht – existentiell ist er frei, sich als dieser oder jener zu wählen. Für den Menschen gibt es überhaupt keinen ontologischen Zwang: Was er existierend ist, ist er in einem ontologischen Sinne immer freiwillig. Sartre – selbst gezwungen, Soldat zu sein – sagt: Wenn ich gezwungen werde, als Soldat in den Krieg zu ziehen, dann bin ich doch, in einem ontologischen Sinne, nicht dazu gezwungen: Ich könnte das Risiko des Desertierens auf mich nehmen, ich könnte mich einsperren 179 l. c., p. 58. 180 ibd. 181 l. c., p. 59. 182 l. c., p. 61. 183 ibd. lassen, oder ich könnte mich im Extremfall durch Selbsttötung dem gesellschaftlichen oder politischen Zwang entziehen, Soldat sein zu sollen. Indem ich mich für eine dieser Alternativen entscheide, z.B. mich dem politischen Zwang zu beugen, beweise ich damit meine radikale und durch nichts aufhebbare Freiheit. Das aber heißt auch: Es gibt keine Entschuldigung für die menschliche Realität. Wenn ich mich dem faktischen Zwang, in den Krieg zu ziehen, nicht verweigere, dann liegt auch darin meine mir selbst eigene Entscheidung; der Krieg, auf den ich mich mit dieser Entscheidung einlasse, wird dadurch zu meinem Krieg. Die in der Praxis sich entfaltende Freiheit begegnet sich im Resultat als Notwendigkeit; im Vollzug negiert sich die Freiheit. Sie gewinnt die Erfahrung einer rückwirkenden Kraft der Materialität, „die meine Freiheit von der Endobjektivität bis zur ursprünglichen Entscheidung untergräbt“. 184 „Sie ist die Negation der Freiheit innerhalb der entfalteten Freiheit, die durch die Freiheit selbst getragen und der vollen Entfaltung dieser Freiheit selbst ... proportional ist. Sie ist also die Erfahrung des Anderen nicht als Gegner, sondern insofern seine zerstreute Praxis durch die Materie totalisiert zu mir zurückkommt, um mich umzuwandeln“.185 Diesen Zusammenhang nennt Sartre die Grundstruktur der Entfremdung. Radikaler noch formuliert: Der Vollzug der Freiheit im Handeln ist bereits der Verlust der Freiheit an das Objekt. Auf diese Weise wird bei Sartre, noch vor aller gesellschaftlichen Organisation von Arbeit, Entfremdung zur Grundstruktur des handelnden Inder-Welt-seins, und zwar in doppelter Weise. Ist das Objekt des Handelns nicht mehr die realisierte Freiheit, so ist auch das Subjekt des Handelns nicht mehr der Ort der Freiheit, sondern es ist – wie Sartre sagt – „vorfabriziert durch ein Gefüge von Forderungen“.186 Mit dem postmodernen Zusammenbruch der Subjektzentrierung ist auch diese Zentrierung hinfällig geworden und der Topos einer Freiheit in Ketten obsolet. Das heißt mitnichten, daß es Freiheit nicht gibt oder nicht mehr gibt. In der medialitätszentrierten Postmoderne werden jedoch Freiheiten medial „illusioniert“. Jedermann ist nun zugemutet, sich einer Praxis unbegrenzter Wahlfreiheit einzufügen. Wer allerdings sich diesen Illusionen der Freiheit nicht fügen mag, weil er sich weigert, zwischen den Freiheitsangeboten frei zu wählen, gerät sofort in Verdacht, insgeheim zu den Feinden „unserer“ Freiheit zu gehören. Sind die medialitätsinduzierten Illusi- 184 J.-P. Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft. Reinbek 1967, p. 241. 185 ibd. 186 l. c., p. 243. onen der Freiheit allumfassend, so ist auch der korrespondierende Verdacht grenzenlos und machte tendenziell auch nicht vor dem Sartreschen ontologischen Residuum halt – wie ja Sartre selber später gesehen hat, ohne daraus bereits medialitätsphilosophische Konsequenzen ziehen zu können.187 2.3.8 Die Freiheit des Individuums (Fortsetzung) Wie gesehen, hat der Prozeß der Individualisierung zugleich zu einem geradezu emphatischen Begriff der Freiheit des Individuums geführt. Die Individualisierung hatte zu einer inneren Unendlichkeit der Bestimmungen und bei Sartre zu einem ontologischen Residuum vorgängig zu diesen geführt und zugleich damit eine äußere Unvergleichlichkeit jedes einzelnen Individuums erzeugt. Eine der Äußerungsformen dieser ambivalenten Doppelstruktur ist die unendliche Vielfalt des Begehrens. Diese wird als Diversität der Bedürfnisse auf die Individuen und ihre Profile zurückgerechnet und verwaltet. Aber wie soll man durch Befriedigung der diversen Bedürfnisse die Unendlichkeit des Begehrens stillen? Das wird bedient dadurch, daß Bedürfnisse und Befriedigungen durch Weckung neuer Bedürfnisse so kurzschlüssig miteinander verknüpft werden, daß in dieser Atemlosigkeit die Unendlichkeit des Begehrens verdeckt wird. Die Hektik der Bedürfnisbefriedigung erzeugt zwischen den Individuen eine tendenzielle Konkurrenz. Daher wurde zugleich mit der Emergenz dieser friedlosen Bedürfnisbefriedigung des einen auf Kosten des anderen der Leviathan als Ordnungsgarant instituiert. Das anarchistische Begehren wird politisch organisiert. Kants Sittengesetz, jener innere Leviathan, kannte jedoch – darin war Kant liberaler als Hobbes – das Wirken dieser Bedürfnisse in der Gesellschaft sehr wohl und anerkannte auch ihre Berechtigung im Sinne eines Plans der Natur und schließlich sogar im Sinne einer „Kritik der kulinarischen Vernunft“ ein harmonisches Zusammenwirken von Sinnlichkeit und Sittlichkeit.188 Aber auch diese Harmonieformel verdeckt nur das Problem, das mit der Individualisierung und ihrem Freiheitsverständnis aufgebrochen ist. 187 S. sein Interview, das er 1969 der Zeitschrift New Left Review gegeben hat; dort heißt es (dt. Übers. in der Zs. „konkret“, 1970, H. 7): „Mit einer einfachen Formel gebracht, könnte ich sagen, daß das Leben hat mich ‚die Macht der Dinge‘ gelehrt habe. Eigentlich hätte ich mit der Entdeckung dieser Macht seit ‚Das Sein und das Nichts‘ die Entdeckung dieser Macht anfangen müssen, denn zu dieser Zeit hatte man aus mir schon einen Soldaten gemacht. Ich hatte schon die Erfahrung gemacht, daß etwas, das nicht meine Freiheit war, mich von außen lenkte. … Nach und nach habe ich dann bemerkt, daß die Welt doch komplizierter ist als ich gedacht hatte…“. 188 Dem ist nachgegangen K. Röttgers: Kritik der kulinarischen Vernunft. Die Gesellschaft der freien Bedürfnisbefriedigung des Individuums führt immer zur Einschränkung der freien Bedürfnisbefriedigung anderer Individuen, jedenfalls dann, wenn die Ressourcen begrenzt sind. In einer solchen universellen „Vernetzung“ von Bedürfnisbefriedigungen ergeben sich dann an völlig unerwarteten Stellen Folgen. Der Schmetterling, dessen Flügelschlag in Rio einen Tornado in den USA auslösen kann, ist keine Erfindung der Chaosforschung, sondern Vergleichbares findet sich bereits in einem anderen Bild bei G. Chr. Lichtenberg: „Niemand wird leugnen, daß in einer Welt, in welcher sich alles durch Ursache und Wirkung verwandt ist, und wo nichts durch Wunderwerke geschieht, jeder Teil ein Spiegel des Ganzen ist. Wenn eine Erbse in die Mittelländische See geschossen wir, so könnte ein schärferes Auge als das unsrige, aber noch unendlich stumpfer als das Auge dessen, der alles sieht, die Wirkung davon auf der Chinesischen Küste verspüren.“189 Und interessanter noch die Vorform des Gedankens in den „Sudelbüchern“: „Wenn eine Erbse bei Helvoet in die See geschossen wird, so würde ich wenn die See mein Gehirn wäre [Hervorhebg. K.R.] vermutlich die Würkung an der Chinesischen Küste verspüren.“190 Der Idee der freien Entfaltung der Individuen trug konsequent Rechnung der Utilitarismus, der erstmals einen Kalkül der Gesamtbedürfnisbefriedigung entwickelte: höchstes Glück der größten Zahl. Diese Idee, so konsequent sie die Individualisierung fortdachte, ist gleichwohl so vielfältiger Kritik begegnet, daß ein solcher Kalkül heute als theoretisch erledigt gelten kann und nur noch als ideologische Basis bestimmter ökonomietheoretischer Ansätze ein befristetes Dasein hat. Als Präferenzen der unberechenbaren Individuen sind sie Störfaktoren rationaler Theorienentwürfe. Dieser Pluralismus des Unvernünftigen macht allerdings die markt-kapitalistisch organisierten Gesellschaften aus. Demgegenüber hatte ein nicht am Begriff des Individuums, sondern an dem des Subjekts festgemachter Freiheitsbegriff Freiheit als Selbstbestimmung eines in seinem Kern vernünftigen Wesens bestimmt. Diesem Subjekt mußte Vernunft nicht beigebracht werden, sondern es war – wenn es sich nur selbst recht verstand – in sich vernünftig, und zwar genau so wie alle anderen und in Harmonie mit allen anderen. Ihre Freiheit schränkte daher seine Freiheit, nämlich zu vernünftiger Selbstbestimmung, in keinerlei Weise ein. Individualisierung kann jedoch in diesem Rahmenmodell nicht ausgelebt werden. Genau das hatte der späte Georg Simmel unter dem 189 G. Chr. Lichtenberg: Schriften und Briefe III, p. 264. 190 Dass. Sudelbücher I, p. 464. Stichwort des „individuellen Gesetzes“ als die Lebensfremdheit der Kantischen Moralphilosophie attackiert. Diese sei auf die Probleme des wirklichen Lebens, das ein Leben individualisierter Individuen sei, gar nicht anwendbar, sondern allenfalls auf abstrakte Strukturen des Handelns. Moralische Verpflichtung aber lasse sich nur denken als je individuelle Pflicht, nicht als ein abstraktes Sollen, geboten durch einen kategorischen Imperativ.191 Wie nun freilich das Individuum der Spätmoderne in der Chaotik seiner Antriebe zu so etwas wie einem es selbst verpflichtenden individuellen Gesetz kommen kann, das bleibt letztlich auch bei Simmel unklar. 192 Während Nietzsche das Problem noch unter Rekurs auf einen auch unter den Antrieben bestehenden Willen-zur-Macht, durch den sich schlicht der stärkste durchsetze, lösen konnte, entfaltete sich bei Simmel unter zunehmender Kant-Opposition aus Impulsen der Lebensphilosophie eine systematische Leerstelle, die bei ihm und bei anderen Lebensphilosophen durch Postulate eines ganz anderen „Individuums“, nämlich des Staats-Individuums, ausgefüllt wurde. In der Sozialphilosophie und Teilen der Soziologie wurde jedoch auch noch eine ganz andere als die irrational-etatistische Lösung bereitgestellt. Diese entfaltete sich entlang des Themas der Identität; sie läßt Individualität als Originalität des Arrangements in einem Ensemble von Rollen begreifen. Dabei löst sich die Vorstellung einer inneren, substantiellen Vielfalt des ineffablen Individuums auf. Vom ausdruckstarken Individuum avanciert es zum Jongleur. Das Individuum nach dem Muster des Genies konnte dieses Schicksal zum Konflikt mit der es umgebenden Gesellschaft gereichen und es in Isolation, Tragik und Wahnsinn treiben. Als Jongleur eines Rollen-Ensembles kann sich das postmoderne Individuum diese oder jene zu den Anforderungen passende Innerlichkeit leisten. Daß diese für es selbst zu einer Identität in Kontinuität gerät, ist nicht selbstverständlich und ist bei extremer Divergenz der Rollenanforderungen, wenn es sich ihnen hilflos ausgeliefert sieht, ebenfalls mit Tragik und Wahnsinn prämiert. 2.3.9 Individualisierung als Belastung Viele der Individualisierungsgeschichten der bürgerlichen Subjekte und Genies von Werther bis Kafka sind Leidensgeschichten. Das kann zwei Gründe haben: Entweder macht die Individualisierung die Subjekte zu Leidenden – oder Leiden individualisiert – oder schlimmstenfalls: beides trifft zu. Die romantische Medizin des beginnenden 19. Jahrhunderts hatte bereits Krankheit als individualisierende Normalexis- 191 G. Simmel: Lebensanschaung. Vier metaphysische Kapitel.- In: ders.: Gesamtausg. XVI. Frankfurt a. M. 1999, p. 209-425, 4. Kap.: „Das individuelle Gesetz“, p. 346-425. 192 Cf. M.-S. Lotter: Das individuelle Gesetz.- In: Kant-Studien 91 (2000), p. 178-203. tenz des Menschen verstanden. Und auch heute noch gelten Symptome als Individualisierungszeichen, so daß Individuen durch die Aufzählung und Erzählung ihrer Krankheiten sich als unverwechselbare Individuen qualifizieren können. Und manch eine der Psycho-Gruppen mag wohl das zum eigentlichen Thema haben, mittels sogenannter Selbsterfahrung Krankheiten und ihre Symptome zu finden bzw. zu erfinden. Denn Gesundheit ist ein Abstraktum 193, was wenn es eine solche Gesundheit gäbe, alle Menschen untereinander gleich machen würde. Jede Abweichung von der abstrakten Norm der Gesundheit wäre dann eine kranke Individualisierung. Also darf man sagen: je kränker, desto individueller. In all denjenigen Krankheiten freilich, die letal verlaufen, wird diese Aussage widersprüchlich; denn der Tod setzt der Individualisierung ein Ende, und am Ende sind alle gleich tot. Als Individualisierungsprozesse sind vor allem psychische Krankheiten interessant; denn nirgendwo sonst genießt ein Individuum so viel Anerkennung von und Zuwendung zu seiner Individualität wie in der psychoanalytischen Kur. Hier insbesondere, aber vielleicht auch allgemeiner sind nur dort Heilungschancen und Ansätze für eine therapeutische Kur gegeben, wo der Patient leidet und Abhilfe sucht. Soziales Individualisierungsgebot und individuelles Leidensgebot sind aufs Engste miteinander verbunden. So darf man sagen: Nur wer unter der Individualisierung leidet, ist therapierbar und in die Heilsgemeinschaft der Gesunden reintegrierbar. Geht man nun aber so weit, wie es viele der Spätmodernen tun, jeden Menschen als mehr oder weniger therapiebedürftig zu halten, dann ergibt sich der Umkehrschluß: Individualität ist eine Krankheit. Da aber Therapien der psychoanalytischen Art als Individualitätsverstärker wirken und man ja auch sagt, daß es noch keine einzige mit einer absoluten Heilung abgeschlossene psychoanalytische Kur gegeben hat, drängt sich die Frage nach einer Individualitätsentlastung auf, die sich nicht immer weiter in den Zirkel von Individualisierung, Leiden und Therapie verstrickt. Eine weitere Individualisierungsbelastung ist die individualisierende Ethik. Als Beispiel sei die Kantische Ethik gewählt. Ihr kann man sowohl eine das Individualitäts-Problem dramatisierende als auch eine entdramatisierende Interpretation geben. Die entdramatisierende besagt, daß der kategorische Imperativ nichts anderes bietet als ein Entscheidungskriterium für Maximen-Konflikte. Maximen, d.h. Handlungsregeln, die in Konflikt zueinander geraten, können daraufhin befragt werden, welche der Maximen die beabsichtigte Handlung zu einer sittlichen Tat machen würde. In dieser entschärfenden Interpretation hat die der Kantischen Ethik entsprechende Moral kaum etwas mit dem Individualitätsproblem zu tun. Der Handelnde wird durch 193 Lt. WHO ist Gesundheit „ein Zustand von vollständigem physischen, geistigen und sozialen Wohlbefinden, der sich nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung auszeichnet“; durch die Ottawa-Erklärung von 1986 wird als Handlungsziel der WHO deklariert, diese Gesundheit als „Gesundheit für alle“ anzustreben. die bloße Möglichkeit der Anwendung einer solchen Entscheidungsprozedur nicht weiter behelligt. Gewirkt hat die Kantische Ethik allerdings in der Form der dramatisierenden Interpretation, nach der der kategorische Imperativ – als Imperativ – eine andauernde Zumutung an die Handlungsorientierung der Handelnden darstellt. An sie als Individuen genommen ergeht die Sollensaufforderung der Orientierung ihrer Taten an der Idee des Allgemeinen, d.h. der Niederschlagung aller Individualität zugunsten einer transzendentalen Subjektivität. Ist das überhaupt möglich? Immerhin konnte auch Kant nicht beanspruchen, ein einziges Beispiel beizubringen, in dem unzweifelhaft aus Pflicht gehandelt worden wäre und nicht nur pflichtgemäß. Was ist, fragen die Kritiker, eine Sollensaufforderung wert, die möglicherweise noch nie realisiert wurde und daher vielleicht unrealisierbar ist. Ist das überhaupt möglich, fragte bereits Schiller, aber dann mit dem vollen Gewicht der Individualitätsproblematik Georg Simmel. Kann das allgemeine Gesetz die Individuen wirklich verpflichten, oder bedürfen wir nicht zur Verpflichtung der Individuen eines „individuellen Gesetzes“.194 In den letzten 100 Jahren kommt aber verschärfend hinzu, daß die Individuen auch Funktionsträger in Organisationen sind; in dieser Funktion sind sie ganz offensichtlich durch eine Ethik überfordert, die die Individuen auffordert, sowohl ihre eigene Individualität, deren Entwicklung und Pflege doch gerade in der Spätmoderne von ihnen erwartet wird, als auch diejenige ihrer Organisation, deren Funktionsträger sie sind, auf dem Altar eines über die Individuen und Organisationen hinausreichenden Allgemeinen (nämlich der Vernunft) zu opfern. Noch bevor das Individuum seine Individualität, dem Rufe des kategorischen Imperativs folgend, auf dem Opferalter des Allgemeinen niedergelegt haben könnte, wird es von der Organisation nach deren Kriterien behandelt sein und seine Individualität samt seiner moralischen Empfindlichkeit für Sittlichkeit neutralisiert werden durch Versetzung auf einen Posten und in eine Funktion, wo ein derartig sensibles Gewissen nicht weiter stören kann, z.B. als Nachtportier statt als Entscheidungsträger. Man kann infolgedessen nicht erwarten, daß die Sittlichkeit der Entscheidungen von Organisationen, selbst wenn sie von einzelnen Entscheidungsträgern getätigt werden, auf der Sittlichkeit solcher Funktionsträger beruht. Wenn Sittlichkeit von Organisationen möglich sein soll, was zu hoffen wäre, dann nur dadurch, daß Organisationen ihrem eigenen „individuellen Gesetz“ folgen, nicht auf so etwas Anfälligem und Kontingentem wie der Besetzung von Funktionspositionen mit gewissenhaften und sittlich gefestigten Personen angewiesen sind. Und genau deswegen haben sich ja Organisationen Verhaltenskodizes gegeben, an denen das Handeln der Funktionsträger im Hinblick auf die Stake holder ausgerichtet sein soll. Für Individuen und für Organisationen stellen sich demnach lediglich analoge und nicht auseinander 194 G. Simmel: Lebensanschauung, Kap. IV.: „Das individuelle Gesetz“, p. 346ff. ableitbare Probleme. Aber gerade das entlastet auch die Individuen von der Universalverantwortung letztlich für den gesamten Weltverlauf. Insofern ist es auch extrem wirklichkeitsfremd, einem Internet-„User“ die Verantwortung für die Inhalte aller durch links erreichbaren Folgeseiten seiner eigenen Seite aufzubürden. Die Philosophie des Individualismus baut auf der in der Moderne seit der Renaissance entwickelten Vorstellung des Individuums auf. Diese Philosophie ignoriert – oder abstrahiert entschlossen davon, daß der Mensch auf Sozialität hin angelegt ist und daß es vielleicht der Sinn des Sozialen zwischen den Menschen sein könnte, durch die Gestaltung dieses Zwischen durch die Zuweisung von Subjekten oder Individuen (oder gar Menschen) in Funktionspositionen des kommunikativen Textes das Wohl dieser Sub-jekte zu fördern. Aber auf dieser Abstraktion von fundierender Sozialität im Zwischen beruht die gesamte Tradition der individualistischen, d.h. atomistischen Philosophie und bringt so die Gesellschaftsvertragstheorien der Neuzeit hervor, die bis in die Spätmoderne bei Rawls und Habermas ihre unbestrittene Geltung beanspruchen durften. In ihrer Rekonstruktion sinnvoller und gerechter sozialer Verhältnisse unterstellten diese Theorien, daß Gesellschaft (als Prototyp des Sozialen genommen) als das Ergebnis einer Übereinkunft zuvor isolierter Gesellschaftsatome, d.h. Individuen verstanden werden könne und müsse. Die Beteuerung, daß es sich nicht um Beschreibung realer, historisch verortbarer Vorgänge handele, sondern um eine regulative Fiktion, nämlich wie man sich die Konstruktion eines Kriteriums der Gerechtigkeit zur Beurteilung realer Verhältnisse zu denken habe, nimmt dieser Konstruktion nichts von ihrer Problematik. Denn eine solche Konstruktion muß mindestens unterstellen, daß die Sozialität der Menschen akzidentell ist und einer Gründung oder Befestigung durch Verträge bedarf. Wäre Gott nicht auf die Idee verfallen, Adam eine Gefährtin (heiße sie nun in erster Ehe Lilith oder in zweiter Ehe dann Eva) beizugesellen, und wäre nicht Freitag bei Robinson aufgetaucht, so – das müssen diese Theorien unterstellen – wäre alles gut, oder wenigstens besser: die Welt wäre eine Welt ohne einen je zweiten Menschen und damit ohne die Notwendigkeit von Verträgen. Die dem Individuum seit Leibniz und Goethe zugesprochene innere Unendlichkeit, diese „black box“ des Behaviorismus, oder aber in einem anderen Theoriedesign dieses originelle Bouquet von Präferenzen – geht die „Sozial“philosophie des Kontraktualismus nichts an. Nach wie vor steht dem individualistischen Kontraktualismus eine sich von Aristoteles herleitende Philosophie entgegen, nämlich daß der Mensch ein zw~on politikón sei, ein animal sociale, wie die lateinische Übersetzung lautet. Diese Theorie besagt nicht mehr und nicht weniger als daß der Mensch seiner genuinen Konstitution nach auf andere bezogen ist sowohl in der Form der Gemeinschaft wie in der Gesellschaft oder Genossenschaft195 und daß nur das als eine gelungene Existenz bezeichnet werden kann, was im Vollzug diese Alterität realisiert. In dieser vormodernen Konzeption fragt sich nicht, auf welche Weise Soziales in die Subjekte eingreift (Foucaults Panoptikum196) und wie sich Strukturen des Selbst in sozialen Strukturen kristallisieren. Denn hier steht noch fest, daß die Sozialität in der Seele des Selbst angelegt ist, ihre eigentliche Bestimmung ist, so daß sich jeder psychische Prozeß nur im Sozialen, heute würden wir sagen im kommunikativen Text, als Sinngestalt schließt. Auf diese Weise sind auch in dieser vormodernen Theoriekonzeption die Dimensionen, die wir heute als die soziale Dimension und die diskursive Dimension (Sinn) des kommunikativen Textes bezeichnen, bereits angelegt. Es ist nicht beiläufig, daß in den obigen Beschreibungen vor allem Bezug genommen wurde auf gelingende soziale Prozesse. Mißlingende könnten gerade dadurch charakterisiert werden, daß in ihnen die psychosoziale Vermittlung scheitert. Wenn Menschen Vereinzelte, d.h. Individuen wären und zwecks Abwehr des Schlimmsten miteinander Verträge zugunsten eines Leviathan abschließen müßten, wäre das dieser Theorie gemäß eine auf Scheitern aufbauende Lebensform. Und wenn die in Marktform organisierte Gesellschaft ihrer Eigengesetzlichkeit des Tauschs sachzwanggemäß und alternativlos folgte und keine Menschen mehr, sondern nur noch homines oeconomici kennte, dann entbehrte eine solche Organisation des Sozialen jeglichen Sinns. Die postmoderne Sozialphilosophie des kommunikativen Textes versucht einerseits, der Funktionspositionalität von der Medialität her gerecht zu werden, aber andererseits das Medium selbst als sprachlich, d.h. als Text zu begreifen und nicht wie die Moderne als ökonomische Zirkulation von Geld im Tauschmedium. Die Geschichtsphilosophien des 19. Jahrhunderts hatten noch versichert, daß ungeachtet des Unglücks der Menschen der über ihre partikularen Interessen hinweggehende Sinn des sozialen Prozesses der Fortschritt sei – das glaubt heute keiner mehr, vielmehr wissen wir, daß jeder Fortschritt in einer Hinsicht einen Rückschritt in anderer mit sich führt. Beispiel: Atomenergie hilft, die CO 2-Belastung der Atmosphäre zu reduzieren, erzeugt aber in der Nähe der Atomkraftwerke das Risiko der Krebserkrankung der Menschen und macht im Katastrophenfall ganze Landstriche unbewohnbar. Die Schwundform des Historischen Materialismus, nämlich daß alle sozialen Prozesse durch eine ökonomische Basis bedingt sind, ist auch die Ba- 195 Als Genossenschaft ist eine soziale Verbindung zu bezeichnen, die auf dem gemeinsamen Genießen etwa einer Mahlzeit aufbaut; von der Gesellschaft unterscheidet sie sich dadurch, daß sie keine Verträge zur Grundlage hat, von der Gemeinschaft dadurch, daß sie zwar wiederholbar ist, aber nicht auf Dauer ausgerichtet ist. 196 M. Foucault: Überwachen und Strafen. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1977, p. 251ff. sisideologie des kapitalistischen Neoliberalismus. Vulgärmarxismus und die „Chicago-Boys“ sind sich einig: alle sozialen Prozesse finden ihre Sinnerfüllung in der Ökonomie; Wachstum des BIP ist das allgemein akzeptierte Maß des Erfolgs, ungeachtet des Scheiterns humaner Existenz.197 Ein Problem der obigen Ausführungen soll nicht verschwiegen werden, nämlich die starke anthropozentrische, d.h. in der Postmoderne nicht mehr zeitgemäße Ausrichtung. Denn Sozialphilosophien, die auf starken anthropologischen Annahmen beruhen, sind deswegen problematisch und leicht angreifbar, weil wir ja – wenn wir so ehrlich sind, es zuzugeben – im Grunde gar nicht wissen, was das „Wesen des Menschen“ ist, um dessen glückliche Erfüllung es zu gehen hätte, so daß die Erhebungen über Glück und Unglück sehr stark mit den Mentalitäten der Völker korrelieren, d.h. sehr subjektiv sind, und wir keine Chance haben, diese Angaben durch Rückbezug auf das „Wesen des Menschen“ zu objektivieren. Beispielsweise rangiert Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, auf dem Glücksindex relativ weit oben, jedenfalls auch höher als Deutschland. In den Anthropologien, die dem abzuhelfen versprechen, indem sie das „Wesen des Menschen“ fixieren, erhält sich oft etwas, was eher den Meinungen der Leute als einer haltbaren Philosophie entsprechen würde, was man also als eine „philosophy“ zu bezeichnen berechtigt ist, nämlich Überzeugungen, die weder begründungsfähig noch als bloße Meinungen begründungsbedürftig sind, weil ihnen gegenüber unter zivilisierten Bürgern lediglich Toleranz angesagt ist. 2.4 M ITTE , M IT Wegen der Medialitätszentrierung des Ansatzes einer postmodernen Sozialphilosophie anstelle einer Subjektzentrierung oder gar Anthropozentrismus fragt sich natürlich, was eigentlich ein Medium ist. Klar ist: ein Medium ist eine Mitte, aber wo eigentlich, bitte schön, ist die Mitte? Die Regieanweisung „Ab durch die Mitte“ des Theaters der Repräsentation in der Form der Guckkastenbühne führt immer nur in die Kulisse und letztlich in die 197 Einzig der Himalaya-Staat Bhutan hat seit 1979 das BNG (Bruttonationalglück) zur Aufgabe nationaler Wirtschaftspolitik erklärt (D. Brauer: Gross national happiness as development goal.- In: Development and cooperation 30 (2003), p. 288–292). Ähnliche Bestrebungen sind auf der Grundlage indigener Vorstellungen in den Verfassungen von Ecuador und Bolivien verankert. Das Centre for Well-Being der New Economic Foundation in London versucht, das Wohlbefinden der Menschen in unterschiedlichsten Ländern zu erheben; danach leben in dem pazifischen Inselstaat Vanuatu die glücklichsten Menschen der Welt. Mit zu den unglücklichsten Menschen zählen danach die Menschen in vielen zentralafrikanischen Staaten, aber auch in den USA und in Rußland. Garderobe des Schauspielers. Das scheint für eine medialitätszentrierte Sozialphilosophie nicht besonders zielführend zu sein, ist es in gewisser Hinsicht aber doch. Denn dieser Weg in die Kulisse (vorausgesetzt der Schauspieler kehrt nicht im Verlauf des Dramas zurück auf die Bühne) bedeutet das Ende der Repräsentation und die Freigabe einer Orientierung an Immanenz. Roman Polanskis letzter Film „Venus im Pelz“, aber auch etliche Filme von Jacques Rivette oder Woody Allens „Purple Rose of Cairo“ zeigen mit aller Deutlichkeit das Ende der Repräsentation, d.h. das Szenario „hier ist der Blick – dort ist das Erblickte; hier ist das Spiel – dort ist die Welt; hier ist die Frage – dort ist der Sinn“ trägt nicht mehr. Die Mitte repräsentiert nicht mehr, sie vollzieht Zuweisungen. Und es sind asymmetrische Zuweisungen. Selbst aber in dem Film „Venus im Pelz“, in dem die Asymmetrie, der Vorlage von Sacher-Masoch folgend, in Unterwerfung besteht, gerät die Unterwerfungs-Asymmetrie wegen des Fortfalls der Repräsentation in eine wechselnde, ambigue Asymmetrie. Der dirigierende Regisseur und Autor Thomas muß in der Probe den unterworfenen Severin spielen, und die sich der Regie unterwerfende Schauspielerin Wanda muß die unterwerfende Wanda (!) spielen. Wanda unterwirft sich durch Fortfall der Repräsentation und der immanenten Vermischung von Spiel und Leben nach und nach den Regisseur, bis hin zum dem Punkt, an dem sie ihren „Sklaven“, abweichend von der Vorlage, statt Gregor bei seinem Regisseur-Namen Thomas nennt. Dabei bleibt das immanentistische Spiel aber nicht stehen. Die unterwerfende Wanda zwingt den Unterworfenen Thomas dazu, die unterwerfende Wanda zu spielen – eine Meta-Unterwerfungs-Zuweisung. Die aristotelische Tugendanweisung der mesóthV führt vielleicht immer nur zur Mittelmäßigkeit.198 Glaubt man aber der politischen Propaganda, dann ist die Mitte überall: die sogenannten Volksparteien, die sich verbal-kontraintuitiv von den Populisten unterscheiden wollen, sehen sich allesamt in der Mitte. Eine andere politische Rhetorik verbietet die Mitte: wer nicht für uns, die Guten, ist, ist offen oder heimlich als Schurke verdächtig und gegen uns, die Guten.199 Zwischen der gebotenen Entscheidung für das Gute und der verwerflichen Anhängerschaft an das Böse 198 Eine andere Deutung findet sich bei Friedrich Schlegel: „Die wahre Sittlichkeit muß in d[er] Mitte zwischen eiserner Standhaftigkeit und Veränderlichkeit schwanken.“ F. Schlegel: Kritische Ausg. XVIII. München, Paderborn, Wien, Zürich 1963, p. 217. Daß sie zwischen diesen Extremen zu suchen sei, würde man ja wohl vermuten, aber Schlegel sagt, daß sie sich dort schwankend befindet, und das ist entscheidend: die Mitte ist instabil zwischen Stabilität und Instabilität: Blanchot hatte gesagt, daß die Mitte zwischen Sein und Nichts nichtiger als das Nichts sei. 199 Zur philosophischen Analyse dieser Topologie s. J. Derrida: Schurken. Frankfurt a. M. 2003. gibt es keine Mitte oder Vermittlung. Wieder andere beklagten kulturkritisch den „Verlust der Mitte“200. Maurice Blanchot schließlich nahm – in Absetzung von Kulturproduktion – für textuelle Kreativität in Anspruch, daß sie nie in der Mitte sein könne, weil sie nicht auf Kontinuität und Versöhnung aus sei, sondern unversöhnlich auf die Differenz im Extrem. Allerdings formuliert er auch einen ganz anderen, gerade am Extrem orientierten Begriff von Mitte, wenn er die Hegelsche Vermittlung von Sein und Nichts oder daß etwas „unmittelbar“ in sein Gegenteil übergeht, hinterfragt und mit Heidegger wissen will, was sich in dieser Mitte, die das Hegelsche Wörtchen „unmittelbar“ zukittet und verdeckt, befindet. Dort tut sich die „question la plus profonde“ auf, die Heideggersche „Grundfrage“ im Abgrund des Zwischen, es ist die Frage, die sich nicht stellt und die niemand stellt („Elle est la question qui ne se pose pas“), die aber sozusagen als Schatten alles Fragen begleitet.201 In der Mitte des minoischen Labyrinths – sagen die Griechen in ihrer kulturdifferenten Verkennung! – saß ein Halbstier, der Jungmänner und Jungfrauen verspeiste. Diesen Bären hat ihnen Theseus aufgebunden, der am Gängelband der Ariadne ins Labyrinth – ins Einweglabyrinth! – ging und als zu feiernder Held, der den Minotaurus tötete, wieder herauskam. Warum sollten wir diesem „Helden“ am Gängelband der listigen Ariadne Glauben schenken?202 Vielleicht war doch die Mitte des Labyrinths immer schon leer – nichtiger als das Nichts. Für Jahrhunderte stand die Erde in der Mitte des Universums bis – nicht der blinde Empiriker Galilei, sondern: – der Philosoph Cusanus kam und dafür sprach, 200 H. Sedlmayr: Der Verlust der Mitte. Berlin 1973 (zuerst Salzburg, Wien 1948). 201 M. Blanchot: L’entretien infini. Paris 1969, p. 20. Leider übersetzt der deutsche Übersetzer „la question la plus profonde“ durch „die tiefste Frage“ und verdeckt damit den ganz offensichtlichen Anklang an Heideggers „Grundfrage“, die Frage nach dem „Seyn“, die den seinsgeschichtlichen, anderen Anfang der Philosophie markiert, die sich auch bei Heidegger im Abgrund des Zwischen auftut. Cf. p. 12ff.; ders.: Das Neutrale. Zürich, Berlin 2010, p. 123; Heidegger unterscheidet die Leitfrage der seinsvergessenen abendländischen Metraphysik seit Aristoteles von der Grundfrage, der Frage nach dem gründenden (Ab-)Grund. M. Heidegger: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), p. 6; auch bei ihm ist die Grundfrage die ungefragte Frage, p. 230ff. 202 Noch Joseph Vogl, weil er die Struktur des Einweglabyrinths nicht berücksichtigt, glaubt, der Faden sei gerissen; M. Foucault: Der Ariadnefaden ist gerissen.- In: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder eine andere Ästhetik. Leipzig 1991, p. 408; er ist nicht gerissen, sondern er war von Anfang an überflüssig. J. Vogl: Über das Zaudern. 2. Aufl. Zürich, Berlin 2008, p. 76 – andere glauben, Ariadne habe sich letztlich an ihrem eigenen Faden erhängt, dagegen spricht die Ariadne/Arachne-Analogie, keine Spinne hat sich je in ihrem Netz erhängt. daß nicht irgendetwas Festes das Zentrum des Universums bilden könne, sondern: „Propter quod machinam mundanam habere aut istam terram sensibilem aut aërem vel ignem vel aliud quodcumque pro centro fixo et immobili variis motibus orbium consideratis est impossibile.“203 Die subtilen Begründungen, die einerseits das Prinzip der „coincidentia oppositorum“, hier den Zusammenfall von Zentrum und Peripherie, andererseits das Prinzip der „docta ignorantia“ in Anspruch nehmen, dürfen wir hier übergehen und nur auf die Konsequenzen hinsichtlich der Mitte hinweisen. Erstens kann jeder, wo immer er sich befinden mag, glauben und glauben dürfen, gerade er sei im Zentrum (seines Beobachtungsuniversums nämlich!). Gibt es also keine Mitte? Im Gegenteil und zweitens: die Mitte ist nicht dinghaft, sie ist kein mögliches Objekt. Die Mitte ist für Cusanus der in seinen Eigenschaften unbekannte Gott. Gott aber ist nicht ortbar, er ist nirgends und überall. Oder wenn wir diese Einsicht in Weltlichkeit übersetzen, müssen wir sagen: die Mitte ist geistig, oder anders: eine materielle Leere gibt Raum für eine ganz andere Mitte als es jedes Mittel je sein könnte. Sie ist ein Abgrund im Seienden. Und außerdem ist zu sagen, daß dieses Geistige in der Mitte von uns ein Prozeß ist (motus), und diese Mitte ist zwischen uns, keineswegs in uns.204 Ein anderer, Gott wohlgesonnener Denker, nämlich Kierkegaard, sprach davon, daß sich in der prozessualen Übergängigkeit der Mitte ein „Flor“ befände, der uns die Mitte verrätselt, so daß wir auch bei Kierkegaard eine „docta ignorantia“ hinsichtlich der objektiven Eigenschaften der Mitte antreffen. Fazit: Die eigentliche Mitte ist ein Geheimnis für alle, die selbst nicht die Position Gottes oder des Minotaurus einnehmen können. Xenon und alle, die ihm folgten, haben ein Problem mit der Mitte. Er ist ein typischer Grieche: von einem Ursprung ausgehend, möchte er – gehend – ein Ziel erreichen. Anders als die minoischen Labyrinth-Tänzer geht er methodisch vor und wählt den geraden, den kürzesten Weg, den er, um zum Ziel zu gelangen von Anfang bis Ende durchschreiten muß. Dazu muß er wie der Mann auf dem Drahtseil über den Niagara-Fällen sorgsam Schritt für Schritt gehen, keine Abwege, keine Umwege, kein Torkeln. Um aber zum Ende zu kommen, muß er durch die Mitte hindurch; diese aber erweist sich nicht als ein abstrakter Durchgangsort, sondern da begegnet ihm ein 203 Nikolaus von Kues: Philosophisch-theologische Schriften, hrsg. v. L. Gabriel. Freiburg 2014, I, p.390. 204 Zu Cusanus s. H. J. Ritter: Docta Ignorantia. Die Theorie des Nichtwissens bei Nicolaus Cusanus. Diss. Hamburg 1927; H. Blumenberg: Einleitung.- In: Nikolaus von Cues: Die Kunst der Vermutung. Auswahl aus den Schriften bes. v. H. Blumenberg. Bremen 1957, p. 7-69; K. Flasch: Die Metaphysik des Einen bei Nikolaus von Kues. Leiden 1973; ders.: Nicolaus Cusanus. München 2001; K.-H. Volkmann-Schluck: Nicolaus Cusanus. Die Philosophie im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1984. Hindernis, etwas Konkretes, das seinen abstrakt-methodischen Fortgang (ver)hindert, er muß also einen Umweg einschlagen oder ein Mittel in der Mitte verwenden, um die Mitte passieren zu können. Die Mitte ist für Xenon zum einem Problem geworden, dessen Bewältigung man sich zunächst einmal als Ziel, als Zwischen-Ziel setzen muß. Um zu diesem Zwischen-Ziel zu gelangen, muß man zuerst durch eine Zwischen-Mitte hindurch; und schon ergibt sich das gleiche Problem wie vorher: ein sehr konkretes Hindernis, das den methodischen Fortgang verhindert. Und so weiter und so weiter. Unmöglich konnte Xenon sein Ziel jenseits der Mitte je erreichen: lost in transition. Mathematiker erklären sein Problem für ein Scheinproblem und erklären dem in den Tiefen der Medialität verlorenen Xenon, wie solche Paradoxien der Kontinua entstehen und wie man sie mathematisch auflöst, bzw. vermeidet. Das hilft dem armen Xenon freilich gar nichts; seine Erfahrung läßt sich nicht abweisen: die Mitte hat kein Ende, nie kommt er jenseits der Mitte an den Anfang vom Ende. Er hat einen Schicksalsgenossen in jener Geschichte von Peter Bichsel, in der ein Mann zwar wußte, daß die Erde eine Kugel sei, es aber nicht glaubte und sich also auf den Weg machte, es auf methodisch saubere Weise zu überprüfen, d.h. durch einen absolut geradlinigen Weg um diese vermeintliche Kugel herum; denn dann würde er ja genau zu dem Punkt seines Ausgangs zurückgekehrt sein. Aber es türmen sich Hindernisse über Hindernisse auf, die er nicht durch Umwege umgehen kann, weil er dann ja vom methodisch vorgeschriebenen geraden Weg abirren würde. Sein Vorgehen ist eine Vervielfältigung der Mittel und der Mittel für Mittel usw.205 Auf seinem geraden Weg liegen ein Haus, das er übersteigen, ein Wald, dessen Bäume er überklettern, und ein Fluß den er überqueren muß, weil er den Geradeausweg nicht verlassen darf, ohne sein Untersuchungsziel zu gefährden. „Ich brauche ein Schiff … und ich brauche einen Wagen für das Schiff und ein zweites Schiff für die beiden Wagen und einen dritten Wagen für das zweite Schiff“, notiert er. Bichsel fährt fort. „Da der Mann aber nur einen Wagen ziehen konnte, brauchte er noch zwei Männer, die die andern Wagen ziehen, und die zwei Männer brauchten auch Schuhe und Kleider und einen Wagen dafür und jemanden, der den Wagen zieht. Und die Wagen mußten alle vorerst einmal über das Haus; dazu braucht man einen Kran und einen Mann, der den Kran führt, und ein Schiff für den Kran und einen Wagen für das Schiff und einen Mann, der den Wagen für das Schiff für den Kran zieht …“ Soviel also zum methodischen Vorgehen. Auch K.s Weg ins Schloß bei Kafka ist von der Art. Immer neue Hindernisse türmen sich auf seinem angestrebten Weg ins Schloß auf. Joseph Vogl interpretiert: 205 P. Bichsel: Kindergeschichten. Frankfurt am M. 1997, p. 12f. „… einerseits wird K. von nun an und im Verlauf der Romans niemals die Grenze überschreiten, nie vom Dorf ins Schloss gelangen, er wird immer wieder …‘abgelenkt‘, um an dessen Peripherie herumzustolpern. Andererseits konnte man gleich zu Beginn erfahren, dass man im Dorf bereits im Schloss sei…“206 Wenn wir Zielerreichung als Maßstab setzten und die Mitte als Mittel in Handlungen der Zielerreichung einsetzten, dann müßten wir, Xenon folgend, feststellen, daß wir niemals auch nur bis zur Mitte vorgedrungen wären, geschweige denn an das Ziel allen Handelns. Immer verbaut uns ein Mittel die Mitte. Die Neukantianer trösteten sich mit der Idee eines unendlichen Erkenntnisfortschritts, der sich asymptotisch der Wirklichkeit der Dinge annähere. Aber woher wissen sie das? Woher wissen sie, daß der Abstand zu den Dingen im Laufe des Erkenntnisprozesses geringer wird, daß wir also schon jenseits der jeweiligen Mitte und jenseits der Mitte zwischen der Mitte und dem Ende uns befinden? Xenon legte das Gegenteil nahe: in alles Bemühen, wenigsten zunächst die Mitte zu erreichen, verstrickten wir uns immer mehr in das Labyrinth. Der Abstand zu den Dingen wächst, je mehr wir uns um sie bemühen. Die Dinge verhalten sich wie pubertierende Töchter, je mehr wir uns bemühen, sie zu verstehen, desto unverstandener sind sie. Ist das nicht grauenhaft und ein Grund, sich mit Kleist das Leben zu nehmen, um wenigstens in jenem letzten Moment keine Mitte mehr vor sich haben zu müssen? Genau der Blick auf diese suizidale Unmittelbarkeit zum Ding an sich könnte ein Gespür dafür erwecken, daß Xenon im Grunde ein glücklicher Mensch ist: niemals kommt er ans Ende, das doch nichts anderes wäre als der Tod. Mit Odo Marquards „Skeptiker“ ist er nicht so sicher, daß Wissen immer besser ist als Nichtwissen, daß er zwar sucht, aber nicht unbedingt finden muß; denken wir uns also einen Xenon, der gar nicht über die Mitte hinaus will, der den Gedanken, daß die Mitte nur ein Mittel sei, für immer verbannt hat. Er genießt den Umweg, die Verzögerung der Zielerreichung. Er wird so zum Kulturwesen, das den kurzen Prozeß (der Gewalt, des Durchhauens des Gordischen Knotens statt eines Tüftelns) verabscheut. Im andauernden Unterwegs zur Mitte, das ja wegen der Vervielfältigung der Mitte eigentlich ein Unterwegs in der Mitte ist, kann verschiedenes passieren. Als Aktivität eines Subjekts gedacht, ist die umwegige Kultur der Mitte eine Kultur der Reflexion. Das ist im Wesentlichen die Struktur der Moderne gewesen, die wir offenbar zu verlassen im Begriffe sind. Auf die Verrechnungseinheit des Subjekts be- 206 F. Kafka: Romane und Erzählungen. Frankfurt a. M. 2004, p. 368-608: wer im Dorf übernachtet, übernachtet gewissermaßen im Schloß“, p. 368; J. Vogl: Über das Zaudern, p. 81. zogen, könnte es sein, daß dieses neu gedacht werden müßte, nämlich als ein verführtes Subjekt.207 Es kann aber auch folgendes passieren: Wir schweifen ab, wir verlieben uns in Details wie die Kinder, die erstmals den Sportwagen verlassen dürfen und mit den Eltern spazieren gehen. Sie vermeiden es, eine permanente Geduldsprobe für die Eltern, geradeaus zu gehen, um „das Ziel“ möglichst geradlinig anzustreben. Sie verweilen da und dort, verlassen den Weg, um irgendeinem Interesse heischenden Detail nachzugehen, necken die Eltern mit Umkehr usw. Descartes hat uns erzählt, daß der, der sich im Wald verirrt hat, immer geradeaus gehen müsse, um herauszufinden. Ich weiß nicht, in welcher Sorte von Wäldern Herr Cartesius sich je verirrt hat, es müssen orthogonal geordnete Forste gewesen sein, in denen sich dann allerdings nur Dummköpfe verirren können. Denn kein Rat als derjenige Descartes‘ ist unbrauchbarer für den, der sich in einem wirklichen Wald verirrt hat. Wer hier immer geradeaus geht, um der Verirrung zu entgehen, kann in einen Sumpf oder ein Moor geraten, und wenn er dann weiter Descartes‘ methodischem Rat folgt, wird er schon sehen, was er davon hat; wer immer geradeaus geht, kann auch an ein Dornendickicht wie um Dornröschens Schloß kommen, beherzigt er weiter Descartes‘ Rat, so wird es ihm ergehen wie all den Prinzen, die, aufgespießt und verhungert, in der Dornenhecke stecken; wer immer geradeaus ging, wird vielleicht an einen Fluß ohne Brücke kommen, ein Fluß der seinerseits nicht geradeaus, sondern bergab fließt nicht methodisch, sondern aleatorisch, in die Strukturen des Geländes eingepaßt, und er wird, wenn er denn kein verbohrter Cartesianer ist, einsehen, daß es zweckmäßig ist, diese Bewegung des Flusses zu imitieren; denn bekanntlich finden auch Flüsse aus dem Wald heraus. Die in ein Glas verirrte Biene wird, da sie methodisch wie ein Cartesianer vorgeht und immer geradeaus auf das Licht zufliegt, vermutlich nie herausfinden; die Fliege dagegen, die – unter Gesichtspunkten linearer Rationalität – völlig unsinnige Flugbewegungen ausführt, wird nach einer gewissen Weile herausgefunden haben. All das ist ein Plädoyer für den Umweg, wie ihn die eingesperrte Fliege nahm, um für eine Sympathie mit der Mitte zu werben und konkret: das Medium nicht länger als Mittel, sondern als Mitte zu verstehen. In der Mitte: das Medium – das soll heißen, das Medium als Mitte zu verstehen. Die Perspektivenveränderung geht überhaupt nicht mehr aus von Substanzen oder substantiell Seiendem, das dann akzidentell auch in Beziehungen eintritt, jener methodische Individualismus, der sich in der 207 K. Röttgers: Autonomes und verführtes Subjekt. .- In: Proteus im Spiegel. Kritische Theorie des Subjekts im 20. Jahrhundert, hrsg. v. P. Geyer u. M. Schmitz-Emans. Würzburg 2003, p. 65-85. politischen Philosophie als Kontraktualismus ausformuliert. Für ihn ist Medialität sekundär, ja er fingiert unter Umständen, daß die wahre „Mitte“ sich im Individuum befinde. Hier soll stattdessen von der Mitte: dem Medium ausgegangen werden, von jenem Zwischen, um nun zu sehen, welche Funktionen, welche Funktionspositionen, welche Relationen und Beziehungsprozesse mit ihren jeweiligen Resultaten von dieser Mitte aus definiert sind und dem jeweiligen Medium seine spezifische Struktur geben. Kehren wir also zurück zu Xenon, der immer noch nicht über die Mitte hinauskam – auch wenn die Mathematiker das Gegenteil behaupten. Wir haben – natürlich in Anspielung an Camus – gesagt, daß wir uns Xenon als glücklichen Menschen vorzustellen haben. Dieser glückliche Xenon ist immer bei der Mitte, er hat nicht mehr tief in seinem isolierten Inneren eine Intention entwickelt, nämlich anderswo zu sein, als er ist, und verwendete dann als Mittel seine Füße und was an Körper so mit diesen zusammenhängt, um dieses Ziel zu erreichen. Auch er ist unterwegs, ständig ist er unterwegs, aber in diesem Unterwegs im Zwischen ist er auch stets dort, wo er sein will. Darin gleicht der glückliche Xenon den Engeln. Auch sie sind den Paradoxien der Zielerreichung enthoben. Deswegen sind sie die perfekten Mittler.208 Die Mitte nicht verlassen zu können, ist demnach kein Fluch, sondern geradezu eine engelsgleiche Existenzform. Engel sind Mittler, insofern müßten wir eigentlich die Frage nach dem Menschen durch die Frage nach dem Engel ersetzen, die Anthropologie durch Angelologie – aber das wäre ein anderes Thema. Ausgehend von Heideggers Analyse des Mitdaseins in § 25 von „Sein und Zeit“, hat Jean-Luc Nancy eine Interpretation des Mit vorgelegt. Zu Recht sieht er in der Kategorie des „Daseins“ bei Heidegger nicht ein anderes Wort für „Mensch“; „Sein und Zeit“ ist keine Anthropologie, sondern eine Ontologie. Daher ist § 25 mit den Kategorien des „Mitdaseins“ auch nicht eine Analyse der „Mitmenschlichkeit“ angepeilt, was immer das heißen könnte. Dieser Paragraph, die einzige Stelle bei Heidegger, auf die sich eine Sozialontologie209 fundieren ließe, gibt dem vulgären methodologischen oder gar ontologischen Individualismus keine Anhaltspunkte. Heidegger hält den Ausgang von einer „Isolierung des ‚Ich’“ für ein Mißverständnis.210 Denn 208 K. Röttgers: Die Physiologie der Engel.- In: Engel in der Literatur-, Philosophie- und Kulturgeschichte, hrsg. v. K. Röttgers u. M. Schmitz-Emans. Essen 2004, p. 29-51. 209 Cf. auch K. Röttgers: Der kommunikative Text als Konkretisierung einer Sozialphilosophie des In-Zwischen.- In: Sozialnaja ontologija w strukturach teoretitscheskogo snanija. Ischewsk 2012, p. 62-70 (dort auch als russ. Übersetzung: Kommunikatiwnyj tekst kak konstrukzija sozialnoj filossofii "w-meschdu". 210 M. Heidegger: Sein und Zeit. 8. Aufl. Tübingen 1957, p. 118. die Anderen, das ist nicht der „ganze Rest der Übrigen außer mir“, sondern die Anderen sind diejenigen, „unter denen man auch ist“. Aber wiederum ist diese Beziehung auch nicht von der Art derjenigen zu den Dingen, unter denen man sich in der Welt befindet. Heidegger: „Das ‚Mit’ ist ein Daseinsmäßiges … Auf dem Grunde dieses Mithaften in-der-Welt-seins ist die Welt je schon immer die, die ich mit den Anderen teile. Die Welt des Daseins ist Mitwelt. Das In-Sein ist Mitsein mit Anderen. Das innerweltliche Ansichsein dieser ist Mitdasein.“211 Selbst wenn die Anderen, wie Heidegger sagt, „bloß herumstehen“, dann ist dieses Mitdasein immer noch etwas ganz anderes als die Vorfindlichkeit von Person-Dingen im Raum, der Andere in diesem Mitdasein ist kein „vorhandenes Menschending“.212 In einer kleinen Nebenbemerkung geht Heidegger sogar noch einen Schritt weiter: er stellt fest, daß sogar die eigene Weltbegegnung des Daseins nur durch „wegsehen“ von diesem Mitsein ermöglicht wird.213 Und so kann er resümieren, daß „das Dasein wesenhaft an ihm selbst Mitsein ist“214, mit der Konsequenz, daß dieses auch dann so ist, wenn die Anderen faktisch nicht vorhanden sind. Dann nämlich „fehlen“ sie. „Fehlen kann der Andere nur in einem und für ein Mitsein.“ Andererseits wird die Einsamkeit nicht dadurch behoben, daß andere Exemplare der Gattung homo sapiens neben mir im Raum sind. Zwischen „Mitsein“ und „Mitdasein“ unterscheidet Heidegger folgendermaßen: „Mitsein ist eine Bestimmtheit des je eigenen Daseins; Mitdasein charakterisiert das Dasein anderer, sofern es für ein Mitsein durch dessen Welt freigegeben ist. Das eigene Dasein ist nur, sofern es die Wesensstruktur des Mitseins hat, als für Andere begegnend Mitdasein.“215 Wie gesagt, dieser Paragraph ist der einzige, in dem das so klar gesagt wird, und Heidegger kommt nie wieder darauf zurück.216 Nancy behauptet nun, daß diese Gedanken eigentlich dazu hätten führen müssen, „Sein und Zeit“ neu und ganz anders zu konzipieren. Und er selbst macht sich daran, den „Sinn von Sein“ völlig neu zu formulieren. Lapidar und zugleich umwerfend heißt es: „Übrigens ist das Dasein wesentlich Mitdasein.“217 Er erklärt das Problem der Ko-Existenz für das experimentum crucis jedes anstehenden, ich würde sagen: postmodernen Denkens. Anders gesagt, hätte Heideggers Kernfrage sein sollen, „wie mehrere Dasein zusammen das Da sein können.“218 Drei Antworten sind möglich: 211 p. 118. 212 p. 120. 213 p. 119. 214 p. 120. 215 p. 121. 216 K. Röttgers: Kategorien der Sozialphilosophie. 217 J.-L. Nancy: singulär plural sein. Berlin 2004, p. 153. 218 l. c., p. 154. • • • Sie kommen zusammen vor, ihr Gemeinsames ist ein Konstrukt oder ein Projekt (so der moderne Mainstream-Individualismus); Sie bilden ein Kollektivsubjekt, ihr Gemeinsames ist von einer eigenen ontologischen Dignität (so der antimoderne Universalismus, aber auch gewisse Spielarten des Kommunitarismus); Sie durchkreuzen sich, berühren sich, vermischen sich – aber wie? Die ersten beiden Spielarten scheiden für Nancy aus. Diese beiden Spielarten sind daran zu erkennen, daß sie das Grundproblem der Sozialphilosophie stets benennen als „das Individuum und die Gesellschaft“ – oder schlimmer noch „das Individuum und die Gemeinschaft“, während die Grundfrage lauten muß: „Was geschieht zwischen uns?“ Die Option für den dritten Weg zwischen Individualismus und Kommunitarismus folgt Heideggers Denkspur. Dieser Weg nimmt Kontiguität (Nancy sagt „brutale Kontiguität“219), nimmt Nähe und Distanz, nimmt Berührung, Ansteckung, Anschluß und Verführung, nimmt Durchkreuzung und Eingriff als Schlüsselphänomene. Das Gewebe zwischen uns / mit uns ist kein Gegenstand. Daher war der Übergang der Rede vom Mittel (wie ein Werkzeug) über die Mitte (wie ein Raum) zum Mit zwangsläufig, als Präposition stiftet das Mit Beziehungen, ohne doch ein Ding (als Werkzeug) oder auch nur ein Raum zu sein; denn das Mit beinhaltet Nähe und Abstand zugleich – uno actu, d.h. in nicht quantifizierbarem Ausmaß von Nähe und Abstand. Oder Nancy: „Das Sein ist zusammen, und es ist nicht ein Zusammen.“ 220 Also darf man eigentlich auch nicht von dem Mit sprechen, „sondern man sollte einfach ‚mit’ sagen …“221 Wie dieses Gewebe, dieser kommunikative Text, zwischen uns analysiert werden kann, zeigt eine Heideggers Ontologie revidierende plurale Ontologie des Mit. Beim späten Heidegger tritt an dieser Stelle der Begriff der „Fuge“ ein.222 In der Fuge fügt sich Abständiges zusammen, ohne doch die Abständigen zu einer Einheit zusammenzuschmelzen oder die Fuge selbst als ein emergentes Etwas zu erzeugen. Die Fuge ist reine Relation im Zwischen. Wie die deutsche Frühromantik kennt Nancy kein transzendentales Ich, sondern eine Transzendentalität des Wir. Wir sind der Sinn, lautet bei ihm eine öfters gebrauchte Formel, was nun wiederum nicht heißen darf, daß jeder von uns allen für sich allein „den“ Sinn repräsentieren könnte, was ja die Grundunterstellung der Transzendentalphilosophie des Subjekts war, noch daß so ein jeden von uns trans- 219 l. c., p. 10. 220 l. c., p. 98. 221 l. c., p. 101. 222 M. Heidegger: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), p. 4-6, passim. zendierendes Wir konstituiert würde, das jedem von uns seinen Sinn verliehe. Vielmehr ist es der zwischen uns stattfindende Prozeß, der den transzendentalen Charakter hat. Nancy haßt jenes Wort, aber man wird es doch noch einmal verwenden dürfen: es ist der Kommunikationsprozeß, und wir sagen der kommunikative Text, in dem Abstand und Nähe der pluralen Singularitäten stattfindet und die Pluralität der Anfänge konstituiert. Man muß von Konstitution sprechen; denn erst mit dem Abstand – darin folgt Nancy offensichtlich den Philosophien der Differenz223 (Heidegger, Adorno, Derrida), mit dem Schritt aus der Präsenz, tritt eine sinnermöglichende Verzweigung ein. Folglich erhält die Formel vom Sinn des Seins bei ihm die Gestalt: „Das Sein kann nur als Mit-ein-ander-seiend sein, wobei es Mit und als das Mit dieser singulär-pluralen Ko-Existenz zirkuliert.“224 Das Zwischen in den singulär-pluralen Vorkommnissen ist kein konsistentes Etwas. Tatsächlich ist das Zwischen die Distanznahme und deren Resultat. Erst mit dieser enträumlichten Relationalität des Zwischen tritt Sinn auf, die reine kompakte Immanenz wäre ohne Sinn. Die in Abstand stehenden Singularitäten berühren sich,225 sie sind weder isoliert, entzweit, noch fallen sie in leerer Identität226 zusammen, noch bilden sie untereinander eine Kontinuität aus, noch interveniert die zauberhafte Berührung in ein schon vorab bestehendes Kontinuierliches hinein. Das Zwischen, oder sagen wir noch einmal, die Mitte ist kein Etwas, dessen Ort in der Mitte wäre. Die reine Relation der Kontiguität erst begründet die Positionen von Selbst und Anderem. Folglich sind in dieser Relation nicht erst zwei Dasein, die dann in Berührung träten oder es auch bleiben lassen könnten. Man muß vielmehr sagen: Wo Berührung ist, sind ipso facto Zwei in Ab- 223 J.-L. Nancy: Parallele Differenzen. Deleuze | und | Derrida.- In: ders. / R. Schérer: Ouvertüren. Texte zu Gilles Deleuze. Zürich, Berlin 2008, p. 31-50; cf. auch M. Blanchot: L’entretien infini, p. 128f.: dort spricht er in Deutung von Heraklit von „cet entre-deux et l’écart des deux“ und: „Au fond, ce qui est langage, ce qui parle essentiellement pour Héraclite, dans les choses et dans les mots et dans le passage, contrarié ou harmonieux, des uns aux autres, enfin de tout ce qui se montre et dans tout ce qui se cache, c’est la Différence ellemême, mystérieuse…“ (p. 129) Zu Blanchot äußert sich Nancy explizit in: Maurice Blanchot. Passion politique. Paris 2011. 224 J.-L. Nancy: singulär plural sein, p. 21. 225 „Daher ist unsere Kommunikation weniger einer Begegnung zwischen ‚cogitos‘ vergleichbar als einem Tanz, bei dem ab und zu Berührung möglich, aber auch Vertrauen nötig ist.“ S. Krämer: Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt a. M. 2008, p. 101f. als Referenz zu Ch.S. Peirce: Critical Common Sensism.- In: ders.: Philosophiscal Writings, hrsg. v. J. Bucherl. New York 1955, p. 268. 226 J.-L. Nancy: Identité. Fragments, franchises. Paris 2010. stand und Nähe. Alterität ist eine Konsequenz der Kontiguität. Weil Nancy die Ontologie im Ausgang von Heidegger neu schreibt, kennt diese plurale Sozio-Ontologie eine Vielheit der Ursprünge der Welt in der Vernetzung von Kontiguität. Die Alterität des Anderen ist sein anderer Ursprung der Welt. Die Unvermeidlichkeit der Koexistenz dieser Welten aber ist der Beweis der Nichtexistenz des Einen Schöpfergottes, der für sich allein schon und vor seiner Schöpfung existiert hätte. Wenn von Distanznahme und Abständigkeit die Rede war, so darf dabei nicht an die Entzweiung im Sinne des Deutschen Idealismus gedacht werden. 227 Entzweiung (als Vorläuferbegriff zu Entfremdung) ist ein kritisch angelegter Begriff, der vor der Kontrastfolie der Einheit und des Heils fungiert. Hier aber wird der Ursprung von vornherein als geteilter gedacht: Die Welt aller hat keinen Ursprung oder eben von vornherein mehrere, d.h. sie hat nicht den einen Ursprung, daher sagt Nancy lakonisch. „Der Ursprung ist ein Abstand.“228 Der Ursprung kommt stets im Plural vor, als die Ursprünge. Der Kern der von Nancy ausgerufenen neuen Ontologie lautet daher: „Also nicht das Sein zuerst, dem dann ein Mit hinzugefügt wird, sondern das Mit im Zentrum des Seins.“229 Spricht die Sozialphilosophie des kommunikativen Textes von Selbst und Anderem als Funktionspositionalitäten, so heißt es analog bei Nancy, daß weder vom Ich noch vom Subjekt mehr die Rede sein kann, sondern von reiner Ipseität, „die keine Beziehung von Einem ‚Ich‘ zu einem ‚Selbst‘ ist. Es ist weder ‚ich‘ noch ‚du‘, sondern lediglich das Unterschiedene einer Unterscheidung.“ 230 Von daher gibt es jenen transzendentalen Standpunkt nicht, von dem aus das Unterscheiden unterscheidungsfrei eingeführt werden könnte. Im kommunikativen Text zu sein, heißt Unterscheidungen zu vollziehen, so wie ein Phonem keinen Sinn in den Text mitbringt, sondern ihn aus den Unterscheidungen von anderen Phonemen bezieht. 227 Entzweiung, vor allem in seiner Interpretation der Modernität Hegels, war eines der zentralen Themen Joachim Ritters, s. vor allem J. Ritter: Hegel und die Französische Revolution. Kön 1957, auch mit Exkursen in: ders.: Metaphysik und Politik. Frankfurt a. M 1977, p. 183-255, s. dazu auch M. Schweda: Entzweiung und Kompensation. Freiburg 2013. 228 J.-L. Nancy: singulär plural sein, p. 40. 229 l. c., p. 59. 230 l. c., p. 62; dort auch ein Bezug auf M. Heidegger: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), p. 319. Jede Substantialisierung ist in der Ontologie ausgeschlossen. „Wir: jedes Mal ein anderer, jedes Mal mit anderen.“231 Um alle Reminiszenzen an den spätmodernen Existentialismus zu tilgen, ersetzt Nancy stellenweise den Begriff der Ko-Existenz auch durch den der Ko-Ipseität.232 Das Medium, mißdeutet als Mittel, gedeutet als Mitte, offenbart den Charakter des Mit. Selbst und Anderer kommen nur miteinander im Medium des Textes vor. Und deswegen – darin ist Nancy zu folgen – hat die soziale Ontologie wie jede Sozialphilosophie von der Präposition des „mit“ auszugehen. Selbst und Anderer als Funktionspositionen repräsentieren nichts, weil jede Repräsentation eine Ermächtigung voraussetzt. Selbst und Anderer präsentieren sich einander in ihrer Wechselseitigkeit und miteinander in ihrem Medium. 2.5 M ITTLER – E NGEL Z .B. „Du sollst dir kein Bildnis machen…“, sagte der Gott, der bei uns das Sagen hatte. Deswegen brauchen wir Mittler, die uns bildfrei ein „Bild“ von Gott ermöglichen, Vermittler, die an beiden Welten, seiner und unserer, teilhaben können und uns so den tiefen Abgrund überbrücken lassen. Einer von denen war Hermes, der Götterbote, jener Halbgott, der Schutzpatron der Kaufleute, Diebe und Hermeneuten ist. 233 Als Götterbote war er emsig unterwegs und nirgendwo so recht zu Hause; er überbrachte Botschaften oder Geld, jedenfalls verstand er sich wohl auf die Kunst der Übersetzung der Werte und des Sinns aus einer Welt in eine andere. Im Geld-Transfer bewerkstelligte er das durch Abstraktion, durch die später so genannte Tausch-Abstraktion; wie der Transfer im Übermitteln von Sinn gelang, d.h. wie Verstehen überhaupt möglich ist, das ist bis heute ein Rätsel. Noch rätselhafter ist die theologische Lehre vom Mittler, also von den Engeln. Das Buch Hiob nennt die Engel Gottes-Söhne. Und einer unter ihnen („aus tausend“) tritt ausdrücklich als „Mittler“ auf. Mit dieser Rolle hat er eine Doppelfunktion: Er verkündet den Menschen, wie diese durch Gehorsam gegen Gott recht tun sollen, und er bittet vor Gott um Gnade für die Menschen.234 231 J.-L. Nancy: singulär plural sein, p. 65. 232 l. c., p. 76; auch Heidegger hat sich stets vehement vom Existentialismus distanziert: „… mit der ‚Existenzphilosophie‘ habe ich nichts zu tun…“ M. Heidegger: Überlegungen VIIXI (Schwarze Hefte 1938/39) (Gesamtausg. XCV), p. 170, cf. p. 35: Existenzphilosophie als neuzeitlicher Subjektivismus. 233 M. Serres: Hermes. Bde. 1-5. Berlin 1991ff. 234 Hiob 33, 23. Philosophisch gesehen, beruht die Notwendigkeit des oder der Engel auf den Paradoxien der Unmittelbarkeit. Zunächst vermittelt er zwischen Gott und den Menschen, weil eine unmittelbare Beziehung zu Gott wegen seiner abgründigen Andersartigkeit nicht möglich scheint. Unzugänglich die ein absolutistischer Monarch oder der Herrscher der Azteken235 ist von ihm nur das Wissen einer negativen Theologie möglich, deren Wissen maximal das Bewußtsein der Unmöglichkeit der Unmittelbarkeit („docta ignorantia“ bei Nikolaus von Cues) ist. Aber wozu dienen dann die Offenbarungen, wenn der Gott in ihnen doch verborgen bleibt? Aber der Engel vermittelt nicht nur die Beziehungen zu Gott, die als unmittelbare nicht möglich sind, sondern er mischt sich – vermittelnd – auch in die Angelegenheiten der Menschen ein. So spitzt sich die Frage nach dem Vermittler zu: brauchen wir etwa, um mit unseresgleichen zu verkehren, einen Mittler, der uns tatkräftig dabei unterstützt, uns die Worte des Anderen verständlich zu machen? Ist Unmittelbarkeit ganz und gar unmöglich? Hatte unsere Mutter uns nicht verstanden, bevor noch jemand kommen konnte und sich als Dolmetscher oder Advokat des Babies aufspielen konnte. Und wünschen wir uns nicht insgeheim in diese paradiesische Unmittelbarkeit zurück, in der jede Hilfe eines vermittelnden Engels überflüssig ist? Noch heute würde ich mich dagegen verwahren, wenn jemand seinerzeit meine Rechte als Baby gegen meine Mutter hätte geltend machen wollen und würde ihm dieses ursurpierte Recht des Einspruchs nachträglich strittig machen. Da wäre ein Engel ein auszuschließender Dritter gewesen. Aber es war ja auch der Engel, der uns aus dem Paradies vertrieben hat, war das etwa wohlmeinend von ihm? Das läßt sich zusammenfassen in die Feststellung, daß Engel stören, sie sind Störer einer als möglich vorgestellten, gewesenen Unmittelbarkeit. Also wenn Engel Vermittler sind, Reparaturexperten für eine verlorene Unmittelbarkeit, sind doch auch sie es, die uns auf diese Weise Probleme zu lösen helfen, die wir ohne sie gar nicht hätten, m.a.W. die Engel haben auch eine diabolische, d.h. dazwischentretende Seite. Der Vermittler hat jeweils die Doppelfunktion, zu trennen und die Trennung zu heilen; denn die Mitte ist immer Nähe und Distanz zugleich. Steht hinter jeder Kommunikation auch der Traum eines unvermittelten, eines Vermittlers unbedürftigen Verstehens, ja des gemeinsamen Innestehens, so wäre doch auch die Realisierung dieses Traums das Ende aller Kommunikation, d.h. des kommunikativen Textes in der Mitte, im Medium. Denn kaum meinen wir vielleicht, einen Moment mystischer Einigkeit und Unmittelbarkeit erlebt zu haben, ist doch sofort die Vermittlung im kommunikativen Text gegenwärtig, die auf dieses Erlebnis reflektiert und es aus der Unmittelbarkeit reißt, in temporaler, sozialer und diskursiver Reflexion. 235 Dessen Macht beruhte auf der öffentlichen Anerkennung des Nichtgesehenwerdens, seiner Unsichtbarkeit, d. T. Todorov: Die Eroberung Amerikas. Frankfurt a. M. 1985, p. 89ff. Wenn Engel Gottes-Söhne sind,236 stellt sich sogleich die Frage nach der Mutter dieser Söhne. Für den Mensch gewordenen Gott ist die Frage nach monophysitischer Ansicht beantwortet: die „Gottes-Mutter“ heißt Maria. Aber wer ist die Mutter von Michael, Gabriel, Raffael und all den anderen? Selbst wenn es Adoptivsöhne Gottes sein sollten, erübrigt sich die Frage nach ihrer Mutter keineswegs und natürlich auch nicht die nach den Motiven, diese Söhne zu Adoption freizugeben. Eine mögliche Antwort bestünde darin, daß Jahwe nicht immer schon der einzige war und daß diese „Söhne“ ehemals Götter waren und dann als Unterworfene an Sohnes Statt angenommen wurden, wie in den Sklavenhaltergesellschaften die Sklaven der Unterwerfer durchaus die unterworfenen Fürsten oder Fürstenkinder sein konnten. Als adoptierte Unterworfene mußten die Götter a.D. nun dem Einzigen dienstbar sein. Einer weigerte sich, begehrte auf und wurde gewissermaßen im Sinne einer Generalprävention „gestürzt“, Satan hieß er. Im Dienstverhältnis zum Einzigen Gott war die Aufgabe der anderen ewige Lobpreisung und Anbetung oder aber eben, als Mittler in der gestörten Kommunikation zwischen Gott und Mensch aufzutreten. Nach Thomas von Aquin (dem „Doctor Angelicus“) sind Engel, im Unterschied zur menschlichen Natur gesehen, geistige Wesen. Aus anderer Perspektive betrachtet, kann diesen Mittelwesen zwischen Gott/Göttern und Menschen auch eine Körperlichkeit zukommen. Diese Körperlichkeit macht aber nicht ihre eigentliche Natur, bzw. ihr Wesen aus, also stellt Thomas fest, daß Engel Wesen sind, die in der Lage sind, einen Körper anzunehmen: „corpora assumant“.237 Man kann die Engel demnach auch Körper-Simulanten nennen. Wenn solche Körper-Simulanten gewisse Körperfunktionen ausüben, wie z.B. das Zeugen von Kindern, sind sie es am Ende nicht wirklich gewesen. So einleuchtend die Lehre von den angenommenen Körpern für Theologen sein mag, behebt diese Interpretation des Mittlertums doch nicht die philosophischen Schwierigkeiten, die mit einer Substantialisierung von Funktionen verbunden sind. Neben dieser „physiologischen“ Theorie der Körperlichkeit steht eine fast ebenso lange Tradition der Darstellung der Engel als Licht-Gestalten. Im Licht entzieht sich der Engel aus der Sichtbarkeit in die Unsichtbarkeit. Denn zwar macht das Licht sichtbar, die Dinge und Körper der sinnlichen Wahrnehmung nämlich, und zwar gibt es leuchtende Körper, aber das Licht selbst, in der Mächtigkeit seines Ursprungs, 236 So Buch Hiob 1,6; auch 2,1. 237 Thomas von Aquino: Summa theol. I, qu 51, 2.; wie das Annehmen von Körperlichkeit vor sich geht, erfahren wir bei Thomas auch: manchmal wird die Luft, die an sich ja immateriell ist, so sehr verdichtet, daß man die Luft sehen kann, als Wolke nämlich. Und so ähnlich sind auch die Engel physice nichts als „dicke Luft“: „et sic assumant corpora ex aere, condensando ipsum virtute divina…“ blendet. Die vielleicht überzeugendste Darstellung dessen findet sich in einem Gemälde von William Turner „Engel vor der Sonne“ (1846). Im „Purgatorio“ der „Göttlichen Komödie“ ist im zweiten Gesang von einer Lichterscheinung die Rede, die schneller als ein Vogel über das Meer fliegt: „un lume per lo mar sì ratto, che’l mouver suo nessun volar pareggia…“238 Das Licht wird immer heller: „rividil più lucente e maggior fatto“, aus ihm lösen sich weiter Lichterscheinungen wie ein Kranz, der sich dann als Flügel herausstellt. Erst dann folgt Dantes Auflösung der rätselhaften Erscheinung: „ecco l’angel di Dio…“ Je näher der Gottesvogel dem Betrachter kommt, desto intensiver und zuletzt unerträglich für die Augen wird das Licht, als Glanz, als Helle, als reines Weiß. Das Licht steigert sich bis zur Unsichtbarkeit für menschliche Augen: die Undarstellbarkeit des Engels als Lichtgestalt. Und schließlich ist auch, was unsichtbar ist, unsagbar. Als Körpersimulanten aber reden Engel; und wenn sie reden, sprechen sie die menschliche Sprache mit menschlicher Stimme. Dann überbringen sie eine Botschaft. Das kann eine Frohe Botschaft sein, ein eÙ Âgg®lion, es kann aber auch eine schreckliche Botschaft sein, so Rilke: „Ein jeder Engel ist schrecklich.“239 Was kann damit gemeint sein? Daß der Engel, der uns vom Paradies fernhält, ein schrecklicher sein muß, scheint klar, aber daß diese Aussage auf alle Engel zutreffen sollte, ist unverständlich. Massimo Cacciari, hat Rilkes „Duineser Elegien“ die „umfassendste Angelologie, die das 20. Jahrhundert kennt“, genannt.240 Das mag übertrieben klingen, aber daß sie gesteigerte Beachtung verdienen, ist kaum zu bestreiten. Rilke knüpft an die bei Dante und in den Bildern Turners manifeste Gestalt des Engels als einer Lichtgestalt an. Dieser Engel ist nicht wie alles Sichtbare beleuchtet, sondern selbst ein so mächtiges Licht, daß er zwar anderes zur Erscheinung bringen kann, nicht aber sich selbst. Ohne das Medium wäre Nacht (Nichts) zwischen dem Subjekt und dem Objekt, auch wenn uns die Subjektphilosophie der Moderne, insbesondere nach der Kopernikanischen Wende Kants, das Gegenteil hat weismachen wollen, nämlich daß das Objekt ein Effekt der Spontaneität des Subjekts sei, am krassesten vielleicht in der Figur der Setzung bei Fichte. Dieser Licht-Engel ist schrecklich, weil er nicht mehr zur Transzendenz anleitet, sondern durch sein Gleißendes den Übergang geradezu verhindert und den Erleuchteten auf Immanenz zurückwirft. Da aber der Mensch auf sein Transzendenz-Begehren nicht einfach Verzicht tun kann, ergibt sich so etwas wie das bei Tobias präfigu- 238 Dante: La vita nuova – la divina commedia. Das neue Leben – die göttliche Komödie, hrsg. v. E. Laaths. Berlin, Darmstadt 1958, p. 201. 239 Erste Duineser Elegie, R. M. Rilke: Das dichterische Werk. Frankfurt a. M. 2005, p. 803. 240 M. Cacciari: Der notwendige Engel. Klagenfurt 1987, p. 17. rierte Ringen mit dem Engel. Dieses Ringen ist insofern aussichtslos, weil dieser Engel ja nun gerade nicht mehr der Andere eines Selbst ist, nicht einmal der Fremde unserer Eigenheit.241 Immerhin war es ein Engel, der uns aus dem Paradies vertrieb und darüber wacht, daß wir nicht unversehens dahin zurückfinden. Im Neuen Testament ist es ein Engel, der Maria verkündet, daß sie den Heiland zur Welt bringen werde. Wie jede Rolle ist auch diese Rolle eines Engels zutiefst zweideutig; und jeder Versuch der Vereindeutigung zerstört die Idee des Mittlertums: Sowohl wenn man die Verkündigungsszene vulgär materialistisch deutet, als auch wenn man sie vulgär technizistisch/informationstheoretisch deutet, wird man der Vieldeutigkeit des Mittlertums nicht gerecht. Wir müssen vielmehr den symbolistischen und darüber hinaus den performativen Charakter der Botschaft hervorheben, wenn wir der Funktion des Engels im kommunikativen Text auf die Spur kommen wollen. Eine andere interessante Szene macht uns eine andere Rollenfunktion deutlich; ähnlich wie in der Vertreibung aus dem Paradies ist hier der Engel in die Übergängigkeit gestellt. Es ist die Szene am leeren Grab. Der Engel verkündet den Jüngern, daß es hier nichts zu sehen gebe außer der Stätte, an der der Heiland fehlt. Außer einer Lücke, der Spur einer Abwesenheit, gibt es nichts zu sehen. Auf das Fehlen verweisen die Worte des Engels, ansonsten gäbe es einfach nichts Bemerkenswertes zu sehen. Allerdings verkündet der Engel auch, wann und wo Jesus wieder erscheinen wird. Die bildliche Darstellung hat ein Problem mit der Nichtpräsenz, sie kann nur zeigen, was gerade nicht fehlt. Die Negation könnte sie nur indirekt verbildlichen. Die älteste erhaltene Darstellung dieser Szene in einem Mosaik in Ravenna zeigt in der Tat ...: nichts. Damit ist sie auf das Primat des Textes angewiesen, der den Gläubigen sagt, was oder wer hier fehlt. Spätere Darstellungen nehmen die doppelte Botschaft (hier und jetzt: nichts – aber zu anderer Zeit und anderswo: etwas, nämlich der über den Tod und seinen Raum und seine Zeit triumphierende Christus) in die Synchronizität einer Szene auf. Der Betrachter des Bildes sieht den Auferstandenen jenseits der Szene, in der die dargestellten Beteiligten seinerzeit nichts sehen konnten. Hier beansprucht die Bildlichkeit den Primat über den Text, indem sie das Unsichtbare, weil Abwesende sichtbar macht. Daher ist die Körperlichkeit des Engels vor allem ein Sujet, aber zugleich auch ein Problem eines bildlichen Denkens. 242 241 So im Prinzip noch C. G. Jung: Von den Wurzeln des Unbewußten. Zürich 1954, p. 175: „Wenn Engel nämlich etwas sind, so sind sie personifizierte Übermittler unbewußter Inhalte, die sich zum [sic!] Worte melden.“ 242 K. Nyíri: The Picture Theory of Reason.- In: Rationality and Irrationality, hrsg. v. B. Brogaard u. B. Smith. Wien 2001, p. 242-266; ders.: From Texts to Pictures: The New Unity of Science.- In: Mobile Learning: Essays on Philosophy, Psychology and Education, hrsg. In den Zeiten der Moderne, als man sich Funktionen nur als Attribute von Substanzen vorstellen konnte, weil man noch nicht medialitätszentriert zu denken gelernt hatte, mußte man sich fragen, wie denn Engel aussehen. Hatte man ursprünglich eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich der bildlichen Darstellung von Engeln geübt, so ist diese Zurückhaltung seit dem Konzil von Nicaea (787) geschwunden und die fromme Ikonographie der folgenden Jahrhunderte schwelgt geradezu in der bildlichen Darstellung von Engelskörpern. Doch was im Text offen bleiben konnte und in der reinen Funktionalität offen bleiben muß, das zwingt im Bild geradezu zur Konkretion. Seit dem achten Jahrhundert verfestigt sich die Bildkonvention, daß Engel Menschen mit Flügeln auf dem Rücken gleichen. In seinem Artikel über Engel, der sich zwischen den Lemmata „Liebe“ und „Menschenfresser“ in seinem „Dictionnaire philosophique“ findet, meinte Voltaire zu wissen, daß Engel Flügel auf dem Rücken hätten, sie aber bisweilen auch unter ihren Gewändern versteckten, aber wo sie sich aufhalten, weiß er nicht, ob in der Luft, im Leeren oder auf den Planeten.243 Wir gehen hier nicht weiter auf die vielfältig zugeschriebenen körperlichen Attribute der Engel ein, auch nicht weiter auf die im Buch Henoch kolportierte Überzeugung, daß die Engel durch Menschentöchter verführbar seien, was letztendlich dazu genötigt haben soll, daß Frauen in der Kirche eine Kopfbedeckung zu tragen hätten,244 damit nicht die in der Kirche vermutlich gehäuft anwesenden Engel durch die Haarpracht weiblicher Wesen in Erregung versetzt würden. 245 Aber überlegen wir in der Sache noch einen Schritt weiter. Damit ein Wesen verführbar sein kann, muß es eine Seele mit Eigenschaften wie Willensfreiheit haben. Willensfreiheit heißt Labilität oder für die Umwelt: Kontingenz und deswegen Verläßlichkeit erst durch eine transsubjektive Normativität. Und in soteriologischer Hinsicht ist Willensfreiheit die Chance der Bewährung. Kann ein Wesen, das labil, unverläßlich und bewährungspflichtig ist, von den Menschen als Mittler (zu Gott) angesehen werden? Allenfalls könnte ein solches Wesen eine Vorbildfunktion erfüllen, wenn es nämlich sich tatsächlich bewährt; im kommunikativen Text hätte es die Position eines (besseren) Selbst und, insofern man sich auf es bezieht, die eines (förderlichen) Anderen, aber es hätte mit Sicherheit nicht v. K. Nyíri. Wien 2003, p. 45-67. Sybille Krämer sagt daher zu recht, daß der Engel die Abbildung des Problems der Abbildung sei. S. Krämer: Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, p. 133ff., mit der Konsequenz, daß die Erscheinungsweise des Engels die Bildlichkeit ist. 243 Voltaire: Dictionnaire philosophique, ed. R. Naves. Paris 1954, p. 24. 244 Berichtet von C. G. Jung: Gesammelte Werke. Solothurn, Düsseldorf 1995, XIII, p. 90f. 245 M. Cacciari: Der notwendige Engel, p. 39: „Hier ist es der Mensch, der den Engel die Sünde lehrt.“ eine rein mediale Funktion, wie es sich hier für uns allmählich als die eigentliche Funktionspositionalität des Engels herausstellt. Dürfen wir uns wirklich vorstellen, daß der, der uns aus dem Paradies vertreibt, durch Verführbarkeit bestechlich sein könnte, daß uns also durch die Verführungskunst eines uns hilfreichen weiblichen Wesens (nach dem Vorbild von Ariadne) die Rückkehr ins Paradies offenstünde?246 Oder daß wenigstens den Frauen unter uns durch Verführung eines Engels die Rückkehr ins Paradies möglich wäre? Oder: dürfen wir uns wirklich vorstellen, daß der Engel der Verkündigung durch Maria verführbar gewesen wäre?247 – An letzterer rhetorischen Frage ist ablesbar, daß ein solcher „Engel“ anderes oder mehr als ein Überbringer einer Botschaft gewesen wäre. Einem solchen Wesen müßte man dann Substantialität, ja materielle Körperlichkeit zusprechen und nicht allein Medialität. Kehrt man diesen Befund um, so kommen wir zu dem bedeutenden Satz: Sobald wir einem Engel Substantialität zusprechen, sehen wir mehr als einen Engel in ihm. Damit ein Engel ein Engel bleiben kann, darf er nicht mit substantiellen Eigenschaften ausgestattet in unsere Vorstellung Einlaß erhalten. Und die erste prekäre Eigenschaft dieser Substantialität wäre die Willensfreiheit. Sobald wir einem Engel Willensfreiheit zusprechen, verdammen wir ihn zum Fall. Nur unverantwortliche Engel bleiben rein. Zurechnung erzeugt Schuld. Die Verführbarkeitszurechnung rechnet zugleich Willensfreiheit zu und damit Substantialität im Prozeß. Einen Engel verführen, heißt demnach, ihm eine Seele machen. Da aber jede Verführung auf Gegenseitigkeit beruht, ist der verführte Engel unser Verführer.248 Im Prozeß der Verführung – abstrakter: der Substantialisierung – wird der Engel zweideutig. Deswegen ist die Formel von Thomas von Aquin so folgerichtig. Es ist nicht in das menschliche Belieben gestellt anzunehmen, die Engel hätten einen Körper und dann volitiv/normativ festzulegen, wann diese menschliche Körperlichkeitszuschreibung zutreffen soll und wann nicht. Nur in der Medialität selbst, nicht im subjektiven Wollen kann der Ursprung der Substantialitätsgenese liegen. Engel gibt es, weil nicht alles, was zwischen uns ist (das Medium, das Mittlere) 246 J. A. Comenius: Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens. Jena 1908. Nach Comenius ist diese Welt ein Labyrinth, und außerhalb befindet sich das Paradies. 247 Cf. jedoch den linken Seitenaltar der Pfarr- und Wallfahrtskirche „Mariä Krönung“ in Lautenbach/Rechtal mit einer Darstellung der Verkündigunsgszene aus der Schule Grünewalds, die in der Tat in den Mienen des Engels einen Abglanz dieser Lüsternheit erraten läßt (den Hinweis darauf verdanke ich Christoph Hubig). 248 Cf. auch M. Cacciari: Der notwendige Engel, p. 43, über Tobias und den Engel: Es ist, “…als ob sich beide wechselseitig und zugleich führen und verführen würden.“ das Produkt freier subjektiver Willensentschließungen ist. Anders als die Vertragstheorie der Moderne sich das zurechtgelegt hatte, ist der kommunikative Text kein Resultat einer Übereinkunft. Kant hat gesagt, daß die Engel, er weiß nicht warum, wenig von sich zu reden geben.249 Das ist richtig, aber auch gar nicht verwunderlich. Der Bote muß hinter der Botschaft zurücktreten. Auf die Botschaft, d.h. auf den Text kommt alles an. Die angenommene Körperlichkeit ist daher kein sonderlich interessanter Gegenstand des Textes, vor allem nicht für den Engel selbst. Können Engel lügen? Wir könnten freilich die harmloser erscheinende Frage vorschalten: Können Engel Geheimnisse haben? Ist es (mythengenealogisch gesprochen) denkbar, daß der Engel zu Maria tritt und ihr verschweigt, daß sie den GottesSohn zur Welt bringen wird? Ist es denkbar, daß der Engel am leeren Grab den Jüngern irgendeine erfundene Mär über den Inhalt des Grabs erzählt? Wenn wir diesen Befund verallgemeinern, dann läßt sich sagen: Der Diskurs der Engel ist ohne Möglichkeit zu Alternativen (Verschweigen, Lüge, Kritik, Poesie), und zwar nicht aus moralischen, sondern aus epistemischen Gründen. Daß Engel Mittler sind, ist unzweifelhaft. Sie geleiten uns über den tiefen Abgrund, der uns von der Gottheit trennt. Daher müssen sie in gewisser Weise Mischwesen sein, die in beiden Welten zu Hause sind – oder in keiner so richtig. In der Mittelstellung (Medialität) können wir drei Formen unterscheiden: Repräsentation Symbolisierung Performanz. In der Repräsentation steht eines für ein anderes, das nicht da ist, oder für einen anderen, in dessen Auftrag jemand dann zu handeln befugt ist. Die Repräsentation setzt normalerweise die Nicht-Präsenz des Repräsentierten voraus, so daß wir eine Separation zweier Örter, zweier Zeiten oder gar zweier Welten vorauszusetzen haben, wenn wir von Repräsentation reden wollen. Für unseren Zusammenhang wichtig ist, daß der Mittler als Repräsentant die Trennung zweier Welten voraussetzt: er kommt von anderswoher und vertritt einen, der anderswo bleibt. Solange seine Aufgabe besteht, bleibt auch der Repräsentant unter uns. In der Funktion der Symbolisierung (oder Diabolisierung) dagegen sind die Engel tätig. Das Symbolon ist im alten Griechenland die zerbrochene Scherbe, deren Bruchkante das Erkennungszeichen von zwei Zusammengehörenden (Freunden nach langer Trennung z.B.). Symbolisierung ist also das erkennende Sichzusammenfügen zweier Getrennter. Für den Engel sind Trennung und Bruch Voraussetzungen eines 249 I. Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.- In: ders.: Gesammelte Schriften VI, p. 119. Tätigkeitsfeldes. Wenn Eheleute zerstritten sind, ist das die Stunde der psychologischen Eheberater, wenn Mensch und Gott durch einen Abgrund (Sund, Sünde) getrennt sind, ist das die Stunde der Engel. Weder Psychologen noch Engel heilen, sie vermitteln lediglich durch Zusammenfügen der vormals Getrennten die Selbstheilung der Beziehung. Die Mittler versprechen die Neueinrichtung der Unmittelbarkeit. Aber sie können nichts als versprechen, bewirken können sie sie nicht, sie bringen bloß eine Botschaft, so wie kein Eheberater einen Konflikt heilt, sondern lediglich die Möglichkeit der Konfliktbeilegung in Aussicht stellt. Nichts als Worte, bloße Worte: der reine kommunikative Text mit Designationswert ohne Wirkung. Das erst leistet die Performanz, d.h. derjenige Text, der zugleich eine Handlungsform ist. Damit aber haben wir auch schon das Aufgabenfeld der Symbolisierung/Diabolisierung verlassen, das das Feld der Engel war. Kein Engel könnte, ja dürfte sagen: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Engel stellen lediglich einen in Aussicht, der das sagen dürfte.250 Damit Performanz glaubhaft sein kann, muß es die Möglichkeit der Inkarnation geben, d.h. daß das zuvor reine Wort zur Tat wird. Es sei erinnert an Fausts Übersetzungsversuche des Beginns des Johannes-Evangeliums, insbesondere an den letzten Versuch, der „logos“ mit „Tat“ übersetzen möchte oder gleichsinnig an die 11. These zu Feuerbach von Karl Marx. Die Dogmatische Konstitution des II. Vatikanischen Konzils erklärt: „... Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist.“ Dieser Mittler ist – anders als die Engel – zugleich Inkarnation; er ist das Wort, das zum „Fleisch“ geworden ist, der Text, der zum Leib wird (zwei Instanzen einer Phänomenologie des Zwischen, d.h. der Medialität). Da die Engel nicht lügen können, ist die andere Seite derselben Beziehung, daß wir den Worten des Engels glauben (müssen). Insofern wir sicher sind, eine EngelsBotschaft erhalten zu haben, können wir nicht anders, als ihr zu glauben. Etwas anderes ist es, ob andere ebenfalls an sie glauben. Als Jeanne d’Arc glaubte, der Engel habe zu ihr gesprochen und sie beauftragt, und als die Kirchenoberen ihr dieses nicht glaubten und auch sie von dem Glauben abbringen wollten, da haben sie nicht gesagt, Jeanne bilde sich das nur ein (denn die Einbildungskraft ist ein Rezeptorium für das Sprechen des Engels), sondern sie fragten sie, woher sie denn wisse, daß es nicht der als Engel verkleidete Satan gewesen sei. Denn beide Typen von Körper-Simulanten operieren auf gleiche Weise: was wir von ihnen sehen, ist nicht ihre wahre Natur, sondern eine unseretwegen angenommene Sekundärnatur. Die alleinige Bürgschaft für die Wahrheit der Botschaft ist die Inkarnation. 250 Zum Verhältnis von Botschaft und Inkarnation, die gespiegelt ist in dem Verhältnis Hermes / Jesus, s. M. Serres: Die Legende der Engel. Frankfurt a. M., Leipzig 1995, p. 279ff.; cf. ders.: Variations sur le corps. Paris 1999, p. 84ff. Inkarnation ist das Ereignis nicht-sprachlicher Art, das das Versprechen der Botschaft einlöst, d.h. wahr-macht. Bei Sprachspielen wie z.B. Befehlen ist der Sinn des Sprachspiels erst dann erfüllt, wenn der Befehl ausgeführt wird. Wenn ein Imperativ debattiert oder analysiert wird, wird sein bindender Befehls-Charakter infrage gestellt, d.h. ob dieser sprachliche Imperativ als ein Befehl gelten solle. Performanzen haben ihren Handlungssinn im Text selbst (als Handeln), Inkarnationen aber transzendieren den Text. Wenn wir nun die Engel in dieses Schema eintragen, so müssen wir sagen, daß den Engeln folgende Eigenschaften zugeschrieben werden. Sie überbringen Botschaften, die reine Informationen sind, und sie überbringen Verheißungen, die – aus menschlicher Perspektive –251 gedeutet werden müssen als Versprechen über zukünftige Zustände oder Ereignisse, aber andererseits sind die Botschafter nur dann Engel, wenn wir ihren Botschaften in einer Weise glauben, daß ihre Verheißungen für uns den Wert von Versprechen haben. Wenn wir die Botschaften als Engels-Botschaften akzeptiert haben, dann sind sie für uns mehr als bloße hoffnungsvolle und schöne Worte. In der Fähigkeit zur Performanz müssen wir den Paradies-bewachenden Engel deuten. Philosophisch gesehen, ist dieses nicht eine Person, die mit einem Flammenschwert herumfuchtelt, um physice die Rückkehr ins Paradies zu verhindern. Sondern es ist die Wirklichkeit der Rede, die als Rede die paradiesische Unmittelbarkeit immer schon ausgeschlossen hat.252 Die Idee, daß eine Inkarnation möglich sei,253 daß also das Wort zu Fleisch wird, ist die Idee, daß jenseits aller Vermittlungen eine erlösende Unmittelbarkeit (das Heil des Heilands) winkt. In dieser menschlichen Welt, die wir bewohnen und durchwandern, ist auch die geglaubte Inkarnation in der Gestalt des Heilands nichts anderes als eine Form des Mittlertums. Insofern ist allerdings, philosophisch gesehen, der Glaube an den Engel leichter und naheliegender als der Glaube an den inkarnierten Christus. Der Glaube an den Engel bleibt rein textimmanent, während der Glaube an Christus der Glaube an die Möglichkeit der Texttranszendenz zur Unmittelbarkeit hin ist, und das erfordert ein größeres Vernunft-Opfer. Für den Alltagsverstand verhält es sich freilich umgekehrt. 251 Aus Engels-Perspektive sind es Informationen aus der Zukunft; aber da die Zukunft offen ist, ist diese Perspektive philosophisch unzulässig. 252 Zu W. Benjamins Sprachphilosophie in dieser Hinsicht s. Chr. Hubig: Die Mittlerfigur aus philosophischer Sicht.- In: Wissenschaft und Transzendenz, hrsg. v. G. Abel. Berlin 1992, p. 49-56. 253 M. Serres: Die Legende der Engel, p. 279ff.; ders.: Die fünf Sinne. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1994, p. 165ff. Er vertraut eher der Körperlichkeit als einem Wort, eher einer zärtlichen Geste als den Worten „Ich liebe dich“. Wenn der Dritte ein Vermittler genannt zu werden verdient, dann deshalb, weil er die Indirektheit als Beziehungsform zwischen dem Selbst und seinem Anderen einführt. Dadurch kann er in Konfliktfällen vermitteln, er kann aber genauso gut den Konflikt überhaupt erst hervorrufen. Für etwas ist die unmittelbare Sicht ganz ausgeschlossen, nämlich für ein Selbst. Ein Selbst kann sich nicht selbst sehen oder zum Gegenstand eines Handelns machen, es kann lediglich sich selbst als Anderen sich verständlich zu machen versuchen. Aber auch das ist meistens ausgeschlossen, nämlich daß man sich selbst versteht ohne den Anderen, daß man im Hinblick auf sich selbst handelt, ohne Vermittlung (Selbstoperation). Daher sagt Jacques Derrida, daß ein Selbst sich selbst versteht mit der Stimme eines Anderen, und zwar eines Boten, eines Engels; auch das gilt, wie man weiß, ebenso für das Verstehen des Anderen, letztlich das Verstehen Gottes: immer braucht es die Vermittlung durch den Engel. Zwar unterstellen die Gläubigen, daß sie von Gott (unmittelbar) gesehen werden („Ça me regarde“ – analog zu Lacans „Ça parle“, das Es spricht254), aber wie er das macht und ob und wie wir das imitieren oder simulieren könnten, wissen wir nicht: dazu brauchen wir die Götterboten.255 An die Stelle des Bewußtseins, von Gott gesehen zu sein, ist in der Postmoderne die allseitige Beobachtung durch Internet, Kundenkarten, Kreditkarten und Überwachungskameras getreten, d.h. pure immanente Beobachtungsmedialität, ohne daß freilich bewußt geworden wäre, daß das moderne autonome Subjekt damit durch ein medial definiertes Profil ersetzt worden ist. Wie aber müssen wir uns die Kommunikation der Engel untereinander vorstellen? Menschliche Kommunikation dient und wird getragen vor allem von der Erzeugung, der Ausräumung und der Tolerierung von Mißverständnissen und ist damit die Kultur von Umwegen und die Vermeidung der Nichtkommunikation in Mystik und Gewalt. N. Luhmann schreibt: „Der Sermon der Engel führt zu nichts.“256 Ich glaube, Luhmann hat recht. Der Sermon der Engel führt zu nichts, weil sie als reine Botschafter untereinander keine kommunikativen Konflikte, Diskordanzen etc. erzeugen können, die auf Mißverständnisse hinauslaufen, die anschließend auszuräumen wären. Mystik und Gewalt brauchen Engel nicht durch Umwege in Kommunikation zu vermeiden; denn beide entstehen aus einem Abbruch von Vermittlungen, aus der Option für reine Unmittelbarkeit. Als Mittlern stehen den Engeln diese beiden Optionen nicht zur Verfügung. Dagegen wäre es eine müßige Frage, ob nicht das Verhältnis 254 Cf. dazu K. Röttgers: Ça parle – Wer sagt das?- In: Diesseits des Subjektsprinzips, hrsg. v. Th. Bedorf u. St. Blank. Berlin 2001, p. 69-85. 255 J. Derrida: Donner la mort. Paris 1999, p. 126ff. 256 N. Luhmann: Soziologische Aufklärung VI. Opladen 1995, p. 266. der Engel zu Gott ein mystisch-unmittelbares sei. Wer so fragte, scheint vergessen zu haben, daß die Frage nach den Engeln keine Frage nach den Relata einer Relation, sondern eine Frage nach der Relation selbst ist. Zwar können selbstverständlich auch Relationen in Relationen eintreten, damit würden sie jedoch nicht aufhören, Relationen zu sein. Auf die Bildung von Meta-Engeln werden wir später zurückkommen. Ganz im Gegensatz zum Bewußtsein der Zeit und ihrem barbarischen Kult der Unmittelbarkeit ist es tatsächlich so, daß die Vermittlungen (Medialitäten) zunehmen – die Engel nehmen allmählich überhand. Und zu ihnen gesellen sich die Meta-Engel. Diese – ein glücklicher Ausdruck von M. Schmitz-Emans257 – werden u.a. deswegen nötig, weil die Diskrepanz zwischen dem Überhandnehmen von Medialität einerseits, dem parallel dazu zunehmenden Kult der Unmittelbarkeit andererseits nach einer Vermittlung ruft. Offenbar hat der einfache Engel versagt, seiner Botschaft wird mißtraut, er scheitert an der aufgetragenen Vermittlungsleistung. Man nimmt ihm nicht mehr ab, daß er aus dem Überbringen der Botschaft keinen eigenen Nutzen ziehen will. Seinem Auftrag nach sollte der Engel einer sein, der als Dritter durch Symbolisierung eine Beziehung heilt. Man mißtraut ihm aber und unterstellt ihm eine Diabolisierung aus parasitärem Interesse. Ein Parasit macht schöne Worte wegen eines materiellen Vorteils: um Brot, Käse oder Wein zu ergattern. Aber Engel vermitteln ohne parasitäre Ambitionen – und weil wir das nicht mehr glauben können, verschwinden diese Engel. Denn daß jemand uns ausnutzen will, verstehen wir, aber das jemand das nicht will, ist so schwer zu verstehen. Die Durchökonomisierung aller Relationen258 läßt keinen Platz für eine Funktionspositionalität ohne Parasitismus. Selbst wenn wir die Vorstellung des Ausnutzens von allen moralischen Bewertungen befreien, wenn wir uns den Säugling an der Mutterbrust oder das Finanzamt als Prototypen vorstellen, ist die Asymmetrie der Beziehungsbeziehung offenkundig. Anders der Engel: er gibt uns kein Geld, aber nimmt uns erstaunlicherweise auch kein Geld (oder Brot, oder Käse oder Muttermilch) ab. Er übermittelt eine Botschaft und er vermittelt eine Beziehung, die auf etwas anderes gegründet ist als die Ökonomie des Mangels. Am Ende geht es in unseren postmodernen und postindustriellen Gesellschaften immer weniger um die Distribution knapper Güter als um die Zuteilung, ja Zumutung von Informationen. Es sind aber Engel, wie gesagt, überhaupt nicht mehr substantiell (gar materiell) oder durch Attribute einer Substanz zu charakterisieren, sondern allein durch ihren 257 M. Schmitz-Emans: Engel in der Krise.- In: Jb. d. Jean-Paul-Ges. 38 (2003), p. 111-138, hier p. 133. 258 Prototypisch für diese Tendenz ist G. Becker: Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens. Tübingen 1982. funktionalen Ort in einer Struktur. In dieser Struktur sind die Meta-Engel durch Iterations-Kaskaden immer schon vorgesehen. Diese Figur setzt allerdings voraus, daß die Unterscheidung des Boten von der Botschaft, die an einer gewissen Stelle wichtig ist, im Meta-Engel – im bekannten dialektischen Mehrfachsinn – aufgehoben ist.259 Damit ist der Engel mit seiner Entwicklungsfähigkeit zum Meta-Engel auch die Überschreitung jenes dummen Manichäismus, der die Gewißheit der Identifikation der „Achse des Bösen“ kennt. In der Postmoderne sind es nicht mehr als handelnd unterstellte Subjekte, die uns als Störer und Mittler philosophisch bewegen, sondern es ist die Medialität als solche,260 die unsere Aufmerksamkeit herausfordert. Und wenn wir in dieser Hinsicht ausreichend konsequent sind, dann werden wir auch in der Sozialphilosophie nicht mehr vom Menschen261, oder vom Subjekt262, oder von der Person oder vom Individuum (lauter eigentlich sorgfältig voneinander zu unterscheidende Kategorisierungen) ausgehen, sondern vom kommunikativen Text, d.h. vom Zwischen.263 Wenn wir das aber tun, dann werden wir nicht mit der einfachen Relation oder einer simplen Verkettung solcher Relationen (die Dyade als Illusion der sozialen Unmittelbarkeit) rechnen dürfen, sondern von der Triade als Grundfigur ausgehen, in der der Störer der Unmittelbarkeit mit seiner Doppelfunktion als Teufel und als Engel schon anwesend ist. Gleichwohl werden wir das Begehren der Unmittelbarkeit nicht los; das heißt, daß uns der Teufel/Engel als ein Begleiter und als ein Experte dieses Übergangs immer zur Seite steht. Der Engel, der uns leitet, vollzieht mit uns – virtuell, was sollte er sonst tun – den Übergang, der uns verwehrt ist. Da uns die Rückkehr ins Paradies der Unmittelbarkeit versagt ist, erfreuen wir uns medial dieses Übergangs. So kann die thomistische Lehre von den angenommenen Körpern auch in umgekehrter Richtung gelesen werden: Menschen können füreinander in Engelsfunktionen eintreten, als Mittler und Begleiter. Man wird vielleicht sagen können: Je mehr ein 259 Genau so macht das viel zitierte und mißbrauchte Wort McLuhans „The medium is the message“ Sinn. 260 K. Röttgers: Medialität.- www.fernuni-hagen.de/KSW/forschung/pdf/fk1_ksw_roettgers.pdf 261 Cf. N. Luhmann: Soziologische Aufklärung VI: Die Soziologie und der Mensch. 262 Cf. l. c., p. 155-168: „Die Tücke des Subjekts und die Frage nach dem Menschen“. 263 Anregungsgeber in dieser Hinsicht sind: N. Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1998; M. Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare. München 1986; L. Hjelmslev: Prolegomena to a Theory of Language. Madison 1961; L. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M. 1967; B. Waldenfels: Das Zwischenreich des Dialogs; diesen Anregungen folgt K. Röttgers: Kategorien der Sozialphilosophie. Mensch für einen anderen zum Engel wird, desto weniger Rücksicht besteht darin auf seine „reale“ Fleischlichkeit, d.h. desto mehr gerät seine reine Medialität ins Zentrum der Bedeutung; das ist nicht nur im Hinblick auf die Leiblichkeit der Intersubjektivität eine rücksichtslose Idealisierung des Anderen, es ist auch eine schonende Befreiung von der Hinfälligkeit des Körpers, eine Tendenz auf das, was als Medium weiter besteht, selbst wenn die Menschen siechen, sterben und verwesen. Für die Wissensorganisation der Postmoderne, die eine Organisation der Vermittlungen, d.h. der Engel, sein wird, ist zentral das Wissen, wie man mit Wissen umgeht. Eine der Lehren, die jetzt schon absehbar sind, weicht von den klassischen Angelologien ab, und das ist die netzförmige, statt einer hierarchischen Struktur. 264 Der Meta-Engel hat eine nur relativ privilegierte Position; sie ist vielmehr selbst Objekt einer rekursiv und netzförmig geschlossenen Relation. Damit ist – anders als in Hierarchien – jede einzelne Position im Netz unsicher und zweideutig. Was gestern noch als Engel amtierte, findet sich heute als Empfänger einer Botschaft wieder. Daher sagt Massimo Cacciari konsequenterweise mit Bezug auf Dantes Engel ohne Erinnerung: „Es ist Maria, die Gabriel die Worte der Verkündigung vorgesagt hat.“ 265 Jeder Versuch einer überblicksartigen Positionsbestimmung – ein Sinn von Hierarchien – ist eine schnell verfliegende Illusion. Engel sind sowieso nicht bodenständig und seßhaft, aber auch ihre Bewegungen im Medium sind dezentriert. Gott selbst ist allgegenwärtig-abwesend, überall fehlt er. Dort aber springen von Fall zu Fall die Engel ein. Eine irgendwie geartete „natürliche“ Gestalt des Engels hat sich seit dem 20. Jahrhundert mehr und mehr aufgelöst, er hat kein „Wesen“ mehr, was aber nicht heißt, daß er verschwindet; im Gegenteil: Zunehmend ist dieses seine eigentliche ihn selbst betreffende Botschaft, daß er kein Wesen mehr hat, sondern reine Botschaft geworden ist.266 Damit ist der Engel zur Darstellung des Problems der Darstellung 264 Cf. dazu auch die von Chr. Hubig angebotene Interpretation, die, Hegel und Benjamin aufgreifend, die „Sprache überhaupt“ (Benjamin), die Vermittlung des Bezugs, permanent scheitern sieht, die aber dieses Scheitern als die eigentliche Botschaft und damit die Unerreichbarkeit von Unmittelbarkeit zur Sprache der Dinge vermittelt. Chr. Hubig: Die Mittlerfigur aus philosophischer Sicht. 265 266 M. Cacciari: Der notwendige Engel, p. 138f. Cf. M. Cacciari: Der notwendige Engel, p. 48: „Er verkündet die Auflösung seiner eigenen ‚Wesenheit‘ in der Metamorphose seiner Zeichen“. In seiner dekonstruierenden Interpretation zeigt allerdings Bernhard Siegert, daß das eigentlich schon immer so war: „Denn Engel, griechisch angeloi, sind bekanntlich, insofern sie etymologisch Bedienstete des angareion, des persischen Relaispostsystems … sind, buchstäblich nichts als Postreiter. Nichts Sterbliches gibt es, berichtet Herodot, das schneller einträfe als diese angeloi. Gott ist also kein Großer Anderer, der am Anfang aller Zeiten DAS WORT gewesen wäre. Am geworden. Das bedeutet aber zudem, daß der Engel, der zuvor ein Experte des Übergangs war und den Menschen bei ihren schwierigsten Übergängen zur Seite stand, nunmehr der Übergang ist.267 Zur reinen Funktion geworden, rein medial geworden, hört er auf, nützlicher Helfer beim Lösen des Problems der Metabasis268 zu sein, sondern ist eine der Erscheinungsweisen des Problems. Erst der Engel als Mittler und als Medium269 ist der angemessene Engel, allerdings ist er auf diese Weise immer auch zweideutig; denn als Bote, der selbst die Funktionsstelle der Botschaft einnehmen kann, werden wir ihm niemals mehr ansehen können, ob nicht seine Botschaft eine längst nicht mehr Frohe Botschaft geworden ist. Denn der Mittler kann nur Mittler sein, wenn die Unmittelbarkeit ausgeschlossen wird, im Zweifel durch ihn selbst, indem er trennt, was nicht zusammenkommen darf, wenn er überleben soll. Und in dieser Trennfunktion ist der Engel auch ein Dia-bolos. Kann es sein, daß durch zunehmende Aufklärung, durch zunehmende Wissenschaftsdurchdringung unserer Alltagswelten und durch eine ihr antwortende Entmythologisierung die Engel verschwinden werden? Da es der Philosophie nicht auf die Meinungen der Leute ankommt, kann eine Antwort auf die gestellte Frage nicht darauf verweisen, daß die Zahl der Bücher über Engel in den Esoterik-Abteilungen der Buchhandlungen ständig wächst und mancherorts bereits die Zahl der Bücher in den Kochbuchabteilungen (und erst recht natürlich der in den Philosophie-Abteilungen) Anfang war die POST, und die Post ist der Ursprung Gottes.“ B. Siegert: Vögel, Engel und Gesandte.- In: Gespräche – Boten – Briefe, hrsg. v. H. Wenzel. Berlin 1997, p. 45-62, hier p. 55. Und das entspricht auch der älteren jüdischen Tradition, die Horst Seebaß so zusammenfaßt: „Der Terminus [mal’ ak jhwh = Boten Gottes] meint nur die Botenfunktion (die Nominalbildung bedeutet ‚Gesandtschaft‘), d.h. Entsender, Empfänger und Botschaft sind wichtig, nicht aber die Art oder Seinsweise des Boten – sehr im Unterschied zur abendländischen Engel-Vorstellung, die auf ein überirdisches und als solches erkennbares Wesen abhebt (Flügel).“ H. Seebaß: Engel II.- In: Theologische Realenzyklopädie, Bd. IV, Berlin, New York 1982, p. 583-586, hier p. 583. Ferner hat der Engel kein Wissen von der Welt und zieht so den Kürzeren im Wissensvergleich mit dem Menschen. Allah „prüfte Engel und Menschen über ihr Wissen von der Welt. Da ergab es sich, daß die Engel von den Dingen der Welt nicht einmal die Namen wußten, sondern nur Loblieder auf Allah kannten, während Adam alle Dinge bei Namen nennen konnte.“ W. Belz: Sehnsucht nach dem Paradies – Mythologie des Korans. Berlin 1979, p. 142. 267 Dazu paßt vorzüglich, daß Papst Pius XII. am 12.1.1951 den Erzengel Gabriel zum Schutzengel der Telekommunikation erklärt hat. 268 K. Röttgers: Metabasis. Philosophie der Übergänge. Magdeburg 2002. 269 Chr. Hubig: Mittel. Bielefeld 2002. übertrifft. Wenn wir die Frage nach dem Verschwinden der Engel als philosophische Frage ernstnehmen wollen, dann ist es die Frage nach der zunehmenden oder abnehmenden Bedeutung von Vermittlungen. Und da vermutlich alle Kultur die Kultur von Vermittlungen ist,270 ist es (vermittelt!) auch die Frage nach der verbliebenen Bedeutung von Kultur. In der angebrochenen Postmoderne wird die Hauptvermittlungsleistung – manche deklarieren sogar die Einzigkeit – vom Geld geleistet. Ist diese Vermittlung symbolisch oder diabolisch? In den Vermittlungen leben die Bilder der Unmittelbarkeit (die es vielleicht nie anders als in Bildern von ihr, d.h. vermittelt, gegeben hat) als Bilder des Ursprungs und als Bilder des Heils fort und bekräftigen damit eigentlich immer wieder die Vermittlungsbeziehungen. Bei jedem Bild aber besteht die Gefahr der Verwechslung von Bildgehalt und Abgebildetem, von Signifikatum und Denotatum, von vermittelter Unmittelbarkeit mit dieser selbst. Unserer Gegenwart kommt in hohem Maße diese Idolatrie der Unmittelbarkeit zu. Der sogenannte „Terror der Ökonomie“ ist nichts anderes als der Glaube an den absoluten Vorrang des Gesichtspunkts der effizienten Produktion und Verteilung von knappen Gütern, also eine Bevorzugung des kurzen Weges, um nicht zu sagen des kurzen Prozesses zuungunsten aller Vermittlungen. Der Kult der Unmittelbarkeit drückt sich am krassesten dort aus, wo die Vermittlung am offensichtlichsten sein könnte: in den sogenannten Medien. „Reality-TV“, Computerspiele und schließlich die Kategorie „Action“ als Qualitätsmerkmal z.B. eines Films sollen die Medialitäts-Vermittlung vergessen lassen. Aber das tatsächliche Verlassen jeglicher Vermittlung wäre der Abbruch des kommunikativen Textes: epistemisch als Mystik, praktisch als Gewalt. Aber selbst die Texte der Mystiker sind nicht die unio mystica, sondern sie vermitteln sie nur als Bericht, als Anleitung o.ä.; ebenso sind die Heldensagen nicht Gewalt-tätige, sondern Gewaltberichtende Texte. Die Unmittelbarkeit selbst kennt keine Worte. Sie würde schauen und schweigen, oder sie würde handeln und schweigen. Für Vermittlungen der kulturellen Art birgt das die zusätzliche Schwierigkeit, daß sie eigentlich nicht nur Vermittlung der Unmittelbarkeit, sondern mehr noch Vermittlung des Bewußtseins von der Unvermeidlichkeit der Vermittlung der Unmittelbarkeit zu sein hätte. Hermes muß zum Hermeneuten werden können, die Engel zu Angelologen, Lyriker zu Poetologen. Der Effekt dieser Steigerung der Mittlungen wäre die eigentliche Domäne der Kultur: die Unmittelbarkeit von Gewalt und Mystik immer mehr zu verunmöglichen und beide Phänomene als reine Bildphänomene zu konservieren. Nicht Entlar- 270 H. Blumenberg: Anthropologische Annäherung an die Rhetorik.- In: ders.: Wirklichkeiten in denen wir leben. Stuttgart 1993, p. 104-136; ders.: Die Sorge geht über den Fluß. Frankfurt 1987, p. 137f.; M. Serres: Hermes V: Die Nordwest-Passage. Berlin 1994, p. 123ff. vung (der Teufel oder Engel) wäre die Aufgabe der Kulturschaffenden, sondern fortschreitende Verlarvung. Durch Masken und Larven wird das Leben erträglich, 271 nicht dadurch, daß das, was sie verbergen hinter der Engelsgestalt, hervorgezerrt und dem schamlosen Blick oder der schamlosen Tat preisgegeben wird.272 Der Bote ist stets der Dritte, der zur Zweizahl reiner Intersubjektivität hinzutritt. Nun ist die Position des Dritten strukturell keineswegs eindeutig. Der Dritte kann erstens eine Beziehung zu jedem von den Zweien haben, die von der gleichen Art ist, die auch die Zwei untereinander unterhalten: la ménage à trois. Er kann zweitens aber auch eine andersartige Beziehung pflegen, nämliche eine Beziehung zu ihrer Beziehung; das ist die eigentliche Spezialität des Parasiten, aber auch des Hermes: er bezieht sich auf den Text zwischen Zweien und übersetzt ihn, vermittelt ihn und macht ihn verständlich. Aber was sind die Zwei füreinander außer in ihrer Beziehung, sagen wir im kommunikativen Text? – Also wäre der Unterschied nicht wirklich erheblich. Statt zwischen der Deltaform () einer Dreierbeziehung und der Form des gedrehten T () unterscheiden zu müssen, hätten wir es immer mehr oder weniger mit einem rotierenden Mercedes-Stern ( ) zu tun. Berücksichtigen wir dann außerdem, daß in dieser Struktur absolut unklar wird, wer Erster, wer Zweiter, wer Dritter ist, dann haben wir einen Begriff des Sozialen entwickelt, in der der Bote nicht mehr ontologisch, sondern nur noch strukturell ausgezeichnet ist. Engel/Teufel sind wir füreinander – oder genauer: für einen Beziehungszusammenhang. Wer z.B. ist der Übersetzer, wenn jeweils Zwei durch eine gemeinsame Sprache und durch einen gemeinsamen Text miteinander verbunden sind? Wir haben (gemeinsam) einen Engel, wir sind füreinander Engel (oder versagen darin, es zu sein), wir begehren oder entbehren den Engel …– wen würde nicht all das auch an die Funktion des Phallus in Lacans kulturalistischer Deutung der Psychoanalyse erinnern? Dürfen wir also sagen: Der Engel – das ist der Phallus? Wenn der Dritte ein Vermittler genannt zu werden verdient, dann deshalb, weil er die Indirektheit als Beziehungsform zwischen dem Selbst und seinem Anderen einführt. Dadurch kann er in Konfliktfällen vermitteln, er kann aber genauso gut den Konflikt überhaupt erst hervorrufen. Und schließlich – das Parasitäre – ist er als tertius gaudens der Nutznießer des Konflikts. Georg Simmel hat diese drei Rollen des Dritten unterschieden;273 aber eigentlich kommen sie immer zusammen vor, und vor 271 F. Nietzsche, l. c. V, p. 57, cf. pp. 51, 226, 78. 272 In diesem Sinne hat R. Konersmann in Aufnahme eines alten Motivs das Malen des Schleiers vor den Dingen als die eigentliche Aufgabe des Malers bezeichnet: Der Schleier des Timanthes. Frankfurt a. M. 1994, p. 12-14. 273 G. Simmel: Soziologie, hrsg. v. O. Rammstedt. Frankfurt a. M. 1992 (Georg-Simmel-Gesamtausg. XI), p. 121-150. allem wissen wir hinterher kaum mehr zu unterscheiden: Hatten wir wirklich eine heile Beziehung, bevor der Dritte auftauchte und unsere bloß scheinbar heile Beziehung entlarvte und heilte; und ist der Vorteil, den er aus dieser Beziehungstherapie zog, unser Nachteil oder auch unser Vorteil? Immer zeigt sich, daß die soziale Beziehung ohne den Dritten ein bloßes Phantasma ist. Und manchmal ist dieser Dritte ein Engel gewesen; aber niemals werden wir es vorher gewußt haben. Nach einem Bild von Paul Klee hat Walter Benjamin das Bild eines Engels in geschichtsphilosophischer Mission entworfen. In der neunten seiner „Geschichtsphilosophischen Thesen“274 gibt Benjamin diesem Engel folgende Deutung. Er ist der Engel der Geschichte, der Vergangenheit zugewandt; was uns als Kontinuität der Geschichte erscheint, nimmt dieser Engel als eine einzige Katastrophe wahr, die „unablässig Trümmer auf Trümmer häuft“. Dieser Neue Engel „möchte“ den Trümmerhaufen heilen („das Zerschlagene zusammenfügen“ – die Symbolisierungsfunktion eines jeden Engels). Aber „vom Paradiese her“ weht ein so starker Wind („das was wir Fortschritt nennen“), daß er an seiner Mission gehindert wird. Dieser Fortschrittswind treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft. Auch dieser Neue Engel Benjamins ist ein scheiternder Engel. Dennoch ist der Gedanke des Heils denkbar geblieben: es ist der Gedanke an die schwache messianische Kraft, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen. Bei dieser Aufgabe hilft dem Menschen kein neuer und kein alter Engel mehr. „Wir sind auf der Erde erwartet worden. Uns ist wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat.“275 Was in unserer Gegenwart als Kult der Unmittelbarkeit auftritt, hat mit dem Moment der Erlösung bei Benjamin kaum etwas gemein. Denn Benjamin denkt dialektisch. Es ist das Kontinuum der Katastrophe, das uns zwingt, die Möglichkeit der Erlösung in jedem Moment als deren Negation zu denken. Das messianische geschichtsphilosophische Denken ist der Versuch, den unendlichen Prozeß der Verkündigungsszene zu brechen und die Inkarnation potentialiter in den Vermittlungsprozeß einzusetzen. Das ist kein Werk eines Engels mehr. Insofern ist der Neue Engel – der Möglichkeit des Eschatons nach – der letzte Engel. Angesichts der immer aufdringlicher hervortretenden „Unmöglichkeit der Übersetzung“ wird eine Gestalt immer unabwendbarer, die M. Schmitz-Emans als den „scheiternden Engel“ bezeichnet und in der Literatur seit der Romantik aufgespürt hat.276 Er scheitert an der Aufgabe der Vermittlung: Die zu malenden Bilder verleiben in der Imagination und erscheinen nicht auf der Leinwand, was wie ein Engel auftritt, entpuppt sich als eine Form von Teufel, vielleicht auch weil die phy- 274 W. Benjamin: Illuminationen. Frankfurt a. M. 1961, p. 272f. 275 l. c., p. 269. 276 M. Schmitz-Emans: Engel in der Krise. sische Anwesenheit des Engels, wie Dante sie beschrieb, als unerträglich weginterpretiert werden muß, der Engel scheitert an seiner Aufgabe der Apparenz. Ob allerdings aus dem scheiternden Engel auf den gefallenen Engel geschlossen werden darf, wie Schmitz-Emans das tut, kann bezweifelt werden. Es gibt verschiedene Traditionen der Erläuterung des gefallenen Engels: Konkurrenz zu Gott und seiner Herrlichkeit, Konkurrenz zu den Menschen als dem von Gott bevorzugten Werk seiner Schöpfung etc. Scheiternde Engel scheinen eher an einer Vermittlungsaufgabe nach dem Tode Gottes zu scheitern. Insofern ist es bemerkenswert, daß es sozusagen eine Aufhebung des Scheiterns gibt, nämlich indem der Autor erfolgreich an die Stelle des Engels tritt: „Der Erzähler ist der Engel, der nicht versagt.“277 Wenn wir nun des weiteren auf die texttheoretische Unterscheidung zwischen dem Schriftsteller als dem Menschen, der etwas geschrieben hat, und dem Autor als einer Textfunktionsstelle beharren, dann entwickelt sich dieser Engel immer mehr zu einer Kommunikationsfunktion. Und dann kann man seine eigentliche Medialität untersuchen und muß nicht mehr der irreführenden Frage nach der Physiologie der Engel nachgehen. Diese Medialität kann durchaus in jenem „einvernehmlichen Mißverstehen“ bestehen, das die Grundlage vieler erfolgreicher Kommunikationen darstellt.278 Daß SchmitzEmans das für eine ironische Zeichnung des Engels hält, beruht auf der fälschlichen Annahme, hier würden wirklich noch Aussagen über die Natur der Engel – wenngleich ironisch gebrochen – gemacht. Der „Meta-Engel“ ist vielmehr ein Engel ohne Physiologie, seine „Flügel“ sind in der Tat Anführungszeichen. Ein solcher Engel erinnert eben gerade nicht an den Auferstehungsengel des Neuen Testaments. 279 Schmitz-Emans selbst kommt zu dieser Auffassung, weil sie annimmt, daß Erzählungen über scheiternde Engel lesbar seien „als Erinnerung an deren ursprüngliche Funktion“ – gut, im Sinne einer multiplen Lesbarkeit sind sie zugegebenermaßen auch so lesbar. Aber nicht an dieser Traditionalität besteht ein Interesse, sondern ich glaube, gerade in der entgegengesetzten Lektüre. Daher ist auch der Schluß von Schmitz-Emans unpassend, der da lautet: „Die zeitgenössischen Engel sehen aus wie Flugzeuge und Faxgeräte …“,280 weil gerade das der Wandel ist, der sich mittlerweile vollzogen hat, daß Engel überhaupt nicht mehr aussehen … 277 l. c., p.. 125. 278 l. c., p. 131: „Je schöner man aneinander vorbeiredet, desto mehr fühlt man sich verstanden und genießt das harmonische Miteinander.“; cf. zuvor auch K. Röttgers: Die Einheit deutsch-französischer Mißverständnisse – oder: Der Pumpernickel-Effekt.- In: Hagener Universitätsreden 12 (1988), p. 49-60. 279 M. Schmitz-Emans: Engel in der Krise, p. 133. 280 l. c., p. 138. Wenn Engel nicht mehr über ihre Physis identifizierbar sind, also weder über sichtbare Flügel noch über ein Licht, das sich zuletzt der Sichtbarkeit entzieht und natürlich noch mehr den anderen Sinnen, dann bleibt zumal nach der von Cassirer ausgerufenen Wende von der Substanz zur Funktion und von der Substantialität zur Medialität die Botenfunktion des Engels im Mittelpunkt des Interesses. 281 Ihre gelegentliche Sichtbarkeit ist ein zu vernachlässigendes Attribut. So wie der Autor im Text nur noch eine Funktionsstelle im Text ist, so ist der Engel am Ende seiner Geschichte das, was er – um Hegelsch zu reden – seinem Begriffe nach immer schon war: die reine Botschaft, an der lediglich die hörende Gemeinde den Boten begehrt und ihm seine Gestalt verleiht. Die Botschaft verbindet, die Frohe Botschaft z.B. die Gemeinde der Gläubigen. Sie verbindet aber auch den, von dem die Botschaft mutmaßlich ausgegangen ist, mit denen, denen sie als Botschaft gilt. Engel sind medial. Bestimmte mediale Strukturen erzwingen unter Umständen bestimmte Materialitäten. Aber solche Materialität hängt gar nicht vom Inhalt der Botschaft ab, als könnte man bestimmte Botschaften nur den Schallwellen im lufterfüllten Raum anvertrauen, nicht den elektromagnetischen Wellen. Und ebenso wenig man dann zwischen der Luft und dem Kupferkabel Ähnlichkeiten zu suchen braucht, die es ermöglichen, ein Geständnis oder einen Befehl zu übermitteln, ebenso wenig bleibt die Frage nach der Physiologie der Engel, die ja schon von Fechner nur mehr ironisch traktiert werden konnte, eine ernsthaft zu beantwortende Frage. 282 Es ist diesem Sinne, daß sich Michel Serres in seinem Buch „Legende der Engel“ mit den Engeln auseinandergesetzt hat.283 Die Annahme von Engeln dient hier dazu, Medialität zu deuten. Gerade eine angemessene Deutung von Medialität im Zeitalter des Hermes dient dazu, Engel neu und entschiedener in ihrer Mittlerfunktion zu verstehen. Zum ersten heißt das, den Engel nicht von der Botschaft zu trennen, sondern in Einheit zu denken – wie signifié und signifiant. Zweitens aber gibt es auch eine Iteration dieser Unterscheidung durch sozusagen parasitäre Kaskadenbildung. So kann der Bote einer originären Botschaft zur Botschaft werden. Nach Serres leben wir jetzt erst im eigentlichen Zeitalter der Engel. Im Zeitalter des Herakles ging es um Sammeln, Einbringen und Verteidigen der Früchte des Feldes; im Zeitalter der Prometheus ging es um Nutzung von Energien (Feuer) zur Umwandlung von Materien und um Äquivalententausch der erzeugten Produkte (homo 281 K. Röttgers: Wer oder was ist ein Medium? http://www.fernuni-hagen.de/KSW/forschung/pdf/ fk1_ksw_roettgers.pdf. 282 G. Th. Fechner: Vergleichende Anatomie der Engel. Leipzig 1821; dazu K. Röttgers: Die Physiologie der Engel.- In: Literatur als philosophisches Erkenntnismodell, hrsg. v. S. Hüsch u. S. Singh. Tübingen 2016, p. 163-176. 283 M. Serres: Die Legende der Engel; cf. dazu K. Röttgers: Strukturen mit Götterboten.- In: Französische Nachkriegsphilosophie, hrsg. v. G. Abel. Berlin 2001, p. 399-426. faber und homo oeconomicus: Werkstatt und Markt); im Zeitalter des Hermes geht es um Botschaften, um Information, um Erkenntnis und Wissen (universale Kommunikation in einer Weltöffentlichkeit der Netze). Die den heutigen Philosophen von der Politik oftmals anempfohlene oder abverlangte Praxisbehilflichkeit des Wissens entstammt, sozusagen als letztes Aufbäumen, der Wissensorganisation der Lehrwerkstätten und der polytechnischen Kombinate. Für die Wissensorganisation der Zukunft, d.h. der Engel, ist zentral das Wissen, wie man mit Wissen umgeht. Der MetaEngel oder – was nichts anderes ist: der Luhmannsche „Beobachter des Beobachters“ – hat nur relativ die privilegierte Stellung; die Iterationen erweisen sich vielmehr regelmäßig als rekursiv und netzförmig geschlossen. Wenn das aber so ist, dann ist – anders als in Hierarchien – jede Position unsicher und zweideutig. Zur Wesens-losigkeit des Engels gehört seine Erinnerungslosigkeit. Hatte Sartre die ontologische Verfassung des Menschen so gedeutet, daß er kein Wesen „hat“, das er verwirklichen müßte, sondern das er sich im Vollzug seiner Existenz aus absoluter Freiheit heraus eines schafft (eines schaffen muß),284 so gilt für den Engel, daß auch er kein Wesen mitbringt, sich aber auch wegen seiner Erinnerungslosigkeit keines geschaffen haben kann. Aufgrund der Erinnerungslosigkeit kennen die Engel – so Cacciaris Deutung von Dante – weder Furcht noch Schrecken. Nur der Mensch kann sich an die Entscheidung, die er getroffen hat, erinnern, und daher kennt nur der Mensch das Abenteuer, und auch nur der Mensch kennt, wenn sie denn stattfand, die Sünde der Engel. Solche Deutung führt zwangsläufig auch zu einer neuen Deutung des Falls des Engels. Die Freiheit Satans, durch die er sich selbst ein Gesetz gab (man ist erinnert an Simmels „individuelles Gesetz“285), wird zu einem Moment des Vermittlungszusammenhangs und verbleibt nicht länger die Negation desselben. „Luzifer ist jetzt bloß der Moment des Zornes ‚Gottes über sich selbst in seinem Anderssein‘.“286 Dann aber findet die uralte Frage, von Hans Blumenberg seinerzeit aufgegriffen, „Sollte der Teufel erlöst werden?“287 eine eindeutige Antwort in der Negation der Negation. Der Teufel, als negatives Prinzip, kann sich in seiner Negation nicht affirmativ treu bleiben; er hat kein Wesen, zu dem er zu stehen verdammt wäre. Nur indem er unwesentlich, inkonsequent ist, kann er überhaupt Gott widersprechen, und genau aus dem gleichen Grund kann und wird er errettet werden – freilich nicht, indem er Buße tut; denn das wäre nicht glaubhaft. 284 J.-P. Sartre: L’être et le néant, bes. p. 58ff. 285 G. Simmel: Gesamtausg. XVI, p. 346ff. 286 M. Cacciari: Der notwendige Engel, p. 130. 287 H. Blumenberg: Sollte der Teufel erlöst werden?- In: FAZ 27.12.1989. 2.6. D IFFERENZ UND V ERFÜHRUNG / E REIGNIS 2.6.1. Das Einheitsdenken 2.6.1.1 Cusanus Es gibt gute Gründe, die Einheit zu lieben.288 Das Einheitsdenken in der Philosophie beginnt mit Parmenides. Für ihn ist erstmals, soweit wir wissen, der Gedanke des Seins das Denken des Einen. Allerdings gibt es nur eine einzige überlieferte Stelle, an der dieses manifest ist. In Fragment 8 heißt es: „oüdè diairetón Êstin, Êpeì pân mâllon Êstin ὁmoîon∙ oüdè ti t²i mâllon, tó ken eÍrgoi min synέcesjai, oüdé ti ceiróteron, pân d᾽ ˆmpleón Êstin Êóntoς.“289 Insbesondere wird dieses Einheitsdenken dann fortgeführt zu der These der Einheit von Sein und Denken. Denn ein Denken ohne das als seiend Gedachte ist nicht möglich. Diese Einheit ohne ein (undenkbares) Außen vergleicht Parmenides mit der idealen Kugel, die von der Mitte her alles als gleichgewichtig gestaltet. Heidegger drückt es so aus: „Das Sein ist das Eine, mit Ausschluß jedes Anderen. Damit gemeint: nicht nur anderem gegenübergestellt, über jedes Andershafte, Andersheit hinaus. Und zwar wird nicht einfach gesagt: das Sein ist tautón, selbig, sondern selbig im Selbigen verbleibend; es in ihm selbst verbleibend, es bleibt und hält sich in solcher Selbigkeit. Es ist von sich aus sich gegenwärtig haltend, einigend, Einheit bildende Einheit, als welche sie west.“290 Deutlicher noch wird dieses Einheitsdenken im Platonischen Dialog „Parmenides“. Dort nennt Parmenides291 als seine Grundvoraussetzung das Eine. Sein Gesprächspartner ist an dieser Stelle, n.b., der Jüngste, nämlich ein gewisser Aristoteles. Seine These faltet er aus zu der Folgerung: das Eine kann nicht Vieles sein oder aus Vielem (aus vielen Einzelteilen) bestehen; denn dann wäre es nicht das Eine. Apelt übersetzt: „Wenn das Eins wirklich Eins sein soll, kann es also weder ein Ganzes sein 288 „Im allgemeinen haben die Philosophen für die vielfältige Vielheit längst nicht so viel übrig gehabt wie für die Einheit. Das, worauf sie sich oft als letzte und höchste Einheit einigten, das Sein, war abstrakt und wirkte blaß und langweilig …“ H. Böhringer: Die Ruine in der Posthistoire.- In: ders.: Begriffsfelder. Von der Philosophie zur Kunst. Berlin 1985, p. 2337, hier p. 23. 289 Die Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. v. H. Diels, 6. Aufl. hrsg. v. W. Kranz. BerlinGrunewald 1951, I, p. 237. 290 M. Heidegger: Gesamtausg. XXXV, Frankfurt a. M. 2012, p. 170. 291 137c. noch Teile haben.“292 Also ist das Eine auch einfach. Auf die vielfache Beweisführung durch Parmenides und seine eher fragwürdige Triftigkeit braucht an dieser Stelle nicht eingegangen zu werden. Nach Platon konvergieren das Eine und das Gute. In der Hierarchie der Ideen, d.h. jener Ordnungsvorstellungen, die uns in einer Welt voller Kontingenzen Sicherheiten des Erwartens ermöglichen, nehmen die Ideen der Einheit und des Guten die oberste Stellung ein, die nicht ihrerseits noch einmal ein dialektisches Gegenüber haben. Plotin steigert die Hingabe an die Einheit noch um eine Stufe. Er arbeitet mit dem Totalitätsbegriff des Ureinen. Alle Differenzen, die in der Sinnenwelt auftreten, sind im Einen als zusammenfallend gedacht. Dieses eine ungeschiedene Ganze ist zunächst als dýnamiϛ; sobald aber diese dýnamiϛ als Möglichkeit auftritt, steht sie sofort im Gegensatz zur Wirklichkeit dieser Möglichkeit; dann aber erscheint an jeglicher Wirklichkeit auch die Möglichkeit des Andersseinkönnens – und schon haben wir es mit Vielheiten zu tun. So emaniert durch die intensive Unendlichkeit der Macht des Alleinen die extensive Unendlichkeit der Mächte der Wirklichkeit. Ja, es ist noch vertrackter: Diese Vielheit ist für den Erkennenden die einzige Zugangsweise zur Vorstellung von der Einheit des Ganzen. Für Plotin heißt das weniger, daß alles im Grunde eines ist, als vielmehr daß sich das Viele ordnend auf Einheit zurückführen läßt, so daß das Ganze auf diese Weise begriffen werden kann. Wie auch immer vermittelt es sein mag, durch diese Rückbezüglichkeit von Vielheit auf Einheit werden letztlich Unterschiede und Differenzen als gleichgültig gesetzt. Identität wird das Zauberwort, das gegen Differenzen erfolgreich eingesetzt wird. Solch ein Denken geht hinter die Selbstanschauung Gottes zurück bis zu dem Punkt, wo die einzig verbliebene Unaussprechlichkeit jenes „Ich bin, der ich bin“ ist. Daher ist das Eine nicht nur der Endpunkt aller Erkenntnis in der Einheit des Wissens, sondern in ontologischer Entsprechung dazu auch der Ursprung alles Werdens. Einheitsdenken, jedenfalls in der abendländischen Tradition, ist daher stets auch ein Denken vom Ursprung her, von der Ârcή. Dieses Eine kann stets nur paradox gedacht und ausgesagt werden; denn jedes Reden vom Einen ist schon das Andere des Einen, Denken ist schon das Zweite. Wir gehen daher jetzt über zu einem der radikalsten und zugleich argumentativ stärksten Einheitsdenker, der nicht – wie Platon und der Platonismus – die Vielheit als nicht-seiend unterstellt, sondern sich der Realität von Vielheit als Problem stellt, und zwar als eine Einheit jenseits der Differenz von Einheit und Vielheit, diese erst ermöglichend, nämlich Nikolaus von Cues.293 Für Cusanus stellt sich die Conditio des Menschen, seine Endlichkeit, nicht quasiplatonisch als Schein dar, sondern er nimmt diese Endlichkeit ernst als Andersheit 292 Platon: Parmenides, neu übers. u. erläutert v. O. Apelt. 2. Aufl. Leipzig 1922, p. 70. 293 Nikolaus von Cues: Philosophisch-theologische Schriften. und damit als Vielheit. Dem Erkennenden erscheint das zu Erkennende als ein System von Relationen, in dem das zu Erkennende auf ein bereits Erkanntes bezogen wird. Jede Erkenntnis ist auf eine solche Relationierung des Unbekannten auf das Bekannte angewiesen. So basiert jede endliche, d.h. verstandesmäßige Erkenntnis, auf Vielheiten; erst eine absolute, den Verstand überschreitende Erkenntnisform würde nichts mehr ein ihr Anderes enthalten.294 Ihr Denken wäre in einem radikalen Sinne ein Denken der unüberschreitbaren Einheit. Indem Cusanus aber nun diese Möglichkeit eines Denkens unterstellt, muß er die menschliche Erkenntnis begrenzen auf ein Wissen der Unwissenheit hinsichtlich dieses Einen: „docta ignorantia“. Das Denken entzieht sich in die Unmöglichkeit des Begreifens. Aber so einfach bleibt es nicht. Das Eine ist zugleich das Größte, dem nichts entgegengesetzt ist. Im Endlichen ist jedem Eins ein anderes entgegengesetzt. Aber jenem Einen, das zugleich das Maximum ist, ist nichts mehr entgegengesetzt, es ist das Non-aliud. Für die endliche Erkenntnis, also für Verstandes-Erkenntnis, gilt der Nicht-Widerspruchs-Satz des Aristoteles, nämlich daß für Etwas nicht als dieses und zugleich als sein Gegenteil gedacht/ausgesagt werden kann. Für jenes absolute Erkennen, dessen Möglichkeit nur in einer docta ignorantia, d.h. in obliquer Weise, verdeutlicht werden kann, muß aber der Satz des Widerspruchs außer Kraft gesetzt sein; denn sonst wäre dem absolut Größten das absolut Kleinste entgegengesetzt, d.h. die Einheit des Einen bestünde nicht. Also braucht Cusanus ein Prinzip, das von dem aristotelischen Widerspruchsprinzip abweicht: die coincidentia oppositorum. In Vernunfterkenntnis, die eben nicht auf empirische Sachverhalte in ihrer irreduziblen – ontologischen – Vielheit bezogen ist, fallen das absolut Größte und das absolut Kleinste zusammen. Die Maximalität kommt beiden Extremen gleicherweise zu. Cusanus veranschaulicht diesen Perspektivenwechsel, die Abkehr vom Aristotelismus, mit Beispielen aus Mathematik und Geometrie. Die Mathematik kennt den Begriff des Unendlichen, das aller Zählbarkeit entzogen ist. Gleichwohl ist dieses Unendliche für das mathematische Denken einsichtig zu machen: „Applicemus beryllum mentalibus oculis, et videamus per maximum, quo nihil maius esse potest, pariter et minimum, quo nihil minus esse potest; et videamus principium ante omne magnum et parvum, penitus simplex et indivisibile omni modo divisionis, quo quaecumque magna et parva sunt divisibilia.“295 Aber dieses absolut Größte erkennen wir nicht, sondern berühren es auf unbegreifliche Weise („incomprehensibiliter attingimus“296) auf dem Weg der Einsicht in 294 Zu diesem Aspekt s. insbes. K. Flasch: Die Metaphysik des Einen bei Nikolaus von Kues. 295 Nikolaus von Cues: Philosophisch-theologische Schriften III, p. 8/10. 296 l. c. I, p. 204. unser Nichtwissen. Weil das absolut Größte und das absolut Kleinste zusammenfallen, ist das Eine keine Eins, keine Zahl, sondern als Ursprung der Zählbarkeit dem Zählen selbst entzogen. Es muß als Bedingung der Möglichkeit verstandesmäßiger Erkenntnis eine das Erkennen selbst transzendierende Einheit geben. Folglich muß es, so Cusanus, ein der Unterscheidung von Einheit und Andersheit vorausliegende Einheit geben, die diese Unterscheidung ermöglicht: eine unitas aeterna. Diese Einheit ist der Grund aller Verbindung, die als Verbindung ja ihrerseits der Teilung in Zweiheit zugrunde liegt. Das aber heißt, daß es nicht zweierlei Einheit gibt, eine, die der Andersheit entgegengesetzt wäre, und eine andere, die die Grundlage dieser Entgegensetzung wäre. Sprachlich läßt sich das am besten ausdrücken, indem wir das Zählen selbst vom Gezählten (Erstes = die Eins; Zweites = das Andere) unterscheiden; die dem Zählen entzogene Zählbarkeit aber ist unteilbar nur Eine. Noch einmal zur Hilfe der Mathematik zum Begreifen der unendlichen Einheit: Je größer ein Kreis ist, desto geringer ist seine Krümmung; der unendliche Kreis ist schließlich ein „Kreis“ ohne Krümmung, d.h. der unendliche Kreis ist eine Gerade. Umgekehrt: Verkleinert man den Kreis unendlich, so wird sein Umfang gleich Null, d.h. er wird zu dem, was eine Linie ausmacht, zum Punkt. Ähnlich verläuft die Versinnbildlichung über das Dreieck. Verkleinert man einen der Winkel bis zum unendlich kleinsten Winkel, so wird das Dreieck ebenfalls zur geraden Linie, ebenso bei der unendlichen Vergrößerung eines Winkels. Folglich koinzidieren im Unendlichen das absolut Kleinste und das absolut Größte – „Qui hoc enim intelligit, omnia intelligit…“297 Er hätte nämlich Einblick darein, daß es ein Größtes geben muß, dem kein Kleinstes entgegengesetzt ist: „… das Größte ist so beschaffen, daß das Kleinste in ihm das Größte ist, so daß jeder Gegensatz unendlich weit überschritten wird.“298 Wir haben es bisher vermieden, wovor Cusanus keine Scheu hatte, nämlich dieses Eine, Größte/Kleinste Gott zu nennen. In diesem Gott aber fallen nun auch Transzendenz und Immanenz derart zusammen, daß Gott nun in allem und in nichts ist. Über die Figur der explicatio (Ausfaltung) erscheint daher der Mensch ebenfalls als ein Gott, weil auch er schöpferisch ist. Das Beispiel von Cusanus ist der Löffel: nirgendwo in Gottes Schöpfung kommen Löffel vor, die der Mensch hätte imitieren können, es bedurfte also dieses kleinen Gottes „Mensch“, um diese Schöpfung in die Welt zu setzen. Die Kreativität, die dem Menschen als Menschen, d.h. als zweitem Gott zukommt, individualisiert ihn. Als Individuum, d.h. als selbst ein Einziger, hat er nicht mehr seinen festen, durch die Ordnung ein für alle Mal vorgesehenen Ort in dieser Ordnung, sondern ihm ist aufgegeben, Stellung in der Ordnung zu beziehen. Das negiert nicht nur die hierarchische Ordnung des Mittelalters, sondern es untergräbt sie nachhaltig und bringt in diesem Untergrund einen Sprengsatz an, dem das 297 l. c., p. 242. 298 l. c., p. 243. Mittelalter letztlich nicht standhält: der Wert des kreativen Individuums, und zwar in seiner Vielfalt. Offen sichtbar wird dieser Krypto-Perspektivismus bereits in der Frage, ob die Erde im Zentrum des Universums stehe, wie das ptolemäische Weltbild im vermeintlichen Einklang mit dem Schöpfungsbericht der Genesis postulierte. Für Cusanus steht nicht die Erde im Zentrum, sondern der Geist; das ist eine so radikale Perspektivenänderung, daß vor dessen Hintergrund auch Kopernikus und Galilei dürftig erscheinen. Diese Verschiebung von einem Fundamentalismus der Einheit zu einem Vielheiten von Sinnbildungen einschließenden Einheitsdenken setzt aber das Einheitsdenken einem enormen Risiko aus. Es braucht ja nur das zu geschehen, was dann in der Neuzeit tatsächlich geschah: der zweite Gott schickt den ersten in den Ruhestand und erklärt sich zum ersten Gott. So wird sein Perspektivismus zum Polytheismus, und das Einheitsdenken hat keine Grundlage mehr, bis dann einer kommen wird, der die Vielheit der Individuen zur Einheit des transzendentalen Subjekts synthetisiert. Noch aber sind wir in der zweischneidigen Rettung des Mittelalters durch Cusanus. Hans Blumenberg interpretiert die Schrift „De coniecturis“299 zuspitzend dahingehend, daß er sagt: „An Stelle des scholastischen Stufenkosmos ist ein All der Individuen getreten, die nicht an ihrer äußeren Weltstelle, sondern an ihrer inneren Einzigartigkeit ihren Wert besitzen. Die Gesamtheit je einziger Wesen ist allein die angemessene explicatio, Entfaltung, der unendlichen göttlichen complicatio, Einfaltung.“300 So ist die Quintessenz von Blumenbergs Cusanus-Verständnis, daß dieser in konservativer Absicht, indem er das mittelalterliche Denken in seine radikalsten Konsequenzen treiben wollte, ungewollt, ja vielleicht unbewußt, revolutionär wirkte. Er wollte mit dem Koinzidenz-Theorem das Einheitsdenken auf die Spitze treiben. Mit der Koinzidenz von Transzendenz mußte er die Welt in ihren Vielheiten als explicatio darstellen, wodurch Vielheit nicht nur zugelassen war (wie bei Plato als Werden und Schein), sondern notwendig wurde. Die einzige Alternative zu dieser verborgenen Dekonstruktion von Einheit wäre ein Agnostizismus gewesen: von Gott können wir nichts wissen, aber von der Welt und uns selbst ebenso wenig: indocta ignorantia. Der Perspektivismus führt notwendigerweise zum Pluralismus. Das geozentrische Weltbild ist daher eine Illusion, aber eine notwendige Illusion: Wo immer ein Beobachter sich befindet, muß er glauben (dürfen), er befinde sich im Mittelpunkt. 299 l. c. II, p. 1-209. 300 H. Blumenberg: Einleitung.- In: Nikolaus von Cues: Die Kunst der Vermutung, p. 7-69, hier p. 34. Und tatsächlich befindet er sich im Zentrum seines Beobachtungsuniversums. Ferner muß er glauben, daß sein Zentrum unbewegt sei, weil alle Bewegung nur relativ zu Ruhendem als Bewegung erscheint; wenn aber jeder Vergleich fehlt, entsteht der Eindruck der Unbewegtheit.301 Wenn aber in jedem Punkt des Universums der Eindruck als Blickpunkt des Beobachters möglich ist, er wäre der Mittelpunkt des Universums, dann ist (unter Abstraktion vom göttlichen Einheitsgesichtspunkt) das Uni-versum immer schon ein Pluriversum. Die Paradoxien der ontologischen Einheitstheorien werden vermieden durch Kant. Obwohl auch er dem Willen zur Einheit folgt, verlegt er sie doch gemäß der kopernikanischen Wende in das Subjekt. So wird Einheit, statt eine metaphysische Voraussetzung zu sein, eine Leistung des Bewußtseins. Solche einheitsbildenden Leistungen nennt Kant Synthesis. Durch die synthetischen Leistungen der Einbildungskraft und des Verstandes werden die Vielheiten (Kant sagt: die Mannigfaltigkeit) der Empfindungen und der Vorstellungen zur Einheit von Erfahrungen und Urteilen organisiert. Einheit der Welt ist bei Kant hergestellte Einheit, hergestellt gemäß Regeln, die das Subjekt mitbringt. Die Vielheit der einheitsbildenden Operationen ist ihrerseits noch einmal zusammengefaßt gedacht in der höheren Einheit der transzendentalen Apperzeption, jenem berühmten Cogito, das alle Vorstellungen muß begleiten können. Nun muß aber der Einheit des Cogito eine Einheit des Cogitatum entsprechen. Das macht für Kant den Begriff der Welt aus. Einheit und Ganzheit sind durch die Struktur des Erkennens in unauflöslicher Weise miteinander verbunden. Irreversibel steht dahinter auch die kopernikanische Wende, so daß auch der Weltbegriff keine metaphysische Voraussetzung, sondern ein Konstrukt ist. Damit hört freilich Einheit auf, etwas vom Ursprung her garantieren zu können. Synthesis wird Kontingenz. Es könnte jeweils auch anders sein, und wir könnten auch anders verfahren. So entsteht die Frage (diesmal an Kant): Wozu überhaupt Einheit und nicht vielmehr Vielheit? 2.6.1.2 Kosten der Einheit Anders gesprochen, ist das die Frage nach den Kosten der Einheit.302 Verzichten wir mit dem Willen zur Einheit und der Auflösung von Differenz nicht auf zu viel? Und 301 Nikolaus von Cues: Philosophisch-theologische Schriften I, p. 398ff. 302 Unter dem Label „Kosten der Einheit“ tauchten nach 1990 Problematisierungen der ökonomischen Folgen der Integration der DDR in die BRD auf. Seit etwa 2015 werden zunehmend auch die problematischen Folgen der Brüsseler Bürokratie der EU und ihres Einheitsdenkens diskutiert und führten 2016 zur Entscheidung der Bevölkerung von Großbritannien, die EU zu verlassen. Das forcierte politische Einheitsdenken der Kommission – an der Stelle setzt dann bekanntlich Hegel an – sind wir überhaupt in der Lage, auf Differenz zu verzichten, oder entsteht sie nicht mit jeder Synthesis erneut? Gleichwohl, das soll bereits hier nicht verschwiegen werden, setzt auch Hegel mit der Selbsttransparenz des Geistes in seiner Entwicklung noch auf ein Einheitskonzept. Hegels Geheimnis303 als die Grenze der Selbsttransparenz findet erst in Adornos Negativer Dialektik ihren Ort. Sogar F. Schlegels Abschied vom Kant-Fichteschen „Ich“ im Begriff des „transzendentalen Wir“ macht lediglich nicht das Subjekt in seiner Singularität zum Bezugspunkt der Einheitsbildung, sondern die Kommunikation; ansonsten ist auch das Symphilosophieren unter dem Leitbegriff der polemischen Totalität noch der Einheitsvorstellung zugetan, nämlich als einer Einheit, die in sich selbst wie ein Organismus als Vielheit gegliedert ist. Und selbst an Nietzsche304 könnte man noch das, wenngleich für ihn nicht mehr einlösbare Streben nach Einheit aufdecken. ohne wirkliche demokratische Legitimation hat den Europa-Gedanken zugrunde gerichtet; und im Schatten der Einheitsillusion gedieh subversiv ein ungebremster Pluralismus der Egoismen zur Ausnutzung der „Einheit“. Immer schon war das die Politik Großbritanniens gewesen, die Einräumung von Sonderrechten zu verlangen, zeigte sich aber zuletzt sehr krass in der Frage der Verteilung der Lasten der Flüchtlinge in Europa. Unter diesem Zerfall der Einheit änderte sich auch die Bedeutung des „Wir“ in der Phrase der Bundeskanzlerin von Deutschland „Wir schaffen das“: 1) wir Deutschen –, 2) wir Deutschen mit Hilfe der anderen Europäer –, 3) wir Europäer mit Unterstützung des autokratischen Regimes der Türkei. Wer also sind „Wir“? Was ist jene Einheit noch jenseits der Brüsseler Kommission und ihres Illusionen-Oktrois und eines autokratischen Regimes außerhalb der EU? 303 K. Röttgers: Hegels Geheimnis.- In: Schweigen und Geheimnis, hrsg. v. K. Röttgers u. M. Schmitz-Emans. Essen 2002, p. 17-46. 304 Nietzsche spricht von einer „Subjekt-Vielheit“ und einem „Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte“. F. Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausg. V, p. 27. Aber so wie die Einheit der Gesellschaft keine Vorgegebenheit ist oder kein als notwendig zu unterstellender Vorgriff, wie die nochmodernen Hierarchiker und Konsensualisten glauben, sondern eine immer problematische Aufgabe, so ist auch die Einheit der Seele weder eine Vorgegebenheit noch eine durch pädagogische Identitätspflege zu erreichende Einheit, sondern ein Effekt eines Willens zur Macht in der Vielheit der Seelen-Triebe. Auch wenn Einheit nur eine Aufgabe ist, so besteht doch unzweifelhaft diese Aufgabe. Die Illusion ist eine notwendige Fiktion; denn die sogenannte Wahrheit z.B. über das Subjekt resultiert aus dem unvertilgbaren Willen, „Herr zu werden über das Vielerlei der Sensationen“, l. c. XII, p. 382. Politisch-philosophisch und wissenspolitisch bedeutet das Streben nach Einheit die Favorisierung von hierarchischen Ordnungsstrukturen, im Prinzip mon-archischer Art, weil – so die Begründungen von Denkern wie Thomas von Aquin und Dante – was durch einen getan werden kann, am besten auch durch den einen getan werden solle, so wie es ja auch nur Ein Gott war, der sich diese Welt erschuf. Also ist die Universalmonarchie die beste Regierungsform auf der Welt – so Dante.305 Nur scheinbar widerspricht dem der lange währende und theoretisch auf beiden Seiten gut abgestützte Streit zwischen weltlicher und geistlicher Macht im Mittelalter. Zurückgeführt wird dieser Streit auf einen Brief von Papst Gelasius I. an den oströmischen Kaiser Athanasius; dort heißt es: „Duo quippe sunt, imperator, auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas.“ Es sind Zweifel erlaubt, ob nicht der ursprüngliche Sinn der Aussage dem Sinn seiner Wirkungsgeschichte entgegengesetzt war, d.h. ob nicht gemeint war: es sind zwei und nur zwei Mächte und nicht viele, die diese Welt beherrschen; gewirkt aber hat der vielzitierte Satz als: es ist nicht eine Macht, sondern es sind zwei Mächte, die diese Welt beherrschen: Kaiser und Papst. Aber die Befürworter der Gleichberechtigung dieser zwei Mächte sind mitnichten Differenztheoretiker: sie verlegen lediglich die Einheit in die Transzendenz (nur in Gott ist Einheit), während diejenigen, die die Unterordnung der einen Macht unter die andere verlangen, die Einheit in dieser Welt verwirklicht wissen wollen, weil ja nicht Gott eine Welt geschaffen haben kann, die suboptimal geordnet ist, die also nicht mon-archisch/hierarchisch strukturiert wäre. Das wirkungsvolle Prinzip der reductio ad unum, das von Bonaventura folgendermaßen formuliert wurde „Omnis tamen haec varietas ad unum habet reduci summum et primum, in quo principaliter residet universalis omnium principatus“ 306, hat in Ockhams Razor sein erkenntnislogisches Äquivalent. Offensichtlich gibt es eine logische Überlegenheit von Theorien, die auf Einheit hin reduzieren können, gegenüber solchen, die eine Vielheit von Erscheinungsformen des Vernünftigen für schlechthin irreduzibel erklären müssen. Gibt es auch gute Gründe, apollinisch die Einheit zu lieben, so widerstreitet doch dem Streben nach Einheit ebenso hartnäckig eine dionysische Lust an der Vielheit. Der Pluralismus als diejenige metaphysische Doktrin, derzufolge die „reductio ad unum“ nicht möglich ist, nimmt an, daß mehr als ein einziges Prinzip, sei es der Welt, sei es des Wissens anzuerkennen sei. Dieser tritt vor allem in drei Hauptvarianten mit ihren jeweils spezifischen Begründungen auf, nämlich als psychologischer Pluralismus der vielen Seelen, als kosmologischer Pluralismus etwa eines Fontenelle und als Polytheismus. Die für den Pluralismus des 20. Jahrhunderts maßgebende Position 305 Dante Alighieri: Tutte le Opere. Florenz 1919, I, 4, p. 370ff. 306 Bonaventurs: Opera Omnia. Quaracchi 1882, V, p. 189. von William James ist zunächst nicht politisch gemeint, sondern beinhaltet im Ursprung eine religionsphilosophische Position, die dann metaphysisch begründet wird. Schon in der Einleitung zur Herausgabe der Schriften seines Vaters im Jahre 1884 stellt James fest, daß der Theismus des gewöhnlichen christlichen Gläubigen in Europa trotz aller Variationen im einzelnen immer dem Pluralismus, um nicht zu sagen dem Polytheismus treu geblieben ist.307 Daran, so begründet er, daß wir die Welt als eine Ansammlung oder Versammlung von verschiedenen Wesen betrachten, hat weder der jüdische noch der christliche Monotheismus etwas ändern können. Und zu dieser Grundvielfalt von Wesen gehören Gott, der Teufel, Christus, die Engel, die Heiligen und schließlich die Vielfalt menschlicher Wesen. Nur ein solcher Pluralismus gibt für die praktische Orientierung der Menschen eine tragfähige Basis ab. Die darüber hinausgehende, als religiöses Bekenntnis geforderte Einheit jenseits der Vielheit war für die Menschen immer ein bloßes Bekenntnis ohne praktischen Orientierungswert. In religiöser Hinsicht bedeutet das, daß die Menschen nur zu einem Gott, der ein „primus inter pares“ geistiger Wesen ist, ein persönliches und warmes Verhältnis ausbilden können. Dagegen sind die metaphysische Idee des Einen und Einzigen Wesens, die Idee der Einen Seele alles Seienden, das Erste Prinzip und dgl., also die Ideen der monistischen Metaphysik, immer nur blasse und abstrakte Begriffe einer Einheit, die als solche nicht verehrungswürdig erscheinen kann, mag sie auch von den Philosophen noch so gut begründet werden. Aber dieser Pluralismus läßt sich eben tatsächlich auch philosophisch begründen, und zwar dadurch, daß der Gedanke der Einheit der moralischen Orientierung nicht durchzuhalten ist. Die angemessene Moralität ist darauf gerichtet, gut zu handeln und das Gute zu tun; deswegen hat sie es immer mit Vielheiten zu schaffen. Darüber hinaus gibt es philosophisch einen Moralismus der Einheit, dem es nicht reicht, Gutes zu tun, sondern der darüber hinaus verlangt, gut zu sein, vielleicht sogar das Gute selbst zu verkörpern. James nennt ihn einen „morbiden“ Moralismus; erst für diesen stellt sich überhaupt die Frage nach dem Sein und damit die Frage nach der Einheit; denn dieser verzweifelte Moralismus benötigt zwecks Identifikation das Eine Gute. Noch etwas später gibt James dem Pluralismus eine über die Moralpragmatik hinausgehende Begründung ungefähr folgender Art: Zwar bemüht sich alle Wissenschaft um eine vereinheitlichende Erkenntnis der Welt, also um eine Einheit des Wissens, doch bleibt diese Einheit, wie jeder weiß, ein bloßer Grenzbegriff. Obwohl das so ist und jeder es weiß, wird das Residuum des Wissens als ein Negatives, Alogisches, Unbegriffliches ausgegrenzt. Es bleibt für diesen Einheitswillen ein bloßes factum brutum, ein Nichtidentisches und Unbegriffliches. Es gibt keine mögliche Position, von der aus die Vielfalt der Welt restfrei in die Einheit der Theorie überführt werden könnte. M.a.W.: 307 W. James: Essays in religion and morality.- In: ders.: Works XI. Cambridge/MA, London1982, p. 60. Die Welt ist keine Tatsache. Sie ist lediglich eine Ansammlung (collection), sie ist eine nicht auflösbare Vielheit von Monaden. So werden für James Monadenlehre und Polytheismus zu natürlichen Verbündeten. Damit wird die Möglichkeit der Einheitsbildung nicht bestritten, aber – so James – sofern man bereits Einheiten und Vielheiten im Raum des Wissens als gleichberechtigt nebeneinander bestehend konzedieren muß, sei dieses schon ein Beweis für den Pluralismus. Insofern weder Pluralisten noch erst recht Monisten die Einheit bestreiten können oder wollen, reduziert sich die Differenz auf die Darstellung von Wissensgehalten in der „All“-Form durch die Monisten oder der „Each“-Form durch die Pluralisten. Daß aber die Welt insgesamt aus Vielheiten besteht, beweist James folgendermaßen: Alles Einzelne, was existiert, existiert mit seiner Umwelt zusammen, mit der es im Austausch steht, so daß „Etwas“ immer zugleich heißt „Etwas-und-etwas-anderes“. Und es gibt nichts, das alles andere in sich enthält und keine Umwelt mehr hätte; andererseits gibt es aber auch kein absolut Einfaches, so daß Umwelt-Haben immer auch heißt Struktur-Haben. Pluralismus ist die eindeutige Absage an ein Denken des Ursprungs, an ein Denken der Einheit oder an ein Denken in der Logik der Hierarchie. Immer schon finden wir uns in Vielheiten, wir, die vielen, jeder von uns schon eine Vielheit. Natürlich kann man Einheiten bilden, und manchmal muß man das: jeder Begriff ist schon eine Einheitsbildung, aber auch Begriffe kommen immer schon als viele vor und jede Begriffsbildung hat „Kosten der Einheit“. Und Anfänge sind immer schon gemacht. Es kommt nirgendwo darauf an anzufangen, sondern das wesentliche Augenmerk gilt den Anschlüssen, den Übergängen und den Transformationen. 308 Hierarchien werden zu Inseln in einem im übrigen anders strukturierten Gesamtzusammenhang. Pluralismus heißt aber immer auch, die Realität von Konflikten zuzulassen. Vielleicht muß man sogar den Gesamtzusammenhang – mit einem Begriff der Romantiker – als „polemische Totalität“ ansprechen. Diese wird man nicht mehr durch eine Letztbegründung von Normen los, weil, wie Luhmann gezeigt hat, die Moralisierung selbst polemogen ist. Es kommt vielmehr darauf an, Konflikte zuzulassen und den kultivierten Umgang mit ihnen einzuüben. Dazu gehört der Respekt, der daraus folgt, daß die Kontrahenten sich gegenseitig als notwendige Teile eines Gesamtzusammenhangs anerkennen und sogar benötigen – Dissenskultur. Dieses ist jedoch eine sozialphilosophische Einsicht und nicht ihrerseits eine begründungsbedürftige Norm. Muß man sich zwischen Einheit und Vielheit entscheiden; muß man sich entscheiden, Pluralist oder Monist zu sein? Die Monadologie (Leibniz) kennt die Besonderheit der Monaden, die – so § 13 – notwendig eine „Vielheit in der Einheit“ beinhaltet. Eine solche Vielheit in der Monade, Erklärungsgrund für Veränderungen der Monade, kann nicht als eine Zusammensetzung aus Teilen gedacht werden; denn 308 K. Röttgers: Der Anfang vom Ende.- In: Anfänge und Übergänge, hrsg. v. K. Röttgers u. M. Schmitz-Emans. Essen 2003, p. 246-252. dann wären ja jene Teile der Monaden die wahren einfachen Substanzen, die Monaden usw.. Sie werden vielmehr gedacht als Folge der Perzeptionen, hervorgerufen von einem Begehren. Leibniz sagt: „Wir können uns selbst durch Erfahrung von der Vielheit in der einfachen Substanz überzeugen, wenn uns einmal aufgeht, daß der geringste Gedanke, dessen wir uns bewußt sind, eine Mannigfaltigkeit im Gegenstande in sich befaßt. Somit müssen alle diejenigen, welche zugeben, daß die Seele eine einfache Substanz ist, auch diese Vielheit in der Monade anerkennen ...“309 Zweites Beispiel: Kant. Eingeführt hatten wir Kant als einen Liebhaber der Einheit, und das ist im Prinzip auch richtig. Für die theoretische Philosophie Kants gilt Einheit zusammen mit Vielheit und Allheit als eine der Kategorien des Verstandes, nämlich als eine Kategorie der Quantität, wobei nun in der Tat Kant die Dichotomie Einheit vs. Vielheit auflöst, die eine Entscheidung zu verlangen scheint, indem er die dritte Kategorie der Totalität einführt, von der er sagt, sie sei nichts anderes als die „Vielheit als Einheit betrachtet“. Das hört sich schön an, gibt aber doch zu denken. Denn offenbar kann sich Kant nur genau diese eine Verknüpfung zwischen Einheit und Vielheit vorstellen, nämlich die Vielheit als Einheit zu betrachten. Leibniz hatte jedoch auch die andere Spur gewiesen, nämlich die Einheit als Vielheit zu betrachten. Wie auch immer man dieses Defizit bewerten mag, es bleibt eindeutig, daß bei Kant eine Entscheidung deswegen unnötig wird, weil sich Vielheit auch als Einheit betrachten läßt, so daß der zwischen Einheit und Vielheit angebrachte Zeiger bei Kant in Richtung Einheit tendiert, was die Wissenswelten betrifft, in denen wir uns bewegen. Noch eindeutiger wird die Einheitsorientierung in seiner praktischen Philosophie. Zwar wird auch hier Vielheit nicht ausgeschlossen, so daß es auch hier keiner Entscheidung dieser Dichotomie bedarf, aber hier wird doch die Einheit als Allgemeinheit des Sittengesetzes in seiner Form als kategorischer Imperativ als die alleinige Grundlage gewählt; die Vielheit der Zwecksetzungen oder die Allheit als System ebendieser Zwecksetzungen sind nur mögliche Veranschaulichungen, sind aber als Begründung der sittlichen Forderung ungeeignet, so daß auch in dieser Frage die theoretische und die praktische Philosophie Kants nicht analog gebaut sind. Wenn wir nun einige Blicke auf die Kostengeschichte des Strebens nach Einheit werfen wollen, so können wir ebenfalls bequem von Kant ausgehen. Ich wähle den § 88 der Anthropologie, der von dem höchsten moralisch-physischen Gut spricht. Kant geht zunächst davon aus, daß das moralische und das physische höchste Gut nicht einfach vermischt werden dürften, weil sie sich dann gegenseitig vernichteten. 310 Es ist der Kampf der zwei Prinzipien, der die Humanität des sozialen Umgangs ausmacht. In der Ausgestaltung dieser nicht-nivellierenden Vereinigung von Wohlleben 309 G. W. Leibniz: Monadologie, hrsg. v. H. Glockner. 2. Aufl. Stuttgart 1966, § 16, p. 14; zur Erläuterung: Monadologie, hrsg. v. H. Busche. 310 Ausführlich dazu K. Röttgers: Kritik der kulinarischen Vernunft. Bielefeld 2009. und Tugend lernen wir einen Kant kennen, der neben dem Willen zur Einheit durchaus auch eine Lust an der Vielheit kennt. Er spricht von den guten Mahlzeiten und den geselligen Vergnügen, bei denen gepflegte Gespräche geführt werden, durch die die Menschen sich so unterhalten, daß sie „einander selbst zu genießen die Absicht haben“. Kant hat ziemlich genaue Vorstellungen davon, was zerstörerisch oder hinderlich für die Entfaltung eines solchen geselligen Gesprächs anläßlich einer guten Mahlzeit sein wird: Musik, Tanz und Spiel. Sie stören oder zerstören die angestrebte Verbindung von Wohlleben und Tugend, weil sie die „Conversation“ hindern. Aber auch die bloße gute Mahlzeit (als „Gelag und Abfütterung“ bezeichnet) ist nach Kant geschmacklos. Die Mahlzeit ist die Form der Organisierung des geistreichen Gesprächs. Wesentlich ist das belebende Spiel der Gedanken in einer Gesellschaft, d.h. die Vielfalt. Kant verdammt daher den „Solipsismus convictorii“. Ein philosophierender Gelehrter dürfe einfach nicht alleine speisen, das sei sogar ungesund, sagt er. Denn der Philosophierende trage seine Gedanken immer mit sich herum, er kann sie nicht ablegen, wie es die Wissenschaftler der empirischen Wissenschaften können. Also wird er auch beim „Solipsismus convictorii“ von seinen Gedanken gequält, so daß sein Essen zur erschöpfenden Arbeit, nicht zur Erholung der Kräfte gerät, wohingegen ein Mahl in guter Gesellschaft ihm eine Vielheit von Anregungen und Ablenkungen von seinen festgefahrenen Gedanken geboten hätte. Die Vielheit der Gerichte an einer reichen Tafel hält diese Vielfalt der Gespräche in Gang. Es ist diese von Kant nicht ausgeführte vierte Kritik, die die Vielheit rehabilitiert. Hier ist von den „Gesetzen der verfeinerten Menschheit“ (im Plural!) die Rede statt von dem einen Sittengesetz. „Der Purism ... ohne gesellschaftliches Wohlleben“ ist für ihn hier eine verzerrte Gestalt der Tugend. Und daß es sich dabei um die nicht aufzulösende Auseinandersetzung von Einheit und Vielheit handelt, wird überdeutlich durch Anm. 3 dieses Paragraphen. Hier wird nämlich der philosophierende Gelehrte, der – wie gesagt – besser nicht alleine speisen sollte, unterschieden von dem Begriff des Philosophen, der eine Idee bezeichnet und von dem daher überhaupt nur im Singular die Rede sein kann. Im Plural von den Philosophen zu reden, hieße, eine Vielheit anzunehmen von dem, „was doch absolute Einheit ist“. Das korrespondiert mit einer Bemerkung der „Kritik der reinen Vernunft“,311 wo davon die Rede ist, daß das Ich der Transzendentalen Apperzeption, ein „Singular“ ist, „der nicht in eine Vielheit der Subjekte aufgelöst werden kann.“ Die Kostengeschichte des Einheitswillens beginnt in der Marginalität dieser apokryphen „Kritik der kulinarischen Vernunft“, setzt sich aber in der Kantschule mit großer Eindeutigkeit fort. Stellte Kant noch das Lachen an das Ende des geselligen Mahls als Formgestalt der Vereinigung von Wohlleben und Tugend, so vergeht dem Einheitswillen in der Nachfolge Kants das Lachen. Mit Jakob Sigismund Beck 311 B 407. und Johann Gottlieb Fichte erstehen jene Standpunktsphilosophien, die – so explizit bei Beck – vom „einzig möglichen Standpunkt“ sprechen. Diese Philosophien nehmen ein topologisches Modell als Muster ihrer Einheitsphilosophien in Anspruch, für das der Berggipfel steht. Es gibt einen Standpunkt – und das ist der Gipfel des Berges –, der alles unter sich läßt und von dem aus alles andere überblickt werden kann. Dieser Ort ist der Standpunkt, von dem aus alles Wahre gesehen werden kann und den einzunehmen deswegen zugleich auch eine moralische Pflicht ist. Wer von einem solchen Standpunkt spricht, hat ihn natürlich längst eingenommen, er wohnt gewissermaßen auf dem Monte Verità und kann auf alle anderen herabblicken. Diesen historischen Hintergrund möchte ich zu der These verallgemeinern: Jeder einzig mögliche Standpunkt findet den Gipfel eines anderen einzig möglichen vor, den er zwar in einem agonalen Konsenserzwingungsspiel niederzuringen hoffen muß, für den aber maximal erwartet werden kann, daß jeder von der Kritik der anderen derart profitieren kann, daß er Gelegenheit hat, seine eigene Position verbessert auszubauen. In der Metaperspektive ergibt sich durch diese von Friedrich Schlegel im Rahmen seiner Programmatik des Symphilosophierens so genannte „polemische Totalität“ ein Perspektivismus der sich ergänzenden Gesichtspunkte. Einheitsphilosophien sind oftmals nicht in der Lage, diesen Ebenenwechsel vorzusehen. – Ergänzend sei jedoch – sozusagen die Kosten der Vielheit – hinzugefügt, daß Vielheitsphilosophien oftmals in der Gleichgültigkeit eines Relativismus enden, dann nämlich, wenn sie die Ausgangsebene der Auseinandersetzung ein für alle Mal verlassen zu haben glauben und dadurch vergessen machen, daß es den Anspruch der Philosophie ausmacht, wahres Wissen anzustreben und nicht eine „philosophy“ beliebig tolerierbarer Meinungen. Insofern muß es im folgenden unsere Tendenz sein, die Kosten der Einheit, von denen wir sprechen, zwar zur Kenntnis zu nehmen und als Nebenfolgen des Einheitswillens einzukalkulieren, aber nicht zu versuchen, sie grundsätzlich zu vermeiden; denn auch der Verzicht auf Einheit hat seine Kosten. Pascal hat diese beiderseitigen Folgekosten in einer unnachahmlich klaren Formulierung so ausgedrückt: „ Die Vielheit, die sich nicht zur Einheit zusammenschließt, ist Verwirrung; die Einheit, die nicht von der Vielheit abhängig ist, ist Tyrannis.“ 312 Im folgenden möchte ich eine Alternative vorschlagen. Im Sinne der angesprochenen polemischen Totalität sieht diese eine Mélange vor. Sie richtet ihr Augenmerk zuerst auf den Zusammenhang von Kant und seinem kaum bekannten Kollegen auf dem Lehrstuhl für Praktische Philosophie in Königsberg, Christian Jakob Kraus: Zigeunerforscher, Skeptiker, Hume-Übersetzer, Tischgenosse Kants und Vertreter einer nomadischen Alternative der Aufklärung im Gegensatz zur seßhaften und ihr 312 B. Pascal: Über die Religion und über einige andere Gegenstände Pensées), hrsg. v. E. Wasmuth. Heidelberg 1946, p. 420 (Nr. 871). Land vermessenden Vernunft à la Kant.313 Diese nomadische Alternative ist für die seßhafte Vernunft der Landvermesser zutiefst bedrohlich, zugleich aber ist diese Angst der ersitzenden Vernunft vor der beweglichen mitverantwortlich für deren Beweglichkeit. Denn überall in jenem reizenden Land der Wahrheit hat die Vernunft, die jedem Ding seine ihm gehörige Stelle zuweisen möchte, Galgen errichtet für die Nomaden, die den beständigen Anbau „verabscheuen“. Nomadismus ist auch eine Fluchtbahn, auf der die Skeptiker gleich der Kugel im Flipperautomaten durch ständige Abwehr in Bewegung gehalten werden. Daß diese Nomaden auf ihrer Bahn zwischen den diversen Galgen hindurch offensichtlich glücklich sein können und sich nicht in ständigem Wehklagen über ihre Nichtseßhaftigkeit ergehen, jagt den entbehrungsreich Seßhaften den Schrecken in die Glieder. Sollten nicht etwa jene, sondern sie selbst die Orte der Vernunft falsch bestimmt haben? Dagegen hilft nur die harte Beteuerung, daß die Vernunft nicht dazu dienen könne, uns glücklich zu machen. Auf diese Weise bricht die nomadische Bewegung in die Ordnung der Seßhaftigkeit ein. Hält der Galgen die Nomaden in Bewegung, so hält er die Seßhaften in der Furcht vor der Bewegung. Die Zuweisungsgeste ordnet eine chaotische Vielfalt. Aber es gibt Hyperordnungen, die durch ein Zuviel an Ordnungsstrukturen die Orientierung verunmöglichen, solche Hyperordnungen werden oftmals als Labyrinthe bezeichnet. Als die Welt noch zweidimensional war, brauchte man nur die dritte Dimension zu betreten, um den absoluten Überblick zu gewinnen. Wenn es aber mehrere Überblicker gibt, mehrere einzig mögliche Standpunkte, von denen aus die „wahre“ Struktur der zweidimensionalen Welt durchschaut werden kann, dann reproduziert sich das zu lösende Problem, und es wiederholt sich in jeder weiteren Dimension. Der absolute Überblick ist unmöglich geworden, ja jeder Versuch, ihn zu gewinnen, verschärft nur das Problem. Die Labyrinthe wachsen in alle Richtungen und in alle Dimensionen. Wie aber kann die Mélange aussehen? Finden wir uns doch damit ab, daß der uralte Traum der Menschheit und der Philosophen nach einer Einheit und einer einheitlichen Ordnung des Wissens unerfüllbar ist – oder, wenn wir weiter von partiellen Überblicken sprechen wollen, daß diese durch polemische Totalität, durch Mißverstehen und durch Dissens gekennzeichnet sind. Um Wittgenstein abzuwandeln, könnte man sagen: Sag nicht: Es muß doch eine Einheit geben, sondern schau hin. Und was Du dann siehst, ist die Vielfalt der Sprachspiele, der Lebensformen und der Wissenswelten und ihre vielfältigen Verknüpfungen und Anschlußstellen. Und jede dieser Welten hat die Gestalt eines Labyrinths, aus dem deswegen ein Entkommen unmöglich ist, weil jedes gelöste Problem hundert neue Fragen aufwirft, d.h. jedes 313 Mehr dazu: K. Röttgers: Kants Kollege und seine ungeschriebene Schrift über die Zigeuner. Heidelberg 1993. Mal das Labyrinth vergrößert. Der Zusammenhang der Labyrinthe ist selbst ein Labyrinth, so daß ein temporärer Überblick nichts nützt. Falls Neil Armstrong auf dem Mond gewesen sein sollte, ist die ausgesucht dumme Bemerkung, die er von dort an die Heimat sandte, Indiz dafür, daß der bislang größtmögliche Überblick absolut nichts erbracht hat, und wahrscheinlich haben ihm ja auch wohlmeinende Souffleure zu Hause diesen Satz mitgegeben. Ariadne hat versagt: der methodische Leitfaden führt uns nicht mehr aus dem Labyrinth hinaus, eine kartographische Repräsentation unserer Position in den Wissenswelten ist nicht mehr möglich. Der Wille zum Überblick eröffnet nur weitere Dimensionen des Labyrinths. In dieser Situation muß die Orientierung eine strategische sein, gekennzeichnet nicht mehr von Einheit, aber auch nicht von Beliebigkeit. Wie dem auch sei, es ist die Konsensorientierung, verbunden mit dem Glauben an die Einfachheit der Wahrheit, die es den Kontrahenten unmöglich macht, aus dem Stellungskampf herauszufinden. Versuchen wir es doch deswegen – zetetisch! – einmal mit dem Gegenteil: Dissens ist förderlich und daher erstrebenswert, und die Wahrheit kommt nur in perspektivischen Differenzen, d.h. nicht als Einfachheit, vor. Das macht es für den Beobachter nicht einfacher, sondern bringt ihn selbst in eine paradoxe Situation. Er muß argumentieren können, warum der Streit der Kontrahenten nicht weiterführt, nicht weiterführen kann, und er darf diese Einsicht nicht als endgültige Einsicht ausgeben. Mit anderen Worten er muß zugleich die Sinnlosigkeit des konsensorientierten Streits um die einzige Wahrheit wissen und für diese Überzeugung eintreten und zugleich einer sein, der sich einmischt, dieses Spiel mitspielt, indem er dieses tatsächlich offensiv vertritt. Das geht nur mit einer skeptischen Grundhaltung, die die Einheitsvorstellung (am Ursprung oder am Ziel der Bemühungen) aufgegeben hat zugunsten einer Anschlußorientierung in einem labyrinthischen Mehrebenenspiel. Postmodern daran ist, daß die Orientierung an einem „heiligen“ Ursprung, einer Arché, aufgegeben worden ist, weil dieses Heile oder Heil-Sein-Sollende, sei es eine übergreifende Ordnung, sei es der ewige „Mensch“, das „Subjekt“, das „Individuum“, die „Person“, theoretisch nicht mehr zur Verfügung steht oder praktisch nur noch den atavistischen Kampf darauf gegründeter Fundamentalismen hervorbringt. An die Stelle der Ordnung tritt das Labyrinth mit seiner Netzstruktur, an die Stelle des autonomen Subjekts das verführte.314 Die Bewegung in labyrinthischen Vielheiten gleicht dem Erwandern einer Landschaft ohne Karte. Es muß auf Einzelheiten achten und diese zu einer sinnerschließenden Bahn arrangieren. 2.6.1.3 314 Pluralität im Anfang Zum Gedanken der Labyrinthik s.u. und K. Röttgers: Arbeit am Mythos des Labyrinths.In: Das Daedalus-Prinzip, hrsg. v. L. Kais. Berlin 2009, p. 13-37; zum Gedanken des verführten Subjekts s. ders.: Autonomes und verführtes Subjekt. 2.6.1.3.1 Heidegger (R. Schürmann) Das Lager der Gegner des Einheitsdenkens bildet keine Einheit – wie sollte es auch anders sein? Die Uneinheitlichkeit kann sich entweder auf den Ursprung oder Anfang beziehen oder aber bereits auf den Fehler, überhaupt einen Ursprung identifizieren zu wollen, bzw. zu müssen. Novalis – wie bereits oben einmal zitiert – notierte: „(Wozu überhaupt ein Anfang? Dieser unphilosophische oder halbphilosophische Zweck führt zu allen Irrthümern.) Theorie der Berührung – des Übergangs – Geheimniß der Transsubstantiation.“315 Auf die daraus hervorgehende Philosophie der Berührung und Verführung wird am Ende dieses Abschnitts zurückzukommen sein. Läßt man aber die Ursprungs-Orientierung mit der Maßgabe der Uneinheitlichkeit dieses Anfangens zu, dann gibt es auch dafür verschiedene Modelle. Eins dieser Modelle ist von Heidegger in seiner seinsgeschichtlichen Wendung vorgezeichnet. Er fordert den „anderen Anfang“. Hier wie auch in der sozialphilosophischen Rede von dem Anderen ist der (oder das) Andere immer das zweite. Gleichwohl ist bei Heidegger dieser andere Anfang einer, einer, der mit dem ersten Anfang in einer verborgenen Verbindung steht. Daraus ergibt sich die Frage, erstmals von Reiner Schürmann aufgeworfen, ob dieser zweite, dieser „andere Anfang“ nicht zu einer Pluralität anderer Anfänge fortgeschrieben werden müßte, eine Frage, die uns später anläßlich von Nancy weiter beschäftigen wird. Damit kommen wir auch schon zum zweiten, gegenüber dem ersten erweiterten Modell. Es setzt von vornherein eine Pluralität der Anfänge. Seine frühesten Ausprägungen findet dieses Modell in der antiken Atom-Theorie bei Demokrit und dann vor allem bei Lukrez. Wir werden es bei Michel Serres und bei Jean-Luc Nancy wiederfinden. Pluralistisches Denken kann sich der Einheit nicht grundsätzlich sperren, ohne nämlich aufzuhören zu denken, was auch der Pragmatismus von William James wußte. 316 Und so haben Vielheitsdenker immer mitbedacht, wie aus Vielheiten Einheiten hervorgehend gedacht werden können. Auf jeweils sehr unterschiedliche Weise haben Leibniz, Hobbes und auch Nietzsche an diesem Problem gearbeitet. Das dritte Modell in der Verabschiedung der Einheit im Ursprung, was man auch das Plotin-Syndrom nennen könnte, nimmt nicht von der Pluralität (im Zweifelsfall gar der Diffusität) seinen Ausgang, sondern von der Differenz. Auch die Philosophien der Differenz317 gliedern sich in diejenigen, die Differenz für unaufhebbar halten, und diejenigen, die Verfahren der Einheitsbildung im Ausgang von Differenz 315 Novalis: Schriften, III, p. 383. 316 K. Röttgers: Freiheit: liberalistisch – pluralistisch, bes. p. 49-55. 317 Zur Darstellung s. H. Kimmerle: Philosophien der Differenz. Würzburg 2000; F. Dastur: Philosophie et Différence. Chatou 2004. vorsehen. Aber selbst diese Differenz unter den Differenztheoretikern ist keine grundsätzliche. Zu den ersteren zählt Jacques Derrida, zu den letzteren Hegel. Dem Zeitalter Hegels verdankt sich eine Tendenz, Entzweiung318 und in der Konsequenz Reflexion319 als Signatur der Moderne anzusehen. Dieses Denken prägte sich dann auch seit der Frühromantik im Verfahren der Kritik aus. 320 Eine andere Konsequenz ist das Alteritätsdenken, dessen Konjunktur in den Anerkennungstheorien der Spätmoderne erneut aufblüht. In der Postmoderne, die sowohl die Figur der Kritik als auch die der Anerkennung beiseitegeschoben hat, die demnach nicht mehr reflexionsbasiert ist, indem sie Identität nicht mehr subjektzentriert, sondern medialitätszentriert faßt, treten gleichwohl sowohl pluralistische als auch differenztheoretische Versionen in der Deutung der Immanenz des Zwischen, des Mediums, nebeneinander auf. Ein solches Nebeneinander – als Nebeneinander – neigt sich eher den pluralistischen Tendenzen zu, ohne daß man das forcieren oder pressen müßte. Beide postmoderne Tendenzen müssen schließlich in den Begriffskreisen von Berührung, Verführung, Verschränkung und Verfugung erprobt werden. Das mündet zuletzt in den labyrinthischen Tanz und in die Frage nach dem Überleben des Doppelgängers, zwei Aspekte, die uns dann in den folgenden Abschnitten näher beschäftigen werden. Reiner Schürmann gibt in seinem Buch mit dem paradoxen Titel „Le principe d’anarchie“ Heideggers Aussicht auf den anderen Anfang eine doppelte Interpretation.321 Einmal bedeutet der „andere Anfang“ den zu erwartenden und zu bereitenden Beginn einer Epoche und das Enden des Zeitalters der Seinsvergessenheit, d.h. die Epochenschwelle zur – wie wir sagen: – Postmoderne. Zum anderen bedeutet dieser 318 Zur Philosophie der Enzweiung vor allem bei Joachim Ritter s. O. Marquard: Zukunft braucht Herkunft. Bemerkungen zu Joachim Ritters Philosophie der Entzweiung.- In: Politik und Kultur nach der Aufklärung. Fs. f. H. Lübbe. Basel 1992, p. 96-197. 319 Zum Spiegel als Bild der Reflexion s. R. Konersmann: Von Angesicht zu Angesicht. Der Spiegel als Metapher des Subjekts.- In: Neue Rundschau 100 (1989), H. 4, p.103-121; ders.: Lebendige Spiegel: Die Metapher des Subjekts. Frankfurt a. M. 1991. 320 K. Röttgers: Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx. Berlin, New York 1975; differenzierter ders.: Kritik.- In: Enzyklopädie Philosophie, hrsg. v. H. J. Sandkühler. Hamburg 1999, I, p. 738-746; sowie ders.: Identität als Ereignis, p. 167176; s. jetzt ferner P. Gehring: Macht und Kritik. Über Machtanalyse als Kritikform.- In: Dt. Jb. Philosophie VI: Macht und Reflexion, hrsg. v. H. Hastedt u.a. Hamburg 2016, p. 83-103. 321 R. Schürmann: Le principe d’anarchie. Bienne, Paris 2013, p. 194. andere Anfang als Wiederholung des ersten Anfangs auch den Ausgangspunkt eines Denkens und Fragens, das nicht nur nach dem Sein des Seienden fragt, sondern radikaler nach der Wahrheit des Seyns, eine Frage die der erste Anfang bei den Griechen noch nicht stellen konnte. Weil aber im Konzept des „anderen Anfangs“ beide Versionen konvergieren, ist das Denken bei Heidegger als ein Praxisvollzug zu verstehen, der imstande ist, die Welt zu verändern. Heidegger hatte in seinem Logos-Aufsatz folgendes gesagt, auf das sich Schürmann bezieht: „Das Wort der Denker hat keine Autorität. Das Wort der Denker kennt keine Autoren im Sinne der Schriftsteller … Das Wort des Denkens ruht in der Ernüchterung zu dem, was es sagt. Gleichwohl verändert das Denken die Welt.“322 Schürmann faßt zusammen: „La parole des penseurs ne connaît pas d’auteurs.“323 In diesem Gestus fallen epochaler Diskursbruch und das Denken der Denker zusammen in einem einzigen Er-eignis. Ein solcher Diskurs-Bruch bricht auch ein in den Humanismus der Identitäts-Kontinuitäten. Der handlungstheoretischen Vorstellung, die von Zwecksetzung und Mitteleinsatz beherrscht ist, widerspricht die vorsokratische Vorstellung des Ursprungs. Dieser ist nicht arché, als Zusammenfall von commencement und commandement, sondern ist – wie Schürmann sagt – an-archisch, d.h. arché-frei. Für die Vorsokratiker ist der Ursprung ein Auftauchen, ein In-Erscheinung-Treten, „leur simple venue à la présence.“324 Heidegger verdeutlicht diesen Zusammenfall von „ursprünglich und anfänglich“, z.B.: „Weil das Wort ursprünglich und anfänglich entbergend das Unverborgene als ein solches ‚sammelt‘ (liest), deshalb wird das sagende Sammeln zum ausgezeichneten légein – deshalb bedeutet von früh an légein, als Sammeln, zugleich Sagen. Denken und Dichten sind, obzwar in grundverschiedener Weise ursprünglich (und be-ginnlich) das Selbe: das sich im Wort sammelnde Hervorbringen des Seins ins Wort. Hier, in diesem jetzt genannten Wesensbereich, nähern wir uns erst dem Quellgebiet, aus dem das geheimnisvolle Widerspiel des Dichtens und Denkens bei den Griechen im Einklang mit jenem Hervorbringen entspringt, das wir als das Bauende und Bildende kennen – aber noch längst nicht wissen.“325 So ist die Sammlung der ursprüngliche Sinn des Sagens, aber zugleich auch der Beginn des Sprechens. Freilich ist dieses ursprüngliche légein/Sammeln nicht durch einen vor ihm liegenden Ursprung verursacht. Es geschieht. Und der Mensch ist nicht der Ursprung des Sagens, etwa aus einem vorgängigen Meinen heraus, als Ursache 322 M. Heidegger: Gesamtausgabe VII. Frankfurt a. M. 2000, p. 234. 323 R. Schürmann: Le principe d’anarchie, p. 196. 324 l. c., p. 144. 325 M. Heidegger: Gesamtausgabe LV. Frankfurt a. M. 1979, p. 370. seines Sagens, und er ist nicht der Urheber seines Sagens, sondern er steht im Dienste – in der Verfügung – dieses Vollzugs. Heidegger durchstreicht somit einen vermeintlichen Ursprung vor dem Ursprung. In Heideggers Denken des Seyns geht es mithin nicht mehr um zu be-handelndes Seiendes, und sei dieses auch „der“ Mensch, sondern es geht um die Praxis des denkerischen und dichterischen Vollzugs des Seyns, in dem sich Vielheiten er-eignen, d.h. wörtlich: vor Augen erscheinen. Der Ursprung so gefaßt und begriffen, ist dann nicht mehr der Anfang allen Seienden, sondern dieses Er-eignen begründet multiple Identität, also eine im Zwischen (Medium) beheimatete Zusammengehörigkeit von Vielheiten. Die klassische Metaphysik – als Mainstrean-Henologie – hat immer ein einziges Erstes gesucht, das das Erkennen und das Handeln organisieren könnte: ein Principium; und An-Archie bedeutet demgegenüber „le déperissement d’une telle règle.“326 Und die These ist dann, daß nur eine Philosophie des Übergangs diesen Widerspruch denken kann. Die Dekonstruktion der Metaphysik, die den Unterschied des Theoretischen und des Praktischen, der theoretischen und der praktischen Philosophie zusammenbrechen läßt mit dem Begriff der Gelassenheit eine Form in Erscheinung treten läßt, die als „Auftauchen“ („venue à la présence“), und zwar als Auftauchen von Vielheiten bezeichnet werden muß. Die Vielheiten des Geschehenlassens und des Auftauchens ersetzen in den späten, den dekonstruktiv-postmodernen Texten Heideggers die Einheit etwa eines Führerprinzips. 2.6.1.3.2 Lukrez Nachdem wir in Schürmanns Anschluß an Heidegger eine kryptisch angelegte Vielheit bei Heidegger entdecken konnten, soll es jetzt um explizit pluralistisches ontologisches Denken gehen; dazu beziehen wir uns zuerst auf Lukrez. In seiner unvollendet gebliebenen Schrift „De rerum natura“ folgt Lukrez der Atomistik Demokrits. Danach existiert die Welt als eine Vielheit von Atomen, kleinsten, nicht mehr teilbaren Körperchen, die sich in ständiger Bewegung zwischen Trennung und Isolation befinden. Die Anzahl dieser Körperchen ist unendlich, die Geschwindigkeit ihrer Bewegungen unglaublich groß. Sie kommen auch von außerhalb der Welt, und zwar treten sie durch Höhlungen (per caulos) in sie ein, aber ebenso auch wieder hinaus. Diese Körperchen verbinden sich miteinander in zufälliger Weise, d.h. ohne kausale Determination, zu größeren Körpern. Doch diese Zufälligkeit hat eine erkennbare Struktur, nämlich die Abweichung (clinamen) von ihren regulären Bewegungsbahnen. Lukrez ist in der Nachfolge von Archimedes einerseits, von Demokrit andererseits einer der ersten, der sich mit Turbulenzen befaßt hat und sie als Effekte von „clinamen“, kleinsten Abweichungen in den Bahnen der Atome gedeutet hat. Das clinamen führt zunächst zu Wirbeln, zu Turbulenzen in der Ordnung der Welt. So hat 326 R. Schürmann: Le principe d’anarcie, p. 15. – gewissermaßen eine Vorwegnahme der Chaostheorie unserer Tage – eine kleine Abweichung u.U. gravierende Folgen. Diesen Vorgang kann man an der Wolkenbildung beobachten. Wolken wachsen aus kleinsten, vielleicht unsichtbaren Partikeln zusammen, aber ihre Zusammensetzung ändert sich unaufhörlich. Auch wenn und wie viele solche Körperchen zusammenkommen, sind sie in der Wolke doch nur schwach, instabil und flexibel miteinander verbunden; gleichwohl hält die Verbindung, ja kleine Wolken verbinden sich u.U. zu großen. Die allerersten solcher Verbindungen der Körperchen sind so schwach und flüchtig, daß sie dem menschlichen Auge unsichtbar bleiben. Wenn aber das Zusammenkommen (coitus) sich stärker ausprägt, treten sie in die Sichtbarkeit ein. Im Phänomen der Wolke wird der Pluralismus am Ursprung der Welt am ersichtlichsten. Ihr Ort ist allemal das Zwischen (wörtlich das Meteorische). Michel Serres hat dieser Theorie eine eingehende und die Modernität von Lukrez beleuchtende Interpretation gegeben. 327 Serres bekennt: „La physique atomiste [nämlich die des Lukrez] est la nôtre.“328 Dabei sind die Wolken nur eines der Phänomene im Zwischen, sie gehören zu den „météores“, wie Regen, Hagel, Wind, aber natürlich auch die Meteoriten. Wellen sind geordnete Bewegungen der Dynamik von Flüssigkeiten, Turbulenzen verdanken sich nun kleinsten Winkel-Abweichungen in diesen Wellenbahnen. Nur der Unwahrscheinlichkeit dieser geringen Abweichungen (clinamen) vom Gleichgewicht der geordneten Bewegungsformen verdanken sich letzten Endes auch so etwas wie das Leben und alle seine Erscheinungsformen. Die physikalische Theorie der Turbulenzen enthält ein Paradoxon. Einerseits gibt die Wellenbewegung selbst, und zwar unter Gesichtspunkten der Ordnung, auf den ersten Blick das Bild eines Chaos ab. Tatsächlich aber folgen die Atome in der Wellenbewegung einer strengen Ordnung der Abfolge und der Parallelität. In diese Ordnung nun führt die Turbulenz eine neue Unordnung ein. Das aber heißt, die Unordnung entsteht aus der Ordnung. Andererseits aber versucht die Physik, die Entstehung der Ordnung aus dem Chaos der Atome zu erklären. Unter diesem Aspekt erklärt gerade die Turbulenz den Übergang in die Ordnung. Und so ergibt sich ein Widerspruch. Bei Lukrez ist das Chaos, aus dem alles sich zu einer Ordnung zusammenfügt, eine Wolke, „chaos-nuage“, bzw. „nébuleuse première“. „Ordre ou désordre, il est difficile d’en décider“, sagt Serres.329 Die Wortwahl bei Lukrez ist in dieser Hinsicht bezeichnend. Er verwendet viele Wörter mit der separierenden Vorsilbe deoder dis-, um diese Spaltung, diese Rückkehr zum Chaos zu bezeichnen. Und in dieser Auflösungsbewegung wird sichtbar, was allein stabil ist: das kleinste Teilchen, 327 M. Serres: La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences. Paris 1977. 328 l. c., p. 152. 329 l. c., p. 37. das Atom. Die Spaltung und die Verbindung über Ähnlichkeiten erzeugen Stabilitäten, so sind Erde und Wasser, Feuer und Luft, sowohl voneinander getrennt, als auch durch Ähnlichkeiten verbunden: die Differenz erzeugt Ordnungen, die Abweichung dagegen Unordnung. Im Grunde aber ist es derselbe Operator, der beides bewirkt. Das Wort „Turbulenz“ mischt dementsprechend semantisch zwei lat. Wörter: turba und turbo. Das erste bezeichnet eine Menge, insbesondere eine Menge in Aufruhr, einen Tumult, und im griech. turbé auch einen bacchantischen Tanz, das letztere meint eine Holzschachtel, einen Kegel oder einen Spiralwirbel: „L’origine des choses et le commencement de l’ordre consistent simplement dans ce passage fin entre turba et turbo, incalculable population agitée d’orages, de troubles, et mouvement tourbillonaire.“330 Alles entsteht aus einer Wolke, einer Chaos-Wolke, aus einem Fließenden wie Aphrodite aus dem Meer und aus den Turbulenzen. Die Turbulenz als Ursprung verweist auf eine doppelte, gegensätzliche Bewegung, die doch einem einzigen Gesetz folgt. Dieses erlaubt es, das Gleichgewicht der Ordnung durch das Fließende hindurch und das Fließen durch die Ordnung hindurch zu verfolgen, so wie auch Geburt und Tod ein und demselben Gesetz des Werdens folgen. Denn auch das Gleichgewicht, auf das die Mechanik der Neuzeit so viel Wert gelegt und es als den Normalfall herausgestellt hatte, ist immer schon prekär und enthält die Abweichung, das macht sie zerbrechlich und temporär. Insofern ist auch die Welt als Ganzes, da sie dem Nichts und dem Chaos der Atome entstammt, nur vorübergehend und dem Untergang geweiht. Das Ende der Welt hat mit ihrem Beginn schon begonnen. Während die klassisch neuzeitlich Physik im wesentlichen auf eine Physik im Labor hinausläuft, also eine, die sich einschließt oder abschließt, gibt die Begründung der Physik durch Lukrez das Modell einer zur Welt hin offenen Physik ab: „La physique atomiste est une critique de la raison close. … Non pas une critique, mais une clinique. Le stable fuit, et seule l’instable peut tenir. Le clinamen.“331 Das Buch über die „Meteore“ ist ein Buch über die von der Statik, dem Ordnungsdenken nicht abbildbaren Phänomene wie Wolken, Donner und Blitze, sie sind Keime der Unordnung, der Turbulenzen. „Le clinamen est la turbulance infinitésimale, première, mais il est aussi le passage de la théorie à la pratique. Et … sans lui, on ne comprend rien à ce qui se passe.“332 Die Wolken sind der Ursprung dieser Unordnung; denn Blitz und Donner gibt es nur, wo es Wolken gibt. Die Wolke ist das Modell des Chaos, aber das „clinamen“, die minimale Abweichung innerhalb der 330 l. c., p. 39. 331 l. c., p. 99. 332 l. c., p. 104. Wolke sind die Ursachen von Blitz und Donner. Zugleich sind sie es, die das clinamen erfahrbar machen, als augenblickshafte Abweichung vom geordneten normalen Gang der Dinge: „Le clinamen, dans le chaos-nuage amène les turbulances.“333 Physik als Erfahrungswissenschaft, die sich vorrangig mit diesen Phänomenen befaßt, wird zur „théorie dans le tempête.“334 Wolken bilden sich durch ein Fließen von Dampf und dem Fließen von Wind, das ist eine amorphe, sich durchkreuzende und zusammenströmende Verbindung von Flüssen, die der Erde und dem Wasser entstammen. Die Chaos-Wolke wird zur Wolkengestalt. So wird der Operator „clinamen“, d.h. die minimale Abweichung, den wir in der Wolke am Werk sehen, auch der Operator, der uns die Welt insgesamt erklärt, wenn wir die Grundelemente des Atomismus zur Voraussetzung gemacht haben: die Leere und in ihr gestaltlos die Atome: „Il n’y a de monde et des choses du monde que par le clinamen, dans leur existence, leur commencement et leur fin. … Le clinamen est donc l’operateur, phénoménal et théorique, minimum de la transformation en général.“335 Und dieses Modell läßt sich mühelos auch auf das Phänomen des kommunikativen Textes übertragen; überall kommt es als Bedingung der Existenz auf die minimale Abweichung an, die uns mit den Turbulenzen und den Unordnungen segnet. Die Theorie des ursprünglichen Chaos bei Lukrez ist mit einer Doppeldeutigkeit behaftet. Einerseits ist es eine stochastische Wolke, in der die Atome in einem Leeren vielfältig aneinander stoßen; andererseits ist das ursprüngliche Chaos ein fließender Katarakt, in dem die Atome wellenförmig fließen, ohne sich zu berühren und wo erst die Abweichung sie aufeinanderprallen läßt. Oder anders gesagt: Das ursprüngliche Chaos ist eine Leere, und aus nichts wird nichts, es sei denn es gibt eine energetische Differenz, genau jenes Fallen. Aus nichts wird nichts, aber aus der Differenz wird alles. Die Verbindung dieser beiden Modelle bei Lukrez sieht Serres dadurch gegeben, daß das Katarakt-Modell eine Lokalisierung des ersten Modells anbietet. „L’écart multiplié, globalisé, dans le nuage, est ramené à l’unité, la différence de la chute, distance, et la déclinaison angulaire, direction et sens. La réalité c’est le chaos désordonné.“336 Auf diese Weise sind die zwei Bilder des ursprünglichen Chaos kompatibel. Aber auf diese Weise verschwindet das Chaos auch nicht. „… le chaos est éternel. Le chaos ne cesse jamais. Il est toujours, et toujours là. Le monde né, ou la nature, ne supprime pas le nuage atomique.“337 Die Chaos-Wolke ist Realität, sie „va 333 l. c., p. 109. 334 ibd. 335 l. c., p. 115. 336 l. c., p. 169. 337 l. c., p. 170. du chaos premier au chaos dernier.“338 Überall wirkt das Gesetz des Fallens, eines Fallens in Richtung Gleichgewicht. „Le cataracte est du chaos, elle est la configuration originaire, mais elle ne cesse pas une fois les mondes formés.“ Negentropisch trotzen die Verbindungen eine Zeitlang dieser Tendenz; aber dann werden auch sie durch einen Zusammenprall zertrümmert und in die Atome zerlegt und kehren zurück zur „nuage atomique.“339 2.6.1.3.3. Serres Seiner Interpretation der Grundlegung der Physik im Anschluß an Lukrez ist Serres auch in seinen anderen Arbeiten gefolgt. Für ihn sind Wolken, Turbulenzen, Meteorisches, d.h. die Unordnung der Normalfall im Universum. Ordnungen, auch hochkomplexe Ordnungen netzförmiger Art, sind unwahrscheinliche Ausnahmen in einem grundlegenden und hintergründigen chaotischen Pluriversum. Wie kleine Inseln in einem riesigen Ozean der Unordnung geben sie denjenigen, die einen Halt benötigen bzw. sogar herbeisehnen, die tröstende Illusion eines Kosmos. Nur jenen Furchtsamen, die sich an diesen kosmotischen Halt klammern, erscheint das Ungeordnete als eine Ausnahme und Störung der Idylle der Großen Ordnung. Der Paradigmenwechsel in der Konzeptualisierung der Bedingungen des Wissens in der Postmoderne, dem sich der Wissenschaftsphilosoph Serres verschrieben hat, wird von der Chaostheorie gestützt, die Ordnung und Chaos als zwei mögliche Serien von Werten innerhalb ein und derselben mathematisch darstellbaren Funktion und d.h. als zwei mögliche und aufeinander folgende Systemzustände darzustellen vermag. In dem Diskurs der klassischen Mechanik mit ihrer Darstellungsform more geometrico gab es für Wolkiges keinen vorgesehenen Platz. Selbst wenn man die Ketten des Wissens in der Art einer ars combinatoria verbindet, erschließen sich die Wolkenformationen nicht besser. Immer verfügt man über einen festen Ausgangspunkt, die Arché, ohne den es nicht geht; man mag diesen festen Ausgangspunkt nun die Sonne nennen (Heliozentrismus) oder Jesus (Pascal, Badiou), oder „Il principe“ (Machiavelli) oder transzendentale Apperzeption (Kant), oder gar den „einzig möglichen Standpunkt“ (J. S. Beck), immer markiert dieser Ausgangspunkt seit den Griechen Ursprung und Herrschaft zugleich. Diese Denkstruktur wurde nach Michel Serres‘ Darstellung der Wissenschaftsgeschichte auch dann nicht aufgegeben, als die Kinetik von Flüssigkeiten und Gasen einbezogen wurde, und auch dort nicht, wo vom Denken des Einen, des Zentralkörpers, übergegangen wurde zum pluralistischen Universum (Leibniz340). Serres sagt: „Für das klassische Zeitalter gibt es Systeme nur im Bezug auf 338 l. c., p. 183. 339 l. c., p. 182. 340 H. Busche: Leibniz‘ Weg ins perspektivische Universum. Hamburg 1997. einen Punkt, von dem her die Ordnung sich entfaltet. Es gibt kein rationales Wissen, keine Kohärenz und keine Vernunft ohne eine hierarchisierte Mannigfaltigkeit.“ 341 Im 19. Jh. wandelt sich das: Nicht mehr das Uhrwerk ist die Grundmetapher, sondern das alles verzehrende Feuer. Daraus folgt die Botschaft: „Das Reale ist nicht rational; das Rationale, das dennoch unvermeidlich ist, das da ist, ist in Wirklichkeit unmöglich.“342 In diesem historischen Zusammenhang begegnet erstmals die Figur der Wolke: „Jenseits des Punktes gibt es eine Punktewolke…“ 343 Denn die festen Ordnungen, durch Punkte, Ebenen und Hierarchien definiert, lösen sich auf, ihre Objekte nehmen nunmehr die Gestalt von Wolken an; an den nicht genau bestimmbaren Rändern dieser Wolken hausen die Probleme: zugleich selbst unbestimmt, instabil übergängig im Austausch von Innen und Außen. Wenn man aber die genaue Definition, Festlegung der Ränder des Unbestimmten haben wollte, so wäre der Preis unendlich hoch; denn man benötigte eine Informationsmenge, die nicht zu bewältigen wäre. Nur ein Betrüger, der seinen Kredit bis zum Bankrott überzöge, könnte behaupten, die Wolke zu bestimmen: „Das Reale ist gesetzlos.“ 344 Michel Serres führt diese Einsicht auf Brillouins Theorem zurück, das besagt, „daß die exakte Erkenntnis dieser Wolke und selbst ihre präzise Abgrenzung ein unendliches Quantum an Negentropie kosten würde.“345 Angewandt z.B. auf historische Erkenntnis einer Wolke von Relikten bedeutet das, daß die vollständige Erkenntnis dieser Wolke aus Relikten die „offene Unendlichkeit der zukünftigen Zeit kosten“ würde.346 „Ja, die Unordnung geht der Ordnung voraus, und real ist nur die Unordnung; ja, die Wolke, das heißt die große Zahl, geht der Determinierung voraus, und real ist nur die Wolke mitsamt der großen Zahl. Gesetz, Kette und Ordnung sind immer nur Ausnahmen, so etwas wie Wunder. Die minimale Wahrscheinlichkeit ist an die Stelle des Unvermeidlichen getreten. Wenn es eine Ordnung der Dinge gibt, dann liegt ihr stets ein Kalkül zugrunde, der in aller Evidenz zeigt, daß sie nicht hätte sein müssen.“347 341 M. Serres: Hermes IV: Verteilung. Berlin 1993, p.26. 342 l. c., p. 33. 343 ibd. 344 l. c., p. 37. 345 ibd. 346 ibd. 347 l. c., p. 39. In seinem Buch „Variations sur le corps“348 stimmt er geradezu ein Loblied der Unordnung an, indem nur sie, nicht aber die Ausgeglichenheit, die Ataraxie, des Körpers und der Seele lebensdienlich ist. Ausgehend von der Erfahrung des Seefahrers, daß in hohem Wellengang nur ein Schiff, das sich den Wellen ausliefert, nicht untergeht, geht er über zu den überlebensförderlichen Störungen der Organismen, kommt zu einer Ablehnung der antiken Vorstellung von Ataraxie und zum Lob der Unordnung des instabilen Gleichgewichts als Lebensmodus. „Und wie steht es mit der Realität? Sie ist für den Augenblick nichts als Rationalität. Aber in Wirklichkeit ist sie eine Menge von der Art einer Wolke.“ 349 Dieser scheinbare Widerspruch von Rationalität im Augenblick und Wolke, beruht darauf, daß die Rationalität im Augenblick auf einer Entscheidung, einer Dezision, beruht. Wer das leugnete, möchte offenbar in ideologischer Art die Beherrschung der Präsenz zu einer politischen Herrschaft verstetigen. Serres‘ Resümee in diesem Aufsatz lautet: „Die Realität/Wolke ist ohne arche, dieses Residuum des Idealismus, das man einst die Vernunft nannte und das in Wirklichkeit der Sitz des Herrschers oder seiner Ordnung ist.“350 Die Rechtfertigung der Begrifflichkeit der Wolke findet sich vor allem im Vorwort von „Hermes IV: Verteilung“. „Am Anfang ist das Undifferenzierte, über das niemand Informationen besitzen kann. Das mag man als ‚Wolke‘ bezeichnen.“351 Diese Differenz ist entscheidend: Klassisch war der Anfang ein Einheitspunkt, die Arché, nun ist sie eine undifferenzierte Wolke aus Vielheiten: „…eine Wolke mit unscharfen, fließenden, verschwimmenden Rändern.“ 352 Die meteorologische Metapher als Modell einer Wissensformation bestimmt die Wissenschaft seit dem Beginn des 20. Jahrhundert. Die Wolke bildet die Mitte zwischen der irdischen und der kosmischen Ordnung: „eine prachtvolle Unordnung“. Diese Unordnung im Zwischen der Ordnungen war für die Wissenschaft sowohl als Objekt wie als Modell ihres Selbstverständnisses ohne Belang. Einzig, so sagt Serres, Bauern, Seeleute und „ein paar ausgehungerte zwielichtige Gestalten“ interessierten sich dafür. Der Umschwung im 20. Jahrhundert bestand darin, die Wolkigkeit sowohl im Irdischen wie im Kosmos zu entdecken, d.h. sie nun für eine motivierende Struktur unseres Weltverhältnisses insgesamt zu verstehen. 348 M. Serres: Variations sur le corps. Paris 1999. 349 M. Serres: Hermes IV, p. 41. 350 l. c., p. 42. 351 l. c., p. 7. 352 ibd. „Die Wolke ist nicht mehr nur das schöne oder schlechte Wetter, über das man sich lustig machen kann im abgeschlossenen Raum der Schulen und mit der städtischen Technologie im Rücken, sie ist in uns und um uns herum, in der Brownschen Bewegung der Dinge, in der Ergotik des Lebenden und Historischen…“ „Sie endet nicht beim Meteorologischen, und alles, ohne Ausnahme, ist Wolke. Alles fließt. Es fließt.“ 353 „Das Rationale ist im strengen Sinne unwahrscheinlich. Gesetz, Regel, Ordnung, alles, was wir so bezeichnen, sind so unwahrscheinlich, daß sie an die Grenze dessen kommen, was eigentlich nicht sein kann.“354„Die Unordnung ist fast immer da. Das heißt Wolke oder Meer, Sturm oder Rauschen, Gemisch und Masse, Chaos, Tumult.“355 Bei Serres hat demnach die Wolke nicht mehr den Charakter des Trügerischen oder Verbergenden: da wir immer innerhalb der Wolke sind, betrügt sie uns nicht mehr, und einen verbergenden Charakter hat sie nur für die, die mehr wissen wollen, als sie wissen können. Wolken derart zu verehren, ist eine Form von Skepsis, zugleich aber ist sie eine Zulassung derjenigen natürlichen Erscheinungen, zu denen sich die methodische Erkenntnis immer exorzistisch verhalten hatte: zu Vielheiten, die sich nicht einer Einheit fügen, zu Protuberanzen, zum Fließen und zu einem nichtdeterministischen Werden. Die methodische Erkenntnis fügte sich immer als schrittweise Linearität ein zwischen Arché und Telos. Die neue Erkenntnis der Postmoderne ist labyrinthisch, rhizomatisch, wolkig; sie ist an-archisch.356 Wolkigkeit entzieht sich der klaren Struktur eines dem erkennenden Subjekt ausgelieferten Objekts. Hatte Platon die Wahrheit des Dings an die sichtbare Wiedererkennbarkeit im Fluß des Werdens und seiner Illusionen gebunden, d.h. an die Idee, so zieht die Wolke vorbei, ist morgen so sicherlich nicht mehr gestaltet, ist also entweder überhaupt kein objektiv sichtbares Ding, oder eine ganz neue Form von Ding, ein Ding ohne Idee, die seine Identität im Werden absicherte. Und wenn sie uns als Nebel umgibt, ist das Subjekt inmitten des Objekts, dann macht die Wolke das Subjekt zum Objekt. Dem hilft eine von der mathematischen Mengenlehre und der Philosophie Heideggers abgestützte Ontologie der Vielheiten ab, die statuiert: „Das Eins ist nicht“,357 präsentiert in Situationen sind immer nur Vielheiten, die dann als Eins gezählt werden können, so daß sich eine Struktur ergibt, und dann wären Wolken Bilder jener 353 l. c., p. 8. 354 ibd. 355 l. c., p. 9. 356 M. Serres: La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce, p. 40. 357 A. Badiou: Das Sein und das Ereignis. Berlin 2005, p. 37, passim. Stätten, die am „Rand der Leere“358 Ereignisse ermöglichen, die so nicht vorhersehbar sein konnten. Genau dafür könnten die Bilder Turners stehen, die die festen Konturen der Dinge auflösen in einer Wolkigkeit.359 Das Identitätsprinzip fordert, daß das Erkenntnisobjekt mit sich identisch bleibt, das aber tut die Wolke in keinem Moment und führt daher die identifizierende Erkenntnis ad absurdum; als Schlüsselphänomen genommen verweist sie vielleicht darauf, daß kein Ding ein dem identifizierenden Denken gefügiges Objekt ist oder bleibt. Reflexiv gewendet, müßte das die Erkenntnis anleiten, daß diese Suche und diese Sucht nach Einheit gewährenden Ideen eine Selbstverwolkung des Subjekts ist. Es weiß nicht mehr, daß es selbst es ist, das die Wolken interpretiert und ihnen dezisionistisch Gestalten zuweist. In seinem Aufsatz „Turner übersetzt Carnot“ schildert Michel Serres die Verabschiedung einer Welt, die sich der Analytischen Mechanik verschrieben hatte und die sich von der Geometrie fester Körper, von ihrer Statik und ihrer berechenbaren Kinetik leiten läßt und die George Garrard in seinen Bildern der Brauerei von Samuel Whitbread abgebildet hat, eine „objektive Welt“ und ihre „Wahrnehmung … über geometrische Schemata“360. Von dieser Welt sagt Serres, daß sie dem Untergang geweiht war, ja daß sie dieses insgeheim wußte und die ihre letzten Momente im Bild festzuhalten versuchte. Die neu entstehende Welt lebt von der Dynamik des Feuers, und es ist Turner, der diese Welt ins Bild zu setzen versteht. „Turner oder die Einführung der entzündeten Materie in die Kultur. Das erste wahrhafte Genie der Thermodynamik.“361 Und noch deutlicher: „Die Wahrnehmung des Stochastischen ersetzt die Zeichnung der Form.“362 Die Ersetzung der Zeichnung der Form hat Konsequenzen für die Wahrnehmung. Doch zunächst dient die Wolke als Wahrnehmungsschema der feurigen Welt: „Das Feuer löst sie [die feste Form] auf, läßt sie vibrieren, zittern, oszillieren, läßt sie in Wolken explodieren. Von Garrard zu Turner oder von der gefaserten Gitterstruktur zur Zufallswolke. Niemand vermag den Rand einer Wolke zu zeichnen, diesen Grenzbereich des Zufalls.“363 Die starre Gitterstruktur erlaubte es, wie Kant sich ausdrückte, jedem Ding seinen Platz zuzuweisen.364 Das ist 358 l. c., p. 201. 359 M. Serres: Turner übersetzt Carnot.- In: ders.: Hermes III: Übersetzung. Berlin 1992, p. 327-340. 360 l. c., p. 329. 361 l. c., p. 331. 362 l. c., p. 333. 363 ibd. 364 Die Gitterstruktur ist zugleich das mathematisch inspirierte Verfahren der zentralperspektivischen Darstellung in der Malerei seit Brunelleschi und Alberti. Daß die Zentralperspektive nicht die „wahre“ Darstellung des Raums ist, sondern sich der mathematikzentrierten nun vorbei: im Feuer zerstieben die festen Dinge und die festen Orte, und die Materie wird in ihre Moleküle und Atome zerlegt und ihre Bewegung dem Zufall und der Zufälligkeit der Orte preisgegeben. Mit dieser Hinwendung zum Schema des auflösenden Feuers wird auch das Interesse am Vulkanismus neu entfacht.365 Am Schluß dieses Abschnitts möchte ich den Philosophen der Gemische und Gemenge, Michel Serres, noch einmal zitieren: „Monokultur. Nichts Neues unter der einzigen Sonne. Die endlosen homogenen Reihen verdrängen oder löschen das Moiré; das Isotrope schließt das Unerwartete aus... Ein rationales oder abstraktes Panorama vertreibt tausend Landschaften mit ihren kombinatorischen Spektren. Vor unseren Augen entfalten sich zwei Sichtweisen der Vernunft oder des Verstandes. Das Schwierige, Nichtlineare mit seinen tausend Randbedingungen verschwindet bald angesichts der langen Reihen von Mais- oder Weizenfeldern und des Einfachen, Leichten, das sie darstellen. Das Eine tritt an die Stelle des Vielen. Und die reine Unordnung, die der homogenen Ordnung gegenübersteht, vertreibt die raffinierten Gemische. ... Manchmal benutzen wir gerne ein kombinatorisches Spektrum und manchmal das universelle, wie fahren gerne über die Autobahn der Abstraktion, über den Boulevard des Globalen und das formale Konzept, an den rasch vorbeiziehenden homogenen Maisreihen entlang, aber wir lieben es auch, uns auf gewundenen Wegen zu ergehen, uns in der Landschaft zu verlieren, um zu Wissen und Verständnis zu gelangen. Warum sollten wir nicht zugleich rational und intelligent, wissenschaftlich und kultiviert, variabel und weise werden? In vielen Fällen bringt uns nur der eine Gott den Frieden, in ebenso vielen Fällen ist es besser, auf die Engel zu vertrauen.“366 2.6.1.3.4 Rhizomatische Vielheiten Wenn die Modernen Einheit qua Kontinuität durch Reflexion, durch reflexive Prozesse zu sichern sich bemühten, so entgegnen Deleuze/Guattari in ihrer 1976er Einleitung in den zweiten Band von „Kapitalismus und Schizophrenie“ gegenüber der Anfrage „Seid ihr auch schön kohärent?“: „Nur eins ist schlimmer als die Einwände Kultur der Renaissance verdankt und den tatsächlichen Raum der Wahrnehmung verzerrt, dazu s. E. Panofsky: Die Perspektive als „symbolische Form“.- In: ders.: Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, hrsg. v. H. Oberer u. E. Verheyen. 2. Aufl. Berlin 1974, p.99-167. 365 Mehr dazu K. Röttgers: Die Herkunft der Steine. Wie die Steine eine Geschichte bekamen.In: Steine, Versteinertes, hrsg. v. K. Röttgers u. M. Schmitz-Emans. Essen 2014, p. 19-34, mit weiteren Literaturhinweisen. 366 M. Serres: Die fünf Sinne. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1994, p. 342f. und Widerlegungen der Einwände: die Reflexion…“367 Das wendet sich ab von allen Kontinuitätssicherungen jenseits oder oberhalb (transzendent) der Prozeßfortsetzung. Weil der – wie wir sagen: – kommunikative Text die unterschiedlichsten Materien verbindet, gibt es keine durch Reflexion gesicherte Kontinuitätsgewähr. Deleuze/Guattari benennen die Fortsetzungsverfahren an den Verbindungs- und Übergangspunkten: „Linien der Artikulation oder Segmentierung, Schichten und Territorialitäten; aber auch Fluchtlinien, Bewegungen der Deterritorialisierung und Entschichtung…“368 Aus solchen Ver- und Entknüpfungen kann eine Einheit nicht hervorgehen, eine Einheit, die von Deleuze/Guattari als „Buch“ benannt wird. „Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, wovon ein Buch handelt, und der Art, wie es gemacht ist. Ein Buch hat also kein Objekt mehr. Als Verkettung steht es nur in Verbindung mit anderen Verkettungen und im Verhältnis zu anderen organlosen Körpern. Man fragt nie, was ein Buch bedeuten soll, Signifikat hin, Signifikant her, man sucht in einem Buch nichts zu begreifen; man fragt, womit ein Buch funktioniert, in welchen Verbindungen es Intensitäten strömen läßt, in welche Vielheiten es seine Vielheit einführt und verwandelt, mit welchen anderen organlosen Körpern sein eigener konvergiert.“ 369 Und ganz klar: „Die Literatur ist eine Verkettung, sie hat nichts mit Ideologie zu tun…“370 Denn Ideologie ist eine Extrapolation von Meinungen und Glaubensüberzeugungen, wie auch immer notwendig sie sei, die angeblich die Textentstehung steuern; das ist mitnichten der Fall. Es gibt keine einheitliche Steuerung, die die Verknüpfung von Vielheiten dirigiert. Das Denken im Modell des Wurzelbuchs, d.h. daß die Wurzel ein Bild des Baums über ihr, und dieses ein Bild der Welt außer ihm sei, dieses Denken hat „die Vielheit nie begriffen: es muß von einer starken, vorgängigen Einheit ausgehen.“371 Ein anderes Modell (die büschelige Wurzel) versucht – kaum besser – die Vielheit immer auf eine totalisierende Einheit zu bringen: „Jedesmal, wenn sich eine Vielheit in eine Struktur verfängt, wird ihr Wachstum durch eine Reduktion der Kombinationsgesetze kompensiert.“372 Als eines der zentralen Merkmale des Rhizoms (in Abkehr von den Wurzel-Büchern) nennen Deleuze/Guattari das „Prinzip der Vielheit“. Demgegenüber taucht 367 G. Deleuze / F. Guattari: Rhizom. Berlin 1977, p. 5. 368 l. c., p. 6. 369 l. c., p. 7. 370 ibd. 371 l. c., p. 9. 372 l. c., p. 10. Einheit nur mit Subjektzentrierungen des Diskurses über Texten auf. Das Rhizom jedoch verweigert jede Überschreibung des Textverlaufs. Wie man aus den neueren Anregungen der Epigenetik373 lernen könnte, ist nach dem kurzen Hype der Genetiker der Entschlüsselung des Genoms nun die Phase vorbei, in der man glaubte, durch Entschlüsselung des Genoms den Code geknackt zu haben, unter dessen „diskursiver“ Dominanz genetische Prozesse ablaufen (müssen). Diese und andere vom Einheits- und Hierarchiedenken beherrschte Forschung erwies sich als völlig falsche Weichenstellung. Oder wie Deleuze/Guattari sagen: „Aus Eins wird zwei… Die Natur geht so nicht vor…“374 Genau genommen aber ist Rhizomatik eine Denk- und Schreibweise, die sich weder der Einheit noch der Vielheit mit Eindeutigkeit zuordnen läßt, sondern das Rhizom ist die Artikulation von Dimensionen, nicht von Einheiten, nicht von Vielheit: „Ohne Subjekt und Objekt bildet es lineare Vielheiten mit n Dimensionen, die auf einem Konsistenzplan ausgebreitet werden können, und von denen das Eine immer abgezogen wird. Eine Vielheit variiert ihre Dimensionen nicht, ohne sich selbst zu ändern und zu verwandeln.“375 „Jede Vielheit, die mit anderen durch an der Oberfläche verlaufende unterirdische Stengel verbunden werden kann, so daß sich ein Rhizom bildet und ausbreitet, nennen wir Plateau.“376 Und genau diesen Gedanken rhizomatischer Verknüpfungen von Vielheiten führen Deleuze/Guattari im später erschienen Hauptteil des Buches durch: „Mille Plateau.“377 2.6.1.3.5 singulär plural sein (Nancy) Jean-Luc Nancy hat seine Sozio-Ontologie auf das Zwischen gegründet: alle sozialen Prozesse spielen sich zwischen uns ab. Dieses Zwischen des Sozialen ist aber weder konsistent noch kontinuierlich, sondern hat die Form der Berührung,378 bei Heidegger wäre das die Fuge gewesen. Daher ist das Zwischen weder selbst materiell ein Etwas, noch ist es eine Überbrückung zwischen ansonsten Unverbundenen. Vielmehr ist „Zwischen“ die Relation zunächst der Distanznahme und dann, wenn man Nancys Grundsatz in Anschlag bringt, daß wir, d.h. jeder Einzelne der Sinn ist, Sinn also 373 B. Kegel: Epigenetik. 374 G. Deleuze / F. Guattari: Rhizom, p. 8. 375 l. c., p. 34. 376 l. c., p. 35. 377 Dies.: Mille Plateau. Paris 1980. 378 J.-L. Nancy: Le Sens du monde. Paris 1993, p. 94ff. singulär ist und wir zusammen die Zirkulation des Sinns, dann ist diese Distanzierungsrelation zugleich eine Verräumlichung von Sinn. Diese räumliche Mitte zwischen uns ist also kein vorausliegendes Mi-lieu; denn erst mit unserem singulären Auftauchen entsteht die distanzierende und zugleich verbindende Relationierung. Unter dieser Voraussetzung gibt es nicht den Einen Ursprung der Welt: „… wir wissen, daß die Welt keinen anderen Ursprung hat als diese singuläre Vielheit von Ursprüngen.“379 Also: „Der Ursprung ist ein Abstand.“380 Der Ursprung ist also nicht einer, und die Einheit steht nicht am Ursprung, in jedem Einzelnen löst die Ausstreuung des Ursprungs eine innere Entrückung und Verrückung aus, eine Distanzierung, ein Zwischen im Inneren. In einem bemerkenswerten Aufsatz anläßlich des 11. September 2001 setzt sich Nancy explizit mit der Idee des Einen und der Hierarchie in der Politik auseinander. Sein Ausgang ist die Feststellung, daß die Welt zerrissen und gespalten ist, und zwar durch eine unerträgliche Spaltung zwischen Reichtum und Armut in dieser Welt. Unerträglich ist diese Spaltung, weil sie auf keiner irgendwie zu rechtfertigenden Hierarchie beruhe. Wörtlich besage Hierarchie, eine sakrosankte Archie (ἀrcή) im Doppelsinn von Ursprung und Herrschaft, also eine durch einen heiligen Ursprung legitime Herrschaft. Wenn aber diese Welt dem Anspruch nach ebenfalls auf dem Niveau von technischer Effizienz und aufgeklärter Humanität fußt, dann müßte es eine Welt von Demokratie, von Menschenrechten (den Rechten des als universell unterstellten Menschen als solchem) und der religiösen, der ästhetischen und der moralischen Toleranz sein. Diesen proklamierten Werten von Gleichheit und Gerechtigkeit widerspricht aber ein sakrosanktes System der Autoritäts- und Legitimitätsdifferenzen. So ist unsere Welt tatsächlich eine Welt der Herrschenden und der Beherrschten, der Ausbeuter und der Ausgebeuteten, der Reichen und der Armen. Hier gibt es nur dies, und nur hier gibt es dies, sagt Nancy. 381 Die Gründe dafür sind ökonomischer Natur, nämlich die Identifikation der Gleichheit der Menschen mit der im Tauschprinzip unterstellten Äquivalenz, übrigens etwas, das Kant mit der Unterscheidung von Wert (=Preis) und Wert (=Würde) noch zu unterscheiden vermochte. Nach Nancy aber ist die Gleichheit der Menschen fundiert in ihrer unvergleichlichen Singularität, während Wertäquivalenz eine Allgemeinheit und numerische Vergleichbarkeit aller Waren jenseits der Besonderheit sta- 379 J.-L. Nancy: singulär plural sein, p. 29. 380 l. c., p. 40. 381 So in seiner Stellungnahme zum 11. September 2001: J.-L. Nancy: De l’un et de la hiérarchie.- In: Lignes 2002, H. 2, p. 72-75. tuiert. Wegen der Nichtäquivalenz der Singulären begründet das für Nancy einen heiligen (hier-archischen) Vorrang der Vielheit der Einzelnen, eines Vorrangs freilich ohne Krone, ohne Dogmen und ohne Weihen. Die sogenannte Instrumentalisierung der Religionen für politische Zwecke (im Islamismus ebenso wie national-theistischen Amerikanismus) folgt nicht aus inkompatiblen Momenten unterschiedlicher Zivilisationen, wie noch Huntington glaubte,382 sondern ergibt sich aus dem Handlungs-Motiv des Großen Einen. Die globale Konfrontation beruht auf der beiderseitigen und gegenseitigen Berufung auf Einheit, Einzigkeit und Allgemeinheit. Eine solche Berufung auf die allgemeine Einheit und Einzigkeit ist in sich bereits polemogen und steuert den Konflikt. Die allseitige totale Mobilmachung auf allen Seiten antwortet allem Anschein nach auf die ökonomische Globalisierung. Überall herrscht der Glaube an den, den allgemeinen Menschen, und sei es auch nur der rationale des homo oeconomucus, jeweils rückgebunden an den Einen Gott. Der Ersatzgott „der Mensch“, Abbild des transzendenten Gottes sind tatsächlich die zwei Formen des Einen in seiner Einzigkeit, die die pyramidale Form des Sozialen von seiner Spitze, als Arché zugleich Ursprung und Herrschaft, begründen. Und da Einer nur einer sein kann, herrscht Terrorismus auf beiden Seiten des Einzigkeitsanspruchs des Einen. Nach Nancy ist diese Konfrontation von Einheitsansprüchen und ihre kriegerische Politik zusammengenommen nichts anderes als die innere Widersprüchlichkeit ein und desselben Nihilismus. Denn dem Einen kommt erwiesenermaßen die Eigenschaft der Selbst-Negation zu. Entweder der Eine negiert sich in grenzenloser Vervielfältigung, oder er negiert sich, sich als nichts zunichtemachend. Diesem Nihilismus der Einzigkeit setzt Nancy eine immer schon in den monotheistischen Religionen virulente, sie zwar nicht einende, aber verbindend-berührende Gottesvorstellung entgegen, für die Gott gerade in der Vielfalt des Erscheinenden anwesend ist. 2.6.1.4 Einheit im Ausgang von Pluralität 2.6.1.4.1. Leibniz Zu dem Lukrezschen Credo, daß alles, was ist, dem Untergang geweiht ist, gibt es keinen größeren Gegensatz als die Philosophie von Leibniz, zu deren Grundvoraussetzungen es gehört, daß nichts zugrunde geht, sondern daß sich in allen Prozessen des Wandels eine grundlegende Harmonie erhält. Es muß in allem Wandel, damit er überhaupt feststellbar ist, ein unwandelbares Etwas geben: „un detail de ce qui 382 S. P. Huntington: Kampf der Kulturen. München, Wien 1996 (urspr. „clash of civilizations“); zur Kritik A. Sen: Die Identitätsfalle. Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. München 2007. change, qui fasse pour ainsi dire la specification et la variété des substances simples.“383 § 13 der Monadologie fährt dann fort: „Ce detail doit envelloper une multitude dans l’unité ou dans le simple.“384 Die Begründung nimmt Bezug darauf, daß es keine Sprünge im Wandel gibt, sondern sich jede Veränderung gradweise („par degrés“) vollzieht. Es gibt immer ein sich Veränderendes, und „quelque chose reste.“ Das aber heißt nichts anderes als daß die Monade (die kleinste substantielle Einheit) in vielfältigen Beziehungen steht: „une pluralité d’affections et de rapport“. 385 Für Leibniz spielt das Verhältnis von Vielheit und Einheit eine so zentrale Rolle, daß der 8. Internationale Leibniz-Kongreß (2006) nicht zu Unrecht unter dem LeitThema „Einheit in der Vielheit“ versammelte. Denn das Verhältnis von Einheit und Vielheit bestimmt die zentralen Begriffe von Leibniz‘ Philosophie. So ist etwa der metaphysische Begriff der Harmonie verstanden als „unitas in multitudine“ oder auch als „unitas in multis“.386 Die Monade als kleinste und einfache Substanz ist einerseits eine irreduzible und nicht-teilbare Einheit, andererseits ist jede Monade von allen anderen verschieden, bildet somit aufgrund dieser Verschiedenheit eine irreduzible Vielheit. Zudem spiegeln die Monaden je spezifisch die Vielheit der Welt, sind also trotz ihrer einfachen Einheit im Inneren von unendlicher Vielheit der Weltbezüge. Die Harmonie wird in § 78 als „l’harmonie préétabli entre toutes les substances“ eingeführt, um die Übereinstimmung von Körper und Seele verständlich zu machen, obwohl doch beide eigenen Gesetzen folgen. „L’ame suit ses propres loix et le corps aussi les siennes.“387 Verallgemeinernd gesprochen, ist das zugleich die präetablierte Harmonie von Natur und Sittlichkeit. Die Monade ist schon ihrem Begriff nach die einfache Einheit (mon-ade). In der empirischen Welt ist alles einem permanenten Wandel unterworfen; aber in diesem Wandel gibt es ein Minimum der Unwandelbarkeit, und das ist das metaphysische Prinzip der einfachen Substanz oder die Monade. Sie ist die minimale Einheit in der Vielheit; zugleich aber sind die Monaden in ihrer absoluten Differenziertheit untereinander in die Einheit einer präetablierten Harmonie eingefaßt. Um allerdings die Möglichkeit dieser Einheit begreiflich zu machen, benötigt Leibniz die Idee einer Urmonade, die schöpferisch sein kann, also Gott. Ohne Gott wäre die Annahme einer präetablierten Harmonie verwegen. Während also die Vielheit der Monaden einen 383 G. W. Leibniz: Grundwahrheiten der Philosophie. Monadologie, hrsg. v. J. Chr. Horn. Frankfurt a. M. 1962, p. 42 (§ 12). 384 ibd. (§13). 385 ibd. 386 Zit. nach M. Meier-Oeser: Vielheit I.- In: Historisches Wörterbuch der Philosophie XI, hrsg. v. J. Ritter†, K. Gründer u. G. Gabriel. Basel2001, Sp. 1041-1050, hier Sp. 1047. 387 G. W. Leibniz: Grundwahrheiten der Philosophie, p. 130. Pluralismus und Perspektivismus der Welten begründet, begründet Gott eine Einheitssicht jenseits des Perspektivismus in der Vielheit der Perzeptionen und Strebungen der Monaden. Dieser Gott ist in seiner Willkür des Schaffens eingeschränkt: er konnte nur die bestmögliche (nach seiner perfekten Einsicht in die ewigen Wahrheiten die bestmögliche) schaffen. Das metaphysische Universum bleibt trotz allen Pluralismus und Perspektivismus der Monaden durch Gottes Garantie eine Welt: ein Uni-versum. Leibniz‘ Lösung des Problems der Vielheit der Einheiten und der Einheit in der Vielheit ist eine sehr konsequente Darstellung dieses Zusammenhangs, allerdings mit den Investitions-Kosten einer Super-Monade, die die eine Harmonie der Perspektiven eingerichtet haben mußte. Wir stoßen somit bei Leibniz auf ein Cusanus vergleichbares Problem: Einheit ist ein Postulat (von der docta ignorantia berührbar; oder als Harmonie erfahrbar); ein Postulat entzieht sich der Erkennbarkeit und einer epistemischen Begründbarkeit. 2.6.1.4.2 Der Leviathan Ein noch radikaleres Modell eines Einheitsdenkens im Ausgang von Vielheit vertritt Thomas Hobbes. Zwar liegen alle diejenigen falsch, die behaupten, Hobbes‘ Philosophie sei (womöglich sogar durch persönliche Erfahrungen des Menschen Thomas Hobbes) von einem pessimistischen Menschenbild befallen gewesen.388 Wenn das so wäre, könnte man diese bloß subjektive Weltanschauung getrost philosophisch ignorieren, dann müßte man allerdings erklären, warum sein Ansatz so einflußreich in der politischen Philosophie gewesen ist. Wenn Hobbes tatsächlich die These vertreten hätte, daß alle Menschen vorrangig allen anderen nach dem Leben trachteten, wenn sich nur die Gelegenheit dazu böte, dann wäre – als Allsatz – die Theorie durch ein einziges Gegenbeispiel (Mutter Theresa oder Papst Franciscus) bereits widerlegt. Aber die Hobbessche politische Theorie ist nicht auf einen falschen anthropologischen Allsatz gegründet; ohnehin sind Sozial- und politische Theorien, die eine 388 So auch noch der Anerkennungstheoretiker Axel Honneth. „Hobbes … war unter dem Einfluss von Machiavelli von dem anthropologischen Grundsatz ausgegangen, dass die Menschen vor allem von dem Bedürfnis beherrscht werden, ein stetig wachsendes Mass an ‚Achtung‘ und ‚Ehre‘ zu erlangen…“ Ein solches maßloses Bedürfnis als angebliche anthropologische Konstante erzeugt dann zwangsläufig den allgemeinen Konflikt aller Menschen mit allen. A. Honneth: Anerkennung oder Umverteilung.- In: Die Wirtschaft in der Gesellschaft, hrsg. v. P. Ulrich u. Th. Maak. Bern, Stuttgart, Wien 2000, p. 131-150, hier p. 136. Anthropologie als Grundlage benötigen, schlecht begründet.389 Die Kernthese von Hobbes ist jedoch eine sicherheitstheoretische, und die scheint im nun angebrochenen Zeitalter mit seinem Individualterror plausibler geworden zu sein. Individualterror nenne ich, im Unterschied zum ursprünglichen, staatlich organisierten, den Terror, der von psychisch Gestörten – wie man so sagt – oder religionspolitisch Verwirrten gegen Mitmenschen oder Menschengruppen ausgeübt wird. Die dem entgegengesetzte sicherheitstheoretische These hat nun die Form: ich kann nicht wissen, ob es unter meinen Mitmenschen nicht wenigstens einen Gestörten oder Verwirrten gibt, der mir nach dem Leben trachtet. Generalisiert man diese Unsicherheit, dann kommt man zur Generalisierung des Verdachts, wie ihn die Geheimdienste – allen voran der NSA – und inzwischen auch so manche Regierung pflegen: Jeder ist verdächtig und muß folglich überwacht werden, und zwar prophylaktisch ein jeder, d.h. alle; denn man hat oft genug erlebt, daß bisher unverdächtige Personen, sogenannte Schläfer, terroristische Anschläge verüben. Also sind wir alle, ein jeder von uns – weil noch unverdächtig, also ein Schläfer – verdächtig. Die diffuse Pluralität von Menschen, unverdächtig-verdächtig, muß zur großen Einheit der Überwachungswürdigen integriert werden, die auf diese Weise jedem Unverdächtig-Verdächtigen die Sicherheit zu geben verspricht, daß niemand, d.h. kein einziger, diesem nach dem Leben trachtet. Diese Einheit heißt bei Hobbes Leviathan. Ihn gibt es, d.h. die große Einheit gibt es, weil alle untereinander den Vertrag geschlossen haben, daß die Einheit die Vielheit absolut beherrschen solle. Geblieben ist den Vielen so das nackte Überleben, das auch diese Super-Einheit „Leviathan“ nicht antasten darf. Und so stellt sich heraus, daß es bei Hobbes eben doch eine Minimalanthropologie gibt, die aus genau zwei Sätzen besteht: • Der Mensch ist ein Wesen, das den legitimen Anspruch hat zu überleben; • Der Mensch ist ein Wesen, das mit seinesgleichen einen Vertrag abschließen kann, konkret einen Vertrag zugunsten eines Dritten, der aber selbst nur Nutznießer, nicht Vertragspartner ist. Anders als bei Leibniz, der Vielheit und Einheit verschränkte, hat bei Hobbes die Vielheit zugunsten der Einheit (aus Selbsterhaltungsinteresse) abgedankt. Selbstverständlich gibt es, teilweise unter dem Einfluß von Hobbes, weitere Einheitsideologen unter den Philosophen der Politik, allen voran Jean-Jacques Rousseau, über den Carl Schmitt schreibt: „Die Übereinstimmung [von Hobbes und Rousseau] betrifft den Staat als politische Einheit, die in sich selbst nur Frieden kennt und einen Feind nur außerhalb ihrer selbst anerkennt.“390 Rousseaus „volonté générale“, die die Identität von Herrschern und Beherrschten anphantasiert, ist von der „volonté des 389 K. Röttgers: Das Soziale als kommunikativer Text. Eine postanthropologische Sozialphilosophie. Bielefeld 2012. 390 C. Schmitt: Der Begriff des Politischen. Berlin 1987, p. 120. tous“ oder bloßer Mehrheitsherrschaft nur in ihrer Negativformel zu unterscheiden; d.h. wenn ich im Sinne der „volonté de tous“ feststelle „alle sind gegen mich“, wie es Rousseau selbst in den ersten Sätzen der „Rêveries du Promeneur Solitaire“ herzzerreißend dramatisiert vorstellt, dann ist das eine empirisch überprüfbare und vermutlich zu falsifizierende Aussage. Erst wenn der generalisierte Aussagende sich in die Aussage selbst einschließt „wir alle sind gegen mich“, kann daraus so etwas wie die „volonté générale“ werden, nämlich wenn alle das sagten. Das heißt, wenn man sich auf Herrschaft in einem Herrschaftsverband einläßt, dann kann die Identität von Herrschern und Beherrschten nur als ein spezifischer Wahn gegeben sein. Das Einheits-Denken kann die Pluralität nicht ertragen, es ist von der Obsession heimgesucht, alle Pluralität auf Einheit hin reduzieren zu müssen oder zu sollen. Volonté générale ist entweder der allgemeine Unwille, durch den wir alle uns durch uns alle verfolgt wissen dürfen oder es ist idealerweise das Gegenteil, nämlich die Markierung, die keinen mehr markiert, also ins Leere läuft. Das wahrhaft Totalitäre, ja Terroristische dieses Echtheits- und Transparenz-Zwangs spricht Rousseau in seiner Antwort an Bordes aus: In Rousseaus Idealstaat stehen an der Grenze eines Landes Galgen, die jeden hängen sollen, der versucht, das Land zu verlassen „und es ist immer noch besser für ihn, er sei gehenkt als ein schlechter Mensch.“391 Hobbes‘ Einfluß geht auch bis zu Montesquieu, dessen Gewaltenteilungslehre angeblich pluralistisch und auf diese Weise freiheitsermöglichend sei, 392 der aber klarerweise von der Unverzichtbarkeit der Einheit der Macht im Staat ausgeht. 393 Er spricht nicht von einer „séparation des pouvoirs“, was erst seit der Revolution geläufig wird, was aber gerade in Deutschland das Bild der Gewaltenteilung geprägt hat,394 sondern er spricht on einer „distribution de pouvoir“, d.h. einer funktionalen Verteilung einer als Einheit unterstellten Macht im Staate, also gerade nicht von einer Trennung und Balance der Mächte. 2.6.1.4.3 Einheit trotz Vielheit? 391 „… il vaut encore mieux qu’il soit pendu que méchant.“ J.-J. Rousseau: Œuvres complètes. Paris 1959, III, p. 91 Anm.; s. auch J. Starobinski: Jean-Jacques Rousseau und die List der Begierde.- In: E. Cassirer / J. Starobinski / R. Darnton: Drei Vorschläge Rousseau zu lesen. Frankfurt a. M. 1989, p. 79-103, hier p. 102. 392 So verschiedentlich O. Marquard, s.. Individuum und Gewaltenteilung. Stuttgart 2004. 393 K. Röttgers: Spuren der Macht. Zur Begriffsgeschichte und Systematik. Freiburg, München 1990, p. 182ff. 394 R. Vierhaus: Montesquieu in Deutschland.- In: Collegium philosophicum. Fs. J. Ritter, hrsg.v. E.-W. Böckenförde u.a.. Basel 1965, p. 403-473. Daß Nietzsche ein Denker der Pluralität ist, ist unstrittig, gewissermaßen ein Gemeinplatz. Für Nietzsches Philosophie ist der Pluralismus in zweierlei Weise entscheidend. Einerseits liegt ihr die Erfahrung des Seienden und des Seins als eine ambigue Vielheit und Vieldeutigkeit zugrunde. Das prägt den Inhalt seines Denkens. Aber diese Vielheit hat andererseits Gestalt im Text, d.h. der Form des Fragmentarischen. Sein Text ist in sich diskontinuierlich und die Kontinuität brechend, man kann auch sagen: intermittierend.395 Die Fragmentarik macht den Text zu einem explizit im Zwischen siedelnden, besser nomadisierenden Prozeß. Nietzsche selbst spricht von einem „geistigen Nomadenthum“ der „freizügigen Geister“, das sich im „Gegensatz zu den gebundenen und festgewurzelten Intellecten“ versteht.396 Anders als Aphorismen stiften Fragmente keine Verbindungen, sondern verhindern sie geradezu durch ihr Dazwischentreten. Man kann sogar sagen: redend manifestieren sie ein Schweigen („parlant, se tait“397). In gewisser Weise kommen aber die zwei Seiten des Pluralismus überein: indem nämlich die Weltzuwendung (der Wille-zur-Macht) als eine der Welt immanente Interpretation aufgefaßt wird. Nicht nur die Welt erscheint als ein Spiel und ein Kampf der Kraftquanten, sondern auch die Auslegung der Welt ist selbst ein Moment dieses Zusammenhangs der Welt, Interpretation ist eine Gestalt des Willens-zur-Macht. Umgewendet heißt das auch, mit den Worten Blanchots: „On peut comprendre que le monde est un texte dont il s’agit seulement de conduire à bien l’exégèse, afin que s’en révèle le sens juste…“398 Für das darin enthaltene Sinnkonzept heißt das: die Welt hat keinen Sinn, noch gibt der Text ihr einen Sinn, sondern „le sens est intérieur au monde“399, weil die Interpretation eine Welt-Operation ist, die Sinn und Unsinn prozediert. Dieser mundane Sinn-Prozeß (Text) bildet keine Einheit, sondern intermittiert als Fragment in jede mögliche Einheit. Nietzsche spricht sehr wohl und vielfältig von Einheit, aber meist und an den theoretisch gewichtigen Stellen von einer aus Vielheiten hervorgehenden Einheit. Daher ist die von den Chauvinisten des 19. Jahrhunderts gebräuchliche Rede von der Einheit der Nation, nämlich als etwas, das dem Individuum gegenüber vorauszusetzen wäre, für Nietzsche verdächtiger Unsinn. Sarkastisch äußert er sich zu der Maxime „Das Wohl des Allgemeinen fordert die Hingabe des Einzelnen…“ Denn dieses Allgemeine, diese übergeordnete Einheit eines vermeintlichen Ganzen gibt es gar nicht. Für manche folgt aus dieser inzwischen mehrheitlich geteilten Ansicht ein 395 Diesen Ausdruck verwendet Maurice Blanchot. M. Blanchot: L’entretien infini, p. 234f. 396 F. Nietzsche: Sämtliche Werke II, p. 469. 397 M. Blanchot: L’entretien infini, p. 237; cf. M. Heidegger: Gesamtausg. XCVII. Frankfurt a. M. 2015, p. 35. „Schweiget im Wort. | So gründet die Sprache.“ 398 M. Blanchot: L’entretien infini, p. 247. 399 ibd. quasi-defätistischer Nihilismus, den Nietzsche dann ebenfalls kritisiert. Werte, gar der Wert des Ganzen, der Nation o.ä. bestehen gar nicht, sondern werden durch Wertsetzungen erzeugt; angesichts dessen ist nicht Verzweiflung angesagt, sondern der Wille zur Wertsetzung.400 Das betrifft aber auch die philosophische Psychologie. Die in ihr vorausgesetzte Einheit des Bewußtseins ist eine ungerechtfertigte, ja unsinnige Hypostase. Allgemein ist das Werden (des Bewußtseins, der Nation etc.) ein komplexer Prozeß, dessen Gelingen oder Mißlingen offen ist. Nietzsche exemplifiziert: ausgehend von einer Vielfalt der Begehrungen, setzt sich einer der Triebe als der stärkste durch: der Wille zur Macht; dieser ist sowohl im Inneren gegenüber allen anderen Trieben als auch nach außen in dem Willen zur Unterwerfung vergleichbarer Kraftquanten (Willenzur-Macht) der stärkere. So ist der Wille-zur-Macht kein irgendwie substantiell identifizierbarer Trieb im Triebhaushalt eines Subjekts, sondern es ist schlicht derjenige, der die anderen Triebe unterwirft und in dieser Differenz, in dieser Relation seine Wirklichkeit hat und so etwas wie Einheit überhaupt erst hervorbringt. Eben das gilt auch für diejenigen Willen-zur-Macht, die sich als Interpretationen äußern. Im Rahmen eines durchgängigen Perspektivismus ist der Wille zur Interpretation einer, der seinerseits behauptet, daß Interpretation eine Manifestation des Willens zur Macht sei, an der folglich jede „objektive“ Überprüfung dieser These zerschellen muß. Es gibt eben außerhalb dieser Behauptung und dieses mächtigen Interpretationsanspruchs nicht eine wahre Kontrollinstanz.401 Es ist dieser starke Wille zur Interpretation und zur Wertsetzung, der verhindert, daß Nietzsches Perspektivismus in einen grundlosen nihilistischen Relativismus mündet. Und schließlich gibt es keinen „Grund, an eine ‚seelische Einheit‘ zu glauben“402, gar an ein Ich. Dessen physiologische Grundlage ist selbst vielmehr ein Resultat einer „Vereinigung“. Der Grund der „Einheit“ eines Dings, auch eines Dings wie es unser Körper ist, ist nur der Einheitsgesichtspunkt, unter dem für uns so etwas wie Einheit relevant ist. Am deutlichsten wird das in folgendem Fragment aus dem Nachlaß. „Alle Einheit ist nur als Organisation und Zusammenspiel Einheit: nicht anders als wie ein menschliches Gemeinwesen eine Einheit ist: also Gegensatz der atomistischen Anarchie, somit ein Herrschafts-Gebilde, das Eins bedeutet, aber nicht eins ist. … Wenn alle Einheit nur als Organisation Einheit ist? Aber das ‚Ding‘ an das wir glauben, ist nur als Ferment zu verschiedenen Prädikaten hinzuerfunden. Wenn das Ding ‚wirkt‘, so heißt das: 400 F. Nietzsche: Sämtliche Werke XIII, p. 47. 401 l. c. XII, p. 17. 402 l. c., p. 29. wir fassen alle übrigen Eigenschaften, die sonst noch hier vorhanden sind und momentan latent sind, als Ursache, daß jetzt eine einzelne Eigenschaft hervortritt, d.h. wir nehmen die Summe seiner Eigenschaften – als Ursache der Eigenschaft x: was doch ganz dumm und verrückt ist!“403 … denn: Das „Ich“ (die Einheit des Bewußtseins) ist eine scheinbare Einheit, eine Illusion. „Am Leitfaden des Leibes zeigt sich eine ungeheure Vielfachheit…“404 Und das gleiche gilt auch auf Seiten der Dinge: „Alles, was als ‚Einheit‘ ins Bewußtsein tritt, ist bereits ungeheuer complizirt: wir haben immer nur den Anschein von Einheit.“405 Daher spricht Nietzsche auch davon, daß es wichtig sei, „… daß man das All, die Einheit los wird, irgend eine Kraft, ein Unbedingtes; … Man mu<ß> das All zersplittern; den Respekt vor dem All verlernen…“406 Diese Respektlosigkeit gegenüber dem All und der Einheit läuft nicht auf diffuse Vielheiten hinaus, sondern zunächst nur auf die Zerstörung der Illusion einer Einheit am Ursprung (der Welt oder unserer Erkenntnis) oder als Generalvoraussetzung unserer Weltzuwendung hinaus. Voraussetzung ist vielmehr bedingungslos die Vielheit; gewollt im Modus des Willens-zur-Macht ist aber sehr wohl eine Einheit via Prozeß der Vereinigung, z.B. als Einheitsbildung durch Unterwerfung und aristokratische Erhaltung der Schwächeren durch die Stärkeren in einer Einheit mit dem starken Willen-zur-Macht im Konzert der Kraftquanten. Im Prozeß des Werdens ist Einheit nicht vorhanden, im Werden kommen nur Vielheiten vor, aus denen, unserem praktischen Interesse folgend, Einheiten gebildet werden.407 DasWerden als solches ist aber selbst auch keine Einheit, es gibt keinen „‘Prozeß des Ganzen‘.“408 Im Rahmen seiner Überlegungen zum „Willen zur Macht“ finden sich die entscheidenden Aufzeichnungen zum Zusammenhang von Einheit, Willen zur Macht, Machtquanten, Ich-Begriff und Berechenbarkeit: „Es giebt kein Gesetz: jede Macht zieht in jedem Augenblick ihre letzte Consequenz. Gerade, daß es kein mezzo termine giebt, darauf beruht die Berechenbarkeit. Ein Machtquantum ist durch die Wirkung, die es übt und der es widersteht, bezeichnet. Es fehlt die Adiaphorie: die an sich denkbar wäre. Es ist essentiell ein Wille zur Vergewaltigung und sich gegen Vergewaltigungen zu wehren. Nicht Selbsterhaltung: jedes Atom wirkt in das 403 l. c., p. 104f. 404 l. c., p. 106. 405 l. c., p. 205. 406 l. c., p. 317. 407 l. c. XIII, p. 36. 408 l. c., p. 37. ganze Sein hinaus,– es ist weggedacht, wenn man diese Strahlung von Machtwillen wegdenkt. Deshalb nenne ich es ein Quantum ‚Wille zur Macht‘: damit ist der Charakter ausgedrückt, der aus der mechanischen Ordnung nicht weggedacht werden kann, ohne sie selbst wegzudenken. Eine Übersetzung dieser Welt von Wirkung in eine sichtbare Welt – eine Welt für’s Auge – ist der Begriff ‚Bewegung‘. Hier ist immer subinteligirt, daß etwas bewegt wird – hierbei wird, sei es nun in der Fiktion eines Klümpchen-Atoms oder selbst von dessen Abstraktion, dem dynamischen Atom, immer noch ein Ding gedacht, welches wirkt, – d.h. wir sind aus der Gewohnheit nicht herausgetreten, zu der uns Sinne und Sprache verleiten. Subjekt, Objekt, ein Thäter zum Thun, das Thun und das, was es thut, gesondert: vergessen wir nicht, daß das eine bloße Semiotik und nichts Reales bezeichnet. Die Mechanik als eine Lehre der Bewegung ist bereits eine Übersetzung in die Sinnensprache des Menschen. Wir haben Einheiten nöthig, um rechnen zu können: deshalb ist nicht anzunehmen, daß es solche Einheiten giebt. Wir haben den Begriff der Einheit entlehnt von unserem ‚Ich’begriff, – unserem ältesten Glaubensartikel. Wenn wir uns nicht für Einheiten hielten, hätten wir nie den Begriff ‚Ding‘ gebildet. Jetzt, ziemlich spät, sind wir reichlich davon überzeugt, daß unsere Conception des Ich-Begriffs nichts für eine reale Einheit verbürgt.“ 409 Mit Nietzsches Herleitung von Einheit aus Vielheit sind wir an einen Punkt gekommen, den Gründen für diese illusionäre Voraussetzung von Einheit für Vielheit nachzugehen. Nietzsches Zeitgenosse Sigmund Freud immerhin hielt die Suche nach letztbegründender Einheit für eine Philosophen-Krankheit: „Ich fürchte Sie sind auch ein Philosoph“, schreibt er an Groddeck, „und haben die monistische Neigung, alle schönen Differenzen in der Natur gegen die Lockung der Einheit geringzuschätzen. Werden wir damit die Differenzen los?", fragt er.410 Damit ist das Stichwort für den nächsten Abschnitt gefallen, der nun explizit den Differenzbegriff zu klären hat. 2.6.2 Differenz Es macht einen Unterschied aus, den wir von Nietzsche lernen konnten, ob eine unbestimmte Vielheit zum Ausgang genommen wird oder ob eine Differenz dort steht. Eine Vielheit kann durch Prozesse der Vereinigung zu – wie auch immer fiktiven – Einheiten geführt werden. Für die Differenz aber gilt das, was Lacan für das Subjekt in der Analyse festgestellt hatte. Im psychoanalytischen Dialog sprechen nicht zwei miteinander, sondern der Patient ist gespalten in das Subjekt, das „spricht“, und das Subjekt, das spricht. Im „Sprechen“ und seinem mitgeführten Schweigen er-spricht 409 l. c., p. 258f. 410 S. Freud, G. Groddeck: Briefe über das Es, hrsg. v. M. Honegger. Frankfurt a. M. 1988, p. 13, hier zit. nach K. Meyer-Drawe: Illusionen von Autonomie. München 1990, p. 119. sich das Subjekt. Das Subjekt ist gespalten zwischen dem aussagenden und dem ausgesagten Subjekt. Wenn das Subjekt „sich“ aussprechen will, ist sein Sprechen schon ver-rückt. In Freud-Interpretation sagt Käte Meyer-Drawe:411 „Das Ich konkretisiert sich nur als Differenz, die seine Identität ausmacht…“ Eine andere Quelle der Differenztheorien des 20. Jahrhunderts ist Heideggers ontologische Differenz.412 Diese markiert die Differenz von Sein und Seiendem. Während die metaphysische Tradition Sein als Totalität des Seienden verstanden hatte, insistiert Heideggers ontologische Differenz darauf, daß die Frage nach dem Sein die Frage nach dem ist, was jenes „ist“ ausmacht, wenn man sagt, das Seiende ist. Die Frage nach dem Sein des Seienden ist die Frage nach dem Seinsmodus des Seienden. Während aber „Sein und Zeit“413 bei dieser Differenz stehenblieb, stellt die spätere Ereignisphilosophie Heideggers heraus, daß die Feststellung der ontologischen Differenz nur vorbereitenden Sinn gehabt haben konnte. Die Ereignisphilosophie exponiert nun, was sich im ersten Anfang der Philosophie bei den Griechen begeben hatte. Damals war die „Wesung des Seyns“ noch verstanden worden als Anwesenheit. Das Seiende (auch in seiner Totalität) ist das Vertraute, „aus dem das Seyn nur als verdunstender Rest abgehoben werden konnte, als wäre das Seyn nur die noch nicht gefaßte allgemeinste Bestimmung des sonst bekannten Seienden.“414 Als allgemeinste Bestimmung ist es die Wahrheit des Seienden, welches dann in der metaphysischen Tradition seit Aristoteles zu der Richtigkeit von Aussagen verkam. Der von Heidegger ins Auge gefaßte „andere Anfang“ kehrt die ontologische Differenz um. In ihm „vollzieht sich die äußerste Entrückung vom ‚Seienden‘ als dem vermeintlich Maßgebenden…So bleibt das Seyn entwürdigt zu einem Nachtrag… “415 Aber im „anderen Anfang“ wird das Seyn als Ereignis verstanden, es ist nicht mehr nur Verallgemeinerung ausgehend vom Seienden. Das verändert auch die Sicht auf die ontologische Differenz; denn nun geht es in der Entrückung vom Seienden um die Wahrheit des Seyns selbst. Diese Aspektverschiebung führt Heidegger zur Diagnose der Seinsvergessenheit, d.h. die Differenz erscheint nun als Abwesenheit des Seyns 411 K. Meyer-Drawe: Illusionen von Autonomie, p. 118. 412 Heinz Kimmerle behandelt in seiner Einführung in die Philosophien der Differenz nach der Suche nach Einflüssen durch Hegel, Nietzsche, Freud und de Saussure vor allem Adorno, Heidegger, Deleuze, Lyotard und Derrida, sowie die „praktische Seite“ bei Irigaray, Kristeva und in der interkulturellen Philosophie. H. Kimmerle: Philosophien der Differenz. Würzburg 2000 auf der Grundlage eines Kurses für die FernUniversität in Hagen. 413 M. Heidegger; Sein und Zeit. 414 ders.: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), p. 258. 415 ibd. im Seienden. Das erscheint als eine Radikalisierung des Gedankens der Differenz, hinter die nicht mehr zurückgegangen werden kann. Während Heidegger den „anderen Anfang“ nur proklamiert hat und seine Leitlinien im Zusammenspiel von Dichten und Denken skizziert hat, war es Maurice Blanchot, der diesen Übergang in seinem Schaffen vollzogen hat. Bei ihm hat daher die Rede von der Differenz einen anderen, deutlicheren Zungenschlag. Nietzsches Diktum von der Wiederkehr des Gleichen gibt ihm Anlaß zu der Frage: Wenn es wiederkehrt, ist es dann überhaupt noch das Gleiche, oder umgekehrt: wenn es das Gleiche ist, wieso ist es dann eine Wiederkehr und nicht eine stetige Omnipräsenz? „… la différence et la répétition, soit la non-identité du même?”416 Vielleicht aber, so mutmaßt er wohlwollend, ist die “ewige Wiederkehr des Gleichen” („l’éternel retour du même“) nur eine Vermeidung einer Rede von der immerwährenden Abweichung der Differenz: „perpétuel détour de la différence“. Mit der Korrespondenz von retour und détour greift er ein Angebot der französischen Sprache zum Verständnis des Deutschen Nietzsche, bzw. eines seiner grundlegenden Gedanken auf.417 Wenn man, wie Blanchot über Nietzsches Philosophie sagt, die Welt als einen auslegungsfähigen Text begreift, dann allerdings verläßt man spätestens das Denken des Vorrangs der Einheit; denn der Text als solcher ist die Realität der Differenz, „puisque l’écriture est différence, puisque la différence écrit.“418 So kann für Blanchot Differenz nur qua Textualität begreiflich gemacht werden, und zwar als NichtIdentität des Selbst, als Bewegung der Selbst-Distanzierung.419 Im kommunikativen Text, wie wir sagen, ist diese differentielle Selbst-Distanzierung der Wechsel der Besetzung der Funktionspositionen. In der Antwort wechselt der angesprochene, hörende Andere in die Position des antwortenden Selbst. Selbst ist durch diese Abweichung (détour) nicht mehr identisch: die Differenz hat Einzug ins Selbst gehalten. Solche Entfaltung der Differenz, die keine dialektische „Versöhnung“ mehr kennt, 416 M. Blanchot: L’entretien infini, p. 410. 417 l. c., p. 413. 418 l. c., p. 247. 419 Zur Differenz-Genese qua Bewegung s.o. das zu Serres und seinem Lukrez Ausgeführte; vom gerechtfertigten Grundsatz „Aus n/Nichts wird n/Nichts“ ausgehend, folgt, daß aus dem Chaos allein keine Welt entstehen konnte, dazu braucht man Energie, also eine Bewegung, mithin eine Differenz; das Fallen der Atome begründet diese ursprüngliche Differenz, M. Serres: La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce, p. 168f.; auch A. Wilden: System and Structure, p. 399; oder Niklas Luhmann, für den jede Operation eine Unterscheidung einführt: „jeder Anfang ist eine Differenz.“ N. Luhmann: Die Tücke des Subjekts und die Frage nach dem Menschen.- In: Der Mensch – das Medium der Gesellschaft?, hrsg. v. P. Fuchs u. A. Göbel. Frankfurt 1994, p. 40-56, hier p. 51. ist das offenbare Geheimnis des Werdens.420 Das Geheimnis des Werdens liegt inmitten der Kommunikation, wir sagen: es kommunikativen Textes, im Zwischen. Das unendliche Gespräch (entretien infini) entfaltet (expliziert) die Differenz. Dieses Zwischen bietet Nähe und Distanz zugleich, ähnlich der Fuge bei Heidegger: es greift im Text ineinander ohne die Benötigung eines Umgreifenden oder einer Überbrückung des Abstands und ohne die Konfusion einer unendlichen Nähe. Indem sie sich in einem Gespräch befinden, sind die Kommunizierenden vereint; indem sie es als Wechselrede realisieren, halten sie sich in Distanz und Differenz. Im Reden enthüllt und verhüllt sich ein Selbst (Heidegger spricht bekanntlich von verbergender Entbergung als Wesen der Wahrheit): „… c’est la Différence elle-même, mystérieuse…“421 Die Abweichung, der Ab-weg konstituiert die Differenz im Text. Für Jacques Derrida, Denker der Differenz par excellence,422 ist die Zeitlichkeit der Abweichung ein auslösender Faktor; différer heißt im Französischen eben auch: aufschieben, verzögern, eine Erfüllung suspendieren: „Différer …heißt temporisieren, heißt bewußt oder unbewußt auf die zeitliche und verzögernde Vermittlung eines Umweges rekurrieren, welcher die Ausführung oder Erfüllung des ‚Wunsches‘ oder ‚Willens‘ suspendiert…“423 Weil aber das einfache Wort „différence“ nicht auf die Vielfältigkeit des différer verweisen konnte, führt er die Differenz in die Differenz selbst ein und schreibt – diesen Mangel kompensierend –: différance.424 Mit dieser ihm eigenen, im Mündlichen unhörbaren Abweichung will er, die Zeitlichkeit der Abweichung einfangend, den Prozeß „von Spaltung und Teilung“425 hervorheben. In seiner Husserl-Kritik, die sich hauptsächlich auf dessen Zeit-Philosophie bezieht, ist sein Hauptaugenmerk gerichtet auf Husserls Begriff der Urimpression, der eine reine Präsenz voraussetzte. Derrida wendet ein, daß es diese reine Präsenz gar nicht gibt, sie vielmehr immer schon geteilt ist durch eine reine Differenz. 420 M. Blanchot: L’entretien infini, p, 65. 421 l. c., p. 129. 422 Die Abhängigkeit auch des Derridaschen Differenzdenkens von Heideggers Philosophie beleuchtet Françoise Dastur. F. Dastur: Heidegger, Derrida et la question de la différence.In: Derrida, la tradition de la philosophie, hrsg. v. M. Crepon u. F. Worms. Paris 2008, p. 87-106. 423 J. Derrida: Randgänge der Philosophie. Wien 1988, p. 36. 424 l. c., p. 37. 425 ibd. „Man muß durch sie [die Selbstgegenwart] hindurchgehen, um sich die Differenz in nächster Nähe zu ihr selbst wieder zueigen zu machen – und nicht zu ihrer Identität oder zu ihrer Reinheit oder zu ihrem Ursprung. Dergleichen hat sie nicht. Sondern in nächster Nähe zur Bewegung der différance. Diese Bewegung der différance überfällt nicht unvermutet ein transzendentales Subjekt. Sie bringt es hervor. … Sie bringt das Selbe als Beziehung zu sich in der Differenz mit sich, das Selbe als das Nicht-Identische hervor.426 Das hat eine theoretisch dramatische Folge: différance als Prozeß kann nicht mehr als „Repräsentation einer Präsenz“427 verstanden werden. Diese Einsicht wiederholt quasi Heideggers Überwindung der ursprünglichen ontologischen Differenz. „Repräsentation einer Präsenz“ hatte noch die Struktur von „das Sein des Seienden“. Aber sowohl Heideggers „Seyn als Ereignis“ als auch Derridas Prozeß von Spaltung und Teilung überschreiten diese ursprünglichen Festlegungen. Differenz wandelt sich von einem reinen Relationsbegriff zu einem Begriff relationierender Prozessualität. Derrida selbst bestätigt diese interpretatorische Vermutung, wenn er sagt, daß die différance „auf eine gewisse und äußerst sonderbare Weise ‚älter‘ als die ontologische Differenz oder als die Wahrheit des Seins“ sei.428 Dieser Anciennitäts-Vorsprung rührt genau von diesem Vorrang des Prozessualen und des Ereignishaften bei Heidegger gegenüber einer semantischen Statik her. Auch in späteren Texten hat Derrida immer wieder versucht, – „dekonstruierend“ – seine Distanz zum frühen Heidegger herauszuarbeiten. In Marx‘ Gespenster hat er z.B. behauptet429 – vermutlich zu Unrecht –, daß Heidegger in seinem Aufsatz zum Spruch des Anaximander 430 dem Versammeln oder gar dem Selbst einen Vorrang gegenüber der Differenz, also dem Bruch gegeben habe, könnte heißen: vor dem Ereignis, und das wäre einfach unzutreffend. Wenn Derrida dann freilich levinasianisierend auch kritisch von dem Vor- 426 J. Derrida: Die Stimme und das Phänomen. Frankfurt a. M. 2003, p. 112: Gerhard Gamm kommentiert: „Gegenwart ist nie.“ G. Gamm: Der unbestimmte Mensch. Berlin, Wien 2004, p. 233. 427 J. Derrida: Die Stimme und das Phänomen, p. 38. 428 l. c., p. 51. 429 J. Derrida: Marx‘ Gespenster. Frankfurt a. M. 1995, p. 55. 430 M. Heidegger: Der Spruch des Anaximander.- In: ders.: Holzwege. Frankfurt a. M. 1977, p. 321-373. rang des Selbst vor der Hinwendung zum Großen Anderen spricht, dann hat er zweifellos in diesem Punkt recht. Heidegger ist kein Levinasianer, wie es allerdings der spätere Derrida z.T. geworden ist.431 Das Denken der Differenz drückt sich vor allem in den späteren Texten Derridas auch aus in kulturellen und sozialen Zusammenhängen. Bekannt und viel zitiert ist sein Diktum: „Es ist einer Kultur eigen, daß sie nicht mit sich identisch ist.“432 So wird Kultur als eine Realität von Differenz dargestellt; aber es ist nicht ganz klar, ob nicht – insofern es um Multikulturalismus gehen soll – hier keine differenztheoretische, sondern eine pluralistische These unterstellt werden muß, wenngleich die Nichtidentität, d.h. die Selbstdifferenz, vielleicht doch zuerst differenztheoretisch formuliert ist, und zwar weil sich die klassische Identitätstheorie an Nichtidentität abarbeitet.433 In einem langen Text über Blanchots kurzen Text „L’instant de ma mort“ 434 fragt sich Derrida, wie jemand über seinen eigenen Tod schreiben könne. Und seine Antwort, die auch von Foucault435 und von der Theorie des kommunikativen Textes 436 geteilt wird und die ganz auch Blanchots eigenem Verständnis von Schreiben entspricht, lautet: Das ist nur möglich weil, und zeigt es auf unwiderlegliche Weise, daß die Autorfunktion von dem Schreibenden in Differenz gesetzt und gehalten wird, eine Position, die auch von Blanchot (übrigens auch von Heidegger) konsequent durchgehalten wurde, so daß wir von Blanchots Leben fast nichts wissen und vielleicht gar nichts wüßten, wenn nicht seine Freunde in ihren Texten einiges über ihn gesagt hätten – so eben auch Derrida. Seine These ist, daß es genau der Tod ist, der die genannte Differenz unwiderleglich macht: der Tod steht zwischen Autor und Erzähler, ja läßt sie so wenig in eins zusammenfallen, daß durch ihn Fiktion und Zeugnis irreparabel 431 Zur komplementären Differenz von Derrida und Heidegger s. F. Dastur: Heidegger, Derrida et la question de la différence, p. 105: „Derrida est le penseur de l’absence de la présence … alors que Heidegger est celui de la presence de l’absence.”… was ja kein Widerspruch, sondern nur eine Akzentverschiebung ist. 432 J. Derrida: Das andere Kap. Frankfurt a, M. 1992, p. 12. 433 Zur Neufindung eines anderen Identitätsbegriffs s. K. Röttgers: Identität als Ereignis. Bielefeld 2016. 434 M. Blanchot: L’instant de ma mort. Paris 2002 (zuerst 1994); dazu J. Derrida: Demeure. Maurice Blanchot. Paris 1998. 435 M. Foucault: Was ist ein Autor?- In: ders.: Schriften zur Literatur. Frankfurt a.M. 1988. p. 7–31. 436 K. Röttgers: Das Leben eines Autors. Was ist ein Autor, und wo lebt er?- In: Dialektik 2005/1, p. 5-22, auch im e-Journal http://www.jp.philo.at/texte/RoettgersK2.pdf Philosophie der Psychologie unter: getrennt sind. Zwar ist bekannt, daß Autobiographien Fiktionen sind – Hannah Arendt kannte nichts Verlogeneres als Autobiograpien, weil sie ihre Prätention als Zeugnisse ernst nahm –, aber Autothanatographien zeigen die Differenz in aller Deutlichkeit. Auch Heidegger schrieb ja in „Sein und Zeit“ nicht über seinen Tod, sondern über den „jemeinigen“. Und der liegt in einer essentiell unbekannten Zukunft, d.h. in einer Zukunft, die die Gegenwart wie ein Schatten stets begleitet (als „Vorlaufen“). Die satirische Online-Publikation „Der Postillon“ hatte 2016 einen interaktiven Test ins Netz gestellt „Sind Sie noch am Leben oder bereits tot?“437 Je nachdem, wie man antwortete, konnte es einem passieren, daß man am Ende die Auswertung erhielt: „Oh, tut uns leid, aber Sie sind bereits tot … Naja, es gibt Schlimmeres.“ Dekonstruktive Verfahren fördern Unsichtbares zutage. Im Unterschied zur Kritik in der Moderne ist die dekonstruktive „Kritik“ der Postmoderne die Aufhellung derjenigen Probleme, die bereits mit der Annahme einer Begrifflichkeit und den darin implizierten Differenzen aufbrechen. So gilt zunächst die empirisch zu erhebende Feststellung, daß die sexuelle Differenz für Heidegger keine Rolle spielt. Aber dekonstruktiv läßt sich ermitteln, daß, obwohl die sexuelle Differenz in „Sein und Zeit“ kein Thema ist, sie doch genau dort eine Rolle spielt: „Bien que la sexualité n’y soit pas nommée, ces motifs y sont traités de façon plus complexe, plus différencée…“438 Für Heidegger, so sagt Derrida, ist Dasein ein Neutrum; die sexuelle Differenz aber ist für ihn eine bloße Faktizität, derer sich die Wissenschaften oder allenfalls Teildisziplinen der Philosophie annehmen könnten. Die Daseinsanalytik als solche kennt keine sexuelle Differenz, das Dasein gehört folglich weder der Männlichkeit noch der Weiblichkeit an. Diese Form der Differenz ist eben keine, die das Denken der Wahrheit des Seyns betrifft. Ein anderer Denker der Differenz ist Gilles Deleuze, durchaus unterschieden (different!) von allen von Heidegger herkommenden Differenztheoretikern. Für ihn ist Singularität in ihrer nomadischen Einzigartigkeit eine Grundannahme. Das Leben ist nicht statisch und nicht seßhaft, sondern vielfältig beweglich, es entsteht immer wieder und unvorhersehbar neu. Deleuzes Philosophie ist nicht kritisch im herkömmlichen Sinne von Moderne und Spätmoderne, aber auch nicht dekonstruktiv in Derridas Sinn; sie ist wesentlich positiv und affirmativ, 439 wendet sich aber wegen der reinen Positivität auch von jeglicher Transzendenz ab. So ist es zwar eine Philosophie der Differenz aber einer Differenz in reiner Immanenz.440 Für die Kunst beispielsweise 437 www.der-postilloon.com/2016/08/psychotext-leben.html. 438 J. Derrida: Psyche. Invention de l’autre II. Paris 2003, p. 29. 439 G. Deleuze: Differenz und Wiederholung. 3. Aufl. München 2007, p. 296: „Sie [die Intensität] macht aus der Differenz einen Gegenstand von Bejahung.“ 440 Cf. W. Langer: Gilles Deleuze. Kritik und Immanenz. Berlin 2003, p. 158ff. heißt das, daß sie nichts repräsentiert, in Immanenz bezieht sie sich anknüpfend und verwendend auf Immanentes, also andere Kunstwerke z.B. So stellt sich Differenz in Immanenz her. „Bekanntlich versucht das moderne Kunstwerk diese Bedingungen zu verwirklichen: es wird in diesem Sinne ein regelrechtes Theater, bestehend aus Metamorphosen und Permutationen. Ein Theater ohne Fixpunkt, ein Labyrinth ohne Faden (Ariadne hat sich erhängt). Das Kunstwerk verläßt das Gebiet der Repräsentation, um ‚experimentelle Erfahrung‘ zu werden…“441 Während Derrida mit der UrSpur die Differenz in einen Punkt 0 versetzt, verlangt die nomadische Differenz nach einem Punkt n+1 oder auch n-1. Seinen Entwurf einer Immanenzphilosophie nennt Deleuze auch einen „transzendentalen Empirismus“.442 Weiter heißt es an gleicher Stelle: „In Wirklichkeit wird der Empirismus transzendental und die Ästhetik eine apodiktische Disziplin, wenn wir im Sinnlichen direkt das auffassen, was nur empfunden werden kann, das Sein selbst des Sinnlichen: die Differenz, die Differenz im Potential, die Intensitätsdifferenz als ratio des qualitativ Verschiedenen. Die Differenz ist es, in der das Phänomen aufblitzt, sich als Zeichen expliziert und in der die Bewegung sich als ‚Effekt‘ ergibt. Die intensive Welt der Differenzen, in der die Qualitäten ihre ratio finden und das Sinnliche sein Sein, ist eben der Gegenstand eines höheren Empirismus. Dieser Empirismus lehrt uns eine fremdartige ‚ratio‘, das Viele und das Chaos der Differenz (nomadische Verteilungen, gekrönte Anarchien). Immer sind es die Differenzen, die sich ähneln, die analog, entgegengesetzt oder identisch sind: Die Differenz steht hinter jedem Ding, hinter der Differenz aber gibt es nichts.“ 443 Auch Deleuze bemüht sich um Nietzsches Satz der ewigen Wiederkehr. Korrigierend-interpretierend führt er aus, daß in der Wiederkunft nicht dasselbe oder auch nur ein Ähnliches wiederkehrt. Deleuze sagt, daß die Wiederkunft ausgesagt wird in einer „Welt ohne Identität“444 – „Sie sagt sich von einer Welt aus, deren Untergrund selbst die Differenz ist, wo alles auf Disparitäten, Differenzen von Differenzen beruht, die bis ins Unendliche widerhallen…“ „Die Differenz ist nicht das Verschiedene. Das Verschiedene ist gegeben. Die Differenz aber ist das, wodurch das Gegebene gegeben ist. Sie ist das, wodurch das Gegebene als Verschiedenes gegeben ist. Die Differenz ist nicht das Phänomen, sondern das Noumenon, das dem Phänomen am nächsten kommt.“445 441 G. Deleuze: Differenz und Wiederholung, p. 84. 442 ibd. 443 ibd. 444 l. c., p. 305. 445 l. c., p. 281. In jenem „am nächsten kommt“ verrät sich die Immanenzphilosophie, während eine transzendente Philosophie an dieser Stelle sagen müßte: „begründet“ oder „konstituiert“. Jedoch zu zeigen, wie die Wiederholung, die Vielfalt der Wiederholungen mit der reinen Differenz (ungleich der negationslosen Differenz im Erscheinenden) im Zusammenhang stehen, würde an dieser Stelle zu weit führen. Es kam hier vielmehr darauf an, an Deleuzes Begriff einer affirmativen Differenz einen immanenzphilosophischen Differenzbegriff herauszuarbeiten. Zwischenbemerkung: Wolfgang Welsch versucht,446 den immanenzphilosophischen Differenzbegriff mit dem Gedanken einer Übergangsgarantie zu verbinden; er bezieht sich dabei auf „Rhizom“ und meint: „Deleuze und Guattari setzen das Differente nicht monadisch, monolithisch, insular an. Daher geraten sie gar nicht erst in die Sackgasse ‚idealer‘ Nur-Differenz.“ Dieser Popanz wird von Welsch hochgehalten, damit im Gegenzug den Autoren ein Kontinuitätsdenken unterstellt werden kann, das dann Welschs Vernunftbegriff soll tragen können. Ich glaube, diese Harmonisierung von Welschs „Vernunft“ mit Deleuze/Guattaris „Rhizom“ mußte mißlingen. Welsch wollte zeigen, „daß Vernünftigkeit sich in Übergängen realisieren muß – und daß solche Übergänge geschehen können, ohne daß die Differenzen gelöscht werden.“ Auf „Differenz und Wiederholung“ geht Welsch nur auf einer einzigen Seite ein, und zwar (ohne Nachweis) auf die von Deleuze im Vorwort angesprochen Gedanken.447 Auch seine kurze Erwähnung des Gedankens der Wiederkehr bei Nietzsche bleibt unter dem Niveau der oben anläßlich von Blanchot ausgeführten Differenziertheit: er nämlich meint, daß Nietzsche zwar mit seiner Aphoristik das linearen Denken durchbrochen habe, „vereinigt dann aber die Fragmente am Ende in der großen Einheitsform der ewigen Wiederkehr.“448 Die verschiedenen Differenztheorien von Derrida und Deleuze hat Jean-Luc Nancy zu einem bemerkenswertren Aufsatz mit dem Titel „Les différences parallèles (Deleuze & Derrida)“ behandelt.449 Der Aufsatz beginnt mit dem Satzfragment: „Deleuze et Derrida se partagent…“450 Die erste Instanz der Teilung ist der Anfang (commencement). Für Derrida ist der Anfang Antizipation und zugleich Abwesenheit in das Eindringen in ein Ziel, das niemals erreicht werden wird. Für Deleuze ist Anfang 446 W. Welsch: Vernunft. Frankfurt a. M. 1996, p. 365ff. 447 l. c., p. 355f. 448 l. c., p. 358. 449 J.-L. Nancy: Les différences parallèles (Deleuze & Derrida).- In: Derrida, la tradition de la philosophie, hsrg. v. M. Crépon u. F. Worms. Paris 2008, p. 199-215; dt. auch in: ders./ René Schérer: Ouvertüren. Texte zu Gilles Deleuze. Zürich, Berlin 2008, p. 31-.50. 450 l. c., p. 199. in dem Sinne gar kein Anfang, weil alles Beginnen immer schon in einer ununterbrochenen Bewegung seinen Ort hat. Beiden stellt sich die Aufgabe, die Differenz zu denken, sie sind Zeitgenossen in unserem Zeitalter der Differenz, d.h. der Zerrüttung einfacher oder abgesicherter Identität und aller Kontinuitäten oder sogar des Menschen. Was also ist die Differenz als solche? Deleuze und Derrida sind auch gemeinsam Gegner derjenigen, denen die Differenz gefährlich erscheint, weil sie (nostalgisch) den Ideen der Wiederherstellung der klassischen Identitätsvorstellungen des Menschen und seiner Menschenrechte, sowie des vernünftigen Konsenses der Vernünftigen anhängen. Der Weg von Deleuze besteht darin, Begriffe zu erfinden,451 der Weg Derridas, nicht unähnlich, darin, die Sprache zu berühren: „toucher à la langue“: „…cela sans aucun doute revient à la différence du même qui ne revient au même qu‘en le diffractant à travers son propre prisme. Qui ne revient donc pas, qui ne se revient pas, qui ne revient pas à soi.“452 Das Differenzdenken folgt bei beiden nicht einer ursprünglichen Einheit, die sich dann à la Plotin im zweiten Akt in Differentes gespalten hätte. Die Teilung, die Differenz geht der Einheit schon voraus. Vergleichbar ist vielleicht die parallele Differenz von Mann und Frau. Einem griechischen Mythos verdanken die Geschlechter sich einer Spaltung des Einen Menschen. Aber solch ein Mythos ist insofern irreleitend, als man diese Einheit nicht braucht, um die Differenz zu erklären. Und selbst im Geschlechtsakt, der denkbar größten Nähe, sind sie nicht Eines, sondern sie geben sich lediglich dem Prozeß der Vereinigung hin.453 Im Schöpfungsmythos der Genesis wird eine andere Geschichte der Geschlechterdifferenz erzählt; eine der Versionen berichtet, daß Gott den Menschen als Mann und Frau, d.h. in Differenz geschaffen hat. Aber selbst in der anderen Version, der mit der Rippe, ist eine differenztheoretische Deutung möglich. Denn erst in dem Moment des Auftauchens der Frau („Isha“) ist es für Adam möglich, sich als Mann zu erkennen. Ohne die Differenz wäre er nicht Mann („Ish“) gewesen. Also gibt es selbst in diesem Bericht keine Vorgängigkeit des Mannes, nur eines des Menschen („Adam“). Erst ab dem Moment, als Isha auftaucht, spricht die Bibel von Ish. Ish und Isha tauchen gleichzeitig auf: parallele Differenzen.454 451 G. Deleuze, F. Guattari: Was ist Philosophie? Frankfurt a. M. 1996, p. 9, passim. 452 J.-L. Nancy: Les différences parallèles, p. 202. 453 Umfassend dazu J. Evola: Metaphysik des Sexus. Frankfurt a. M, Berlin, Wien 1983. 454 St. Mosès: Au cœur d’un Chiasme.- In: Derrida, la tradition de la philosophie, p. 109-133, hier p. 131; cf. auch M. Voigts: Aus welchem Holze ist der Name?- In: Katabole 1 (1982), p. 38-58, hier p. 49. Zwischen Deleuze und Derrida gibt es aber auch wiederum keine Gemeinsamkeit, keinen Konsens oder Kontinuität. Zur Charakterisierung ihres Verhältnisses verwendet Nancy wie bereits im Titel seines Aufsatzes den Begriff der Parallelen: auch das „D“ im Differenzanfang ihrer Namen verbindet sie nicht, sondern sie teilen sich das D. Paradox wird es allemal; denn: „Ils ont en commun cette absence de communauté.“455 Das Fehlen von Gemeinsamkeit teilen sie in unverbindbarer Alterität gemeinsam: „la mêmeté de la différence“.456 Deleuze spricht davon, sich von sich zu unterscheiden, Derrida von einem sich unterscheidenden Selbst. Die deutsche Übersetzung sagt: „Deleuze sagt sich als ‚mit sich differieren‘ 457 aus… Derrida als ‚Sich differierend‘.“ Die parallelen Differenzen halten sich in Abstand: „D’un côté, le soi est donné et emporté avec la différence et comme la différence. De l’autre, le soi est donné et perdu dans la différence458 qui le diffère.“ Das heißt, für Deleuze sind Differenz und Sich-Sein dasselbe. Und an der Stelle kommt Nancy ins Spiel, der sagt, daß es immer um Sinn gehe. Aber, wie wir gesehen hatten, meint Sinn für Nancy nie den Einen Sinn, sondern den verteilten Sinn. Sinn macht gerade die parallele Konstellation von Sinn-Differenzen und Differenzen-Sinn. Man muß also einerseits sagen, daß es die Differenz nicht gibt, d.h. keine Identität von Differenz. Vor dem Hintergrund von Sinn-Pluralismus heißt für Nancy Philosophieren, in die Differenz eintreten und die Identität verlassen: „Ce qu’ils partagent, c’est aussi ceci: que philosopher, c’est entrer dans la différence, c’est sortir de l’identité et, par conséquent, prendre les moyens et les risques qu’une telle sortie exige. Peut-être s’agit-il de cela depuis le début de la philosophie: de ne pouvoir tenir en place là où il nous semble d’abord être posés, assurés d’un sol, d’une demeure et d’une histoire. Mais aussitôt que l’on bouge, la différence joue et il ne peut y avoir une manière unique d’entrer en différence.”459 Differenztheorien werfen auch ein neues Licht auf die Theorie der Übersetzung. Übersetzung wurde in alter Zeit als ein Angleichen des Fremden, des Fremdsprachlichen an das Eigene verstanden, so daß die Angleichung an das Deutsche auch als „eindeutschen“ bezeichnet wurde. Differenztheoretisch aber käme es darauf an, die Differenz des Sagens in verschiedenen Sprachen erkennbar zu halten. Daß das nicht immer möglich ist, ist klar. So hat sich z.B. Derrida vielfach einen Spaß daraus gemacht, Unübersetzbarkeiten zu erzeugen wie z.B. „pass de Methode“. Zwar wird 455 J.-L. Nancy: Les différences parallèles, p. 204. 456 ibd. 457 ders./ René Schérer: Ouvertüren, p. 39. 458 ders: Les différences parallèles, p. 207. 459 l. c., p. 214. konkret jeweils der Kontext determinieren, ob „keine Methode“ oder „Methodenschritt“ gesagt sein soll, aber jeder Franzose hört die durch den Kontext negierte Bedeutung irgendwie mit. Und wenn ein Naturschützer vor Naturschützern fordert: SEID GUT ZU VÖGELN! Kann ein Zuhörer es gar nicht vermeiden, die nicht-gemeinte Bedeutung nicht mit zu hören. Kardinal Frings soll in einer Weihnachtspredigt gesagt haben: „Freude kehrt in jedes Haus – jedes Haus ein Freudenhaus“. In einer Weihnachtspredigt ist der Sinn eigentlich klar, aber die andere, die ausgeschlossne Bedeutung klingt semantisch eben rudimentär mit an. In Interpretation von Marcel Proust stellt Armin Schäfer die Szene nach Albertines Tod so dar, daß er von einem „Austausch-Ich“ spricht.460 Es handelt sich psychisch um genau den Vorgang, den Derrida als différer bezeichnet hatte: ein anderes Ich461 tritt an die Stelle desjenigen, der in der Vergangenheit eine Beziehung zur lebenden Albertine hatte. Schäfer zitiert: „Das neue Wesen, dem es leicht sein würde, ohne Albertine, weiterzuexistieren, war in mir aufgetaucht.“462 Das „Austausch-Ich“ ist eine Abschattung des vergangenen Ichs. Auf diese Art der Differenzbildung wird im Abschnitt 2.7. zurückzukommensein. Zunächst aber wenden wir uns derjenigen Differenz zu, die sich in Verführungen ausgestaltet. 2.6.3 Die Verführung 2.6.3.1 Verführung als Verfugung – statt Tat eines Täters Man kann Verführung nicht begreifen, wenn man sie sich als ein Tun eines Täters, also eines Handlungssubjekts, vorstellt, der oder das ein anderes Subjekt mit seinem Tun zu einem Objekt seiner Handlungen macht, also be-handelt. Verführung ist keine Behandlung irgendeiner Art. Man muß vielmehr auch hier die Perspektive umstellen auf das Zwischen, in dem sich Verführung als Prozeß ereignet. Aber genau ersteres war die Sicht der Alltagspsychologie und auch die der subjektzentrierten Psychologie von Moderne und Spätmoderne: Es gibt einen Menschen (einen Mann zumeist in dieser Sicht), der will einen anderen Menschen (eine Frau zumeist) zur Willfährigkeit bringen. Zu diesem Zweck wählt er nicht das Mittel des Zwangs zur unmittelbaren Durchsetzung seines Willens, sondern quasi den Umweg der Verführung. Im Zuge 460 A. Schäfer: Mittendrin.- In: Die biologische Vorgeschichte des Menschen, hrsg. v. J. F. Lehmann, R. Borgards, M. Bergengruen. Freiburg 2012, p. 301-322, bes. p. 309f. 461 Zu verschiedenen Interpretationen von Rimbauds Satz „ICH ist ein anderer“ s. K. Röttgers: Identität als Textereignis. ceive/mir_mods_00000578, p. 4-13. 462 A. Schäfer: Mittendrin, p. 309. https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/re- der Amerikanisierung der europäischen Kultur, konkret hier der bigotten Moralisierung, wird dann eine solche Willensdurchsetzung als sexueller Übergriff oder als unverschämte Anmache deklariert, was zuvor in Europa als Kunst und Kultur der Verführung gepflegt wurde, nämlich als Erotisierung der Geschlechterdifferenz, statt einer plumpen und negativ bewerteten Verletzung von Selbstsein. „Man sagt, daß die Verführung eine Strategie sei. Nichts ist falscher. Die Verführung beruht auf unvorhersehbaren Verkettungen…“463 Die Subjekt-Psychologie hat allerdings diese Unvorhersehbarkeit immer durch eine als solche unsichtbare Triebstruktur zu erklären versucht.464 2.6.3.2 Gegenseitigkeit: Differenz und Fuge Verkettungen – das heißt: Verführungen beruhen auf Gegenseitigkeit gemäß der alten Dienstmädchen-Parole von ehemals „Oh Gott, man wird so leicht verführt, man muß sich nur bemüh’n“. In der Gegenseitigkeit unterscheidet sich Verführung auch von Liebe. Unglückliche, d.h. einseitige Liebe, die nicht erwidert wird, ist möglich und geschieht; aber unglückliche Verführungen gibt es nicht, lediglich scheiternde. Liebe, die nicht erwidert wird, kann als unglückliche Liebe und Sehnsucht fortbestehen, aber die Gegenseitigkeit einer Verführung läßt einseitig fortbestehende „Verführung“ nicht zu. Das zeigt noch einmal das Ungenügende eines einseitig handlungstheoretischen Verständnisses. Denn auch das Scheitern ist nicht das Scheitern einer handlungstheoretisch zu verstehenden Strategie, sondern es ist ein Scheitern im Zwischen möglich gewesener Gegenseitigkeit. Liebe kennt Eifersucht, wenn sie mit Besitzergreifung verbunden ist, Verführung, da sie auf Gegenseitigkeit beruht, kennt eine solche Eifersucht deswegen nicht. Aber Gegenseitigkeit heißt nicht Einverständnis oder gar Konsens. Die Gegenseitigkeit ruht im Gegenteil wie der kommunikative Text generell auf Wiederholungen von Positionswechseln auf: Hingabe – Verweigerung – deren Anspielungen und Vorspiegelungen und deren vielfältigen Varianten. 463 J. Baudrillard: Die fatalen Strategien. München 1985, p. 191. 464 Die Freudsche These einer ursprünglichen Verführung war schon bei Freud selbst zweideutig, war es ein reines Phantasma oder entsprach ihm eine für die kindliche Entwicklung problematische Realität, und Freud bemühte sich detektivisch, die erinnerte vergangene Verführung von der phantasierten vergangenen Verführung zu scheiden, weil diese Unterscheidung für die Therapie von Relevanz sei. S. Freud: Werkausgabe in 2 Bden., hrsg. v. A. Freud u. Grubrich-Simitis. Frankfurt a. M. 1978, I, p. 280, 459. Diese These ist von J. Laplanche korrigiert worden: Von der eingeschränkten zur allgemeinen Verführungstheorie.- In: ders.: Die allgemeine Verführungstheorie und andere Aufsätze. Tübingen 1988, p. 199-239. So können sämtliche Philosophien der Anerkennung465 Verführung nicht verstehen oder lehnen sie mit der ihnen eigenen Normativität einer „kritischen“ Theorie als „Macht“-Strategie ab. Gegenseitigkeit im kommunikativen Text und so auch in Verführungsprozessen ist stets asymmetrisch und daher für die in dieser Hinsicht nichtsozialen Intersubjektivitätstheorien anstößig.466 Aber Verführung ist eben – damit ein Musterbeispiel des kommunikativen Textes – wechselnd asymmetrisch und eben kein Übergriff wie Zwang oder Vergewaltigung; auf einer Metaperspektive, die den Wechsel der Besetzung der Positionen mit einbezieht, ist dieser Prozeß aus Asymmetrie-Wechseln dann auch wieder, unter Abstraktion vom Prozeßcharakter, als Symmetrie darstellbar. Die in der Verführung aktuelle Differenz ist eine Differenz der Fuge: ein verfugter Zwischen-Raum. Maurice Blanchot interpretiert sogar Heraklit in dem Sinne, daß es zwischen Dingen und Wörtern eine solche permutierende Differenz gibt, darstellbar anhand der Einheitsbildung über Vielheiten.467 Für ihn seien Sprache und Wörter auf ihre Weise dinglich, und die Dinge der Welt sprechen – ihre Sprache. Das läuft über Enthüllungen und Verbergungen auf beiden Seiten der Differenz. 2.6.3.3 Das Zwischen: die Fuge Wie gesagt, im Zwischen artikuliert sich diese Ambivalenz aufgrund der Positionswechsel. Und genau das geschieht im Sinne Heideggers in der Fuge. Was aber wird in der Fuge verfugt/verfügt? Heidegger spricht in der Programmatik seiner EreignisPhilosophie davon, daß diese „eine Fuge dieses Denkens zu sein“ habe.468 Dazu merkt er dreierlei an: erstens bildet das Gefüge der Fuge (d.h. die Struktur der Fuge) 465 Erwähnt seien abkürzungshalber nur J. Habermas: Die Einbeziehung des Anderen. Frankfurt a. M. 1996; A. Honneth: Kampf um Anerkennung. Frankfurt a. M. 1994 und vieles andere mehr von diesem Autor; R. Jaeggi: Entfremdung. Frankfurt a. M., New York 2005; Ch. Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Frankfurt a. M. 2009; Th. Bedorf: Verkennende Anerkennung. Frankfurt a. M. 2010; wenn Hegel für diese Theorien in Anspruch genommen wird, gehen viele zurück auf die in dieser Hinsicht problematische Hegel-Interpretation von M. Theunissen: Der Andere. 2. Aufl. Berlin, New York 1977. Inzwischen ist das Thema sogar aufgenommen worden in die Reihe „Grundthemen der Philosophie“: H. Ikäheimo: Anerkennung. Berlin, New York 2014. 466 Intersubjektivitätstheorien sind noch keine Philosophien des Sozialen, und es lassen sich über sie auch keine aufbauen – weil sie die fundamentale Rolle des Dritten nicht kennen. Erst auf der Grundlage der Figur des Dritten läßt sich Soziales als Soziales begreiflich machen. 467 M. Blanchot: L’entretien infini, p. 128. 468 M. Heidegger: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), p. 81. im Denken zwar kein System, aber ist doch von unnachgiebiger systematischer Strenge, zweitens bezieht sich die Struktur auf einen Prozeß (einen „Weg“), nicht auf einen Zustand, drittens handelt es sich dabei um eine „Fügung des Seyns“, d.h. nicht um irgendwelche Faktizitäten, Dinge oder dgl., sondern handelt von demjenigen, was die Sprache und die Dinge sprechen läßt. Zwar ist jede Fuge, jede Fügung zur Fuge, einzig, folgt jedoch dabei derselben Struktur des Ineinandergreifens der Verfugten in Nähe und Distanz der Fuge. Die für Heidegger entscheidende Frage aber ist: Ist die Fuge tatsächlich der Ort im Seienden, an dem es dem Seyn einen Platz einräumt? Oder anders und auf unsere Frage nach der Verführung gewendet: Ist diese mehr oder anderes als die Freisetzung trivialer Handlungen z.B. der Sexualität?– Aber zurück zur Ernsthaftigkeit von Heideggers Denken! Im „Vorblick“ muß er einräumen, daß die Ereignisphilosophie „noch nicht die freie Fuge der Wahrheit des Seyns aus diesem selbst“ bereitstellen kann, jedoch ist bereits der entscheidende Perspektivenwechsel getätigt: „hier ist das Sagen nicht im Gegenüber zu dem zu Sagenden, sondern ist dieses selbst als die Wesung des Seyns.“469 Insofern ist Fuge nicht statisch zu verstehen, sondern sie ist die Struktur des Prozesses, d.h. des „Übergangs“ im Zwischen. In diesem Zwischen gibt es für den Übergang keine Übergangsregeln, sondern in der Fuge im Zwischen ereignet sich ein Abgrund.470 2.6.3.4 Subjekt/Objekt-Polarität, geändert Wenn Verführung im Sinne dieser abgründigen Fuge verstanden werden muß, dann liegt in der Struktur der Verführung eine Kehre der klassischen Handlungstheorie beschlossen, d.h. der Einwirkung eines Subjekts auf ein Objekt. Dieses hat Jean-Paul Sartre thematisiert. Er begreift Liebe als einen existentiellen Entwurf, der zum Ziel habe, daß der Liebende Grund seiner selbst werden kann. In dem oft nicht unwahrscheinlichen Fall, daß der Geliebte seinerseits nicht lieben möchte oder kann, tritt nach Sartre die Verführung auf den Plan. „… und seine Liebe unterscheidet sich nicht von diesem Verführungsunternehmen.“471 Solches unterscheidet sich zwar fundamental von unserer Interpretation von Verführung, fällt jedoch nicht zurück auf die Alltagspsychologie mit ihrem Verständnis von Verführung als Handlungsstrategie. Denn Verführen bedeutet für Sartre im Rahmen des Entwurfs der Liebenden, sich selbst insofern für den Anderen als Objekt zu exponieren, als es sich dem Blick des anderen aussetzt. 469 l. c., p. 4. 470 Zum Übergang s. K. Röttgers: Metabasis. Philosophie der Übergänge. Magdeburg 2002; zum Abgrund bes. bei Heidegger s. ders.: Gründe und Abgründe.- In: Abgründe, hrsg. v. P. Gehring, K. Röttgers u. M. Schmitz-Emans. Essen 2016, p. 19-26. 471 J.-P. Sartre: Das Sein und das Nichts, p. 650. „Die Verführung zielt darauf ab, beim Andern das Bewußtsein seiner Nichtsheit [néantité] angesichts des verführenden Objekts zu veranlassen. Durch die Verführung will ich mich als eine Seinsfülle konstituieren und als soche anerkennen lassen. Dazu konstituiere ich mich als bedeutendes Objekt.“472 2.6.3.5 Identitätsauthentifizierung Diesen Aspekt nimmt – verandert! – Jean Baudrillard auf, wenn er sagt, daß das Subjekt vom Objekt verführt wird, es wird zur „Beute des Scheins“.473 Aber genau das ist für Baudrillard eine Perversion der Struktur der Verführung, daß nun die „Strategie des Scheins“ alles beherrsche. Sie führt dazu, daß das Soziale heutzutage „das kollektive Teilhaben an der Verführung“, nämlich durch den Schein werde.474 Nicht die Verführung als solche lehnt Baudrillard ab, sondern nur die Verführung durch den Schein. Das wird besonders deutlich dort, wo er sich gegen den Identitätszwang wendet: „… wir sind gezwungen, wir selber zu sein … Im Gegensatz zur Verführung … Erpressung zu Identität.“475 Das ist die Obszönität, die erbarmungslose Enthüllung. In diesem Sinne ist Verführung ein Kulturelement, das den labyrinthischen Umweg pflegt statt der obszönen Illusion des direkten Zugangs. Roland Barthes sagt daher, daß die Verführung im Labyrinth omnipräsent ist.476 Es komme nicht darauf an, den kürzesten Weg zum Minotaurus zu finden, um ihn zu töten, sondern seine Verführung auf allen Wegen zu genießen, was aber wiederum nichts anderes heißt, als das Zwischen, das Labyrinth als Medium der Verführung zu genießen. Baudrillard hingegen bringt diese Opposition auch auf die Unterscheidung der Begriffe von Ereignis und Spektakel. Das ließe sich an der Wirksamkeit von Sprache aufweisen.477 Sprache funktioniert als seduktive Verkettung. Sie unterliegt nicht dem Tauschprinzip des Tauschs von Virtualitäten (Geld gegen Aktien oder Optionen), sondern im Gebrauch der Zeichen fungiert Sprache als ein Erscheinen-Lassen. Das ErscheinenLassen, die Gelegenheit des Auftauchens, ist etwas ganz anderes als die Schamlosigkeit der Enthüllungen zur Nacktheit. Der pure Sex ist obszön, wie Kant sagte, der 472 l. c., p. 651, Klammerzusatz in dieser Form in der deutschen Übersetzung v. H. Schöneberg u. T. König. 473 J. Baudrillard: Die fatalen Startegien, p. 99. 474 l. c., p. 92. 475 l. c., p. 47. 476 R. Barthes: Les mots du labyrinthe.- In: Cartes et figures de la terre. Paris 1980, p. 94-103, hier p. 96. 477 Cf. A. Hetzel: Die Wirksamkeit der Rede. Bielefeld 2011. wechselseitige Gebrauch der Geschlechtseigenschaften, entweder als Natur des Fortpflanzungsverhaltens unter Menschen oder die pornographische Simulation solcher Naturvorgänge, Verführung dagegen ist als asymmetrische Performanz im Medialen ein Kulturmoment. Die Natur produziert, d.h. bringt hervor, Kultur verführt zu Umwegen, ist daher in diesem direkten Verständnisse un-produktiv. Soweit der Mensch produziert und produzieren will, ist er noch kein Kulturwesen. Als Kulturwesen dagegen ist er ein Wesen, das sich den Verführungen überläßt, ist – so Iso Camartin – offen für (neue!) Erfahrungen.478 In seinem Buch „De la séduction“479 schildert Baudrillard, wie in der Entwicklung der Zivilisation in der Gegenwart alles Verführerische durch reine Sexualität ersetzt wird. Das Sexuelle ist nichts als das durch ein es praktizierendes Subjekt naturalistische Unternehmen der Triebabwicklung: Du hast als natürliche Ausstattung Geschlechtsorgane und eine Triebstruktur, also gebrauche sie. Es ist reine Körperlichkeit, die Seele (also der innere Andere) und die Sinndimension des kommunikativen Textes spielen dabei keine oder doch wenigstens nur eine untergeordnete Rolle. Sexualität läuft nach dem Modell produktiven Handelns ab, herstellend-produktives Handeln und sexuelles Handeln folgen der gleichen Struktur. Dennoch vergißt sich die erotische Kultur der Verführung nicht gänzlich, sondern nistet sich in das Begehren ein, weil das Begehren anders geartet ist als der Sexualtrieb. Aber die Verführung als Sinn-Form fügt sich dem Begehren nur ein und hat keine eigene Valenz. Insofern kann man analog zum Konstrukt des homo oeconomicus einen homo sexualis konstruieren, der durch eine vergleichbare Rationalität der Zielerreichung durch Mitteleinsatz gekennzeichnet wäre. Baudrillard untersucht noch etwas genauer die Vorherrschaft des Sex und den Verbleib der Verführung, d.h. der Naturalität gegenüber der Kulturalität, und stellt fest, daß die Verführung auch im rein Sexuellen erhalten bleibt, insofern dieses der Begehrensstruktur und nicht der Rationalität des reinen Triebs folgt und also fortexistiert, nur daß sie verborgen ist. Das rein Sexuell-Naturale wäre sprachlos. Es gibt keinen Diskurs, d.h. keine Sinnformation des pur Sexuellen. Es bewegte sich wie Gewalt oder Mystik außerhalb des kommunikativen Textes und ihn abgründig abbrechend. Dieser Befund macht eine Neuinterpretation von Pornographie erforderlich. Evidentermaßen ist Pornographie keine Gestalt des Diskurses der Verführung. Aber in allen pornographischen Enthüllungen bis hin zur reinen Nacktheit der Geschlechtsorgane lebt so etwa wie ein verführerisches Moment fort. Nicht das Enthüllte, wohl aber der Prozeß des Enthüllens läßt etwas Verführeri- 478 I. Camartin: Lob der Verführung. Zürich, München 1987, p. 12. 479 J. Baudrillard: De la séduction. Paris 1980. sches überleben, wie man etwa am Unterschied von Sich-Ausziehen und dem raffinerten Striptease bemerken kann. Das Entscheidende ist vermutlich, ob ein Rest von Geheimnis bleibt.480 2.6.4 Verführung als Verschränkung Aus all dem oben Ausgeführten dürfte sich ergeben haben, daß es sich bei der Struktur der Verführung um eine Verschränkungsstruktur handelt. Schon die Zurückweisung des rein strategischen Verständnisses, aber mehr noch die Absetzung von allen handlungstheoretischen, allen triebtheoretischen und allen produktivistischen Interpretationen legte das nahe. Schaut man aber jetzt noch etwas näher zu, bemerkt man, daß es eine fundamentale Komplementarität von Verführung und Verführtwerden in der Verführung gibt. Zuerst kann man das am Blick verdeutlichen. Der Blick ist die Relation von Erblicken und Erblicktwerden. Aber anders als in den Beziehungen zu den beobachtbaren Dingen weiß der Erblickte um sein Erblicktwerden und inszeniert es. In der Inszenierung steckt ebenfalls ein Moment der Verführung: so korrespondieren verführerischer Blick und verführerisches Erblicktwerden. Der zu Verführende muß also sein Gesehen-Werden sehen. Aber auch das Sehen des Gesehenwerdens muß vom Verführer gesehen werden. So ist immer der Verführer auch der Verführte und umgekehrt. Anders als das rein strategische Verständnis, das auf die Macht des Verführerischen der Person des Verführers allein glaubt bauen zu können, ist die genannte Komplementarität der Verführung ein mediales Geschehen., d.h. es ereignet sich im Zwischen und ist dort immer bidirektional. In den Verschränkungen sichtbarer Leiblichkeit erzeugt sich das Ereignis der Verführung. Diese mediale Verschränkung läßt mehr erblicken als zu sehen ist. Im Unterschied zum Spiegel, der nur zu sehen gibt, was zu sehen ist, der also nicht sehen kann, daß sein „Sehen“ zu sehen ist, bildet der leibhaftige Blick dasjenige aus, wodurch die komplementäre Leibhaftigkeit ein Geheimnis erzeugt. Erblickte Leiblichkeit ist Sichtbarkeit und Geheimnis zugleich, darin liegt das Verführerische beschlossen. 480 Auch bei den Philosophen der absoluten Transparenz bleibt entweder gewollt oder ungewollt ein Residuum des Geheimnisses, bei Hegel gewollt, bei de Sade auf paradoxe Weise ungewollt und bei Rousseau schließlich illusionär verleugnend. Mehr dazu K. Röttgers: Hegels Geheimnis.- In: Schweigen und Geheimnis, hrsg. v. K. Röttgers u. M. SchmitzEmans. Essen 2002, p. 17-46; ders.: Um Kopf und Kragen. Das Schreiben der Verausgabung bei Bataille und de Sade. –In: http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/philosophie/textdokumente/sade_bataille.pdf; ders.: Der „echte“ Rousseau.- In: ders. Kopflos im Labyrinth. Essen 2013, p. 145-159. Verführerisch ist ferner, daß es im Medialen des Verführungsprozesses eine Ambivalenz von Nähe und Distanz gibt. Die Differenz (im Sinne des différer der différance) ist in die Verführung eingebaut. Verführung ist damit verzögerte Annäherung. Erotische Verführung ist Verzögerung und Umweg, d.h. Kultur.481 Anders als das strategische Verständnis nahelegt, wird die Verführung durch den Dritten nicht gestört oder zerstört, sondern im Gegenteil gesteigert. Und durch den Dritten wird die Verführungsstruktur zu einer sozialen und nicht bloß intersubjektiven Struktur. Wenn Verführung als Verschränkung oder Verfugung eine mediale Struktur ist, erst recht wenn ein Dritter zugegen ist und die Verführung, die Verführbarkeit, das Verführtwerden-Wollen etc. als soziale Struktur steigert, verbietet sich eine Moralisierung, die doch für die strategische Sicht so naheliegend gewesen wäre. Verführung ist weder „gut“ noch „böse“. Nur ein Okkasionalismus wird der Verführung gerecht, wir sprechen daher von einem seduktiven Okkasionalismus.482 Ein neueres Verständnis von Macht läuft darauf hinaus, Macht als eine modale Struktur eines Feldes zu begreifen: als Möglichkeitsraum. In diesem Feld strukturiert Macht, was zwischen uns geschehen kann. Seduktiver Okkasionalismus dagegen läßt geschehen, was jeder Machtstruktur entzogen ist. Während Nietzsche Macht als Relation von Kraftquanten darstellen kann, würde Camartin Verführung als Relation der Schwäche, genauer der Kraftverzichtsquanten, der Nachgiebigkeiten darstellen müssen. 483 Auf die beteiligten Subjekte bezogen, müßte man daher sagen, „daß wir bei der Verführung zugleich Täter und Opfer sind…“484 Während die moralischen Kategorien der Beschreibung von Verführungsprozessen versagen, bewähren sich hingegen ästhetische Kategorien, insbesondere diejenigen des (schönen) Scheins und der Simulation. Der Verführer gibt sich den Anschein, erscheint im Lichte davon, ein Verführter zu sein. Der Schein des Sichverführenlassens wiederum hat etwas ungemein Verführerisches. Da der seduktive Okkasionalismus Schein und Simulationen hervorbringt, versagt an ihm auch der aufklärerische Impetus der Entlarvung des Scheins, es sei denn ihm gelingt die gänzliche Zerstörung der Verführungsstruktur des Medialen. Aufklärerische Entlarvung bis zur Nacktheit der Triebstruktur der menschlichen Lebewesen ist pornographisch. Wir dagegen halten es mit Rumpelstilzchen: Wie gut, daß niemand weiß… 481 In seiner Thematisierung der Bodenlosigkeit von Kunst spricht Jean-Luc Nancy von der „aufgeschobenen Unmittelbarkeit“. J.-L. Nancy: Am Grund der Bilder. 2. Aufl. Zürich, Berlin 2006, p. 50l. 482 So bereits K. Röttgers: Kategorien der Sozialphilosophie. Magdeburg 2002, p. 460. 483 I. Camartin: Lob der Verführung, p. 10ff. 484 l. c., p. 17. Auch wenn es, wie gesagt, Gegensätze von Macht und Verführung gibt, haben doch beide Anteil an der Asymmetrie, die dem kommunikativen Text generell zukommt. Wie aber durch den Wechsel der Besetzung der Funktionspositionen im kommunikativen Text die Asymmetrie nicht positional besiegt ist, so gilt das für die Verführungsstruktur ebenso: in beiden Fällen gibt es letztlich eine Reziprozität von Asymmetrien. Wenn man sich Verführung als mit dem über jegliche Triebbefriedigung hinausgreifenden Begehren verbunden denkt, dann sind Verführungsprozesse wie der kommunikative Text generell ergebnisoffene Prozesse. Es mag sein, daß ein konkreter Prozeß im stummen Sexualakt sein Ende findet genauso wie auch die Fortsetzbarkeit und Anschließbarkeit des kommunikativen Textes stets ungewiß ist. Generell aber sind kommunikative Texte und Verführungen als eine Instanz derselben auf Fortsetzbarkeit angelegt. Es könnte z.B. sein, so in Kierkegaards „Tagebuch des Verführers“, daß der Verführer der Verführten qua Verführung „eine Seele macht“, die etwa die Gestalt des Verführtwerden-Wollens hat. Sie diesem Wollen als ein Objekt möglicher Verführungen darzubieten, wäre dann eine mögliche Anschlußstelle im Prozeß. Im „Tagebuch des Verführers“ geht es primär um Johannes, den Verführer, und Cordelia, die Verführte. Aber diese Simplizität führt über die Erkenntnis des Sichselbst-Verführens seitens Johannes und dem Verführen des Verführers seitens Cordelias und über die Reflexion beider als Textgestalten, also als Verführter-im-Text und Verführte-im-Text bis hin zur Verführung des Lesers durch den Text des Tagebuchs. Nur ein Leser, der sich auf dieses Spiel einläßt, d.h. bereit ist, sich durch den Text verführen zulassen, wird dem Text gerecht werden können. Nur wenn der Leser zur Selbstfiktionalisierung zum Leser-im-Text wird, er in einen Verführungsprozeß mit dem fiktiven Autor-im-Text und den fiktiven Gestalten im Text sich verstricken läßt, wird er verstanden haben können. Also der eigentliche Verführer ist dann nicht eine Figur namens Johannes, sondern der eigentliche Verführer ist der Text. Der Verführungsprozeß beginnt also bereits mit den ersten gelesenen Zeilen. Und es gibt nicht erst einen Verführer, einen Verführungstäter, der dann ein Verführungsobjekt verführte, sei es nun Cordelia oder der Leser. Die These, daß der Textprozeß der eigentliche Verführer ist, wird gestaltet und in der Gestaltung um eine weitere Stufe gesteigert duch die Verfilmung „Le journal du séducteur“ von Danièle Dubroux. 2.6.5 Verführung als Sichtbarkeit des Abgrunds 2.6.5.1 Die These Die These dieses Abschnitts lautet: Inmitten des kommunikativen Textes der Verführung eröffnet sich der Blick in den Abgrund. Wir müssen aber (mit Heidegger) davon Abstand nehmen, den Abgrund nur als Gefahr zu sehen. Im Abgrund wird vielmehr etwas sichtbar, was in der Oberflächlichkeit vergessen ist und verborgen bleibt. Gleichwohl macht es für eine Immanenzphilosophie keinen Sinn, Abgrund und Oberfläche gegeneinander auszuspielen. Gemäß der These, daß alles Oberfläche ist, an der Oberfläche liegt oder nichts als Oberfläche hat,485 ist auch im Abgrund der Verführung nur eine andere Oberfläche sichtbar, keineswegs aber die alles fundierende Tiefenstruktur der Realität. Nur, diese andere Oberfläche bricht die Oberflächlichkeit des fortlaufenden Geredes der Leute in einer Weise, über die nicht so einfach hinweggegangen werden kann. Es steht keine Brücke über den Abgrund zur Verfügung. Vielleicht müssen wir eine bauen, aber das geht nur von dieser Seite aus, auf der wir stehen und eine Bahnung suchen. Aber wieso bricht der Abgrund die Oberfläche? Und: was wird im Abgrund sichtbar? Es ist nicht ein bestimmtes Etwas, das im Abgrund hockt und den Spalt im kommunikativen Text der Verführung offen hält, ein Diabol oder ein Teufelchen. Es ist die Ereignis-Struktur als solche, die die Kontinuitäten bricht und abgründig wirkt. Daher kann in der Sichtbarkeit des Abgrundes durchaus sehr Verschiedenes auftauchen. 2.6.5.2 Obszönität Der erste und krasseste Fall wird von Baudrillard diskutiert. In seiner Sicht bricht das Obszöne den Text. Das aber heißt: Im Abgrund der Realität wird mehr sichtbar als in der kulturellen Praxis sichtbar sein sollte. Obszönität ist ein Maximum von Sichtbarkeit. Sie ist ein Zerbrechen (ein Erbrechen?) des kulturellen Prozesses der Verführung in Richtung reiner Naturalität. Und was die Sichtbarkeit betrifft: „…die sichtbaren Dinge enden nicht im Dunkel oder im Schweigen, sondern sie verflüchtigen sich in dem, was sichtbarer als das Sichtbare ist: in der Obszönität.“486 Im Spalt, der ein Abgrund ist, bricht in den Verführungsprozessen das Mehr-sehen-Lassen ein und gibt dort im Abgrund das Pornographische frei. Baudrillards Gegenbild ist das Geheimnis. „unsichtbarer als das Unsichtbare“.487 Aber sehen wir klarer: auch das Geheimnis ist ein Abgrund der Verführung, was heißt: Es geht nicht um ein den Abgrund ursächlich produzierendes Etwas, das positiv (als Geheimnis) oder negativ (als Obszönes) bewertet werden könnte. 2.6.5.3 Sichtbarkeit des Unsichtbaren Wir reden also nicht über Sichtbares oder Unsichtbares, sondern über Sichtbarkeit und ob und wie die Struktur der Sichtbarkeit Sichtbares und Unsichtbares hervorruft. 485 K. Röttgers: Die Oberfläche der Seele.- In: ders.: Sozialphilosophie: Macht – Seele – Fremdheit. Essen 1997, p. 152-174. 486 J. Baudrillard: Die fatalen Strategien. München, p. 12. 487 l. c., p. 66. Der Blick in den Abgrund macht etwas sichtbar, was wir nicht wissen oder aufgrund von Wissen antizipieren können. Seit der Neuzeit ist Theorie, dem griechischen Wortursprung widersprechend, nicht mehr auf Sehen bezogen. Die Theorie unterrichtet nun über unsichtbare „Dinge“ und Sachverhalte; denn wer hätte je ein Neutron, ein Gen oder die transzendentale Apperzeption gesehen? Gleichwohl sprechen wir im Vertrauen auf den Augenschein vom Sonnen-Aufgang, weil wir tatsächlich sehen, wie die Sonne am östlichen Horizont aufgeht. Manfred Sommer meint sogar, daß es unerträglich wäre, wenn wir sähen, was wir wissen: „Dem Himmel sei Dank, daß er uns tagtäglich wieder als das erscheint, was er nicht ist: als ein Gewölbe.“ 488 Für ihn wäre es unerträglich, „überall nur Abgrund“ zu sehen. Das „überall“ mag man unterschreiben; aber gewollte Abgrund-Blindheit ist auch eine selbstverschuldete Abschneidung von Erfahrungsmöglichkeiten, erst recht von Verführungen. Der Unterschied liegt vermutlich in einer Prozessualität, die Abgründe liebt, und einer epistemischen Seßhaftigkeit, die den Abgrund zwar überhaupt nicht kennt, aber zutiefst fürchtet. Der Seßhafte liebt die sichtbaren Dinge, die ihn bleibend umgeben. Er weiß zwar, daß es Unsichtbares „gibt“ (jeglichem muß dieses „il y a“ zukommen), aber er findet Ruhe in dem Gedanken, das Unsichtbare sei lediglich wegen seiner absoluten Transparenz unsichtbar. Genau auf diesem Glauben baut eine Strategie des Verschwindens auf. Dann mag wohl einer anstreben, durch absolute Transparenz für andere unsichtbar und dadurch un(an)greifbar zu werden. Er macht nicht nur sich unsichtbar, sondern auch, daß das Sichentziehen in die Unsichtbarkeit und Transparenz zugleich der Versuch einer Machtstrategie ist: Montezuma war besiegt, als er sichtbar wurde. Im Märchen verleiht die Tarnkappe mit der Unsichtbarkeit zugleich unermeßliche Kräfte, und die Obsessionen eines Jean-Jacques Rousseau folgen dem gleichen Modell: alle ausnutzen zu können, aber von keinem ausgenutzt zu werden, weil man sich ja der Sichtbarkeit entzieht. Aber was für die „Dinge“ und Sachverhalte seine Berechtigung hat, versagt beim Menschen: wir „sehen“ Jean-Jacques in seinen Bekenntnissen und den „Rêveries“, zwar seelisch nackt, aber gerade deswegen peinlich sichtbar. Wer seine Unsichtbarkeit inszeniert, ist in seiner Echtheitsemphase nur ein jämmerlich schlechter Schauspieler.489 488 M. Sommer: Suchen und Finden. Frankfurt a. M. 2002, p. 70. 489 Zum Paradox der Transparenz bei Rousseau s. J. Starobinski: La transparence et l’obstaacle. Paris 1971; K. Röttgers: Kopflos im Labyrinth. Essen 2013, Kap. 6: Immanenz ohne Demaskierung, p. 119-159, sowie ders.: „Ich bin eine Illusion“. Die Bühne als Modell postmoderner Sozialphilosophie.- In: Zs. f. Kulturphilosophie 2013/1, p. 147-170; bei Rousseau s. die 6. „Promenade“ seiner „Les Rêveries du promeneur solitaire, ed. H. Rod- Nach Ralf Konersmann geht es in Magrittes Bildern um die Sichtbarkeit des (bildnerischen) Denkens, wenn ein Bild – wie oft bei Magritte – sich selbst zum Thema hat.490 Noch spannender freilich sind solche Bilder, die durch eine Lücke, ein Fehlen o.ä. im Bild einen Abgrund eröffnen, wie z.B. das Unsichtbarmachen der Füße der Engel durch Frottage bei Giotto. Gleiches gilt für Texte. Texte enthalten Lücken, in denen der Leser(-im-Text) das anknüpfende Weiterdenken beginnen kann, wo also der Abgrund einen Umweg sichtbar macht. Odo Marquard hat das als die eigentliche Aufgabe der Hermeneutik bezeichnet, „…aus einem Text herauszukriegen, was nicht drinsteht: wozu – wenn man doch den Text hat – brauchte man sie sonst?“491 Ganz ähnlich beschreibt Maurice Blanchot seinen Zugang zu Bataille: „… de penser auprès d’une absence, plutôt que de prétendre exposer ce que chacun devra lire dans ses livres.“492 Aber was heißt das für Blanchots eigenes Schreiben? Das Unsichtbare sichtbar machen, oder das Sichtbare unsichtbar? Vermutlich realisiert Blanchots eigenes Schreiben ein Schreiben jenseits dieser Alternative von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Es ist ein Schreiben am Rande möglicher Erfahrung, also: „expérience de la non-expérience.“493 Die Sichtbarkeit des Abgrunds heißt nicht, daß im Abgrund etwas sichtbar würde oder die Abgrundtiefe ihre Unsichtbarkeit enthüllte. Dieses Schreiben ohne ein Sehen seitens des Subjekts und ohne ein sichtbares/unsichtbares Objekt nennt Blanchot die Beziehung zum Neutralen („le Neutre“). 494 Alexander García Düttmann weist in seiner Arbeit über Derrida u.d.T. „Rien à voir“ auf die Paradoxie hin, daß Sichtbarkeit auf einen Hintergrund des Unsichtbaren zwingend angewiesen ist.495 Selbst ein Schreiben, wenn es „sichtbar“ macht, daß es nichts zu sehen gibt, ist in diese Paradoxie eingefangen. Dafür ein anderes Beispiel: Den Frauen, die das Grab Christi besuchen wollen, verkündet der Engel: Hier gibt es nichts zu sehen; der, den ihr sucht, ist nicht hier, sondern anderswo. Für die Malerei, dier. Paris 1960, hier p. 77ff; dazu H. Meier: „Les rêveries zu Promeneur solitaire: München 2005; ders.: Über das Glück des philosophischen Lebens. München 2011; cf. auch V. Ladenthin: Jean-Jacques Rousseau. Die Geschichte von Letzten Buch. Würzburg 2012. 490 R. Konersmann: Das wahre Stilleben oder die Wirklichkeit der Malerei. Sprachbilder und Bildersprache bei René Magritte.- in: Zs. f. Ästhetik u. Allgemeine Kunstwissenschaft 34/2 (1989), p. 196-212. 491 O. Marquard: Frage nach der Frage, auf die die Hermeneutik die Antwort ist.- In: ders.: Abschied vom Prinzipiellen. Stuttgart 1981, p. 117-146, hier p. 117. 492 M. Blanchot: L’entretien infini, p. 300. 493 l. c., p. 311. 494 l. c., p. 384. 495 A. García Düttmann: Rien à voir. Radicalité d’une déconstruction.- In: La part de l‘œil 7 (1991), p. 135-141. die doch von der Sichtbarkeit lebt, ist das ein Problem. Wie kann gemalt werden, was nicht da ist, was fehlt? Allerdings umgeht der prozessuale Perspektivismus der Fresken dieses Problem; dieser kann zeigen, daß der Gekreuzigte zwar jetzt nicht hier ist, aber der Auferstandene sehr wohl anderswo tatsächlich ist. Der Text (hier der Bibel) – gewissermaßen Supplement der Sichtbarkeit – macht auf seine Weise „sichtbar“, „…que rien n’est à voir.“496 So ist zwar darstellende Kunst die Sichtbarmachung des Sichtbaren und in eins damit des Unsichtbaren; aber anders der Text, der sich auf Kunst bezieht, er thematisiert Sichtbarkeit; und Sichtbarkeit kann man – nach einem Wort von Derrida selbst497 – nicht sehen. Im Text wird nicht irgendein Unsichtbares sichtbar, sondern die selbst unsichtbare Sichtbarkeit, das Sehen soll „sichtbar“ gemacht werden.498 Insofern ist die Sichtbarmachung im Text keine Abdankung, sondern diejenigen, die im Text etwas Bestimmtes „sehen“ wollen, sind fehlgeleitet. Wie Blanchot programmatisch erklärt hat: „Parler, ce n’est pas voir“: „Parler libère la pensée de cette exigence optique qui, dans la tradition occidentale, soumet depuis des millénaires notre approche des choses et nous invite à penser sous la garantie de la lumière ou sous la menace de l’absence de lumière.“499 Das Schreiben, der Text, vollzieht einen Einschnitt in die totalisierende Kontinuität des Sichtbaren. Sehen heißt sehen, was es zu sehen gibt; der Text aber überschreitet diese Beschränkung: seine Enthüllungen erzeugen Geheimnisse. Das hat zur Folge, daß Verführung niemals in der Sphäre des Sichtbaren allein bleiben kann – denn dort ist letztlich nur das Obszöne zu Hause. Verführung führt in das Ungefähre eines „Blickens“ in den Abgrund, der nur im Text möglich ist: eines Verschweigens der Unmittelbarkeit. 2.6.5.4 Sichtbarkeit im Text Im kommunikativen Text gibt es die Funktionspositionen von Selbst und Anderem. Beide Positionen werden wechselnd von diversen Subjekten bekleidet. Das hat zur Folge, daß ein spezifisches Subjekt keine bleibende Option auf eine bestimmte Position hat und entsprechend eine solche Präsentation nicht inszenieren kann. Präsentation wäre Sichtbarkeit, aber Subjekte sind (normalerweise!) unsichtbar. Nur als Bil- 496 l. c., p. 138. 497 J. Derrida: Marx‘ Gespenster, p. 162; cf. auch K. Fiedler: Theorie der Sichtbarkeit.- In: Kritik des Sehens, hrsg. v. R. Konersmann. Leipzig 1997, p. 202-219. 498 J.-L. Nancy: Am Grund der Bilder, p. 156. 499 M. Blanchot: Entretien infini, p. 35-45, hier p. 38. der vergangener Subjektivität können sie im Text, d.h. im Inhalt des Textes vorkommen, nicht jedoch als ihn performierend. Folglich sind es nicht die klassischen Subjekte in ihrer Zentrierung des Wissens von der Welt und des Handelns in der Welt, die am Abgrund stünden, vielleicht furchtsam hineinblickten und nichts sähen. Nicht verführte oder verführende Subjekte sehen nichts im Abgrund ihrer gegenseitigen Auslieferung, sondern die Verführung selbst ist die Sichtbarkeit des Abgrunds. 500 2.6.5.5 Sichtbarkeit des Nichts Das Nichts ist, in phänomenologischer Perspektive, unsichtbar. Die Tiefe seines Abgrunds, konkret etwa die Erdtiefe, aus der Sichtbares (Wasser aus der Quelle, Lava aus dem Vulkan) in die Sichtbarkeit der Oberfläche dringt, ist als solche der Sichtbarkeit entzogen. Ute Guzzoni faßt zusammen: „An ihr [der Quelle] zeigt sich augenscheinlich eine Ankunft der Seienden aus dem Nichts.“ 501 Wie das möglich ist, ist zwar ein Rätsel, aber Rätsel (Enigmata) sind nicht als erstes Lösungsaufgaben, sondern zuallererst kommt es darauf an, das Rätsel in seiner Rätselhaftigkeit zu sehen und anzuerkennen.502 Zu sehen ist die Rätselhaftigkeit, wie die Sichtbarkeit des Unsichtbaren möglich sei, allein im Sichtbaren durch das Sichtbare hindurch. Dadurch stellt sich die Sichtbarkeit der Immanenz des Abgrunds inmitten von Positivität und Kontinuität dar als eine Höhlung. 2.6.5.6 Nichts im Abgrund Die Höhlung in der Kontinuität steht entgegen einer unstillbaren Sehnsucht nach Kontinuität des Seienden und gefährdet sie. Die Topologie des Abgrunds ist jenes Loch, in dem Heidegger das Seyn ansiedelt. Insofern darf man getrost sagen: Die Verführung ist der Ort, an dem Seyn als Ereignis stattfindet, besser gesagt: eine Unstatt findet. 500 Es gibt eine gewisse Analogie zu Nietzsches Ablehung des Begriffs der Selbsterhaltung. Schon 1885 hatte es bei ihm geheißen, daß nicht Wesen sich selbst erhalten, erhalten wollen, „sondern der Kampf selber erhalten will, wachsen will und sich bewußt sein will. … nicht ein Subjekt, sondern ein Kampf sich erhalten will.“ F. Nietzsche: Kritische Studienausg. XII, p. 40. 501 U. Guzzoni: Wasser, p. 87. 502 Cf. M. Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerks.- In: ders.: Holzwege (Gesamtausg. V). Frankfurt a. M. 1977, p. 67: „Der Anspruch liegt fern, das Rätsel [„das die Kunst selbst ist“] zu lösen. Zur Aufgabe steht, das Rätsel zu sehen.“ Ders.: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). (Gesamtausg. XCIV) Frankfurt a. M. 2014, p. 36: „Jede Frage eine Lust – jede Antwort ein Verlust.“ 2.6.5.7 Der gründende Abgrund Und damit kommen wir zur seinsgeschichtlichen Kehre der Ereignisphilosophie. Heideggers Philosophie kennt und liebt den Abgrund. Der Abgrund ist dem Ereignis verbunden, ja inmitten des Seienden eröffnet sich die „Zerklüftung“: „der Sprung in das Seyn als Ereignis“. Kein horror vacui leitet Heideggers Denken, im Gegenteil: zum Seyn gelangt man nicht durch eine hartnäckige oder tüftelnde Analyse von Seiendem oder durch eine Herauspräparierung des Seins als Seiendheit des Seienden. Nur im furchtlosen Sprung in den Abgrund gelingt die „völlige Ablösung“.503 Das grenzt Heidegger deutlich ab von der Suche nach dem „Wesen des Seienden im Ganzen und seinen Schluchten und ‚Gründen‘“.504 Seit seinem Kant-Buch verfolgt Heidegger die Idee der Grundlegung, einer Gründung der Gründe und findet sie im Abgrund: „Der Grund gründet als Ab-grund…“505 Und dessen Topologie beschreibt das Paradox „das Offene des Sichverbergens“ – ein solcher gründender Abgrund ist eben deswegen keine Leere. Wohl ist es ein „Zwischen“, zugleich aber der Blick in den „ab-gründigen Grund“.506 An anderer Stelle507 benennt er jenes „Zwischen“ auch als „Inzwischen“, den temporalen Aspekt jener Medialität des Zwischen hervorkehrend, oder auch „das abgründige Inmitten des Zwischen“. 508 Für Heidegger, insbesondere auch wegen des Temporalen von Medialität („Zwischen“, „Inzwischen“, „Inmitten“) und wegen des gründenden Aspekts ist Abgrund nicht unbedingt „unten“, sondern ebenso sehr auch „oben“. Das Brechende („Zerklüftung“) durch das Ereignis ist das Entscheidende. Radikaler als alle anderen Denker des Abgrunds betont Heidegger das Ereignis, durch das es nicht bei einem Blick in den Abgrund bleibt, sondern das Dasein, das sich im Ereignis dem Seyn ausliefert, wagt den „Sprung“ in den Abgrund. Durch das Wagnis des Sprungs wird zwar die glatte Rationalität gebrochen, aber das ist keine Auslieferung an das sogenannte Irrationale; denn dieses wäre nur eine Ausnahme und in ihrem Ausnahmecharakter eben doch immer bezogen auf die „beruhigende Macht“ gegenüber der „ungezähmten Wildheit 503 M. Heidegger: Beiträge zur Philosophie, p. 278. 504 M. Heidegger: Überlegungen II-VI, p. 30. 505 M. Heidegger: Beiträge zur Philosophie, p. 29. 506 l. c., p. 286. 507 M. Heidegger: Das Ereignis (Gesamtausg. LXXI), p. 85. XXX 508 M. Heidegger: Beiträge zur Philosophie, p. 23; in „Zum Wesen der Sprache“.- In: Gesamtausg. LXXIV), p. 29 klärt er den „nüchternen ‚Sinn‘“ des Begriffs „Abgrund“: „Der Abgrund aber ist: daß sich das Er-eignis doch in der Er-eignung verweigert und sich weghebt in das Seine, das wir doch je nur selten im Er-eignis wissen. An das Wort ‚Ab-grund‘ klammere sich daher nie die Meinung, hier sei ‚Tiefsinn‘ gewollt und ‚Tragik‘ gespielt und auf ‚Rührung‘ gerechnet.“ der Dinge“, und zwar durch die Worte, bzw. Wörter, die sich an gebotener Stelle in den fragilen kommunikativen Text einfügen.509 In seiner Interpretation von Luthers „Sendbrief vom Dolmetschen“ spricht Thomas Schestag davon, wie bei Luther dort, wo die „Fuge reißt“, der tragende Untergrund beschworen wird.510 Ein solcher „Untergrund“ ist das gerade Gegenteil von Heideggers Abgrund. Selbst dort, wo Heidegger, vor allem in seinem Kant-Buch, vom gründen Abgrund spricht, ist dieser doch alles andere als ein tragender Untergrund. Vielmehr wirft Heidegger Kant gerade vor, daß er vor den Konsequenzen seines Denkens zurückwiche. Kant nannte die Wurzel der Wesensverfassung des Menschen ein Unbekanntes, in das er, so Heidegger, „hineingeblickt haben muß, wenn er von der ‚uns unbekannten Wurzel‘ sprach. Denn das Unbekannte ist ja nicht das, wovon wir schlechterdings nichts wissen, sondern was uns im Erkannten als das Beunruhigende entgegendrängt. … Kant ist vor dieser unbekannten Wurzel zurückgewichen.“511 Unter Einsatz des Terminus „Abgrund“ wird Heidegger noch deutlicher: „Kant brachte die ‚Möglichkeit‘ der Metaphysik im Radikalismus seines Fragens vor diesen Abgrund. Er sah das Unbekannte. Er mußte zurückweichen. Denn das allein war es nicht, daß ihn die transzendentale Einbildungskraft schreckte, sondern daß inzwischen die reine Vernunft als Vernunft ihn noch stärker in ihren Bann gezogen hatte.“512 Weil er auf den tragenden Untergrund nicht verzichten konnte oder mochte, ist Kant vor dem Abgrund, den sein eigenes Denken sichtbar macht, gleichwohl zurückgewichen. Im Übergang von der ersten zur der zweiten Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ wird der Schrecken des Abgrunds und seine Tilgung allzu deutlich. Heidegger sucht in Kants Werk den gründenden Grund im Abgrund seines Denkens und findet ihn in der transzendentalen Einbildungskraft. Wegen Kants Zurückweichen kann der auslegende Text nicht dem Wortlaut Kants folgen, sondern er muß das noch 509 Zur „ungezähmten Wildheit der Dinge“ s. R. Musil: Der Mann ohne Eigenschaften 12. Aufl. Reinbek 2002, p. 1088. 510 Th. Schestag: Sem.- In: Übersetzung und Dekonstruktion, hrsg. v. A. Hirsch. Frankfurt a. M. 1997, p. 64-115, hier p. 82. 511 M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. (Gesamtausg. III). Frankfurt a. M. 1991, p. 160. 512 l. c., p. 168. „Ungesagte durch das Gesagte“ hindurch präsentieren.513 Das heißt, „sich der verborgenen inneren Leidenschaft eines Werks anzuvertrauen…“ 514 Und Heideggers neuer hermeneutischer Zugang ist es, nicht bei Gesagten, den „Resultaten“ stehenzubleiben; das Ungesagte aber enthüllt sich einem Blick auf den Prozeß des Sagens. Nicht, was Kant gesagt hat, ist das philosophisch Entscheidende, sondern was in seinem Text geschieht. Und wenn man das tut, dann rückt unvermeidlich jenes Zurückweichen in den Fokus, ja mehr noch, „daß Kant bei seiner Grundlegung sich selbst den Boden weggräbt, auf den er anfangs seine Kritik stellte.“ 515 Er durchlöchert gewissermaßen den „tragenden Untergrund“. Das Achten auf das textuelle Geschehen, also auf den Text des Philosophierens als Prozeß, zeigt „jene Bewegung des Philosophierens, die das Einbrechen des Bodens und damit den Abgrund der Metaphysik offenbart.“516 Mit unserer Thematisierung der Verführung als eines Prozesses, der die Sichtbarkeit des Abgrunds hervorruft, waren wir einer Heideggers Methode vergleichbaren strukturellen Vorgabe gefolgt, die dem Prozeß des kommunikativen Textes als Spur folgt. 2.6.5.8 Über-Setzung Übersetzung scheint zunächst nichts anderes zu sein als ein Herübersetzen eines Fremden (eines fremdsprachlichen Textes) über einen Abgrund, der uns von der Fremdheit jenseits des Abgrundes trennt. Zu diesem Zweck scheint es sogar angebracht zu sein, nicht in den Abgrund zu schauen, sondern Brücken auf Gemeinsamkeiten zu bauen. Oder wenn es die vielleicht (noch) nicht gibt, den Sprung über den Abgrund zu wagen, den Blick in den Abgrund vermeidend. – Aber so kommt eine Struktur der Verführung durch den oder das Fremde nicht zustande, allenfalls Kameradschft oder Gemeinschaft als Formen der Erfahrung des Übergangs. Der Abgrund aber ist eine Untergangserfahrung in genau dem Sinne, in dem auch Heidegger von Untergang spricht, nämlich als Subversion oder so wie man auch von einer Unterführung spricht, die kein Scheitern ist, sondern nur das Verlassen der Oberflächlichkeiten des Man und des Geredes der Leute. Übersetzung in diesem oberflächentreuen ´Übergehen setzt zwar auch den Abgrund voraus, meidet ihn aber. Heidegger dagegen stellt sich der Abgründigkeit der Übersetzung.517 Insofern aber der Abgrund ein 513 l. c., p. 201. 514 l. c., p. 202. 515 l. c., p. 214. 516 l. c., p. 215. 517 Cf. L. Heidbrink: Das Eigene im Fremden: Martin Heideggers Begriff der Übersetzung.In: Übersetzung und Dekonstruktion, p. 349-372. Chaos birgt, zeigt er nichts weiter als nichts: ein Klaffen, ein Gähnen, ein Leeres. 518 Ursprünglich ist Chaos nämlich nicht die in Unordnung geratene, zuvor geordnete Welt, was uns im Hinblick auf Übersetzung der Mythos von Babel zu suggerieren scheint,519 sondern ursprünglich öffnet sich das Chaos für das Nichts. 2.6.5.9 Der Abgrund zum Anderen In der Verführung öffnet sich der Abgrund zum Anderen. Dadurch sind Selbst und Anderer im kommunikativen Text in Nähe abgründig getrennt. Angesichts dessen empfiehlt Jacques Derrida für die Freundschaft (die ja keine Verführung ist) zur Überbrückung ein Schweigen über den Abgrund.520 Im kommunikativen Text der Freundschaft gilt eben nicht, daß die Alltagssprache ihre eigene Metasprache sei. Für sie wird man wohl sagen müssen, daß der Metatext ein Schweigen ist. Das wußte bereits Novalis: „Freundschaft, Liebe, und Pietät sollten geheimnißvoll behandelt werden. Man sollte nur in seltnen, vertrauten Momenten davon reden, sich stillschweigend darüber einverstehn – Vieles ist zu zart, um gedacht, noch mehreres um besprochen zu werden.“521 Und das wußte auch bereits Nietzsche: „Man darf über seine Freunde nicht reden: sonst verredet man sich das Gefühl der Freundschaft.“ 522 Und dieser Aphorismus trägt die Überschrift „Silentium“. Derrida kommentiert: „… muss ihre [der Freunde] Rede ein stillschweigend mitvernommenes Schweigen atmen.“523 Der Metatext des Miteinander-Redens im kommunikativen Text ist in diesen Fällen das Miteinander-Schweigen. Also muß, wer den kommunikativen Text 518 M. Serres: La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Paris 1977. 519 Dazu R. Caillois: Babel. 2. Aufl. Paris 1948; Caillois bezeichnet das Unternehmen des Turmbaus als ein unsinniges Beginnen; denn entweder glaubten die Konstrukteure an Gott, dann konnten sie wissen, wie sinnlos angesichts von dessen Allmacht ihr Projekt war, oder sie glaubten nicht ihn, dann ist es noch sinnloser, weil, wenn man einen Turm bauen will, der an einen Himmel ohne Stopsignal „Gott“ heranreichen soll, man zu keinem Zeitpunkt der Durchführung weiß, wieviel noch zu tun ist. Diese Architekten sind zwar Helden der Rebellion, aber, wie man aus der Sprachverwirrung lernen kann und wie Caillois‘ ganzes Buch mit seinen diversen Kritiken nahelegt, nicht Stifter einen neuen Ordnung, sondern immer nur Chaoten, deren Folgen dann ordentliche Übersetzer zu beseitigen haben. Daß man das auch anders sehen könnte, versucht meine kleine Skizze zu zeigen: K. Röttgers: Ein Lob auf die Unordnung meines Schreibtischs.- In: Journal Phänomenologie 43 (2015), p. 27-31. 520 J. Derrida: Politik der Freundschaft. Frankfurt a. M. 2000, p. 84f. 521 Novalis: Schriften II, p. 422. 522 F. Nietzsche: Kritische Studienausgabe II, p. 489. 523 J. Derrida: Politik der Freundschaft, p. 86. thematisiert, das mitlaufende Schweigen kennen. Einerseits wäre es ein abgründiger Metatext, andererseits ist für eine Philosophie der Immanenz dieser Abgrund nichts anderes als die Lücken, die Brüche, das Klaffen und Gähnen des Chaos und die Faltungen im fortlaufenden Text. Insofern wir die Besetzungen der Positionen von Selbst und Anderem in Betracht ziehen, d.h. die diversen Subjekte (und Subjekte als Objekte), müßten wir von einem absoluten Abstand der Subjekte sprechen, zwischen ihnen, im Zwischen, ist also nicht nur ein eindeutiger oder mehrdeutiger Text, sondern zugleich immer auch der abgründige Nicht-Text. Einerseits, und das wäre die erste Stufe, gilt das, was Blanchot über die psychoanalytische Kommunikationssituation gesagt hat: „Chacun trompe l’autre et se trompe sur l’autre.“524 Das ist grundlegend so und kein Defekt, sondern wie Blanchot, Lacan zitierend, sagt: „Le sujet commence l’analyse en parlant de lui sans vous parler à vous – ou en parlant à vous sans parler de lui. Quand il pourra vous parler de lui, l’analyse sera terminé.“ 525 Im kommunikativen Text generell, speziell aber auch in der therapeutischen Situation, gilt nicht, daß zwei seelische Tiefen, Abgründe wohl gar (individuum est ineffabile, sagte man) miteinander in eine Berührung oder mystische Union gelangen könnten. Immer ist die Distanz, die Differenz oder das Mißverständnis das Selbstverständliche. Was aber befindet sich nicht inmitten von Selbst und Anderem, sondern zwischen Subjekt und Subjekt, gleich welche Position sie im kommunikativen Text innehaben? Martin Crowley, in direkter Kritik an Heidegger, nennt dieses Zwischen der Subjekte das Tier. Seine Animalität, für das Subjekt selbst ein unsichtbarer Abgrund seiner Subjektivität, zugleich aber, da auch die anderen Subjekte von ihm befallen sind, die Animalität, die uns abgründig verbindet.526 Zum ersten Aspekt zitiert Crowley Bataille: „Il y a ainsi, dans chaque homme, un animal enfermé dans une prison, comme un forçat, et il y a une porte, et si on entrouvre la porte, l’animal se rue dehors comme le forçat trouvant l’issue.”527 2.8 D AS L ABYRINTH 2.8.1 Das Verführerische des Labyrinths Im folgenden geht es um den Mythos des Labyrinths; eine solches Bedenken des Mythos kann, wenn es verstehen will, nicht dem Leitbild folgen, daß jeder Mythos durch rationale Bearbeitung in den Logos aufgelöst werden müsse. Wenn Verstehen 524 M. Blanchot: Entretien infini, p. 349. 525 Zit. l. c., p. 351. 526 M. Crowley: L’homme sans. Lamecy 2008, p. 143ff. 527 Zit. l. c., p. 144. allgemein verstanden werden kann und muß als die Möglichkeit einer sinnvollen Anschlußhandlung, insbesondere einer Textfortsetzung, dann kann die Arbeit am Mythos nur bedeuten, selbst mythisch zu reden. Die These vom Übergang vom Mythos zum Logos in frühgriechischer Zeit unterstellte ja fälschlicherweise die Irrationalität des Mythos und ihre Ersetzung durch die Rationalität des Logos. Tatsächlich ist es erst eine sich durchrationalisierende Kultur, die kompensatorisch die diversen Irrationalismen freigesetzt hat.528 Demgegenüber hat die Rehabilitation der Vollstufigkeit des Mythos auf der Komplexitätsstufe der Welt- und Handlungsorientierungen die gleiche Funktion wie sie auf der Komplexitätsstufe der Begrifflichkeiten die Metapher hat.529 Beide sind in der Lage, komplex-radikale Übergänge zu konzeptualisieren und damit ein „Fremdgehen“ der Vernunft zu ermöglichen, ohne daß sie immer wieder in sich selbst kreiste. Die Vernunft ist von zwei Abgründen umgeben, die sie nicht begreifen und doch nicht vergessen kann: den Eros und den Tod. Beide spielen verführerisch mit der Vernunft. Die Narrativität des Mythos ist es, die die Übergängigkeit vernünftige Gestalt annehmen läßt, durch die die Vernunft sich nicht verliert und an der sie dennoch auch nicht scheitert. Es können also nur mythische Vermutungen über das Labyrinth weiterführen, u.a. auch, da uns Quellen aus der minoischen Kultur fehlen, die uns befähigten, das Mißverständnis in der Kulturbegegnung von Griechen und minoischer Kultur aufzuhellen. Verstehen eines Mythos ist, wie alles Verstehen eine Textverknüpfung darstellt, nur in einer selbst mythischen Rede möglich. In dieser wird im folgenden die leitende Vermutung sein, daß die Griechen das Labyrinth nicht verstanden haben und daher glauben mußten, daß man sich im Labyrinth verirre. Nach griechischer Vorstellung aber hatte das Verderben, weswegen die, die ins Labyrinth hineingingen, nicht wieder herauskamen, eine Gestalt. Im Innersten des Labyrinths wohnte ein karnivorer Halbstier, der alljährlich neun Jungfrauen und neun Jünglinge auffraß. Wie in einem schwarzen Loch im Universum gingen viele hinein und keiner kam je heraus. Woher wußten die Griechen dann aber, wer dort saß und fraß? Kein Gefressener könnte es ihnen je erzählt haben. Dann aber kam einer, Theseus mit Namen, der auch fest daran glaubte, daß man sich im Labyrinth verirren könne. Daher ließ er sich von Ariadne, der minoischen Königstochter, an einen Faden, einen Leitfaden, wie man es später genannt hat, anbinden, dessen anderes Ende Ariadne fest in ihren Händen hielt. Am Gängelband der Ariadne konnte sich Theseus 528 Insofern war gerade jener sogenannte Mythos des 20. Jahrhunderts gar kein Mythos, sondern die kompensatorische Emergenz einer irrationalistischen Ideologie. A. Rosenberg: Der Mythos des 20. Jahrhunderts, 143.-146. Aufl. München 1939. 529 R. Konersmann: Kultur als Metapher.- In: Kulturphilosophie, hrsg. v. R. Konersmann. Leipzig 1996, p. 327-354; ders.: Vorwort: Figuratives Wissen.- In: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hrsg. v. R. Konersmann. Darmstadt 2007, p. 7-21. sicher fühlen, aus dem Einweglabyrinth wieder herauszufinden in die Arme der umgarnenden Ariadne. Was Ariadne an diesem „Helden“ attraktiv fand, wissen wir nicht. Vielleicht fand sie ihn ja auch gar nicht attraktiv, sondern ihr Gängelband diente von vornherein dazu, den Griechen vor den zuschauenden Minoern lächerlich zu machen. Und vielleicht hat Theseus das schwach geahnt, und er erzählte deswegen, als er wieder herauskam, er habe den Minotaurus getötet. Nun, zwischen labyrinthischem Tanz der Minoer530 und dem Irrgarten-Labyrinth der Neuzeit gab es ein Zwischenglied: Der Tanz wurde von dem griechischen Architekten Daedalus in ein „steinhartes Gehäuse“ umgeschaffen, und auch der Name verweist mit dem Wortbestandteil „labyr“ offenbar auf „Stein“.531 Dennoch, wie konnte sich der Architekt, der dieses Gebäude geschaffen hatte, selbst so in ihm verirren, daß er sich gefangen glaubte und den Fluchtweg nach oben glaubte antreten zu müssen. Der Architekt war insofern ein typischer Grieche, als er von der Arché, dem Einen Ursprung alles Seienden und alles Geschaffenen her dachte. Das Ursprungsdenken aber kann sich auf das Performative des Tanzes nicht einlassen. Ein archébesessener Grieche sucht stets nach dem Einen Ursprung und Grund, und wenn er diesen aus dem Blick verloren hat, was im labyrinthischen Tanz unvermeidlich ist, dann glaubt er sich verloren und haltlos verirrt. Seine Orientierung geht stets von der Arché auf ein Telos, ein Ziel, und der beste Weg (met-hodos) ist die gerade Linie, die ihn auf dem kürzesten Weg vom Ursprung zum Ziel führt; insofern ist auch die Spirale nur eine Deformation der geraden Linie und etwas ganz anderes als ein Labyrinth. 532 Noch die Xenonschen Paradoxien beruhen darauf, daß der Weg die gerade Linie ist, die Schritt für Schritt zum Ziel führen soll. Schon Aristoteles brachte aber den Gesichtspunkt ins Spiel, daß zur Bestimmung des Gelingens allen Handelns, d.h. des Insgesamt des Lebens, ein Begriff vonnöten sei, der sich nicht auf eine Verknüpfung von Methodenschritten, sondern auf Ganzheiten bezieht: der Begriff der Glückseligkeit, der nicht mehr ein Ziel hat, sondern der die Ganzheit des Zielerreichungsgetriebes umfassen kann. Aber auch er dachte sich noch Handeln als Linearität. Diese aber versagt im Labyrinth. Davor soll der Leitfaden bewahren, er simuliert die Linearität 530 Ich folge Hans Kern in der These, daß das Labyrinth ursprünglich ein komplexerTanz war, der die kosmischen Prinzipien der zyklischen Wiederkehr und der oszillierenden Wiederholung aufeinander abbildete. H. Kern: Labyrinthe. 3. Aufl. München 1982. 531 Roland Barthes zitiert M. Detienne mit der Feststellung, daß das Labyrinth „n’est pas fait de pierres, mais éternellement reproduit par les files de danseurs du branle de la grue“ und wörtlich: „le labyrinthe, est cosa mentale“. R. Barthes: Les mots du labyrinthe, hier p. 99, Anm. 17. 532 Cf. M. Bucaille: Spirale et labyrinthe.- In: The Situationist Times. 4. International Edition. Kopenhagen 1963, p. 12-16. Das gleiche gilt für Mäander. der Methode in einer Welt der kreisenden Wiederkehr des Gleichen und der fundamentalen Oszillation der Differenz. Die Linie des methodischen Vorgehens kann in jedem Moment ihrer Verfolgung eine Verzweigung,533 einen Abweg, anbieten. Nur eine Linie, die permanent hinsichtlich ihrer Linearität kontrolliert würde, wäre davor gesichert; aber dann ergibt sich auf der Ebene der Kontrollgarantie das gleiche Problem. Die Linie bietet kein gesichertes Entkommen aus der rhizomatischen Struktur des Labyrinths. Das Märchen vom menschenfleischfressenden Minotauros gleicht demjenigen von Hänsel und Gretel; denn auch ihr Wald ist ein Labyrinth, in dem die beiden sich verirren. Und auch hier hockt im Inneren ein angeblich menschenfressendes Wesen. Es dürfte jedoch die Prüfung angeblich des Fingers von Hänsel Chiffre für die Prüfung eines ganz anderen Körperteils des Jungen gewesen sein, so wie es sich auch im Labyrinth von Knossos und den in ihm „geopferten“ bemerkenswerterweise gleichen Anzahl von Jungfrauen und von Jungmännern wohl eher um einen Initiationsritus gehandelt haben dürfte als um die Speisung eines monströsen Hybriden. Jungmänner und Jungfrauen gingen hinein und sie kamen nicht als diese wieder heraus. Wer sich ins Labyrinth begibt, kommt nicht als derselbe wieder heraus, er wird ein anderer geworden sein. Der Minotauros frißt keine Jungfrauen und Jungmänner, sondern seine symbolische Virtualität verführt sie bloß zum Erwachsensein. Er sitzt nicht traurig in seinem Labyrinth in der Erwartung, daß eßbares Jungmenschenfleisch sich zu ihm verirrt. Im Inneren des Einweglabyrinths bezeugt seine Symbolhaftigkeit, daß die Vereinigung des Differenten immer nur temporär gelingt, dann folgt der Rückweg durch die gleichen Bewegungen und Stationen der Polarität und der Konzentration und Ekstase nur in spiegelverkehrter Umkehr. Nach der ertanzten Erfahrung des Inneren verliert sich auch im Außen nicht das unauslöschbare Bewußtsein eines rhythmisch gegliederten Ritornells.534 Die in der Initiation vollzogene Bewegung muß und kann zwar nicht erneuert werden, aber sie wird im Zustand des erwachsenen Körpers und seines Bewußtseins unendlich wiederholt. Der Minotauros ist keine Person, keine Maske und erst recht kein Individuum von modern innerer Unendlichkeit, sondern als symbolische Figur zeigt er eine Ordnung an, die eben keine Personen oder Individuen kennt, sondern Differenzen und Bewegungen… – bis Theseus kam. Die oszillierende Bewegung löst die Eindeutigkeit von Aussagen auf. Zwar schwingt das Pendel ewig von links nach rechts und zurück, ob es aber gerade jetzt links oder rechts sei, die Aussage darüber hängt vom Standpunkt des Beobachters ab, 533 J. L. Borges: Der Garten der Pfade, die sich verzweigen.- In: ders.: Erzählungen 19391944. Frankfurt a. M. 1992, p. 86. 534 K. Röttgers: Das Ritornell.- In: Spiegel - Echo - Wiederholungen, hrsg. v. K. Röttgers u. M. Schmitz-Emans. Essen 2008, p. 7-21. schwingt aber auch er rechtwinklig zu der Pendelbewegung, so wird die Lage schwieriger, vor allem wenn man annimmt, daß die Beobachtung eines Beobachters, der schwingt, selbst schwingend ist. So mag man eine bestimmte Einsicht als ‚zwar theoretisch richtig, aber praktisch falsch’ beurteilen, aber das ändert sich. Nehmen wir probehalber an, daß in der im Inneren gefundenen Synthese auch Theorie und Praxis wie in einer versöhnenden Dialektik vereint seien, so stünde diese doch unaufhebbar im Kontrast zum Außen des Labyrinths, der selbst nicht darin aufgelöst wäre. So ergibt sich eine Oszillation, die selbst die Alternative einer versöhnenden und einer negativen Dialektik hinter sich läßt. Die Frage, ob im Inneren des Labyrinths das Unheil des Menschenfressers dräut oder das Heil einer Kopulation des Differenten, ist eine marginale Frage. Nun zum Minotauros. Er soll jedes Jahr neun Jungfrauen und neun Jungmänner verspeist haben. Schon daß ein Halbstier Appetit auf Menschenfleisch hat, macht die Geschichte unglaubwürdig. Und dann, warum sollte er, der er ja kein Grieche war und daher nicht glauben mußte, sich im Labyrinth zu verirren oder in ihm gefangen zu sein, nicht einfach das Labyrinth verlassen haben und draußen auf die Suche nach Menschenfleisch oder besser noch nach schönem grünem Weidegras gegangen sein? Auch wenn man das harte Schicksal eines solchen bedauernswerten Monsters nicht beschönigen wollte, könnte man doch sicher sein, daß es sich irgendwie durchgeschlagen hätte, wenn es Realität besessen hätte. Aber genau das ist nicht der Fall. Das Innerste des Labyrinths war die erreichte Synthese der beiden sich überlagernden und durchkreuzenden Rhythmen des labyrinthischen Tanzes. Diese Synthese läßt sich nur als Symbol denken, nicht als eine reale Figur. 535 Der symbolische Stier, der Minotauros, versinnbildlicht die Vereinigung von Ekstase und Konzentration, von Männlichem und Weiblichem im Symbol der ambivalenten Gestalt von Stier und Mensch, als Initiation von jungen Menschen und als Sonnenkultus. Jungfräulichkeit und Jungmännlichkeit werden symbolisch gefressen; und aus dem Labyrinth kehrten nie mehr Jungfrauen und Jungmänner zurück, sondern initiierte Erwachsene. Der Minotauros frißt keine Jugendlichen, sondern seine Virtualität verführt zum Erwachsenendasein. Noch die sehr viel späteren Liebeslabyrinthe organisieren dieses Vereinigen der Geschlechter. In dem Zentrum dieser Liebeslabyrinthe steht aber nicht mehr ein Menschenfresser, sondern der Ehehafen … Für diese Paradoxie gebe ich zwei Erklärungen, eine logische und eine mythische. Die logische lautet: Die Griechen suchten nach dem Ursprung und Grund aller Dinge zum Zweck der Orientierung in der Welt und im Handeln. Ursprung und Grund hatte im Begriff der Arché auch die Bedeutung der Beherrschung. Wer seinen Ursprung kennt, beherrscht seinen Weg. Nun hat ein Labyrinth zwar einen Eingang, aber nur 535 Auch das Labyrinth in der Kathedrale von Chartres, ein Einweglabyrinth, hat im Inneren das christliche Symbol der Rose. wer den Eingang oder Zugang mit dem Ursprung verwechselt, wird die Bewegungen im labyrinthischen Tanz verwirrend finden, weil er den vermeintlichen Ursprung ebenso aus den Augen verliert wie auch die Bewegung in der Nähe des Zentrums ekstatisch zunächst von dort wieder fortgeführt wird. Man mußte also Arché-gläubig sein, um sich im Labyrinth zu verirren, d.h. man mußte Grieche sein oder einer seiner Nachfahren ohne Sinn für den labyrinthischen Tanz der minoischen Kultur. Daher kommen wir jetzt zu Theseus. So ein Arché-gläubiger war Theseus – und damit komme ich zur mythischen Erklärung der Paradoxie. Theseus hatte ein klares Ziel vor Augen, er wollte den Minotauros töten. Ariadne hatte den Theseus verführt zu glauben, man verirre sich im Labyrinth. Und er glaubte anscheinend an ein reales kannibalisches Wesen, das, halb Tier, an das Kannibalismus-Tabu menschlichen Zusammenlebens nicht gebunden zu sein schien, d.h. an die kulturell definierte Grenze zwischen Kultur und Natur, und deshalb beseitigt werden mußte.536 Tatsächlich ziehen Kulturen diese Grenze je spezifisch; es ist daher zwangsläufig so, daß die eine Kultur die Grenzziehung einer anderen mißversteht als Verletzung dieser fundamentalen Grenzziehung zwischen Natur und Kultur. Ein Sonnen-Kult, symbolisiert in der Figur des Stiers, ist jedenfalls ein hoch vermitteltes kulturelles Element und nicht wilde Naturalität. Was aber in der einen Kultur als Symbol gedeutet erscheint, ist für eine andere pure, bedrohliche Natur. Arché-Glaube und Renaturalisierung eines Symbols gab Theseus den Plan ein, den Minotauros zu töten. Aber zugleich machte ihn der Arché-Glaube im Labyrinth verwirrt und handlungsunfähig. An dieser Stelle kommt der Verführungscharakter der fremden Kultur ins Spiel. Die Verführung ist die andere Seite der Bedrohlichkeit des Fremden. Diese beiden Seiten von Fremdheit aber sind aufeinander angewiesen. Ariadne, das ist die Gestalt der Verführung der Fremden; sie kann den Theseus nur verführen, weil dieser an den Menschenfresser glaubt, aber er glaubt an den Minotauros genau deswegen, weil Ariadne ihn zu diesem Glauben verführt. „In Wirklichkeit“, wir wissen es inzwischen, gab es keinen menschenfressenden Halbstier im Inneren des Labyrinths. Wir müssen uns Ariadne, die Verführerin, wie Johannes, den Verführer, in Kierkegaards „Tagebuch eines Verführers“ als jemanden vorstellen,537 der sein Opfer erkundet und ihm eine Seele bildet. Ariadne kennt die Schwächen der Griechen, zwischen Arché und Telos eine Verbindung zu suchen.538 Und sie bildet 536 H. Peter-Röcher: Mythos Menschenfresser. München 1998. 537 S. Kierkegaard: Entweder – Oder, hrsg. v. H. Diem u. W. Rest, 2. Aufl. Köln, Olten 1968. 538 Die Unterschiede zwischen Platon, dem es primär um den Grund ging, und Aristoteles, der eher teleologisch dachte, sind demgegenüber nachrangig, obwohl, wie wir sehen werden, die Prozeßorientierung des Aristoteles für eine labyrinthische Welt angemessener zu sein scheint. diese Schwäche so, daß der Ursprung in ihren eigenen Händen lag, das Ziel aber als Verführung zur Bedrohtheit wirksam wurde. Die Jungmänner und Jungfrauen, wußten nicht, was sie im Labyrinth erwartete, ein Halbstier oder was sonst? Warum gingen sie trotz fehlenden sicheren Wissens ins Labyrinth hinein? Deswegen weil junge Männer und junge Frauen an der Schwelle zum Erwachsenendasein nicht Sicherheit wollen, sondern Wagnis: Kierkegaards verführerische Wirkung des Worts „Verführer“. Insofern hat das Labyrinth selbst als solches etwas Verführerisches. Die Verführung ist, wie Roland Barthes gesagt hat, im Labyrinth omnipräsent. Das Labyrinth ist die Verführung. Die traurige Gestalt des Minotaurus ist ebenfalls ein Verführter, so wie oben Verführung als Prozeß der Gegenseitigkeit geschildert wurde. Einerseits ist es das Ungewisse eines Abgrunds im Inneren des Labyrinths, der die jungen Leute verführt, andererseits aber hat die Initiation in das Erwachsenenleben eine konkrete Gestalt: den Tanz. 2.8.2 Die Wendeltreppe nach oben und nach unten Der labyrinthische Tanz-Rhythmus ist das Gegenteil einer Methode und daher der Moderne so unverständlich und unzugänglich. Die Methode ist zielorientiert und geradlinig, der labyrinthische Tanz aleatorisch, diese Bewegungsform führt dazu, daß man nicht geradewegs ins Zentrum gelangen kann, sondern so, daß man im Vollzug der Bewegung zunächst zwar dem Zentrum (konzentrisch) sich zu nähern scheint, dann aber plötzlich, wenn man sich ihm ganz nahe glaubt, exzentrisch sich wieder nach außen geführt findet, und das mehrfach, so daß die Ausschläge der Pendelbewegung zunächst geringer werden, dann aber wieder zunehmen. Für die Konstruktion des Ganges/Tanzes gibt es einen Algorithmus, der die Minoer als Schüler der ägyptischen Geometrie auszuweisen scheint. Diese Grundfigur eines Labyrinths sieht etwa folgendermaßen aus.539 539 H. Kern: Labyrinthe, p. 35, dort auch eine Darstellung des Algorithmus. Dieses ist, wie man sieht und wie jetzt schon festgehalten zu werden verdient, ein Einweglabyrinth, man kann sich in ihm nicht verlaufen, man findet sich hinein und man findet wieder heraus. Der menschliche Körper kann sich so oder so auf vielfältige Weise bewegen; 540 wenn er seinen Bewegungen eine bestimmte Struktur gibt, die auf Bewegungen anderer Körper abgestimmt ist, sei es menschlicher, sei es andere Körper in Bewegung, dann tanzt er. Die Abstimmungen der Bewegungen der Körper aufeinander erzeugen Sinn. In den alten Kulturen steht solche Sinngeneration durchweg auch im Zusammenhang der Abstimmung auf übergeordnete Sinnstrukturen bewegter Körper kosmischer Natur. Oftmals sind die Sinnverknüpfungen so, daß z.B. der Sinn kosmischer Bewegungen sozial in sinngebender Weise nachgespielt wird. Die naheliegende Deutung des labyrinthischen Tanzes ist also, daß er die Bewegungen der Sonne nachbildet: kreisförmig zieht die Sonne über das Firmament, und eingelassen ist sie in den Wechsel von Tag und Nacht. Und die Griechen erzählen, wie gesagt, im Inneren des Labyrinths säße ein Halbstier, der Minotauros; lassen wir im Moment die Charakterisierung dieses Wesens als virgino-carnivor beiseite und verlegen uns allein auf seine (Halb-)Stier-Natur, so ist diese ein weiterer Beleg dafür, daß der labyrinthische Tanz ein Sonnenkult gewesen sein muß. In vielen der mediterranen Kulturen ist der Stier mit seiner zugleich zeugenden und zerstörerischen Kraft ein Symbol der Sonne mit ihrer (mediterran) zugleich fördernden und potentiell zerstörerischen Kraft. Wenn der labyrinthische Tanz ein Sonnenkult gewesen ist, so bewegte er sich mit Sicherheit nicht auf einen wirklichen (Halb-)Stier zu, sondern auf ein Symbol desselben, der er ja nur ein Symbol der 540 V. Schürmann: Menschliche Körper in Bewegung. Zur Programmatik.- In: Menschliche Körper in Bewegung, hrsg. v. V. Schürmann. Frankfurt a. M., New York 2001, p. 9-40. Sonne war. Nicht auf die wirkliche Sonne bezog sich der Tanz, sondern auf die mythisch transformierte „nominale“ Kraft. 2.8.3. Abgrund oder Leitfaden Wo aber kommt nun Daedalus ins Spiel? Daedalus, der Archi-tekt, Daedalus der Grieche, schuf den Tanz in ein steinernes Gehäuse um. Er tat es auf Geheiß des Königs Minos. In Ermangelung des Stahls (Max Weber) erschuf er ein steinhartes Gehäuse – ob das eine gute Idee war, sei dahingestellt. Schaut man sich seinen Palast in Knossos an, so wäre es Minos durchaus zuzutrauen, daß er die Idee hatte, einen Tanz zu versteinern. Es wäre aber auch denkbar, daß er gewollte hätte, daß der griechische Ingenieur mit Erfüllung dieser Aufgabe sich selbst bloßstellte und blamierte. Immerhin hörte man, daß Daedalus im Labyrinth „gefangen“ war, zugleich berichtet der griechische Mythos entgegen aller Evidenz durch zeitgenössische Abbildungen, die stets ein Einweglabyrinth zeigen,541 daß man sich im Labyrinth verirre. Dann hätte sich Daedalus dadurch vor den Augen der minoischen Kultur blamiert, daß er sich in seinen eigenen Versteinerungen des Tanzes selbst nicht mehr zurechtfand. Daedalus, der Architekt, fand sich in seinem eigenen Bauwerk nicht zurecht? Vielleicht muß man ja mit Roland Barthes vermuten, daß nicht der Architekt und seine Perspektivik das Labyrinth erschufen, in dem man sich verirrt, sondern daß ein Grieche, der sich nicht auf den labyrinthischen Tanz der Minoer eingelassen hatte, einer, der als Archi-tekt von der Arché, dem Ursprung und Grund her denkt, sich auf das Performative des Tanzes nicht ohne Mißverständnisse einlassen konnte, weil er stets nach der Arché suchte, wo doch eine Ordnung, die kreisförmig und oszillierend ist, keinen Anfang hat. Entweder das von Minos in Auftrag gegebene Bauwerk war perfekt, dann hatte es tatsächlich selbst auch keinen Anfang und der archi-tektonische Ursprungssucher scheiterte an dieser Perfektion, oder es hatte einen Ursprungs-Ort, dann wäre sein Werk mißlungen und Minos hielt Daedalus wegen seines Versagens fest. Vielleicht aber war die Aufgabe, ein steinernes Labyrinth zu schaffen, eine paradoxe Aufgabe, an der Daedalus auf die eine oder auf die andere Weise scheitern mußte. Roland Barthes sagt, daß die Kurzsichtigkeit des Wandernden das Labyrinth für ihn entstehen läßt.542 Meine abschließende These wird sein, daß weder Theseus noch Daedalus angemessen auf die Herausforderung des Labyrinths geantwortet haben. Beide Griechen sind in dem Irrtum geeint, dem Labyrinth entkommen zu sein. Die Modernen, ihre legitimen Nachfolger, glaubten dann nicht mehr, ihm bereits entronnen zu sein, aber sie hielten ein Entkommen immerhin für möglich und wünschenswert. Sie schreiben 541 542 … und zwar bis 1420, s. u. R. Barthes: Les mots du labyrinthe, p. 95. Leitfäden noch und noch und suchen den Überblick über die Verwirrungen und den Überblick über die verwirrenden Überblicke. Wer den Über-Blick gewinnen oder behalten will, muß den Mittelweg zwischen den Symbolen und der Unmittelbarkeit wählen und erdnah fliegen wie Daedalus. Er scheint gewonnen zu haben. Er kann jetzt im Überblick seines Überflugs543 sehen, was er als Erbauer der Labyrinths natürlich (freilich auf andere Weise) bereits wußte, nämlich daß man sich im Labyrinth gar nicht verirren konnte, und vielleicht sah er auch, daß die Mitte – wie im von Michel Foucault eindringlich geschilderten Benthamschen Panoptikum544 möglich – gar nicht besetzt war. Es gibt gar keinen Minotauros, es gibt auch keine Minotauroiden, das Labyrinth ist unbewohnbar – aber begehbar. Andererseits: Die symbolische Repräsentation in der Religion ist eine Leerstelle: kein Gott (oder ein nicht-repräsentierbarer), nur die Banalität einer realen Sonne, die ins Labyrinth scheint. Was aber Daedalus nicht sah und was kein Überblick sichtbar machen kann, ist, daß der Beobachter trotz oder ungeachtet allen Distanzierungswollens ein Teil des Labyrinths ist. Jeder Fluchtversuch (nach oben, oder in die Zukunft oder wo immer man das Heil suchen mag545) bewirkt nichts anderes, als die Komplexität des Labyrinths zu steigern.546 Zum Irrgarten wird die Welt genau dadurch, daß wir uns methodisch, von einem Ursprung und Grund ausgehend, in ihr zu bewegen versuchen. Im Bewußtsein der Abhängigkeit der Struktur des Labyrinths von den Bewegungen in ihm und den Fluchtversuchen aus ihm geht das Bewußtsein des Einen Grunds aller 543 S. auch die Vorbehalte von Maurice Merleau-Ponty gegen den „survol“, M. Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare, p. 33, passim; ähnlich auch bereits Kants Kritik des „Überflugs“, I. Kant: Gesammelte Schriften XX, p. 272f.; cf. auch „Kritik der reinen Vernunft“ B 671. 544 545 M. Foucault: Überwachen und Strafen, p. 251ff. Noch Walter Benjamin ist von dieser Ungeduld eines Heilswillens bewegt, deswegen hält er das Labyrinth für den Ort der Zögernden („Heimat des Zögerns“) oder die labyrinthische Bewegungsform eine für denjenigen, „der noch immer früh genug am Ziel ankommt. Dieses Ziel ist der Markt.“ W. Benjamin: Illuminationen, p. 253, 252. Aber Wandern im Sinne einer Randonnée ist alles andere als ein Zögern, es ist lediglich eine Bewegungsform, die sich weigert, mit großem Elan und großer Konsequenz in die falsche Richtung zu laufen. Zum Begriff der Randonnée s. M. Serres: Hermes V: Die Nordwest-Passage, p. 9-17. Auf diese Weise kann das Labyrinth auch als Erzählmodell angesehen werden, s. M. Schmeling: Der labyrinthische Diskurs vom Mythos zum Erzählmodell. Frankfurt a. M. 1987. 546 Daher ist Roland Barthes Zuversicht, daß wir uns in Labyrinthen nicht verirren könnten, weil diese finit seien, trügerisch. Die Bewegung selbst erzeugt die Infinitheit des Labyrinths, s. R. Barthes: Les mots du labyrinthe, p. 94. Dinge (arché) endgültig verloren. Der Archéiker Theseus, ein Grieche, immer am Faden entlang gehend, den ihm Ariadne aufgeredet hatte, um ihn damit für sich einzufangen, ist konsequent: Er will den Halt an der Arché nicht verlieren und muß deswegen den symbolischen Repräsentanten der minoischen Kultur zerstören. Daedalus jedoch hat mit der Überblicks-Orientierung anstelle einer Ursprungs-Orientierung das Labyrinth als Irrgarten unausrottbar in der Seele der abendländischen Kultur eingepflanzt. Die Welt wird genau dann zum Irrgarten, wenn wir uns falsch, d.h. methodisch, linear, entlang einem Leitfaden, in ihr bewegen, angemessen wäre, wie wir sehen werden, eine nomadische, die Gelegenheiten des Geländes nutzende Bewegungsform. 2.8.4 Kein Außen, kein Mittelpunkt – nur ein Tanz Die Annahme, daß das Labyrinth zweidimensional sei und daß man ihm also durch Philosophie als einer überblickenden oder überfliegenden Metaebene entfliehen könne, ist also irrig. Ariadne, die verführerische Spinnenfrau, sorgt dafür, daß Theseus ihr nicht entfliehen kann, indem sie aus den Leitfäden ein neues netzförmiges Meta-Labyrinth spinnt.547 Und der geflügelte Daedalos weiß nicht, daß der philosophische Überblick nur ein trompe l’œil ist. Denn genau genommen ist es gerade erst der Überflugpunkt als Standpunkt der Philosophie, der den Irrgartencharakter des Labyrinths erschafft. Und so war dann der Gesichtspunkt der griechischen und griechisch-beerbten Philosophie, daß man sich in Labyrinthen verirren muß. So schuf die Philosophie unentwegt Labyrinthe, in denen das so war, und sie erzeugte Leitfäden, um diesen Zustand auf Dauer zu stellen. Und die sich aus ihr emanzipierenden Wissenschaften arbeiteten ihr darin fleißig zu. Geht man auf den Ursprung des Mythos zurück, so muß man überdies feststellen: Nur einer wohnte je im Labyrinth, sagen die Griechen, sein Name war Minotauros. Im Labyrinth zu wohnen, heißt, ein Minotauros zu sein, ein Mischwesen, dessen Ruf davon lebt, andere zu verspeisen. Wer wohnt, muß Örtern und Räumen Funktionen zuweisen, und er muß jedem Ding seinen Platz in einer so geordneten Welt zuweisen. Das heißt dann, dem zu Erkennenden einen realen oder logischen Ort in einer vordefinierten Ordnung zuweisen. Nur ein Minotauroide kann das, weil für ihn alles Eßbare, d.h. Verstehbare und in seine Wissenswelt Integrierbare, an ihm und seinem festen Wohnsitz im Zentrum seines Universums vorbeikommt und er nur erkennend zuzuschnappen braucht. Kants sogenannte Kopernikanische Wende, nach der er versuchte, die bisherige Determination des Subjekts durch das Objekt im Erkenntnisprozeß umzukehren, ist in Wahrheit antikopernikanisch schlechthin; denn hatte Kopernikus den Menschen aus dem Zentrum des Universums vertrieben (wie Gabriel seinerzeit Adam und Eva), so sorgt Kants sogenannte kopernikanische Wende dafür, 547 Cf. dazu auch J. Vogl: Über das Zaudern, p. 85. daß das Subjekt, freilich auf veränderte Weise, dort wieder einziehen und sich minotaurisch dort seßhaft einrichten kann. Es käme nicht auf die wirkliche oder vermeintliche Umkehrung des Subjekt/Objekt-Verhältnisses an, sondern auf deren Aufhebung. Einen solchen Wissens-Minotauros im Zentrum seines Universums seinerseits beobachtend, wird man jedenfalls eine Form des Nichtwissens gerade ihm zwangsläufig zuschreiben müssen, nämlich das Nichtwissen darüber, ob sein Labyrinth ein Einweglabyrinth oder ein echter Irrgarten ist, ob im Prinzip oder in the long run alles Begegnende wißbar (eßbar) ist, oder ob sich einiges im Irrgarten so verlaufen und wiedergefunden hat, daß es das Labyrinth des Wissens längst verlassen und sich damit dem Integrationsbegehren des Minotauros entzogen hat. Anders gesagt: Genau die Frage, ob alle Fragen (im Prinzip) beantwortbar, alle Probleme lösbar, alle Dinge und Menschen verstehbar sind, genau diese Frage – und wenn es auch im Bewußtsein eines vorgestellten Allwissenden die einzige wäre – ist nicht beantwortbar. Das muß den Minotauros traurig stimmen, möchte er doch so gerne alles in sein gütiges Verstehen, bzw. Fressen integrieren, weil seine menschliche Hälfte es doch so gut meint mit allen Dingen und Wesen. Aber überlegen wir advokatorisch in seinem Sinne: Könnte er wirklich alles verdauen, ist sein wohlmeinender Universalismus, seine neoliberale Globalisierungsbegeisterung nicht eine sich selbst täuschende Selbstüberforderung? Mit anderen Worten: Müßten wir als Minotauroiden nicht darauf hoffen, daß das Labyrinth kein Einweglabyrinth ist und gerade nicht alle Dinge und Wesen zu uns kommen, sondern sich im für uns Geheimen verlaufen? Dem Minotauros könnte das nichts ausmachen. Für ihn ist die Hauptsache, daß manchmal etwas begegnet, das verstanden, erkannt und einverleibt werden könnte. Selbst wenn (mit Nietzsche zu sprechen) alles Schein wäre, müßte ihm das egal sein; Hauptsache wäre dann, daß manchmal solch Scheinbares seinem Scheinleib einverleibt werden könnte. „Auch das Leben als Traum hätte seine Welt von Theorie und Technik, von Bedingungen des Glücks und Unglücks – immer das Glück (höherer Ordnung) vorausgesetzt, aus jenem Traum nicht erwachen zu müssen.“548 So weit aber brauchen wir gar nicht zu gehen; es reicht die Feststellung, daß die klare Abtrennung einer Insel der Wahrheit, auf der allen Dingen ihre ihnen zukommenden Orte zugewiesen werden, und dem Ozean des Scheins, der sie umgibt,549 nicht mehr nicht mehr gilt, die Dinge verlassen ihrer Örter, und zwar genau in Abhängigkeit von dieser Zuweisung. Aber vielleicht sind wir ja gar keine Minotauroiden, keine seßhaften Bewohner der Wissenswelten und Texte, keine Manifestationen der ersitzenden oder erwohnenden Vernunft. Vielmehr sehen wir, daß es nicht zweckmäßig ist, sich wohnlich im 548 H. Blumenberg: Höhlenausgänge, p. 470. 549 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, B 249ff. Labyrinthischen einzurichten, wenn man kein minotauroider Allesfresser sein kann.550 Menschen sind eben wohl doch keine Minotauroiden. Für sie ist eher, wie Hans Blumenberg festgestellt hatte, die Verbindung aus „Evidenzmangel und Handlungszwang“ die Grundsituation, die er als rhetorische bestimmte.551 2.9 N OMADISTIK 2.9.1 Kant und die Nomaden Kant liebte die Nomaden nicht. Im Reich des Geistes sind es die Skeptiker, die auf gleiche Weise wie die Zigeuner vagabundieren, „die allen beständigen Anbau des Bodens verabscheuen.“552 Sie „zertreten von Zeit zu Zeit die bürgerliche Verfassung.“ Aber nach Kant sind sie nicht die Barbaren eines Ursprungs. Am Anfang – auch im Reich des Geistes – steht vielmehr die Despotie. Den aristotelischen Gedanken eines Kreislaufs der Verfassungen verwendet auch Kant, um von einem ähnlichen Kreislauf der Geistesverfassungen zu sprechen; denn der despotische Dogmatismus, jene „Spur der alten Barbarei“, löst sich alsbald in Anarchie auf. Anarchie aber – das ist die Stunde der Nomaden, d.h. auf den Dogmatismus folgt der Skeptizismus. Aber Kant, der Kritiker der Vernunft, dieser „Chinese von Königsberg“, wie Nietzsche ihn genannt hat, war, so Nietzsche, nur ein Kritiker, kein Philosoph. Wenn man allerdings Philosophie mit dogmatischer Metaphysik identifizieren wollte, so hätte Kant diesem Diktum sogar zugestimmt. Sein Geschäft war die Erkundung und Sicherung der Grenzen der Vernunft, an die sich dann erst später eine solche Metaphysik hätte anschließen können, die diese Grenzen respektierte. Aber es gibt auch eine Metaphorik bei Kant, die etwas mehr beinhaltet als die bloße Grenzsicherung; sie findet sich in B 294f. Hier ist die Rede von einer landvermessenden, einer kartographischen Vernunft, die eben nicht nur an der Grenze tätig ist, sondern das „Land der Wahrheit“ selbst kartographiert und „jedem Ding auf demselben seine Stelle bestimmt.“ Wie die Zigeuner nach dem preußischen Edikt von 1725 keine Bleibe hatten,553 sondern ihnen mit dem Galgen gedroht wurde, so sollen 550 Allerdings werden wir auf diese Frage zurückkommen müssen, wenn wir mit Ute Guzzoni fragen werden, ob es nicht auch ein „im Wandern wohnen“ geben könne, also ein nichtersitzendes Wohnen. U. Guzzoni: Wandern und Wohnen. Düsseldorf 1999. 551 552 553 H. Blumenberg: Anthropologische Annäherungen an die Rhetorik, p. 117. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft A IX. Edict, daß die Zigeuner, so im Lande betreten werden, und im 18. Jahr und darüber alt seyn, ohne Gnade mit dem Galgen Bestraffet, und die Kinder in Wäysen-Häuser gebracht werden sollen. Berlin 5. Octobr 1725. Berlin 1725; nachdem 1726 das Alter auf 16 Jahre herabgesetzt worden war, wurde dieses Edict 1739 ausdrücklich erneuert und war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auch nicht aufgehoben worden. Das sollte gelten unabhängig davon auch die Nomaden im Reich des Geistes nicht geduldet, sondern vertrieben werden. Kants Kollege, der die Zigeuner in Preußen empirisch erforsch hatte (linguistisch, physiognomisch und in ihrem Sozialverhalten), der zudem ein Skeptiker à la Hume war, hatte allerdings durch seine Forschungen herausgefunden, daß es offenbar zwei entgegengesetzte Wege zur Aufklärung gebe: die ersitzende und die nomadische Vernunft. Daß aber der zivilisierte Weg zur Aufklärung der erfolgreichere sei, ist noch keineswegs ausgemacht; denn es mag in diesem Sinne „viele abergläubische Gelehrte, ja sogar abergläubische Aufklärer geben.“ 554 Ihr Abenteuerleben lehrt die Zigeuner, ihr Glück als Ergebnis eigener Klugheit und Geschicklichkeit in die eigenen Hände zu nehmen, daher ihr hohes Maß an Urteilskraft. Wenn man bei ihnen „Abneigung von aller Zwangsarbeit und sitzenden Lebensart“ beobachten kann, so ist das für Kraus für nur allzu verständlich; denn „von Natur kann kein Mensch Zwangsarbeit und Sitzen lieben.“ Wenn man also Menschen auf den ersten Weg, den Zivilisationsweg, hineinerziehen will, dann muß man sie frühzeitig an Zwangsarbeit und an sitzende Tätigkeiten gewöhnen. Wirkliche Aufklärung aber ist nicht an ein solches Intellektuellen-Leben im Sitzen und unter Zwang gebunden; es gibt die nomadische Alternative. 2.9.2 Das Wagnis Auch Peter Wust kennt die Erschütterungen, die nach Kant zur Anarchie führen, und er macht auch das gleiche Spiel auf: Dogmatiker vs. Skeptiker. Aber er setzt beide in Relation und relativiert sie dadurch: „Die Dogmatisten sind gegenüber den Pyrronianern mit ihrem Vernunftoptimismus im Recht, und die Pyrrhonianer sind ihrerseits gegenüber den Dogmatisten auch wieder im Recht mit ihrem Vernunftpessimismus. Aber beide Parteien sind auch wieder insofern im Unrecht, als sie, jede in ihrer Weise, die Teilwahrheit, die sie erfaßt haben, verabsolutieren und so zu Häretikern werden. … Aber beide Parteien sind eigentlich Egoisten einer falschen Vernunftsekurität. Denn beide wollen gegenüber der unendlichen Beunruhigung, die sie von der Wahrheit her ob den Betreffenden irgendetwas vorzuwerfen war und auch unabhängig davon, ob sie zum ersten oder zum wiederholten Male aufgegriffen worden sei. Der Galgen zum wiederholten Male zeigt, daß es nicht um Exekutionen ging, sondern darum, die Zigeuner in Furcht und auf der Flucht zu halten. 554 Auf der Grundlage der Zippel/Krausschen Papiere hatte Biester einen Aufsatz verfaßt: Ueber die Zigeuner; besonders im Königreich Preußen.- In: Berlinische Monatsschrift 21 (1793), p. 108-165, 360-393, hier p. 158; zu den Einzelheiten s. K. Röttgers: Kants Kollege und seine ungeschriebene Schrift über die Zigeuner. Heidelberg 1993. verfahren, ihre endgültige Gesichertheit erlangen. Beide wollen sich von dem Zustand des Unterwegsseins befreien, der nun einmal zum Wesen der Menschennatur gehört.“ 555 „Die Pyrrhonianer aber möchten lieber wie Nomaden auf freiem Felde wohnen, weil sie die stets drohenden Erdbeben fürchten, die von Zeit zu Zeit alle menschlichen Wahrheitsgehäuse wieder zerstören. Die Dogmatisten huldigen dem falschen Sekuritätsideal einer endgültigen Seßhaftigkeit, und die Pyrrhonianer lassen sich verlocken von dem trügerischen Ideal einer absoluten Ungebundenheit und Freizügigkeit.“556 Den skeptischen Nomaden vergleicht er auch mit dem verlorenen Sohn im Gleichnis: „Er liebt das absolute Vagantentum des Geistes, weil er die unerbittliche Determination der Wahrheit als unerträglich empfindet.“557 So sehr Wust das Wagnis auf der Suche nach Wahrheit befürwortet, daß er „den schützenden Kreis der alltäglichen Geborgenheit durchbrechen muß, um sich dem Wagnis der äußersten Ungeborgenheit auszusetzen“,558 und daher eine gewisse Sympathie für die Nomaden aufbringen könnte, weiß er doch auch, daß solche unruhigen Geister für ihre die Seßhaftigkeit bevorzugenden Mit-„Geister“ etwas Beunruhigendes haben. Sie gelten als verdächtige Existenzen. Dabei ist doch jede Ordnung „von Stunde zu Stunde gefährdet durch jenen aus der Dunkelheit der Zukunft drohenden Verfall“559. Wer das weiß, dem ist die Ruhe des geordneten Bestands genommen, und er ist auf der Flucht vor dem unberechenbar drohenden „Erdbeben“ des Geistes. „Jene wenigen Ausnahmeexistenzen aber, die umgekehrt wie die Menge das dunkle Hasardspiel des Lebens mehr zu lieben scheinen als die Gesichertheit der bürgerlichen Ordnung, werden als die ewigen Revolutionäre gegen den Alltag mit Mißtrauen betrachtet oder unter Umständen sogar verfemt, weil sie eine Ausnahme bedeuten, die der allgemeinen Daseinskalkulation hemmend im Wege steht.“560 Demgegenüber gelten zwei Einwände: • Eine Existenz wie z.B. Christian Jakob Kraus suchte verzweifelt nach Gewißheit, zuerst in der Religion, dann in der Mathematik. Sein Hume-Erlebnis, durch Hamann vermittelt, der von ihm sagte „Er kann den Hume 555 P. Wust: Ungewißheit und Wagnis. 4. Aufl. München, Kempten 1946, p. 290f. 556 l. c., p. 291. 557 l. c., p. 292. 558 l. c., p. 16. 559 l. c., p. 18. 560 l. c., p. 19. beynahe auswendig…“561, nahm ihm die Aussicht auf Gewißheit. Er hielt es dann mit den nomadischen Zigeunern, die – immer auf der Flucht vor dem preußischen Edict von 1725 ihr Leben auf der Flucht zu genießen gelernt hatten: Sie tanzen gerne: „Alles singt und springt“, „Sonst liegen sie gemeiniglich zu halben und ganzen Tagen im Grase ausgestreckt an der Sonne, unterreden sich, scherzen und treiben Muthwillen.“562 – Kraus übernimmt einiges wenige von ihrer Lebensweise, z.B. erlernt er die Fähigkeit zum Müßiggang, aber insgesamt hält er auch die zigeunerische Lebensart für eine unverdächtige Art der Lebensführung, nachdem er sein vormaliges Streben nach Gewißheit sozusagen in Parenthese gesetzt hatte, d.h. es handelt sich nicht nach Wust um Menschentypen, sondern um veränderbare Lebensweisen. • Der zweite Einwand hat mit der Entstehungszeit von Wusts Buch zu tun. 1937 erschien die erste Auflage, d.h. noch zu Zeiten der späten Moderne, für die Sicherheit einer Ordnung (des Staates, der Kirche, der Heimat), das Nonplusultra war, das nun Wust mit seiner existentialistischen Wagnisphilosophie ein wenig infrage gestellt hat. Diese Konstellation aber hat sich in der Postmoderne grundlegend gewandelt. In ihr ist Mobilität und Kurzfristigkeit der Beziehungen der Normalfall. 563 Jede Präsenz enthält ein Ticket zu einem Anderswo, zu einer Absenz. Der User ist wie sein Mobiltelefon: überall, d.h. nirgendwo erreichbar. Daher die Standardansagen des Users in sein Mobiltelefon, er sei gerade im Bus und der Bus fahre gerade an der Haltestelle XY vorbei. Nomadismus ist der Normalfall des postmodernen „Menschen“ geworden, den man deswegen angemessen als User tituliert, weil er seine Existenzweise dem Anschluß an ein Mobiles verdankt. Freilich ist eine solche Nutzerexistenz kein Wagnis im Sinne Wusts mehr. Schon eher gleicht er dem Gejagten im Sinnen des Edicts von 1725, und auch er ist „glücklich“, oder besser mit Camus gesprochen: wir müssen uns ihn als einen glücklichen Menschen vorstellen. Alle Öffentlichkeitsarbeit von Werbung und Journalistik geht dahin, Zweifel an diesem Bild des mobilen Konsumismus zu unterdrücken. Wir können aber mit diesem doppelten Zweifel auch erneut an Wust anknüpfen, der weder die Skeptiker noch die Dogmatisten, also weder die flüchtenden Nomaden 561 J. G. Hamann: Briefwechsel, hrsg. v. W. Ziesemer u. A. Henkel. Wiesbaden 1957, VII, p. 154. 562 Aus den Kraus/Zippelschen Papieren zit. bei K. Röttgers: Kants Kollege…, p. 77f. 563 Zur Geistesgeschichte der Unruhe s. R. Konersmann: Die Unruhe der Welt. Frankfurt a. M. 2015. noch die seßhaften Ordnungsliebhaber als ein Leitbild akzeptieren mochte. Auf der Suche nach Wahrheit, ja Weisheit heißt es für ihn immer: Ein Wagnis eingehen! Die Frage, ob Vernunft an sich nomadisch sein könne, hätte er allerdings mit dem Zweifel bedacht, welche Weisheit die nomadische Flucht denn verbürgen könnte. Aber umgekehrt: Die Verbürgung von Weisheit, die die Ordnungsfanatiker wünschen, ignoriert die grundsätzliche Verborgenheit der Wahrheit, der sich nur das Wagnis stellen kann. Kann etwa Nietzsches Denken als ein nomadisches oder aber als ein wagendes angesehen werden? Um eine solche Frage beantworten zu können, muß man vermutlich die Nietzsche-Lektüre postmodern gestalten. Anregungen zu einer derartigen Lektüre gehen von Raoul Richter aus.564 Richter schreibt: „Aber dann besteht eben die einzige Erkenntnis über die Transzendenz darin, daß sie der Erkenntnis verschlossen ist…“565 Nietzsche seinerseits hatte für eine Vermischung der Rassen plädiert und erwartete davon den „Quell großer Cultur“566. Von einer solchen Vermischung (von „Civilisation“, von „Vermenschlichung“, von „Fortschritt“) erwartet er „die langsame Heraufkunft einer wesentlich übernationalen und nomadischen Art Mensch“567. Aber diese „Vermischung“, die den europäischen Nomaden als höheren Typ Mensch hervorbringen wird, ist etwas ganz anderes als die „Anpassung“; denn eine solche erzeugt nichts anderes als eine „Vermittelmässigung“: „ein nützliches, arbeitsames, vielfach brauchbares und anstelliges Heerdenthier Mensch“ 568. 2.9.3 Nomaden verteilen neu Diese Opposition des höheren Nomaden und des arbeitsamen (sc. seßhaften) „Heerdenthiers“ wird von Carl Schmitt auf historisch-etymologische Grundlagen zurückbezogen. Die Wörter némein, nehmen, Name, nómoV und Nomaden seien urverwandt und ließen sich alle auf gemeinsame Grundbedeutung der sei es temporären, sei es dauerhaften (Land-)Nahme zurückführen. Der Unterschied besteht in dem weidenden Distribuieren eines Landstrichs durch die Nomaden, die zwar auch aufteilen, aber wenn das Land abgeweidet bist, weiterziehen, zu den Seßhaften, die einen Landstrich dauerhaft verteilt in Besitz nehmen. Die Nomaden teilen immer wieder und immer wieder neu. Die Fähigkeit dazu fehlt den Seßhaften; die Zigeuner nennen die seßhaf- 564 Dazu St. Dietzsch: ‚Die Philosophie fängt an, wo der Respekt aufhört‘.- In: Weimarer Beiträge 49 (2003), p. 219-241. 565 R. Richter: Essays. Leipzig 1913, p. 235. 566 F. Nietzsche: Kritische Studienausg. XII, p. 45. 567 l. c. V, p. 182. 568 l. c., p. 183. ten Nicht-Zigeuner „Gadschos“, und das heißt die Zurückgebliebenen in jeder Bedeutung des Wortes, ihnen fehlt die Gabe des Weiterziehen-Könnens. Sie leiten aus der Grund-Nahme den Nomos ab, dem allerdings zunächst nichts Normatives, also keine Moral innewohnt.569 Carl Schmitt ist in seiner Deutung abhängig von den Forschungen von E. Laroche.570 Diese griechische Wurzel *nem- hat ganz ursprünglich nur den Sinn „weiden-lassen“. Die Aufteilung des Landes geschieht erst in nach-homerischer Zeit. Gilles Deleuze referiert die Forschungen Laroches: „Ganz anders eine Verteilung, die man nomadisch nennen muß, ein nomadischer nomos, ohne Besitztum, Umzäunung und Maß. Hier gibt es kein Aufteilen eines Verteilten mehr, sondern eher die Zuteilung dessen, was sich verteilt, in einem unbegrenzten offenen Raum, in einem Raum, der zumindest keine genauen Grenzen kennt. … Die homerische Gesellschaft kennt weder Umzäunung noch Besitz des Weidelands: Es handelt sich nicht um eine Verteilung des Lands auf das Vieh, sondern im Gegenteil darum, das Vieh selbst zu verteilen, es hier und dort über einen unbegrenzten Raum, Wald oder Berghang hinweg aufzuteilen.“ 571 Auch Deleuze unterscheidet die Universalisierung und die kapitalistische Globalisierung, die auch noch die Universalisierung der Staatlichkeit transzendiert, von einem subversiven Nomadentum, das mikropolitisch agiert. Dahinter steht die von Bergson inspirierte Ansicht, daß das Leben ein Werden ist, das nicht statisch oder seßhaft sein kann, ohne seine Lebendigkeit einzubüßen. Das Nomadische ist singulär und gerade nicht universalisierend. Nachdem diese Konzeption in „Differenz und Wiederholung“ und in „Logik des Sinns“ bereits begründet worden war, enthält „Mille Plateaus“ von Deleuze und Guattari ein eigenes Kapitel „Traité de nomadologie“, dort allerdings im Zusammenhang mit der „Kriegsmaschine“, die der ordnenden Staatlichkeit entgleitet. Doris Schweitzer führt aus, daß Deleuze die Nomaden in seine kritische Philosophie einführt, weil Kant sie ausgeschlossen hatte.572 Und Simon Critchley verallgemeinert, daß die Zigeuner eine nomadische Erinnerungsspur in unserer Kultur seien.573 569 C. Schmitt: Nomos – Nahme – Name.- In: Der beständige Aufbruch. Fs. E. Przywara, hrsg. v. S. Behn. Nürnberg 1959, p. 92-105, bes. p. 100f. 570 E. Laroche: Histoire de la racine nem- en grec ancien. Paris 1949. 571 G. Deleuze: Differenz und Wiederholung. 3. Aufl. München 1992, p. 60 u. Anm. 7. 572 D. Schweitzer: Topologie der Kritik. Kritische Raumkonzeptionen bei Gilles Deleuze und Michel Serres. Berlin 2011, p. 158. 573 S. Critchley: Ethics – Politics – Subjectivity. London, New York 1999, p. 126-129. In Deleuzes Nietzsche-Lesebuch gibt es einen eigenen Abschnitt „NomadenDenken“.574 Darin geht Deleuze der Frage nach, was Nietzsche heute noch bedeuten kann, konkretisiert in der Frage: warum greifen die jungen Leute (von 1965) auf Nietzsche zurück und beginnen aus eigenem Antrieb, Nietzsche zu lesen. In seiner kurzen Erzählung „Ein altes Blatt“ spricht auch Kafka von den Nomaden,575 von den „Nomaden aus dem Norden“, die sich als Soldaten in der Hauptstadt aufhalten. „Ihrer Natur entsprechend lagern sie unter freiem Himmel; denn Wohnhäuser verabscheuen sie.“ Und dann folgt im Text das Entscheidende, das den Nomadismus aus der diskursiven Normalität des kommunikativen Textes ausgrenzt: „Sprechen kann man mit den Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht, ja sie haben kaum eine eigne.“576 Verzweifelte Versuche der Kommunikation mit ihnen enden so: „… sie haben dich doch nicht verstanden und werden dich nie verstehen. Oft machen sie Grimasse; dann dreht sich das Weiß ihrer Augen und Schaum schwillt aus ihrem Munde, doch wollen sie damit weder etwas sagen noch auch erschrecken; sie tun es, weil es so ihre Art ist.“577 Besser kann man die Fremdheitsanmutung für die Seßhaften kaum beschreiben. Deleuze bringt sie auf die Formel: „Irgendetwas springt aus dem Buch und tritt in Kontakt mit einem reinen Außen.“578 Diese Begegnung mit dem „reinen Außen“, sprachlos, außerhalb des kommunikativen Textes, hat aber nicht nur etwas Bedrohliches wie bei Kafka, sondern auch etwas abgründig Verführerisches. Das Nomadentum ist kein Ursprungszustand der Menschheit vor der Zivilisation, sondern es ist „… ein Abenteuer, das seßhafte Gruppen überkommt, ein Ruf von Außen, die Bewegung. Der Nomade mit seiner Kriegsmaschine widersetzt sich dem Despoten mit seiner Administrationsmaschine…“579 2.9.5 Die nomadische Affirmation „Die nomadische Affirmation“ ist die Formulierung von Maurice Blanchot, die (ungewollt) sehr gut die Position von Deleuze hinsichtlich des Nomadentums charakterisiert. Er führt aus: „Die nomadische Affirmation affirmiert, dass das, was sie affirmiert, weder die Form des ‚Erworbenen‘ noch des ‚Errichteten‘ noch auch des ‚Grundlegenden‘ hat.“580 Die Kritik, die sich der Nomadistik verschreibt, ist eben bei 574 G. Deleuze: Nietzsche. Ein Lesebuch von Gilles Deleuze. Berlin 1979, p. 105-121. 575 F. Kafka: Sämtliche Werke. Frankfurt a. M. 2004, p. 1153-1154. 576 l. c., p. 1153. 577 ibd. 578 G. Deleuze: Nietzsche, p. 113. 579 l. c., p. 119. 580 M. Blanchot: Das Neutrale, p. 7. Deleuze keine negierende, sondern eine durch und durch positive, affirmierende Kritik. Wenn man also feststellen muß, daß wir uns in der Postmoderne befinden, ist das zwar eine kritische Aussage, die aber weder – wie so manch ein Spätmoderner – die Postmoderne ablehnt, noch auch die (Spät-)Moderne negiert. Sie registriert einfach die Differenz, durch die etwa unter der Herrschaft des globalisierten (ziellosen und okkasionalistischen) Kapitalismus alle Akteure Nomaden werden auf einer Bahn ohne ein festes Ziel oder Sinn. Diese Nomaden können nicht mehr feststellen, ob es in ihrer Bewegung (gemeinhin: „das Wachstum“) eine Logik oder gar einen Sinn gibt, der mehr wäre als eine Illusion. Die Bewegung, nämlich des Mediums des kommunikativen Textes, bewegt sich selbst, ohne daß diese postmodernen Nomaden diese intendieren oder verstehen müßten.