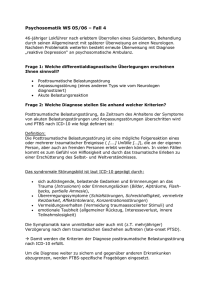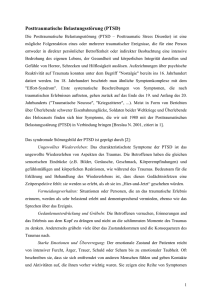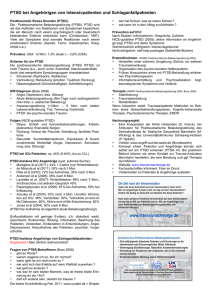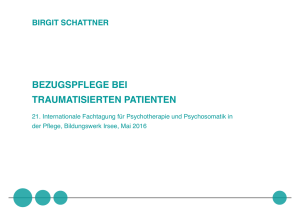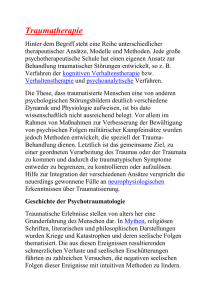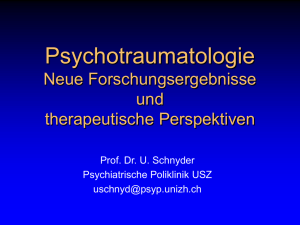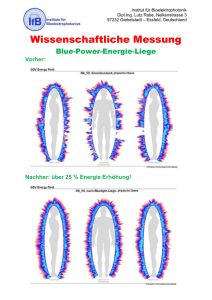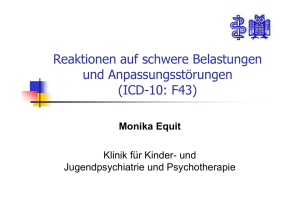Probleme bei der Begutachtung der posttraumatischen
Werbung

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Sektion für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie (Leiter: Prof. Dr. K. Foerster) M. Leonhardt, K. Foerster Probleme bei der Begutachtung der posttraumatischen Belastungsstörung Zusammenfassung Die Begutachtung der posttraumatischen Belastungsstörung hat eine große Bedeutung erlangt. Frühere Häufigkeitsangaben für diese Störung waren zu hoch. Die korrekte Erfassung der Traumakriterien ist für die Diagnose wichtig. Weder aus der Psychopathologie noch aus der Beschwerdeschilderung lässt sich erschließen, ob ein objektiv schweres Ereignis vorlag. Diese Frage muss vorab vom Auftraggeber geklärt werden. Die Komorbidität der posttraumatischen Belastungsstörung ist sehr hoch. Die Symptomatik verändert sich zeitbezogen, da Krankheitsverarbeitung ein dynamischer Prozess ist. Fehler, die zu falsch positiven und falsch negativen Diagnosen führen, werden genannt. In der Untersuchung sollte sich das Vermeidungsverhalten reproduzieren lassen. Die Untersuchung Traumatisierter erfordert ein sensibles Vorgehen. Bei korrekter Durchführung besteht keine Retraumatisierungsgefahr. Hinweise für die Untersuchung von Probanden, die (fälschlich) mit den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung identifiziert sind, werden gegeben. Aussagen zur Kausalität sind mit dem deskriptiven Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung nicht verbunden. Schlüsselwörter posttraumatische Belastungsstörung – Trauma – posttraumatische Störungen Einleitung Die posttraumatische Belastungsstörung (posttraumatic stress disorder – PTSD) ist eine Diagnose mit hoher Anziehungskraft, gerade auch im gutachtlichen Bereich. Andere posttraumatische Störungen wie depressive Reaktionen, Angst-, dissoziative und Schmerzstörungen drohen dagegen aus dem Blickfeld zu geraten oder tauchen vor allem im Zusammenhang des PTSD-Konzeptes auf. In Ergänzung zu unserem Aufsatz zur Diagnose der PTSD in diesem Heft, haben wir für diese Arbeit eine problembezogene Darstellung gewählt, die der besonderen Situation des Gutachters Rechnung tragen soll. Neue wissenschaftliche Konzepte werden anfangs meist überbewertet. Man erhofft sich von ihnen Lösungen für komplexe Probleme, die sich einem vollständigen Verständnis entziehen. Es gibt Gründe zur Annahme, dass dies auch für das PTSDKonzept gilt. Der Versuch, alle psychoneurotischen Störungen traumatologisch abzuleiten, ist bereits vom Ansatz verfehlt, ebenso wie die Ausweitung des Traumabegriffs auf Mobbing und Arbeitslosigkeit, wie sich mancherorts beobachten lässt [6]. Das komplexe Zusammenspiel von Ereignis und Persönlichkeit (oder wie ein Außen ein Innen beeinflusst und umgekehrt) lässt sich nicht einseitig auflösen. Die Grundfrage auch der Psychotraumatologie ist, wie ein Mensch von seiner Umwelt beeinflusst wird und sich mit ihr auseinandersetzt. Die Apperzeption schwerer, potentiell traumatisierender Ereignisse ist ein Spezialproblem der ubiquitären Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt. Das heißt aber auch, dass nicht jede, auch nicht jede belastende Apperzeption eines äußeren Ereig- Anschrift der Verfasser: Dr. med. Martin Leonhardt Prof. Dr. med. Klaus Foerster Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Sektion für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie (Leiter: Prof. Dr. K. Foerster) Osianderstraße 24 72076 Tübingen 150 nisses traumatisierend wirkt. Eine Traumatisierung liegt nur dann vor, wenn ein objektiv schweres Ereignis eine tiefgreifend verstörende, psychisch nicht zu integrierende Erfahrung hinterlässt. Hier haben allerdings die Erkenntnisse der Psychotraumatologie zu wesentlichen Fortschritten in Diagnose und Therapie geführt. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Angaben zur Lebenszeitprävalenz der PTSD in früheren Studien deutlich zu hoch angesetzt waren. Heute wird von einer Prävalenz von unter 10 % ausgegangen [3, 12]. Das Risiko, nach einem Ereignis entsprechender Schwere eine PTSD zu entwickeln, wird heute je nach Studie auf weniger als 10 % bis zu 25 % geschätzt [3, 9]. Ältere Arbeiten kamen teilweise zu weitaus höheren Angaben. Neuere, methodisch anspruchsvolle Studien veranschlagen das Risiko zur Entwicklung einer PTSD deutlich geringer. In einer aktuellen mitteleuropäischen Studie über die Folgen schwerer Verkehrsunfälle wiesen nach dem Unfall innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten zu keinem Zeitpunkt mehr als 5 % der Patienten eine voll ausgebildete PTSD auf, die Prävalenz im gesamten Untersuchungszeitraum lag bei 8,5 % [20]. In älteren Arbeiten lagen dagegen die Inzidenzzahlen im ersten Jahr bei bis zu 39 % [1]. Der Grund für diese erheblichen Unterschiede dürfte in Selektionseffekten liegen. Sorgfältig ausgewählte Stichproben von gesunden Probanden zeigen weitaus niedrigere Erkrankungsziffern [20]. Allerdings wurde auch deutlich, dass nach bestimmten, von Menschenhand gemachten traumatisierenden Ereignissen („man made desasters“ wie z. B. Folter) 50 % oder mehr der Betroffenen eine PTSD entwickeln [22]. In Übereinstimmung damit zeigte es sich, dass Ereignisse, die einen Angriff auf eine bisher als vertrauensvoll erlebte Beziehung darstellen, wie Gewalttaten im familiären Kontext, grundsätzlich schwerer zu verarbeiten sind als non-interpersonale Ereignisse [13]. Dieser Sachverhalt ist ein weiterer Beleg dafür, dass zusätzlich zur objektiven Schwere des Ereignisses die Bedeutung, die das Ereignis für den Betroffenen annimmt, besonders relevant ist. Daraus resultiert, dass im diagnostischen und gutachtlichen Kontext immer zu fragen ist, welche Funktionen ein Ereignis für das Binnenleben des Betroffenen angenommen hat, auf welche innere Resonanz es gestoßen ist und was diese Erfahrung für die post hoc-Wahrnehmung seiner Umwelt bedeutet. Solche Einschätzungen sind nur in einem intersubjektiven Dialog mögMED SACH 99 (2003) No 5 lich. Daher ist die gutachtliche Untersuchung psychoreaktiver Störungen, noch dazu wenn auch Kausalitätsfragen zu beantworten sind, immer auch eine psychotherapeutische Untersuchung. Es ist weder möglich, allein über Ereignisqualitäten (objektive Schwere und weitere Charakteristika) noch über die deskriptive Psychopathologie abzuschätzen, an welchem inneren Ort das Ereignis für den Betroffenen angesiedelt ist. Probleme des Traumakriteriums, Unterschiede zwischen DSM-IV und ICD-10 Es wird immer wieder auf die Unterschiede in den Konzepten des DSM-IV und der ICD-10 hingewiesen (vgl. auch Schnyder in diesem Heft). Generell ist zu sagen, dass die diagnostischen Kriterien im DSM-IV klarer definiert sind. Das gilt auch für die PTSD. Die konsequente Anwendung operationalisierter Kriterien, die dem subjektiven Ermessensspielraum des Untersuchers weniger Platz lässt, führt dazu, dass die Prävalenzzahlen der PTSD etwa um die Hälfte niedriger sind, wenn nach DSM-IV diagnostiziert wird, als bei Diagnosen nach der ICD-10 [17]. Dieser Sachverhalt ist in Gutachten zu berücksichtigen, da hier häufig gegenüber den nicht sachkundigen Auftraggebern argumentiert wird, dass die diagnostischen Kriterien, wahlweise der ICD-10 oder des DSM-IV, gegeben seien und daher eine PTSD anzunehmen sei. In beide Klassifikationssysteme gehen allerdings Vorannahmen ein, die wertenden Charakter haben und die gegebenenfalls gegenüber dem Auftraggeber offengelegt werden müssen. Fabra hat darauf hingewiesen, dass hier evtl. bereits rechtliche, normative Gesichtspunkte mit überlegt werden müssen [5]. Liegt tatsächlich auch ein schädigendes Ereignis i. S. der für das Gutachten geltenden gesetzlichen Grundlagen vor? Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Klassifikationen der ICD-10 und des DSM-IV sind die Traumakriterien. Wann ist davon auszugehen, dass eine Traumatisierung vorliegt, wann nicht? Im DSM-IV heißt es, dass in der Vorgeschichte der Störung ein Ereignis vorgelegen haben muss, das sowohl objektiv lebensbedrohlich war (A1-Kriterium) als auch subjektiv als extrem (lebens-)bedrohlich erlebt wurde (A2-Kriterium). Nur wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, darf man von einem Trauma oder einer Traumatisierung sprechen. Hingegen sind in der ICD-10 der subjektive und objektive Aspekt des Traumas nicht so deutlich getrennt, was zu Vagheiten und Interpretationsspielräumen führt. In der ICD-10 wird die PTSD als eine „Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“, definiert. Das DSM-IV stellt hingegen klar, dass Trauma ein janusköpfiger Begriff mit einer doppelten Bezogenheit nach Außen und Innen ist, der eine dialektische Bewegung enthält [6], in den Subjektives und Objektives eingehen [2]. Ein Ereignis, das subjektiv zwar als extrem bedrohlich wahrgenommen wurde, ohne aber entsprechend objektiv bedrohlich gewesen zu sein, erfüllt daher nicht die Traumakriterien des DSM-IV, möglicherweise aber diejenigen der ICD-10. Im Sinne des DSM-IV liegt dann evtl. eine andere reaktive Störung vor, allerdings ohne die Vorgeschichte einer Traumatisierung. Daher kann in solchen Fällen auch nicht die Diagnose einer PTSD gestellt werden. Eine Traumatisierung kann nicht allein aus dem subjektiven Erleben des Ereignisses begründet werden, ebensowenig wie aus dem objektiven Schweregrad ohne entsprechende subjektive Perzeptionsqualitäten. Vielmehr ist der Nachweis eines Ereignisses MED SACH 99 (2003) No 5 erforderlich, das unabhängig vom Erleben objektiv schwer bedrohlich war. Bei genauerer Betrachtung enthalten die Traumakriterien ein normierendes Element. Die Traumakriterien definieren, dass das subjektiv erlebte Maß an Bedrohung mit dem Ausmaß an objektiver Bedrohung korrespondieren muss. Die objektive und subjektive Ereignisschwere müssen gewissermaßen im Gleichgewicht sein, um eine Traumatisierung annehmen zu können. Die Verhältnismäßigkeit der Reaktion muss gewahrt sein. Wenn diese Gleichgewichtigkeit fehlt, kann keine PTSD diagnostiziert werden. Es ist dann um so mehr von der Bedeutung konflikthaft-neurotischer Anteile auszugehen. Das Konzept der PTSD darf nicht missverstanden werden, wie es gelegentlich geschieht, i. S. des Infektionsmodells der somatischen Medizin. Das PTSD-Konzept macht als rein deskriptives Konzept keinerlei Aussagen darüber, auf welche Weise ein Ereignis ein Trauma „macht“. In die Konzeption der PTSD gehen vielmehr implizit Vorstellungen über „normale“ Reaktionen und Verarbeitungsweisen äußerer Ereignisse ein. In der Vorgeschichte einer PTSD muss, wie es in der ICD-10 heißt, ein Ereignis vorgelegen haben, das „bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde“. Die PTSD ist ein eng definierter, zu einer typischen Symptombildung führender Spezialfall der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt [15]. Andere Formen der Verarbeitung belastender Ereignisse zählen nicht dazu. Dieser Sachverhalt ist besonders im gutachtlichen Kontext immer zu bedenken. Das gilt ganz unabhängig von der rechtlichen Bewertung. So kann selbstverständlich ein belastendes äußeres Ereignis, das nicht zu einer Traumatisierung führte, im rechtlichen Sinne Ursache einer Depression oder einer Angststörung sein mit der Folge, dass die daraus resultierenden Einschränkungen entschädigungspflichtig sind (je nach Rechtsgebiet und gesetzlichen Grundlagen). Anamnestische Probleme Bei den Problemen, die mit dem Traumakriterium verbunden sind, handelt es sich um anamnestische Probleme. Der Untersucher war nicht beim Ereignis anwesend, sondern muss das Ereignis, dessen subjektives Erleben und die peritraumatische Situation retrospektiv beurteilen. Wie dargelegt, enthält die Traumatisierung einen subjektiven (Erlebens-) und einen objektiven (Ereignis-)Aspekt. Der subjektive Aspekt kann nur über eine Rekonstruktion des Erlebens erschlossen werden. Daher ist bei der Exploration zu untersuchen, ob das peritraumatische Erleben tatsächlich die tief verstörende, existenziell bedrohliche Qualität beinhaltete, wie sie für das Vorliegen einer Traumatisierung zu fordern ist. Es ist nicht möglich, die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung zu stellen, ohne eine sorgfältige Untersuchung des peritraumatischen Erlebens. Der objektive Ereignisaspekt ist dagegen nicht Gegenstand der gutachtlichen Untersuchung. Mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher erschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war. Für eine solche historische Rekonstruktion stehen dem Gutachter keine Methoden zur Verfügung. Die Rekonstruktion vergangener Ereignisse ist selbst in sehr langen, i. e. psychoanalytischen Behandlungen, die sich dezidiert ein solches Ziel gesetzt haben, äußerst schwierig und im Ergebnis hinsichtlich ihrer Objektivität und Gültigkeit außerhalb der therapeutischen Dyade immer umstritten [4, 19]. Auch wenn sie gelingt, ist sie mit Unsicherheiten verbunden, die mit der im gutachtlichen Kontext zu fordernden Exakheit nicht zu verein151 baren sind. Systematische Untersuchungen Traumatisierter haben gezeigt, dass deren Schilderungen der akuten peritraumatischen Situation und Symptomatik zwei Jahre nach dem Ereignis starke Veränderungen zeigen verglichen mit der Ausgangsschilderung. Betroffene mit geringen posttraumatischen Symptomen bei der Nachuntersuchung lassen bei der erneuten Schilderung des Ereignisses gravierende peritraumatische Symptome aus, die sie anfangs genannt hatten. Personen mit schweren posttraumatischen Symptomen nennen dagegen neue peritraumatische Symptome, die sie vorher nicht genannt hatten. D. h. die aktuelle Symptomatik beeinflusst die retrospektive Erzählung des Geschehens [10]. Der Grund ist, dass die narrative Rekonstruktion der eigenen Biographie situationsabhängig ständigen Transformationsprozessen unterliegt. Das gilt auch für traumatische Ereignisse. Auch die Psychopathologie bietet keinen Ausweg aus diesem Problem. Es existiert kein psychopathologisches Symptom, von dem aus spezifisch auf ein Ereignis in der Vergangenheit geschlossen werden kann [21]. Das gilt beispielsweise auch für die intrusive Symptomatik, wie sie bei der PTSD vorkommt. Es existiert kein methodisch zuverlässiges Kriterium, um zu entscheiden, ob und in welchem Umfang intrusive Inhalte ein Ereignis oder wenigstens Aspekte desselben sicher abbilden. Die Umbildung der ursprünglichen Situationswahrnehmung beginnt bereits sofort nach einem Ereignis. Anders gesagt: Aus der psychopathologischen Symptomatik lässt sich kein Kriterium gewinnen, anhand dessen über die Glaubwürdigkeit anamnestischer Angaben des Probanden entschieden werden kann. Eine diagnostische Untersuchung im Hinblick darauf, ob eine posttraumatische Störung vorliegt, ist etwas völlig anderes als die Glaubhaftigkeitsbegutachtung von Probanden. Letztere bedient sich Methoden, die von denjenigen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Untersuchung deutlich unterschieden sind. Eine Vermengung der Erkenntnisziele (Glaubhaftigkeit versus Vorliegen einer Störung) führt zu unsicheren, spekulativen Ergebnissen. Aus diesen Gründen muss vor einer gutachtlichen Untersuchung einer evtl. PTSD geklärt sein, von welchem Ereignis der Gutachter als mögliche Ursache auszugehen hat. Diese Klärung ist Aufgabe des Auftraggebers, der auch die Möglichkeit (und die Pflicht) zu Ermittlungen hat. Solche Ermittlungen sind nicht Aufgabe des Gutachters. Psychopathologische Probleme Nach den anamnestischen Problemen nun zu den psychopathologischen Problemen. Die Psychopathologie der PTSD beinhaltet spezifische (traumaassoziierte) und unspezifische Symptome. Spezifisch sind die Symptome der Intrusion und des Vermeidungsverhaltens, unspezifisch die Symptome der chronischen Alarmreaktion, die beispielsweise nicht von der Symptomatik bei Angststörungen unterschieden werden kann, und die weitere Symptomatik wie Schlafstörungen oder erhöhte Reizbarkeit. Dazu kommt die konkomitante Symptomatik aus dem gesamten Spektrum der psychoneurotischen Störungen. Da die Komorbididät sehr hoch ist (je nach Untersuchung bis 100 %), liegt in der Regel kein „reines“ Störungsbild einer PTSD vor. In der klinischen Situation besteht vielmehr ein komplexes psychopathologisches Zustandsbild, in dem die spezifischen, traumaassoziierten Symptome eine unterschiedlich große, wechselnde, im Verlauf in der Regel abnehmende Rolle spielen. Die PTSD ist keine statische Störung, sondern Ausdruck eines im Verlauf wechselnden dynamischen Anpassungsprozes152 ses [6]. Es handelt sich bei der PTSD um eine komplexe psychophysiologische Reaktion auf eine schwere äußere Belastung („posttraumatic stress spectrum disorder“ [16]). Es liegt keine abgegrenzte Krankheitsentität vor, deren Symptome von denjenigen einer Depression oder einer Angsterkrankung in jeder Hinsicht klar unterschieden werden können (wie etwa eine Unterschenkelfraktur von einer Tuberkulose), sondern ein fließendes, dynamisches Zustandsbild. Das ist von besonderer gutachtlicher Bedeutung, da bei einer Begutachtung im Sozialrecht gemäß den rechtlichen Vorgaben (Theorie der wesentlichen Bedingung) nicht nach der Diagnose einer Störung gefragt wird, sondern nach dem Vorliegen von Krankheitsentitäten. Damit ist die umschriebene, abgrenzbare Wesenhaftigkeit einer Erkrankung gemeint. Eine solche Forderung ist logisch unvereinbar mit den theoretischen Voraussetzungen der heute gültigen Klassifikationssysteme, die vom deskriptiven Komorbiditätskonzept ausgehen. Die Frage, welche Krankheit ereignisbedingt ist, ist mit den Vorgaben von ICD-10 und DSM-IV nicht zu beantworten bzw. würde zu rechtlichen Verwirrungen führen, da ein Störungsbild im Verlauf stark wechseln kann. Vielmehr muss in solchen Fällen exakt herausgearbeitet werden, welche Anteile der meist komplexen Gesamtsymptomatik traumaassoziiert sind und welche nicht. Traumaassoziiert sind immer die Kernsymptome der PTSD, die unspezifischen und komorbiden Symptome verlaufsabhängig zu wechselnden Anteilen. Es existiert keine Möglichkeit, mit psychopathologischen Mitteln die unspezifischen und komorbiden Symptome kausalitätsbezogen der einen oder anderen Störung zuzuordnen. Das liegt daran, dass Störungsklassifikationen rein deskriptiv sind und kein ätiologisches Konzept beinhalten. Die psychopathologische Konzeption der PTSD stellt den Gutachter vor weitere Probleme. Die traumaassoziierten Symptome (Intrusion und Vermeidung) repräsentieren neue psychopathologische Konzepte, die es – anders als z. B. Depressivität, Angst oder Zwang – vorher in der Psychiatrie nicht gab. Das kann zu diagnostischen Unklarheiten nach beiden Seiten führen. Bei einem Untersucher, der wenig differenzialdiagnostische Erfahrung mit psychiatrischen Krankheitsbildern hat, ist unserer Erfahrung nach häufig eine Überdehnung des Konzeptes zu beobachten. Es sollte aber bezüglich der Intrusionen immer berücksichtigt werden, dass es sich um eine besondere Form dysfunktionaler Erinnerungen handelt, die mit einem schweren, dem peritraumatischen Erleben vergleichbaren Affektsturm verbunden sind. Andere evtl. auch schwer belastende Erinnerungsaffekte zählen nicht dazu. Angst, die z. B. auftaucht, wenn ein Betroffener erneut an einer früheren Unfallstelle vorbeifährt und die ihn zu einer Verringerung der Geschwindigkeit bewegt, ist nicht dysfunktional, sondern Ausdruck eines gelungenen Warnsystems mit einem adäquaten Auftauchen des Angstaffektes. Intrusive Erinnerungen sind ferner ichdyston. Der Betroffene will sie nicht haben, er wendet viel psychische Energie darauf, sie zu unterdrücken und vom Erleben fern zu halten. Intrusive Alpträume reproduzieren nicht beliebige Bedrohungssituationen, sondern beziehen sich – wie die Flashbacks – auf Aspekte der traumatisierenden Situation. Das Vermeidungsverhalten als weiteres spezifisches Symptom ist primär stets ein inneres, nicht ein äußeres Vermeidungsverhalten. Der Betroffene will es vermeiden, mit den traumaassoziierten Affekten in Berührung zu geraten, die durch äußere Trigger ausgelöst werden können. Wenn bestimmte Situationen aus anderen Gründen gemieden werden, ist diese Bedingung nicht gegeben. Pitman et al. nennen als häufige Fehler, die zu einer falsch positiven Diagnose der PTSD führen [18]: Unfähigkeit, adäMED SACH 99 (2003) No 5 quaten emotionalen Stress von krankheitsbedingtem zu unterscheiden; Auslassen bestimmter diagnostischer Kriterien (des DSM-IV); Nichtberücksichtigung früherer traumatischer Ereignisse und daher falsche Kausalzuordnung der aktuellen Störung; fehlende Diagnose einer präexistierenden Psychopathologie; fehlende Erhebung der Familienanamnese, die Hinweise für das Vorliegen einer anderen Erkrankung geben könnte; fehlende differenzialdiagnostische Erörterungen. Zu falsch negativen Diagnosen können führen: Betrachtung der PTSD-Symptome als im wesentlichen verständliche, nachvollziehbare Reaktionen auf das Ereignis; oberflächliche Exploration ohne den konsequenten Versuch, die peritraumatische Situation und das peritraumatische Erleben zu explorieren; persönliche Vorbehalte gegenüber der Diagnose; fehlende Anerkennung des Sachverhalts, dass eine PTSD trotz schwerwiegender präexistenter Auffälligkeiten diagnostiziert werden kann; falsche Zuschreibung der Symptomatik zu anderen Ereignissen; Rekurs auf einseitige oder veraltete Theorien hinsichtlich der Störungsverursachung (wie: „Jede psychische Krankheit hat ihre Wurzeln in der Kindheit“ oder „Alle Krankheiten sind genetisch.“); keine Berücksichtigung der relevanten Literatur. Probleme der Untersuchungstechnik Traumatisierte Menschen meiden es mit großer psychischer Anstrengung, mit den traumatisierenden Inhalten und Gefühlen in Verbindung zu geraten. Zurecht wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Betroffene auf den ersten Blick durchaus den Anschein von Normalität vermitteln können, was zu diagnostischen Fehleinschätzungen führt. Gelegentlich kommt es zu Koalitionsbildungen zwischen Proband und Untersucher, die beide das Trauma bagatellisieren, um die damit verbundenen verstörenden Gefühle abzuwehren [11]. Die wichtigste Regel bei der Untersuchung (wie bei der Behandlung) traumatisierter Menschen ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem diese sich sicher fühlen können. Nur dann hat man als Untersucher eine Chance, sich an die für die Diagnosestellung unumgänglichen, für den Probanden (und den Untersucher) aber sehr belastenden Gefühle heranzutasten. Dazu benötigt man Zeit und Ruhe. Untersuchungsabschnitte, die der Beziehungssicherung, also mehr „technischen“ als direkt diagnostischen Zwecken dienen, nehmen einen größeren Raum ein als bei anderen Probanden. Eine sorgfältige Exploration des peritraumatischen Erlebens und der peritraumatischen Situation ist dann allerdings ein zwingend notwendiger Bestandteil der Untersuchung. Dafür gibt es zwei Gründe. Einmal muss in anamnestischer Hinsicht geprüft werden, ob das primäre Situationserleben so gestaltet war, dass es die Traumakriterien erfüllt. Es geht also um eine Rekonstruktion dieses Erlebens, so weit dies möglich ist. Zum anderen muss psychopathologisch geprüft werden, wie der Proband auf die Thematisierung der mutmaßlich traumatisierenden Situation reagiert. Im typischen Fall reagiert der Betroffene mit wahrnehmbar gesteigerter Anspannung, Unruhe und Angst. Vielen Probanden gelingt es im Vorfeld, diesen Explorationsversuchen unmerklich und elegant auszuweichen und dabei ein Gefühl von Normalität zu vermitteln, so dass man als Untersucher quasi verführt wird, derartige Bestrebungen aufzugeben („nichts zu holen“). Das sollte man gerade dann aber auf keinen Fall tun. Wenn man eine solche Beobachtung gemacht hat, ist es vielmehr sinnvoll, diese dem Probanden mitzuteilen, der sich dadurch verstanden, entlastet und geschützt fühlt und sich daher eher auf die für ihn belastenden Gefühle einlassen kann. MED SACH 99 (2003) No 5 Auf diese Weise entsteht nach und nach während der Exploration ein interaktionelles Muster, das durch ein An- und Abschwellen der beobachtbaren Anspannung bis hin zu brüsker Abwendung in Abhängigkeit davon, wie nahe sich der Proband an traumatisierenden Inhalten bewegt, gekennzeichnet ist. Ein solches Interaktionsverhalten beweist (im Kontext) die Diagnose einer PTSD. Da die anderen beobachtbaren Symptome der PTSD-Probanden unspezifisch sind, wir aber auf beobachtbare Befunde zur Sicherung der Diagnose angewiesen sind, kann auf ein solches Vorgehen und den Nachweis solcher Beobachtungen nicht verzichtet werden. Denn im Gegensatz zu den Symptomen, die der Proband nur anamnestisch schildert, kann man auf diese Weise das Vermeidungsverhalten quasi „in vivo“ reproduzieren. Gelegentlich können Probanden das Ereignis relativ frei schildern. In diesem Fall ist besonders auf den begleitenden Affekt zu achten. Fehlende affektive Resonanz bei kühlen, distanzierten Schilderungen widerlegt eine Traumatisierung nicht, sondern ist häufig ein Hinweis auf einen abgespaltenen traumatischen Affekt. Nicht von einer noch fortdauernden Traumatisierung auszugehen ist dagegen bei Schilderungen, die relativ flüssig vorgetragen werden und mit einem adäquaten traurigen, weinenden oder auch wütend-zornigen Affekt verbunden sind, der aber nicht die Charakteristika der tiefgreifenden Verstörung aufweist, wie sie für eine Traumatisierung typisch sind. Umstritten ist, ob man nicht nur das Vermeidungsverhalten, sondern auch intrusive Phänomene, vor allem Flashbacks, während der Untersuchung gezielt reproduzieren soll. Manche Untersucher tun das. Unseres Erachtens ist das nicht zwingend erforderlich. Wir bevorzugen das gerade beschriebene, sensible Vorgehen. Wenn man es tut, sollte man über fundierte therapeutische Erfahrungen verfügen, um den Probanden auffangen zu können. Prinzipiell können allerdings auch bei einem Vorgehen, wie wir es bevorzugen, Flashbacks auftreten. Allerdings ist das Risiko dafür sehr gering. Spezielle Probleme des gutachtlichen Settings Zu den Problemen des gutachtlichen Settings gehört, dass der Proband nicht als Patient kommt. Er ist als Proband meist noch misstrauischer und zurückgezogener als es traumatisierte Patienten ohnehin sind. Die Notwendigkeit, unter diesen Voraussetzungen eine vertrauensvolle Situation zu schaffen, muss noch einmal betont werden. Gelegentlich wird von Probanden oder deren Anwälten argumentiert, dass eine Untersuchung nicht möglich sei wegen einer angeblichen Retraumatisierungsgefahr. Es muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht möglich ist, eine medizinische Diagnose ohne eine vorherige persönliche Untersuchung zu stellen. Diagnosen lassen sich nicht nach Aktenlage stellen oder allein aus der Beschwerdeschilderung eines Betroffenen ableiten. Auf der anderen Seite sollte der Gutachter selbstverständlich zusichern und alles dafür tun, um die Untersuchung möglichst wenig belastend durchzuführen. Gelegentlich ist es erforderlich zu erläutern, dass eine Untersuchung zwar belasten kann (auch bereits im Vorfeld), aber nicht mit der Gefahr einer Retraumatisierung sensu strictu verbunden ist. Die Untersuchungssituation ist kein objektiv schweres Ereignis, wie es für die Traumakriterien erforderlich ist. Schlimmstenfalls können Flashbacks auftreten. Hier muss aber gesagt werden, dass diese andererseits für therapeutische Zwecke gezielt ausgelöst und dort auch in Kauf genommen werden. 153 Das Argument der drohenden Retraumatisierung dient unserer Erfahrung meist dazu, einer notwendigen Untersuchung auszuweichen. Oft sind es auch Probanden, die eine gutachtliche Untersuchung wegen der angeblichen Retraumatisierungsgefahr verweigern, andererseits aber schon lange in psychotraumatologischer Behandlung sind, bei denen über Imaginationen gezielt Flashbacks ausgelöst werden. Findet eine Untersuchung in einer solchen Konstellation doch statt, liegt häufig keine Traumatisierung vor, sondern ein anderes, neurotisches Krankheitsbild. Andererseits sind uns keine traumatisierten Probanden bekannt, die aus diesen Gründen eine Untersuchung verweigert haben. Traumatisierte Patienten stellen sich in der Regel mit großer Gewissenhaftigkeit der Untersuchung zur Verfügung, auch weil sie hoffen, dass das gutachtliche Ergebnis ihnen – durch die Anerkennung der traumatischen Realität – bei der Verarbeitung hilft. Große gutachtliche Probleme schaffen Probanden, die nicht an einer PTSD leiden, sondern mit einer solchen identifiziert sind. Dabei handelt es sich nicht um einen Ausdruck von Simulation, sondern um Personen, die subjektiv davon überzeugt sind, traumatisiert worden zu sein und nunmehr unter den Symptomen einer PTSD zu leiden. Meist existiert in solchen Fällen bereits eine lange Vorgeschichte von Begutachtungen und psychotraumatologischen Behandlungen und Attesten, ganz ähnlich wie bei Patienten, die mit den Symptomen einer körperlichen Erkrankung identifiziert sind. Oft finden sich enge, teilweise mit Heilserwartungen aufgeladene Koalitionsbildungen zwischen Proband und Behandlern oder auch Vorgutachtern im Sinne eines geschlossenen Systems. Die Folge sind (iatrogene) Artefakte. Diese Probanden können die Symptome der PTSD und der Traumatisierung lehrbuchartig schildern. Psychopathologisch fällt in der Untersuchung dann auf, dass die Präsentation der Symptome durch die Probanden immer zum genau „richtigen“ Zeitpunkt erfolgt und ausgestaltet wirkt. Wenn man nachfragt, kontrastiert die demonstrierte Beschwerdestärke auffällig zur Vagheit der Angaben. Beim Untersucher entstehen rasch die Gegenübertragungsgefühle, wie sie auch sonst bei demonstrierten Störungen bekannt sind (Gefühl des Unechten, des Manipuliertwerdens, Ärger, Gereiztheit). Traumatisierte Menschen stellen dagegen eine völlig andere Untersuchungssituation her, die vom Versuch gekennzeichnet ist, das Trauma vor dem Untersucher (und vor sich selbst) zu verbergen. Wegen der manchmal sehr schwierigen differenzialdiagnostischen Probleme ist davor zu warnen, dass die Begutachtung traumatisierter Probanden, wie es manchmal geschieht, von Untersuchern durchgeführt wird, die ihre klinische Erfahrung überwiegend aus der Psychotraumatologie beziehen und keine gründliche Erfahrung mit dem gesamten Spektrum psychischer Störungen haben. Denn woher soll man als Untersucher sonst seine Maßstäbe beziehen zur Unterscheidung, ob eine traumatogene Störung oder beispielsweise eine Angststörung oder eine Persönlichkeitsstörung vorliegen? Wenn der Verdacht auf eine Symptomatik auf der Basis einer Identifizierung vorliegt, empfiehlt sich zuerst eine sorgfältige Prüfung, ob tatsächlich ein objektiv schweres Ereignis in der Vorgeschichte belegt ist. Bei Zweifeln ist der Gutachtenauftrag zur weiteren Sachaufklärung zurückzugeben. Dann sollte untersucht werden, ob sich aus der Vorgeschichte des Probanden Hinweise für eine nur unzureichend gelungene Lebensbewältigung oder gar für eine manifeste psychische Erkrankung ergeben. Bei der Exploration sollten diese Punkte vertieft werden, um auf diese Weise ein Bild von der Persönlichkeitsstrukur des Probanden zu gewinnen, wie es bei der Begutachtung neurotischer Patienten regelmäßig erforderlich ist [7]. Sind die Anga154 ben zur persönlichen Entwicklung vage und bagatellisierend, obwohl manifeste Probleme in der Vorgeschichte belegt sind (z. B. Eheprobleme), taucht die Frage auf, ob die angebliche Traumatisierung, die über eine Verschiebung innerer Konflikte nach außen eigentlich der psychischen Stabilisierung dient, so nicht stattgefunden hat, aber aus Schutz vor seelischem Schmerz an ihr festgehalten wird. Daher muss die Lebenssituation des Probanden zum Zeitpunkt des Ereignisses besonders sorgfältig untersucht werden. Es ist wichtig, sich bei der Untersuchung vor Augen zu halten, dass es nicht darum geht, den Probanden zu „überführen“ – echte Simulation ist eine Rarität – , sondern gemeinsam mit ihm eine alternative Erklärung für seine Beschwerden zu entwickeln. Dazu ist die Vertrauenssituation eines quasi psychotherapeutischen Kontakts erforderlich. Meist handelt es sich um schwer leidende Menschen, deren Störung nur eine andere Ursache hat als eine Traumatisierung. Wegen der häufig bestehenden Koalitionsbildungen im Vorfeld kann eine solche Untersuchung sehr schwierig sein. Kausalitätsprobleme Wenn die Störung erkannt und die Diagnose richtig gestellt wurde, ist die Kausalitätsbeurteilung einer isolierten PTSD einfach. Das gilt für alle relevanten Rechtsgebiete (soziales Entschädigungsrecht, gesetzliche Unfallversicherung, Zivilrecht). Das liegt daran, dass – anders als beispielsweise bei einer depressiven Störung – bei der PTSD das zugrundeliegende Ereignis in den traumaassoziierten Kernsymptomen direkt wieder auftaucht. Schwierigkeiten treten dann auf, wenn ein buntes psychopathologisches Zustandsbild besteht, das neben anderen auch traumaassoziierte Symptome enthält (Intrusionen, Vermeidungsverhalten). Es ist dann im Einzelfall sorgfältig zu klären, welches der Symptome dem Ereignis zuzuordnen ist und welches nicht. Dafür gelten dann die Regeln der Kausalitätsbeurteilung, wie wir sie an anderen Stellen ausgeführt haben [8, 14]. Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei langjährigen chronifizierten Verläufen, die häufig von einer depressiven Symptomatik begleitet sind, deren Ursachen evtl. anderswo gesucht werden müssen. In der ICD-10 heißt es, dass „prädisponierende Faktoren“ zwar die Schwelle für die Entwicklung einer PTSD senken oder deren Verlauf erschweren können, aber „weder notwendig noch ausreichend [seien], um das Auftreten der Störung zu erklären.“ Aus dieser Formulierung wird von manchen Gutachtern geschlossen, dass eine gesicherte PTSD prämorbide Persönlichkeitsauffälligkeiten ausschließen würde. Dieser Umkehrschluss ist falsch. Das PTSD-Konzept ist ein deskriptives Konzept, das keine Aussagen zur Ätiologie enthält. Daher kann es auch nicht zu gutachtlichen Kausalitätsbeurteilungen benutzt werden. Ferner gilt, dass eine Traumatisierung immer das Resultat einer Auseinandersetzung von Ereignis- und Persönlichkeitsqualitäten ist. In der Regel muss dieser Sachverhalt bei der Kausalitätsbeurteilung der PTSD, wie oben dargelegt, allerdings nicht ausführlich diskutiert werden. Wenn aber keine monosymptomatische PTSD vorliegt oder bei chronischen Verläufen, darf die Kausalitätsbeurteilung für die gesamte Symptomatik nicht über den gerade beschriebenen Umkehrschluss „erledigt“ werden. Dann ist die Einzelsymptombeurteilung erforderlich. Bei einer „bunten“ Symptomatik, gesicherten prämorbiden Auffälligkeiten oder schweren Chronifizierungen können die Probleme der Kausalitätsbeurteilung so komplex sein, dass sie mit den Mitteln eines psychiatrischen Gutachtens nicht gelöst werMED SACH 99 (2003) No 5 den können. Der Gutachter sollte sich dann nicht scheuen, die methodisch bedingten Grenzen seiner Aussagen klar zu kennzeichnen. Es ist dann eine Werteentscheidung erforderlich, die Aufgabe des Juristen ist. Literatur: 1 Blanchard, E. B., E. J. Hickling, A. E. Taylor, W. R. Loos: Psychiatric morbidity associated with motor vehicle accidents. J Nerv Ment Dis 183, 495–504 (1995) 2 Bohleber, W.: Die Entwicklung der Traumatheorie in der Psychoanalyse. Psyche – Z Psychoanal 54, 797–839 (2000) 3 Breslau, N., R. C. Kessler, H. D. Chilcoat, L. R. Schultz, G. C. Davis, P. Andreski: Trauma and posttraumatic stress disorder in the community. Arch Gen Psychiat 55, 626–632 (1998) 4 Cremerius, J.: Die Konstruktion der biographischen Wirklichkeit im analytischen Prozeß. In ders.: Vom Handwerk des Psychoanalytikers, Das Werkzeug der psychoanalytischen Technik, Bd. 2. FrommannHolzboog, Stuttgart, 398–465, 1984 5 Fabra, M.: Das sogenannte Traumakriterium (A-Kriterium des DM-IV) der posttraumatischen Belastungsstörung und seine Bedeutung für die Sozial- und Sachversicherung. Versicherungsmedizin 55, 19–25 (2003) 6 Fischer, G., P. Riedesser: Lehrbuch der Psychotraumatologie. UTBErnst Reinhardt, München – Basel 1998 7 Foerster, K.: Psychiatrische Begutachtung im Sozialrecht. In: Psychiatrische Begutachtung. Hrsg. U. Venzlaff und K. Foerster. Urban und Fischer, München 2000, 505–522 8 Foerster, K.: Die Kausalitätsbeurteilung bei funktionellen psychischen Störungen nach Unfällen. In: Psychische Störungen und die Sozialversicherung – Schwerpunkt Unfallversicherung. Hrsg. E. Murer. Stämpfli, Bern 2002, 117–140 9 Green, B.: Psychosocial research in traumatic stress: an update. J Traumatic Stress 7, 341–362 (1994) 10 Harvey, A. G., R. A. Bryant: Memory for acute stress disorder symptoms: a two-year prospective study. J Nerv Ment Dis 188, 602–607 (2000) 11 Henningsen, F.: Traumatisierte Flüchtlinge und der Prozeß der Begutachtung. Psyche – Z Psychoanal 57, 97–120 (2003) 12 Kessler, R. C., A. Sonnega, E. Bromet, M. Hughes, C. B. Nelson: Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity study. Arch Gen Psychiat 52, 1048–1060 (1995) 13 Kunzke, D., F. Güls: Diagnostik einfacher und komplexer posttraumatischer Störungen im Erwachsenenalter. Psychotherapeut 48, 50–70 (2003) 14 Leonhardt, M.: Wie ist eine Kausalitätsbeurteilung im sozialen Entschädigungsrecht möglich? MedSach 98, 188–193 (2002) 15 Leonhardt, M.: Psyche und Trauma: Eine Einführung. In: Psychische Störungen und die Sozialversicherung – Schwerpunkt Unfallversicherung. Hrsg. E. Murer. Stämpfli, Bern 2002, 58–71 16 Moreau, C., S. Zisook: Rationale for a posttraumatic stress spectrum disorder. Psychiatr Clin North Am 25, 775–790 (2002) 17 Peters, L., T. Slade, G. Andrews: A comparison of ICD-10 and DSMIV criteria for posttraumatic stress disorder. J Traumatic Stress 12, 335–343 (1999) 18 Pitman, R. K., F. S. Sparr, L. S. Saunders, A. C. McFarlane: Legal Issues in Posttraumatic Stress Disorder. In: Traumatic Stress. The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society. Hrsg. Beassel A. van der Kolk; Alexander C. McFarlane, Lars Weisaeth. Gilford Press, London 1996, 378–397 19 Sass, L. A., R. l. Woolfolk: Psychoanalysis and the hermeneutic turn: a critique of „Narrative truth and historical truth“. J Am Psychoanal Ass 36, 429–454 (1988) 20 Schnyder, U.: Die psychosozialen Folgen schwerer Unfälle. Steinkopf, Darmstadt 2000. 21 Stoffels, H., C. Ernst: Erinnerung und Pseudoerinnerung: Über die Sehnsucht Traumaopfer zu sein. Nervenarzt 73, 445–451 (2000) 22 Van Velsen, C., C. Gorst-Unsworth, S. Turner: Survivors of torture and organized violence: demography and diagnosis. J Traumatic Stress 9, 181–193 (1996) Buchbesprechungen Ärztliches Berufsrecht Ausbildung – Weiterbildung – Berufsrecht Von H. Narr (Begr.) Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2. Auflage mit der 15. Ergänzungslieferung, Stand: 1. Januar 2002, 1760 Seiten, Loseblattwerk in zwei Ordnern, 74,95 a, ISBN 37691-3028-6 Das nunmehr von dem Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. jur. Reiner Hess, und dem Justitiar der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Horst-Dieter Schirmer, bearbeitete Werk sichert auch in der 2. Auflage seinen begründeten Ruf als „Standardwerk des Ärztlichen Berufsrechts“. Die umfassenden beruflichen Erfahrungen der Autoren, aber auch ihre in vielen Veröffentlichungen ausgewiesene Fähigkeit, praktische MED SACH 99 (2003) No 5 Fragen wissenschaftlich aufzubereiten und einer rechtlich abgesicherten Beantwortung zuzuführen, rechtfertigen schon vorab die uneingeschränkte Empfehlung insbesondere – aber nicht nur – für freiberuflich tätige Ärzte, Krankenhausärzte, Ärzteorganisationen, Krankenkassen, Krankenversicherer, Verwaltungsbeamte und Richter, um nur einige zu nennen. In drei Kapiteln (Ausbildung zum Arzt – Weiterbildung der Ärzte – Berufsausübung) und insgesamt 25 größeren bis großen Unterabschnitten werden alle wesentlichen Fragen, die das ärztliche Berufsrecht und die sie anwendende Praxis stellen, übersichtlich, klar und informativ dargestellt. Als Loseblattwerk ist die notwendige Aktualität gesichert, wie z. B. der im 2. Kapitel eingefügte neue Abschnitt zur Anerkennung der Weiterbildung mit dem Recht zum Führen einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung zeigt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Anerkennungs- und Prüfungsverfahren zur Erlangung dieser Weiterbildungsbezeichnungen. Den umfangreichsten Teil bildet jedoch – worauf in dieser Zeitschrift besonders hinzuweisen ist – die neugefasste ausführliche Darstellung zu den Anstellungsbedingungen der angestellten Ärzte, den Chefarztverträgen und der Privatliquidation sowie der beruflichen Kommunikation und zum kollegialen Verhalten im 3. Kapitel. Der Preis ist bei 1760 Seiten nahezu schon erstaunlich gemäßigt und wohl nur darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage entsprechend groß ist, und dies zeigt wiederum, wie eingangs erwähnt: es ist ein Werk, das eigentlich jedem Arzt, sei es in freier Praxis als auch im Krankenhaus, zur Verfügung stehen müsste. Also: es ist wirklich das Standardwerk. O. E. Krasney, Kassel 155