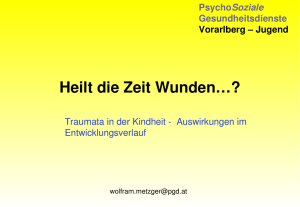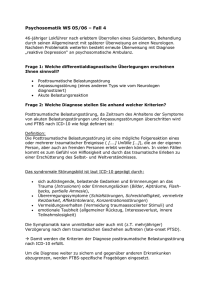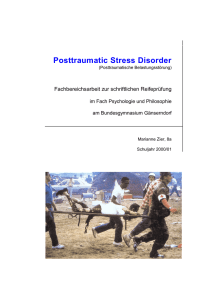Birgit Schattner (PDF
Werbung
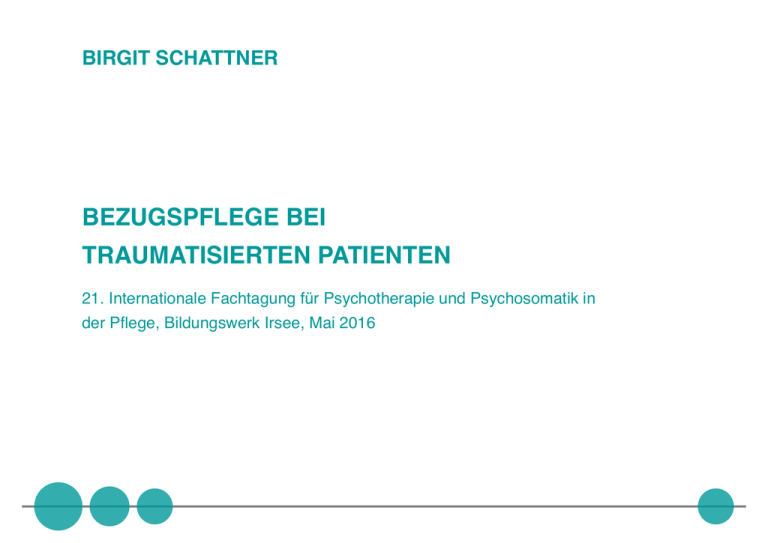
BIRGIT SCHATTNER BEZUGSPFLEGE BEI TRAUMATISIERTEN PATIENTEN 21. Internationale Fachtagung für Psychotherapie und Psychosomatik in der Pflege, Bildungswerk Irsee, Mai 2016 AUFHEBUNG Sein Unglück ausatmen können tief ausatmen so dass man wieder einatmen kann und vielleicht auch sein Unglück sagen können in Worten die zusammen hängen und Sinn haben und die man selbst noch verstehen kann und die vielleicht sogar irgendwer auch verstehen kann oder verstehen könnte und weinen können dass wäre schon fast wieder Glück. Erich Fried WAS IST EIN TRAUMA? Trauma (nach Fischer, Riedesser) nicht erwartbares Ereignis bzw. außergewöhnliche Belastung, die das Selbst und das Weltbild im Leben eines Menschen erschüttert extrem bedrohliche Ereignisse können ein Trauma auslösen z.B. Naturkatastrophen, Verkehrsunfälle, Kriege, Vergewaltigung, plötzlicher Verlust einer Bezugsperson usw. gleiche Ereignisse wirken nicht auf alle gleich traumatisierend nicht jede Traumatisierung löst eine PTSD aus POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG (PTSD) PTSD (Posttraumatic stress disorder) ist eine Traumafolgestörung drei Leit-Symptome für eine PTSD Diagnose • unwillkürlich auftretende und überflutende Erinnerungen an das Ereignis • Flashbacks • Albträume • Intrusionen • Konstriktion (Vermeidung von Reizen und Erfahrungen, die Erinnerungen an das Trauma auslösen) • übermäßige Nervosität und Schreckhaftigkeit UNTERSCHEIDUNG PTSD – TYP 1 UND TYP2 TYP 1 – Monotraumatisierung Störung durch ein einmaliges, plötzliches und unvorhergesehenes Ereignis • apersonal wie z.B Naturkatastrophen, Verkehrsunfälle usw. • personal wie z.B. Vergewaltigung, plötzlicher Verlust einer Bezugsperson TYP 2 – komplexe Traumatisierung Störung durch chronische, kumulative oder sich immer wiederholende Ereignisse z.B. Kriegsereignisse, Folter, Geiselnahme oder persönliche Nahbereich z.B. Kindesmissbrauch, Vernachlässigung, Bindungsstörungen usw. PSYCHISCHE REAKTIONEN AUF EIN TRAUMATISCHES ERLEBNIS • • • • • • • Gefühl von Betäubung Überforderung und Unruhe Hilflosigkeit und Schutzlosigkeit Verwirrtheit und Kontrollverlust Rückzug Überaktivität Todesangst Wenn Bindung und Sicherheit im Bezug zum Selbst und zur Welt gut verankert sind • psychische Reaktionen klingen im Laufe von Tagen wieder ab • Erlebnis wird selbstständig psychisch verarbeitet • Erlebnis wird als Teil des eigenen Lebens erinnert und integriert Wenn dies nicht gelingt, kann es zu einer PTSD kommen MÖGLICHE FOLGE-ERKRANKUNGEN EINER PTSD • Depressionen • Aggressionsausbrüche • Alkohol- oder Drogenkonsum • Zwänge (z.B. Waschzwang) • komplexe PTSD DIS: dissoziative Identitätsstörung DISSOZIATIVE IDENTITÄTSSTÖRUNG Begriffsklärung DSM-IV • Anwesenheit von zwei oder mehr unterscheidbaren Identitäten oder Persönlichkeitszuständen • mindestens zwei dieser Identitäten übernehmen wiederholt die Kontrolle über das Verhalten der Person • es besteht „Zeitverlust“, d.h. verschiedene wichtige persönliche Informationen und Erlebnisse werden nicht erinnert • die Störung ist nicht körperlich verursacht STÖRUNGEN IN DER REGULATION VON AFFEKTEN/IMPULSEN • Affektregulation • Umgang mit Ärger • Selbstverletzung / Selbstbeschädigung • Suicidalität • Störungen der Sexualität • Excessives Risikoverhalten STÖRUNGEN DER WAHRNEHMUNG ODER DES BEWUSSTSEINS • Amnesien • Vorübergehende dissoziative Episoden und Depersonalisierung • Wirkungslosigkeit • Stigmatisierung • Schuldgefühle • Scham • Isolation • Bagatellisierung • Fehlende Zukunftsperspektiven • Verlust von persönlichen Grundüberzeugungen STÖRUNGEN IN DER BEZIEHUNG ZU ANDEREN MENSCHEN • Unfähigkeit zu vertrauen • Reviktimisierung • Viktimisierung anderer Menschen SOMATISIERUNG • Somatoforme Beschwerden • Hypochondrische Ängste CO MORBIDITÄT VON PTSD • Depression • Essstörung • Panikstörung • Persönlichkeitsstörung, Borderline • Manisch-depressive Erkrankungen • Süchte • Somatoforme Schmerzstörung PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER PTSD - 1 • Erkennen einer Gefahr löst im Gehirn eine Art Alarmstaffel aus • Breitstellung der Möglichkeit zur Rettung (Flucht oder Kampf) Trauma • weder Flucht noch Kampf möglich • Supergau für die Amygdala • alles ist bereitgestellt und doch hilft nichts • Alarmbild in der Hirnrinde, das sich in der Amygdala einprägt (gedrückter Klingelknopf, der stecken bleibt) • erhöhte Sensibilität • Alarmglocke reagiert auf kleinste Auslöser PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER PTSD - 2 Höchstbelastung führt im Gehirn zu • Brocasches Sprachzentrum kann Information nicht in Worte fassen • Information bleibt als einzelne Datei unsortiert liegen (flashbacks) • keine Weitergabe an linke Gehirnhälfte • keine Einordnung in die bewusste Biographie • Veränderung des Gehirn (Verbindungen, die häufig benutzt werden, nehmen an Größe zu, vernachlässigte Regionen verkleinern sich • dauerhafte Alarmbereitschaft verstärkt sämtliche Verbindungen des • „Supergau“-Alarmkreises • Abnahme der Verbindung zum Hippocampus sowie den bewussten Zentren der linken Gehirnhälften • Höchstalarm-Schaltkreis wird zur Norm GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK 1998 / Deutschland • Beachtung der Folgen traumatischer Erlebnisse mit dem schweren Zugunglück in Eschede / Herr Fischer und Herr Riedesser betreuten mit ihren Teams die Verletzten, Augenzeugen, aber auch Helfer • erster internationaler Kongress der Psychotraumatologie in Köln 1970 / USA • Diskussion der psychischen Folgen durch den Vietnamkrieg • psychischen Folgen der Kriegserlebnisse wurden erstmalig als Krankheitsbild anerkannt traumatisierte Soldaten wurden in Deutschland wenig anerkannt und als „Кriegszitterer“ bezeichnet oder als Rentenbegehrer diskriminiert GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK UND KLASSIFIKATIONSSYSTEM Einfluss der Frauenbewegung (ausgehend von den USA) öffentliche Diskussion über sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder auch in Deutschland 1980 / Deutschland auf Grundlagen empirischer Ergebnisse aus der Forschung an Kriegsveteranen und KZ-Überlebenden erstmalige Aufnahme der PTSD in das Klassifikationssystem DSM-III Heute Definition der PTSD in den Krankheitsklassifikationen DSM-IV und ICD-10 AUFBAU UND STRUKTUR IM TRAUMASETTING • feste Bezugsperson mit einer Vertretung • zwei mal pro Woche Bezugsgespräch • Vorausplanung in größeren Zeiträumen • enger Austausch mit der Einzel- und Gruppentherapeuten • ausführliche Dokumentation über Notfallkoffer, Ressourcen, Trigger usw. • Ausweitungen des Datenschutzes • Begleitung bei ärztlichen Untersuchungen oder Behördengängen • Planung der Entlassung (Therapieplatz, Wohnung, Arbeitsplatz, usw.) AUFGABEN DER BEZUGSPFLEGE • ausführliches Pflegeanamnese-Gespräch mit Fokusierung auf Ressourcen • geschützten Raum bieten • Fokus auf der Selbstfürsorge und dem Selbstschutz • individuelle Stabilisierungen • individuelle Dissoziations-Stopps • individuelle Imaginationen • Alternativen für Selbstverletzendes Verhalten finden BEZUGSARBEIT WÄHREND DER TRAUMAKONFRONTATION • evtl. Bezugsgespräche auf tägliche Kurzkontakte umstellen • Vor- und Nachbereiten der Trauma-Expositionssitzung • Meldezeiten für zusätzliche Sicherheit • fehlende Selbstversorgung vorbeugen (Nahrung, Medikamente, usw.) • Vermittlung bei vorübergehender Täterübertragung AUSTAUSCH INNERHALB DES THERAPEUTISCHEN TEAMS • tägliche Teambesprechungen • ausführliche Dokumentation • monatliche Team-Supervision • wöchentlicher Pflegefokus • monatliche Balintgruppe • tägliche Übergaben • innerbetriebliche Fortbildungen • Fortbildung zur Traumafachberater/in RESSOURCENARBEIT • vielfältige und individuelle Nutzung der Ressourcen • individuelle Ausgestaltung der Stabilisierungsmethoden • Einbeziehung aller Sinne • Erlernen imaginativer Techniken und deren individuelle Ausgestaltung • zur Verfügung stellen der eigenen Kreativität und Phantasie STANDARDIMAGINATIONEN Entlastung Gepäck ablegen Auftanken und Ausruhen Baumübung und innerer Garten Schutz und Sicherheit innerer sicherer Ort und Tresor Unterstützung innerer Helfer Körperwahrnehmung und Schmerzbekämpfung Lichtstromübung ERSCHEINUNGSFORMEN DISSOZIATIVER STÖRUNGEN • Amnesie • dissoziative Fugue • Depersonalisiserung • Derealisiation • Identitätsunsicherheit • Identitätswechsel VORGEHEN BEI DISSOZIATIVEN STÖRUNGEN • Beruhigung, Reorientierung im Hier und Jetzt • Ansprechen und Erklären wer man ist und wo man ist • Datum nennen, WICHTIG die Jahreszahl • Orts-, Lage- und Themenwechsel • Aufforderung in Bewegung zu kommen • verschiedene Sinne ansprechen (Coldpack, Riechfläschchen, Klingel …) • Gespräch über allg. Dinge führen, KEINE inneren Themen ansprechen • körperlicher Kontakt NUR wenn es vorher vereinbart wurde BEZUGSARBEIT VOR DER ENTLASSUNG • frühe Abklärung der Wohn- und Arbeitssituation • individuelle Notfallplanung für Krisensituationen im Alltag • individuelles Hilfsnetz erarbeiten • Hilfe bei der Suche nach ambulanten TherapeutInnen • Liste mit wichtigen Adressen (Traumahilfezentrum, FTZ, usw.) • eventuell Üben von Kontakten im Rollenspiel • soziales Kompetenztraining PROCEDERE DER AUFNAHME UND PLANUNG DER BELEGUNG • Beachtung der Gruppen-Zusammensetzung • Beachtung der Belastungsgrenzen in der Gruppe und im Team • Planung der Zimmersituation • Planung der Bezugspflege ERSTELLUNG DER PFLEGEANAMNESE • Vorstellen des Bezugssystems und der Stationsregeln • Stundenplan erklären • Urlaube ankündigen (Transparenz WICHTIG!) • Datenerhebung (VORSICHT! Grenze wahren und auf Belastung achten) • Ressourcen erfragen und Würdigung der bisherigen Bewältigungsstrategien • Problematiken klären „Auf was müssen sie achten?“ (dysfunktionales Verhalten) • Psychoedukation (Erklären der Symptome, Verhaltensweisen usw.) • Formulierung der Ziele • Schaffung eines Arbeitsbündnisses INNERE SICHERHEIT Maximaler Kontrast zur traumatischen Situation als Grundprinzip (W. Wöller) • Verlässlichkeit • vorhersagbare Abläufe • Auftrag und Ziele gemeinsam besprechen • Autonomie und Selbstwirksamkeit beachten und Stärken • Stressreduktion • Aufbau Notfallmanagment, Notfallkoffer • stabilisierende imaginative Techniken • klare Grenzen zwischen PatientInnen und Bezugspflege ÄUSSERE SICHERHEIT • Regeln z. B. über traumatische Erlebnisse nur im geschützten Raum sprechen • Pförtnersperre • besondere Besucherregelung • Datenschutz UMGANG MIT FLASHBACKS – PRAXIS • Orientierung im Hier und Jetzt • Aufmerksamkeit und Sinneswahrnehmung nach Außen lenken z.B. Gegenstände beschreiben lassen, Tierketten bilden, usw. • Wechsel von Körperhaltung und Raumsituation • Notfallkoffer UMGANG MIT DISSOZIATIONEN – ALLGEMEIN In dissoziativen Zuständen kann nichts aufgenommen, oder verarbeitet werden! • Dissoziation verhindern • Stress reduzieren • innere und äußere Trigger achtsam wahrnehmen und Vorboten erkennen Ziel: Affekttoleranz und Umgang mit Affekten erlernen UMGANG MIT DISSOZIATIONEN – PRAXIS • Reorientierung • Ansprache • Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt holen Orientierung und Erklärungen geben (wo man ist, wer man ist, Datum, Uhrzeit) • Ortswechsel, Lagewechsel, Themenwechsel • Vorsicht mit körperlicher Berührung! • Umgang mit ANP (anscheinende normale Persönlichkeit) und EP (emotionale Persönlichkeitsanteile) UMGANG MIT SELBSTVERLETZENDEM VERHALTEN Selbstverletzendes Verhalten wird zur Emotionsregelung eingesetzt. • andere Möglichkeiten zur Emotionsregelung erlernen (Notfallkoffer, Ressourcenarbeit) • Absprachen über Verträge • Absprache über Versorgung der Wunden (selbstständig, beim Pflegepersonal, Nothilfe) • Differenzieren, was der auslösende Moment war und wo hätten die PatientInnen noch eine Alternative gehabt • Absprache über „Schneidewerkzeug“ im Zimmer • Schutz des Milieus (kein Schneiden in öffentlichen Räumen, Tragen von langen Ärmeln, Verdecken von Wunden usw. ) ÜBERTRAGUNG – TEIL 1 unbewusste Wiederholung vergangener Beziehungserfahrungen und gewissermaßen Verschiebung der dazugehörigen Affekte, Wünsche und Erwartungen auf Personen der Gegenwart • traumatisierte Menschen nehmen Nähe sowie Distanz als Bedrohung wahr • aktuelle Bezugspersonen können verzerrt wahrgenommen werden • es kommt leicht zu Retter-Opfer-Täterdynamik • Macht und Ohnmacht PatientInnen erleben das Team als machtvoll, kontrollierend sich selbst als ohnmächtig und ausgeliefert, oder umgekehrt • Täterübertragung PatientInnen versuchen das Team zu beruhigen und alles richtig zu machen, aus Angst vor Übergriff und Strafe ÜBERTRAGUNG – TEIL 2 • Parentifizierung PatientInnen sorgen sich um die Bezugsperson • Idealisierung Bezugskraft wird als omnipotente RetterIn erhöht • Übertragung des wegschauenden Elternteils wir wissen, aber greifen nicht ein • Versuch Sonderrolle einzunehmen Verführung zu einer besonderen Beziehung • Flashback-Übertragung Bezugsperson kann durch Stimme oder Kleidung triggern GEGENÜBERTRAGUNG – TEIL 1 Alle Emotionen, Wünsche, Erwartungen, Körperempfindungen und Handlungsimpulse, die in uns im Kontakt mit unseren PatientInnen entstehen. • Mitgefühl, Mitleid • Wut auf Täter und Aktion gegen den Täter • Fürsorge-Impuls bis Retter-Impuls • Ohnmacht, Hilflosigkeit und Resignation • Versagensängste, Gefühl der Inkompetenz • Zweifel an der Geschichte und den Erlebnissen der PatientInnen • sexuelle Fantasien und Handlungsimpulse GEGENÜBERTRAGUNG – TEIL 2 • Faszination • Schuldgefühle, etwa bei berechtigten Grenzsetzungen • Schamgefühle • Gefühl manipuliert oder missbraucht zu werden • Übernahme von Gefühlen und Emotionen der PatientInnen MÖGLICHKEITEN DER BEWÄLTIGUNG FÜR UNS SELBST UND DAS TEAM • gutes Klima im Team, Kontakt und Unterstützung von KollegInnen, Wertschätzung • regelmässiger Austausch im Team • Traumainhalte nicht im Gesamt-Team besprechen • Supervision • Fortbildung • eigene Ressourcen nutzen • gute Selbsthygiene (Hobbys, Imaginationen, …) • Wahrung von Grenzen, der Struktur und von Vereinbarungen • Gegenübertragungsgefühle bewusst machen EMPFOHLENE LITERATUR – TEIL 1 Herausgeber: Huber, Dorothea und von Rad, Michael. Störungsorientierte psychodynamische Therapie im Krankenhaus. Kohlhammer, Stuttgart 2010. Biberacher, Marlene; Dittmar, Volker; Wolf-Schmid, Regina; Beckrath-Wilking, Urlike. Traumafachberatung, Traumatherapie und Pädagogik Junfermann, Paderborn 2013. Huber, Michaela. Trauma und die Folgen. Junfermann, Paderborn 2009. Fischer, Gottfried; Riedesser, Peter. Fachbuch der Psychotraumatologie. UTB, Stuttgart 2009. Reddemann, Luise; Dehner-Rau, Cornelia. Trauma. Trias, Stuttgart 2006. Reddemann, Luise. Imagination als heilsame Kraft. Klett, Stuttgart 2001. Wöller, Wolfgang. Trauma und Persönlichkeitsstörungen: Psychodynamischintegrative Therapie. Schattauer, Stuttgart 2006. EMPFOHLENE LITERATUR – TEIL 2 Sachsse,Ulrich. Selbstverletzendes Verhalten: Psychodynamik – Psychotherapie. Das Trauma, die Dissoziation und ihre Behandlung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002. Reemtsma, Jan Philipp. Im Keller. Rowohlt. Reinbek 1998. Huber, Michaela. Der innere Garten. Junfermann, Paderborn 2010. Huber, Michaela. Viele sein – ein Handbuch, Komplextrauma, dissoziative Identität verstehen, verändern, behandeln. Junfermann, Paderborn 2011. Reddemann, Luise. Psychodynamische imaginative Traumatherapie – PITT. Klett, Stuttgart 2010. Boon, Suzette; Steele, Kathy; van der Hart, Onno. Traumabedingte Dissoziation bewältigen. Junfermann, Paderborn 2013.

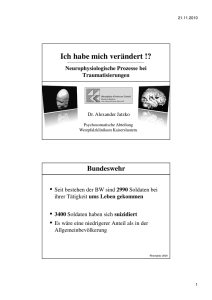
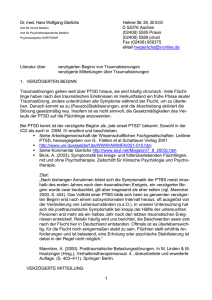


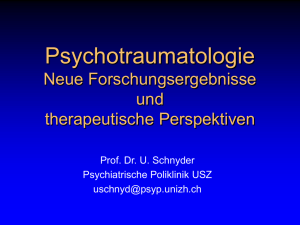
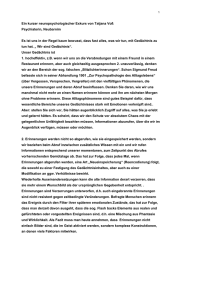
![Bosse_2016_OEG-Seminar Anerkennung von P[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/003324767_2-a96191ddceda7293f3f2f695b9db034f-300x300.png)