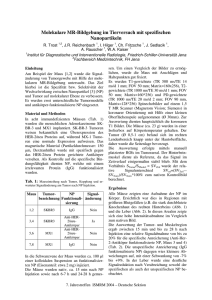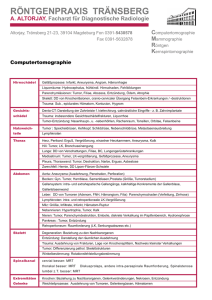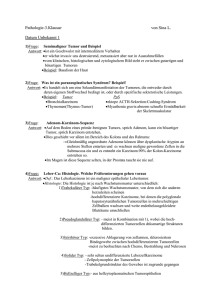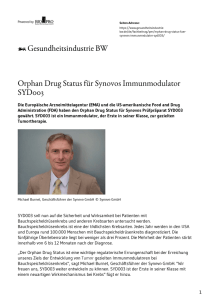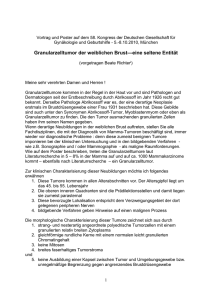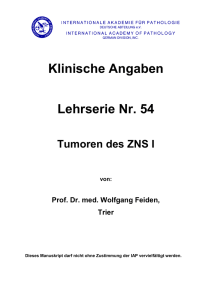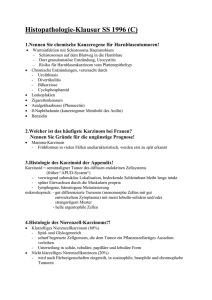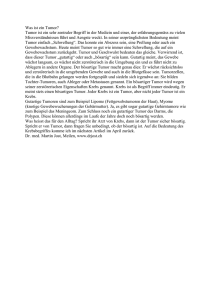Software-Assistenten für Radiologen
Werbung

Strahlendiagnostik Software-Assistenten für Radiologen Wie Mediziner aus Schnittbildern Informationen über Organstrukturen gewinnen Es könnte eine Szene aus dem Science-Fiction-Film „Phantastische Reise“ sein: Ein Arzt „fliegt“ durch den Dickdarm eines Patienten und betrachtet so das Organ von innen. Ein Endoskop, mit dem er in den Patienten eindringen müsste, braucht er dazu nicht – der Flug wird am Bildschirm simuliert und durch die Computermaus gesteuert. Szenenwechsel. Ein Chirurg muss einen Tumor aus der Leber seines Patienten operieren. Er weiß genau, wo die Geschwulst sitzt und wie groß sie ist. Weil er schon vor der Operation vom Computer genau ins Bild gesetzt wurde, kann er gezielt schneiden und den Tumor präzise herausoperieren. Für den Patienten heißt das: Die Operation dauert gerade so lang wie nötig, die Schnittwunde bleibt so klein wie möglich. Das klingt nach Zukunftsmusik, und doch können Ärzte heute schon mit der „virtuellen Endoskopie“ und der Operationsplanung am Bildschirm arbeiten. Zwei Radiologen der Philipps-Universität waren entscheidend an der Entwicklung solcher Computer-Hilfsmittel beteiligt: Professor Klaus Jochen Klose, Leiter der Klinik für Strahlendiagnostik am Medizinischen Zentrum für Radiologie, und Dr. Ronald Leppek, Oberarzt in derselben Abteilung. entstehen Aufnahmen mit der neueren Magnetresonanz-Tomographie (MR), die allerdings nicht mit Röntgenstrahlen, sondern mit einem starken Magnetfeld arbeitet. Immer mehr Schnittbilder in immer kürzerer Zeit Auf der normalen CT-Aufnahme der Leber (o.) sind nur ihre Umrisse und hell gefärbte Gefäße zu erkennen. Einzelne Lebersegmente (u.) werden erst sichtbar, nachdem eine Software aus den ursprünglichen Aufnahmen die Lebersegmente errechnet und farbig dargestellt hat. „Virtuelles“ Institut Zurzeit arbeiten die beiden Röntgenspezialisten in einem hochkarätigen Forschungsprojekt mit, in dessen Verlauf solche Werkzeuge für Mediziner verbessert und weiterentwickelt werden sollen. „VICORA“ heißt das interdisziplinäre Programm – die griffige Abkürzung steht für „Virtuelles Institut für Computerunterstützung in der klinischen Radiologie“. „Virtuell“ weil die Mitglieder des Instituts über halb Deutschland verteilt sind: Außer Marburg sind drei weitere Universitäten an dem Forschungsverbund beteiligt, zudem zwei Bremer Krankenhäuser, die Firmen Siemens und MeVis-Technology und das Bremer Institut für „Medizinische Diagnosesysteme und Visualisierung“, kurz „MeVis“ genannt. „Das Projekt hat den Status eines Sonderforschungsbereichs“, betont 30 Dr. Leppek. Das Bundesforschungsministerium bewilligte im vergangenen November acht Millionen Mark für die kommenden drei Jahre. In dieser Startphase werden die Mediziner in Zusammenarbeit mit Informatikern, Mathematikern und Experten aus der Industrie die Methoden der digitalen Röntgendiagnostik weiterentwickeln und in klinischen Studien erproben. Die Universitäten haben dabei je unterschiedliche Forschungsschwerpunkte, wie Mammographie oder Lebertransplantation. In Marburg werden Anwendungen bei Tumoren, Leber-, Lungen- und Gefäßerkrankungen erforscht. Am Ende sollen so genannte „SoftwareAssistenten“ für Radiologen als marktfähige Produkte stehen. Um Knochen und Gelenke sichtbar zu machen, hat sich die gut hundert Jahre alte projektive Röntgentechnik bis heute bewährt: Die Strahlen einer Röntgenquelle durchqueren den Körper und zeichnen ein „Schattenbild“ des Skeletts auf einen Film. Weil Organe wie das Gehirn oder die Leber bei dieser Technik kaum Spuren auf dem Film hinterlassen, wurde seit Mitte der siebziger Jahre die Computer-Tomographie (CT) entwickelt. Bei ihr umkreist ein Röntgenstrahler den Patienten, der in einer Röhre liegt, und ein gegenüberliegender Sensor misst, wie viel Strahlung bei ihm ankommt. Aus diesen Informationen errechnet der Computer eine Serie von Schnittbildern. Ähnlich CT und MR haben sich in den letzten Jahren allerdings so fortentwickelt, dass sie immer mehr Schnittbilder in immer kürzerer Zeit liefern – bei einer Untersuchung der Brust, einer MR-Mammographie, können das mehrere hundert Bilder sein, die der Arzt anschließend am Leuchtkasten betrachten muss. Solche Datenmengen von Hand und mit dem Kopf auszuwerten ist jedoch zeitraubend und teuer. „Kollege Computer“ ist daher gefragt. Nur er kann aus dem Datenwust die entscheidenden Informationen herausarbeiten, die beim bloßen Betrachten der Bilderflut unterzugehen drohen. Doch selbst die gängigen Methoden der Bildverarbeitung sind dieser Datenfülle nicht mehr gewachsen. Um die ganze Informationstiefe der Schnittbilder auszuschöpfen, braucht es leistungsfähigere Bildbearbeitungswerkzeuge als bisher – das ist der Forschungsauftrag von VICORA. Zwar gibt es schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, zweidimensionale Schnittbilder digital nachzubearbeiten und etwa dreidimensional darzustellen. Doch das war bislang teuer und zeitaufwendig und wurde im klinischen Alltag nur selten eingesetzt. Außerdem hatten die bisherigen 3D-Darstellungen ihre Grenzen. Sie konnten etwa das Innere von Organen nicht sichtbar machen. Der VICORA-Forschungsverbund arbeitet nun daran, solche Programme zu verbessern. Dabei fangen die Forscher allerdings nicht bei Null an. Die ersten Verfahren, Informationen aus den Schnittbildern herauszuholen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, haben die beiden Marburger Radiologen zusammen mit Informatikern und Mathematikern bereits entwickelt. Die Computerspezialisten arbeiten in Bremen bei MeVis, das als Kerninstitut des Projekts VICORA fungiert. Gemeinsam gelang es ihnen, ein Problem zu lö- Strahlendiagnostik sen, das in der Leberchirurgie eine große Rolle spielt. Wie viele andere Organe setzt sich die Leber aus verschiedenen Segmenten zusammen. Abbildungen in medizinischen Lehrbüchern zeigen diesen Aufbau. Doch dort ist nur das Grundprinzip zu sehen – in Wirklichkeit liegen die Segmente keineswegs bei allen Menschen genau gleich. Für den Chirurgen aber ist es wichtig, die Anatomie seines individuellen Patienten zu kennen, damit er genau weiß, wo er schneiden muss. Bisher musste er sich anhand von Schnittbildaufnahmen eine räumliche Vorstellung vom Aufbau des Organs machen. Aber wenn er den Bauch öffnet, verrät kaum ein Zeichen an der Oberfläche der Leber, wo ein Segment aufhört und das nächste beginnt. Bislang kann auch keine radiologische Technik deren Grenzen sichtbar machen. Computerprogramme errechnen unsichtbare Strukturen Bekannt ist aber dies: Jedes Lebersegment wird von einem anderen großen Zweig der Pfortader mit Blut versorgt. Diese Regel stimmt immer, denn die Segmente sind über die Blutversorgung definiert. Doch es ist schwierig, sich anhand von „flachen“ Röntgenaufnahmen eine Vorstellung davon zu machen, wie die Adern verlaufen und sich verzweigen. Hier kann der Computer helfen. Er wird mit den riesigen Datenmengen gefüttert, die der Computer-Tomograph oder der Magnetresonanz-Tomograph nach einem „Leber-Scan“ liefert. Für die Aufnahme hat der Patient ein Kontrastmittel erhalten, das die Gefäße hervorhebt. Sie zeigen also etwas andere Grauwerte als das Gewebe der Umgebung, und so zeichnet der Computer den Verlauf der Gefäße nach: Er beginnt an einem Punkt, der eindeutig zu einer Ader gehört. Anschließend untersucht er alle Nachbarpunkte. Weicht der Grauwert eines Punktes zu stark ab, folgert der Rechner, dass die Ader nicht in diese Richtung weitergeht. Liegt der Grauwert dagegen innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs, schlägt der Rechner ihn der Ader zu und sucht von hier aus weiter. So arbeitet er sich langsam in alle Richtungen vor, wobei er stets aufhört, sobald er irgendwo nicht weiterkommt. Das erfasste Aderngeflecht „wächst“ regelrecht – Fachleute sprechen von „region growing“. Die neuen Computerverfahren schaffen es auch, die verschiedenen Zweige der Pfortader auseinanderzuhalten, was ja die Voraussetzung für die Unterscheidung der verschiedenen Lebersegmente ist. Irgendwann allerdings wird die Verästelung der Adern so fein, dass sie selbst mit modernsten Tomographen nicht mehr zu erfassen ist. „Bis zur dritten, vierten Verzweigungsstufe sind die Gefäße zu sehen“, sagt der MeVis-Informatiker Dr. Dirk Selle, mit dem Leppek seit fünf Jahren eng zusammenarbeitet. „Bei allem, was darüber liegt, bleibt nur eines: berechnen, wie das Aderngeflecht weitergehen müsste.“ Glücklicherweise ist das möglich. Denn Adern verzweigen sich nicht zufällig. Sie gehorchen den Grundsätzen der fraktalen Geometrie. Der Grundgedanke dieser Theorie ist einfach: Viele Strukturen in der Natur sind selbstähnlich – das immer wieder gleiche Muster wiederholt sich in verschiedenen Größendimensionen. Eine Luftaufnah- me von ganz England zeigt eine Küstenlinie mit zahlreichen Buchten. Betrachtet man diese großen Buchten näher, zeigt sich, dass sie aus kleineren Buchten bestehen, die sich ihrerseits wieder in kleine Buchten untergliedern. Ein Baumstamm verzweigt sich in einige große Äste, diese wiederum in weitere Äste, die wie getreue Verkleinerungen der großen aussehen. Genauso machen es auch die Adern, und deshalb lassen sich mit Hilfe der fraktalen Geometrie Äderchen berechnen, die kein medizinisches Gerät erkennen kann. „Die Berechnungen gehen über die Originaldaten der Schnittbilder hinaus“, erläutert Dirk Selle die Arbeitsweise der neuen Programme. Sobald die Verteilung der Aderngeflechte feststeht, ist auch die Position der Lebersegmente klar, da sie ja bis in den letzten Winkel von den Adern durchzogen werden. Die Forscher haben ihr Verfahren an Leberpräparaten von Leichen getestet und festgestellt, dass die errechnete Anatomie gut mit der tatsächlichen übereinstimmt. Das interdisziplinäre Teamwork bei MeVis kommt nicht von ungefähr. Leiter des Instituts ist Professor Heinz-Otto Peitgen, ein renommierter Mathematiker und Spezialist für fraktale Geometrie und Chaostheorie. Die fraktale Struktur von Bäumen hatte es Forschern wie ihm immer schon angetan. Dass sein Team sich für die ähnlich aufgebauten Blutbahnen oder Luftwege in der Lunge interessieren könnte, lag nahe. Doch erst durch die Zusammenarbeit mit dem Marburger Radiologen Klaus Jochen Klose nahm die Idee zu den Forschungsvorhaben Gestalt an, die VICORA nun bearbeitet. „Zwei visionäre Forscher haben sich zusammengetan“, beschreibt Leppek die 1991 begonnene Kooperation von Klose und Peitgen. Die beiden sind Mentoren des Programms; Leppek ist der wissenschaftliche Koordinator. Interdisziplinäres Projekt Außer Informatikern und Mathematikern arbeiten Physiker, Elektroniker und ein Arzt bei MeVis. Sie treffen sich regelmäßig mit den beteiligten Medizinern der vier Universitäten und der zwei Krankenhäuser. Die Mediziner haben dann die zuletzt ausgetüftelten Werkzeuge in der klinischen Praxis erprobt und können angeben, was schon gut und was noch gar nicht funktioniert. Grundsätzlich muss „ein medizinisches Problem in ein mathematisches übersetzt werden“, schildert Leppek den Austausch. „Der Mathematiker sagt beispielsweise dem Mediziner: Wenn Du wissen willst, wie vital ein Tumor ist, dann musst Du mir sagen, was der Parameter für Vitalität ist.“ Die Kommunikation klappt nicht immer auf Anhieb, doch die Beteiligten loben einmütig den interdisziplinären Arbeitsstil, der bei VICORA herrscht. „Die Informatiker haben schnell erkannt, dass die Medizin Bedarf an ihren Programmen hat und umgekehrt“, sagt Leppek. Anwendungsreife Programme Was auf keiner normalen Röntgenaufnahme zu sehen ist, macht der Computer sichtbar: Die Leber besteht aus mehreren Segmenten, deren Lage beispielsweise ein Chirurg vor einer Operation kennen muss. Der Rechner zeigt auch die sonst verborgenen Adersysteme, von denen jeweils ein Zweig ein Lebersegment versorgt. Dass die Programme Patienten zugute kommen, dafür sorgen die Mediziner. Die Lebersegmentierung hat sich in der Praxis bereits bewährt und wird an der Medizinischen Hochschule Hannover bei so genannten „Split-liver“-Transplan31 Strahlendiagnostik Auf den zwölf CT-Bildern ist ein Tumor in der Leber als dunkler Fleck zu erkennen. Die Schnittbilder – von links oben nach rechts unten übereinanderliegend zu denken – zeigen seine Ausdehnung in verschiedenen Schnitthöhen. Der Rechner zeichnet die Umrisse des Tumors automatisch ein und errechnet sein Volumen – sehr viel präziser als bisherige Messungen mit dem Lineal. tationen eingesetzt. Dabei spenden Angehörige Leberkranken einen Teil ihrer Leber. Die Teilleber wächst bei Spender und Empfänger wieder nach, sofern sie nicht kleiner als rund ein Drittel des gesamten Organs ist. Wie groß genau die Leber bleibt, nachdem sie geteilt wurde, kann man mit Hilfe der Lebersegmentierungsmethode schon vor der Operation berechnen. Außerdem kann der Chirurg vorher sehen, wie er beide Lebern an den Rändern der Segmente entlang schneiden muss. Er kann die Operation vorher am Bildschirm simulieren. Die neuen Methoden der Bildanalyse bewähren sich auch schon bei der Entfernung von Tumoren aus der Leber. Mit Hilfe eines mathematischen Verfahrens namens Wasserscheiden-Transformation lässt sie die Lage eines Tumors genau bestimmen und als räumliches Gebilde darstellen. Der Betrachter kann dann per Mausklick angeben, welcher Bereich ihn interessiert und welcher nicht – schon lässt der Computer den Tumor aufleuchten, der nun von allen Seiten betrachtet werden kann. Der Arzt kann sich zudem zeigen lassen, ob der Tumor sich zum Beispiel über zwei Segmente erstreckt, die von zwei Gefäßbäumen versorgt werden, oder nur über eines. Da auch Tumorgewebe Blut zum Leben braucht, operiert man heute radikal segmentorientiert und schneidet so eventuell zurückbleibendem Krebsgewebe die Blut32 zufuhr ab. Ein entscheidender Fortschritt in der Tumorchirugie, meint Leppek: „Mit den Software-Werkzeugen kann man den individuellen Organaufbau darstellen, um dem Chirurgen, na, ich will nicht sagen, das Skalpell zu führen, aber ihm doch eine wichtige Hilfe zu geben.“ Der Chirurg kann so besser der heutigen Operationsmaxime folgen: so schonend wie möglich und so radikal wie nötig. Erklärtes Ziel von VICORA ist die Entwicklung anwendungsreifer Techniken, die sich auf dem Markt behaupten. „Mit VICORA sollen sich nicht sechs, sieben Leute habilitieren, sondern die Ergebnisse sollen möglichst vielen Patienten zugute kommen“, beschreibt Leppek das Selbstverständnis. Aus diesem Grund arbeitet die Firma Siemens Medizintechnik von Anfang an mit. „Wir setzen die Werkzeuge so in klinische Arbeitsplätze um, dass die Benutzer damit arbeiten können“, beschreibt der Produktmanager Dr. Gerald Lenz die Aufgabe der Firma. Dazu werden die Ergebnisse von VICORA in SYNGO integriert – die Standard-Software von Siemens, die auf vielen medizinischen Geräten läuft. Quantitative und funktionelle Informationen über Organe Von einer weiteren VICORA-Anwendung werden zunächst hauptsäch- Anhand dieser Aufnahme kann ein Chirurg eine „Split-liver“-Operation – bei der ein Verwandter eines Leberkranken einen Teil seiner Leber spendet – präzise planen. Dazu hat der Computer drei Lebersegmente (re.) farblich unterschieden und vom Rest der Leber abgetrennt. Zugleich macht er die Verzweigungen des Pfortadersystems sichtbar. lich Marburger Patienten profitieren: Ronald Leppek will mit Hilfe des Computers feststellen, wie groß und wie gefährlich ein Tumor ist. Das soll die Verlaufskontrolle bei Krebserkrankungen einen großen Schritt voranbringen. „Wir messen das Volumen von Tumoren bis heute mit dem Lineal“, erläutert er. Dabei ermittelt man bislang einfach den Durchmesser an der dicksten Stelle, die auf einem Schnittbild zu sehen ist. Da ein Tumor aber kein regelmäßiges Gebilde wie eine Kugel ist, konnte man bislang das Volumen der Geschwulst nur grob ausrechnen – eine viel zu subjektive Messmethode. Erst seit der Computer Tumorgewebe von gesundem Gewebe unterscheiden kann, können Ärzte das Volumen einer Krebsgeschwulst wesentlich genauer als bisher berechnen. Auch das ist ein erklärtes VICORA-Ziel: Methoden zu entwickeln, die quantitativ präzise Untersuchungsergebnisse hervorbringen. Nur so können Mediziner künftig effektiver und wirksamer behandeln. Wichtig zu wissen ist aber auch, wie aktiv ein Tumor noch ist. Hat die Behandlung ihn schon getötet, oder lebt er noch? Ärzte sprechen von der „Vitalität“ des Tumors. Sie lässt sich nicht immer aus seiner Form ableiten – es kommt daher darauf an, etwas über die Funktion des Tumors zu erfahren. Solche Fragen stellen sich den Diagnostikern immer öfter. „Die Radiologie bewegt sich vom Bild weg zur Funktion, die Strahlendiagnostik man dem Bild als solchem nicht ansieht“, so Leppek. Daran arbeiten die VICORA-Forscher ebenfalls: computergestützte radiologische Verfahren zu entwickeln, die den Medizinern neben morphologischen auch funktionelle Informationen über die Organe liefern. Die Vitalität eines Tumors lässt sich nur feststellen, wenn ein Computerprogramm neben den Raumdimensionen auch den zeitlichen Verlauf körperlicher Vorgänge erfassen kann. Zum Beispiel, wie ein Tumor Kontrastmittel aufnimmt und wieder abgibt. Ein bösartiger Tumor tut das in der Regel schneller als beispielsweise eine gutartige Geschwulst, ein vitaler Tumor zeigt im Unterschied zu einem abgestorbenen einen regen Stoffwechsel. Kombiniert man diese funktionelle Messung mit der Volumenberechnung, bekommt man Aufschluss darüber, ob der Krebs beispielsweise schon auf eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie anspricht. „Denn es ist ja denkbar, dass ein Tumor zwar abstirbt, aber noch nicht geschmolzen ist. Wenn ich nur die Größe messe, dann sage ich, der Tumor hat gar nicht reagiert“, schildert Leppek den Klinikalltag. Wenn es aber gelänge nachzuweisen, dass der Tumor trotz gleichbleibender Größe unter der Therapie abgestorben ist, könnte man dem Patienten eine aggressive, nebenwirkungsreiche Therapie ersparen. Oder man könnte Patienten ermutigen, bei denen die Behandlung anschlägt – auch das ist bislang noch nicht nachweisbar. Der Arzt könnte begründeter entscheiden, ob er das richtige Mittel verabreicht, ob er die Behandlung umstellen, weiterführen oder gar abbrechen muss. Diese vielen Themen bewältigt Leppek freilich nicht alleine. Zur Marburger Arbeitsgruppe gehören Forscher aus allen Disziplinen: der Onkologe Zugmaier, der Pharmakologe Aigner, der Physiker Heverhagen, der Chirurg Kisker und der Radiologe Alfke. Die Arbeitsgruppe Der Bronchialbaum der Lunge zeigt auf jeder Verzweigungsstufe dieselbe Art der Verästelung. Aufgrund dieser selbstähnlichen Struktur lassen sich die Segmente der Lunge mit Hilfe der fraktalen Geometrie berechnen: Zunächst wird das Skelett der Segmentbronchien (li.o.) und dann ihre volle Größe errechnet (re.o.) Anschließend errechnet der Computer für jeden Punkt der Lunge, zu welchem Segment er gehört (li. u.) und stellt das Resultat – die Lungensegmente – farblich dar. sucht noch weitere Wissenschaftler. Interessierte Mediziner, Physiker und Biologen können sich bei Dr. Leppek melden. Leid und Geld sparen Gezieltere und effizientere Behandlungen würden nicht nur den Patienten unnötige Leiden, sondern den Krankenkassen auch viel Geld sparen, besonders wenn es sich um „Volkskrankheiten“ wie zum Beispiel die Arteriosklerose handelt. Das Heer der Kranken mit solchen Durchblutungsproblemen wird möglicherweise von den neuen Bildanalyse-Methoden profitieren können. Die Marburger haben mit der Suche nach Methoden begonnen, um die Schwere von arteriellen Ver- Dr. Ronald Leppek Oberarzt an der Klinik für Strahlendiagnostik Zentrum für Radiologie Baldingerstraße 35033 Marburg Tel.: 06421 / 28-65937 E-Mail: [email protected] schlusskrankheiten wie der Arteriosklerose festzustellen. Bislang schauen Ärzte danach, wie eng oder weit ein Blutgefäß ist, das durch Ablagerungen verengt wurde. Für den Patienten heißt das: Er bekommt von der Leiste aus einen Katheter in das Blutgefäß geschoben. Doch das Starren auf die Verengung ist gar nicht unbedingt hilfreich, dachten sich die Marburger Forscher und kamen auf die Idee, dort zu untersuchen, wo die eigentlichen Probleme entstehen: in der Muskulatur. Die bekommt durch die Verengung weniger Blut und schmerzt bei Belastung – die so genannte Schaufensterkrankheit ist das bekannteste Beispiel. Wenn der Arzt den Durchblutungsgrad der Muskulatur ermitteln könnte, wäre er besser in der Lage, die angemes- sene Behandlung zu wählen. Oft nämlich entsprechen die subjektiven Beschwerden der Patienten nicht der tatsächlichen Minderdurchblutung. Nicht jeder braucht gleich die stärkste Behandlung. Manchmal reicht es, ein Medikament zu geben, dass das Gefäßwachstum stimuliert. So müsste man nur solchen Patienten die Gefäße mit einem Ballonkatheter weiten oder gar durch eine Operation ersetzen, bei denen dies wirklich nötig ist. Auch zur Diagnose müssten sich die Patienten keinem Eingriff unterziehen, sondern sich nur in die MR-Röhre legen. Gabriele Neuhäuser Prof. Dr. Klaus Jochen Klose Leiter der Klinik für Strahlendiagnostik Zentrum für Radiologie Baldingerstraße 35033 Marburg Tel.: 06421 / 28-66231 E-Mail: [email protected] 33