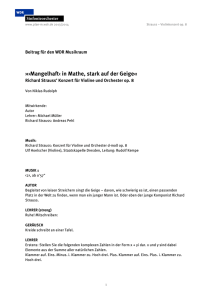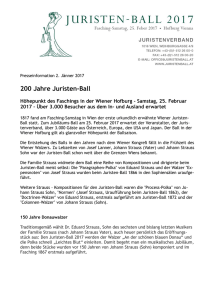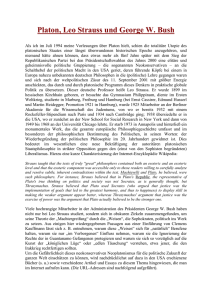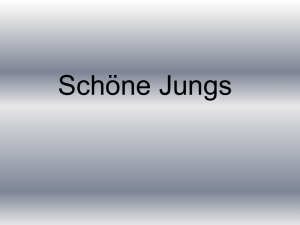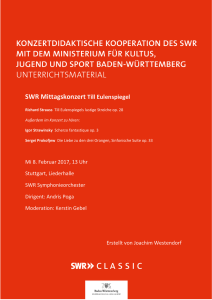Valery Gergiev - Münchner Philharmoniker
Werbung

Valery Gergiev Sol Gabetta Freitag, 6. März 2015, 20 Uhr ERLEBEN SIE DAS FRIDRICH ZEITGEFÜHL! Edelstahlgehäuse, Shell Cordovan Band, vergoldete Glashütter Dreiviertelplatine, vergoldete Zeiger, Sonderbodengravur Noch sind einige wenige Exemplare unserer NOMOS-Sonderedition aus unserem Jubiläumsjahr 2014 zu Jubiläumspreisen erhältlich: TANGENTE 33 und TANGENTE 38 Limitierte Auflage von jeweils 150 Stück TANGENTE 33: € 1.210,– statt € 1.360,– TANGENTE 38: € 1.450,– statt € 1.600,– T R AU R I N G H AU S · SC H M U C K · J U W E L E N · U H R E N · M E I ST E RW E R KST Ä T T E N J. B. FRIDRICH GMBH & CO. KG · SENDLINGER STR ASSE 15 · 80331 MÜNCHEN TELEFON: 089 260 80 38 · WWW.FRIDRICH.DE A n t o n í n D v o ř á k Konzer t für Violoncello und Orchester h-Moll op. 104 1. Allegro 2. Adagio, ma non troppo 3. Finale: Allegro moderato Richard Strauss „Also sprach Zarathustra“ Tondichtung (frei nach Friedrich Nietzsche) für großes Orchester op. 30 „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ nach alter Schelmenweise – in Rondeauform – für großes Orchester gesetzt op. 28 Valery Gergiev, Dirigent Sol Gabetta, Violoncello Freitag, 6. März 2015, 20 Uhr 3. Abonnementkonzer t h5 Spielzeit 2014/2015 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant 2 Antonín Dvořák: Cellokonzert h-Moll „Wie ich es gefühlt und gedacht habe“ Klaus Döge Antonín Dvořák (1841-1904) Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll op. 104 1. Allegro 2. Adagio, ma non troppo 3. Finale: Allegro moderato Sängerin am Prager Interimstheater und Dvořáks große Liebe Mitte der 1860er Jahre war, integrierte er das Melodiezitat „Lasst mich allein in meinen Träumen geh’n !“ aus seinen „Vier Liedern“ op. 82/1 in den Mittelsatz des Konzerts. Den Schluss des Finales arbeitete Dvořák nach Josefinas Tod grundlegend um, ließ ihn „diminuendo, wie ein Hauch“ ausklingen und verzichtete auf die ursprünglich vorgesehene Solokadenz. Aus diesem Grund wurde die revidierte Reinschrift der Partitur in Písek / Böhmen erst am 11. Juni 1895 fertig. Widmung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 8. September 1841 in Nelahozeves (Mühlhausen), unweit von Prag an der Moldau gelegen (Böhmen); gestorben am 1. Mai 1904 in Prag. Entstehung Dvoř áks Cellokonzert ist das letzte größere Werk, das der Komponist während seines knapp dreijährigen USA-Aufenthalts schrieb; es entstand vom 8. November 1894 bis 9. Februar 1895 in New York City im Anschluss an einen Urlaub, den Dvoř ák in seiner böhmischen Heimat verbracht hatte. Im Gedenken an seine schwer erkrankte Jugendfreundin Josefina Kaunitzová (geb. Cermáková), die früher Schauspielerin und Im Erstdruck: „Hanuš Wihanov“ (Hans Wihan gewidmet); Dvoř ák hatte sein Cellokonzert auf Anregung des berühmten Prager Cellisten und Gründers des „Böhmischen Streichquartetts“ Hanuš Wihan (1855-1920) geschrieben, mit dem er sich in der Folge allerdings überwarf, weil er die von Wihan gegen Ende des 3. Satzes gewünschte große Solokadenz bewusst aussparen wollte. Uraufführung Am 19. März 1896 in London (Orchester der London Philharmonic Society unter Leitung von Antonín Dvoř ák; Solist: Leo Stern); 1897 dirigierte Dvoř ák sein Konzert in Leipzig „In memoriam Johannes Brahms“, 1899 in Amsterdam ein erstes und einziges Mal mit Widmungs­t räger Hans Wihan als Solist. Antonín Dvořák: Cellokonzert h-Moll Konzertante Vorläufer Die Gattung „Konzert“ spielte im umfangreichen Schaffen von Antonín Dvoř ák eine eher periphere Rolle. Zwar schrieb der Prager Komponist bereits am Anfang seines künstlerischen Wegs, in jener Phase der kompositorischen Hochproduktion des Jahrs 1865, in der neben dem Liederzyklus „Zypressen“ auch seine beiden ersten Symphonien (Nr. 1 c-Moll, Nr. 2 B-Dur) entstanden, ein Konzert für Violoncello A-Dur „mit Begleitung des Klavieres“; aber mehr als eine kompositorische Fingerübung und insbesondere eine musikalische Gefälligkeit für den befreundeten Cellisten Ludevít Peer, mit dem der Bratscher Dvoř ák damals zusammen im Orchester des Prager Interimtheaters spielte, war dieses vom Autor unveröffentlicht gelassene Konzert nicht. Elf Jahre vergingen, Jahre, in denen drei weitere Symphonien, drei Opern und eine Vielzahl von Kammermusikwerken entstanden, bevor sich Dvoř ák im August 1876 zum zweiten Mal der Gattung „Konzert“ zuwandte und – angeregt durch seine Freundschaft mit dem Prager Klaviervirtuosen Karel von Slavkovsky – sein Klavierkonzert g-Moll op. 33 komponierte, dessen Charakter und Schicksal der Verleger Robert Lienau mit den Worten kommentierte: „Sie behandeln das Clavier, Beethoven ähnlich, in enger Verschmelzung mit dem Orchester, und es ist noch fraglich, ob das den heutigen Konzertspielern sehr willkommen ist...“ Dass Dvoř ák bereits drei Jahre später wiederum an einem Konzert, diesmal für die Violine, arbeitete, ging auf das Drängen des Berliner 3 Verlegers Fritz Simrock zurück. Am 27. Januar 1879 hatte dieser an den Prager Komponisten die Anfrage gerichtet: „Wollen Sie mir ein Violinkonzert schreiben, recht originell, kantilenenreich und für gute Geiger ?“ Mit „gute Geiger“ meinte Simrock dabei vor allem einen: den berühmten Berliner Violinvirtuosen Joseph Joachim, dem Dvoř ák sein Violinkonzert zur Begutachtung übersandte, dessen Änderungswünsche Dvoř ák zu mancher Umarbeitung veranlassten und dem der Prager Komponist sein Geigenkonzert denn auch widmete. Neu erwachtes Interesse Was 13 Jahre später – kurz vor Dvoř áks Reise nach Amerika, wo er von Oktober 1892 bis April 1895 als künstlerischer Direktor und Kompositionsprofessor am New Yorker National Conservatory of Music wirkte – den Anstoß dafür gab, dass Dvořák in seinem Schaffen nochmals das Konzertgenre aufgriff, ist unbekannt. Feststellen lässt sich, dass sein künstlerisches Interesse an der Gattung, das schließlich zur Entstehung des Violoncellokonzerts führte, im Sommer 1892 neu erwachte. Seinen Freund Alois Göbl ließ er damals wissen, dass er sich gerade Gedanken über ein neues Klavier- oder Violinkonzert mache. Und auch Simrock gegenüber muss er von dieser Idee berichtet haben, denn im Oktober 1892 – Dvoř ák war bereits in New York – meldete der Verleger: „Ich will nicht unterlassen, Ihnen zu sagen, dass ich z. B. ein Klavierkonzert ganz gerne von Ihnen edieren würde (wenn es ein schönes und wirkungsvolles Stück ist).“ 4 Antonín Dvořák: Cellokonzert h-Moll Kompositorisch greifbar wird Dvoř áks damalige Konzertidee zwischen 19. Dezember 1892 und 10. Januar 1893: Auf Seite 11 des mit „Motivy New York“ überschriebenen ersten amerikanischen Skizzenbuchs befindet sich ein melodischer Entwurf, betitelt „Allegro Concert Piano Rondo Finale“. Dass Dvoř ák diesen Entwurf nicht weiter ausführte und damit das neue Konzertprojekt zunächst nicht weiter verfolgte, muss nicht verwundern angesichts der umfangreichen anderen kompositorischen Arbeiten des Jahrs 1893 (Symphonie e-Moll „Aus der Neuen Welt“ op. 95, „Amerikanisches Streichquartett“ F-Dur op. 96, Streichquintett Es-Dur op. 97, Vio­lin­ sonatine G-Dur op. 100), angesichts der mehrmonatigen Sommerreise 1893 nach Spillville in den Norden der USA, angesichts der vielen Direk­t ionsverpflichtungen am New Yorker Konservatorium während des Schuljahres 1893/94 und auch angesichts der sich daran anschließenden, heiß ersehnten Sommerferien in der böhmischen Heimat von Mai bis Oktober 1894. In seinem Denken fallen gelassen aber hatte Dvoř ák dieses Konzertprojekt nicht. In Hamburg, wo er auf der Rückreise nach New York Mitte Oktober 1894 bei der mit ihm befreundeten Komponistenfamilie Josef Bohuslav Foerster Station machte, ging es in der Unterhaltung der beiden Tonsetzer nachweislich um ein Konzert, diesmal mit der Violine als Soloinstrument. Und am 2. November 1894, nur kurze Zeit nach seinem Wiedereintreffen in New York, war in einem Brief Dvoř áks an seine in Prag gebliebenen Kinder zu lesen: „Bis jetzt arbeite ich an nichts, aber froh wäre ich, wenn es wieder dazu käme, sehr froh – ich bin ausgeruht mehr als genug. Gerne würde ich ein Konzert machen für Klavier oder Geige oder Cello.“ Symphonisches Prinzip Dass in diesen Zeilen neben dem Klavier und der Geige erstmals auch das Violoncello als mögliches Soloinstrument genannt wird, hängt wohl mit Dvoř áks Zusammentreffen und gemeinsamen Musizieren mit Hanuš Wihan, Professor am Prager Konservatorium und Cellist des „Böhmischen Streichquartetts“ während seines Sommerurlaubs zusammen. Wihan scheint damals – einer späteren Schüler-Erinnerung zufolge – an den befreundeten Prager Komponisten (der ihm vermutlich von seiner Konzertidee erzählt hatte) immer und immer wieder mit der Bitte um ein Konzert für Violoncello herangetreten zu sein. Dabei ist anzunehmen, dass zum Zeitpunkt des zitierten Schreibens an die Kinder das Soloinstrument „Cello“ in Dvořáks kompositorischem Denken bereits favorisiert war. Denn nur sechs Tage später, am 8. November 1894, begann Dvoř ák im fünften amerikanischen Skizzenbuch mit der Erstniederschrift seines Konzerts für Violoncello, und zwar mit dem 1. Satz, den Dvoř ák ursprünglich in d-Moll notierte, nach etwa 50 Takten abbrach und daraufhin mit gleicher Thematik in h-Moll nochmals von vorne schrieb. Kurze Zeit nach Beendigung der Partitur am 9. Februar 1895 ließ er seinen Freund Josef Bohuslav Foerster wissen: „Ich sage Ihnen aufs bestimmteste, dass dieses Konzert meine beiden Konzerte, das Violin­ konzert wie das Klavierkonzert, bei weitem übertrifft.“ 5 Antonín Dvořák (1891) 6 Antonín Dvořák: Cellokonzert h-Moll Dabei war auch das Violoncellokonzert in seiner Konzeption dem Typus des symphonischen Konzerts verpflichtet. Doch verstand es Dvoř ák hier, die Idee des symphonischen Ganzen in einzigartiger Weise mit dem konzertierenden Prinzip zu verbinden. Es ist das Soloinstrument, das dramaturgisch agiert, neue Gedanken vorträgt, den Dialog mit dem Orchester eröffnet; und es ist das Orchester, das dieses Agieren und Dialogisieren im Sinne einer Ausbalancierung für das Ganze aufgreift, sich – wo nötig – in die musikalische Dramaturgie einschaltet und durch eigene Themen oder Themenvarianten eine höchst individuelle Rolle spielt. Von hier aus gesehen wird Dvoř áks vehemente Ablehnung einer Kadenz nur zu verständlich, die Hanuš Wihan, der Dvoř ák für den Solopart beratend zur Seite stand, gegen Ende des Finales eingefügt wissen wollte: „Überhaupt muss es [das Konzert] in der Gestalt sein, wie ich es gefühlt und gedacht habe. [...] Das Finale schließt allmählich diminuendo wie ein Hauch – mit Reminiszenzen an den 1. und 2. Satz – , das Solo klingt aus bis zum pp, dann ein Aufschwellen, und die letzten Takte übernimmt das Orchester und schließt im stürmischen Tone.“ Tönende Autobiographie Über das Kompositorische hinaus ist das Cellokonzert zugleich ein höchst persönliches Werk Dvoř áks. Dies nicht so sehr, weil es zu seiner Entstehung weder der Anregung von Verlegernoch von Freundesseite her bedurft hatte, sondern vor allem deshalb, weil es ein Stück Auto­ biographie enthält. Musikalisch fixiert ist dies im zweiten, zuerst vom Cello vorgetragenen Thema (g-Moll) des langsamen Satzes, ein stilisiertes Zitat der Gesangsmelodie aus Dvoř áks 1887/1888 komponiertem Lied „Lasst mich allein in meinen Träumen geh’n !“ Es war das Lieblingslied von Josefina Kaunitzová (geb. Cermáková), ehemalige Schauspielerin und Sängerin am Prager Interimstheater, Dvoř áks große Liebe Mitte der 1860er Jahre und später seine Schwägerin. In einem Brief vom 26. November 1894 hatte Josefina dem Komponisten ihren bedrohlichen Gesundheitszustand geschildert; Dvoř ák, der diesen Brief nachweislich noch vor der Skizzierung des 2. Satzes erhielt, gedachte ihrer mit dem Melodiezitat aus dem ersten der „Vier Lieder“ op. 82. Und nachdem Josefina am 27. Mai 1895, nur kurze Zeit nach Dvoř áks Rückkehr aus Amerika, verstarb, änderte Dvoř ák den Schluss des Finalsatzes und fügte auch dort das Liedzitat ein: gespielt von Holzbläsern und Solo­ violine in hoher Lage, ohne eigentliches Bassfundament, fern vom Gewohnten und damit gleichsam wie aus einer anderen Welt herüberklingend. 7 Hugo Boettinger: Antonín Dvořák (um 1895) 8 Richard Strauss: „Also sprach Zarathustra“ Mit Musik gegen das „Ewig Gestrige“ Stephan Kohler Richard Strauss Entstehung (1864–1949) Im Frühjahr 1894, noch vor der Uraufführung seiner ersten Oper „Guntram“, scheint sich Strauss in Weimar erstmals mit der Konzeption einer Tondichtung „frei nach Friedrich Nietzsche“ beschäftigt zu haben; im Juli 1895 griff er das Projekt während eines Urlaubs in Cortina d’ Ampezzo (Trentino) wieder auf, um noch im gleichen Jahr mit der Niederschrift der definitiven Komposi­ tionsskizze zu beginnen. Das Particell seines Opus 30 beendete Strauss am 17. Juli 1896 in Marquartstein / Oberbayern, die Partiturreinschrift am 24. August 1896 in München. „Also sprach Zarathustra“ Tondichtung (frei nach Friedrich Nietzsche) für großes Orchester op. 30 Widmung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 11. Juni 1864 in München; ge­ storben am 8. September 1949 in GarmischPartenkirchen. Literarische Vorlage „Also sprach Zarathustra“, mehrteilige philosophische Dichtung von Friedrich Nietzsche (1844– 1900) mit dem Untertitel „Ein Buch für Alle und Keinen“; Nietzsches zuletzt auf „vier Teile“ erweitertes Hauptwerk erschien zwischen 1883 und 1885 und erlebte zahlreiche Auflagen, von denen Strauss – wie der redaktionelle Stand der aus Nietzsches Buch übernommenen Kapitelüberschriften in seiner Partitur beweist – eine der frühesten benutzte. Auf eine personenbezogene Widmung hat Strauss bewusst verzichtet; statt dessen wollte er seinem Werk ursprünglich den Untertitel geben: „Symphonischer Optimismus in Fin de siècle – Form, dem 20. Jahrhundert gewidmet“. Dieses bereits in Weimar 1894 zu Papier gebrachte „Motto“ wich bei der Drucklegung dem ersten Kapitel von „Zarathustras Vorrede“, mit dem Strauss seiner Partitur einen Originaltext Friedrich Nietzsches voranstellte. Uraufführung Am 27. November 1896 in Frankfurt am Main im Rahmen des 4. Museumskonzerts der Frankfurter Museums-Gesellschaft im Saalbau (Frankfurter Museums-Orchester unter Leitung von Richard Strauss). Richard Strauss: „Also sprach Zarathustra“ Vom Geist der Opposition Im Herbst 1898 vertauschte Richard Strauss, 34-jährig, seinen Posten als Nachfolger Hermann Levis am Königlichen Hof- und Nationaltheater zu München mit der Position eines Preußischen Hofkapellmeisters seiner Majestät, des Kaisers Wilhelm II., in Berlin. Berlin hatte das spätbiedermeierliche München weit überflügelt, war zur intellektuellen Hauptstadt Deutschlands avanciert und zog Künstler aus allen Teilen des Deutschen Reiches an. Strauss galt als bedeutendster Komponist seiner Generation, und sein Wechsel von München nach Berlin wurde allgemein als spektakulärer Vorgang gewertet. Spektakulär waren auch die Erfolge, die Strauss um die Jahrhundertwende feierte – meist verbunden mit erbittert umkämpften Uraufführungsskandalen, die den Komponisten nicht unbedingt zum Höfling der wilhelminischen Ära prädestinierten. Dass die Berliner kaiserliche Hofverwaltung ein derartiges „enfant terrible“ dennoch adoptierte, gereicht ihr noch nachträglich zur Ehre. Strauss hingegen geriet durch sein Berliner Engagement für viele nachfolgende Generationen in das dubiose Licht des erzreaktionären und auf bloße Repräsentation bedachten Hohenzollernstaats, als dessen musikalischen Exponenten ihn manche neuzeitliche Musikhistoriographen eilfertig brandmarkten. Wäre es ihm um bloßes Anpassertum gegangen, hätte er nie „Guntram“ komponiert, seinen höchst eigenwilligen Bühnenerstling, in dem Anarchisten, Exzentriker und PolitProvokateure des Fin de siècle sich wieder­ erkennen und philosophisch legitimiert sehen konnten. Auch sein zweites Bühnenwerk 9 „Feuers­n ot“ geht konzessionslos gegen die bürgerliche Reaktion vor und entlarvt gesellschaftliches Wohlverhalten als heimtückische Berechnung und verlogene Prüderie. Der „Feuersnot“-Librettist Ernst von Wolzogen, ein gegen die Wahnfried-Ergebenheit seines Bruders Hans revoltierender „Outlaw“, hatte dem selbsternannten Gottesgnadentum der Wagner-Witwe Cosima ebenso den Kampf angesagt wie sein künstlerischer Partner Richard Strauss, den nach anfänglicher Bayreuth-­ Begeisterung bald Skepsis gegen Ideologie und Musiktradition der Wagner-Schule erfasste. Doch schon Jahre vor den „Meistersinger“-, „Tristan“-, „Ring“- und „Parsifal“-Parodien der „Feuersnot“ hatte sich Strauss vor den höchst konservativen Kreisen des zeitgenössischen Bürgertums durch seine offen zur Schau getragene und in „Also sprach Zarathustra“ auch kompositorisch belegte Nietzsche-Begeisterung diskreditiert. Der Geist der Opposition gegen die verhassten, gründerzeitlich-bornierten „Philisternester“ Weimar und München disponierten ihn in jenen Jahren für satirische Komödienhandlungen und provokante Weltanschauungsstoffe. Anstiftung zu lachender Bosheit Als Cosima Wagner 1901 von ihrem abtrünnigen Adepten Richard Strauss zur Uraufführung des Singgedichts „Feuersnot“ nach Dresden eingeladen wird, stellt ihr der Komponist „ein ganz boshaftes Vergnügen“ in Aussicht, um sich sogleich zu korrigieren: „Ach Pardon, ich vergaß: Lachende Bosheit ist nur bei uns schlimmen Nietzsche-Brüdern eine Tugend !“ Cosimas Antwort, bedeutend in ihrer aphoristischen 10 Richard Strauss: „Also sprach Zarathustra“ Prägnanz, beendet zugleich eine knapp zehn Jahre währende Debatte über Wagners einstigen Apologeten, in deren Verlauf der junge Dichterkomponist des „Guntram“ und seine „geistige Erzieherin“ in Wahnfried sich zunehmend entfremdet hatten: „Gott: Nietzsche ! Wenn Sie ihn gekannt hätten ! Er hat nie gelacht und war immer durch unsern Humor wie überrascht; dazu Kurzsichtigkeit bis zur Augenblödigkeit: Armer Nachtvogel, der an allen Ecken und Enden anstieß. Den als Prediger des Lachens anzutreffen, berührt seltsam.“ Wie war Strauss unter die „schlimmen NietzscheBrüder“ geraten ? Im Frühjahr 1892 hatte er sich eine lebensgefährliche Lungenerkrankung zugezogen, die er im Winterhalbjahr 1892/93 auf einer Mittelmeer-Reise auszuheilen hoffte. Mit im Reisegepäck, quasi als Rezeptur für nicht nur körperliche, sondern auch geistige Genesung, hatte er die damals aktuellsten Schriften Schopenhauers und Nietzsches. Doch Schopenhauers Theorie von der „Erlösung des Willens in der Verneinung“ erwies sich für Strauss als unzugänglich; in sein Reisetagebuch notierte er: „Ich bejahe bewusst, das ist mein Glück !“ Im Frühjahr 1893 in Taormina angelangt, schrieb er schließlich an Cosima über Nietzsches 1886 erschienene Schrift „Jenseits von Gut und Böse“, die im Untertitel als „Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“ bezeichnet ist: „Die Zweifel, die Schopenhauer mir erweckt, hat Nietzsche auch nicht ganz gelöst, wenn ich es auch gleich für möglich halte, dass auf dem Wege, auf dem dieser wahnsinnig geworden, doch vielleicht einmal ‚die Philosophie der Zukunft‘ heraufdämmern wird. Kennen Sie das Buch ? Es ist ein tolles Gemisch von Verrücktheiten, Absur- ditäten und dann wieder Gedanken, die ich für das Bedeutendste mit halte, was ein Menschenkopf ersinnen kann.“ „Fingerzeige zu einem neuen Leben“ Spätestens mit diesem Brief vom April 1893 beginnt sich – wie Max Steinitzer, sein erster Biograph, es formulierte – Strauss’ dezidierte Abwendung vom „Bayreuther Erlösungsrummel“ abzuzeichnen. Schon im Februar desselben Jahres hatte Strauss an seinen Jugendfreund Ludwig Thuille geschrieben, die Zeit der „Moralpredigten“ sei nun endgültig vorbei. Spielte er damit auf Nietzsches Selbstinterpretation in seiner späten, 1888 entstandenen Schrift „Ecce Homo“ an („Wie man wird, was man ist“), wo die Verweigerung jedwelchen Verkündens von „Moral“ als besondere Errungenschaft gerade von „Also sprach Zarathustra“ gepriesen wird ? Nietzsche sagt dort über sein berühmtes, „für Alle und Keinen“ geschriebene Buch, das von 1883 bis 1885 zum Teil nur als Privatdruck erscheinen durfte: „Hier redet kein ‚Prophet‘, keiner jener schauerlichen Zwitter von Krankheit und Willen zur Macht, die man Religionsstifter nennt. Hier redet kein Fanatiker, hier wird nicht ‚gepredigt‘, hier wird nicht Glauben verlangt.“ Strauss („Ich bejahe bewusst !“) musste sich von Nietzsches „Zarathustra“ angezogen fühlen, dessen dichterischer Konzeption – laut „Ecce Homo“ – „die höchste Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann, das ‚Ja !‘ sagende Pathos par excellence“ zugrunde liegt. „Also sprach Zarathustra“, dem in einer frühen Fassung der Untertitel „Fingerzeige zu 11 Früher Privatdruck von „Also sprach Zarathustra“ mit satirischer Widmung Nietzsches an einen Freund: „Ein verbotenes Buch ! Vorsicht ! Es beisst ! 12 Richard Strauss: „Also sprach Zarathustra“ einem neuen Leben“ beigegeben war, verkörperte für Strauss – wie für die meisten seiner Leser – das „Dithyrambische“ als Lebensform, den artistisch geträumten, gedichteten Daseinsrausch, in dem man ein Fanal der Befreiung von gründerzeitlichen Zwängen erblickte. Sein sensualistischer Subjektivismus ließ sich zu einer Metaphysik der Diesseitigkeit überhöhen, der im Kampf gegen das „Ewig Gestrige“ deutliche Überbau-Funktion zukam. Mochte für Nietzsche, den kränklichen Philologen, „Also sprach Zarathustra“ kompensatorische Bedeutung gehabt haben – für Strauss war seine Lektüre zweifellos ein Mittel affirmativer Selbstbestätigung. Nietzsche-Brüder unter sich Die vielgerühmte Musikalität des Textes hatte schon Nietzsche selbst hervorgehoben. In einem Brief an seinen komponierenden Vertrauten Peter Gast heißt es: „Unter welche Rubrik gehört eigentlich dieser ‚Zarathustra‘ ? Ich glaube beinahe unter die Symphonien !“ In „Ecce Homo“ wiederholt Nietzsche den synästhetischen Zuordnungsversuch, indem er angesichts der Silbenkatarakte seines entfesselten Sprachflusses anheimstellt: „Man darf vielleicht den ganzen ‚Zarathustra‘ unter die Musik rechnen.“ Vorausbedingung für seine adäquate Lektüre sei allerdings eine dringend erforderliche „Wiedergeburt“ in der den meisten Menschen abhanden gekommenen „Kunst zu hören“. Außer Richard Strauss „hörten“ und komponierten „Zarathustra“-Texte im selben Zeitraum Oscar Fried („Das trunkene Lied“), Frederic Delius („A Mass of Life“), Siegmund von Hausegger („Dionysische Phantasie“) und vor allem Gustav Mahler in seiner breit angelegten 3. Symphonie, die parallel zu Strauss’ „Zara- thustra“ zwischen 1894 und 1896 entstand. Noch 1906 erklärte sich Mahler diese auffallende Duplizität aus dem Umstand, „dass wir beide als Musiker die sozusagen latente Musik in dem gewaltigen Werke Nietzsches herausgefühlt haben“. Seine „Dritte“ hatte Mahler ursprünglich in Anlehnung an Nietzsches gleichnamige, von 1882 bis 1887 erschienene Schrift „Die fröhliche Wissenschaft“ betitelt und für jeden der anfangs sieben, zuletzt sechs Sätze akribisch ausgearbeitete Überschriften erdacht, in die Lektürefrüchte aus Büchern Nietzsches einflossen. Bei Drucklegung ließ Mahler jedoch alle Nietzsche-Anspielungen rückwirkend tilgen, so dass nur noch das Altsolo des 4. Satzes, in dem das „Mitternachtslied“ Zarathustras („O Mensch ! Gib acht !“) vertont ist, die ursprüngliche Konzeption der Symphonie verrät. Warum musste Mahler so verzweifelt um Nietzsche ringen, wo ihn sich ein Strauss im Handumdrehen als „Hausphilosoph“ erobert hatte ? Zwar bewunderte Mahler das sprachliche Feuer von Nietzsches Prosa und die Sogwirkung ihrer von größter Musikalität durchdrungenen Deklamationskunst; aber was der bekennende Atheist Richard Strauss als Freibrief für weltanschaulichen Liberalismus hielt, konnte den konvertierten Juden Gustav Mahler in seinem christlichen „Missionsgefühl“ auf Dauer nur abstoßen. Nicht zuletzt an der markanten Abänderung des ursprünglichen Titels seiner Symphonie in „Meine fröhliche Wissenschaft“ ist Mahlers deutliche Kurskorrektur gegenüber Nietzsche abzulesen: Der „Übermensch“ als Produkt eines überzogenen Sozialdarwinismus oder – noch 13 Hans Olde: Friedrich Nietzsche auf dem Krankenlager (1899) 14 Richard Strauss: „Also sprach Zarathustra“ schlimmer – gezielter „rassischer Auslese“ war dem Juden Mahler begreiflicherweise nicht zugänglich. Er sah im Gegensatz zu Strauss den Mensch als Produkt der „Mitte“, nicht des „Darüber“: als „primus inter pares“ eingebettet in eine von christlich-pansophischem Ganzheitsdenken geprägte Ahnung des Allzusammenhangs jeglicher Natur. Schließlich sei man, so Mahler an Anna von Mildenburg, „sozusagen nur ein Instrument, auf dem das Universum spielt...!“ Seiner Ehefrau Alma, die sich selbst als „wilde Nietzscheanerin“ bezeichnete, hielt er folgerichtig „die ganz verlogene und schlimmfreche Herren-‚Unmoral‘ Nietzsches“ vor und empfahl ihr, ihre Nietzsche-Gesamtausgabe schleunigst „ins Feuer“ zu werfen. „Symphonischer Optimismus in Fin de siècle – Form“ So sehr sich Strauss im Gegensatz zu Mahler für Nietzsches Herren-„Moral“ begeistern konnte und den Autor des „Zarathustra“ als Apologet institutionalisierter „Freigeistigkeit“ feierte – das Programmatische, Bekenntnishafte seiner Tondichtung „frei nach Friedrich Nietzsche“ wollte er dennoch nicht überbewertet wissen. Die in der Tat sehr „freie“ Handhabung der Vorlage durch den Komponisten macht es einem ohnehin nicht leicht, programmatische Entsprechungen zwischen Text und Musik eindeutig zu fixieren. Lediglich einige wenige Kapitelüberschriften Nietzsches fanden Eingang in die Partitur, wo ihre Reihenfolge von der der Buchausgabe im Übrigen erheblich abweicht: „Von den Hinterweltlern“, „Von der großen Sehnsucht“, „Von den Freuden- und Leidenschaften“, „Das Grablied“, „Von der Wissenschaft“, „Der Gene- sende“, „Das Tanzlied“ und schließlich „Das Nachtwandlerlied“, dessen Titel Nietzsche in einer späteren Auflage in „Das trunkene Lied“ abänderte. Strauss stellte seiner Partitur das erste Kapitel von „Zarathustras Vorrede“ gleichsam als Einführungstext voran und opferte dafür den ursprünglich vorgesehenen, ironisch gefärbten Untertitel „Symphonischer Optimismus in Fin de siècle – Form, dem 20. Jahrhundert gewidmet“. Dieser „Slogan“ wurde vermutlich schon 1894 in Weimar zu Papier gebracht; soweit reichen jedenfalls die ersten Skizzen zu dem Werk zurück. Im Juli 1895 setzte Strauss die Arbeit während eines Sommeraufenthalts in Cortina d’ Ampezzo fort, um noch im gleichen Jahr mit der Niederschrift des Particells, der letzten von ihm sogenannten „Bleistiftskizzen“, zu beginnen. Er beendete sie am 17. Juli 1896 in der Sommerresidenz seiner Schwiegereltern in Marquartstein im Chiemgau, hatte zu diesem Zeitpunkt aber auch schon längst – nämlich seit 4. Februar 1896 – mit der Partitur-Reinschrift begonnen, so dass „Also sprach Zarathustra“ bereits am 24. August in München fertig vorlag. Der von Strauss gewählte Orchesterapparat entspricht im Wesentlichen demjenigen des Vorgänger-Werks „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ op. 28; geringfügige Einsparungen bei Trompeten und Hörnern werden durch Hinzu­ fügung einer Basstuba wieder ausgeglichen. Zwei Harfen und die bei Strauss erstmals verwendete Orgel komplettieren das üppig besetzte Orchester. Hatte Strauss in seinen bisherigen Werken, z. B. in „Don Juan“, den Formverlauf zumeist noch 15 Richard Strauss als Münchner Hofkapellmeister (1896) 16 Richard Strauss: „Also sprach Zarathustra“ an Rudimenten eines in Auflösung begriffenen Sonatenhauptsatzes orientiert, so wählte er für „Zarathustra“ die Form einer großangelegten symphonischen Phantasie: Nietzsches sprunghafter Zitier- und Formulierungskunst konnte und wollte er nicht mit althergebrachter symphonischer Vernetzungstechnik begegnen, um auf solch traditionelle Weise übergreifende tektonische Zusammenhänge zu stiften. Wenn Nietzsche modernste, quasi „filmische“ Techniken vorwegnahm wie Montage, Überblendung oder Schnitt, so folgen auch bei Strauss auf die Themen-Exposition eher lose verbundene, durchführungsartige Episoden, die sich auf einzelne „Bilder“ oder fragmentarische Einsprengsel konzentrieren und in denen jeweils unterschiedliche Variationsprinzipien gelten. Alle zielen sie jedoch auf Intensivierung, Steigerung und keineswegs auf bloße Rekapitulation der anfangs eingeführten Themen ab. Erkennbare Satzelemente wie Fugato, Scherzo, Adagio, Finale und Coda sind nie Folge abstrakt-formaler Planung, sondern bleiben stets rückbeziehbar auf ihre inhaltliche bzw. literarische Funktion; Strauss erweist sich hier als unbeirrbarer Anhänger der „neudeutschen“ Musikästhetik Friedrich von Hauseggers und seines Hauptwerks „Die Musik als Ausdruck“. Wechselspiel entferntester Ton­ arten Eine besondere Rolle spielt im „Zarathustra“ die Kontrastivität der Tonarten, deren Symbolwert Strauss in einer Tagebuch-Eintragung rückblickend kommentierte: „ ‚Zarathustra‘ ist musikalisch genommen als Wechselspiel zwischen den zwei entferntesten Tonarten (die Secunde !) angelegt.“ In der Tat bilden die beiden Hauptton­arten H-Dur und C-Dur das harmonische Grundgerüst der Komposition: Mensch (H-Dur) und Natur (C-Dur) werden miteinander konfrontiert, ohne dass Aussicht auf Aufhebung ihrer Gegensätzlichkeit bestünde; im Gegenteil: ihre Gegensätzlichkeit wird festgeschrieben und musikalisch gleichsam „zementiert“. In einem seiner „Zarathustra“-Skizzenbücher hat Strauss die Mensch-Natur-Polarität zusätzlich durch ein Zitat aus Goethes „Faust“ glossiert: „Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir !“ So wird der „Übermensch“ Faust – als solcher bereits von Goethe tituliert ! – von der Naturgottheit des unerbittlichen „Erdgeists“ in die engen Schranken seiner menschlich-bedingten Existenz gewiesen. Ein anderes Skizzenbuch nennt das fanfarenartige Trompetenthema des Beginns (c-g-c) die Formel für das „Universum“ („immer unbeweglich, starr, unverändert bis zum Schluss“) und gibt Einblick in die von Strauss virtuos gehandhabte Technik des symbolischen, fast schon sprachähnlichen Spiels mit Tonarten: „Großes Diminuendo und Erlöschen bis zum Beginn der Fuge; großer Aufbau, bis alle Lebensthemen zusammenkommen ! Ihre Combination endet mit Verzweiflung (Dmoll), aus der die Sehnsucht (Hmoll) endlich sanft ihre Flügel über den vom Kampfe mit den Gespenstern des ‚Lebens‘ Ermatteten ausbreitet (Hdur) und ihn zur ‚Freiheit‘ führt (Cdur 3/4). Lebenstrieb, niedrige Leidenschaften, Schütteln vor Lachen (gestopfte Trompeten, hi – hi – hi – hi). Leidenschaftsthema in Asdur (Blech, dunkelblau). Englisch-Horn-Solo Richard Strauss: „Also sprach Zarathustra“ tanzend. Die erfüllte Sehnsucht als Schluss­ hymnus (Hdur, dann Cdur). Chromatisches Ausklingen !“ „Dem 20. Jahrhundert gewidmet“ Kaum eine symphonische Dichtung von Richard Strauss musste sich schon vor ihrer Uraufführung so viele Anfeindungen und Gehässigkeiten gefallen lassen wie „Also sprach Zarathustra“. Cosima Wagner, immerhin, rang sich zu einer versöhnlich-toleranten Haltung durch: „Ich hatte den Titel Ihrer symphonischen Dichtung ‚So sprach Zarathustra‘ für einen Zeitungsscherz gehalten. Aber ich kenne Nietzsches Buch nicht und nehme jetzt an, dass in seinem Inhalt etwas sein muss, was Sie musikalisch angeregt hat !“ Noch im November 1899, fast auf den Tag genau drei Jahre nach der Frankfurter Uraufführung, wägt man in Wahnfried das Für und Wider ab: „‚Zarathustra‘ ist gar nicht berüchtigt, vielmehr höre ich ihn von allen Seiten rühmen. Ich protestiere nur gegen den armen Nietzsche als Programmdichter, weil er ja schon seit über 20 Jahren traurig erkrankt ist.“ Dieselbe (Geistes-) Krankheit unterstellte mancher Kritiker auch Richard Strauss, so in verschlüsselter Form sein Wiener Gegenspieler Eduard Hanslick: „Oh, Zarathustra ! Klatsch’ doch nicht so fürchterlich mit deiner Peitsche ! Du weißt ja: Lärm mordet die Gedanken !“ Auf andere wieder, so auf den jungen Béla Bartók, wirkte „Also sprach Zarathustra“ wie ein „Blitzschlag“, der urplötzlich eigene, bisher nicht gekannte musikalische Energien freisetzte. Claude Debussy schließlich glaubte während eines 17 Pariser Konzerts, in dem Strauss seinen „Zarathustra“ dirigierte, eine seltsame Übereinstimmung zwischen Dirigent, Komponist und Werk zu entdecken, die auch schon Romain Rolland, dem hellsichtigen Kritiker und künstlerischen Weggefährten von Strauss, aufgefallen war: „Seine Stirn ist die eines Musikers, aber die Augen und das Mienenspiel sind die eines ‚Übermenschen‘, von dem der sprach, der auch sein Lehrmeister in der Energie war: Nietzsche. Von ihm hat er die erfreuliche Verachtung des AlbernSentimentalen übernommen; von ihm hat er gelernt, dass Musik nicht nur unsere Nächte erhellen soll, sondern dass sie wie die Sonne selbst sei. Ich kann Ihnen versichern, dass in Richard Strauss’ Musik Sonne ist ! Es ist unmöglich, der gewinnenden Macht dieses Mannes zu widerstehen.“ 18 Friedrich Nietzsche: „Also sprach Zarathustra“ „Zarathustras Vorrede“ Friedrich Nietzsche Als Zarathustra dreißig Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoß er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, – und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also: „Du großes Gestirn ! Was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest ! Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange. Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluß ab und segneten dich dafür. Siehe ! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muß ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn ! Ich muß, gleich dir, u n t e r g e h e n, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzugroßes Glück sehen kann ! Segne den Becher, welcher überfließen will, daß das Wasser golden aus ihm fließe und überallhin den Abglanz deiner Wonne trage ! Siehe ! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden.“ – Also begann Zarathustras Untergang. Von Richard Strauss dem Partiturdruck seiner Tondichtung vorangestellter Eröffnungsabschnitt aus Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ Richard Strauss: „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ 19 Mit Schelmenweisen gegen die Philister Stephan Kohler Richard Strauss (1864–1949) „Till Eulenspiegels lustige Streiche“, nach alter Schelmenweise – in Rondeauform – für großes Orchester gesetzt, op. 28 komischen Einakter „Till Eulenspiegel bei den Schildbürgern“, dessen fragmentarisches Libretto er im Frühjahr 1894 in Weimar zu Papier brachte. Der nicht ausgeführte Opernplan mündete ein Jahr später in die Komposition der symphonischen Dichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche, nach alter Schelmenweise – in Rondeauform – für großes Orchester gesetzt“, deren Reinschrift Strauss am 6. Mai 1895 in München beendete. Widmung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 11. Juni 1864 in München; ge­storben am 8. September 1949 in GarmischPartenkirchen. Entstehung Noch während der Abschlussarbeiten an seiner ersten Oper „Guntram“ befasste sich Strauss im Sommer 1893 in Italien mit dem satirisch- „Seinem lieben Freunde Dr. Arthur Seidl gewidmet“: Arthur Seidl (1863-1928), Wortführer der „neudeutschen“ Schule um Wagner und Liszt, Mitarbeiter der „Bayreuther Blätter“ und Verfasser vielgelesener „Straussiana“, war Strauss seit seiner Weimarer Kapellmeister-Zeit freundschaftlich verbunden. Er nahm regen Anteil an der Entstehung des „Guntram“ und der geplanten „Till“-Oper, der er die „wertvolle Dedikation vielleicht noch lieber eingeschrieben gesehen hätte“ als der zuletzt realisierten symphonischen Dichtung. Uraufführung Am 5. November 1895 in Köln im Rahmen des 2. Abonnementkonzerts der Kölner Konzert­ Gesellschaft im Gürzenich-Saal (Städtisches Gürzenich-Orchester unter Leitung von Franz Wüllner). 20 Richard Strauss: „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ Verkappte Identifikationsfigur Nach seiner ersten Oper „Guntram“, so schrieb Strauss rückblickend in seinen „Betrachtungen und Erinnerungen“, sei der Weg frei gewesen für „unbehindert selbstständiges Schaffen“; der „neue subjektive Stil“, den er damals angestrebt habe, manifestiere sich schon wenig später in seiner zweiten Oper „Feuersnot“. Mit gleichem Recht hätte Strauss an dieser Stelle die noch vor „Feuersnot“ entstandene Tondichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ nennen können, denn auch in ihr spielt, um mit Strauss zu reden, „der Mensch sichtbar in das Werk“. Wie sehr der Komponist den Spötter und Spaßtreiber Till als verkappte Identifikationsfigur empfand, geht nicht nur aus Bemerkungen wie dieser, sondern auch aus einem selbstverfassten Opernentwurf hervor, mit dem sich Strauss nach „Guntram“ beschäftigte und der die mittelalterliche Sagenfigur des Till Eulenspiegel als Protagonisten verwendete. Vielleicht ließ er sich dabei von Cyrill Kistlers zweiaktiger Oper „Till Eulenspiegel“ inspirieren, die auf einem Text August von Kotzebues basierte und im April 1889 in Würzburg zur Uraufführung gekommen war – Strauss kannte den heute völlig vergessenen Komponisten und stand mit ihm im Briefkontakt. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass er die Till-Figur bereits als Kind kennen gelernt hatte; denn 1878 – Strauss war gerade 14 Jahre alt – erschien Carl Simrocks moderne Nacherzählung des mittelalterlichen Volksbuchs und zählte binnen kürzester Zeit zu den beliebtesten Kinder- und Jugendbüchern der Gründerzeit. Für die Till-Renaissance die- ser Jahre spricht auch das Unternehmen des Halle’schen Verlegers Knust, der 1885 den ältesten Druck der Till-Legenden, erschienen im Straßburg des Jahres 1515, neu herausgab. Der historische Till Eulenspiegel soll übrigens zu Kneitlingen in der Nähe Braunschweigs geboren und um 1350 in Mölln bei Lauenburg gestorben sein – wo noch heute sein im 17. Jahrhundert erneuerter Grabstein mit Eule und Spiegel gezeigt wird: Ein klarer Fall von Volksetymologie, da der Namensbestandteil „-spiegel“ ursprünglich von französisch „espiègle“ (= Schalk) herrührt. Satirischer Opernplan Das fragmentarische „Till“-Libretto, das Strauss ausarbeitete, trägt den Titel „Till Eulenspiegel bei den Schildbürgern“. Das Thema des genialen Individualisten, des „Weltverächters, der die Menschen missachtet, weil er sie im Grunde liebt“, spiegelt des Komponisten eigene Situation in den „Philisternestern“ Weimar und München, wo er während der Beschäftigung mit der Till-Figur für ihn höchst unerfreuliche Engagements als Kapellmeister innehatte. Strauss ist es in seinem dramatischen Entwurf vor allem um die Darstellung des aus seiner Sicht „ewigen“, folglich immer wiederkehrenden Kampfes des „Fortschritts“ gegen das „Ewig-Gestrige“ zu tun, des intellektuell begabten Künstlers gegen ein Milieu, in dem der philiströse Mief dominiert: Schilda steht für Weimar und München, und in den Schildbürgern sind des Komponisten Landsleute portraitiert, deren bornierte Dummheit von Till Eulenspiegel satirisch bloßgestellt wird. 21 „Dem braven ‚Till’ zum 50. Geburtstag“: Späte Abschrift der Partitur durch den Komponisten „für meine lieben Kinder und Enkel“ (1944) 22 Richard Strauss: „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ Strauss gefiel sich in der Rolle des boshaften Skeptikers und lachenden Philosophen, der sich unter der Tarnkappe des „Narren“ erfolgreich zu verstecken wusste. Wenig später sollte sich in „Feuersnot“ die hier angestrebte Dramaturgie in der (nicht mehr ganz so komischen) Konfrontation des künstlerischen Outsiders Kunrad mit dem spießbürgerlichen „Munichen“ wiederholen: die Parallelen zwischen beiden Werken sind unübersehbar, zumal die „Till“-Oper wie die spätere „Feuersnot“ als Einakter gedacht war, und die Protagonisten beider Opern, von ihren Mitbürgern unerkannt, ihr streng gehütetes Inkognito am Ende wie Wagners Lohengrin in einem breit angelegten Enthüllungsmonolog preisgeben. Rondeau, Scherzo oder einfach „Tanz“ ? Möglicherweise war es die für Strauss betrübliche Einsicht, dass ihm letzten Endes die Qualitäten eines Dichterkomponisten vom Range Richard Wagners abgingen, die ihn den etwas weitschweifigen Entwurf seiner „Till“-Oper beiseite legen ließ. An die Stelle des Komödienprojekts trat zu guter Letzt eine symphonische Dichtung „in Rondeauform“, in die die wichtigsten Wesenzüge der Till-Figur aus dem Opernentwurf übernommen wurden. Die „Reigen“Form, die Strauss im Untertitel seiner Tondichtung nennt, hat aber nichts mit dem klassischen Formideal eines „Rondo“ zu tun, wie wir es aus dem Finalsatz eines dreisätzigen Instrumentalkonzerts kennen: „Rondeau“ ist hier metaphorisch gemeint und betont das Tänzerische des Werks, das nicht umsonst das am häufigsten choreographierte Orchesterwerk von Richard Strauss wurde. Den „Reigen“ der zahlreichen „Till Eulenspiegel“Ballette eröffnete niemand Geringerer als Vaclav Nijinsky, für den Strauss später die Rolle des Joseph im Ballett „Josephs Legende“ schuf. Mit „tänzerisch“ ist aber noch nichts über den tatsächlichen Formverlauf gesagt, den der Komponist wie so oft an eine sehr frei gehandhabte Sonatenhauptsatzform anlehnte. Um die Verwirrung vollständig zu machen, sprach Strauss auch öfters von einem „Scherzo“ – wie später Paul Dukas im Untertitel seiner Tondichtung „Der Zauberlehrling“, die überdeutlich in der Tradi­ tion des „Till Eulenspiegel“ steht und von Dukas kaum anders als französische Hommage an Richard Strauss gedacht sein konnte. „Verflucht komisches Programm“ Wie die meisten Strauss’schen Tondichtungen sind auch „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ untrennbar mit dem Begriff „Programm-Musik“ verknüpft. Im Gegensatz zum weitverbreiteten Klischee von programmatischer Musik als naiv deskriptiver Bebilderung außermusikalischer Inhalte war Strauss der Meinung, ProgrammMusik müsse auch stets Musik sein, „die sich logisch aus sich selbst entwickle“, und so schrieb er folgerichtig an den Dirigenten der „Till“Uraufführung Franz Wüllner, der ihn um inhaltliche Aufschlüsse über die Komposition des „Till Eulenspiegel“ gebeten hatte: „Es ist mir unmöglich, ein Programm zu ‚Eulenspiegel‘ zu geben: in Worte gekleidet, was ich mir bei den einzelnen Teilen gedacht habe, würde sich oft 23 „Wer zuletzt lacht, lacht am besten...“: Richard Strauss an seinem 80. Geburtstag (1944 ) 24 Richard Strauss: „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ verflucht komisch ausnehmen und viel Anstoß erregen. Wollen wir diesmal die Leutchen selber die Nüsse aufknacken lassen, die der Schalk ihnen verabreicht.“ In die Partitur seines Komponisten-Kollegen Wilhelm Mauke, der uns heute allenfalls noch als Verfasser von bemühten Einführungsschriften zu Orchesterwerken von Richard Strauss bekannt ist, hat der Komponist des „Till“ dann doch einige Erläuterungen, in gewisser Weise sogar „Übersetzungen“ seiner Musik ins verbale Medium notiert, die der phantasiebegabte Hörer aber nicht benötigt und allenfalls als redundant empfindet. Spürsinn für das Szenische Romain Rolland war überzeugt, dass der Komponist des „Till Eulenspiegel“ früher oder später komische Opern schreiben würde und lobte an der Partitur, was er den „sens scénique“ nannte. Bühnenwirksamkeit und Spürsinn für das Szenische sind in der Tat Elemente der Strauss’schen „Schreibart“ – eine Beobachtung, die sich beim Blick in sein „Till“-Skizzenbuch bestätigt. Strauss gibt sich dort ein librettoähnliches, bald nur skizziertes, bald ausformuliertes „Programm“ vor, das er dann mit Musik gleichsam „auffüllte“. Er tat es offenbar sehr zur Unzufriedenheit seiner Gattin Pauline, die sich auf vielen Seiten des Skizzenbuchs mit drastischen Bemerkungen zu Wort meldete. So heißt es gleich auf der ersten Seite: „Entsetzliches Componieren !“ Daneben von der Hand des lieben Ehemanns: „An- merkungen der Frau Gemahlin !“ Dafür rächt sich Pauline wieder auf der dritten Seite mit der Bemerkung „Infam !“, auf später folgenden Seiten mit „Verrückt !“, „Scheußlich !“ und zuletzt mit „Schlechtes Geschmier !“ Doch auch der Komponist ist nicht zimperlich: Gegenüber der Eintragung seiner Frau, er sei nicht ganz bei Sinnen, skizziert er seelenruhig eine Passage für die Szene, in der Till zum Tode verurteilt wird, und unterlegt sie mit den Worten: „Die Zunge herausstreckend“ und zuletzt „Lustig auf und davon...!“ „Raffinierteste Décadence“ Die unverwüstliche Keckheit und Kühnheit der Partitur hat noch den alten Anton Bruckner fasziniert, der der Wiener Erstaufführung des „Till Eulenspiegel“ am 5. Januar 1896 in einem Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker unter Leitung von Hans Richter beiwohnte. Bruckner, der im selben Konzert eine Aufführung seiner 4. Symphonie („Romantische“) erleben durfte, musste in einer Sänfte in den Saal getragen werden, da er bereits sehr leidend war. Er ließ sich von der Strauss’schen Tondichtung jedoch so sehr gefangen nehmen, dass er sich eine weitere „Till“-Aufführung am 29. März anhörte, um dem Wiener Musikgelehrten Theodor Helm anschließend zu bekennen, die erste, flüchtige Bekanntschaft mit dem Werk hätte in ihm den Wunsch geweckt, es beim zweiten Mal noch besser zu verstehen, in seinen Kompositionsstil noch tiefer einzudringen. Anders der erklärte Feind der „neudeutschen Schule“ Eduard Hanslick, der schon nach dem Richard Strauss: „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ ersten Anhören zu wissen glaubte, an welchen Stellen die Partitur verbesserungsbedürftig und wo das Fehlen Schumann’scher Stil- und Form­ ideale besonders auffällig, besonders schmerzlich zu bemerken sei. Er verglich Strauss’ orchestrale Komik mit dem Einbruch der Engländer in Transvaal bzw. mit Italiens Kriegsführung in Massanah und schreckte nicht davor zurück, Strauss einen „glänzenden Virtuosen der Mache“, sein „verrücktes Scherzo“ ein Produkt der „raffiniertesten Décadence“ zu nennen. Musikalische Sturzflüge für Verrückte Der schon von Pauline gebrauchte Begriff der „Verrücktheit“ taucht auch in Claude Debussys spektakulärer Pariser Konzertkritik auf, in der just diejenigen Kennzeichen der Partitur, die einen Hanslick um den Verstand brachten, zu Merkmalen von Genialität erklärt wurden. Der Autor des „Pelléas“ hatte am 19. Mai 1901 eine Aufführung der Berliner Philharmoniker unter Leitung Arthur Nikischs gehört, auf die er in der Pariser Zeitschrift „Revue blanche“ mit einer höchst witzigen Glosse reagierte: „Dieses Stück gleicht ‚einer Stunde neuer Musik bei den Verrückten‘. Die Klarinetten vollführen wahnsinnige Sturzflüge, die Trompeten sind immer verstopft, und die Hörner, ihrem ständigen Niesreiz zuvorkommend, beeilen sich, ihnen artig ‚Wohl bekomm’s !‘ zuzurufen; eine große Trommel scheint mit ihrem Bum-Bum den Auftritt von Clowns zu unterstreichen. Man hat gute Lust, lauthals herauszulachen oder todtraurig loszuheulen, und man wundert sich, dass noch alles 25 an seinem gewohnten Platz ist; denn es wäre gar nicht so verwunderlich, wenn die Kontrabässe auf ihren Bögen bliesen, die Posaunen ihre Schalltrichter mit imaginären Bögen strichen und Herr Nikisch sich auf den Knien einer Platzanweiserin niederließe.“ Im Gegensatz zu Debussy betonte Komponisten­ kollege Ferruccio Busoni weniger die expressionistischen oder gar dadaistischen Elemente des „Till“, sondern deutete ihn als Schlüssel­ werk des sich anbahnenden Neoklassizismus: „Strauss’ ‚Eulenspiegel‘ klang“ – schrieb er 1910 an seine Frau Gerda – „wie ein modernerer Papa Haydn, der in seiner naivsten Laune ist und die alten Wiener Aristokraten, die selbst mitspielen, zum Lachen bringt.“ Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung Zeitlebens liebte es Strauss, sich als „Till“ oder „Eulenspiegel“ zu bezeichnen. Nur zu gern schlüpfte er in die Rolle des Schalksnarren, um seine Ansichten ironisch zu verschleiern. Als er 1918 den kabarettistischen Liederzyklus „Krämerspiegel“ schrieb, in dem er die skrupellosen Geschäftemacher unter den Musikverlegern satirisch bloßstellte, vertonte er Texte des berühmtberüchtigten Berliner Theaterkritikers Alfred Kerr, in denen Till Strauss alias Richard Eulenspiegel als Urheber aktuellster Schelmenweisen auftritt: „O Schröpferschwarm, o Händlerkreis, / wer schiebt dir einen Riegel ? / Das tat mit neuer Schelmenweis’ / Till Eulenspiegel...!“ 26 Die Künstler Valery Gergiev Dirigent Die Künstler 27 Sol Gabetta Violoncello nic Orchestra und dem Concertgebouw Orchestra auf. Sie ist gern gesehener Gast bei zahlreichen interna­tionalen Musikfestivals wie dem Menuhin-Festival in Gstaad und dem SchleswigHolstein-Musikfestival. Ihr breites Repertoire, das vom Barock über die Klassik bis hin zur Romantik und frühen Moderne reicht, ergänzt Sol Gabetta stets mit Werken der Gegenwart, die zeitgenössische Komponisten für sie schreiben. Als engagierte Kammermusikerin hat Sol Gabetta ihr eigenes Kammermusikfestival „Solsberg“ in der Schweiz gegründet. Ihre zahlreichen CDEinspielungen wurden vielfach mit Preisen ausgezeichnet, so z. B. mit dem Echo Klassik und dem Gramophon Award. 2012 wurde der AusnahmeKünstlerin der renommierte „Würth Preis der Jeunesses Musicales Deutschland“ verliehen. Die in Córdoba, Argentinien, geborene Sol Gabetta gewann bereits im Alter von zehn Jahren ihren ersten Violoncello-Wettbewerb. Ihre internationale Karriere startete die junge Cellistin 2004, als sie den renommierten „Crédit Suisse Young Artist Award“ gewann, eine der höchst dotierten Auszeichnungen für junge Musiker. In­z wischen tritt Sol Gabetta unter Dirigenten wie Charles Dutoit, Mario Venzago, Thomas Hengel­ brock und David Zinman mit weltweit renom­ mierten Orchestern wie dem Royal Philharmo- Sol Gabetta spielt eines der seltenen und kostbaren Guadagnini-Violoncelli von 1759, das ihr von der Rahn-Kulturstiftung zur Verfügung gestellt wurde. 28 Zu Ehren Lorin Maazels „Lorin Maazel war einer der genialsten Musiker, seine dirigentische Brillanz von nahezu einzigartiger Qualität. Er hat mich immer wieder beeindruckt mit einer zutiefst humanen Grundhaltung. Er war überzeugt, dass Musik das menschliche Leben gerade unter extremen Bedingungen verbessert. Dafür hat er seine ganze Leidenschaft und Energie investiert. Darum hat er sich so intensiv für junge Musiker eingesetzt, sie gefördert, für sie ein eigenes Festival auf seiner Farm in Castelton/ Virginia gegründet. Das wird ihn zu einem wichtigen Vorbild für junge Musiker machen. Dass er mit uns zusammen seinen 85. Geburtstag feiern wollte, empfinden wir als große Ehre. Wir wollen daher die Konzerte an diesem Wochenende ihm, unserem verehrten Maestro, widmen. Nicht nur ich, auch die Kolleginnen und Kollegen aus Direktion und Orchester vermissen ihn – als genialen Musiker und großartigen Menschen.“ Paul Müller Intendant der Münchner Philharmoniker „Ich bin seit 1984 im Orchester – und mein allererstes Konzert bei den Philharmonikern war unter der Leitung von Lorin Maazel mit Mozarts Prager Symphonie und der 5. Symphonie von Tschaikowsky. Mit Lorin Maazel verbinde ich seine unglaubliche Präsenz und Präzision. Er hat eine solche Sicherheit und Souveränität ausgestrahlt, die mich immer wieder verblüfft und begeistert hat.“ Stefan Gagelmann Solo-Paukist 29 „Uns Münchner Philharmonikern war es vergönnt, Lorin Maazel als Chefdirigenten so zu genießen, wie es vielleicht kein anderes Orchester zuvor konnte: altersmilde, aber trotzdem unnachgiebig qualitätsfordernd an uns Musiker – und an sich selbst. Am bewegendsten war für mich sein Antrittskonzert im September 2012 mit Mahlers 9. Symphonie, einer „Liebeserklärung an das Leben“, wie im damaligen Programmheft stand. Ich hätte mir sehr gewünscht, noch viel mehr Zeit und Musik mit Lorin Maazel zu erleben.“ Alexandra Gruber, Solo-Klarinettistin „Ich durfte mit Lorin Maazel neben seiner Position als Chef des Orchesters und neben meiner Vorstandsarbeit einige Zeit verbringen. Wir haben zusammen die Oper „La voix humaine“ von Francis Poulenc für sein CastletonFestival umarrangiert und viele Stunden auf dem Sofa nebeneinander sitzend verbracht. Bei unserer gemeinsamen Arbeit an der Partitur durfte ich nicht nur sein unfassbares Können und Wissen bewundern, sondern vielmehr seine Liebe zur Musik, seine warmherzige Ernsthaftigkeit, Sensibilität und seinen so trockenen Humor. Er war ernsthaft an jeder Idee oder musikalischen Meinung interessiert und hatte großen Spaß daran, quasi unlösbare Probleme in der Orchestrierung stundenlang zu diskutieren, analysieren und mit ins Bett zu nehmen, um die Lösung am nächsten Tag voller Stolz zu präsentieren. Auch wenn er ein bisschen Unbehagen ob der Spielbarkeit mit „…das können meine fantastischen Musiker schon…“ oder „…ganz schön viele Doppelgriffe. Ich hoffe, es verletzt sich niemand…“ beruhigte. Ich hoffe, er konnte sein Buch vollenden, aus dessen Manuskript (auf dem Laptop!) er immer wieder Passagen vorlas und herrliche, rührende Anekdoten etwa von einem Sabbatical auf einer Südseeinsel erzählte. Er war an allem interessiert, was echt war. Am Leben und an den Menschen. Und er war offen für Neues, war interessiert an jeder Verbesserung oder Veränderung. So musste ich ihm un- 30 bedingt bei einem Glas Wein und einer Banane den Umgang mit einem Notensatzprogramm am Computer erklären, weil ihm das Notenschreiben mit der Hand viel zu langsam ging. Er war mit einer Auftragskomposition für einen Wettbewerb beschäftigt und hatte Sorge, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Mit 83 Jahren wurde Lorin Maazel noch quasi ein Fussballfan. Er erkannte die Chance, als ich ihm die Partitur für die FC Bayern Hymne zeigte, Millionen von noch nicht Klassikfans zu erreichen und vielleicht nur für einen Moment deren Neugier zu wecken. Er sagte sofort seine Mitwirkung zu und war voller Begeisterung sogar im Wembley Stadion zum Champions League Finale in London. Dass er bei der Aufnahme das Trikot trug, was aus einer „Anzug noch im Hotel“Notsituation resultierte, reute ihn bei aller Kritik in keiner Sekunde. Wir haben uns mit ihm halb schlapp gelacht. Ich erzählte ihm, dass einige wenige Stimmen zu vernehmen waren, dass die Aktion unseriös sei. Darauf entgegnete er völlig entspannt, dass er diese Leute kenne, die nicht auch mal über sich selbst lachen können. Sie täten ihm Leid und seien in seinen Augen selten wirklich seriös. Seine Professionalität, seine unfassbar genialen Fähigkeiten und seine Intelligenz konnten wohl auf den ersten Blick distanziert oder kühl wirken. Bei genauerem Hinsehen musste man allerdings den warmherzigen, vertrauenden, selbstkritischen und zutiefst idealistischen Menschenfreund erkennen, der sein ganzes Leben darauf verwendet hat, die Welt mit seiner Musik besser zu machen. Ich werde ihn sehr vermissen.“ Matthias Ambrosius Orchestervorstand der Münchner Philharmoniker 31 32 Do. 19.03.2015, 20:00 Uhr 3. Abo k5 Fr. 20.03.2015, 20:00 Uhr 5. Abo c So. 22.03.2015, 19:00 Uhr 5. Abo g5 Franz Schubert Symphonie Nr. 4 c-Moll D 417 („Tragische“) Gustav Mahler Symphonie Nr. 5 cis-Moll Vorschau Do. 26.03.2015, 20:00 Uhr 5. Abo b Fr. 27.03.2015, 20:00 Uhr 6. Abo d Wolfgang Rihm Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 Anton Bruckner Symphonie Nr. 9 d-Moll (Sätze 1–3) Robert Trevino, Dirigent Christoph Eschenbach, Dirigent Tzimon Barto, Klavier Impressum Herausgeber Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4, 81667 München Lektorat: Stephan Kohler Corporate Design: Textnachweise Klaus Döge, Paul Müller, Stefan Gagelmann, Alexandra Gruber und Matthias Ambrosius schrieben ihre Texte als Original­beiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler s­ tellte seine Texte den Münchner Philharmonikern zum Abdruck in diesem Programmheft zur Verfügung; er ­r edigierte bzw. verfasste auch die lexikalischen Angaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Künstlerbiographien: Agenturtexte (Gergiev, Gabetta). Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Graphik: dm druckmedien gmbh, München Druck: Color Offset GmbH, Geretsrieder Str. 10, 81379 München Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt. Fr. 10.04.2015, 20:00 Uhr 6. Abo c Sa. 11.04.2015, 19:00 Uhr 7. Abo d So. 12.04.2015, 19:00 Uhr 6. Abo f Felix Mendelsohn Bartholdy „Elias“ op. 70 Andrew Manze, Dirigent Sally Matthews, Sopran Daniela Sindram, Mezzosopran Christian Elsner, Tenor Michael Volle, Bariton Philharmonischer Chor München, Einstudierung: Andreas Herrmann Bildnachweise Abbildungen zu Antonín Dvoř ák: Antonín Hořejš, Antonín Dvoř ák – Sein Leben und Werk in Bildern, Prag 1955; Michael Raeburn and Alan Kendall (Hrsg.), Heritage of Music, Vol. III: The Nineteenth-Century Legacy, Oxford / New York 1989. Abbildungen zu Richard Strauss: Strauss Archiv München (SAM), Sammlung Stephan Kohler, München. Künstlerphotogra­phien: Marco Borggreve (Gergiev, Gabetta). Abbildungen von Lorin Maazel: Petra Coddington, Christian Beuke, Severin Vogl, wildundleise.de. SOL GABETTA UND DIE MÜNCHNER BEI SONY CLASSICAL PHILHARMONIKER ETTA B A G SOL ERT IN I SIGN AUSE P DER Sol Gabetta hat mit ihrem Freund, dem herausragenden französischen Pianisten Bertrand Chamayou, Werke für Cello und Klavier von Chopin und dessen Freund, dem Cellisten Franchomme, aufgenommen. „Das ist ein Programm mit Glücksmomenten…Chopins Musik aufs Schönste.“ NDR Kultur Foto © Sony Classical International / Marco Borggreve SOL GABETTA DAS CHOPIN ALBUM SOL GABETTA RACHMANINOFF SCHOSTAKOWITSCH Die mit dem ECHO Klassik ausgezeichnete Aufnahme des Cellokonzertes Nr. 1 von Schostakowitsch und der Cellosonate von Rachmaninoff. Mit den Münchner Philharmonikern unter Lorin Maazel und Olga Kern (Klavier). www.solgabetta.de MÜNCHNER PHILHARMONIKER VERDIS REQUIEM Die Live-Aufnahme von Verdis berühmtem Requiem mit den Münchner Philharmonikern unter Lorin Maazel entstand wenige Monate vor seinem überraschenden Tod im Juli 2014. Mit Anja Harteros, Georg Zeppenfeld, Daniela Barcellona und Wookyung Kim. „Eindringlich und überzeugend“ Abendzeitung · Erhältlich ab 27.3.15 www.sonymusicclassical.de www.facebook.com/sonyclassical 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant