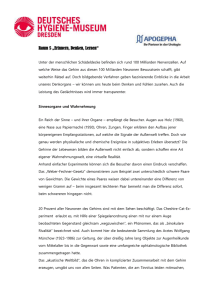Ästhetische Bildung als Beitrag zur Entwicklung der
Werbung

Ästhetische Bildung als Beitrag zur Begabungsförderung: Betrachtung im Lichte interdisziplinärer Lernforschung Prof. Dr. Willi Stadelmann In: Gysin, Béeatrice (Hrsg.): Wozu Zeichnen? Qualität und Wirkung der materialisierten Geste durch die Hand. Verlag Niggli; Sulgen/Zürich 2010, S. 95-102 Man kann einen Menschen nicht lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu tun. Galileo Galilei Ästhetische Bildung ist nicht Mittel zum Zweck oder Vehikel für ausserästhetische Zwecke, sondern Befähigung zu einer eigenständigen und eigenwertigen Weise der Wahrnehmung bzw. Erfahrung und der Gestaltung von Wirklichkeit oder vorstellbarer alternativer Möglichkeiten. Jedem Kind, jedem Jugendlichen und jedem Erwachsenen ästhetische Wahrnehmung und ästhetische Praxis in dieser Eigenständigkeit und diesem Eigenwert zugänglich zu machen, ist eine der Aufgaben recht verstandener Allgemeinbildung heute. Wolfgang Klafki Zur Einleitung eine begriffliche Klärung: Wenn im Folgenden von “Wissen” die Rede ist, das wir uns aneignen oder das wir unseren Schülerinnen und Schülern zugänglich machen wollen, dann sind damit immer sowohl kognitives Wissen als auch Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Strategien und Emotionen gemeint. Das Gehirn verarbeitet all dies grundsätzlich in gleicher Weise. Auch die Entwicklung von zeichnerisch-gestalterischen, handwerklichen, musikalischen und motorischen Fähigkeiten beruht auf Lernprozessen, auf Anpassungsreaktionen im Gehirn. 1. 1.1 Neuropsychologie des Lernens: Lernforschung Eine Disziplin der interdisziplinären Aussagekraft von Resultaten aus der neuropsychologischen Forschung zum Thema Lernen Erkenntnisse der Neuropsychologie sind nicht dergestalt, dass sie die gesamte bisherige Pädagogik quasi über den Haufen werfen und damit absolut Neues für den Unterricht bringen. Was wir heute über Lernen wissen, wissen wir aus der Pädagogik, der Lernpsychologie, der Schulpraxis. Die Neurowissenschaften haben aus sich heraus keine neue Dimension des Lernens aufgezeigt. Doch können sie zum tieferen Verständnis von Lernen einiges beitragen und einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Lernprozessen und zur Unterstützung von pädagogischen Anliegen liefern. Lernen besteht aus hochkomplexen psychisch-biologischen Prozessen und lässt sich nicht auf einfache Rezepte reduzieren. Was lernwirksam ist und was nicht, ist sehr individuell. Darum sollen ausgewählte Erkenntnisse zum Thema Lernen aus der Neuropsychologie im Folgenden als Beitrag zum Wissen über Lernen beschrieben werden; als Ergänzungen und Erläuterungen zu den Erkenntnissen aus den Bildungswissenschaften und der Psychologie. 1.2 1.2.1 Hirnentwicklung zwischen Erbanlagen und sozialer Umwelt Unser Gehirn hat keinen direkten Zugang zur Aussenwelt: Wahrnehmung als eine Grundlage von Lernen Von unseren Sinnesorganen her kommen weder Bilder noch Gerüche noch Töne noch sonst direkte ‚reale’ Gegebenheiten ins Gehirn. Alles Aufgenommene gelangt verschlüsselt, ‚kodiert’ ins Gehirn in Form von elektrischen Impulsmustern. Dort werden die kodierten Signale individuell interpretiert (‚in Bewusstsein umgewandelt’). Das Nervensystem hat ohne Sinnessystem (Sinnesorgane) keine Information, weder über den eigenen Zustand noch über Umweltreize. Die Nervenzellen (Neuronen) und Neuronalen Netzwerke sind nicht selbst die Information sondern nur Träger der Information. Ein vom Sinnessystem abgeschnittenes neuronales Netz kann nicht aus sich selber Information erzeugen. Es gibt keine Information ohne individuelle Interpretation. Die Neurowissenschaften bestätigen also, was wir aus der Psychologie schon lange wissen, dass wir die Welt nie so ‚wahr’ nehmen können, wie sie real existiert. Wir erleben sie im Rahmen der Qualität und der Leistungsfähigkeit unserer Sinnesorgane sowie der Fähigkeit unseres Gehirns, Signale zu interpretieren. Daraus folgt, dass Wahrnehmung nur möglich ist mit Hilfe des Gedächtnisses, das die Fähigkeit eröffnet, Neues mit Vergangenem zu vergleichen. Lernen ist auf Gedächtnis angewiesen. Sowohl Gedächtnis als auch Wahrnehmung sind mit Lernen verbunden. Stets vergleichen wir mit unserem Gehirn Neues mit der bisherigen Erfahrung, mit bisherigem Wissen und bisherigen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wahrnehmung beeinflusst künftige Wahrnehmung; die Wahrnehmungsfähigkeit wird durch stetige aktive Wahrnehmung geschult, entwickelt und verfeinert. Das Gehirn operiert auf der Basis seiner eigenen Geschichte (Schmidt, 1991 S. 146148). Daraus können wir ermessen, wie wichtig für erfolgreiches Lernen die bisherige Lernbiografie des Individuums, sein Vorwissen und Vorkönnen sind. Und wie wichtig der Zugang zur Erkenntnis über die Phänomene, über die Sinneserfahrung ist. Der Entwicklung und Verfeinerung der Sinnesorgane kommt für die Lernbiografie grosse Bedeutung zu: Eine „Schule des Sehens“ beispielsweise, wie sie zur ästhetischen Bildung gehört, trägt viel zur Lernbiografie bei. 1.2.2 Was ist vererbt, was steuert die soziale Umwelt bei? Warum haben Menschen unterschiedliche kognitive Leistungsfähigkeiten? Wir können heute aufgrund von gut gesichertem Wissen davon ausgehen, dass Erbmerkmale (‚Gene’) die kognitive Entwicklung nicht allein bestimmen. Es braucht unabdingbar Umwelteinflüsse, Stimulationen, welche die Wirkung der Gene auf die kognitive Entwicklung erst recht ermöglichen. Für eine optimale Hirnentwicklung braucht es beides: Anlage und Stimulation. Ein Kind kann mit noch so guten Anlagen zum Beispiel für Zeichnen- Gestalten oder Musik auf die Welt kommen; wenn es nicht (früh) Gelegenheit erhält, optisch zu beobachten, optisch und feinmotorisch stimuliert zu werden, zu zeichnen und zu gestalten bzw. nicht früh mit Musik stimuliert wird, in seiner Lebensumgebung in ein ‚Musikbad’ eintauchen und ein Instrument lernen kann, werden sich die Anlagen nicht oder nur suboptimal auswirken. Es gibt keinen Automatismus zwischen Erbanlagen und kognitiver Entwicklung: Ein Kind mit guten Erbanlagen für Bildnerisches Gestalten wird nicht ‚von selbst’, quasi ‚automatisch’ Kunstmaler. Gene und Umwelt wirken also nicht völlig unabhängig voneinander sondern stehen in einer Wechselbeziehung. Stimulation fördert und steuert die Genexpression. Verhaltensgenetische Zwillings- und Adoptionsstudien lassen Schlüsse über den Einfluss der ‚Gene’ und der Umwelt auf die kognitive Entwicklung des Menschen zu (Neubauer 2005 S. 10; Neubauer/Stern 2007 S. 110): „…dass bei Kindern und Jugendlichen etwa 50% der Intelligenzunterschiede in einer Bevölkerung auf die Gene, etwa 25% auf (von Mitgliedern einer Familie geteilte) Umwelteinflüsse (also familiäre Einflüsse) und 20% auf nichtgeteilte Umwelteinflüsse (überwiegend ausserfamiliäre Einflüsse) zurückgeführt werden können (die restlichen 5% sind Messfehler).“ „Bei den nichtgeteilten Einflüssen spielen Quantität und Qualität der ‚Beschulung’ eine grosse Rolle“. Wenn wir diese Erkenntnisse etwas holzschnittartig zusammenfassen, können wir aussagen, dass etwa 50% der Intelligenzunterschiede der Kinder und Jugendlichen auf die Erbanlagen und etwa 45% auf ‚Familie’ und ‚Schule’ zurückführbar sind. Der Einfluss von ‚Familie’ und ‚Schule’ ist also viel grösser, als viele Eltern und Lehrpersonen meinen. Dies legt eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen nahe mit dem Ziel der optimalen kognitiven Entwicklung der Kinder. Eltern (Familie und/oder Peer Group, in welcher das Kind aufwächst) und Schule tragen gemeinsam eine enorme Verantwortung für die Entwicklung der Kinder. 1.2.3 Netzwerk Gehirn Das Gehirn ist das am stärksten vernetzte System, das wir kennen; kein anderes natürliches Netzwerk weist einen derartigen Vernetzungsgrad auf. In unserem Gehirn befinden sich nach Schätzungen etwa 120 Milliarden Neuronen (Nervenzellen), die dreidimensional vernetzt sind. Ein Neuron kann dabei mehrere Tausend Kontakte mit anderen Neuronen haben. So entsteht ein sehr dichtes Netzwerk von Verbindungen und Kontakten, das eine Faserlänge von etwa 400'000 km erreicht (Schätzung). Innerhalb beziehungsweise zwischen den Neuronen laufen elektrische und chemische Prozesse ab, welche das Aufnehmen, Interpretieren und Abgeben von Informationen ermöglichen. Die Stärke, die Leistungsfähigkeit, das Potenzial des Gehirns liegen insbesondere in der Fähigkeit, Informationen verknüpfend zu verarbeiten. Lernen bedeutet auch aus Sicht der Neurowissenschaften vor allem vernetzen, verbinden, einbauen in das bisherige Netzwerk, aufbauen auf dem bisherigen Netzwerk. Aber auch Optimierung des Netzwerks durch Abbau von Verbindungen, die nicht dienlich sind („pruning“) und auch schneller machen von Verbindungen (Myelisiniserung von Axonen). Unser Gehirn trennt Sinneserfahrungen und ‚Lernstoff’ nicht nach Disziplinen, sondern verarbeitet sie ‚verbunden’. Wenn wir etwas sehen, ordnen wir auch Bewegungs-, Hör-, Tastund Riecherlebnisse zu, die wir dann später mit erinnern. Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass offenbar Lernprozesse, welche Vernetzung fördern und die Fähigkeiten des Gehirns zu vernetzen ausnützen, erfolgreicher sind als ‚lineare’, isolierte, zersplitternde Formen. Deshalb sind wohl Unterrichtsmethoden, die verschiedene Eingangskanäle der Wahrnehmung ansprechen, vielseitige Fähigkeiten, Fertigkeiten und Tätigkeiten anregen und so das Gehirn vielseitig beanspruchen, zu bevorzugen. 1.3 1.3.1 Neuronale Plastizität: Hirnentwicklung und Lernbiographie Plastizität des Gehirns Gut abgesicherte Forschungsresultate aus den Neuro-Wissenschaften belegen, dass Lernprozesse nur möglich sind, weil sich das Gehirn ein Leben lang entwickeln kann. Lernen und Hirnentwicklung sind miteinander gekoppelt. Informationsübertragungen werden durch Veränderungen an Synapsen (Kontaktstellen im neuronalen Netzwerk) verbessert. Neue Synapsen können gebildet werden, was zu neuen Verknüpfungen, zur Erweiterung des Netzwerks führt. So können Gehirnteile durch Lernen wachsen; parallel dazu können aber auch Vernetzungsteile, die nicht gebraucht werden, abgebaut werden (‚pruning’). Lernen prägt (auch makroskopisch) Strukturen des Gehirns: Das Gehirn ist plastisch. Dazu kommt, dass die Geschwindigkeit der Informationsübertragung durch Lernen gesteigert werden kann. Gehirnareale entwickeln sich, wenn sie stimuliert werden; Veränderungen im Gehirn erfolgen erstaunlich schnell, vor allem in der Kindheit. Es sei erwähnt, dass schon lange vor der Geburt das Gehirn durch Umwelteinflüsse mitgeformt wird. Aber auch erwachsene Gehirne bleiben grundsätzlich flexibel; die Plastizität geht aber mit zunehmendem Alter zurück (vgl. weiter unten). Ohne in einen ‚Frühförderungs- Wahn’ zu verfallen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten früh gelernt und eingeübt werden müssen, damit sie ein Leben lang erfolgreich praktiziert werden können. Gut untersucht sind diesbezüglich das Lernen von Musikinstrumenten, von Sprachen und von Bewegung (Feinmotorik). Wichtig ist, dass Veränderungen des Gehirns durch Üben aufrecht erhalten werden müssen; auch dies zeigt sich beispielhaft in der Musik beim Instrumentalspiel, beim Sprachenlernen und bei der Entwicklung der Feinmotorik, die für Zeichnen und Gestalten von grosser Bedeutung ist. Aktivitäten des Lernenden, das (motorische oder verinnerlichte) ‚Selbst–Tun’ sind für den Lernerfolg unabdingbar. Das Gehirn folgt dem Grundsatz ‚Use it or lose it’. Das Gehirn ist also das Resultat seiner Benutzung. Lebenslanges Lernen setzt lebenslange Aktivitäten voraus; anregungsarme Umgebungen sind schlecht für die Entwicklung und Erhaltung der Lernfähigkeit. Jeder Lernprozess schafft Grundlagen für weiterführende Lernpozesse. Nicht nur Wissen wird gelernt, sondern es entstehen gleichzeitig neue Potenziale und Lernstrategien für weiterführendes Lernen. Neue Strukturen werden auf bisherigen aufgebaut. Dies sind weitere Belege für Erkenntnisse, die wir bereits aus der Psychologie und Pädagogik kennen: Das Vorwissen und Vorkönnen, die bisherige Lernbiografie eines Lernenden spielen für sein weiteres Lernen eine entscheidende Rolle. Vorteile des Erwachsenenlernens gegenüber dem kindlichen Lernen liegen insbesondere in der breiteren Lernbiografie, der Erfahrung, dem umfangreicheren nutzbaren Wissen, den ausgebildeten und bewährten Lernstrategien. So können zunehmende Defizite der Plastizität beim Älterwerden erfolgreich kompensiert werden. Im Übrigen zeigen neuere Untersuchungen, dass die Plastizität des Gehirns erstaunlich gross bleibt bis ins hohe Alter; dies im Gegensatz zu früheren Auffassungen, welche die Plastizität nach der Pubertät als relativ gering beschrieben. Durch Lernen entsteht zunehmend Individualität, weil sich die Gehirne der Menschen im Einklang mit ihrer einzigartigen Biografie entwickeln. Gehirne unterscheiden sich in ihren (Fein-) Strukturen wie Fingerabdrucke. Wenn also in einer Schulklasse 25 Schülerinnen und Schüler sitzen, bringen alle ihre individuelle Lernbiografie, ihre individuelle Hirnstruktur mit. Bereits diese Erkenntnis macht klar, dass Gruppen von Schülerinnen und Schülern, egal wie und wie oft sie durch Selektion gebildet wurden, immer heterogen sind. Homogene Klassen gibt es nicht. Heterogenität von Gruppen ist natürlich (Buholzer/Stadelmann 2009). Ziel aller didaktischen Massnahmen auf allen Schulstufen bis in die Erwachsenenbildung muss die Stimulation der Lernenden zum ‚Selbst- Tun’ sein. Im Sinne von: more learning – less teaching. Und: Menschen sind Individuen, die nicht alle gleich gefördert werden können. Individualisierung des Unterrichts ist unabdingbar. Lernen verändert also unser Gehirn ein Leben lang; durch Lernprozesse findet eine lebenslange Hirnentwicklung statt. 1.4 Emotionen fördern Lernprozesse Schon seit langer Zeit wissen wir, dass Emotionen und Lernen eng zusammenhängen. Die Begriffe ‚Emotion’ und ‚Gefühl’ werden im allgemeinen Sprachgebrauch synonym verwendet: In der Regel ist bei der üblichen Verwendung des Wortes Emotion der Begriff des Gefühls eingeschlossen. Antonio R. Damasio unterscheidet zwischen Emotionen und Gefühlen und zeigt in seiner Theorie, dass Emotionen den Gefühlen voraus gehen. Emotionen sind nach Damasio individuelle physische (körperliche) Reaktionen auf Reize. Gefühle sind individuelle psychische Interpretationen der physischen Reaktionen, also der Emotionen. Ein einfaches Beispiel: Wenn uns etwas Angst einjagt, reagiert unser Organismus physisch; dies zeigt sich an typischer Mimik, an erhöhter Herzfrequenz, am bleichen Gesicht, an weit geöffneten Augen, an feuchten Händen. Diese Primär-Reaktion bezeichnet Damasio als Emotion. Die individuelle psychische Interpretation, das individuelle ‚Fühlen’ und psychische Bewerten der Emotion bezeichnet er als Gefühl. „Die Emotionen treten auf der Bühne des Körpers auf, die Gefühle auf der Bühne des Geistes.“ „Emotionen und Gefühle sind im Zuge eines kontinuierlichen Prozesses so eng miteinander verknüpft, dass wir verständlicherweise dazu neigen, sie als ein einziges Phänomen wahrzunehmen.“ (Damasio 2003, S. 101 ff). Emotionen/Gefühle beeinflussen Informationsvorgänge und damit auch das Lernen. „Gefühle sind einerseits Ergebnisse von Informationsverarbeitungsprozessen und beeinflussen andererseits selbst Informationsvorgänge“. „Beim Prozess der Informationsverarbeitung handelt es sich eigentlich immer um ein Zusammenwirken kognitiver und emotionaler Prozesse. Emotionale (und motivationale) Faktoren sind selbst bei den abstraktesten Formen intellektueller Leistungen beteiligt“ (Edelmann 2000, S. 240 ff). Gefühle wirken bei der Informationsverarbeitung, beim Lernen als selektiver Filter. „Der Filter ist durchlässig für Material, das mit der Stimmung des Wahrnehmenden übereinstimmt, nicht aber für inkongruentes Material. Wichtige Faktoren für die Gedächtnisleistung sind ein intensives Gefühl bei der Informationsaufnahme und ein hoher Grad an Bedeutsamkeit des Lernmaterials. Vergessen wird vor allem der mangelnden subjektiven Wichtigkeit des Materials und der fehlenden Aufmerksamkeit bei der Informationsaufnahme zugeschrieben.“ (ebd.). Aufmerksamkeit ist abhängig von Emotionen und Gefühlen. In verschiedenen Untersuchungen konnte bestätigt werden, dass Lernende mit positiven (fördernden, stimulierenden, wohltuenden, hoffnungsvollen, erfolgsversprechenden) Gefühlslagen, besser in der Lage sind zu lernen und komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Den Zusammenhang zwischen Gefühlslage und Motivation beschreibt Edelmann: „Ein aktuelles leistungsmotiviertes Handeln findet besonders dann statt, wenn die Tendenz ‚Hoffnung auf Erfolg’ die Tendenz ‚Furcht vor Misserfolg’ überwiegt.“ (ebd. S. 254) Einen Menschen motivieren bedeutet also unter anderem, ihm die Möglichkeit eröffnen, Hoffnung auf Erfolg seiner Anstrengungen, seiner Aktivitäten zu haben. Förderorientierte, zielgerichtete Haltung von Eltern und Lehrpersonen steht im Vordergrund. Schulisches Lernen muss sich noch mehr von Defizitorientierung zu Förderorientierung entwickeln. Beurteilung von Leistung muss fördernden Charakter haben. Also: Individuell als bedeutsam und wichtig empfundene Ereignisse werden schneller gelernt und besser gespeichert. Es liegt auf der Hand, dass gerade Musik und Bildnerisches Gestalten eng mit Emotionen und Gefühlen verbunden sind. 1.5 Begabung und Intelligenz Das Wort Begabung enthält den Begriff ‚Gabe’. Es suggeriert also, was historisch gesehen verständlich ist, dass Begabung jedem Menschen von Geburt an gegeben ist; bestimmt und unveränderlich. Diese Ansicht von Begabung als Konstante im Leben eines Menschen muss korrigiert werden: Wie bereits weiter oben ausgeführt, tritt der Mensch mit seinem Lern- und Entwicklungspotenzial in Beziehung zu seiner Umwelt. Es entsteht eine lebenslange Wechselwirkung, in der das Individuum seine Umwelt beeinflusst und verändert und die Umwelt das Individuum beeinflusst und verändert (Plastizität). In dieser Wechselwirkung entwickelt sich das Leistungspotenzial, das Leistungsvermögen des Individuums, seine Begabung. Als Begabung können wir also allgemein das Leistungsvermögen insgesamt bezeichnen. Spezieller ist mit Begabung die jeweils individuelle Ausprägung der leistungsbezogenen Entwicklungsmöglichkeiten gemeint, also jener Faktoren, die bei entsprechender Disposition und langfristiger systematischer Anregung und Förderung das Individuum in die Lage versetzen, auf Gebieten, die in der jeweiligen Kultur als wertvoll betrachtet werden, anspruchsvolle Tätigkeiten durchzuführen (persönliches, individuelles Begabungsprofil). Begabung ist also keine Konstante, Begabung ist ein lebenslanger Prozess zwischen Anlage und Umwelt, zwischen Potenzial und Stimulation. Wenn Begabung eine Konstante wäre, könnte man auch nicht von Begabungsförderung sprechen; denn Konstantes ist nicht förderbar. Begabungsförderung ist ein Leben lang möglich und nötig. Intelligenz kann verstanden werden als allgemeine Denk- und Lernfähigkeit, mit unterschiedlichen individuellen Ausprägungen. Sie umfasst zum Beispiel die Fähigkeiten eines Individuums, mit verbalem Material, mit Zahlen und ihren Beziehungen, mit figuralen und räumlichen Gegebenheiten umzugehen. Die genaue ‚Natur’ der Intelligenz ist unklar; jedenfalls befähigt hohe Intelligenz zu raschen, sicheren, effektiven und effizienten mentalen Tätigkeiten. Sie lässt sich durch standardisierte Tests relativ präzise erfassen und gibt einen Zustand zu einem definierten (Mess-)Zeitpunkt wieder. Intelligenz ist ein Teil von Begabung, der standardisiert messbar gemacht wird. Begabung und Hochbegabung lassen sich also nicht einfach durch einen Intelligenzquotienten erfassen und definieren. Begabung umfasst mehr als Intelligenz, da die Denk- und Lernfähigkeit allein noch nicht von selbst, quasi automatisch, besondere Leistungen hervorbringt. Leistungswille, sachbezogenes Interesse, Arbeitsdisziplin und Selbstvertrauen sind Begabungsfaktoren, die durch die geschilderte Wechselwirkung lebenslang entstehen und in ihrem organisierten Zusammenwirken mit der Denk- und Lernfähigkeit erst besondere Leistungen ermöglichen. Die Gesamtorganisation all dieser Faktoren kann mit dem Begriff ‚Persönlichkeit’ umschrieben werden. Jedes Kind ist eine Person und damit ein Einzelfall. Begabungsförderung ist im weiteren Sinne immer Persönlichkeitsentwicklung (iPEGE 2009 S. 17-20). 2. Was heisst Wissen ‚vermitteln’ und Wissen ‚erinnern’? Wissen und Verhalten werden im Gehirn nicht als Ganzes, sozusagen in fest umrissenen Schubladen abgelegt. Die Speicherung im Gehirn erfolgt netzwerkartig verteilt. Bevorzugt abgelegt werden offenbar individuell besonders beeindruckende, emotional begleitete ‚Eckwerte’, ‚Ankerpunkte’ des Wissens und Verhaltens, und zwar je nach Qualität an verschiedenen Orten: Farbeindrücke an anderen Stellen als Eindrücke über Form und Materialbeschaffenheit oder als Gerüche oder als Töne. Beim Erinnern und Reproduzieren setzt das Gehirn das Gelernte aus den abgelegten Eckwerten wieder neu zusammen. Die Vorstellung, Lehrpersonen könnten den Schülerinnen und Schülern Wissen vermitteln, weitergeben, so dass sie es nachher ‚besitzen’, muss revidiert werden. Bedeutung, Wissen, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Fertigkeiten können nicht von der Lehrperson auf die Schülerinnen und Schüler übertragen werden. Die Bedeutung dessen, was sie vermitteln will, wird ausschliesslich im Gehirn der Lernenden individuell interpretiert und erzeugt. Lernende konstruieren ihre Welt selbst. Wissen und Verhalten werden nicht passiv erworben, sondern in jedem Individuum aktiv konstruiert. Lehrpersonen haben keinen direkten Zugriff auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler; sie können ‚nur’ Umgebungen schaffen, Unterlagen bereitstellen, emotionelle Zugänge ermöglichen, stimulieren, alles mit dem Ziel, dass Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden und individuell ihr Wissen und Verhalten konstruieren. Erinnern und Reproduzieren bedeutet immer Neu-Interpretieren. „Erinnerungen werden nicht so abgerufen, wie sie eingespeichert wurden, sondern wir beziehen beim Abruf inzwischen angesammeltes zusätzliches Wissen mit ein und rufen Information entsprechend unserer momentanen, zum Zeitpunkt des Abrufs vorherrschenden Gemütslage ab.“ Jede Erinnerung zieht eine Neueinspeicherung nach sich, „wodurch die erneut eingespeicherte ‚alte’ Information zwar einerseits gefestigt wird, andererseits aber auch modifiziert an gegenwärtige Gegebenheiten angepasst wird“ (Markowitsch 2002 S. 83 ff). Erinnertes ist nicht identisch mit dem Gespeicherten und bei der Speicherung Erlebten. Erinnern bedeutet neu interpretieren; Erinnerungen entwickeln sich im Rahmen des weiteren Lernens. Diese Tatsache relativiert unseren Zugang zur ‚wahren’ Welt noch mehr; und macht soziale Kommunikation und soziales Lernen so wichtig. 2.1 Computer-Einsatz zur Förderung des Lernens? Ich möchte vorweg nehmen, dass ich den Gebrauch von Computern als Hilfsmittel in der Schule als sehr wichtig erachte. Wir können Kinder nicht an dieser neuen Kulturtechnik vorbei schulen; Computer gehören zur Welt der Kinder und Erwachsenen und beeinflussen unser Leben immer mehr. Trotzdem seien einige konstruktiv-kritische Anmerkungen erlaubt: Computer und Internet gelten heute als der Zugang zum Wissen. Dies ist sicher vom technischen Aspekt her richtig; doch zu welchem Wissen? Das Internet gaukelt vielen Schülerinnen und Schülern vor, mit dem Abrufen von Information sei auch schon gelernt. Immer wieder höre ich Schülerinnen und Schüler sagen: “Wozu brauchen wir eigentlich noch den ganzen Schulkram mit Unterricht durch Lehrpersonen usw.; wir können doch alles ganz einfach aus dem Computer runterladen!” Computer und Internet spiegeln also vor, man könne sehr schnell und ohne Anstrengung zu Erkenntnissen kommen. Dies führt zur Idee bei vielen Schülerinnen und Schülern, man müsse nichts mehr mit eigener Aktivität und Anstrengung erarbeiten, nachvollziehen, üben. Jedoch: Das Sitzen vor dem Bildschirm lässt nur noch bestimmte, stark reduzierte Formen der Wahrnehmung zu, die ein aktives und selbst gesteuertes Erfassen von Phänomenen vermindern. Der Computer darf und soll den Schülerinnen und Schülern die persönliche Auseinandersetzung mit Lerngebieten nicht abnehmen. Der Computer kann Wissen nicht ‚vermitteln’. Auch beim “E- Learning“ müssen aktive Prozesse im Gehirn der Kinder ablaufen, damit Lerneffekte entstehen. Hartmut von Hentig hat dies 2001 an einem Vortrag wie folgt formuliert (Vortrags- Notiz WS): “Computer drohen zu schlechten Schulbüchern zu werden, bei denen nicht mehr die Phänomene der Ausgangspunkt des Fragens und Rätselns sind. Vielmehr werden den Schülern Fragen ins Maul geschmiert und die Antworten gleich hinterher geschoben“. Lehrpersonen müssen den Einsatz von Computern gut planen, damit sie wirklich als Hilfsmittel für das Lernen wirken. Hier ist übrigens noch viel Arbeit im didaktischen Bereich zu leisten. Ich stelle bei Gesprächen mit Lehrpersonen und bei Unterrichtsbesuchen zum Teil immer noch recht grosse Hilflosigkeit fest, wie Computer im Deutsch-, Französisch-, Geschichte-, Musik- und Zeichen-Unterricht eingesetzt werden können. Immer noch wird computergestützter Unterricht vor allem der Mathematik und den Naturwissenschaften ‚zugeschoben’. Der Einsatz von ‚E- Learning’ darf Primärerfahrungen der Schülerinnen und Schüler nicht schmälern. Es wäre aus uns nun einsichtigen Gründen fatal, wenn Schülerinnen und Schüler das Lernen fast ausschliesslich über den Bildschirm, über eine Metaebene, erfahren müssten. Der direkte Kontakt zu Menschen und zu den Phänomenen ist unabdingbar. Und damit auch das Selbst- Gestalten, das Mit- Eigenen- Händen- Nachvollziehen z.B. durch Zeichnen und Gestalten. Computer können also bezüglich Förderung von Lernprozessen bei unseren Kindern die primäre Wahrnehmung nicht ersetzen. Der Computer kann als Instrument ergänzen und anregen; wenn der Computer zeichnet, ersetzt er damit das eigenaktive Zeichnen, das die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder fördert, nicht. Das Kind muss tätig sein, nicht der Computer allein. Ich plädiere deshalb dafür, dass Lehrpersonen als eine Art Kontrast-Verhalten zum ‚E- Learning’ Primärerfahrungen und soziale Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler besonders fördern. Der Wahrnehmungs- Schulung muss grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit zukommen: Genaues Hinsehen, Hinhören, Fühlen und Spüren, Nachvollziehen. 3. Mehrperspektivische Bildung Die geschilderten Erkenntnisse der interdisziplinären Lernforschung unterstützen das Postulat der mehrperspektivischen Bildung (Wanzenried 2004 S.38/39; Hervorhebungen WS). - - - „Bildung ist nur als Prozess beschreibbar und nicht als Kanon von Inhalten. In solchen Prozessen verändert sich die Wahrnehmung von Objekten, von Situationen, Konstellationen so, dass eine Sache für den Menschen nachher nicht mehr dieselbe ist. Bildung ist die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln und Fachgrenzen zu überschreiten. Solcher Perspektivenwechsel beinhaltet die Kompetenzen, die Sichtweise eines Gesprächpartners versuchsweise zu übernehmen, eine Sache aus einem anderen fachlichen Blickwinkel zu betrachten sowie die Grenzen zwischen Fachdisziplinen zu überschreiten. Bildung braucht die Kombination differenzierter Zugriffe und wird durch Vereinseitigung und Fixierung verhindert. Bildung wird erhofft, wo eine breite Palette von Erfah- - rungs- und Handlungsmöglichkeiten zu tätiger Auseinandersetzung führen. Dabei wirken kombinierte und komplexe Zugriffe dem Entstehen von Fixierungen und Vorurteilen entgegen. Bildung geschieht im sozialen Kontext und ist an Selbstreflexion gebunden. (…)“ Also: Bildung setzt die Fähigkeit voraus, „den Blick zu wechseln, und Bekanntes mit fremdem Blick neu zu sehen“. „Bildung als Fähigkeit, verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten und Gestaltungsmittel zu gebrauchen, um Wirklichkeiten damit unterschiedlich zu konstruieren und mitzuteilen, was im eigenen Kopf wirksam wurde.(…)“ (ebd.) Aus diesen Erkenntnissen wird erst recht sichtbar, welch hohen Stellenwert ‚ästhetische Bildung’ für den Menschen hat. 4. Instrumentalspiel und Bildnerisches Gestalten als Beispiele 4.1 Instrumentalspiel Neuere Untersuchungen bestätigen, dass Musik ein hohes Potenzial für die Hirnentwicklung aufweist. Instrumentalunterricht (untersucht ist speziell das Lernen von Tasteninstrumenten), wenn er früh einsetzt (vor dem achten Altersjahr), hat intensiven Einfluss auf die Mikrostruktur des Gehirns. So ist gut belegt, dass das Gehirn professioneller Musikerinnen und Musiker sich signifikant unterscheidet von demjenigen musikalischen Laien. Im Lichte der Erkenntnisse über die Plastizität des Gehirns erstaunt diese Tatsache nicht. Das Spielen eines Stücks vom Blatt ist für das Gehirn ein hochaktiver, komplexer Vorgang. Das Umwandeln des abstrakten Notenbilds letztlich in Feinmotorik der Hände erfordert komplexe und koordinierte Tätigkeiten des Gehirns. Diese vielseitigen Tätigkeiten regen das Gehirn intensiv an und fördern Entwicklungsprozesse im Rahmen der Plastizität. Es gibt Hinweise, dass Instrumental-Spiel die Gehirnentwicklung im Sinne der Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens sowie, als Folge davon, des abstrakten Denkens, was sich wiederum positiv auf die Mathematik- Kompetenzen auswirkt, fördert. Die verschiedenen Studien der letzten Jahre geben Hinweise darauf, dass früher Musikunterricht (Instrumentalunterricht) unter anderem auch folgendes bewirkt (Jäncke 2008, S. 194/195): - bessere verbale Gedächtnisleistungen bei Musikern unter bestimmten Umständen besseres visuelles Gedächtnis bei Musikern bessere Leistungen in visuell- räumlichen Tests offenbar unterstützen Musizieren und Musikbegabung die Rechenleistung ausserordentliche motorische Fähigkeiten eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit. Musik hat also klar eine Einwirkung auf die Gehirnentwicklung, und Musik fördert die Begabungsentwicklung der Menschen. Die Forschungsresultate können aber nicht so interpretiert werden, dass Kinder, die beginnen, ein Instrument zu spielen, dann plötzlich viel bessere Mathematiknoten in der Schule erzielen. Zu viele andere Einflüsse spielen für das Erreichen einer guten Mathematiknote mit, so dass der Anteil des Instrumentalunterrichts wohl schwer zu messen ist. Die Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass Musikunterricht, vor allem, wenn er früh einsetzt, viel zur Gehirn-Entwicklung unserer Kinder beitragen kann. Übrigens: Folgen auf die Hirnentwicklung durch Instrumentalunterricht sind auch bei Erwachsenen nachweisbar; es lohnt sich also auch später noch, ein Instrument zu lernen; die Folgen auf die Hirnentwicklung sind dann allerdings nicht mehr so tief greifend wie bei den Kindern. 4.2 Bildnerisches Gestalten: Sehen und Sichtbarmachen Bildnerisches Gestalten besteht aus einer Summe hochkomplexer Aktivitäten, welche optische Wahrnehmung, Gedächtnis (Vergleich von äusserer ‚Realität’ mit innerer Vorstellung; Interpretation), Emotionalität, Kreativität und Feinmotorik der Hände miteinander verbinden. Zu Bildnerischem Gestalten gehören also sowohl äusserliche, ‚organische’ Tätigkeiten wie aktives sehen und beobachten, zeichnen, malen, plastisch bilden als auch ‚verinnerlichte’ Tätigkeiten wie interpretieren, andere Sichtweisen erleben, verschieden Ausdrucksformen erkennen. Ästhetische Bildung zum Beispiel durch Bildnerisches Gestalten öffnet also Spielräume, Spielfelder, Räume für innere Bilder, für eigene Interpretationen, für Imaginationen, für elementare Erfahrungsmöglichkeiten. Das Gehirn und nicht das Auge entscheidet, welche Objekte in unserem Blickfeld für uns subjektiv sehenswert sind und welche nicht. Durch Bildnerisches Gestalten werden die Wahrnehmungsmöglichkeit des Sehsinns und des Tastsinns (beim plastischen Arbeiten) und die Interpretationsfähigkeit des Gehirns geschärft. Es fördert die Beobachtung („man sieht, was man weiss“). und ist ein wichtiger Zugang zur Welt. Beim Bildnerischen Gestalten gibt die Bewegung der Hand individuellen Wahrnehmungen und Interpretationen Form. Wahrnehmungen werden aktiv nachvollzogen, verändert, verfremdet, symbolisiert, abstrahiert. Räumliche Vorstellung wird zu Form auf der Ebene oder im Raum (Plastik). Die Bewegung der Hand, die Bewegungen der Augen (Sakkaden) beim aktiven Wahrnehmen geben Impulse auf spezifische Vernetzungen im Gehirn. So fördert die Darstellung der ‚realen’ Wahrnehmung (‚Abzeichnen’) die Wahrnehmungsfähigkeit des Gehirns; das Nachvollziehen durch die Hand codiert die Wahrnehmung vielseitiger und nachhaltiger und speichert sie effizienter ab. Bildnerisches Gestalten schult also die visuelle Wahrnehmung und fördert das visuelle Lernen. Es fördert aber auch die innere Vorstellungskraft und die Kreativität. Bildnerisches Gestalten ist verbunden mit aufwändiger Aktivität im Gehirn, die, davon können wir ausgehen, analog zum Instrumentalspiel hohe Anregung auf Veränderung und Optimierung von Vernetzungsstrukturen gibt und damit einen Beitrag zur Begabungsentwicklung leistet. Der Einfluss von Bildnerischem Gestalten auf Hirnentwicklung ist allerdings im Vergleich mit dem Einfluss von Instrumentalspiel noch wenig untersucht. Die Aussagen in diesem Kapitel stützen sich also vorwiegend auf Analogieschlüsse. Auch hier können wir aber davon ausgehen, dass eine gestalterische Tätigkeit früh im Leben unserer Kinder gefördert werden muss, um nachhaltige bildnerische Wirkung zu erzielen, weil eben die Plastizität des Gehirns in früher Kindheit besonders ausgeprägt ist. Hartmut von Hentig bezeichnet in seinen „Schriften zur ästhetischen Erziehung“ die Kunst als Massstab der Ästhetischen Erziehung (Hentig 1987 S.113) und schreibt: „Wenn Kunst all das ist, was uns fragen macht, ob etwas möglich ist (und nicht nur, ob es notwendig ist), ob etwas so oder anders gewollt werden kann (und nicht nur, ob es von Natur so ist), ob es Genuss bringt (und nicht nur ob es nützt); wenn Kunst das ist, was uns erlaubt, Alternativen zu der uns geläufigen Erfahrung wahrzunehmen; wenn sie das ist, was uns erlaubt, mit den Widersprüchen zu leben, die die Ratio einstweilen oder nie auflösen kann – dann scheint sie mir hinreichend praktisch definiert und wert, unter grossen Anstrengungen erhalten zu werden.“ (ebd. S. 103). Ästhetische Bildung unserer Kinder in Familie und Schule ist nicht einfach nice to have sondern ein unabdingbarer Beitrag zur Begabungsentwicklung für das Verstehen der Welt. Literatur Buholzer, Alois; Stadelmann, Willi: Homogenität als Illusion. Kognitive Heterogenität als Herausforderung und Binnendifferenzierung. In: ide. Informationen zur Deutschdidaktik 3/2009: „Sekundarstufe I“. Innsbruck, Studienverlag Damasio, Antonio: Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen. List, München (2003) Edelmann, Walter: Lernpsychologie. Weinheim Beltz PVU (2000) Von Hentig, Hartmut : Ergötzen, Belehren, Befreien. Schriften zur ästhetischen Erziehung. Fischer, Frankfurt am Main (1987) International Panel of Experts for Gifted Education (iPEGE): Jäncke, Lutz: Markowitsch, Hans-Joachim: Neubauer, Aljoscha: Neubauer, Aljoscha; Stern, Elsbeth: Wanzenried, Peter: Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.): Professionelle Begabtenförderung. Özbf, Salzburg (2009) Macht Musik schlau? Hans Huber, Bern (2008) Dem Gedächtnis auf der Spur. Vom Erinnern und Vergessen. Darmstadt, Primus (2002) Begabung möglichst früh erkennen und fördern; in: journal für begabtenförderung 2/2005 Lernen macht intelligent. Warum Begabung gefördert werden muss. München, DVA (2007) Unterrichten als Kunst. Zürich, Pestalozzianum (2004) Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Frankfurt am Main, Suhrkamp Wissenschaft (1991).