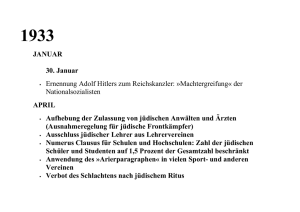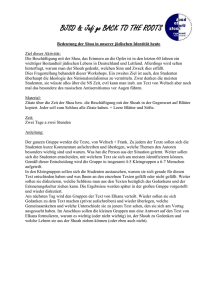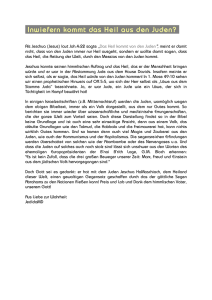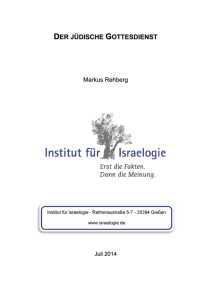Jüdische Existenz in Deutschland
Werbung

Jüdische Existenz in Deutschland Zur Gegenwart vieler offener Fragen Hanno Loewy1 Im Januar 1996 hielt der israelische Staatspräsident im Deutschen Bundestag eine vielbeachtete Rede. Vorgetragen im Ton eines persönlichen Bekenntnisses, entstammte diese Rede gleichwohl der Feder des bekannten israelischen Schriftstellers Meir Shalev. Doch das „Ich“, in dessen Namen Weizman zu den Deutschen und zu den in Deutschland lebenden Juden sprach, erweist sich als „Wir“. Als israelischer Präsident sprach er im Namen der Juden der Welt. „Ich bin nicht mehr der in allen Wegen der Welt wandernde, vom einen Exil ins andere vertriebene Jude. Aber jedem Juden in jeder Generation ist es auferlegt, sich so zu sehen, als sei er dort gewesen.“ Die Thora schreibt allerdings vor, sich im Exil daran zu erinnern, dass „wir“ schon einmal befreit worden sind, dass es folglich Hoffnung für die Juden gibt. In wessen Namen also sprach der Präsident, wessen Präsident sprach hier? Bei einem Treffen mit deutschen nichtjüdischen wie jüdischen Studenten anlässlich seines Besuches in Deutschland drückte Weizmann sich deutlicher aus: Er könne „sich über im Ausland lebende Juden nicht freuen“, und er stellte fest, dass „das einzige Land, in dem ein Jude als Jude leben kann, das Land Israel (sei). Die Errungenschaft des jüdischen Volkes liegt nicht in der Rückkehr von Juden nach Deutschland. Für mich repräsentieren die Juden in Deutschland nicht das jüdische Volk, sondern lediglich die in Deutschland lebenden Juden.“ Der israelischen Tageszeitung „Ha’aretz“ blieb es vorbehalten, darauf hinzuweisen, dass „der Präsident (sich) keine Gedanken darüber gemacht (habe), dass auch er mit seinen Worten bestenfalls die jüdischen Bürger des Staates Israel repräsentierte, dass er darüber hinaus als Präsident des Staates Israel nicht unbedingt zum Präsidenten aller Juden der Welt werde.“2 Die Frage, ob es seine Pflicht als israelischer Staatspräsident sei, auch für die arabischen Bürger Israels zu sprechen, soll uns noch beschäftigen. Wer spricht hier also für wen, mit welchem Recht? Für viele Juden in Deutschland, ob sie sich nun selbst lapidar als in Deutschland lebende Juden, als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens oder als deutsche Juden bezeichnen, war Weizmans Rede eine Provokation. Und das nicht, weil in ihr etwas völlig Neues zum Ausdruck gekommen wäre, sondern weil Anlass und Zeitpunkt dieser Rede eine hohe symbolische Wirkung besaßen. Es war der erste Staatsbesuch eines israelischen Präsidenten in Deutschland, eine Rede vor dem Bundestag, die Ansprache vor dem Souverän. Und es war eine Rede zu einem Zeitpunkt, als Bewegung in die Juden Deutschlands gekommen war, weil die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sichtbar zu wachsen und in sich zu differenzieren begonnen hatte. Die Repräsentanten der jüdischen Gemeinschaft, allen voran Ignaz Bubis, versuchten, den Affront zu mildern und sparten zugleich nicht mit klaren Worten – die Zeit für Belehrungen dieser Art sei vorbei. 1 2 Direktor des Fritz-Bauer-Institutes Roy Grünwald, „Die Robe des Präsidenten“, in Ha’aretz. 22.1.1996 1 STANDORTE Wie viel Irritation von Weizmanns Rede und der Haltung, die sie zum Ausdruck brachte, ausgegangen war, dies lässt sich gerade von ihrer Wirkung auf junge Juden in Deutschland ablesen, die über unterschiedliche Identitäten und Stellungnahmen zu Deutschland und Israel nachdenken, über ihren jeweils eigenen Weg. Vielleicht nicht immer „repräsentative“, aber in ihrer Bandbreite höchst aussagekräftige Momentaufnahmen aus ihrer Sicht hat Micha Brumlik in dem Sammelband „Zuhause, keine Heimat?“ zusammengetragen. Viele dieser Beiträge, ja der Sammelband insgesamt, sind durch Weizmans Rede entstanden. Das Bild einer sich in kaum aufgelösten Widersprüchen bewegenden Selbstfindung, das aus diesen Versuchen hervorgeht, hinterlässt offene Fragen und wenig beruhigende Antworten. Den eigenen Standort, oder besser, die augenblickliche Position „unterwegs“ zu bestimmen, dazu werden immer wieder dieselben Koordinaten bemüht und dennoch höchst unterschiedlich gedeutet. Wie soll dies auch anders sein in einer jüdischen Wirklichkeit, in der so gänzlich verschiedene Erfahrungen miteinander im Widerstreit liegen: Familien, die im Holocaust nahezu total ausgelöscht und nach 1945 mühsam und fragmentarisch neu geschaffen wurden, Emigranten vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, deren reale Erfahrungen mit dem Kommunismus zumeist prägender waren als die mit „den Deutschen“, Kinder schließlich von Emigranten aus aller Welt, zum Teil aus Familien mit deutsch-jüdischer Herkunft. Für die meisten von ihnen besitzt der deutsche Antisemitismus eine besonders beunruhigende Qualität. Für sie ist der Holocaust keineswegs eine längst vergangene Katastrophe, auch dann nicht, wenn er für viele nur noch eine Erzählung, eine Erinnerung anderer darstellt. Für sie ist Israel selbstverständlich ein Land, zu dem eine besondere Verbundenheit besteht, eine Verbundenheit mit Menschen und Orten, die durch regelmäßige Besuche, durch familiäre Bande und emotional unvergängliche Erfahrungen gegenwärtig bleibt, eine Verbundenheit mit einer politischen Vision, die zugleich immer geringere Bedeutung für den eigenen Lebensentwurf besitzt. Die Rede vom „sicheren Hafen“ wird fast gebetsmühlartig wiederholt. Doch einstweilen fühlt man sich in Europa oder in den USA real sicherer als im Nahen Osten. Weizmans Rede hat vor diesem Hintergrund schmerzhafte Ambivalenzen im jeweils eigenen Bewusstsein wachgerufen. Kaum einer, der sie gerade deshalb nicht beinahe wütend abgelehnt hat, und zugleich seiner Loyalität zu Israel nicht dennoch demonstrativ Tribut zollte. Fragil und tabugeladen ist erst recht das Verhältnis zu dem Land, in dem wir leben. Doch es sind gerade die Details, in denen immer wieder deutlich wird, wie sehr sich junge Juden in Deutschland als Teil dieser Gesellschaft verstehen, selbstbewusst und mit dem Anspruch, dieses „deutsche“ Gemeinwesen als Bürger mitzugestalten, nicht nur als „Mitbürger“. Von „jüdischen Deutschen“ zu sprechen, fällt vorerst noch schwerer, als von „nichtjüdischen Deutschen“, doch es meint dasselbe: eine Nation, in der verschiedene „Identitäten“, verschiedene ethische oder religiöse Gruppen durch einen gemeinsamen Bezug auf Verfassung und politisches System, durch das Zusammenleben auf einem bestimmten Territorium, durch gemeinsame Teilhabe an der Gesellschaft, zu einem Ganzen verbunden sind. Der Prozess der Verständigung dieser Gesellschaft darüber, er hat gerade erst begonnen. Er ist noch lange nicht 2 entschieden. Es gehört zu den Widersprüchen jüdischer Existenz in Deutschland, dass ebenjene Kette politischer Ereignisse 1989 und 1990, die zugleich eine reale Chance auf eine Wiederbelebung jüdischen Lebens in Deutschland eröffnete – aus Gründen, die unideologischer, unerwarteter und pragmatischer nicht hätten sein können. BEWEGUNG Bis 1990 blieb die Zahl der in Deutschland lebenden Juden mehr als drei Jahrzehnte lang fast konstant bei rund 30.000 Menschen. Dies änderte sich erst, als 1990, nach dem Fall des eisernen Vorhangs und mit der einsetzenden Auswanderung der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion Deutschland zu einem Einwanderungsland für Juden wurde. Juden in Deutschland sind nun, seitdem eine relevante Zahl von Menschen ihre Koffer packt, um nach Deutschland auszuwandern, vollends zu einem Symbol für die Fortexistenz der Diaspora geworden. Sind für Weizman und mit ihm für viele jüdische Israelis Juden „im Ausland“ ohnehin nur Juden zweiter Wahl, oder besser: Juden, die eben „noch nicht“ nach Israel gegangen sind, so waren schon jene, die nach der Schoa in Deutschland blieben, unter fortwährenden, oft aggressiven Rechtfertigungszwang gestellt. Dass dies für die Überlebenden der Vernichtung so war, ist verständlich. Dass ein Staat, der Deutschland offiziell gerne zu seinen „besten Freunden“ zählt, freilich so agiert, verwunderte auch Roy Grünwald, der in seinem schon zitierten Kommentar in „Haaretz“ schrieb: „Das „andere Deutschland“ gibt es nur für Israelis, nicht für Juden, die in diesem Deutschland leben wollen.“ Anders als die jüdischen Gemeinden in den USA, mit deren Existenz man sich in Israel offenbar abgefunden hat, ist die Existenz jüdischer Gemeinden in Deutschland, erst recht die bewusste Entscheidung für Deutschland, offenbar per se ein Skandal für jeden, der die Diaspora mit der Gründung des Staates Israel als ein historisch überwundenes Kapitel der jüdischen Geschichte betrachtet, an das die Juden sich nun „erinnern“ sollen. Die „russische Einwanderung“ kam zugleich zu einem Zeitpunkt, als die meisten Juden in Deutschland die vielbeschworenen „Koffer“ selbst ausgepackt hatten. Politisches Engagement wie angesichts der Ehrung der SS-Gräber von Bitburg durch Helmut Kohl und Roland Reagan, das selbstbewusste Auftreten gegen die Premiere von Fassbinders „Der Müll, die Stadt und der Tod“ und die Besetzung der letzten Überreste des jüdischen Ghettos in Frankfurt am Main, die einem Neubau der Stadtwerke weichen sollten, symbolisierten einen neu gewachsenen Willen, sich einzumischen, nicht nur eigene Rechte zu verteidigen, sondern diese Gesellschaft mitzugestalten. Mittlerweile sind Juden in Deutschland zwar politisch selbstverständlich aktiv, doch nach wie vor mit der Bürde belastet, als lebende Mahntafeln zu gelten. Ignatz Bubis hat in der „Süddeutschen Zeitung“ vor einiger Zeit eher resignierend seine fortwährende Ausgrenzung als „Israeli“ kommentiert und dies auch im Gespräch mit TRIBÜNE nochmals betont. Wie er sich gesehen fühlt? „Israeli, Fremder, Ausländer, Gast.“ Eine Zukunft für Juden in Deutschland? „Vielleicht in zwei Generationen. Wenn Opfer und Täter und die ersten Nachkriegsgeneration nicht mehr leben.“ Keine neue Blütezeit für ein deutsches Judentum? „Ich sehe schwarz. Die Mehrheit will es nicht 3 akzeptieren. Im Moment jedenfalls nicht. Jüdische Nostalgie ist in. Man hörte gerne Klezmer-Musik, weil es sie nicht mehr gibt.“3 Der Spagat zwischen dem tiefempfundenen Bedürfnis, sich selbst die Existenz in diesem Land durch Mahnung und Einforderung von Erinnerung und Gedenken zu legitimieren, und dem Wunsch, als Staatsbürger in diesem Gemeinwesen auch als Individuum, nicht länger nur als Exempel, als Vertreter des Kollektivs und der Geschichte oder, wo Antisemitismus sich offen artikuliert, als Exemplar der „jüdischen Art“ wahrgenommen zu werden, dieser Spagat wird mit der Zeit größer und nicht kleiner. Deshalb ist an „Normalität“, so sehr und je mehr sie subjektiv auch von Juden gewünscht werden mag, kaum zu denken. Und doch: In den wenigen Jahren seit 1990 hat sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland mehr als verdoppelt. 40.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sind gekommen, wenig zwar im Vergleich zu der Immigration nach Israel und in die USA und doch genug, um die Zahl der Juden in Deutschland enorm ansteigen zu lassen. Schließlich ist es angesichts von 130.000 Ausreisewilligen in den GUSStaaten, die bei den deutschen Konsulaten gemeldet sind, nur eine Frage der Zeit, bis die jüdische Gemeinschaft in Deutschland mehr als 100.000 Menschen betragen wird, um dann, nach Frankreich und England, wieder die drittgrößte in West- und Mitteleuropa zu sein. Zugleich wird diese jüdische Gemeinschaft in Deutschland im Vergleich zu anderen Minoritäten von Arbeitsimmigranten, die ihren Weg in die deutsche Gesellschaft zu finden versuchen und finden müssen, auch in Zukunft nur eine kleine Gruppe sein. All das, was die jüdische Gemeinschaft mit und zum Teil wegen der Hypothek der Geschichte in Deutschland nach 1945 erreicht hat, wird dann auch für diese Minorität ein Maßstab sein, ob wir dies wollen oder nicht. PLURALISIERUNG Die demographische Veränderung der jüdischen Gemeinden in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt hätte radikaler nicht sein können. Die Zahl der Gemeindemitglieder hat sich nicht nur mehr als verdoppelt, gut die Hälfte stammt nun aus der ehemaligen Sowjetunion und besitzt einen völlig anderen Erfahrungshintergrund als die meisten bisherigen Mitglieder. Ihr Bildungsniveau ist ausgesprochen hoch, viele von ihnen haben in der ehemaligen Sowjetunion akademische und technische Berufe ausgeübt. „Die wenigsten Einwanderer, die vor Verelendung und Pogromstimmung fliehen“, so schreibt Daniel Krochmalnik, „verbinden ihre Einreise mit dem Wunsch, das Judentum in Deutschland kennnen zu lernen. Für sie war das Jude sein oft nur ein nationaler Makel, dem sie entfliehen wollten, aber keine geistige Herausforderung. Größtenteils sind die russischsprechenden jüdischen Einwanderer gebildet, belesen und kultiviert. Sie legen viel Wert auf Kultur, haben aber gar kein Verständnis für den Kultus.“4 Dies gilt sicherlich nicht für alle Neuankömmlinge, doch es trifft das Gesamtbild. Für viele sind die jüdischen Gemeinden zunächst einmal soziale Organisationen, von denen sie Hilfe 3 Süddeutsche Zeitung, 21.9.1998 Daniel Krochmalnik, „Der beschwerliche Weg zum Judentum. Zu der religiösen Umkehr russischer Juden, ihren Anpassungsproblemen und unserer Unfähigkeit, ihnen dabei zu helfen.“, In: Frankfurter Jüdische Nachrichten, Nr. 97, September 1998. 4 4 erwarten. Oft bilden sie zugleich längst die Mehrheit, viele neue Gemeinden sind ja durch ihre Einwanderung erst entstanden. Zugleich hat in den jüdischen Gemeinden in den neunziger Jahren ein Pluralisierungsprozess begonnen. In verschiedenen Städten entstehen Gemeinschaften, die in unterschiedlicher Form liberales oder konservatives Judentum, liturgische Praxis und Ritual neu entwickeln wollen, ohne dabei allzu eng an die Traditionen des deutschen Judentums anzuknüpfen, dessen furchtbares Ende wie ein Menetekel erscheint. Dabei spielt natürlich auch der selbstverständliche Anspruch der Frauen eine Rolle, am rituellen Leben der Gemeinschaft gleichberechtigt teilzuhaben. Eine konservative Rabinerin in Oldenburg ist das sichtbarste Zeichen dieser unumkehrbaren Entwicklung. Die Suche nach zeitgemäßeren Formen des Gottesdienstes orientiert sich vor allem an Vorbildern in den USA. So sind auch viele Mitglieder der neuen reformierten Vereinigung Juden aus den USA, die in Deutschland leben. Erst recht sehen viele, die in sogenannten „Mischehen“ leben, in den neuen liberalen Gemeinschaften einen Weg, ihre persönlichen Lebensentwürfe mit dem Wunsch nach einer stärkeren Verbindung zum Judentum in Einklang zu bringen. Für die Mehrheit der Juden in Deutschland ist bislang gleichwohl die Angehörigkeit zur Einheitsgemeinde und auch die Verbindung von strengem Ritus in der Synagoge und liberaler Alltagspraxis die attraktivere Form. Dies mag oft Bequemlichkeit und Gewohnheit sein, vielleicht aber auch Ehrfurcht vor dem Numinosen, das dem orthodoxen Kultus anhaftet und das, wenn schon die Religionsausübung sich vor allem auf die Feiertage konzentriert, für viele die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft sinnfälliger zu symbolisieren vermag. Der Prozess der Differenzierung wird dennoch weiter gehen. „Diese Pluralisierung trägt“, wie Micha Brumlik schreibt, „geographische, generationelle und ethnische Züge, die sich mit Entwicklungen im Bereich der Religion und politischen Institutionen überschneiden und überlappen.“ In Hannover und München beispielsweise hat dies zur Spaltung geführt. In München gibt es jetzt auch eine große liberale Gemeinde mit mehr als vierhundert Mitgliedern. In anderen Städten wie z.B. in Frankfurt scheint einen Pluralisierung jüdischer Religiosität auch innerhalb der Gemeinden möglich zu sein, die auf eine Trennung von Verband, also politischer und sozialer Organisation, und Kultus hinauslaufen würde. Konfliktfrei wird dieser Prozess sicherlich nicht verlaufen. Doch er trüge der Realität Rechnung, dass nur noch für einen kleineren Teil des Judentums der Kern des jeweiligen Selbstverständnisses durch aktive Religionsausübung bestimmt wird. IDENTITÄT Über jüdische Identität zu schreiben, bedeutet gerade in Deutschland ein doppelbödiges Unterfangen. „Jüdisches“ dingfest zu machen, jüdische Existenz positiv und eindeutig zu bestimmen, entspricht nicht nur dem Bedürfnis nach einem „sicheren Ort“. Es steht zugleich im Schatten des Versuches, das „Jüdische“ von außen zu definieren, um es ein für allemal vernichten zu können. Oft genug ist hervorgehoben worden, dass das Judentum sich sowohl als Volk als auch als Religion bestimmt. Das eine bedingt das andere. Doch was dies nun heißt, ist weniger selbstverständlich denn je. Dass ein Volk, also eine „Herkunftsgemeinschaft“, sich als gemeinsamer Glaube konstituiert und umgekehrt, im jüdischen Verständnis also 5 einen Bund bedeutet, der sich über das Bekenntnis zum einen Gott und zur Annahme seiner Gesetzte stiftet, setzt Menschen zueinander in Beziehung, deren „Identität“ höchst „unidentisch“ sein kann. Nur die Geschichte, mit der sie ringen, haben sie gemeinsam. Dieses Ringen ist der Kern dessen, was wir so oft emphatisch „jüdische Erinnerungskultur“ nennen. Bei Lichte besehen, bildet sie allerdings das gemeinsame Problem, nicht dessen Lösung. Auch für agnostische Juden, erst recht für die große Zahl jener, in deren Leben praktizierte Religiosität nur eine marginale Rolle spielt, ist die gemeinsame Geschichte konstitutiv für das eigene Verständnis zur Welt: Eine gemeinsame Geschichte, in deren Mittelpunkt das Ringen mit Gott und seinen Gesetzen steht, aus der Verfolgung auf der einen und Erhaltung des Bundes auf der anderen Seite nicht wegzudenken ist. Seit der Schoa haftet dem Gedanken an eine „Flucht aus dem Judentum“ (wiewohl von vielen versucht) immer etwas Frivoles an. Es gehört zu den bitteren Absurditäten der Geschichte, zu welcher Koinzidenz es in diesem Jahrhundert, ja innerhalb eines Jahrzehntes gekommen ist: Der Versuch, alles Jüdische restlos auszulöschen, fiel zusammen mit der Gründung eines „normalen“ jüdischen Staatsvolkes. Doch ist daraus tatsächlich eine „Normalität“ erwachsen? Der Zionismus trat ein ins politische Leben Europas als Versuch der „Lösung der jüdischen Frage“. Der Zionismus hatte, so schien es, die Energie des europäischen Antisemitismus am ehesten verstanden. Die Vernichtung der europäischen Juden gilt bis heute als undiskutierbare Legitimation eines „jüdischen Staates“ im Nahen Osten, Israel ist legitimer Erbe einer unwiderruflich überwundenen bzw. zerstörten Diaspora. Bis heute bildet das „Recht auf Rückkehr“, also das Angebot einer automatischen „Einbürgerung“ aller Juden, die „heim“-kehren wollen, den Kern der staatlichen Verfasstheit Israels. Bis heute definiert jenes Gesetz jeden Juden, ob er dies will oder nicht, als „Exil-Israeli“, als „Noch-nicht-Israeli“. Doch das Ergebnis solcher „Staatlichkeit“ ist nicht die „Normalität“ geworden, von der Herzl träumte. Im Gegenteil: Die damit vollzogene Staatlichkeit auf ethnisch-religiöser Grundlage hat sich als permanenter Ausnahmezustand erwiesen. Die Verbindung von „israelischer Identität“, Schoa (als Symbol für die Zerstörung der Diaspora) und Allijah wird in den politischen und semi-sakralen Ritualen Israels immer wieder kollektiv beschworen. So entzünden jedes Jahr am Jom Hashoa sechs Neueinwanderer in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem die Flammen zur Erinnerung an die sechs Millionen Toten. Sie besiegeln damit zugleich symbolisch ihre Verwandlung in Bürger des souveränen Staates Israel. Jene „Lösung der jüdischen Frage“ durch die jüdische Staatsgründung hat, so zeigt sich seit vielen Jahren, gerade für Deutschland, für die nicht-jüdischen Deutschen, eine auffallende Attraktivität. Die israelische Definition der Juden als „Exil-Israelis“ macht es leichter, mit den eigenen, wie auch immer realen oder irrealen Schuldphantasien zu leben – als ließe sich der „Katastrophe“ noch im nachhinein just jener Sinn unterschieben, den sie doch für die Nazis von Beginn an gehabt hatte: Ein „Endkampf“, der die jüdische Existenz als solche beendet. Die Verwandlung von Juden in Israelis, vom „auserwählten Volk“ zum Staat kommt den verschiedensten Entlastungsversuchen entgegen. Zu nennen sind die Entlastung von der Bürde der Verantwortung, die Entlastung von der Gegenwart der überlebenden Opfer und ihrer Nachkommen, die Entlastung von der Notwendigkeit, endlich selbst von der Idee eines ethnisch exklusiven Staates auf deutschem Boden Abschied zu nehmen. 6 Doch die Definition eines „jüdischen Staates“ ist eine Chimäre, so schmerzhaft es ist, dies auszusprechen, so bitter es einer allzu verständlichen Hoffnung auf Neuanfang in Sicherheit und gefestigter Identität widerspricht. Der Zionismus hat keines der Probleme gelöst, um derentwillen er angetreten ist. Er hat die Rettung der europäischen Juden nicht befördert. So hellsichtig viele Zionisten gegenüber der drohenden Gefahr des Antisemitismus waren, so wenig haben sie erkannt, dass die Gefahr der Vernichtung aus Deutschland drohte, wo der Gedanke einer ethnischen Nation die fatalste Wirksamkeit entfaltete, als Traum nämlich von der Weltherrschaft. Die nationalen Ambitionen, die sich auf die Einwanderung nach Palästina konzentrierten, haben nicht dazu beigetragen, möglichst viele Juden an einen sicheren Ort zu bringen, egal wohin – in einer nicht-jüdischen Welt, die jeder jüdischen Einwanderung ohnehin Steine in den Weg legte. Und über den Umgang der zionistischen Organisation mit den Überlebenden nach 1945 ist, gerade in Israel, in den letzten Jahren genug Kritisches gesagt und publiziert worden. Vor allem aber hat die jüdische Staatsgründung mit ihrem hypothetischen Ziel der „Heimführung“ aller Juden die Bipolarität von „Volk“ und „Religion“ nicht aufgelöst, sondern nur einen dritten Pol, nämlich den der Staatsnation, hinzugefügt. Da die Staatsgründung das Judentum nicht abgeschafft hat, steht die Definition des „jüdischen Staates“ quer zur erhofften „Normalisierung“ eines modernen israelischen Staatsvolkes, das über eine gemeinsame Religion nicht gebildet werden kann. Israelische Politik wird so zur Geisel der jeweils radikalsten religiösen „Autorität“ oder dessen, was sich dafür ausgibt. Sie wird von diesem inneren Widerspruch zwischen der formal rechtsstaatlich-säkularen Verfasstheit und der ethisch-theologischen Gründung des Staates bestimmt. Ein Widerspruch, der nicht aufzulösen ist. So nimmt es nicht wunder, dass vor diesem Hintergrund, aus dieser „Verfasstheit“ bis heute keine schriftliche kodifizierte Verfassung geworden ist. Die freiwillige Preisgabe der Souveränität durch einen säkularen Staat an religiöse Autoritäten – wir kennen sie aus den islamischen „Gottsstaaten“, aber nicht aus zivilen Gesellschaften. Die Definition der Staatsbürgerschaft – also die Frage „wer ist Jude?“ – wäre wohl kaum in die Buchstaben einer modernen Verfassung zu pressen. Die Aufnahme in diese Staatsbürgerschaft bleibt daher den Rabbinern überlassen, und zwar weltweit (nicht nur denen in Israel). Dies wird so bleiben, solange Israel ein „jüdischer Staat“ sein soll und umgekehrt. Wir leben in einem Schwebezustand, dessen Wirkungen in jedem Augenblick auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland erfassen. Und so gibt es einen modernen demokratischen Staat im Nahen Osten, gebildet nicht nur von „orthodoxen“ wie säkularen Juden, sondern auch von nicht-jüdischen Israelis, ob muslimisch oder christlich, agnostisch oder der Bahai-Religion zugewandt. Anderseits gibt es den Ausnahmestaat fundamentalistischer Sektiener, die niemand stoppen kann, weil ihre Existenz, ja ihre Autorität, in den inneren Widersprüchen Israels zementiert ist. Mit ihrer Utopie eines Gottesstaates können sie die Mehrheit der Israelis, auch der jüdischen Israelis nahezu ungestört terrorisieren. Es ist dies eine Utopie, die mit jüdischer Orthodoxie im Grund nichts zu tun hat – statt demütigen Wartens auf den Messias eine höchst weltliche Selbstüberhebung. Israel als politisches System wird zwischen diesen beiden Polen unaufhörlich zerrieben. Neben der Perspektive des Fundamentalismus, der die Nation als rechtsstaatliches Gebilde parasitär aushöhlt und zersetzt, steht real schon längst nicht mehr die Perspektive der Gründungsväter, die einen ethisch verfassten Sozialismus, das „Jüdische“ als soziale Gemeinschaft erträumt hatten, sondern eine andere. 7 Es sind die liberalen Kräfte der israelischen Gesellschaft, die für einen wirklich säkularen Staat mit einer modernen Verfassung kämpfen, die das „Recht auf Rückkehr“ durch ein ziviles Staatsbürgerschaftsrecht ersetzten wollen, die sich von der kommenden Zweistaatlichkeit Israels und Palästinas auch einen Weg zur Zivilisierung der jeweils eigenen Gesellschaft erhoffen, so mühevoll der Weg dahin auch zu sein scheint. Sie haben längst akzeptiert, dass jüdische Existenz auch in Israel selbst sich wieder mit der Diaspora verbinden wird, selbst dann, wenn eine große Mehrheit der Bürger Israels selbstverständlich jüdische Wurzeln besitzen wird, und dass zugleich der Staat Israel als politisches Gebilde seinen Platz in der Region, im Nahen Osten finden muss. IN DEUTSCHLAND… Es bleibt nicht aus, dass sich zwischen den Koordinaten Volk, Religion und Nation auch das Selbstverständnis von Juden in Deutschland wieder auf einen selbständige Interessendefinition besinnt, dass der zionistische Lippendienst, dem wir überall und jeden Tag begegnen, die eigenen Widersprüche und die eigene Verunsicherung darüber, im „Lande der Täter“ nicht nur zu leben, sondern dadurch auch dazu beizutragen, dass es sich zu etwas anderem verändert, dass all diese Ungleichzeitigkeiten nicht länger geleugnet, besänftigt und überspielt werden. Erwartungen an eine posttraumatische Integration in eine neu zu definierende Gesellschaft melden sich seit Jahren mit wachsender Eloquenz zu Wort. Dass die deutsche Gesellschaft seit der Vereinigung sich selbst wieder auf der Suche nach der „eigenen Mitte“ befindet, ist dabei ein verstörender Kontext. Nun ist mit dem Regierungswechsel im Deutschen Bundestag der Weg frei zu einer Neudefinition des Staatsbürgerschaftsrechtes. Eine Änderung, die dazu ausreichen würde, auch in der Verfassung den entsprechenden Paragraphen 106 dem Vorbild moderner westlicher Gesellschaften entsprechend (d.h. im Sinne eines jus solis und nicht eines jus sanguinis) umzugestalten, ist dagegen noch nicht in Sicht. Es wird sich zeigen, ob diese Gesellschaft bereits ist, die Gesetzesinitiative der neuen Regierung zu tragen und in gelebte Wirklichkeit zu verwandeln. Schon werden Stimmen laut, die den Untergang des christlichen Abendlandes oder der deutschen „Kulturnation“ prophezeien. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es nicht „Barbarei“ war, die den Weg zum Holocaust geebnet hat, sondern eben jene Hybris einer „Kulturnation“, die sich aufmachte, die Welt „an ihrem Wesen genesen“ zu lassen. Die Staatsbürgerschaft aus dem Joch ihrer bis heute nicht überwundenen völkischen Definition zu befreien, die in der Zweistaatlichkeit gewachsene Realität einer Einwanderungsgesellschaft nachzuvollziehen und politisch zu gestalten, dies ist kein bloßer Gesetzesakt, sondern eine Revolution der nationalen Identität. Sie holt nach, was selbst die gescheiterten „Revolutionäre“ von 1848 kaum versucht haben, nämlich die deutsche Nation auf die Grundlage eines Gesellschaftsvertrages und nicht auf Blutsbande zu stellen. Damit wird freilich auch das Verhältnis dieser Gesellschaft zu ihrer Geschichte noch einmal gründlich in Frage gestellt werden. „Entweder wir müssen Barbaren sein, und die Juden bis auf den letzten Mann austreiben, oder wir müssen sie uns einverleiben.“ So schrieb Heinrich Laube, einer der Vorkämpfer von 1848, dieser „Revolution“ ein Jahr zuvor ins Stammbuch. Die Idee der „deutsch-jüdischen Symbiose“ hatte von Beginn an zwei Seiten. Sie meinte 8 die Hoffnung darauf, dass Deutsche und Juden, deutsche und jüdische Kultur zu etwas „Höherem“ verschmelzen könnten, und sie meinte zugleich, jedenfalls unterschwellig, eine Aggression, eine Drohung. Es war ausgerechnet Richard Wagner, aus dessen Feder (1850 in seiner Schrift „Das Judentum in der Musik“) die Worte stammen, es gebe nur zwei Auswege aus dem „Verfall unserer Kultur“, der durch den Einfluss der Juden hervorgerufen sei: „die gewaltsame Auswerfung des zersetzenden fremden Elements“ oder „dass dieses Element uns in der Weise assimiliert, dass es mit uns gemeinschaftlich der höheren Ausbildung unserer edleren menschlichen Anlage zureife.“5 Die deutsch-jüdische Symbiose, es ist dies oft genug betont worden, war vor allem eine jüdische Hoffnung, eine weitgehend unerwiderte Liebe. Doch auch aus deutscher Perspektive, so scheint es, spielte auf dem Weg zur Bildung der deutschen Nation die Phantasie einer gewissen „Verwandtschaft“ zu den Juden eine irritierende Rolle – weniger freilich zu den wirklichen Juden als zu dem Bild, das man sich von den Juden machte. Eine Projektionsfläche für eigene Größenphantasien. In Hermann Rauschnings Buch „Gespräche mit Hitler“, das 1939 erschien und dessen Authentizität zu Recht in Zweifel gezogen wurde, heißt es an einer Stelle (und es ist gar nicht so entscheidend, ob diese Worte nun tatsächlich genau so von Hitler gesagt oder von seinem Gefolgsmann Rauschning zu diesem Wortlaut paraphrasiert worden sind): „Der Jude sitzt immer in uns. Aber es ist leichter, ihn in leiblicher Gestalt zu bekämpfen, als den unsichtbaren Dämonen… Ist ihnen nicht aufgefallen, wie der Jude in allem und jedem das genaue Gegenspiel der Deutschen ist und ihm doch wieder so verwandt ist, wie es nur zwei Brüder sein können… Es kann nicht zwei auserwählte Völker geben, Wir sind das Volk Gottes.“6 Der Massenmord, der Vernichtungsfeldzug gegen die „Gegen-Rasse“, der die Deutschen als solche erst vollends zusammenschmieden, ihre Einheit neu und ein für allemal erschaffen sollte, der Weltkrieg war gerade drei Monate beendet, als Robert Ley, der Führer der „Deutschen Arbeitsfront“ in alliierter Gefangenschaft sein politisches Testament „An mein Deutsches Volk“ niederlegte und zum Frieden mit „dem Juden“ aufrief: „Wir müssen das Misstrauen beseitigen, indem wir mit offenem Herzen und auf klarer Basis dem Juden begegnen. Wir müssen unser gegenseitiges Verhältnis bereinigen. Ohne Vorbehalte und ohne innere Hemmung müssen der Deutsche und der Jude wieder zueinander finden, sich gegenseitig aussöhnen… im Interesse des Weltfriedens und des Weltwohlstandes… Der Jude sollte sich Deutschland und Deutschland sich den Juden zum Freund machen. Dann wird davon ein Segen für die übrige Welt ausgehen… Deutsches Volk! … Versöhne dich mit dem Juden und lade ihn ein, bei dir seine Heimat zu finden. … Wird der Jude sich dieser Einsicht verschließen, so nimmt die Weltkatastrophe… ihren unerbittlichen Lauf. Würde aber Deutschland diese Frage lösen und daran gesunden, gesundet die ganze Welt. … eine Heimat müssen die Juden bekommen, Deutschland ist reif dazu, in sich und bei sich diese Heimat zu geben.“ Ein groteskes Dokument, doch es lässt tiefe Einblicke zu in das, was Saul Friedländer erst jüngst als „Erlösungsantisemitismus“ bezeichnet hat. Nichts, und dies war den Nationalsozialisten durchaus bewusst, vermochte so sehr Gemeinschaft herzustellen wie ein gemeinsames Tabu, wie die gemeinsame unaussprechliche, oder mit den 5 Richard Wagner, Das Judentum in der Musik. Leipzig 1869, S. 57 (Das Zitat stammt aus dem Nachwort zu dem schon 1850 erschienen Pamphlet). 6 Hermann Rauschning. Gespräche mit Hitler. Zürich/ New York, 1940, S. 223f. 9 Worten Himmlers „niemals zu schreibende“, Geschichte, die gemeinsame Teilhabe an einem Verbrechen. Jeder Versuch, heute symbolisch im Namen der deutschen Nation an den Holocaust zu erinnern, bewegt sich in einem unauflösbaren, in einem wahrhaft furchtbaren Widerspruch: zwischen der Notwendigkeit, an das „Unaussprechliche“ zu erinnern, es auszusprechen und der Unmöglichkeit, nationale Identität auf dieses Geschehen zu gründen, ohne das Projekt einer ethnischen Nation fortzusetzen und zu zementieren. Auch das Denkmal in Berlin könnte Ausdruck einer neuen „deutsch-jüdischen“ Symbiose nur sein um einen hohen, einen zu hohen Preis: Ein solches Denkmal stellte Deutschland tatsächlich in der Nachfolge des „auserwählten Volkes“, eines doch noch mit Sinn unterlegten Geschehens der Schoa. Es wird für diesen Konflikt keine Lösung geben, aber vielleicht doch wenigstens ein Eingeständnis, ein beschämendes Zurücktreten von den großen symbolischen Lösungen, vor allem von der eitlen Hoffnung, es könnte ein „gemeinsames Symbol“ geben. An diesem Ort selbst wäre das ehrlichste, das eindruckvollste Denkmal tatsächlich das offene Eingeständnis der Leere, der Verzicht und seine Kenntlichmachung, verbunden mit einer eindeutigen politischen Entscheidung, die vorhandenen Gedenkstätten auf Dauer zu sichern. Den Mut zu solch einem Denkmal, dessen Radikalität allen Identifikationsbedürfnissen, allen Bedürfnissen nationaler Repräsentativität zuwiderlaufen würde, ihn wird leider, so ist anzunehmen, keiner der Verantwortlichen zeigen. Nun statt dessen das Gelände einer jüdischen Einrichtung zu übergeben, die weltweit die Stimmen der Überlebenden hörbar macht, was sie über ihre Überleben, über die Toten und über die Täter zu sagen haben, ist vielleicht der letzte mögliche Kompromiss, ob es ein guter ist, sei dahingestellt. Eine solche Einrichtung, für die sich freilich passendere Orte in Berlin finden ließen als ausgerechnete das Wettbewerbsgelände, könnte immerhin eine Brücke bilden: zwischen dem, was geschehen ist, und denen, die heute leben, „nicht-jüdischen Deutschen“, aus der Türkei stammenden Deutschen, „In Deutschland lebenden Juden“, ausländischen Besuchern. Dies zu tun und auf die großartige symbolische Inszenierung bewusst und demonstrativ zu verzichten, wird schwer fallen. Aber warum sollte hier auch irgendetwas leicht sein. 10