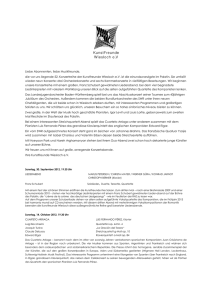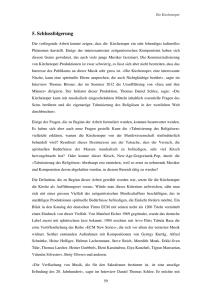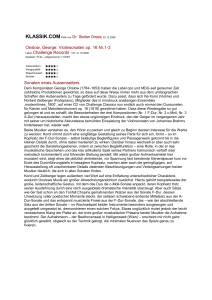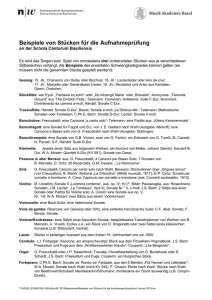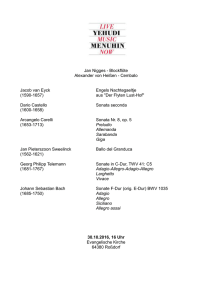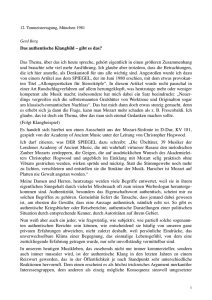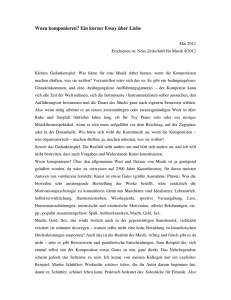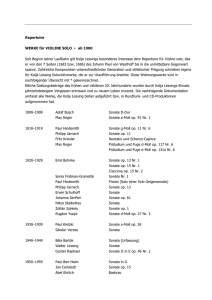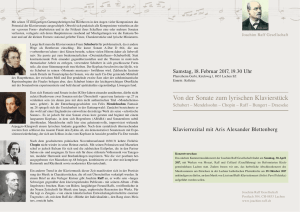Gedanken über Form in der Musik Was ist Form im
Werbung

Gedanken über Form in der Musik Was ist Form im Allgemeinen, was insbesondere in der Musik? Wodurch wird sie generiert, hervorgebracht? Wozu ist sie überhaupt nütze und fähig? Warum sollte ein Musiker davon wissen? Die Beschäftigung mit solchen Fragen, die für einen Musiker immer wieder Thema sein sollten, wird sicher immer wieder zur Erkenntnis führen, dass sie sich lohnt, führt sie doch zu einer Bereicherung der Wahrnehmung, zu einem lebendigeren Tun, zu einem sprechenderen Musizieren! Form ist das Unverwechselbare. Sie charakterisiert das Individuelle und macht es unterscheidbar von anderen Individualitäten, was nicht zwangsweise zum Fehlen jeglicher Schnittpunkte und Gemeinsamkeiten führen muss, können diese doch zwischen unterschiedlichen Individuen Verbindung schaffen. Der Begriff der Form beinhaltet als verbindende Kraft die Idee einer Sache und die individuelle Ausformung dieser Idee. So kommt es zu Erscheinungen, die sich mal mehr, mal weniger ähneln können, sich aber immer auch individuell unterscheiden. Zwischen solchen unterschiedlichen Ausformungen einer Idee entsteht eine Spannung, eine Dynamik durch eben die Unterschiede untereinander. Auch zwischen der Grundidee selbst und ihren individuellen Ausformungen, durch die Abweichungen, welche die Individualität beleben, entsteht eine Spannung; und nicht zuletzt im Innern einer individuell Gestalt gewordenen Idee herrschen Spannungen, ausgelöst durch die charakteristische Oberflächenund Tiefenstruktur dieser Gestalt (Wölbungen, Höhlungen, Durchbrüche sind Grundideen der Plastik in der bildenden Kunst, aber jede Statue, jedes Relief, jede Plastik greift diese Ideen unterschiedlich auf, formt sie auf individuelle Weise aus. Jeder Mensch hat den gleichen Grundbauplan, den wir sogar mit den meisten Säugetieren teilen: Eine Ansammlung von Knochen, Organen, Muskeln, Gliedmaßen in einer bestimmten Anzahl und Anordnung. Es ist immer wieder faszinierend, in einem Naturkundemuseum Skelette von Menschen, Hunden oder Walen zu sehen und festzustellen, wie weitreichend die strukturellen Ähnlichkeiten, die grundlegenden Übereinstimmungen unserer Baupläne doch sind, und doch sehen Wale und Menschen eindeutig verschieden aus, und selbst innerhalb einer Gattung findet man kaum zwei Exemplare, die völlig deckungsgleich sind!). Wir kennen einen Kanon von verschiedenen musikalischen Grundformen, gehen im Musikerberuf immer wieder damit um: Sonate, Liedform, Rondo, Variationen etc. Im Laufe der Musikgeschichte wurde immer wieder der Versuch unternommen, diese genau festzulegen und zu katalogisieren. Ihr Grundplan sollte genauso klar und detailliert definiert werden, wie wir den Menschen mit Augen, Ohren, Nase, Beinen, Armen… beschreiben können (obwohl es ja schon da nicht gelingt, in einer solchen Aufzählung tatsächlich zu verhindern, damit eben nicht doch auch eine Fledermaus umschreiben zu können). Es gab und gibt Kompositionslehren, die versuch(t)en, einem (angehenden) Komponisten gleichsam einen Baukasten in die Hand zu geben, der diesem helfen sollte, seine Fantasie zu bändigen und in geregelte Bahnen zu lenken, auch wenn meist eher der Verdacht nahe lag, dass damit eher dem Fantasielosen Zutritt zur Fantasie ermöglicht werden sollte. Sobald aber irgendein Theoretiker eine solche „unumstößliche“ Regel formuliert hatte, gab es schnell geniale Komponisten, die diese Regel missachteten, sich nicht daran hielten und „trotzdem“ spannende Musik schrieben. Dabei gilt es ja gar nicht zu leugnen, dass Formen wie Sonate, Rondo oder Passacaglia, die ja von ihrer Idee her durchaus beschreibbar sind, existieren – und zwar auch deshalb, weil sie aufgrund irgendwelcher „in der Luft liegender“ Grundprinzipien und vielleicht sogar natürlicher Gesetzmäßigkeiten entstehen konnten. Die Formulierung dieser „Gesetzmäßigkeiten“ in diversen Kompositions- und Formenlehrbüchern scheinen den Versuch darzustellen, dieselben einfangen und beschreiben zu können, auf dass hinter ihnen tatsächlich die reine Idee zutage treten möge. Aber dieser Versuch scheint auf der anderen Seite immer zum Scheitern verurteilt zu sein, so, als sei eine einmal formulierte und verabsolutierte Regel doch auch wieder nicht anderes und mehr als eine spezielle, individuelle Ausformung einer Idee, die als solche wohl doch nicht greifbar sein kann. Sieht man sich an, welche Entwicklung die Grundidee der Sonatenhauptsatzform von frühbarocken Suitensätzen (in denen – zumindest durch den harmonischen Ablauf - ein Grundplan wie in der späteren Sonate oft schon angedeutet erscheint) über die Sonate bei Haydn, Mozart, Beethoven, über die Romantik etwa bei Schubert oder Schumann bis Mahler bis in die Moderne bei Bartók oder Henze genommen hat, wie unterschiedlich diese Form immer wieder – den aktuellen Erscheinungsformen meist hinterherhinkend – theoretisch definiert wurde, ja wie unterschiedlich sogar individuelle Interpretationen dieser Formidee im Schaffen eines einzigen Komponisten wie Mozart oder Beethoven ausgefallen sind, dann fällt es immer schwerer, einer konkreten Formulierung dieser Idee Vertrauen hinsichtlich ihrer objektiven Gültigkeit zu schenken, ja so schrumpft die dahinter stehende Idee auf einen sehr kleinen Kern zusammen, bei dem man sich fragen müsste, wie relevant dieser kleinste gemeinsame Nenner denn nun eigentlich wirklich ist. Und dennoch stellt sich oft zwischen verschiedenen Individualitäten dieser Formidee Sonate das Gefühl ein, auf irgendeine schwer zu fassende Art bestünden unterirdische Beziehungen, die eben doch eine Verwandtschaft der Geisteshaltung und Problemstellung sichtbar machten. Aus welchem Bedürfnis entsprangen überhaupt Formbegriffe wie Rondo oder Sonate (vom Sonatenrondo hier mal ganz zu schweigen!)? Ist es das Bedürfnis, für jedes Individuelle eine Schublade zu finden, um sich – negativ gesprochen – nicht mit der Individualität auseinandersetzen zu müssen? Oder hilft uns die Schublade, das Individuelle als ein Individuelles erfassen zu können? Die Wahrheit liegt vermutlich wie so oft in der Mitte. Wozu braucht nun ein Musiker solche Überlegungen? Ein Musiker, der ein Stück Musik spielen, interpretieren will, hat musikalische Form in Form von Noten vor sich, muss sie in klingende Form übersetzen, muss dem Klingenden eine schlüssige Form geben, die sich allein durch das Hören vermittelt. Es ist viel geschrieben worden über das Ungreifbare musikalischer Form, die eben nichts Körperliches ist, nicht als Ganzes überblickt werden kann, sondern allein durch die Zeit und das Vergehen derselben entsteht und Form gewinnt. Das Formen von Zeit ist ein ziemlich abstrakter und schwer beschreibbarer Vorgang, aber dessen Gelingen ist vielleicht der wichtigste Punkt beim Musizieren. Wie reagiert ein Musiker auf Grundideen und individuelle Ausformungen, wie durchdringt er das Stück, das er spielen möchte, wie nähert er sich ihm, aus welcher Perspektive? Man kann gelegentlich das Gefühl haben, nur noch Individualitäten zu sehen, keine Gemeinsamkeiten mehr erkennen zu können, nichts zu haben, an dem man sich festhalten kann. Man kann darüber verzweifeln und sich isoliert fühlen, ohne Zugang zu anderen Individuen (wie das manchen Künstlern widerfahren ist). Ja, man kann auch über die Unbeständigkeit der eigenen Individualität verzweifeln, denn jeder erlebte Moment beeinflusst ja unsere Individualität. Insofern kann der Gedanke, dass es übergeordnete Ideen gibt, die Verbindungen und Netze herstellen und knüpfen, lebensrettend, weil sinnstiftend, sein. Ich will meine Individualität als Begrenzung überwinden oder überspielen, um wieder Gemeinsamkeit zu erfahren. Musik kann – natürlich! – Momente der Gemeinsamkeit stiften, kann Gedanken und Gefühle bündeln, kann Seelen auf gleiche Weise schwingen lassen. Verschiedene musikalische Formideen können dies auch auf verschiedene Weise tun. Eine Sonate kann eine andere psychologische Wirkung auslösen als eine Passacaglia. Wahrscheinlich übt Musik gerade dadurch immer wieder eine starke Faszination und Macht aus, und gerade deshalb kann diese Macht auf der anderen Seite durchaus auch instrumentalisiert werden, indem sie Gefühle bewusst lenkt und uniformiert. In all diesen Überlegungen treten Spannungen zutage. Jede dieser Überlegungen löst Widersprüche und neue Fragen aus, und daraus resultiert Spannung, die einen ruhelos werden lassen kann. Letztendlich scheint mir, als bliebe bei der frage nach Form, auch nach musikalischer Form, immer wieder der Begriff „Spannung“ übrig (es ist ja wohl auch in erster Linie Spannung, welche eine Form äußerlich und nach innen zusammenhält.): Spannung zwischen der Frage und ihrer Unbeantwortbarkeit, Spannung zwischen einer nicht wirklich fassbaren Idee und ihren unendlich sich individualisierenden Ausformungen, ihren asymptotischen Annäherungen an sie, Spannung zwischen Regel und Abweichung, Spannung zwischen Gebundenheit und Freiheit, Grenze und Grenzenlosigkeit usw. Warum nicht sagen, dass Form gleichbedeutend ist mit Spannung? Spannung erzeugt Form, auch in der Musik; erst durch die Spannung zwischen verschiedenen Ebenen entsteht ein individuelles Gebilde. Schon die Spannung innerhalb des Urbausteins funktionaler Harmonik, dem Verhältnis zwischen Dominante und Tonika, dem Quintfall, erzeugt eine Form mit Dramaturgie und Dynamik. Ebenso die Spannung zwischen verschiedenen musikalischen Themen, zwischen Klangfarben einzelner Instrumente, auch zwischen einzelnen Musikern innerhalb eines Ensembles, zwischen Musikern und Publikum oder zwischen Musiker und Komponist (welche sich durch unterschiedliche Interpretationen ein und desselben Werkes manifestiert). Der Musiker hat die Aufgabe, sich diese Spannungen produktiv zu Eigen und Nutze zu machen, damit sein Musizieren – lapidar ausgedrückt – spannend sein kann! Wie steht es mit Stücken, von denen manche Leute denken, sie seien gar nicht spannend? Man höre sich einmal die Aufnahme des C-Dur Präludiums aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers von Bach in der Aufnahme durch Glenn Gould an. Er empfand dieses Stück wohl nicht als spannend, ich glaube, das hört man seiner Interpretation an. Er scheint es sich auf skurrile Weise spannend zu machen, indem er es überspannt und abgehackt artikuliert. Man könnte, wenn man es darauf anlegte, tatsächlich einige „Beweise“ für das Fehlen von Spannung in diesem Stück anführen: die gleichförmige Bewegung, der einförmige Charakter, die geradezu minimalistisch-meditative Satzstruktur, die scheinbare Entwicklungslosigkeit auf motivisch-struktureller Ebene, überhaupt das oberflächliche Fehlen tatsächlich thematischen Materials… Diese Punkte lassen sich aber bei wohlwollenderer und genauerer Analyse durchaus widerlegen. Man kann das Stück – analog zu seiner Faktur – wie Glenn Gould mechanisch spielen, man kann jede Spannungsentwicklung negieren. Aber hat es deshalb keine Form? Banale Frage, mag man meinen, denn es hat ja einen Anfang und ein Ende und dazwischen einige Noten, da muss es doch eine Form haben! Man kann auch an vielen Punkten des Stückes Ansatzpunkte für die Frage nach Spannungen festmachen: Ich bin gespannt, wie lange ich es aushalte, im selben Bewegungsmuster zu verharren, wie lange ich das Ausbrechen daraus hinauszögern kann, ohne dass das Unterfangen in Langeweile umschlägt. Ich bin gespannt, wie es gelingt, in dem ganzen Stück das unschuldige C-Dur eigentlich kaum zu verlassen (eine einzige perfekte Kadenz nach G-Dur, nur wenige Sequenzen, ein lang hinausgezögerter Dominantquartsextvorhalt nach C-Dur), und es dennoch so zu dehnen, stauchen, dramatisieren. Ich bin gespannt dadurch, wie der Satz durch seinen harmonischen Verlauf langsam aus seiner anfänglichen unbeschwerten, freundlichen, kindlich-naiven Mittellage in ein Gefühl des Geerdetseins, der Reife, der Erfahrung hinabsinkt, so, als sei das C-Dur des Schlusstaktes ein anderes als das der ersten Takte, als sei es an durchaus widrigen und schmerzvollen Erfahrungen gewachsen. Dieses Stück, mit dem dieser Zyklus beginnt, ist wahrhaftig ein Initiationsstück! Spannend ist auch (und das rechtfertigt natürlich auch Glenn Goulds Interpretation), dass man das Stück langsam oder schnell spielen kann, ätherisch oder gehetzt, verträumt oder maschinell; es scheint im Charakter nicht festgelegt zu sein und auch in sehr verschiedenen Charakteren zu „funktionieren“, dadurch auch verschiedenes auszudrücken. Aber es sind doch immer die gleichen, relativ simpel aussehenden Noten! Musikalische Formenlehre kann, glaube ich, als erstes (und einziges?) versuchen, die verschiedenen Spannungen darzustellen, die ein Stück hervorbringen, die unterschiedlichen Techniken bewusst zu machen, mit denen musikalische Spannungsverläufe generiert werden. Solche Spannungen schaffen Zusammenhänge, bewirken, dass Verbindungen entstehen – auch über Trennendes, vermeintlich Unvereinbares hinweg. Spannungen schaffen Abhängigkeitsverhältnisse, die womöglich notwendig sind: Wenn zwei gleichermaßen voneinander abhängige Teile ein Ganzes ergeben, herrscht Gleichgewicht, Ausgewogenheit, gegenseitige Ergänzung; wenn ein Ungleichgewicht herrscht, dann entsteht ein Sog, ein Bedürfnis des Ausgleichs, der Auflösung. Dies alles bringt musikalische Form hervor. Und das gilt sowohl für improvisierte Musik als auch für solche, die über lange Zeit hinweg minutiös komponiert wurde. Dabei ist die Tatsache interessant, dass ein Komponist beim sich vielleicht über einen Zeitraum eines halben Jahres erstreckenden Kompositionsvorgang nie die Echtzeit des später vielleicht zwanzigminütigen Stückes tatsächlich greifen kann. Er muss sie in dieser Zeit vage erfühlen können. Die Gefahr besteht natürlich, sinnvolle Spannungsverhältnisse nicht hinzubekommen, sodass nachher etwa die Proportionen eines Stückes nicht stimmen, die Spannung dadurch verloren geht und das Stück dadurch auseinanderfällt. Hier haben in der Musikgeschichte definierte Formen wie die Sonate oder Fuge ein Gerüst geliefert, welches half, Proportionen von vornherein planen zu können. Aber dieses Gerüst musste natürlich dennoch immer individuell mit Sinn erfüllt werden. Für einen Komponisten heute stellt sich immer wieder das Problem, diese alten Formmodelle nicht mehr so einfach verwenden zu können, zumal wenn diese ursprünglich gerade durch harmonische Spannungsverhältnisse der tonalen Musik hervorgebracht wurden und sich der heutige Komponist nicht unbedingt tonal ausdrückt. Aber auch solche Komponisten, die wieder zeitgemäße Arten tonalen Denkens erproben und erforschen, können nicht ohne weiteres unreflektiert oder ungebrochen auf die tradierten Formen zurückgreifen. Form ist heute zu einem sehr individuellen Problem geworden, welches für jedes Stück einen neuen, eigenen Beantwortungsversuch erfordert (oder war sie dieses nicht auch schon zu Haydns Zeit?). Aber selbst offene, freie Formen, solche, die vom Komponisten nicht eindeutig in ihrem Ablauf festgelegt werden, sind natürlich im Moment der Aufführung eine konkret erfahrbare und abzugrenzende Hülle mit einem Anfang und einem Ende, für die nach wie vor die Frage nach der Spannung, die das ganze zusammenhält, wichtig ist. Bei der Beschäftigung mit musikalischer Form und der Geschichte musikalischer Formenlehre scheint mir also als erstes die Frage am wichtigsten zu sein, was ein Stück Musik denn spannend macht. Welche Spannungsverläufe werden auf welche Weise erzeugt und sind typisch für genau dieses Stück? Was verbindet, was unterscheidet oder trennt es von anderen Stücken? Wo erkenne ich Annäherungen an eine oder Abweichungen von einer Grundidee, wobei die Abweichungen die größeren Spannungen hervorrufen und somit die individuellere Form erzeugen. Man kann natürlich auch Stücke suchen, anschauen, exemplarisch vorführen, die möglichst detailliert und streng eine irgendwann einmal festgelegte Formidee verwirklichen wollten. Ob diese dann zu den interessantesten Stücken gerechnet werden können, muss man im Einzelfall entscheiden. Immer wieder haben sich gute Komponisten in die Entwicklung der Musik mit ihren eigenen Gedanken zur musikalischen Spannungsgestaltung eingebracht. Jeder hatte ein individuell anderes Gespür dafür, was er als spannend empfand, welche Form seinen Gedanken angemessen war. Aber natürlich kann und sollte man sich dennoch die verschiedenen Theorien anschauen, nur sollte man nicht erwarten, dass sich die großen Komponisten wirklich danach gerichtet hätten. Stattdessen sollte man sich genau darüber freuen und Lust dabei empfinden, in dieser Hinsicht auf Entdeckungsreise zu gehen und sich immer wieder aufs Neue überraschen und auf die Folter spannen zu lassen. 7.5.2005