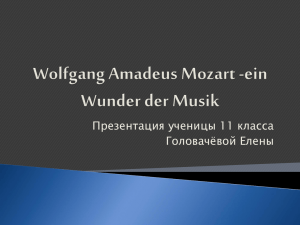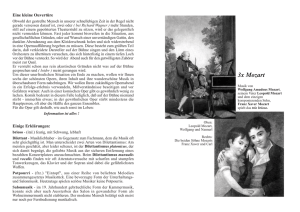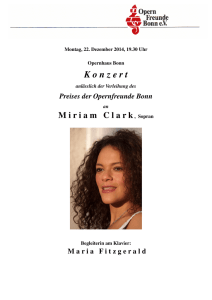Alexander May (Inszenierung und Bühne)
Werbung

EINE OPER MIT DOPPELTEM BODEN Carolin Nordmeyer (Musikalische Leitung), Alexander May (Inszenierung und Bühne), Monika Staykova (Kostüme) und Ralf Waldschmidt (Dramaturgie) im Gespräch über Il re pastore Ralf Waldschmidt: Mozart war erst 19 Jahre alt, als er Il re pastore komponierte, es handelt sich jedoch bereits um seine elfte Oper. Darauf folgte schon Idomeneo, eines der großen Werke des Opernkomponisten. Ist diese Serenata eine „Jugendoper“, kann man das „Jugendliche“ in dem Werk selber nachweisen? Carolin Nordmeyer: Ich glaube schon, dass es hier „Jugendlichkeit“ in der Musik gibt, aber die spürt man auch in jeder anderen Mozartoper. In Il re pastore ist jedoch deutlich zu erkennen, dass die Figuren, die Mozart musikalisch darstellt, jung sind und das spürt man auch in der Musik. Die Auftrittsarie von Elisa zum Beispiel sprüht vor Jugendlichkeit. Wenn die Schäferin auftritt, dann funkelt, trillert und jubiliert es überall und man meint förmlich, die gute Luft in den Bergen, das grüne Gras und die Blumen zu riechen. Aber es gibt auch andere Arien, die von großer Reife zeugen und in denen man merkt, dass die Figuren der Oper eben nicht nur jung und frisch sind, sondern dass sie schon viel erlebt haben, sich Gefühle entwickeln und diese für die Figuren an Bedeutung gewinnen. Das Rondeaux von Aminta etwa ist in dieser Hinsicht an Ruhe und Reife ein großes Zeugnis. „Jugendoper“ ist ein Etikett, das man hier und da verwenden kann, aber Mozart wendet in dieser Oper viele seiner „Tricks und Kniffe“ an, die weit über das Gefühl hinaus weisen, es würde sich hier um eine frühe Oper oder gar ein Singspiel handeln. Gerade in der Instrumentation tritt das deutlich zu Tage. Wenn Mozart den König in seiner Auftrittsarie mit Pauken und Trompeten erscheinen lässt, ihn in seiner zweiten Arie dann aber, bar seiner Königsinsignien, mit virtuos konzertierenden Flöten auftreten lässt und Alessandro sich in einer ganz eitlen Art und Weise selbst beweihräuchert, dann sind dies schon sehr weitreichende und hintergründige Mittel der Darstellung. Ralf Waldschmidt: Die Geschichte jedenfalls handelt von jungen Menschen. Was für ein Lebensgefühl steckt in diesem Stück? Alexander May: Auf jeden Fall ein Lebensgefühl, das mit Neubeginn zu tun hat. Beim Schäfer Aminta spürt man zum Beispiel, dass er im Umgang mit seiner Geliebten Elisa noch nicht viele sexuelle Erfahrungen hat. Wie intim ihre Beziehung tatsächlich ist, wird nicht ausgesprochen, aber die beiden sind durch ihr Vorhaben zu heiraten, kurz davor, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Im ersten Drittel der Oper überbringt Elisa die frohe Botschaft, dass ihr Vater sein Einverständnis zur Heirat gegeben hat, doch da taucht plötzlich der Berater Alexanders des Großen auf und verkündet, dass Aminta König werden soll. Auch Tamiri, die junge Prinzessin des vertriebenen Tyrannen Strato, steht in ihrem Leben vor einem Umbruch. Da sie meint, gesucht zu werden und daher um ihr Leben fürchtet, lebt sie inkognito bei Elisa – bis ihr früherer Geliebter Agenore erscheint und Tamiri damit wieder vor eine neue Situation gestellt wird. Es geht in der Geschichte also um lauter junge Menschen, die kurz vor großen Entscheidungen und Wendungen in ihrem Leben stehen. Ralf Waldschmidt: Das Stück steht für Mozart nicht nur bezüglich seiner Biographie, sondern auch formal an einer Grenze. Es trägt die merkwürdige Gattungsbezeichnung „Serenata“ und darüber, wie die Uraufführung tatsächlich ausgesehen hat, ist nichts Genaues bekannt. Gerade in den Arien verwendet Mozart viele Opera-seria-Formen, die eher aus der Barockoper kommen. Trotzdem hat Il re pastore tatsächlich – trotz seiner manchmal vielleicht etwas schematischen und bereits zu Mozarts Zeiten historischen Formen – etwas Neues, Lebendiges, etwas vielleicht doch Jugendliches. Diese Musik, finde ich, strahlt. Mozart hat somit – wie auch schon in anderen Stücken – zwei Dinge gleichzeitig geschafft: er erfüllt eine Form und legt viel Psychologie in das Stück. Wie geht man damit um? Wir wollen ja nicht den Besuch eines Erzherzogs am Hof des Salzburger Erzbischofs nachstellen, sondern wir versuchen mit dem Material etwas von heute zu erzählen. Daher haben wir einen besonderen Spielort ausgesucht: das Foyer. Hat denn das Foyer musikalisch und szenisch besondere Gesetze, besondere Konsequenzen? Kann man dort überhaupt Oper machen? Carolin Nordmeyer: Man kann dort ganz hervorragend Oper machen. Der Raum schreit förmlich danach, sich darin auszutoben, alle Ecken auszuspielen und sich darin auszubreiten. Das Foyer ist ein Raum, der vieles gleichzeitig möglich macht, weil er zum Beispiel durch die hohe Decke eine große Weite ausstrahlt und trotzdem sehr eng ist und der – wie wir es in den Proben mit den durchwegs jungen Sängerinnen und Sängern gemerkt haben – doch eine Menge anstellt. Sich in diesem Raum zu bewegen, ist eine große Herausforderung. Musikalisch funktioniert das wunderbar, weil der Raum für die Zuschauer und Zuhörer – die sich ja sozusagen mitten im Geschehen befinden – einen Klang wiedergibt, den man sonst gar nicht so erzeugen kann. In diesem Klang zu baden und ihn eigentlich fast schon anfassen zu können, das ist sehr reizvoll. Alexander May: Für unsere konzeptionelle Ausgangssituation ist der Raum auf jeden Fall sehr gut geeignet. Die Zuschauer befinden sich nicht in einer üblichen Theatersituation, sondern sie sitzen am Rand des Foyers und schauen in einen Raum hinein, in dem fünf gedeckte Tische stehen. Man hat den Eindruck, die Tische seien für die Pause vorbereitet, nur mit dem Unterschied, dass Zuschauer darum herum sitzen. Auf einmal hört man Lärm im Flur und man stellt fest, dort sind Leute, die nach irgendetwas suchen und aufgeregt sind. Sie betreten plötzlich den Raum, erkennen, dass sie an diesem Ort richtig sind und der Zuschauer sieht, wie diese jungen Leute sich entscheiden, in diesem Raum ihre Oper zu spielen. Die Vorgeschichte dazu könnte folgendermaßen heißen: fünf Sänger ziehen durch Deutschland und müssen in jeder Stadt ein Gebäude finden, in dem sie ihre Il re pastore-Oper aufführen können. Diesen doppelten Boden spürt man mehrfach. Es gibt immer wieder Beziehungen zwischen den Sängern, die mit der Geschichte Il re pastore nichts direkt zu tun haben, die aber mit der Geschichte der jungen Sänger zu tun haben. Das ermöglicht ein schönes Spiel auf zwei Ebenen. Das heißt, man befindet sich nicht in einem fremden Land der Antike, sondern man ist immer in der Stadt Augsburg im Theaterfoyer und sieht, wie die Welt von Il re pastore durch die Musik und durch das Spiel entsteht. Ralf Waldschmidt: Was bedeutet das für die Kostüme? Monika Staykova: Wir erzählen diese Geschichte mit sehr minimalistischen Mitteln, daher sind die Kostüme und das Aussehen der Figuren sehr wichtig. Sehr reizvoll ist das Konzept, dass die jungen Leute im Foyer spielen, privat herein kommen und dann ihre Kostüme vor Ort finden. Dadurch entsteht eine Atmosphäre des „Hineinschlüpfens“ in das Stück. Es werden somit neue Situationen geschaffen und die Figuren entpuppen sich mit der Erzählung immer mehr und mehr durch ihre Kleidungsstücke, die sie dann anziehen. Außerdem haben wir versucht, alle Charaktere sehr genau zu zeichnen, zum Beispiel, indem der König die Farben Rot und Gold erhalten hat. In der Naturwelt des Schäfers und seiner Geliebten hingegen finden wir eher Pastelltöne und helle Farben. Darüber hinaus arbeiten wir sehr viel mit unserem Schafsmotiv, das im Bühnenbild enthalten ist und das wir auch in den Kostümen wiederentdecken werden. Ralf Waldschmidt: Il re pastore handelt auch von der Identitätssuche junger Leute, die nicht wissen, wer sie sind – oder nicht sind, was sie scheinen. Wie setzt man das um, ohne das Publikum mit dieser Zweigleisigkeit zu verwirren? Und was ich bei den Kostümen noch nicht ganz heraushören konnte, hat jeder zwei Kostüme, so dass das Verkleiden offensichtlich wird? Monika Staykova: Ja, jeder hat zwei Kostüme. Die Sänger werden in das Stück hinein steigen. Das heißt, sie kommen als ganz normale Privatleute, privat gekleidet, jeder bekommt seine Rolle und so werden sie sich dann verkleiden. Dieses „sich Umziehen“ wollen wir sichtbar machen, so dass wir dem Zuschauer den Prozess wirklich erzählen können. Es ist nicht wie auf der großen Bühne, wo man hinkommt und ein kompliziertes Bühnenbild vorfindet, sondern bei uns ist alles sehr nah am Zuschauer, nah am Geschehen dran. Wir haben uns Mühe gegeben, die Merkmale so zu erarbeiten, dass sie wirklich Stärke und Bühnenpräsenz haben. Zum Ende des Stückes werden die Darsteller teilweise wieder in ihre Privatsphäre, Privatwelt und Privatkleidung sichtbar zurückkehren, das ist natürlich sehr spannend. Ralf Waldschmidt: Das heißt, dass man gleichzeitig zwei Identitäten haben kann. Das trifft besonders auf Aminta zu, den Königssohn, der das gar nicht weiß. In der Uraufführung hatte man für die Rolle des Aminta einen Kastraten, jetzt wird er von einer Sopranistin verkörpert. Ist dieser Wechsel zwischen den Identitäten etwas, was das Stück vielleicht gerade für junge Leute verständlich macht? Alexander May: Was jungen Leuten bestimmt Spaß macht zu sehen, ist, dass wir sehr frech mit der Situation umgehen; wie wir aus den Rollen aussteigen und dann wieder in die Rollen einsteigen. Eine solche Situation hatten wir gerade heute in der Probe bei der zweiten Agenore-Arie. Agenore ist darin sehr aufgebracht und wütend und mitten in der Arie gibt es eine Stelle, an der ihn die Kollegen, die eigentlich gar nicht in dieser Szene sind, zu seinen tollen Ideen beglückwünschen, die er für den ersten Teil hatte. Er reagiert auch für einen kurzen Augenblick darauf, wechselt dann gleich wieder zurück in seine Situation und spielt mit großer Wut und Aggression weiter. Und so etwas kann – weil es im Laufe des Abends bereits etabliert ist – sehr viel Spaß machen. Man sieht, wie man mit Gefühlen Theater spielt und singt. Ralf Waldschmidt: Mozart hat in der Partitur konzertierende Instrumente eingesetzt. Verfolgte er damit bestimmte dramaturgische Absichten? Carolin Nordmeyer: Ganz bestimmt. In Amintas zweiter Arie, dem Rondeaux, löst sich die Sologeige wie ein zweites Ich, wie ein Seelenschatten heraus. Es öffnet sich in der Tat in dieser Arie ein Tor zum Himmel, zu einer anderen Welt. Dies geschieht gerade an dem Punkt, an dem Aminta eigentlich den Entschluss gefasst hat, seine „Sandkastenfreundin“ Elisa zu heiraten. Doch nun muss er sich entscheiden, ob er dem Staatswohl folgt und die Position des Königs einnimmt oder sein persönliches Glück verfolgt. Das Rondeaux ist ein völliger Zeitstillstand und ein Ausblick, der größte Ausblick in seine Seele. Das ist anders, als in anderen Arien, die zum Teil eher „Darstellungsnummern“ sind. In dieser Arie zeigt er sich wirklich selbst. Da wird nichts dargestellt, sondern es geht sein „Herz auf“, es ist eine Offenbarung und das zeigt sich auch in der Musik ganz deutlich. Die Arie ist sehr speziell und hat ganz viel Zauber in sich. Die Streicher haben, bis auf die Bassgruppe, alle einen Dämpfer und das ergibt einen sehr schattigen Klang. Es gibt außerdem zwei Englisch-Hörner – was so gut wie nie vorkommt, meistens ist es ein Englisch-Horn –, dazu zwei Flöten, zwei Fagotte; das ist eine ganz andere klangliche Welt, als in den angrenzenden Nummern. Dazu kommt die Solovioline, die sich aus dem Klang herauslöst und in den schönsten Geigenfarben singt und jubiliert. Das ist ein wirklich ganz besonderer Moment. Die konzertierende Flöte in Alessandros zweiter Arie dagegen ist eher so etwas wie ein kecker Begleiter. Das hat viel damit zu tun, dass sie einen sehr virtuosen Part zu spielen hat, was in der Geigenstimme nicht der Fall ist. Die Geige hat keine virtuose, sondern eine sehr zarte, sehr intime und seelenhafte Stimme. Die Flöte hingegen hat ein bisschen etwas von einem Springinsfeld, da darf jemand sein Virtuosentum darstellen. Das passt sehr gut in die Situation, in der dieser eitle Alexander – der trotzdem nicht unsympathisch ist – sich selbst darstellt. Ralf Waldschmidt: Noch ein Wort zu Alexander. Il re pastore ist nicht nur von Mozart, sondern auch von Gluck, von Hasse und anderen Komponisten des 18. Jahrhunderts vertont worden und war meist eine Huldigungsoper für einen Herrscher. Das heißt, ursprünglich war Alexander die Figur, auf die das Stück eigentlich zugelaufen ist, heute erscheint Alexanders Nimbus eher fragwürdig. Alexander May: Alexander ist auf jeden Fall sehr schnell in seinen Entscheidungen und er glaubt, dass die Dinge, die ihm einfallen, alle richtig sind, weil er wahrscheinlich außer Regieren nie etwas anderes gemacht hat. Er hat zwar seine Ratgeber um sich, aber es fehlt ihm der Blick für die Bedürfnisse der Menschen um ihn herum. Das macht das Stück auch modern, denn das ist ja auch ein Punkt, an dem wir in der heutigen Politik manchmal das Gefühl haben, die Politiker sollten einmal mehr auf die Bedürfnisse der Menschen schauen, als sich um sich selbst zu drehen. Und das lässt Alexander ziemlich egoistisch erscheinen. Aber Alexander ist, auch mit seiner Egozentrik und mit der Art und Weise wie er mit seinen Ideen umgeht, total schrullig und dadurch auch sehr liebenswert. Es fällt nur schwer, ihn von Außen wirklich ernst zu nehmen. Wahrscheinlich war das im 18. Jahrhundert anders, aber mir ist das bei der Beschäftigung mit der Figur sehr schwer gefallen. Er ist eine sehr komische Figur. Ralf Waldschmidt: Drückt sich das auch in seinem Kostüm aus? Monika Staykova: Ja, das werden wir sehen. Er ist auf jeden Fall prächtig ausgestattet; mit Glanz und Gloria. Alexander May: Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich inszeniere zum ersten Mal eine Oper. Was sich mir in dieser Arbeit erschlossen hat und was mir früher nicht so bewusst war, ist, wie eine Arie überhaupt zustande kommt. Und zwar spreche ich von der Tatsache, dass die Figur in ihrer Szene an einen Punkt kommt, an dem Worte nicht mehr ausreichen und sie deswegen in eine andere Form übergehen muss. Für meine Arbeit heißt das, dass ich innerhalb der Szene immer wieder nach der Situation suche, in der die Figur einen Druckpunkt hat, von dem aus sie in eine andere Emotion abspringen kann und die dann in der Arie verhandelt wird. Das haben wir durch die Zweisprachigkeit noch unterstrichen. Die Rezitative finden auf Deutsch statt und wenn die Worte nicht mehr ausreichen, die Freude oder die Gefühle zu groß werden, muss eben ein „Lied“ – und zwar auf Italienisch – gesungen werden. Und das ist für mich eine spannende Erkenntnis innerhalb meiner Arbeit; ein interessanter Gedanke, der auch dem Zuschauer den Wechsel zwischen den Sprachen erklärt. Das Gespräch wurde im Oktober 2009 in Augsburg geführt.