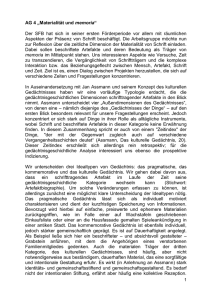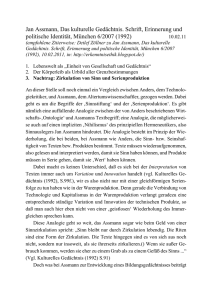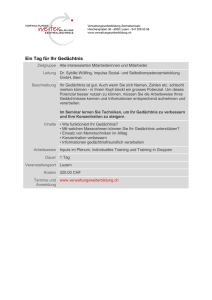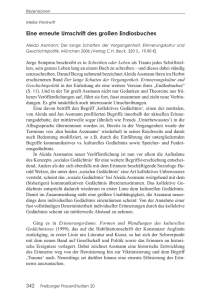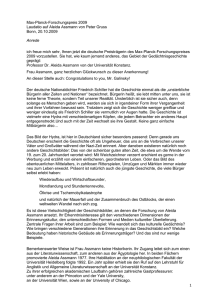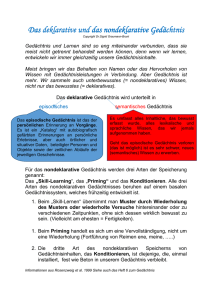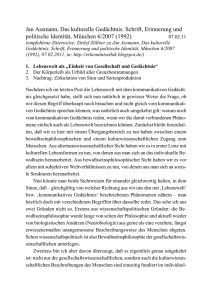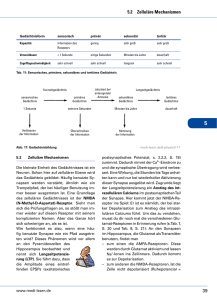Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und
Werbung

Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und 08.02.11 politische Identität, München 6/2007 (1992) (empfohlene Zitierweise: Detlef Zöllner zu Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität, München 6/2007 (1992), 08.02.2011, in: http://erkenntnisethik.blogspot.de/) 1. Lebenswelt als „Einheit von Gesellschaft und Gedächtnis“ 2. Der Körperleib als Urbild aller Grenzbestimmungen 3. Nachtrag: Zirkulation von Sinn und Serienproduktion In Form von zwei Thesen beschreibt Assmann das Verhältnis zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. (Vgl. Kulturelles Gedächtnis (1992), S.130f.) In der ersten These stellt er die Entstehung von Ich-Identität als einen Prozeß dar, der von der Gesellschaft ausgeht: „Ein Ich wächst von außen nach innen. Es baut sich im Einzelnen auf kraft seiner Teilnahme an den Interaktions- und Kommunikationsmustern der Gruppe, zu der er gehört, und kraft seiner Teilhabe an dem Selbstbild der Gruppe. Die Wir-Identität der Gruppe hat also Vorrang vor der Ich-Identität des Individuums ...“ (Kulturelles Gedächtnis (1992), S.130) Diesen Bildungsprozeß kann Assmann nur so beschreiben, weil er keinen Begriff vom Körperleib und der Grenze, vor der jeder Mensch steht, hat. Zwar ergänzt er seine These mit dem Hinweis, daß sich eine individuelle Identität „immer am Leitfaden des Leibes“ entwickelt, der so die Basis eines „irreduziblen Eigenseins“ bildet (vgl. Kulturelles Gedächtnis (1992), S.131), aber dieser Basis fehlt bei Assmann die Plessnersche Grenzhaftigkeit. Sie ist nur der Ort, auf den der gesellschaftliche Bildungsprozeß hinzielt, gewissermaßen als Nährboden des aus ihm erwachsenden wirhaften Ich. Mit dieser eingeschränkten Blickweise auf den Körperleib geht bei Assmann auch eine anatomische Beschränkung auf die „neuronale() Ausstattung“ des Gedächtnisses einher. (Vgl. Kulturelles Gedächtnis (1992), S.47) Was Assmann dabei entgeht, ist, daß der Körperleib selbst schon seine Grenze zwischen Innen und Außen mit sich führt, unabhängig von jeder Gesellschaftlichkeit, und diese so zum Ur-Bild jeder weiteren Grenzbestimmung von Innen und Außen wird. Dem scheinbar von außen nach innen wachsenden Ich, von dem Assmann hier so bildhaft spricht, geht ein von innen nach außen wachsendes Bewußtsein voraus, bei dem man vielleicht noch nicht von einer Ich-Identität im engeren Sinne sprechen kann, das aber von Anfang an exzentrisch positioniert ist. Diese exzentrische Verhältnisbestimmung zum Körperleib wird so zum Ur-Bild jeder weiteren Grenzbestimmung, auch jener des kulturellen Gedächtnisses, dem Assmann mit dem Ethnologen Wilhelm E. Mühlmann eine „limitische() Struktur“ (von limes = Grenze (vgl. Kulturelles Gedächtnis (1992), S.153)) zuspricht: „Je komplexer die Kultur, desto größer wird der Graben, den sie im Inneren der Gruppe aufreißt, weil immer nur wenige Spezialisten das entsprechende Wissen zu verwalten und zu praktizieren imstande sind ... .“ (Kulturelles Gedächtnis (1992), S. 153), S.149) Assmann läßt keinen Zweifel daran, daß wir es hier nicht nur mit einem bloß quantitativen Speicherproblem zu tun haben, sondern mit einer die Gesellschaft stratifizierenden Qualitätsbestimmung von Kultur: „Wir müssen also unterscheiden zwischen einer repräsentativen und einer exklusiven Elitekultur.“ (Kulturelles Gedächtnis (1992), S.153), S.150) – Eine solche limitische Struktur überträgt das dualistische Körper-Geist-Schema – als idealistischer Verhältnisbestimmung des Körperleibs – auf die Kultur. Die Menschen werden kulturell in zwei Klassen geteilt: den ‚Leib‘, also diejenigen, die für die leiblichen Bedürfnisse zu sorgen haben, und den ‚Geist‘, also diejenigen, die für die geistigen Bedürfnisse zu sorgen haben. Assmann beteiligt sich an so einer ideologischen Spaltung der Gesellschaft nicht. Aber der stratifizierende Mechanismus ist doch derselbe. Seiner ersten These vom von außen nach innen wachsenden Ich stellt Assmann nun dialektisch eine zweite These gegenüber: „Kollektive oder Wir-Identität existiert nicht außerhalb der Individuen, die dieses ‚Wir‘ konstituieren und tragen. Sie ist eine Sache individuellen Wissens und Bewußtseins.()“ (Kulturelles Gedächtnis (1992), S.131) So sehr diese These für sich gesehen unserer eigenen Verhältnisbestimmung des Körperleibs nahekommt, beinhaltet sie letztlich doch eine dem Schema vom Ganzen und seinen Teilen folgende dialektische Bestimmung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft: „These 1 behauptet den Vorrang des Ganzen vor dem Teil, These 2 den des Teils vor dem Ganzen. Es handelt sich um die in der Sprachwissenschaft wohlbekannte Dialektik von Dependenz und Konstitution (oder Deszendenz und Aszendenz). Der Teil hängt vom Ganzen ab und gewinnt seine Identität erst durch die Rolle, die er im Ganzen spielt, das Ganze aber entsteht erst aus dem Zusammenwirken der Teile.“ (Kulturelles Gedächtnis (1992), S.131) Assmanns These unterscheidet sich also von unserer Verhältnisbestimmung: statt einer einseitigen Fundierung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft haben wir eine gleichursprüngliche, wechselseitige Fundierung von Individuum und Gesellschaft vorliegen, von der aus der dialektische Prozeß zwischen Individuum und Gesellschaft gedeutet wird. Diese Aufhebung des einseitigen Fundierungsverhältnisses spiegelt die Andersartigkeit dieses Zugangs zum Menschen wider, da von der Gesellschaft aus der Körperleib weder in seiner arbeitsteiligen Anatomie noch als organischer Funktionszusammenhang in den Blick kommen kann. Wenn ich die „limitische Struktur“ des kulturellen Gedächtnisses auf ihr Urbild im Körperleib mit seiner exzentrischen Positionalität zurückführe, so meine ich damit, daß der Mensch auf ein sichtbares Gegenüber angewiesen ist, um sich dazu verhalten, sprich: sich dazu positionieren zu können. Zu seiner Lebenswelt kann er sich nicht verhalten. Er verbleibt in seiner animalischen Verhaftung in der Mitte der Lebenswelt ihr gegenüber unbeweglich. Die einzige Möglichkeit des Menschen in einer mündlichen Kultur, die noch über kein kulturelles Gedächtnis verfügt, sich zu seiner Lebenswelt zu verhalten, ist, da er nicht aus dieser Lebenswelt heraus kann (so wie er nicht aus seiner ‚Haut‘ heraus kann), sich dem anderen, fremden ‚Menschen‘ – sprich: einer fremden Lebenswelt – gegenüber zu stellen und sich so davon abzusetzen, um so zu einem Selbstverhältnis zu kommen. In der noch lebensweltlichen Formung eines Selbstbilds ist diese Absetzung gegenüber dem sichtbaren Anderen deshalb so ursprünglich zentral, weil die eigene kulturelle Gestalt durch weitgehende Verschmelzung mit den lebensweltlichen Mechanismen unsichtbar bleibt. Daß sich diese lebensweltliche Gewöhnung an Spiegelungsprozessen – zumal in Kombination mit Machtinteressen – auch auf die Herausbildung einer eigenständigen Gedächtniskultur überträgt, ist dann nicht mehr weiter verwunderlich. Hier bedarf es der zusätzlichen Schulung eines individuellen Verstandesgebrauchs, um eine individuelle Auseinandersetzung mit dem kulturellen Gedächtnis zu befördern. Um sich in einer mündlichen Kultur zu sich selbst exzentrisch positionieren zu können, bedarf der Mensch also des Anderen als Fremden. Nur so kann er seine im Körperleib vorgegebene Grenzbestimmung in eine selbstbewußte gesellschaftliche Haltung übertragen.