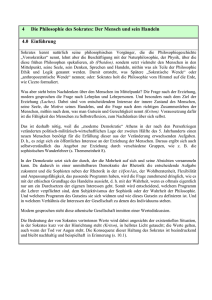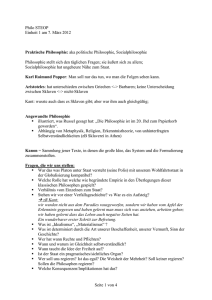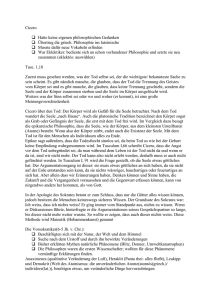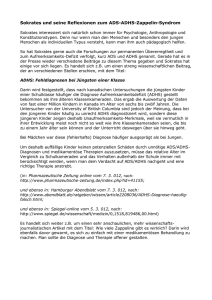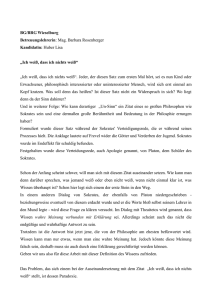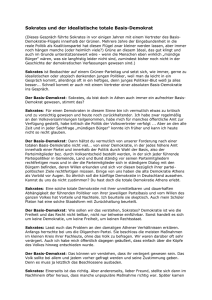Sprachphilosophie
Werbung

Modul Philosophie
Jörg Krappmann, Marie Krappmann, Karsten Rinas
Sprachphilosophie
Vorwort........................................................................................................................................ 3
1. Einleitung: Die Stellung der Sprachphilosophie innerhalb der Philosophie............ 4
Text 1 Johannes Haag: Sprachphilosophie. Die Flüchtigkeit der Bedeutung..........4
Text 2 Johannes Hirschberger: Analytische Philosophie...........................................5
2. Historische Etappen der Sprachphilosophie................................................................. 6
2.1Überblicksdarstellungen.................................................................................................... 6
Text 3 Herbert Schnädelbach: “Philosophie”..............................................................6
Text 4 Ernst Tugendhat / Ursula Wolf: Logik und moderne Sprachphilosophie..... 14
2.2 Sprachphilosophie in der Antike................................................................................... 21
Text 5 Platon: Kratylos................................................................................................. 21
Text 6 Jürgen Trabant: Platon...................................................................................... 42
2.3 Sprachphilosophie in der Spätscholastik...................................................................... 44
Text 7 Jürgen Villers: Nominalistischer Aristotelismus und die Sprache
(Ockham).......................................................................................................................... 45
Text 8 Johann Huizinga: Herbst des Mittelalters...................................................... 46
2.4 Sprache in Aufklärung und deutschem Idealismus.................................................... 47
2.5 Sprachphilosophie im 19. Jahrhundert......................................................................... 49
Text 9 Wilhelm von Humboldt: Zum Ursprung der Sprache................................ 49
Text 10 Adolf Stöhr: Über den Unsinn....................................................................... 50
2.6 Die Sprachkrise am Ende des 19. Jahrhunderts.......................................................... 51
Text 11 Friedrich Nietzsche: Sprache und Wahrheit.................................................. 51
2.7 Der linguistic turn............................................................................................................ 52
Text 12 Wittgenstein: Die Hauptsätze aus dem Tractatus-logico philosophicus.. 52
Text 13 Wittgenstein: Von der Logik zur Philosophie............................................... 53
2.7.1Philosophie der idealen Sprache vs. Philosophie der normalen Sprache................ 55
Text 14 Gottlob Frege: “Über die wissenschaftliche Berichtigung einer
Begriffsschrift”................................................................................................................. 55
Text 15 Eike von Savigny: “Das Normalsprachenprogramm in der Analytischen
Philosophie”..................................................................................................................... 57
3. Ausblick: Sprache und Kulturwissenschaft.................................................................. 62
Text 16 Claudia Fahrenwald: Vom Ende der großen Erzählungen......................... 62
Bibliografie zu Texten 1–16.................................................................................................... 65
Modul Philosophie
Vorwort
Dieser Reader wurde im Rahmen des von der VolkswagenStiftung geförderten Projekts ‘Deutsch
als Sprache der Geisteswissenschaften’ an der Germanistik der Palacký-Universität Olmütz erarbeitet. Er wendet sich insbesondere an Studenten dieses Studiengangs, die Philosophie als
Schwerpunktfach gewählt haben. Grundsätzlich dürfte er jedoch generell für interessierte Germanistik- oder Philosophie-Studenten geeignet sein.
Unser Ziel war es, durch die Präsentation ausgewählter Texte ein Verständnis für Grund­probleme
der Sprachphilosophie zu wecken. Die Präsentation erfolgt primär chrono­logisch, integriert jedoch auch systematisierende Darstellungen.
Unser besonderer Dank gilt der Organisatorin des Projekts ‘Deutsch als Sprache der Geisteswissenschaften’, Ingeborg Fiala-Fürst, sowie der VolkswagenStiftung.
Olmütz, im Juli 2013
Jörg Krappmann
Marie Krappmann
Karsten Rinas
3
Modul Philosophie
1. Einleitung: Die Stellung der Sprachphilosophie innerhalb der
Philosophie
Die Sprache wird gemeinhin als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal des Menschen zur Tierund Pflanzenwelt anerkannt. Daran haben auch die Forschungen der Biologen und Zoologen,
die in den letzten Jahrzehnten auch Sprachsysteme bei höher entwickelten Tieren nachweisen
konnten, nichts geändert. Keine der bisher entschlüsselten Tiersprachen erreicht den Grad an
Komplexität und Differenziertheit wie die der menschlichen Sprache. Sie gehört zum menschlichen Leben ebenso wie zum menschlichen Denken und es ist damit leicht verständlich, dass sie
auch früh zum Gegenstand philosophischer Betrachtung wurde. Gerade innerhalb der Philosophie, müsste man ergänzen, denn nach allgemeiner Auffassung zeichnen sich Philosophen eben
– siehe Sokrates – dadurch aus, dass sie mit sprachlichen Argumenten in Dialoge eingreifen, um
diese zu einem für sie erfolgreichen Abschluss zu führen. Und es sind neben handgreiflichen
auch sprachliche Äußerungen – siehe Xanthippe – die sie wieder ins Alltagsleben zurückholen,
wenn sie sich in den Gesprächen verloren haben. Letztlich ist alles, was wir von der Philosophie
wissen, sprachlich. Es wurde sprachlich gedacht, in sprachlicher Form (in Texten) festgehalten
und mittels sprachlicher Erkennungsverfahren rezipiert, tradiert, übersetzt und weitergedacht.
Trotzdem ist eine eigenständige philosophische Disziplin unter dem Namen Sprach­philosophie
erst sehr spät entstanden. Während Ethik, Ontologie oder Metaphysik als Disziplinen bereits in
der Antike von den Vorsokratikern begründet und späterhin von den Philosophen der klassischen Zeit (Sokrates, Platon, Aristoteles) systematisiert wurden, datieren zahlreiche neuere Publikationen den Beginn der Sprachphilosophie auf die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Verantwortlich für diese Diskrepanz ist die Beurteilung dessen, was Sprachphilosophie eigentlich ist.
Text 1
Johannes Haag: Sprachphilosophie. Die Flüchtigkeit der Bedeutung
Philosophen aller Epochen haben Sprache als Gegenstand der Philosophie betrachtet. Doch die
Beschäftigung mit sprachphilosophischen Problemen hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine
qualitative Veränderung erfahren. Diese Veränderung war die Voraussetzung für die Wende zum
Sprachlichen in der Philosophie, den sog. „linguistic turn“, die sich dann in den ersten Jahrzehn­
ten des vergangenen Jahrhunderts vollzog und deren Wirkung bis heute fortdauert. Systemati­
sche Philosophie ohne Einbeziehung sprachphilosophischer Fragestellungen ist heute kaum noch
denkbar.
Anhand der Frage, wie das Verhältnis zwischen den Begriffen Sprache, Denken und Welt zu denken
ist, soll diese Wende im folgenden veranschaulicht werden. Denn die Bemühungen der Philoso­
phie des vergangenen Jahrhunderts unterscheiden sich von vorangegangenen philosophi­schen
Entwürfen dadurch, dass die Rolle der Sprache in dieser Begriffstrias entscheidend aufgewertet
wurde.
An der traditionellen Auffassung der Funktion von Sprache in dem genannten Begriffsverhältnis
ändert sich zunächst – und teilweise bis heute – nicht viel: Sprache wird weiterhin als Werkzeug
betrachtet, das dem Ausdruck und dem Austausch von Gedanken dient. Allerdings werden ei­
nige wesentliche Fragen, die mit dieser Auffassung verbunden sind, nun erst als problematisch
wahrgenommen. Was heißt es Gedanken auszudrücken? Welche Eigenschaften muß eine Sprache
haben, damit sie dazu in der Lage ist, geistige Inhalte zu „transportieren“? Was heißt es, einen
Satz zu verstehen? Fragen wie diese beschäftigen die Sprachphilosophie bis heute, und keine von
ihnen hat eine unumstrittene Antwort erhalten. Aber im Laufe der vielfältigen Versuche, diese
Probleme zu lösen, rückte Sprache von der Peripherie philosophischen Interesses zusehends in
dessen Mittelpunkt.
4
Modul Philosophie
Im Zuge unserer Auseinandersetzung mit diesen Fragen werden im folgenden Probleme und Me­
thoden herausgearbeitet, die für die moderne Sprachphilosophie charakteristisch sind.
Aus: Eugen Fischer / Wilhelm Vossenkuhl (Hg.): Die Fragen der Philosophie. Eine Einführung in Disziplinen und Epochen. München: Beck 2003, S. 89.
F ragen
1. Haag zufolge hat „die Beschäftigung mit sprachphilosophischen Problemen [...] gegen Ende
des 19. Jahrhunderts eine qualitative Veränderung erfahren.“ Was ist der Gegensatz zu einer
qualitativen Veränderung?
2. Finden sich im zitierten Auszug Begründungen oder Erläuterungen der These, dass es in der
(Sprach-)Philosophie zu einer qualitativen Veränderung gekommen ist?
3. Laut Haag ist ein wichtiges philosophisches Problem die Klärung der Verhältnisse zwischen
Sprache, Denken und Welt. Wie ließen sich diese Verhältnisse nach unserer ‚naiven’, alltäglichen Auffassung bestimmen?
Text 2
Johannes Hirschberger: Analytische Philosophie
Daß alle Philosophie Sprachanalyse sein soll, ist nun eine Ansicht, die selbst wieder verschieden
verstanden werden kann. Die englischen Analytiker [gemeint sind Russell u. a.] berufen sich dar­
auf, dass alle Philosophie immer schon Sprachanalyse gewesen sei. Wenn Platon etwa Begriffe wie
„gut“ und „wahr“ aufgreift, tue er nichts anderes, als dass er die Sprache in ihre Gehalte zerlege.
Das wird man nicht bestreiten können, genauer, man wird nicht bestreiten können, dass er davon
ausgeht.
Das hat die Philosophie tatsächlich immer getan und muß sie immer tun, weil viele philosophi­
sche Theorien nur auf Missverständnissen des Gesehenen und Gesagten beruhen. Man wird aller­
dings nicht zugeben, dass die Philosophie keine eigenen Wahrheiten finden und nur wiedergeben
könne, was schon in der Sprache enthalten sei. Aber Sprachanalyse überhaupt ist ein unerlässli­
ches philosophisches Denkmittel und war es immer. […] Nur hat man darüber nicht viel Aufhe­
bens gemacht und das handwerkliche Rüstzeug nicht zur Philosophie im Ganzen aufgeblasen.
Aus: Johannes Hirschberger: Geschichte der Philosophie. Band 2. Frankfurt/Main: Zweitausendeins
2001, S. 1188–1192.
F ragen
1. Nach Hirschberger war die Philosophie – in einem gewissen Sinne – immer schon Sprachanalyse. Erläutern Sie dies.
2. Welche Einstellung zur Sprachphilosophie haben die „englischen Analytiker“ (= die Vertreter der Analytischen Philosophie)?
3. Welche Bedeutung für die Philosophie weist Hirschberger der Sprachanalyse zu? Inwiefern
unterscheidet sich seine Position von der der Analytischen Philosophie?
4. Erklären Sie die Bedeutung von ‚etwas zu etwas aufblasen’. Erläutern Sie, wie Hirschberger
diese pejorative Wendung verwendet, um die Analytische Philosophie zu kritisieren.
5
Modul Philosophie
2. Historische Etappen der Sprachphilosophie
Im Folgenden sollen ausgewählte wichtige Beiträge zur Sprachphilosophie in Auszügen präsentiert werden. Die Anordnung ist grundsätzlich chronologisch. Um die Einordnung und Interpretation der folgenden Texte zu erleichtern, werden der Darstellung zunächst zwei fachhistorische
Überblicksdarstellungen vorausgeschickt.
2.1 Überblicksdarstellungen
Text 3
Herbert Schnädelbach: “Philosophie”
Einleitung
[...] Unabhängig von bestimmten Philosophiekonzepten [kann man] nicht definieren [...], was
Philosophie sei. Man kann deswegen auch nicht in ‘die’ Philosophie einführen, ohne zumindest
implizit das Phi­lo­so­phieverständnis ins Spiel zu bringen, das man als Einführender selber be­
sitzt. Man kann somit auch nicht kontextfrei in ‘das’ Philosophieren einführen; denn auch das
Methoden­verständnis wandelt sich mit dem allgemeinen Bild von Philosophie. Dies ist übrigens
der wahre Grund für die vielbeklagte Uneinigkeit der Philosophen untereinander. Es trifft nicht
zu, daß sie so viel ‘zerstrittener’ seien als etwa die Psychologen oder Sozialwissenschaftler, son­
dern ihr Problem ist, daß die Ansichten darüber, was Philosophie sei und wie ihre Gegen­stände
und Methoden zu bestimmen seien, immer schon auf eine philosophische Gesamt­kon­zeption
verweisen.
Für eine Darstellung des Philosophiebegriffs ergeben sich daraus zwei Folgerungen. Wegen des
Wandels dieses Begriffs kann man ihn nur mit begriffsgeschichtlichen Mitteln fassen. Dann aber
genügt es nicht, nur aufzulisten, was jeweils als ‘Philosophie’ definiert wurde, sondern man muß
den jeweiligen Kontext solcher Definitionen mit berücksichtigen, d. h. man muß – zumindest in
Umrissen – die Geschichte jener Gesamtkonzeptionen von Philosophie vor Augen stellen, von der
die Geschichte des Philosophiebegriffs selbst nur ein Aspekt ist. [...]
Im folgenden soll versucht werden, nach einigen Bemerkungen über die Anfänge die drei gro­
ßen Konzep­tionen von Philosophie, die sich in unserer Tradition unterscheiden lassen, dadurch
zu beschrei­ben, daß immer vom jeweiligen expliziten Philosophiebegriff ausgegangen wird, um
dann zu dem überzu­gehen, was jeweils als der Gegenstand, die Methode und die richtige Eintei­
lung der Philosophie ange­sehen wurde. Die dadurch skizzierten Konzeptionen von Philosophie
werden mit Thomas S. Kuhn ‘Para­digma’ genannt werden (Kuhn 1967). Ein Paradigma umfaßt
immer Vor­stellungen vom Gegen­stands­gebiet, von einschlägigen Problem­stellungen und vorbild­
lichen Pro­blem­lösungen einer Disziplin [...].
[In der folgenden Darstellung sollen] ein ontologisches [griech. tò ón – das Seiende], ein menta­
listisches (lat. mens – das Bewußtsein) und ein linguistisches Paradigma unterschieden werden.
[...] Die paradig­men­geschichtliche Darstellung des Philosophiebegriffs ist [...] nur eine ‘ideale’ Re­
konstruktion seiner Geschichte, die ohne starke Typisierung und Vereinfachung nicht aus­kommt.
Ihr methodischer Vorteil aber besteht darin, daß man aus ihr erst einmal ein struktu­riertes Ge­
samtmodell gewinnen kann, das sich dann im Lichte von historischen Detailunter­suchungen prä­
zisieren und kritisieren läßt. [...]
Eine [...] Grundthese des folgenden ist nun, daß die Philosophie als Wissenschaft immer durch
Auf­klä­rungs­schritte von dem einen Paradigma zum anderen übergegangen ist – wenn man nur
den argumen­tati­ven Gehalt solcher Übergänge berücksichtigt. Es wäre eine Vereinfachung, hier
von ‘Ent­wick­lung’ zu spre­chen, weil jeder Fortschritt immer auch einen Preis hat und man nicht
aus­schließen kann, daß das, was auf der einen Seite wie ein Fortschritt aussieht, aus anderer
Perspektive als Rück­schritt, als ein Ver­gessen oder als Verlust von Wesentlichem erscheint. – Dies
ist übrigens der Grund für die Neigung der Philosophie zu Renaissancen: Nimmt man den Aristo­
6
Modul Philosophie
telismus des Mittelalters, den Platonismus der Renaissance [...], aber auch den Neukan­tianismus,
Neuthomismus, Neuhegelianismus und andere Neu...ismen als Beispiel, wird deutlich, daß die
produktive Erinnerung an das vermeintlich Veraltete zum philosophischen ‘Fortschritt’ offenbar
notwendig hinzugehört; in kaum einer anderen Disziplin ist dies der Fall. Daraus folgt auch, daß
die Philosophie ein anderes Verhältnis zu ihrer Geschichte unterhalten muß als die Einzelwissen­
schaften. Weil es zu ihren Aufgaben gehört, die Fort­schrittsidee selbst kritisch zu diskutieren,
kann sie sich in ihrem eigenen wissenschaftstheoretischen Selbstver­ständnis dieser Idee nicht
kritiklos einfach überlassen; sie muß also immer zugleich über einen Begriff von Philosophie und
einen Begriff von der Geschichte dieses Begriffs verfügen. [...]
Das ontologische Paradigma
Was ontologische Philosophie ist, soll in diesem Abschnitt an Platon und Aristoteles verdeutlicht
werden: durch Hinweise auf Begriff, Gegenstand, Methode und Einteilung von Philosophie in
ihrem Sinne. Das platonisch-aristotelische Modell ist das der klassischen Metaphysik, das bis zum
Beginn der Neuzeit alles Philosophieren bestimmte. [...] Die Ausdrücke ‘Metaphysik’ und ‘Ontolo­
gie’ freilich kommen bei Platon und Aristoteles selbst nicht vor. Während das Wort ‘Metaphysik’
schon im 1. Jahrhundert v. Chr. geprägt wurde, ist ‘Ontologie’ ein Kunstwort aus dem 16. Jahr­
hundert. Es bedeutet in der Spätscholastik die allgemeine Metaphysik als Lehre vom Seienden als
solchen und im allgemeinen. [...]
Bei Platon lassen sich zwei Grundbedeutungen von ‘Philosophie’ unterscheiden. Einmal ist damit
jede syste­matisch betriebene theoretische Erkenntnis gemeint – so die Geometrie (vgl. Theätet
143d); auch der Besitz einer solchen Erkenntnis wird von Platon Philosophie genannt (vgl. Euthy­
dem 288 d). An solchen Stellen ist ‘Philosophie’ gleichbedeutend mit ‘Wissenschaft’. [...] Die an­
dere Bedeutung von ‘Philoso­phie’ [...] ist ‘Liebe zur Weisheit’. Somit ist hier die Philosophie] von
der Weisheit (sophía) her bestimmt [...], auch wenn sie sich von ihr unter­scheidet; erst wenn sie
am Ziel ist, fällt die philosophía mit der sophía zusammen [...]
Fragt man nun, warum die Philosophie gerade so und nicht anders bestimmt wird, verweist einen
das ontologische Paradigma auf den Gegenstand; ontologisches Philosophieren ist immer Philo­
so­phie­ren vom Gegenstand her. Dies ist zunächst auch plausibel; denn wie sollte man Erkenntnis
auf andere Weise näher qualifizieren als dadurch, daß man fragt, wovon die Erkenntnis ist? [...]
Erkenntnis muß Erkenntnis von etwas sein, und dieses Etwas muß sein und kann nicht nicht
sein; Erkenntnis von nichts wäre nichts. Erkenntnis aber des Seienden (tò ón) ist ontologische
Er­kenntnis. Sie wird vom Seienden selbst auf den Weg gebracht; darum liegt ihr Anfang im Stau­
nen (thaumázein). Die Grundfrage der Philosophie als On­to­logie lautet: Was ist? Bemerkenswert
ist nun, daß Platon von Vollkommenheitsgraden des Seines des Sei­enden ausgeht: Was ist, kann
vollkommener oder unvollkommener sein, wobei die vollkommene Erkenntnis – die sophía also –
als Erkenntnis des vollkommen Seienden bestimmt wird. [...]
Wenn sich im ontologischen Modell die Philosophie selbst von ihrem Gegenstand her begreift,
dann ist dies auch für ihr Methodenverständnis zu erwarten. ‘Methode’ gehört wortkundlich ge­
sehen zu griech. hodós (der Weg) und bedeutet wörtlich ‘das Nachgehen (eines Weges)’. Für die
Ontologie ist in der Tat Methodologie nichts anderes als das Aufzeigen des Weges zur Wahrheit,
der dem Erkennen im Seienden selbst schon gebahnt ist. [...] Platon hat in seinem berühmten
Höhlen-Gleichnis im VII. Buch des ‘Staat’ diesen Weg [...] in vier Stadien bildlich charakterisiert.
Er führt das Erkennen von den Schatten an der Höhlenrückwand, die die in der Höhle Gefessel­
ten wahrnehmen, zur Beobachtung dessen, was in der Höhle die Schatten wirft – ein Feuer und
Menschen, die sich bewegen und Gegenstände hin- und hertragen –, dann zur Erfahrung der
wirklichen Welt außerhalb der Höhle und schließlich zum Anblick der Sonne, die alles bescheint
und von der alles Wärme und Leben hat. Das Sonnen- und das Liniengleichnis vervollständigen
Platons Methodologie in Bildern und Gleichnissen, die eben nicht nur eine Verfahrensregel für
die Wissenschaft meint, sondern der Seele den Weg aus der Welt der Schatten zur Sonne als der
Idee des Guten weisen will. So wie der Weg aus der Höhle Erkenntnis und Befreiung der Seele
zugleich bedeutet, ist Platons philosophische Methode primär als ein Bildungsweg der Seele mit
dem Ziel ihrer Vergöttlichung zu verstehen. [...]
7
Modul Philosophie
Das mentalistische Paradigma
Daß die Philosophie erkennen will, was ist, scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Darum ist
ontolo­gisches Philosophieren auch so attraktiv, denn da erfährt man etwas über die Welt. Daß die
Philosophie seit Descartes mentalistisch wurde und sich in das Innere des Bewußtseins zurück­
zog, muß demgegen­über als ein großer Verlust, ja als Deformation eines ursprünglich ‘gesunden’
Verhältnisses von Subjekt und Objekt erscheinen. [...]
Die Schwierigkeit ist, daß der, der erkennen will, was ist, voraussetzen muß, daß das, was ist,
sich auch erkennen läßt. Für den Ontologen ist wahre Erkenntnis nur als Erkenntnis des Wahren
möglich; woher weiß er aber, daß das Wahre [...] überhaupt erkennbar ist? Wie kann er sicher
sein, daß das, was er zu erkennen meint, wirklich das Wahre ist? Durch Erkenntnis selbst kann
er dies nicht feststellen; denn die ist hier ja gerade problematisiert: Man kann nicht erkennen,
daß man erkennt. Ontologisches Philoso­phie­ren wird unmöglich, wenn erst einmal fundamental
be­zweifelt ist, daß Erkenntnis des wahren Seins gelin­gen kann. Diesen Zweifel muß man zuerst
ausräumen, wenn man weiter an der Erkenntnis des Seins inter­essiert ist. Die Philosophie kann
also nicht mehr mit dem Staunen beginnen und sich der Faszination durch die Objektwelt einfach
überlassen, sondern sie muß jenen Zweifel, nachdem er einmal in der Welt ist, ernst nehmen,
zu ihrer eigenen Sache machen und dann versuchen, ihn so zu bewältigen, daß Philosophie als
Wissenschaft der Wahrheit möglich bleibt. Die Anfangsfrage kann nicht mehr sein: “Was ist?”,
sondern sie muß lauten: “Was können wir erkennen?” oder “Was kann ich wissen?” (vgl. Kant,
KdrV B 833).
Historisch gesehen ist diese Veränderung [bereits ...] in der antiken Skepsis (von griech. sképtomai – ich spähe, blicke umher, überlege) vollzogen worden; die Argumente der beiden skepti­
schen Schulen, von denen eine zeitweilig die platonische Akademie beherrschte, haben seitdem
das Philosophieren immer be­gleitet und es gezwungen, sich mit ihnen auseinanderzu­setzen. Ihre
Einwände gegen die Möglichkeit, das Sein selbst zu erkennen, sind in ihrer Gründ­lichkeit und
Schlüssigkeit auch in der Moderne nie mehr überboten worden. Selbst Descartes, der Virtuo­
se des methodischen Zweifels (vgl. Descartes, Med. 11ff.), hat die skeptischen Argu­mente nur
als alten “Kohl” bezeichnen können, den er nur mit Widerwillen wieder aufwärme (Med. 118),
und ihnen nur ein einziges Argument hinzugefügt. Zu fragen ist nun, warum der Beginn des
Philosophierens mit dem Zweifel zum Paradigmenwechsel von der ontologischen zur mentalis­
tischen Philosophie nötigt. Hier muß man an die klassische Definition der Wahrheit als Über­
einstimmung von Gegenstand und erkennendem Bewußtsein [...] erinnern. Ist diese Adä­quation
erst ein­mal in Frage gestellt, dann können wir uns nicht mehr unmittelbar auf die res (lat. das
Ding, die Sache, der Gegenstand) beziehen; denn wir haben zunächst nur unseren intellectus und
müssen versuchen, den Skeptiker dadurch zu widerlegen, daß wir vom Boden des Bewußt­seins
aus die Wahrheit als adaequatio rekonstruieren und sichern.
So wird deutlich, daß der ‘Weg nach innen’ nicht bloß eine subjektive Vorliebe für die ‘Inner­
lichkeit’ repräsentiert, sondern unter dem Druck der Skepsis und ihrer Zweifelsargumente er­
zwungen wird. Seit der antiken Skepsis beginnt alles gründliche Philosophieren mit dem Zweifel,
und wenn dies auch kein sehr attraktiver Anfang ist – wer läßt sich schon gern in solche Unsicher­
heit stürzen? –, haben doch alle Philosophen samt den Ontologen darauf reagieren müssen und
sich stets bemüht, zunächst die Erkenn­barkeit des Wahren darzutun. [...]
Einen solchen Weg aus der Skepsis gefunden zu haben, ist Augustinus zu verdanken. Nachdem er
selbst lange den Skeptizismus vertreten hatte, erkannte er, daß es etwas gibt, was der Zweifeln­
de nicht bezwei­feln kann, und dies ist die Tatsache, daß er zweifelt und daß er, um zweifeln zu
können, existieren muß: “Ich zweifle, also bin ich” (dubito ergo sum) lautet das Argument (De tri­
nitate, X; vgl. auch Augustinus, De libero arbitrio (Über den freien Willen), Kap. 3). Die Existenz
des Bewußtseins des Zweifelnden kann von ihm nicht bezweifelt werden und ist für ihn somit
die erste unbezweifelbare Tatsache. So kann man den Skeptizismus mit seinen eigenen Waffen
schlagen, was aber bedeutet, daß man mit dem Bewußtsein beginnen und zunächst mentalistisch
philosophieren muß.
“Dubito, ergo sum” – ist das nicht schon das “cogito, ergo sum” (Ich denke, also bin ich) des Descar­
tes? [...] Das Neue bei Descartes ist nicht das Argument als solches, nicht einmal die Aus­weitung
des dubito auf alle Bewußtseinsakte – cogito heißt nicht nur ‘ich denke’, sondern meint alles, was
mir bewußt sein kann: also auch Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühle usf. –, sondern be­
8
Modul Philosophie
trifft das, was derjenige, der ‘Ich bin’ denkt, unter seinem Ich begreift. Augustinus versteht sich
von vornherein theologisch als Gottes Geschöpf und ist darum sicher, in dem, was er in sich
vorfindet, die Spuren Gottes, Anzeichen seiner Schöp­fungsgedanken und seines Han­delns er­
kennen zu können. [...] Auf diesem Wege wird dann nicht nur Philosophie insgesamt, sondern
sogar noch die antike Skepsis zur “Magd der Theologie’ (ancilla theo­lo­giae)”. – Descartes hingegen
unterscheidet sich von Augustinus [...] dadurch, daß dieser theolo­gische Rahmen wegfällt und
das cogito darauf besteht, ganz auf sich selbst zu stehen und ohne weitere Anleihen auszukom­
men. Die “Abhandlung über die Methode” zeigt auch autobiographisch, was dahinter­steht: das
Bedürfnis des neuzeitlichen Subjekts nach Autonomie, nach vernünftiger Selbständig­keit, nach
Gewißheit im selbst erworbenem Wissen – das Prinzip der bürgerlichen Aufklärungsphilo­so­phie
(vgl. Krüger 1962). Dies alles ist gerade im Widerstand gegen die Auto­rität der theologisch legi­ti­
mier­ten Tra­di­tion überhaupt erst zu erringen und zu sichern. Darum fügt Descartes dem “Kohl”
der Zweifels­argu­mente den “Täuscher-Gott” hinzu. Es könnte ja sein, daß selbst das, was der
christliche Neu­plato­nismus und Augustinismus auf dem “Weg nach innen” als Unbezweifelbares
vorzufinden glaubt [...], Einge­bun­gen eine genius malignus (miß­güns­tiger, boshafter Geist) sind.
Aber selbst dann, wenn ein sol­cher Genius mich täuscht, sagt Descartes, kann er mich nicht dar­
über täuschen, daß ich bin, wenn ich denke, daß ich sei (Med. 17ff.) – so weit reicht seine Macht
nicht. Der Preis hierfür ist, daß der Denkende zunächst nichts anderes in Anspruch nehmen kann
als das, was im cogito, ergo sum gedacht und impli­ziert ist; nach der Skepsis und nach der Theologie
muß die Philosophie als reine Bewußtseinsphilosophie beginnen.
Der Paradigmenwechsel vom Sein zum Bewußtsein verändert notwendig auch den Philosophie­
begriff. [...] Nach der Skepsis kann die Erste Philosophie nicht mehr Ontologie sein. ‘Meta­physik’
bedeutet nach Descartes nicht mehr die Lehre vom Seiendem als solchem und im allge­meinen,
sondern sie enthält als erster Systemteil der Philosophie die “Prinzipien der mensch­lichen Er­
kenntnis” (XLIII). Daß man mit der Untersuchung nicht der Gegenstände, sondern der Möglich­
keiten und Grenzen unserer Erkenntnis der Gegen­stände philosophisch zu beginnen habe, ist
auch Kants Ausgangspunkt, und darin bleibt er Cartesianer. Was man dann im 19. Jahrhundert
“Erkenntnistheorie” nannte, tritt somit an die Stelle der Ersten Philosophie. [...]
Die Neubestimmung der Ersten Philosophie als Wissenschaft von den “Prinzipien der mensch­
lichen Erkenntnis” [...] hat erhebliche Folgen für die Bestimmung des Gegenstandes der Philo­
sophie. [... Kant zufolge ist es] nicht so, wie die Ontologie behauptet, daß sich unsere Weise zu
erkennen nach den Gegen­ständen richten müsse, sondern unsere Erkenntnisweisen und –mög­
lich­keiten legen a priori fest, was Gegenstand unserer Erkenntnis sein kann und was nicht. Damit
kehrt sich auch im Verhältnis von Gegenstand und Methode die traditionelle Rang­ordnung um;
denn die Methode kann sich ja nicht einem Objekt anmessen, das man erst durch das Befolgen
einer Methode konstituieren kann.
Die Methode gehört schon bei Descartes zu den “Prinzipien der menschlichen Erkenntnis” und
geht aller Gegenstandserkenntnis voraus. In der “Abhandlung über die Methode” bestimmt sie
Descartes in vier Regeln: (1) Nichts soll als wahr angenommen werden, was sich nicht so klar und
deutlich dem Geiste dar­bietet, daß man es nicht mehr bezweifeln kann; (2) alle Probleme sind in
elementare Teilprobleme zu zerlegen; (3) die Lösung ist im geordneten Aufstieg vom Ein­fachen
zum Komplexen zu suchen; (4) durch vollständige Aufzählung und Übersichten soll man sich
versichern, nichts vergessen zu haben (vgl. Abh. II, §§14–17). [...] Fragt man nun, wo Descartes
diese Regeln her hat, wird man von ihm nicht auf die Natur der Gegenstände ver­wiesen – dies
wäre zirkelhaft –, sondern auf die euklidische Geometrie, deren Verfahren und Ergebnisse ihn im
Lichte seiner Forderung nach Klarheit und Deutlichkeit der Erkenntnis allein überzeugt hatten;
keine andere Wissenschaft konnte damit konkurrieren (vgl. Abh. I, insbes. §10). [... Eine solcher­
maßen konzipierte Philosophie muß] ein System bilden; denn nur wenn das Wissen vollständig
ist, kann man sicher sein, den Zweifel vollständig entkräftet zu haben. Daß die Philosophie nur
als System möglich sei, ist eine Vorstellung, die die Philosophie der Neuzeit von der der Antike
unterscheidet; darin waren alle Philosophen bis Hegel Cartesianer. [...]
So darf die neuere Philosophie seit Descartes nur das als ihren Gegenstand betrachten, was be­
stimm­ten, der Gegenstandserkenntnis vorausliegenden und sie schon bestimmenden methodolo­
gischen Forderungen entspricht. Weil Descartes seine Methodologie der Geometrie entlehnt,
ist es nicht verwunderlich, daß das einzige, was mit Klarheit und Deutlichkeit von den Gegen­
9
Modul Philosophie
ständen in der Welt erkannt werden kann, außer ihrer Existenz ihre geometrischen Eigenschaf­
ten sein können; die Natur ist res extensa, ausgedehnte Körper­welt, und sonst nichts. Auch Kant
behauptet, “daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen
werden könne, als darin Mathematik anzutreffen sei” (Kant, MAN A VIII). Die Verkehrung des
traditionellen und unmittelbar plausiblen Bestimmungsverhältnisses von Begriffsbildung und
Gegenstand ist das, was man im Anschluß an Kants eigene Charakterisierung seiner Vorgehens­
weise “kopernikanische Wende” nennt. [...]
Der Preis für diese Wendung und für die Vorteile, die sie für eine Metaphysik als Wissenschaft
bedeuten kann, ist hoch; denn daß sich die Natur, wie sie unabhängig von uns besteht, nicht von
uns Gesetze vorschreiben läßt, ist selbstverständlich. Man muß also unterscheiden zwischen den
Dingen, wie sie ‘an sich’ sind, und den Dingen, wie sie uns erscheinen oder wie wir sie erfahren.
Also sind Metaphysik [...] und auch Wissenschaft überhaupt nur möglich im Bereich möglicher
Erfahrung, d. h. von Gegenständen als Erscheinung. Damit entfallen alle metaphysischen Aus­
sagen als unbeweisbar, die sich nicht auf Erfah­rung stützen können: über die Seele und ihre Un­
sterblichkeit, über das Weltganze und die menschliche Freiheit, vor allem aber über Gott und
seine Existenz. [...]
Das linguistische Paradigma
Es sollte deutlich werden, daß der Übergang vom ontologischen zum mentalistischen Paradigma
der Phi­lo­sophie – wenn man nur auf die argumentativen Gründe sieht – durch einen Aufklä­
rungsschritt erzwun­gen wurde. Skepsis zeigt den Verlust von naivem Vertrauen an; sie ist das
Resultat von Selbstbesinnung, von erneutem Nachdenken über das, was man bisher für selbst­
verständlich gehalten hatte. Skepsis ist Reflexion, weil sich in ihr das Denken und Erkennen auf
sich und seine Möglichkeiten bezieht, und so ist in der antiken Skepsis und im Cartesianismus
genau das problematisiert worden, von dem man sich im ontologischen Paradigma die Lösung
aller Probleme erhoffte: die Erkenntnis des Seins selbst. Seit Descartes wurde dann der Zweifel
methodisch ‘institutionalisiert’ und galt als der selbstverständliche Anfang eines jeden vernünf­
tigen Philosophierens [...] Wie nachhaltig die Wirkungen der Skepsis als Aufklärungsschritt sind,
kann man daran ermessen, daß bis heute viele Philosophen mit dem Skeptizismus kokettieren,
niemand aber als dogmatisch gelten will.
Mit dem Namen Ludwig Wittgensteins (1889–1951) verbindet sich das dritte hier zu skizzieren­
de Paradigma der Philosophie: das linguistische. Es entsteht dadurch, daß die Aufklärungsdyna­
mik, die im mentalistischen Modell eine neue Konstellation von Wissenschaft und Aufklärung
not­wendig machte, nun auch noch über den Mentalismus hinaustreibt und neue Reflexions­
leistungen vom Philosophieren er­for­dert [...] Bei Kant ist kritische Philosophie Erkenntniskritik
im Medium des Bewußtseins – Vernunft­kritik; bei Wittgenstein hingegen tritt kritisches Philoso­
phieren als Sinnkritik im Medium der Sprache auf: “Alle Philosophie ist Sprachkritik” (Wittgen­
stein, T 4.0031). Kants Ausgangsfrage war: “Was kann ich wissen?”; Wittgenstein hingegen sucht
die Grenze zwischen dem klar Sagbaren und dem Unsinn (vgl. Wittgenstein, T Vorw.), und so
ist sein Problem: “Was kann ich verstehen?”. Beginnt im Mentalismus die Philosophie mit dem
Zweifel, so ist die Ausgangserfahrung des linguistischen Philosophierens der Zusammen­bruch
des Verständnisses, die Konfusion: “Ein philosophisches Problem hat die Form: ‘Ich kenne mich
nicht aus’” (Wittgenstein, PU §123). Der Übersicht kann das folgende Schema dienen:
Paradigma
ontologisch
mentalistisch
linguistisch
Bereich
Sein
Bewußtsein
Sprache
Gegenstand
Seiendes
Vorstellungen
Sätze/Äußerungen
Anfang
Staunen
Zweifel
Konfusion
Anfangsfrage
Was ist?
Was kann ich wissen?
Was kann ich verstehen?
10
Modul Philosophie
Wittgenstein sagt: “Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. – Die Phi­
losophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht wesentlich
aus Erläuterungen. – Das Resultat der Philosophie sind nicht ‘philosophische Sätze’, sondern das
Klarwerden von Sätzen. – Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst, gleichsam, trübe und ver­
schwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen” (T 4.112). Es wird also das carte­sianische
Ideal der Klarheit und Deutlichkeit fest­gehalten; aber bezogen wird es nicht auf Erkenntnisse,
sondern auf Gedanken. Gedanken werden klar und deutlich im Klarwerden von Sätzen, das sei­
nerseits das Resultat der Erläuterungstätigkeit der Philosophie sein soll. An dieser Charakterisie­
rung der Philosophie, die Wittgenstein trotz der großen Unterschiede zwischen dem “Tractatus”
und dem späteren Werk nicht verändert hat, fällt zweierlei auf: daß es keine eigenständigen phi­
losophischen Sätze geben soll und daß die Klärung der Gedanken mit der Klärung von Sätzen
identifiziert wird.
Die Begründung für die erste These steht im “Tractatus” unmittelbar vor dem zitierten Abschnitt:
“Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die gesamte Naturwissenschaft (oder die Gesamtheit der
Naturwissen­schaften). – Die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften. (Das Wort ‘Philoso­
phie’ muß etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den Naturwissenschaften
steht.)” (Wittgenstein, T 4.11 und 4.111). Wittgenstein philosophiert in einer wissenschafts­
geschicht­lichen Situation, in der die alte Einheit von Philosophie und Wissenschaft zerbrochen
ist. Die Welt – “die Welt ist alles, was der Fall ist” (T 1) – ist den Wissenschaften zugefallen, die
sich aus der philosophischen Vormundschaft gelöst haben; dabei ist die Philosophie leer ausge­
gangen, und in der Tat ist das 19. Jahrhundert nach Hegel – philo­sophiegeschichtlich gesehen
– die Periode einer tiefgreifenden Identitätskrise der Philosophie, die bis heute andauert. In wel­
chem Sinne ist Philosophie auch Wissenschaft? Was ist ihr eigener, von den Wissen­schaften nicht
schon okkupierter Gegenstandsbereich? Kann sie vielleicht als Geisteswissenschaft sich neu eta­
blieren und so mindestens Reste ihres alten Renommees retten? [...] Diese Fragen werden von
Wittgenstein radikal beantwortet: Es gibt nicht einmal Geisteswissenschaft, denn alle wahren
Sätze der Wissenschaft sind naturwissenschaftliche Sätze, und da die Philosophie keine der Na­
turwissenschaften ist, kann sie keine wahrheitsfähigen Sätze aufstellen wollen. Als Tätig­keit der
Gedankenklärung hingegen kann sie über oder unter den Naturwissenschaften stehen: als Vorbe­
reitung oder Ergänzung, aber eben nicht in Konkurrenz mit ihnen.
Die Begründung der zweiten These macht den Paradigmenwechsel deutlich, der sich zwischen
Kant und Wittgenstein ereignet. Gedankenklärung im Vorfeld oder im Nachhinein der Wissen­
schaft – so kann man Kants “Kritik der reinen Vernunft” auch verstehen, die ja als Erläuterung
der Bedingungen der Möglich­keit metaphysischer und wissenschaftlicher Urteile nicht in dem­
selben Sinn einen Wahrheits­anspruch erheben konnte wie diese Urteile selbst. Das Neue ist, daß
Wittgenstein in der Gedankenklärung vom Bewußtsein in die Sprache als Erläuterungsmedium
über­wechselt. Über seinen “Tractatus” sagt er: “Man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa
in die Worte fassen: Was sich überhaupt sagen läßt, läßt sich klar sagen, und wovon man nicht
reden kann, darüber muß man schweigen. Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen,
oder vielmehr – nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken: Denn um dem Denken
eine Grenze zu ziehen, müßten wir beide Seiten dieser Grenze denken können (wir müßten also
denken können, was sich nicht denken läßt.) Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen
werden können und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein” (Wittgenstein, T
Vorw.). Kants Grenzziehung zwischen dem, was wir erkennen können, und dem Unerkennbaren
wird hier wiederholt, aber im Felde des Denkbaren und Undenkbaren; und weil wir nicht den­
ken können, was sich nicht denken läßt, müssen wir in das Feld der Sprache als des Ausdrucks
der Gedanken hinübergehen und dort, in der Sprache, die Grenze ziehen zwischen dem sinnvoll
Sagbaren und dem Unsinn. Freilich können auch wir nicht sagen, was sich nicht sagen läßt, denn
“wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen”; aber die Sprache als Ausdruck des
Gedankens bietet doch die Möglichkeit, Unsinn als Unsinn aufzuweisen. “Die richtige Methode
der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich sagen läßt, also Sätze der Natur­
wissenschaft – also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat –, und dann immer, wenn ein an­
derer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzu­weisen, daß er gewissen Zeichen in seinen
Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefrie­digend – er
hätte nicht das Gefühl, daß wir ihn Philosophie lehrten – aber sie wäre die einzig streng richtige”
11
Modul Philosophie
(Wittgenstein, T 6.53). Wenn alles, was sich sagen läßt, Sätze der Naturwissen­schaft sind und die
Philosophie demzufolge keine eigenen sagbaren Sätze besitzt, kann das Phi­lo­sophieren nur noch
in solchen klärenden, erläuternden Zeigehand­lungen bestehen und in nichts anderem.
Damit ist die viel weiter reichende These verbunden, daß alle diejenigen, die “etwas Metaphy­
sisches sagen” wollten, immer in der Situation waren, die der korrekt Philosophierende kritisch
behebt: “Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt – wie ich glaube –, daß die
Fragestellung dieser Probleme auf dem Mißverständnis der Logik unserer Sprache beruhen” (T
Vorw.). “Die meisten Sätze und Fragen, die über philosophische Dinge geschrieben worden sind,
sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beant­
worten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophie
beruhen darauf, daß wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. (Sie sind von der Art der Frage,
ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne.) Und es ist nicht verwunderlich,
daß die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind” (Wittgenstein, T 4.003). Wenn Kant
meta­phy­sische Fragen wie die nach der Existenz Gottes als unentscheidbar und unsere Erkennt­
niskräfte übersteigend erklärte, hatte der damit nicht behauptet, solche Fragen seien unsinnig
und schon deshalb unentscheidbar. Wittgenstein hingegen stellt die Philosophie insgesamt unter
Sinn­losigkeitsverdacht: Wir brauchen uns in der Regel erst gar nicht mit der erkenntnis­kritischen
Frage aufzuhalten; denn wir können schon zuvor die Unsinnigkeit ihrer Fragestellungen und Be­
hauptungen feststellen, und wenn wir die festgestellt haben, dann zeigt sich, daß die “tiefsten
Probleme eigentlich keine Probleme sind”. So schaltet Wittgenstein systematisch der Erkenntnis­
kritik die Sinnkritik vor, und diese wiederum braucht nicht auf die Welt oder die Erkenntnis­
vermögen unseres Bewußtseins einzugehen. Es genügt, die Mißverständnisse der Logik unserer
Sprache aufzuklären, um die meisten unserer philosophischen Probleme – oder was wir dafür
halten – zum Verschwinden zu bringen.
Das Aufzeigen der Grenze zwischen dem sinnvoll Sagbaren und dem Unsinn und die Korrektur
des Verständnisses unserer Sprachlogik sind für Wittgenstein dasselbe. Noch immer aber könnte
das alles mentalistisch verstanden werden: so, als wäre die Sprachkritik nur ein Hilfsmittel der
Gedankenklärung, weil Wittgenstein ja selbst von der Sprache als dem “Ausdruck der Gedan­
ken” spricht. Die vollständige Abkehr von der Bewußtseinsphilosophie vollzieht der Satz 4 des
“Tractatus”: “Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.” Sprache und Bewußtsein stehen also nicht in
einer äußerlichen Ausdrucksbeziehung zuein­ander, sondern Denken ist Sprechen, und was wir
nicht sagen können, können wir auch nicht denken, sondern darüber müssen wir schweigen. Die
sinnkritische Wende der Philosophie ist somit zugleich eine sprachkritische Wendung – der “lin­
guistic turn”.
Die Frage, ob Denken immer und notwendig Sprechen ist, kann hier nicht weiter verfolgt werden
[...]; es ist aber auch nicht notwendig, dies hier zu entscheiden. Wichtig ist nur, daß in dem Augen­
blick, in dem der sprachkritische Sinnlosigkeitsverdacht gegenüber der Philosophie erst einmal in
der Welt ist, wir es mit einer neuen und viel radikaleren als der antiken und neuzeit­lichen Skepsis
zu tun haben und damit mit einer neuen Qualität von Aufklärung. Alle Skeptiker bisher hatten
immerhin noch der Sprache selbst vertraut; kaum jemand von ihnen hatte ernsthaft bezweifelt,
daß wir uns mit unseren Zweifeln verständ­lich machen können, denn der Zweifel selbst bezog
sich ja nur auf die Erkennbarkeit der Gegenstände. Erstreckt er sich aber nicht mehr nur auf die
Wahrheitsfähigkeit, sondern auch noch auf die Verständ­lichkeit unserer philosophi­schen Sätze
selber, muß die Philosophie als ‘Sprachkritik’ beginnen und versuchen, die sinn­kritische Skepsis
dadurch zu entkräften, daß sie die Bedingungen angibt, unter denen Sätze Sinn und Bedeutung
haben können. Erst wenn wir sicher sein können, daß Sätze sinnvoll sind, können wir über ihre
Wahrheit oder Falschheit entscheiden; nach Wittgenstein geschieht dies aber nicht mehr in der
Philosophie, sondern in den Wissenschaften.
Wittgenstein ist der Begründer der modernen Analytischen Philosophie; man sollte, um Mißver­
ständnisse auszuschließen, lieber von sprachanalytischer Philosophie sprechen. Das Wort ‘Ana­
lyse’ hat sich an dieser Stelle eingebürgert, weil Wittgenstein im “Tractatus” die “Erläu­terun­gen”,
aus denen ja ein philo­so­phisches Werk wesentlich bestehen soll, mit den Mitteln der Ana­lyse der
Logik unserer Sprache zu gewinnen hoffte; das methodische Muster hierfür war das große Werk
von Russell und Whitehead “Principia mathematica” (1910–13), das eine logische Begründung
12
Modul Philosophie
der Mathematik und zu diesem Zweck auch eine Neufassung der gesamten formalen Logik ent­
hält. [...]
Man hat die sprachanalytische Philosophie häufig mit dem Argument zu kritisieren versucht,
sie reduziere alle philosophischen Probleme auf Sprachprobleme und mache aus der Philosophie
einen Zweig der Linguistik. [...] Der Vorwurf der Philosophiezerstörung hätte aber mit eben­so­
viel Berech­tigung schon von den Ontologen gegen die Mentalisten erhoben werden können: Sie
reduzierten alle Seinsfragen auf Be­wußt­seinsprobleme, und die Philosophie sei doch nicht bloß
Psychologie. Wie Descartes und Kant in ihrer Wendung zum Bewußtsein niemals das Erkennt­nisund Wahrheits­problem aus den Augen verloren – denn sie wollten es ja gerade dadurch lösen –,
so geht es auch Wittgenstein im “Tractatus” und später um das Erkennen der Welt und letztlich
um die Welt selber. Er sagt sogar von den Sätzen des “Tractatus”: “Meine Sätze erläutern da­
durch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf
ihnen – über sie hinaufgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr
hinaufgestiegen ist.) Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig” (T 6.54). Die
Sprachkritik ist eben nicht Selbstzweck, sondern die notwendige Leiter hinauf zu dem, wo­nach
seit Parmenides alle Philosophie strebte: das richtige Sehen der Welt. Was Wittgenstein er­kannte,
war die Tatsache, daß wir ohne Sprachkritik nicht sicher sein können, die Welt richtig zu sehen,
und daß wir uns deswegen, wenn wir an Philosophie im Ernst interessiert sind, darauf einlassen
müssen.
So ist die sprachanalytische Philosophie keine Position, die man einnehmen könnte oder auch
nicht; wer sie so sieht, sei daran erinnert, daß im linguistischen Paradigma alle klassischen philo­
so­phischen Stand­punkte – Platonismus, Aristotelismus, Skeptizismus, Kritizismus usf. – wider­
auf­getaucht und ver­treten worden sind. Dies gilt auch für die traditionelle Einteilung der Philoso­
phie in Spezialdisziplinen oder Bindestrich-Philosophien, die im 19. Jahrhundert außeror­dentlich
verstärkt und weitergetrieben wurde; sie wird nicht wesentlich verändert, sondern nur trans­
formiert. Was zuvor ‘Erkenntnistheorie’ hieß, tritt nach Wittgenstein auf als “logische Ana­lyse
der Wissenschafts­sprache” (Carnap) [...] Seit G. E. Moore wird es üblich, moralphiloso­phischen
Erörterungen eine Analyse der “Sprache der Ethik” (Hare) vorauszu­schicken, die bald [...] Me­
ta-Ethik genannt wird [...] Die Ästhetik konzentriert sich auf die “Sprachen der Kunst” (Good­
man) und wird zu einer Theorie des ästhetischen Diskurses (Zimmermann) ausgebaut. (Die Reihe
der Beispiele ließe sich lange fortsetzen.) Die sprachanalytische Philosophie will die Seins- und
Erkenntnisfragen nicht einfach zugunsten der Sprachanalyse fallenlassen; sie ist vielmehr ein
methodi­sches Programm, das uns auffordert, alle philosophischen Sachprobleme zu­nächst als
Sprach­probleme zu stellen, damit klar ist, daß es sich dabei nicht nur um durch sprachlogische
Mißverständnisse erzeugte Scheinprobleme handelt. Es geht nach der sinn­kritischen Skepsis
darum, zuerst die elementaren Ver­stehens­bedingungen im philosophischen Diskurs selber zu
sichern, ehe man sich dann Erkenntnis­problemen und den ‘Sachen selbst’ zuwendet. Sprachana­
lytisches Philosophieren allein löst in der Regel noch keine Probleme, gestattet aber, sie genauer
zu stellen.
Aus: Ekkehard Martens / Herbert Schnädelbach (Hg.): Philosophie. Ein Grundkurs. Band 1. Reinbek:
Rowohlt 1991, S. 37–76 (Auszug).
B ibliografie
Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen (Med.) (übers. v. Buchenau). Hamburg 1954.
– Abhandlungen über die Methode (Abh.) (übers. v. Buchenau). Hamburg 1957.
Kant: Kritik der reinen Vernunft (KdrV). Akademie-Ausgabe, Bd. 3.
– Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (MAN). Akademie-Ausgabe, Bd. 4.
Krüger, G. 1962: Die Herkunft des philosophischen Selbstbewußtseins. Darmstadt.
Kuhn, Th. S. 1962/1967: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Chicago/Frankfurt/M.
Platon: Apologie etc. – zitiert nach Platon: Sämtliche Werke (übers. v. Schleiermacher). Reinbek bei
Hamburg 1957 ff.
Wittgenstein 1960–1980: Tractatus logico-philosophicus (T). In: Wittgenstein Schriften. Frankfurt/M.
– Philosophische Untersuchungen (PU). In: s. o.
13
Modul Philosophie
F ragen
1. Was ist das Hauptziel bzw. das zentrale Thema dieses Aufsatzes?
2. Warum wird in dieser Darstellung ein historischer Abriss präsentiert? Welches spezielle Verhältnis hat die Philosophie zu ihrer eigenen Geschichte?
3. Wird mit diesem Beitrag eine ausführliche Darstellung der Philosophiegeschichte ange­strebt?
4. Ist die Geschichte der Philosophie eine Fortschrittsgeschichte?
5. Was ist ein Paradigma? Welche Rolle spielt der Paradigmenbegriff für die Darstellung?
6. Womit befassen sich Metaphysik und Ontologie?
7. Welchen Stellenwert hat laut Schnädelbach das Höhlengleichnis innerhalb von Platons Philosophie?
8. Was ist mit dem ‘Weg nach innen’ in der mentalistischen Philosophie gemeint?
9. Inwiefern wird beim Übergang vom ontologischen zum mentalistischen Paradigma das Verhältnis von Gegenstand und Methode verändert?
10.Welche inhaltlichen ‘Verluste’ sind mit dem Übergang vom ontologischen zum mentalis­ti­
schen Paradigma verbunden?
11.Wie kam es zur Sinnkrise der Philosophie im 19. Jahrhundert?
12.Wie distanziert sich Wittgenstein von der traditionellen (ontologischen, mentalistischen) Phi­
lo­sophie?
13.Wieso nennt man die Philosophie des linguistischen Paradigmas ‘Analytische Philo­sophie’?
14.Wie verhält sich die Analytische Philosophie gegenüber traditionellen philosophischen Teil­
disziplinen (Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik)?
15.Welche Stellung kommt der Sprachphilosophie im Rahmen des linguistischen Para­dig­mas
zu?
16.Inwiefern ist auch der Übergang vom mentalistischen zum linguistischen Paradigma mit
einem Verlust an Themen und Fragemöglichkeiten verbunden?
Z usatzfragen
17.In Schnädelbachs Text heißt es, dass der Satz 4 von Wittgensteins Tractatus “die voll­ständige
Abkehr von der Bewußtseinsphilosophie” vollziehe. An anderer Stelle wird kon­sta­tiert, dass
es auch Wittgenstein “um das Erkennen der Welt und letztlich um die Welt selber” gehe.
Liegt hierin ein Widerspruch?
18.(Im Text wird Wittgenstein als “der Begründer der modernen Analytischen Philosophie”
be­zeichnet. Überprüfen Sie anhand anderer philosophiehistorischer Darstellungen, ob die­se
Einschätzung unkontrovers ist bzw. ob noch weitere ‘Gründerväter’ genannt werden.
19.Laut Schnädelbach “ist die sprachanalytische Philosophie keine Position, die man einneh­men
könnte oder auch nicht”.
• Paraphrasieren Sie diese Aussage.
• Mit welchen Argumenten lässt sich diese These stützen?
Text 4
Ernst Tugendhat / Ursula Wolf: Logik und moderne Sprachphilosophie
Zur Konzeption der Logik
Das Wort [‘Logik’] ist im Verlauf der Geschichte dieser Disziplin in verschiedenen Hinsichten en­
ger und weiter gefaßt worden. Dabei ist es nicht sinnvoll zu fragen, welche Bedeutung die richtige
ist, da es nicht eine wahre Bedeutung eines Wortes gibt. Was man hier vermeiden muß, ist nicht
Falschheit, sondern Unklarheit. Deswegen ist es wichtig, sich darüber Rechenschaft zu geben, in
14
Modul Philosophie
welchen Beziehungen die verschiedenen Bedeutungen, in denen das Wort verwendet worden ist,
zueinander stehen. Bevor wir das unternehmen können, sind einige orientierende Vorbemerkun­
gen erforderlich.
Man kann die Geschichte der Logik grob in drei Perioden einteilen.1 Die erste umfaßt die ältere
Logik, die in etwa von ihrem Begründer Aristoteles bis zum ausgehenden Mittelalter reicht. Die
zweite ist die neuzeitliche Logik, beginnende mit der sogenannten Logik von Port-Royal (1662).2
Diese zweite Periode ist gekennzeichnet durch ein Vorherrschen erkenntnistheoretischer und
psychologischer Fragestellungen, durch die die logische Forschung im engeren Sinn und auch die
Klärung der logischen Grundbegriffe zurückgedrängt wurde. [...] Die dritte Periode ist die der
modernen Logik, die mit Freges Begriffsschrift (1879) beginnt. Diese Logik wird oft als ‘mathe­
matische’ oder auch ‘symbolische’ Logik oder auch als ‘Logistik’ bezeichnet. Diese Bezeichnungen
beziehen sich auf die kalkülmäßige Durchführung der Logik. Wichtiger ist jedoch, daß die Logiker
dieser dritten Periode die spezifisch logischen von psychologischen Fragestellungen wieder scharf
getrennt und die logische Forschung im engeren Sinn erneut aufgenommen und zu ungeahnten
Weiterungen geführt haben [...]
Was ist denn nun aber mit ‘Logik’ überhaupt gemeint? Man kann die verschiedenen Antworten,
die auf diese Frage gegeben worden sind, in ihrem Verhältnis zueinander nicht recht verstehen,
wenn man nicht [...] vor der genaueren Ausgrenzung der Thematik drei verschiedene Auffassungsweisen unterscheidet. Zu diesem Zweck genügt es, zur Thematik vorerst nur so viel zu sagen, daß
die Logik doch wohl bestimmte Regeln oder Gesetze oder Zusammenhänge erforscht, und die
Frage ist nun: Regeln oder Gesetze oder Zusammenhänge wovon? Handelt es sich um Gesetze
des Seins oder der Wirklichkeit (wir wollen das die ontologische Auffassung nennen) oder um
Gesetze des Denkens (die psychologische Auffassung) oder um Gesetze der Sprache (die sprachli­
che Auffassung)? Nehmen wir z. B. den Satz vom Widerspruch. Er besagt ungefähr: Etwas kann
nicht zugleich der Fall sein und nicht der Fall sein. Warum nicht? Die einen sagen, das gründe im
Wesen des Seins; die anderen: im Wesen des Denkens; die Dritten: im Wesen der Sprache. Diese
verschiedenen Auffassungsweisen haben sich auf die Frage, wie man die Thematik der Logik aus­
grenzen soll, ausgewirkt.
Für die zweite der vorhin unterschiedenen Perioden der Geschichte der Logik ist die psychologi­
sche Auf­f assung charakteristisch. Die Logik von Port-Royal definiert die Logik als “die Kunst, seine
Vernunft {raison} gut zu leiten”. [...] Demgegenüber war die ältere Tradition und auch wieder die
moderne Auf­fassung eher an der Sprache bzw. am Sein orientiert, die moderne primär an der
Sprache. [...]
Aus: Ernst Tugendhat / Ursula Wolf: Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart: Reclam 1983, Kap. 1:
“Was heißt ‘Logik’ ”, S. 7–16 (Auszug).
Der Satz vom Widerspruch
Was man den ‘Satz vom Widerspruch’ nennt, ist der Satz, daß es unmöglich ist, daß eine Aussage,
die sich widerspricht, wahr ist. Genaugenommen müßte man also vom Satz vom ausgeschlosse­
nen Wider­spruch reden. [... Es stellt] sich die Frage, was der Satz vom Widerspruch [...] genau
besagt und worin die Notwendigkeit dieses Satzes ihrerseits gründet.
Oder ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, nach dem Grund eines solchen irgendwie letzten Satzes
zu fragen? Muß der Rückgang im Begründen nicht irgendwo ein Ende finden? Nun wäre es ge­
wiß unsinnig, die notwendige Wahrheit dieses Satzes durch irgendeinen anderen Satz begründen
zu wollen; es wäre schon deswegen unsinnig, weil sich dann bei diesem Satz die Frage nach der
Begründung von neuem stellen würde. Das zeigt aber nur, daß wir die Antwort auf unsere Frage
jedenfalls nicht in dieser Rich­tung suchen dürfen; hingegen zeigt es nicht, daß die Frage als solche
nicht sinnvoll ist. Die Frage kann nicht sein, worauf (auf welchen anderen Satz) die Notwendig­
keit des Satzes vom Widerspruch gründet, sondern wir können nur fragen, worin die Notwendig­
keit gründet, worin sie besteht.
1
2
Zur Geschichte der Logik vgl. Kneale, The Development of Logic.
Arnauld/Nicole, La logique ou l’art de penser, dt.: Arnauld, Die Logik oder die Kunst des Denkens.
15
Modul Philosophie
Wollte man statt dessen diese Frage überhaupt abweisen, so hieße das, daß man den Satz vom
Wider­spruch auf den Status einer bloßen Voraussetzung, einer blinden Annahme reduziert. Diese
Auffassung, wonach das Anerkennen des Satzes vom Widerspruch einfach ein dezisionistischer
Akt, eine rationalistische Vorentscheidung darstellt, wird häufig vertreten. Es wäre dann eben­
sogut möglich, sich gegen diesen Satz zu ‘entscheiden’, sei es, daß man einen ‘Irrationalismus’
vertritt, sei es, daß man einen angeblich höheren ‘dialektischen’ Rationalismus vertritt, der die
Bejahung der Möglichkeit und Wirk­lich­keit des Widerspruchs einschließen soll. Hier soll nicht
bestritten werden, daß es vielleicht möglich ist, sich gegen den Satz vom Widerspruch zu ‘ent­
scheiden’. Wichtig ist nur, daß man sich darüber Rechen­schaft gibt, was eine solche Entscheidung
impliziert, und das tut man eben dadurch, daß man klärt, was mit diesem Satz gemeint ist und
worin seine Notwendigkeit besteht.
Dies ist selten geschehen. Bei Logikern wird der Satz meist einfach vorausgesetzt, und auch unter
Philo­so­phen haben sich nur wenige mit dieser Frage beschäftigt. Die wichtigste und in ihrem
Grundgedanken bis heute nicht überholte Erörterung des Satzes vom Widerspruch findet sich
in der Metaphysik des Aristoteles. Die wohl aufschlußreichste zeitgenössische Erörterung ist in
Strawsons Introduction to Logical Theory enthalten.
Was ist mit ‘Widerspruch’ gemeint? Jemand widerspricht sich, wenn er sagt, daß etwas der Fall
ist, und gleichzeitig behauptet, daß es nicht der Fall ist. Verstehen wir ‘p’ als eine Variable für
einen beliebigen Aussagesatz, so hat also jeder Widerspruch die Form folgender zusammenge­
setzter Aussage: ‘p und nicht-p’. Es mag nicht immer klar sein, ob ein bestimmter Satz, in dem ein
Negationszeichen vorkommt, die Negation von ‘p’ ist. [...] Wir brauchen also ein klares Kriterium,
durch das wir einen vorgegebenen Satz als die Negation eines anderen Satzes erkennen können.
Hier hilft der Zusammenhang zwischen Negation und Falschheit weiter. Wenn wir einen Satz
(bzw. die mit ihm gemachte Aussage) negieren, behaupten wir, daß er (bzw. die mit ihm gemachte
Aussage) falsch ist. Ein Satz ‘q’ ist also die Negation eines Satzes ‘p’ (und steht somit für ‘nichtp’), wenn er genau dann wahr ist, wenn ‘p’ falsch ist. Man nennt denjenigen Satz, der genau dann
wahr ist, wenn ‘p’ falsch ist, auch das kontradiktorische Gegenteil zu ‘p’. Das erlaubt uns zugleich
eine andere Formulierung des Satzes vom Widerspruch, die mit der vorigen äquivalent ist: Zwei
einander kontradiktorisch entgegengesetzte Aussagen können nicht zugleich wahr sein. [...]
Wenden wir die allgemeine Formulierung auf den speziellen Fall der prädikativen Sätze an, so
ergibt sich: ‘Es ist notwendig falsch, daß a F ist und a nicht F ist’. [...] Die klassische Formulierung,
die Aristoteles dem Satz vom Widerspruch gibt, lautet: “Daß ein und dasselbe {Prädikat} ein und
demselben {Subjekt} nach derselben Hinsicht gleichzeitig zukommt und nicht zukommt, ist un­
möglich” (1005b 19f.). Diese Formulierung unterscheidet sich von der eben gegebenen formalen
durch die Hinzufügungen “nach derselben Hinsicht” und “gleichzeitig”; ja Aristoteles ergänzt die
eben zitierte Formulierung noch durch die Bemerkung: “und dazu mögen noch die anderen nähe­
ren Bestimmungen hinzugefügt sein gegenüber den logischen Einwürfen”.
Weshalb sind diese Zusätze erforderlich? Es ist einer der naheliegendsten Einwände gegen den
Satz vom Widerspruch, daß man sagt: es ist durchaus möglich, daß ein und dasselbe Prädikat
einer Sache zukommt und nicht zukommt; zweifellos kann es der Sache zu einem Zeitpunkt zu­
kommen und zu einem anderen Zeitpunkt nicht zukommen. [...] Deswegen fügt Aristoteles also
eigens das Wort “gleichzeitig” hinzu. Aber die Zeit ist in Wirklichkeit nur eine Hinsicht unter
vielen anderen, nach der ein Prädikat einem Gegenstand sowohl zukommen wie nicht zukommen
kann. Genauso, wie es sich nicht widerspricht, wenn ein Prädikat einem Gegenstand zu verschie­
denen Zeiten zukommt und nicht zukommt, widerspricht es sich nicht, wenn ein Prädikat einem
Gegenstand an verschiedenen Stellen zukommt und nicht zukommt. Auf die Frage ‘Ist diese Tul­
pe rot?’ kann man gegebenenfalls wahrheitsgemäß nur mit ‘Ja und nein’ antworten, wenn sie
zwar rot ist, aber einen weißen Fleck hat. Diese Notwendigkeit der Präzisierung einer prädikati­
ven Aussage kann sich aber auch nach anderen Hinsichten ergeben. Auch wenn die Tulpe überall
dieselbe Farbe hat, kann man unter Umständen auf die Frage, ob sie rot ist, wahrheitsgemäß
nur mit ‘Ja und nein” (‘sie ist rot, und doch auch nicht rot’) antworten, wenn nämlich z. B. das
Prädikat ‘rot’ zu grob ist, um die bestimmte Farbnuance zwischen Rot und violett zu treffen, die
diese Tulpe hat. Aristoteles hätte also auf den Zusatz “gleichzeitig” verzichten können, weil er in
dem zweiten Zusatz “nach derselben Hinsicht” mit enthalten ist. Dieser zweite Zusatz ist jedoch
unentbehrlich, weil wir nicht vorweg wissen können, wie viele verschiedene Hinsichten herausge­
16
Modul Philosophie
stellt werden können, die immer wieder ein ‘Ja und nein’ erforderlich machen.3 Dieser Zusatz ent­
hält also eine offene Anweisung auf gegebenenfalls notwen­dige Präzisierungen. Angesichts dieser
Sachlage kann man freilich den Eindruck gewinnen, daß der­jenige, der den Satz vom Widerspruch
aufrechterhalten will, demjenigen, dem es gelingt, immer von neuem scheinbare Widersprüche
aufzuzeigen, gewissermaßen hinterherläuft. So könnte es fast willkürlich erscheinen, ob man den
Satz vom Widerspruch überhaupt aufrechterhalten will. Um so dringlicher wird die Frage nach
seiner Begründung.
Diese Frage behandelt Aristoteles in Metaphysik IV,4. Er weist zunächst darauf hin, daß es unmög­
lich ist, den Satz vom Widerspruch direkt zu beweisen (1006a 5ff.). Das einzige, was man tun
könne, sei, den­jenigen zu widerlegen, der den Satz leugnet. Nun ist aber auch ein normaler indi­
rekter Beweis durch Widerlegung des Gegenteils nicht möglich, denn ein solcher Beweis würde
voraussetzen, daß man in der Annahme des Gegners einen Widerspruch nachweisen könnte. Das
könnte ihn aber in diesem Fall, in dem seine Annahme gerade in der Negation des Satzes vom Wi­
derspruch besteht, nicht treffen. Die Wider­legung muß also einen besonderen Charakter haben.
Das einzige, was der Gegner zugeben soll, ist, daß er spricht, daß er etwas sagt. Und das tue er
doch, wenn er den Satz vom Widerspruch leugne. Sage er hingegen nichts, so sei es lächerlich,
mit jemandem argumentieren zu sollen, der seinerseits nichts sagt, “denn ein solcher ist insofern
nur noch wie eine Pflan­ze”. Was ist nun darin impliziert, wenn jemand zugibt, daß er etwas sagt?
Etwas zu sagen bedeutet: “etwas zu verstehen geben {semainein}, sowohl sich selbst wie einem
anderen” (1006a 21). Etwas zu verstehen zu geben heiße aber, etwas Bestimmtes (horismenon)
zu verstehen zu geben (1006a 24). Wer nicht eines (etwas Bestimmtes) zu verstehen gebe, gebe
nichts zu verstehen (1006b 7).
Wir haben schon in Kap. 1 die Frage aufgeworfen, ob die Notwendigkeit des Satzes vom Wider­
spruch [...] im Wesen des Seins (der Wirklichkeit), des Denkens oder des Sprechens gründe. Auf
diese Frage gibt Aristoteles eine eindeutige Antwort: Die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß
man spricht – und das heißt, daß man etwas zu verstehen gibt – ist, daß man etwas Bestimmtes
sagt.
Noch ist nicht ganz ersichtlich, wie daraus der Satz vom Widerspruch folgen soll. Das versucht
Aristo­teles im sich anschließenden Text zu zeigen (1006a 31 ff.): Wir können in einem prädikati­
ven Satz nur etwas Bestimmtes sagen, wenn das Prädikat etwas Bestimmtes bedeutet. Dagegen
erheben sich zwei Einwände. Der erste ist, daß Prädikate oft mehrdeutig sind. Dieser Einwand ist,
so antwortet Aristoteles, unerheblich, wenn nur die Vielzahl der Bedeutungen eines Wortes ih­
rerseits eine bestimmte ist (1006a 34-b2). Der zweite Einwand lautet, daß doch die Gegenstände,
auf die wir Prädikate anwenden, immer eine Vielzahl (und vielleicht eine unbestimmte Vielzahl)
von Bestimmungen haben. Hierauf antwortet Aristoteles: “Das [Prädikat] ‘Mensch’ wird nicht
nur auf eines angewendet, sondern bezeichnet eines” (1006b 14). Es muß also, modern gespro­
chen, unter­schie­den werden zwischen der Bedeutung des Prädikats und dem Gegenstand, auf
den es angewendet wird. Während der Gegenstand allerdings in einer unbestimmten Mannigfal­
tigkeit von Aspekten vorgegeben ist, muß die Bedeutung des Prädikats eine ein­deutig bestimm­
te sein. Aristote­les bringt nun den Gedankengang so zum Abschluß (1006a 28–34): Wenn ein
Prädikat (z.B. ‘Mensch’) etwas Bestimmtes bedeutet, dann kann es nicht zugleich sein Gegenteil
be­deuten (z.B. ‘nicht-Mensch’); also ist es unmöglich, daß man, wenn man wahrheitsgemäß von
etwas sagen kann, es sei ein Mensch, zugleich auch wahrheitsgemäß von ihm sagen kann, es sei
nicht ein Mensch.
So überzeugend der Ansatz der aristotelischen Argumentation ist, so können doch die letzten
Schritte nicht befriedigen. Der Stellenwert, den das Wort ‘nicht’ im Zusammenhang mit der Be­
stimmtheit des Prädikats hat, kommt nicht zu wirklicher Klarheit. Auch bleibt hinsichtlich der
Bestimmtheit des Prä­dikats der weitere Einwand unberücksichtigt, daß viele (oder vielleicht alle)
Prädikate vage sind.
Hier können die Überlegungen weiterhelfen, die Strawson zur Erläuterung des Satzes vom Wider­
spruch anstellt.4 Während es bei Aristoteles so aussieht, als repräsentiere das Prädikat etwas in
sich Geschlos­senes, das mit dem Gegenstand irgendwie verbunden wird, versteht Strawson das
3
4
Vgl. die Erörterung des Satzes vom Widerspruch von Nagel in seinem Aufsatz “Logic Without Ontology”.
Vgl. Strawson, Introduction to Logical Theory, Kap. 1.
17
Modul Philosophie
Prädikat von vornherein in der Funktion, die es mit Bezug auf den Gegenstand in der Rede (in
einem Akt der Prädikation) erfüllt:
“Einer der Hauptzwecke, für den wir Sprache verwenden, ist es, Ereignisse zu berichten und
Dinge und Personen zu beschreiben. Solche Berichte und Beschreibungen sind wie Antworten
auf Fragen der Form ‘Wie war es?’, ‘Wie ist es (er, sie)?’. Wir beschreiben etwas, wir sagen, wie
es beschaffen ist, indem wir Wörter darauf anwenden, die wir auch auf andere Dinge anzu­
wenden bereit sind. Jedoch nicht auf alle anderen Dinge. Ein Wort, das wir ausnahmslos auf
alles anzuwenden bereit sind [...], wäre für die Zwecke der Beschreibung nutzlos. Denn wenn
wir sagen, wie ein Ding beschaffen ist, dann vergleichen wir es nicht nur mit anderen Dingen,
sondern wir unterscheiden es auch von anderen Dingen. (Das sind nicht zwei Tätigkeiten,
sondern zwei Aspekte ein und derselben Tätigkeit.)”5
Die Wörter, von denen Strawson hier spricht, sind natürlich diejenigen, die auch von ihm selbst
im wei­teren Text als Prädikate bezeichnet werden. Der Sinn der Verwendung eines Prädikats
– seine Funktion – ist nach Strawson, daß wir damit einen Gegenstand klassifizieren (verglei­
chen-und-unterscheiden). Die Kontrastierung des ‘es ist so’ gegen das ‘es ist nicht so’ gehört also
von vornherein zum Sinn des Prädikats, das wir gar nicht unabhängig von dem Akt der Prädikati­
on verstehen können, der in der ganzen prädikativen Aussage zum Ausdruck kommt.
Die Verwendung eines Prädikats setzt, so erläutert Strawson im sich anschließenden Text, so et­
was wie das Ziehen einer Grenze voraus: indem wir das Prädikat auf einen Gegenstand anwenden,
geben wir zu verstehen, daß der Gegenstand sich auf der einen Seite dieser Grenzlinie befindet
und nicht auf der anderen. Diese Beschreibung läßt den von Aristoteles hervorgehobenen Zusam­
menhang zwischen dem Sinn des Redens als Zuverstehengeben und der Bestimmtheit deutlicher
erkennen als Aristoteles’ eigene Ausführungen: der Grund, warum wir, wenn wir etwas sagen,
etwas Bestimmtes sagen, liegt darin, daß eine Prädikation nur dann informativ sein kann (und
das heißt eben: etwas zu verstehen geben kann), wenn mit ihr behauptet wird, daß der Gegen­
stand auf der einen und nicht auf der anderen Seite der durch das Prädikat bezeichneten Grenzli­
nie liegt. Jetzt läßt sich auch das Ergebnis für den Satz vom Widerspruch schlüssig formulieren:
Wenn der Informationswert einer Prädikation darin besteht, daß durch sie ein Gegenstand auf
die eine statt auf die andere Seite einer Linie gesetzt wird, folgt unmittelbar, daß, wenn wir den
Gegenstand sowohl auf die eine als auch auf die andere Seite der Linie setzen, der Informations­
wert der Aussage gleich Null ist. Hier läßt sich Aristoteles’ Formulierung genau aufnehmen: Wir
haben dann strenggenommen nichts zu verstehen gegeben. Wir würden uns so verhalten, wie
wenn wir beim Schachspielen einen Zug machen und ihn sofort wieder zurückziehen würden.
Jetzt läßt sich auch ein Mißverständnis beseitigen, das Philosophen, die sich die genaue Struk­
tur der Prädikation nicht klargemacht haben, immer wieder unterlaufen ist. Nach Aristoteles’
Darstellung der Sache könnte es nämlich naheliegen zu sagen: “Jedes Prädikat ist also etwas Be­
stimmtes und als solches von allen anderen Prädikaten Unterschiedenes. Daraus müßte doch aber
folgen, daß sich ein Widerspruch bereits ergibt, wenn einem Gegenstand zwei verschiedene Prä­
dikate zukommen, z. B. daß er rot und daß er kantig ist. Denn Kantigsein ist nicht identisch mit
Rotsein. Wenn man also von einem Ding sagt, es sei rot und kantig, scheint das darauf hinaus­
zulaufen, daß man sagt, es sei rot und nicht rot.” Und wer eine Neigung zur ‘Dialektik’ hat, wird
hinzufügen: “Das zeigt, daß die Wirklichkeit sowie unsere Sprache in sich widersprüchlich sind;
der formale Logiker entzieht sich dieser Einsicht nur durch Ad-hoc-Unterscheidungen.”
Strawsons Darstellung zeigt, wo hier der Fehler liegt. Die Bestimmtheit einer Prädikation liegt
nicht darin, daß das Prädikat von allen anderen Prädikaten unterschieden ist, sondern darin, daß
durch das Prädikat der Gegenstand von anderen unterschieden wird. Wenn jemand sagt “Dies ist
nicht rot”, be­hauptet er nur, daß der Gegenstand auf der anderen Seite der durch das Prädikat
gezogenen Linie liegt. Das schließt freilich bestimmte mögliche positive Aussagen nicht aus. Wir
können nämlich für die andere Seite der durch ein Prädikat gezogenen Grenze auch ein positives
Prädikat verwenden. Statt zu sagen “Es ist nicht krumm”, könne wir sagen “Es ist gerade”. Wir
können aber auch – und das ist in der Sprache der häufigere Fall – das jenseits der Grenze offenge­
lassene Feld seinerseits durch weitere Grenzziehungen unter­teilen, wie wir es z. B. tun, wenn wir
den Bereich jenseits der durch ‘rot’ gezogenen Grenze einteilen in Blau, Gelb usw. Die Prädikate
‘rot’, ‘blau’, ‘gelb’ usw. liegen auf einer Ebene und schließen sich daher gegenseitig ebenso aus wie
5
Strawson, Introduction to Logical Theory, S. 5.
18
Modul Philosophie
‘rot’ und ‘nicht rot’. Strawson verwendet in diesem Zusammenhang den Terminus “Inkompati­
bilitätsbereich” (S. 6). Die Prädikate ‘rot’, ‘blau’, ‘gelb’ usw. gehören in ein und den­selben Inkom­
patibilitätsbereich. Ein Inkompatibilitätsbereich ist so definiert: zwei Prädikate ‘F’ und ‘G’ sind
miteinander inkompatibel, d. h. gehören zu einem Inkompatibilitätsbereich, wenn die Aussage ‘a
ist G’ die Aussage ‘a ist nicht F’ impliziert und die Aussage ‘a ist F’ die Aussage ‘a ist nicht G’. Da
‘a ist G’ nur ein Fall von ‘a ist nicht F’ ist (wenn ‘F’ und ‘G’ in denselben Inkompatibilitätsbereich
gehören), steht ‘a ist G’ ebenso im Widerspruch zu ‘a ist F’ wie zu ‘a ist nicht G’. Da ein Prädikat wie
z. B. ‘kantig’ nicht in einem Inkompatibilitätsbereich mit ‘rot’ liegt (d.h. nicht in ein und demsel­
ben Feld von prädikativen Grenzziehungen), kann es natürlich, obwohl es mit ‘rot’ nicht identisch
ist, ein und demselben Gegenstand zukommen. [...]
Mit Hilfe der Erläuterungen Strawsons können wir jetzt auch genauer erklären, in welchem Sinn
der Satz vom Widerspruch auch dann gilt, wenn das verwendete Prädikat nicht vollkommen be­
stimmt ist. Es hat sich gezeigt, daß eine Prädikation wesentlich darin besteht, daß ein Gegen­
stand auf die eine statt auf die andere Seite einer klassifikatorischen Grenzlinie gesetzt wird. Ein
Widerspruch ergibt sich, wenn man den Gegenstand auf die eine und auch auf die andere Seite
dieser Grenze setzt. Die Grenze ist aber immer mehr oder weniger unscharf. Es ist dieser Um­
stand, der in denjenigen Fällen in Schwierigkeiten führt, in denen sich zeigt, daß der Gegenstand
sich gerade auf dem unscharfen Streifen zwischen den beiden Feldern befindet. Man kann dann,
wie wir schon vorhin gesehen haben, auf die Frage, ob der Gegenstand z. B. rot ist, nur mit ‘Ja und
nein’ antworten, und es ist in solchen Situationen legitim, so zu antworten. Es ist legitim unter
der Voraussetzung, daß man bereit ist zu präzisieren, inwiefern ‘ja’ und inwiefern ‘nein’, z. B. weil
der Gegenstand nur teilweise rot ist oder weil er auf der Grenze zwischen Rot und Violett liegt
o. ä. Nur wer zu keiner derartigen Präzisierung bereit ist, wer sagt ‘Ich meine nichts dergleichen,
sondern ich meine genau das, was ich sage, nämlich daß er rot und nicht rot ist’, widerspricht sich,
und d. h., wie wir inzwischen gesehen haben, er sagt nichts, indem er etwas sagt und es sofort
wieder zurücknimmt.
Der Satz vom Widerspruch setzt also keineswegs voraus, daß wir vollkommen bestimmte Prä­
dikate haben; er (oder besser gesagt, der Sinn der Prädikation) impliziert jedoch, daß wir in be­
stimmten Situa­tionen genötigt werden, unsere Prädikate genauer zu bestimmen. Das genauere
Bestimmtsein ist also etwas, was nicht von vornherein vorliegt, sondern sich gerade durch den
Satz vom Widerspruch pro­gressiv ergibt. Dies ist auch der Grund, weshalb man nicht im voraus
alle einschränkenden Hinsichten aufzählen kann, die, wie wir gesehen haben, bei einer formelhaf­
ten Formulierung des Satzes vom Wider­spruch erforderlich wären. Jetzt wird auch verständlich,
warum derjenige, der am Satz vom Widerspruch festhält, in gewisser Weise demjenigen, dem es
gelingt, ständig neue scheinbare Widersprüche aufzu­weisen, immer hinterherlaufen muß. Die
Spannung, die hier besteht, ist eine Spannung zwischen dem Sinn der Prädikation, der eine Be­
stimmtheit im Sinne eines ‘Ja oder nein’ erfordert, und den tatsächlich zur Verfügung stehenden
Prädikaten, die immer nur mehr oder weniger bestimmt sind. [...]
Der Satz vom Widerspruch ist nicht ein Gesetz über die Realität, sondern die Notwendigkeit, die
er zum Ausdruck bringt, gründet in der Bedeutung unserer sprachlichen Ausdrücke [...] und in
der Bedeutung der Form der Prädikation. In dieser Hinsicht ist es mit dem Satz vom Widerspruch
genauso bestellt wie mit jedem analytischen Satz. Daß ein analytischer Satz notwendig wahr ist,
heißt, daß er von der Realität allemal gilt, aber er gilt von ihr einfach deswegen, weil er eine bloße
Folge davon ist, daß bestimmte Wörter in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang stehen.
Der Satz ‘Wenn jemand ein Junggeselle ist, ist er ledig’ ist notwendig wahr, gleichgültig ob es
Junggesellen gibt oder nicht; und der Satz vom Widerspruch ist notwendig wahr, gleichgültig ob
man über etwas Aussagen machen kann oder nicht. Nur: Wenn ein Wesen in der Realität ein Jung­
geselle ist, dann kann es nicht nichtledig sein; und wenn man über etwas eine Aussage machen
kann, dann kann man darüber nicht die entgegengesetzte Aussage machen.
Was heißt aber, so könnte man immer noch fragen, dieses ‘dann kann man nicht’? Was bedeu­
tet diese Unmöglichkeit? Und was bedeutet es, wenn wir sagen, daß der Satz vom Widerspruch
‘gilt’? Diese Aus­drücke haben alle das Irreführende an sich, daß sie den Eindruck erwecken, als
sei in die Realität oder in die Sprache oder in unser Denken irgendein Zwang eingebaut oder als
herrsche da ein Gesetzt über Himmel und Erde, gegen das man sich nicht versündigen darf. Daß
ein analytischer Satz gilt – daß es nicht anders sein kann –, heißt aber lediglich, daß sich sonst
19
Modul Philosophie
ein Widerspruch ergäbe – und weiter nichts. Und daß der Satz vom Widerspruch seinerseits gilt,
heißt lediglich, daß wir sonst nichts sagen würden, daß sich sonst unser Reden selbst aufheben
würde – und weiter gar nichts.
Aus: Ernst Tugendhat / Ursula Wolf: Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart: Reclam 1983, Kap. 1:
“Der Satz vom Widerspruch”, S. 50–65 (Auszug).
B ibliografie
Aristoteles, Metaphysik IV, 3–4 (In: Aristoteles, Opera, hrsg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1ff., Berlin 1831ff.)
Arnauld, A. / Nicole, P., La logique ou l’art de penser (1662), Neurd. Paris 1965; dt. A. A., Die Logik oder
die Kunst des Denkens, Darmstadt 1972.
Kneale, W. und M., The Development of Logic, Oxford 1962.
Nagel, E., “Logic Without Ontology”, in: H. Feigl / W. Sellars (Hrsg.), Readings in Philosophical Analysis,
New York 1949, S. 191–210.
Strawson, P. F., Introduction to Logical Theory, London 1952.
F ragen
1. Wie lässt sich – in sehr allgemeiner Form – der Aufgabenbereich der Logik charakteri­sieren?
2. Welche Phasen der Logikgeschichte lassen sich unterscheiden?
3. In welchem Verhältnis steht der Satz vom Widerspruch zur Logik?
4. Warum ist es sinnvoll oder sogar notwendig, sich um eine Begründung des Satzes vom Widerspruch zu bemühen?
5. Es ist nicht grundsätzlich widersprüchlich, wenn man auf eine Entscheidungsfrage mit ‘Ja
und nein’ antwortet. Erläutern Sie dies.
6. Versucht Aristoteles den Satz vom Widerspruch ontologisch, psychologisch oder sprach­lich
zu begründen?
7. Wie wird Aristoteles’ Argumentationsgang im Text kritisiert?
8. Erläutern Sie an Beispielen, was es bedeutet, dass man mit dem Gebrauch eines Prädikats
(etwa grün, weiblich, Schmetterling...) eine Grenze zieht.
9. “Das genauere Bestimmtsein [der Prädikate] ist also etwas, was nicht von vornherein vorliegt, sondern sich gerade durch den Satz vom Widerspruch progressiv ergibt.” – Erläutern
Sie diese Aussage.
10.In welchem Sinne ‘kann man nicht’ gegen den Satz vom Widerspruch verstoßen?
Z usatzfragen
11.Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen den Ansätzen von Aristo­teles
und Strawson?
12.Wenden Sie das paradigmengeschichtliche Schema von Schnädelbach auf die Dar­stellung
von Tugendhat/Wolf an. Gibt es weitere Parallelen zwischen diesen Texten?
20
Modul Philosophie
2.2Sprachphilosophie in der Antike
Einem viel zitierten Bonmot von Alfred North Whitehead zufolge kann die gesamte europäische Philosophie beschrieben werden als ‘eine Reihe von Fußnoten zu Platon’. Das mag überzogen sein. Dennoch kann nicht bestritten werden, dass Platon (427–347 v. Chr.) in seinen
philosophischen Werken viele Probleme angesprochen hat, denen in der Folgezeit sowohl in der
Philosophie als auch in zahlreichen Einzelwissenschaften intensiver nachge­gangen wurde. Dies
gilt auch für die Sprachphilosophie. Vor allem in seinem Dialog Kratylos behandelt Platon eine
Reihe sprachphilosophischer Grundfragen.
Kratylos wird allgemein als der erste Text bezeichnet, der sich tiefgehend mit der Beziehung
zwischen der Benennung und dem benannten Ding auseinandersetzt, einer Fragestellung, die
man heute in den Untersuchungsbereich der wissenschaftlichen Disziplin Semantik einordnen
würde. Es ist deswegen sicherlich kein Zufall, dass gerade am Ende des 19. Jahrhunderts, als die
Grundlagen dieser Disziplin allmählich festgelegt wurden, eine lebhafte Diskussion um die Interpretation dieses Werkes entflammte. Friedrich Schleiermacher, Friedrich Schäublin, Heymann
Steinthal, Theodor Benfey und weitere Wissenschaftler setzten sich aus sehr unterschiedlichen
Positionen mit diversen Aspekten des Dialogs auseinander, um zu teilweise sehr abweichenden
Schlussfolgerungen zu gelangen. Natürlich war diese Auseinandersetzung nicht vordergründig
linguistisch motiviert, allerdings zeugt das außergewöhnliche Interesse an diesem Dialog im 19.
Jahrhundert davon, dass man das Werk aus neuen Perspektiven zu rezipieren begann.
Erst im Kontext der sich rasch entwickelnden neuen Wissenschaftsdisziplinen erkannte man
die Aktualität zahlreicher Themenbereiche, die bereits in Kratylos angesprochen wurden. Vor
dem Hintergrund der historisch vergleichenden Sprachforschung begann man sich etwa für die
etymologischen Konstrukte zu interessieren, die Platon im zweiten Teil des Dialogs aufstellt. Die
Überlegungen zur „Richtigkeit“ der Benennungen und der Rolle der Übereinkunft im Prozess
der Benennung wurden wiederum interessant im Kontext der Auseinandersetzungen mit der
„Arbitrarität“ des sprachlichen Zeichens. In den Diskussionen um den Ursprung der Sprache
begann man Platons lautsymbolische Erklärung für die Entstehung der „Benennungen“ im neuen Lichte zu interpretieren. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der neuen wissenschaftlichen Positionen stellte sich deutlich heraus, wie modern Platons Dialog war, gemessen an der
Zeit, in der er verfasst wurde.
Natürlich wäre es irreführend, eine direkte Parallele zwischen Platons Konzepten und seinem
Begriffsystem einerseits und den Thesen und Begriffen der modernen Wissenschaften (z. B. Linguistik) andererseits zu ziehen. Daher ist größte Vorsicht geboten, bei der Interpretation von
Kratylos moderne Termini wie etwa „sprachliches Zeichen“, „Motiviertheit“ oder „Arbitrarität“
zu gebrauchen. Es ist durchaus möglich, einen vorsichtigen Vergleich mit modernen linguistischen Ansätzen aufzustellen, allerdings läuft man dabei stets die Gefahr, anachronistisch vorzugehen. (Bei der Beantwortung der Frage 2. wird auf die möglichen falschen Parallelziehungen
aufmerksam gemacht.)
Der Dialog Kratylos wird traditionellerweise in drei thematische Abschnitte geteilt. Zur Analyse
wurde der erste und dritte Teil ausgewählt, in denen allgemeine Überlegungen zur Wechselbeziehung zwischen den „Benennungen“ und den benannten Dingen aufgestellt werden. Der mittlere
Teil, in dem vorwiegend etymologische Ausführungen entfaltet werden, wurde ausgelassen, einzelne Fallbeispiele können jedoch im Falle des Interesses besprochen werden.
Text 5
Platon: Kratylos
Kratylos • Hermogenes • Sokrates
Hermogenes: Sollen wir auch dem Sokrates da die Sache mitteilen;
Kratylos: Wenn dir‘s beliebt.
21
Modul Philosophie
Hermogenes: Dieser Kratylos behauptet, o Sokrates, es gebe von Natur einen richtigen Namen
für jedes Ding, und nicht das sei ein Name, den einige nach Übereinkunft einem Dinge beilegten
– dabei ließen sie nur ein Teilchen von ihrer Stimme über es laut werden –, sondern es gebe eine
Richtigkeit der Namen von Natur, und zwar für Hellenen und Barbaren, für alle ein und dieselbe.
Ich frage ihn nun, ob ihm in Wahrheit der Name Kratylos gebühre oder nicht? – Er bejahte es. –
»Welcher Name aber gebührt dem Sokrates?« sagte ich. – »Sokrates«, sagt er. – »Gehört denn nicht
auch jedem unter allen übrigen Menschen der Name, den wir ihm beilegen?« – Da sagt er: »Dir
gewiß nicht der Name Hermogenes, auch wenn dich alle Menschen so nennen.« Wie ich nun wei­
ter frage und wissen will, was er eigentlich meint, gibt er mir durchaus keine deutliche Antwort,
sondern verstellt sich gegen mich und tut, als überlege er bei sich und wüßte etwas über die Sache,
und wenn er es nur sagen wollte, könnte er auch mich zum Zugeständnis bringen und für seine
eigene Meinung gewinnen. Wenn du nun etwa das Rätsel des Kratylos lösen kannst, so würde ich
es gerne hören; noch lieber aber würde ich deine eigene Meinung über die Richtigkeit der Namen
(Wörter) erfahren, wenn es dir genehm ist, sie mitzuteilen.
Sokrates: O Sohn des Hipponikos, Hermogenes, es gibt ein altes Sprichwort. Schwer ist das Ver­
ständnis des Schönen, und das Verständnis der Namen ist keine geringe Aufgabe. Wenn ich schon
beim Prodikos den Vortrag für fünfzig Drachmen gehört hätte, durch den man, wie jener sagt,
hierüber aufgeklärt wird, so könntest du leicht sofort die Wahrheit über die Richtigkeit der Na­
men erfahren. Nun aber habe ich ihn nicht gehört, sondern nur den Vortrag für eine Drachme:
Daher kenne ich den wahren Sachverhalt in diesen Dingen nicht. Doch bin ich bereit, ihn mit
dir und Kratylos gemeinsam zu untersuchen. Wenn er aber sagt, dir gebühre in Wahrheit nicht
der Name Hermogenes, so spottet er, wie ich vermute. Denn er meint wohl, in all deinem Stre­
ben nach Geldbesitz hättest du doch jedesmal Unglück. Doch, wie gesagt, die Erkenntnis solcher
Dinge ist schwer, aber man muß sie gemeinsam vornehmen und prüfen, ob du recht hast oder
Kratylos.
Hermogenes: Ich habe zwar, o Sokrates, gar oft mit diesem hier und mit vielen anderen gespro­
chen, kann mich aber nicht überzeugen, daß es einen anderen Grund für die Richtigkeit eines
Namens gebe als Verabredung und Übereinkunft. Denn mir scheint jeder Name, den man einem
Dinge beilegt, der rechte zu sein, und wenn man ihn wieder mit einem anderen vertauscht und
jenen nicht mehr gebraucht, so müsse man diesen späteren für nicht minder richtig halten als
den früheren: wie z. B. wenn man den Sklaven andere Namen gibt, so sei der neue nicht minder
richtig als der, den sie ursprünglich führten. Denn nicht von Natur komme jedem Dinge ein Name
zu, nicht einem einzigen, sondern durch Gesetz und Gewohnheit, je nach der wechselnden Wahl
der Benennung. Wenn sich aber die Sache anders verhält, so bin ich gern bereit zu lernen und zu
hören, nicht bloß von Kratylos, sondern auch von jedem anderen sonst.
Sokrates: Vielleicht freilich hast du recht, Hermogenes; doch laß es uns überlegen: Der Name also
gebührt jedem, den man ihm beilegt?
Hermogenes: Das ist meine Ansicht.
Sokrates: Und zwar gleichviel, ob ein Einzelner den Namen gibt oder der Staat;
Hermogenes: So meine ich.
Sokrates: Wie denn? Wenn ich irgend ein Ding benenne, z. B. was wir jetzt ›Mensch‹ nennen,
wenn ich das ›Pferd‹ nennt, und was man jetzt ›Pferd‹ nennt, ›Mensch‹, wird ihm dann von Staats
wegen der Name ›Mensch‹, von meinetwegen der Name ›Pferd‹ gebühren? Und von meinetwegen
wieder der Name ›Mensch‹, von Staats wegen ›Pferd‹? Meinst du es so?
Hermogenes: Das ist meine Ansicht.
Sokrates: Wohlan denn, beantworte mir folgendes: Unterscheidest du ›Wahres reden‹ und ›Fal­
sches reden‹?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Also gibt es doch eine wahre Rede und eine, die falsch ist?
Hermogenes: Freilich.
Sokrates: Nicht wahr, die, welche sagt, wie das Seiende wirklich ist, ist wahr, die aber sagt, wie es
nicht ist, ist falsch?
Hermogenes: Jawohl.
22
Modul Philosophie
Sokrates: Also ist es möglich, in der Rede zu sagen, was ist, und es auch nicht zu sagen?
Hermogenes: Freilich.
Sokrates: Ist aber die wahre Rede ganz wahr, ihre Teile aber nicht wahr?
Hermogenes: Nein, auch die Teile sind wahr.
Sokrates: Sind nun die großen Teile wahr, die kleinen aber nicht, oder sind alle wahr?
Hermogenes: Alle, meine ich.
Sokrates: Gibt es noch einen anderen kleineren Teil der Rede als das Wort?
Hermogenes: Nein, das ist der kleinste Teil.
Sokrates: Das Wort in der wahren Rede wird doch ausgesprochen?
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Dann ist es wahr nach deiner Meinung.
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Das Teilchen der falschen Rede aber ist falsch?
Hermogenes: So meine ich.
Sokrates: Demnach ist es möglich, ein Wort als falsches und wahres auszusprechen, wenn anders
auch eine wahre und falsche Rede möglich ist?
Hermogenes: Warum denn nicht?
Sokrates: Der Name gebührt also jedem Dinge, den jeder ihm beilegt?
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Gebühren jedem Dinge auch so viele Namen, als man ihm gibt, und dann, wenn man
sie ihm gibt?
Hermogenes: Ich wenigstens, o Sokrates, kenne keine andere Richtigkeit eines Namens als diese,
daß ich das Recht habe, jedes Ding mit einem anderen Namen zu benennen, den ich ihm gegeben
habe, und du wieder mit einem anderen, den du ihm geben magst. So sehe ich auch, daß für eben
dieselben Dinge in einzelnen Staaten besondere Namen bestehen, und zwar bei Hellenen im Ge­
gensatz zu anderen Hellenen, und bei Hellenen im Gegensatz zu Barbaren.
Sokrates: Wohlan denn, laß uns zusehen, Hermogenes, ob es dir auch um die Dinge ebenso zu
stehen scheint, daß jedes von ihnen für jeden ein besonderes Wesen habe, wie Protagoras behaup­
tete, wenn er sagt, das Maß aller Dinge sei der Mensch, so daß also die Dinge für mich so sind, wie
sie mir zu sein scheinen, und für dich wieder, wie sie dir erscheinen; oder scheinen sie dir in sich
eine Wesensbestimmtheit zu besitzen?
Hermogenes: Ich war, o Sokrates, darüber schon einmal im Zweifel und fühlte mich zu der Mei­
nung des Protagoras hingezogen. Doch scheint mir die Sache nicht ganz so richtig.
Sokrates: Wie? Warst du so weit schon gekommen, daß du nicht recht glauben konntest, es gebe
einen schlechten Menschen?
Hermogenes: Nein, beim Zeus, sondern gar oft habe ich gerade diese Erfahrung gemacht und
mußte gewisse Leute für ganz schlecht halten, und zwar gar viele.
Sokrates: Wie weiter? Ganz brave Menschen hast du wohl noch nicht kennengelernt?
Hermogenes: Gar wenige.
Sokrates: Doch einige?
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Wie erklärst du das? Etwa so: die ganz braven für ganz vernünftig, die ganz schlechten
aber für ganz unvernünftig?
Hermogenes: So meine ich‘s.
Sokrates: Ist‘s nun möglich, wenn Protagoras recht hätte und das die Summe der »Wahrheit« ist,
daß für jeden alles ist, wie es ihm zu sein scheint, – ist‘s dann möglich, daß die einen von uns
vernünftig sind, die anderen unvernünftig?
Hermogenes: Sicherlich nicht.
23
Modul Philosophie
Sokrates: So viel nimmst du also wenigstens, scheint mir, ganz sicher an: wenn es eine Vernunft
gibt und Unvernunft, so könne Protagoras unmöglich recht haben. Denn es könnte doch wohl in
Wahrheit keiner vernünftiger nein als der andere, wenn anders für jeden wahr sein soll, was ihm
so scheint.
Hermogenes: So ist‘s.
Sokrates: Doch du nimmst gewiß auch nicht mit dem Euthydemos an, daß allen alles auf gleiche
Weise zugleich und immer zukomme. Denn auch nicht einmal so wären die einen brav, andere
schlecht, wenn auf gleiche Weise allen, und zwar immer, Tugend und Schlechtigkeit zukäme.
Hermogenes: Du hast recht.
Sokrates: Wenn daher weder allen alles gleicherweise zugleich und immer zukommt, noch für
jeden jedes Ding verschieden ist, so haben die Dinge offenbar eine eigene, sich gleichbleibende
Wesenheit, richten sich nicht nach uns und werden nicht durch uns bestimmt, als würden sie
durch unsere Einbildung hin und her gezerrt, sondern sind selbständig in sich nach ihrer eigenen
Wesenheit, so wie sie geartet sind.
Hermogenes: So ist‘s, meiner Meinung nach, o Sokrates.
Sokrates: Sind sie nur etwa selbst so beschaffen, ihre Tätigkeiten aber nicht auf dieselbe Weise?
Oder sind sie nicht auch eine Art des Seienden?
Hermogenes: Allerdings.
Sokrates: Also nach ihrer eigenen Natur gehen auch die Tätigkeiten vor sich, nicht nach unserer
Vorstellung; wenn wir z. B. ein Ding schneiden wollen, müssen wir dann jedes Ding schneiden,
wie wir wollen und womit wir wollen, oder werden wir nur dann, wenn wir jedesmal nach der Na­
tur des Schneidens (und Geschnittenwerdens) schneiden wollen und mit dem passenden Werk­
zeuge, in Wahrheit schneiden und Vorteil davon haben, wofern wir es aber wider die Natur tun,
werden wir fehlgehen und nichts ausrichten?
Hermogenes: Das will ich meinen.
Sokrates: Und wenn wir also etwas zu brennen uns vornehmen, so darf man nicht nach jeder
beliebigen Vorstellung brennen, sondern nach der rechten? Das heißt aber, es kommt auf die
Natur der Sache an, die gebrannt werden und brennen soll, und auf die Natur des Mittels, womit
es geschieht?
Hermogenes: So ist es.
Sokrates: Ist‘s nicht auch mit allem anderen ebenso?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Ist nun nicht auch das Reden eine unter den Tätigkeiten?
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Wird man nun so recht reden, wie es einem gerade einfällt, oder wird man nur dann
etwas ausrichten und wahrhaft reden, wenn man so redet und mit dem betreffenden Mittel, wie
die Natur der Dinge im Reden es verlangt, wo aber nicht, fehlgehen und nichts ausrichten?
Hermogenes: So meine ich, wie du sagst.
Sokrates: Ein Teil des Redens ist aber auch das Benennen; denn nur mittels des Benennen; redet
man ja.
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Ist nicht auch das Benennen eine Tätigkeit, wenn anders das Reden eine war, die sich
auf die Dinge bezieht?
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Die Tätigkeiten aber waren nach unserer Ansicht nicht subjektiv, sondern hatten ihre
eigentümliche Natur?
Hermogenes: So ist‘s.
Sokrates: So muß man auch benennen, wie die Natur der Dinge das Benennen fordert, und mit
dem Mittel, das sie verlangt, nicht aber, wie wir wollen mögen, wenn dies ja mit dem Vorher­
24
Modul Philosophie
gehenden übereinstimmen soll; Und nur so würden wir doch etwas ausrichten und benennen,
anders aber nicht?
Hermogenes: Das gestehe ich zu.
Sokrates: Wohlan denn, was man schneiden mußte, mußte man doch, sagen wir, mit etwas
schneiden;
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Und was man weben mußte, mußte man mit etwas weben, und zum Bohren bedurfte
man auch eines Mittels;
Hermogenes: Freilich.
Sokrates: Und was man danach benennen mußte, mußte man auch mit etwas benennen;
Hermogenes: So ist‘s.
Sokrates: Was aber war das, womit man bohren mußte?
Hermogenes: Ein Bohrer.
Sokrates: Womit aber mußte man weben?
Hermogenes: Mit einer Weberlade.
Sokrates: Womit benennen?
Hermogenes: Mit einem Namen (Worte).
Sokrates: Gut. Also ist auch das Wort ein Werkzeug.
Hermogenes: Freilich.
Sokrates: Wenn ich nun fragte, was für ein Werkzeug war die Weberlade? Nicht das, mit dem wir
weben?
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Was tut man aber, wenn man webt? Zerteilt man nicht den Einschlag und die in einan­
der gewirrte Kette?
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Wirst du es nicht auch von dem Bohrer ähnlich angeben können und von den anderen
Werkzeugen?
Hermogenes: O ja.
Sokrates: Kannst du es dann auch von dem Wort? Was machen wir, wenn wir benennen, mit dem
Worte, da es ja auch ein Werkzeug ist?
Hermogenes: Das kann ich nicht angeben.
Sokrates: Teilen wir vielleicht einander etwas mit und zerteilen die Dinge je nach ihrer Art?
Hermogenes: Freilich.
Sokrates: Das Wort ist also ein mitteilendes und das Wesen zerteilendes Werkzeug, wie die We­
berlade für das Gewebe.
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Die Weberlade aber gehört zur Webekunst?
Hermogenes: Wie anders?
Sokrates: Der Weberkünstler also wird die Weberlade recht gebrauchen, recht aber heißt hier:
nach der Webekunst; der Mitteilende aber wird das Wort recht gebrauchen, recht heißt da: nach
der Kunst des Mitteilens.
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Wessen Werk wird nun der Weber recht gebrauchen, wenn er sich der Weberlade be­
dient?
Hermogenes: Das des Drechslers.
Sokrates: Ist jeder ein Drechsler, oder nur der, der die Kunst versteht?
Hermogenes: Nur ein solcher.
25
Modul Philosophie
Sokrates: Wessen Werk wird der Bohrende recht gebrauchen, wenn er den Bohrer gebraucht?
Hermogenes: Das des Schmiedes.
Sokrates: Ist jeder ein Schmied, oder nur der, der die Kunst versteht?
Hermogenes: Nur dieser.
Sokrates: Gut. Wessen Werk aber wird der Mitteilende gebrauchen, wenn er sich des Wortes be­
dient?
Hermogenes: Auch das weiß ich nicht.
Sokrates: Das weißt du auch nicht zu sagen, wer uns die Worte gibt, deren wir uns bedienen?
Hermogenes: Nein.
Sokrates: Scheint es dir nicht das Gesetz (die Sitte) zu sein, das sie uns überliefert?
Hermogenes: Wohl.
Sokrates: Also eines Gesetzgebers Werkes wird der Mitteilende sich bedienen, wenn er ein Wort
braucht?
Hermogenes: Das meine ich.
Sokrates: Hältst du jeden für einen Gesetzgeber, oder nur den, der die Kunst versteht?
Hermogenes: Nur diesen.
Sokrates: Also nicht jedermanns Sache ist es, Hermogenes, ein Wort zu bilden, sondern das ge­
bührt nur einem Wortbildner. Das ist aber, scheint es, der Gesetzgeber, der offenbar unter den
Künstlern am allerseltensten unter den Menschen auftritt.
Hermogenes: So scheint es.
Sokrates: Wohlan denn, überlege: Wonach richtet sich der Gesetzgeber, wenn er die Worte fest­
setzt? Überdenke es aber gemäß dem Vorhergehenden: Wonach richtet sich der Drechsler, wenn
er die Weberlade macht? Nicht etwa nach etwas, dessen Natur das Weben ist?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Wie dann? Wenn ihm bei der Arbeit die Weberlade zerbricht, wird er dann nach der zer­
brochenen sich richten, wenn er wieder eine neue machen will, oder nach jenem Bilde (Begriff),
nach dem er auch die zerbrochene machen wollte?
Hermogenes: Nach ihm, dünkt mir.
Sokrates: Können wir jenes nicht mit vollem Recht die an sich seiende Weberlade (die Idee der
Weberlade) nennen?
Hermogenes: So scheint mir‘s.
Sokrates: Also alle Weberladen, ob er nun eine für dünnes Zeug oder für dickes, für Leinen oder
Wolle oder was sonst machen soll, müssen den Begriff der Weberlade enthalten; die Beschaffen­
heit aber, durch die sie je für den Zweck am besten geeignet wird, muß er jedesmal in dem Werke
wiedergeben?
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Auch mit den anderen Werkzeugen hat es natürlich dieselbe Bewandtnis: Die naturge­
mäße Eigentümlichkeit je nach seinem Zweck muß man ausfindig machen und in jenem Stoffe
wiedergeben, aus dem man das Werk bildet, nicht also eine willkürliche, sondern die natürliche.
Denn man muß verstehen, die je nach dem Zweck naturgemäße Eigentümlichkeit des Bohrers in
das Eisen hineinzulegen.
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Und die naturgemäße Eigentümlichkeit der Weberlade je nach dem Zweck in das Holz.
Hermogenes: So ist‘s.
Sokrates: Denn von Natur gehört offenbar für jede Art von Gewebe eine besondere Weberlade,
und in anderen Dingen ist es ebenso.
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Muß demnach, mein Bester, nicht auch der Gesetzgeber die naturgemäße Eigentüm­
lichkeit des Wortes in die Laute und Silben zu legen verstehen und sich richten nach eben jenem
26
Modul Philosophie
wahrhaft seienden Worte (der Idee des Wortes) und nach diesem alle Worte bilden und festset­
zen, wenn einer ein tüchtiger Bildner von Worten sein will; Wenn aber nicht jeder Gesetzgeber in
dieselben Silben einbildet, so darf uns das nicht befremden: denn auch nicht jeder Schmied bildet
in dasselbe Eisen, obwohl doch jeder zu demselben Zwecke dasselbe Werkzeug fertigt. Vielmehr
hat es gleichwohl seine Richtigkeit mit dem Werkzeug, wenn er nur dieselbe Idee einbildet, wenn
auch in anderes Eisen, mag er hier oder unter den Barbaren es verfertigen. Nicht wahr?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: So wirst du also auch über den hiesigen Gesetzgeber und einen unter den Barbaren ur­
teilen, solange er nur den jedem Dinge zukommenden Begriff des Wortes wiedergibt, in welchen
Silben auch immer, sei der hiesige Gesetzgeber nicht schlechter als einer irgendwo sonst?
Hermogenes: Allerdings.
Sokrates: Wer wird nun erkennen, ob der richtige Begriff der Weberlade in dem Holze liegt, wel­
ches es auch sein mag? Der Drechsler, der sie verfertigte, oder der Weber, der sie gebrauchen soll?
Hermogenes: Wahrscheinlicher, o Sokrates, der, der sie gebrauchen soll.
Sokrates: Wer ist es nun, der das Werk des Lyrabauers gebrauchen soll? Ist es nicht der, der bei
der Verfertigung am besten zu leiten verstände und dann auch zu erkennen, ob das fertige Werk
geraten sei oder nicht?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Wer ist es?
Hermogenes: Der Zitherspieler.
Sokrates: Wer soll aber von der Arbeit des Schiffbauers Gebrauch machen?
Hermogenes: Der Steuermann.
Sokrates: Wer aber würde am besten die Arbeit des Gesetzgebers leiten und nach der Vollendung
beurteilen können, hier und unter den Barbaren? Nicht der, der davon Gebrauch machen soll?
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Ist das nicht der, der zu fragen versteht?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Und zugleich auch zu antworten?
Hermogenes: Jawohl.
Sokrates: Nicht wahr, wer zu fragen und zu antworten versteht, den nennst du einen Dialektiker?
Hermogenes: Gerade so.
Sokrates: Die Aufgabe des Zimmermanns ist es also, ein Steuerruder zu fertigen unter Leitung des
Steuermanns, wenn das Steuerruder tüchtig sein soll.
Hermogenes: Es scheint so.
Sokrates: Die Aufgabe des Gesetzgebers aber, scheint es, das Wort zu fertigen unter der Leitung
des dialektischen Mannes, wenn er Worte richtig festsetzen soll.
Hermogenes: So ist‘s.
Sokrates: Demnach, o Hermogenes, muß doch deiner eigenen Meinung nach die Wortbildung kei­
ne gemeine und nicht gemeiner Leute und des ersten besten Aufgabe sein. Und Kratylos hat recht,
wenn er behauptet, die Namen kämen von Natur den Dingen zu, und nicht jeder sei ein Meister
der Worte, sondern der allein, der sich nach dem Worte richtet, das jedem Dinge von Natur zu­
kommt, und seinen Begriff in die Buchstaben und Silben einzubilden versteht.
[…]
Hermogenes: Recht tapfer hast du, Sokrates, wahrlich diese Worte zergliedert. Wenn nun aber
einer nach der Bedeutung dieser Worte wie ion, Gehen (Bewegung), rheon, Strom, doun, Fessel,
fragte –
Sokrates: Was wir ihm antworten würden, meinst du? Nicht wahr?
27
Modul Philosophie
Hermogenes: Allerdings.
Sokrates: Ein Mittelchen hatten wir eben doch ausfindig gemacht, und unsere Antwort schien
etwas für sich zu haben.
Hermogenes: Welches meinst du?
Sokrates: Daß wir als ein Fremdwort bezeichneten, was wir nicht ergründen können. Vielleicht
könnte auch in Wahrheit von diesen Worten eins der Art sein, vielleicht aber mögen auch die
ersten Worte, die Stammwörter, wegen ihres Alters unerklärbar sein. Denn weil die Worte überall
hin und her gedreht werden, so wäre es gar kein Wunder, wenn die alte Aussprache im Vergleich
mit der jetzigen einer fremden Sprache nichts nachgibt.
Hermogenes: Deine Annahme ist gar nicht aus der Art geschlagen.
Sokrates: Enthält sie doch Wahrscheinlichkeit. Jedoch die Streitfrage läßt, denke ich, keine Aus­
flüchte mehr zu; wir müssen dem Punkt noch genauer auf den Grund zu gehen uns anschicken.
Laß uns aber das beherzigen: wenn man immer nach den Ausdrücken fragt, auf denen das Wort
beruht, und wieder nach jenen, durch die diese Ausdrücke ihre Erklärung erhalten, und das ins
Unendliche, muß dann nicht der Antwortende zuletzt alle weitere Auskunft ablehnen?
Hermogenes: Mir scheint es so.
Sokrates: Wann mag er nun das Recht haben, abzulehnen und aufzuhören? Nicht dann, wenn er
an die Worte gekommen ist, die gleichsam die Elemente der übrigen Sätze und Worte sind? Denn
wenn dem so ist, kann doch bei diesen eine Zusammensetzung aus anderen Worten nicht mehr
hervortreten, wie wir z. B. angaben, agathos, gut, sei aus agastos, bewundernswert, und thoos,
schnell, zusammengesetzt. Vielleicht könnten wir auch von thoos noch behaupten, es sei aus an­
deren Worten, und jene wieder aus anderen, entstanden. Wenn wir aber einmal auf ein nicht
mehr aus anderen Worten zusammengesetztes Wort getroffen sind, so können wir mit Recht
sagen, jetzt seien wir an einem Grundwort, und das dürfe man nicht mehr von anderen Worten
ableiten.
Hermogenes: Deine Meinung scheint mir begründet.
Sokrates: Sind nun die Worte, nach denen du eben fragst, auch Grundworte, und muß man ihre
Bedeutsamkeit schon auf eine andere Weise erforschen?
Hermogenes: Wahrscheinlich.
Sokrates: Freilich wahrscheinlich, mein Hermogenes. Wenigstens scheinen doch alle früheren von
diesen abgeleitet. Ist aber dem so, wie mir scheint, – wohlan, so überlege mit mir, damit ich keine
Albernheiten begehe, wenn ich angeben will, worin die Bedeutsamkeit der Stammwörter besteht!
Hermogenes: Gib es nur an: soviel wenigstens in meinen Kräften steht, will ich‘s ergründen hel­
fen.
Sokrates: Daß es also nur eine Richtigkeit und Bedeutsamkeit jedweden Wortes, sei es ein Stamm­
wort oder ein abgeleitetes, ein erstes oder letztes, gibt, und daß danach in dem Werte des Wortes
kein Unterschied stattfindet, das, denke ich, gibst auch du zu.
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Die Richtigkeit der Wörter, die wir eben durchgenommen haben, sollte doch darin be­
stehen, daß sie das Wesen jedes Dinges kund gebe?
Hermogenes: Wie anders?
Sokrates: Diese Kraft müssen also die Stammwörter nicht minder haben als die abgeleiteten,
wenn sie überhaupt Worte sein sollen.
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Und doch waren die abgeleiteten offenbar nur durch Vermittlung der Stammwörter dies
zu leisten imstande.
Hermogenes: Natürlich.
Sokrates: Genug. Wie werden nun die Stammwörter, denen keine andern mehr zugrunde liegen,
nach Kräften so gut als möglich die Dinge kund machen, wenn sie doch Worte sein sollen? Be­
antworte mir folgendes: Wenn wir keine Stimme und keine Zunge hätten, aber einander über die
28
Modul Philosophie
Dinge Mitteilung machen wollten, – würden wir nicht, wie jetzt die Stummen, versuchen, mit den
Händen, dem Kopfe und dem übrigen Leibe uns Zeichen zu geben?
Hermogenes: Wie anders, Sokrates?
Sokrates: Wenn wir, denke ich, das Oben und das Leichte bezeichnen wollten, würden wir die
Hand zum Himmel erheben und die Natur der Sache nachahmen; wenn das Unten und das Schwe­
re, würden wir sie nach der Erde hinbewegen, und wollten wir ein Pferd oder ein anderes Tier im
Laufe darstellen, weißt du, dann würden wir unseren Leib und unsere Gestalt jenen so viel wie
möglich ähnlich machen.
Hermogenes: Notwendig müßte es wohl so sein, wie du sagst.
Sokrates: So entstände nämlich, denke ich, ein Zeichen für etwas mit dem Leib, indem dieser den
Gegenstand nachahmte, den er bezeichnen sollte.
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Da wir aber mit Stimme, Zunge und Mund bezeichnen wollen, so wird doch dann ein
Zeichen für jedes Ding entstehen, das von diesen Werkzeugen ausgeht, wenn durch sie von irgend
einem beliebigen Dinge eine Nachahmung stattfindet?
Hermogenes: Notwendig so.
Sokrates: Ein Wort ist also offenbar eine Nachahmung mit der Stimme von dem Gegenstand, den
der Nachahmende mit der Stimme nachahmt und benennt, wenn er gerate will.
Hermogenes: Mir scheint es.
Sokrates: Aber, beim Zeus, mir scheint, mein Freund, die Erklärung gar nicht gut.
Hermogenes: Warum denn?
Sokrates: Wenn also Leute die Schafe nachahmen und Hähne und andere Tiere, so würden wir
genötigt sein, zuzugeben, daß sie das, was sie nachahmen, benennten.
Hermogenes: Da hast du recht.
Sokrates: Scheint dir also der Satz gut?
Hermogenes: Nein, wahrhaftig nicht! Doch welche Nachahmung, Sokrates, wäre dann der Name?
Sokrates: Zunächst, wie mich dünkt, nicht, wenn man in derselben Weise die Dinge nachahmt,
wie man es in der Musik tut, obwohl es ja auch da mit der Stimme geschieht, und ferner glaube
ich, wird man nicht benennen, wenn man dasselbe an den Dingen nachahmt wie die Musik. Ich
meine es ungefähr so: Es hat doch jedes Ding eine Stimme (Klang) und Gestalt, viele haben auch
Farbe?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Wenn also einer diese Eigenschaften nachahmte, so wäre das natürlich nicht die Kunst
des Benennens; diese bezieht sich auch nicht auf diese Nachahmungen. Denn das ist die Musik
und die Malerei, nicht wahr?
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Was sagst du zu folgendem? Hat nicht auch jedes Ding ein Wesen, so gut wie eine Farbe
und Eigenschaften, die wir eben angaben? Hat nicht zunächst die Farbe selbst und die Stimme
jede ein Wesen, und so auch alles übrige, das man des Prädikates sein gewürdigt hat?
Hermogenes: Mir scheint es.
Sokrates: Wie nun? Wenn man eben dieses, das Wesen jedes Dinges, nachahmen könnte, und
zwar in Buchstaben und Silben, würde man dann darstellen, was jedes ist, oder nicht?
Hermogenes: Gewiß.
Sokrates: Wie würdest du den nennen, der sich darauf versteht, wie du von den früheren den
einen einen Musiker, den anderen einen Maler nanntest? Wie würdest du diesen nennen?
Hermogenes: Das, denke ich, Sokrates, ist der Mann, dem wir schon so lange nachtrachten, der
Namenkünstler.
Sokrates: Wenn also das wahr ist, so muß man jetzt wohl an jenen Worten, nach denen du frag­
test, bei rhoê, Strom, ienai, Gehen, schesis, Halten, untersuchen, ob sie mit den Buchstaben und
Silben das Seiende erfassen, so daß sie das Wesen nachahmen, oder ob das nicht der Fall ist?
29
Modul Philosophie
Hermogenes: Allerdings.
Sokrates: Wohlan denn, laß uns zusehen, ob diese Worte allein die Stammwärter sind, oder ob
noch andere dazu gehören!
Hermogenes: Ich denke, wohl auch andere.
Sokrates: Wahrscheinlich. Doch worin mag das Maß der Scheidung liegen, wonach der Nachah­
mende nachzuahmen beginnt? Ist es nicht am geratensten, da ja die Nachahmung des Wesens
durch Silben und Buchstaben vor sich geht, zunächst die Laute einzuteilen, wie die, welche in der
Rhythmik sich versuchen wollen und darum zunächst den Wert der Laute bestimmen, dann den
der Silben, und so erst zu der Betrachtung der Rhythmen übergehen, vorher aber nicht?
Hermogenes: Ja.
Sokrates: Also müssen auch wir in derselben Weise zuerst die Vokale abscheiden, dann von den
übrigen Buchstaben nach Klassen die stummen und klanglosen. Denn so drücken sich etwa die
Sachverständigen aus. Und dann wieder solche, die keine Vokale sind, aber auch nicht klanglos;
ferner von den Vokalen alle, die unter einander verschiedene Klassen bilden. Und wenn wir das al­
les gehörig geschieden haben, müssen wir wieder an die Dinge gehen, denen man Namen beilegen
soll, ob es Klassen gibt, auf die sich alle Dinge zurückführen lassen, wie die Laute, aus denen man
sie erkennen kann, und ob es unter ihnen Klassen gibt nach demselben Gesichtspunkt wie bei
den Lauten. Haben wir das alles richtig durchgemustert, so muß man wissen, jeden Laut nach der
Ähnlichkeit anzubringen, mag nun für ein Ding nur ein Laut notwendig sein oder die Mischung
vieler für eines, wie ja die Maler, um Ähnlichkeit zu erzeugen, bald nur Purpur nehmen, bald ir­
gend eine andere Farbe, bald viele miteinander mischen, z. B. wenn sie Fleischfarben oder etwas
der Art darstellen wollen, je nach dem, glaube ich, jedes Bild je seine Farbe zu erfordern scheint.
So wollen denn auch wir die Laute an die Dinge halten, und zwar einen an eines, und je nach Be­
dürfnis auch viele zugleich, und daraus bilden, was man bekanntlich Silben nennt, und die Silben
wieder verbinden, aus denen die Gegenstandswörter und Aussagewörter zusammengesetzt wer­
den. Und aus den Gegenstands- und Aussagewörtern wollen wir ein recht großes schönes Ganze
zusammenfügen, wie dort in der Malerei das Gemälde, so hier den Satz, mittels der Namenkunst
oder der Redekunst, oder welche Kunst es sein mag. Doch vielmehr nicht wir – in der Rede ließ
ich mich hinreißen –, denn so haben es die Alten zusammengefügt, wie es jetzt vor uns liegt.
Wir aber müssen, wollen wir all dies kunstmäßig zu betrachten verstehen, nach dieser Einteilung
zusehen, ob in den Stammwörtern und den abgeleiteten Wörtern ein Prinzip sich ausprägt oder
nicht. Planlos sie aneinander zu reihen, wäre übel und unmethodisch, mein lieber Hermogenes.
Hermogenes: Freilich, beim Zeus, o Sokrates.
Sokrates: Wie; Traust du dir selbst die Fähigkeit zu dieser Einteilung zu? Denn ich tue es nicht.
Hermogenes: Dann bin ich gar weit entfernt davon.
Sokrates: Sollen wir es also lassen, oder sollen wir es nach Kräften versuchen und, wenn wir auch
nur einen geringen Einblick zu tun vermögen, indem wir voraus bemerken, wie vorher zu den
Göttern: wir verständen nichts von der Wahrheit, nur die Vorstellungen der Menschen über sie
suchten wir zu erraten; – wollen wir auch jetzt so vorwärts gehen, zuerst aber zu uns selbst sa­
gen, wenn diese Einteilung in sachgemäßer Weise hätte geschehen sollen, entweder durch einen
andern oder uns, so wäre das freilich wahr, jetzt aber werden wir uns damit beschäftigen müssen,
wie man zu sagen pflegt, so gut wie‘s eben gehen wolle? Gefällt dir das, oder was meinst du?
Hermogenes: Mir scheint das ganz in der Ordnung.
Sokrates: Lächerlich wird es sich freilich ausnehmen, wenn die Nachahmung der Dinge durch
Buchstaben und Silben zur Darstellung kommen soll. Gleichwohl muß es geschehen. Denn wir
haben nichts Besseres, worauf wir die Bedeutung der Stammwörter zurückführen könnten, wir
müßten denn auch gerade wie die Tragödiendichter zu den Maschinen ihre Zuflucht nehmen und
Götter in Bewegung setzen, wenn sie in einer Verlegenheit sind, mit der Erklärung uns losma­
chen, daß die Götter die Stammwörter gegeben hätten, und deshalb seien sie richtig. Ist das auch
für uns die überzeugendste Erklärung? Oder jene, wir hätten sie von gewissen Barbaren über­
kommen, und die Barbaren seien älter als wir? Oder wegen der Altertümlichkeit könne man sie
nicht ergründen, gerade wie die Fremdwörter? Denn alle diese gar fein ausgedachten Ausflüchte
hätte man, wenn man über die Bedeutung der Stammwörter keine Rechenschaft geben wollte.
30
Modul Philosophie
Doch mit welcher Entschuldigung man auch immerhin die Richtigkeit der Stammwörter nicht
kennen mag, so ist doch gewiß jede Einsicht in die abgeleiteten Worte unmöglich, wenn man jene
nicht versteht, aus denen diese erklärt werden müssen. Wer hierin ein Kunstverständiger zu sein
behauptet, der muß offenbar über die Stammwörter am besten und klarsten Auskunft zu geben
wissen, oder er muß die Überzeugung haben, daß er über die abgeleiteten nur albernes Geschwätz
vorbringen könne. Oder meinst du‘s anders?
Hermogenes: Nicht im mindesten, o Sokrates.
Sokrates: Meine Bemerkungen über die Stammwörter kommen mir sehr ungehobelt und lächer­
lich vor. Doch will ich sie dir mitteilen, wenn es dir recht ist. Wenn du aber sonst woher etwas
Besseres herzunehmen weißt, so versuche auch mir es mitzuteilen!
Hermogenes: Ich will‘s tun; doch sprich nur dreist!
Sokrates: Zunächst also kommt mir das r gerade wie ein Werkzeug für alle Bewegung vor, von
der wir auch noch nicht angegeben haben, warum sie den Namen kinêsis hat. Doch offenbar da­
rum, weil sie ein Gehen, iesis, sein will. Denn vor alters brauchten wir kein ê, sondern nur ein e.
Der Anfang kommt von kiein, einem Fremdwort; es heißt so viel als Gehen. Wollte man ihren
alten Namen nach unserer jetzigen Aussprache gestalten, so wäre der rechte Ausdruck iesis; jetzt
aber heißt es infolge des Fremdwortes kiein und der Veränderung des ê und der Einschiebung
des n kinêsis, müßte aber kieinêsis heißen oder eisis. Stasis, Stillstand, soll eine Verneinung des
Gehens, aiesis, sein; aber um des Wohlklangs willen sagt man stasis. Der Laut r also war, wie
gesagt, ein vortreffliches Werkzeug der Bewegung für den Namengeber, um in die Worte das Bild
des Treibens hineinlegen zu können. Dazu bedient er sich häufig dieses Lautes. Zuerst ahmt er
in Strömen, rhein, und Strom, rhoê, selbst mittels dieses Buchstabens die treibende Kraft nach;
ferner in Zittern, tromos, dann in rauh, trachys, dann in Zeitwörtern wie schüttern, reiben, rei­
ßen, brechen, bröckeln, drehen (krouein, thrauein, ereikein, thryptein, kermatizein, rhymbein).
Alles dies trifft er meist mittels des r. Denn er bemerkte wohl, daß die Zunge dabei gar nicht sto­
cke, sondern am meisten erschüttert werde, und darum bediente er sich offenbar dieses Lautes
für diese Begriffe. Das i dagegen braucht er für alles Feine, weil natürlich dies am besten alles
durchdringen kann. Daher bildet er das ienai, dringen, gehen, und iesthai, sich erringen, durch
das i nach, wie er ja durch ph, ps, s und z, weil diese Buchstaben mit starkem Hauch gesprochen
werden, alle entsprechenden Begriffe im Benennen nachgebildet hat, wie das Frostige (psychron),
Zischende zeon, erschüttern (seiesthai) und überhaupt jede Erschütterung (seismos). Wenn der
Namenbildner irgend das Luftartige, physôdes, nachahmt, da bringt er offenbar eben meisten­
teils solche Buchstaben in Anwendung. Dagegen hielt er offenbar die Natur des d und t, wonach
die Zunge zusammengepreßt und angedrückt wird, für brauchbar zur Nachahmung des Bindens
(desmos) und Stillstehens (stasis). Weil er ferner sah, daß bei dem l die Zunge am meisten gleitet,
so gab er nach diesem Bilde dem Glatten, dem Gleiten selbst, dem Öligen, Leimigen und allen
ähnlichen Begriffen die Namen (leia, olisthanein, liparon, kollôdes). Weil aber auf das Gleiten der
Zunge die Natur des g einen gewissen Einfluß übt, so bildete er danach glischron, glibberig, glyky,
süß, glücklich, und gloiôdes, klebrig. Weil er ferner bemerkte, daß das n die innere Äußerung der
Stimme sei, so benannte er danach das Innen und Drinnen, endon und entos, um das Bild der
Sache in den Buchstaben wiederzugeben. Das a gab er dem Großen, Gewaltigen, megalô, – und
der Länge, mêkei, das ê, weil die Buchstaben groß sind und lang. Weil er für das Runde, gongylon,
des Zeichens o bedurfte, so mischte er ihm diesen Laut zumeist in den Namen. Und offenbar ver­
fährt auch bei den übrigen Worten der Gesetzgeber ebenso, bildet entsprechend in Buchstaben
und Silben für jedes Ding ein Zeichen, ein Wort, und setzt dann aus diesen Elementen das übrige
mit denselben Mitteln nachahmend zusammen. Das also soll nach meiner Ansicht die Richtigkeit
der Namen und Worte sein, Hermogenes, es sei denn, daß unser Kratylos eine andere Ansicht
vorbrächte.
Hermogenes: Wahrlich, Sokrates, mir macht ja Kratylos oft und viel dadurch zu schaffen, wie
ich von Anfang sagte, daß er trotz der Behauptung, es gebe eine Richtigkeit der Namen, sich
durchaus nicht deutlich erklärt, worin sie bestehe, so daß ich nicht wissen kann, ob er absichtlich
oder ohne Absicht allemal so undeutlich sich darüber ausdrückt. Daher erkläre dich also jetzt, o
Kratylos, gegenüber dem Sokrates, ob des Sokrates Darstellung über die Worte deinen Beifall hat,
oder ob du noch etwas Besseres vorzubringen weißt? Und wenn das, so bringe es vor, damit du
entweder von Sokrates belehrt werdest oder uns beide belehrest!
31
Modul Philosophie
Kratylos: Wie doch, Hermogenes? Hältst du es denn für leicht, sich so rasch über etwas, was es
auch sei, belehren zu lassen oder zu belehren, geschweige gar über einen so gewichtigen Gegen­
stand, der zu den allerbedeutendsten gehört?
Hermogenes: Wahrhaftig, das sage ich nicht. Nur des Hesiod Ausspruch ist, denke ich, in der
Ordnung: Wenn man zu wenigem auch wenig nur hinzufüge, so sei es doch förderlich. Wenn du
daher auch nur wenig die Untersuchung vorwärts bringen kannst, so laß dich‘s nicht verdrießen,
sondern leiste unserem Sokrates den guten Dienst; und auch mir bist du es schuldig.
Sokrates: Natürlich möchte auch ich, mein Kratylos, keine meiner Bemerkungen für sicher ausge­
ben; nur wie ich mir die Sache vorstellte, habe ich sie mit Hermogenes untersucht. Was also das
anlangt, so bringe nur getrost deine Ansicht vor, wenn du eine bessere hast, und sei überzeugt,
daß ich darauf eingehen werde! Denn du hast gewiß schon selbständig Untersuchungen darüber
angestellt und von anderen dir Mitteilungen machen lassen. Wenn du also eine bessere Ansicht
vorbringst, so darfst du auch mich in die Liste deiner Schüler über die Richtigkeit der Worte ein­
tragen.
Kratylos: Allerdings, Sokrates, habe ich mich, wie du sagst, damit beschäftigt, und vielleicht kann
ich in dir einen Schüler gewinnen. Doch fürchte ich, daß es gerade umgekehrt gehe. Denn es
drängt mich, nun den Ausspruch des Achilleus anzuwenden, den er in den »Bitten« an den Aias
richtet. Dort sagt er:
Aias, göttlicher Sohn des Telamon, Herrscher der Völker,
Alles hast du mir fast aus der Seele selber geredet.
So sind auch, o Sokrates, deine Orakelsprüche ganz nach meinem Sinne ausgefallen, magst du
nun durch Euthyphron begeistert gewesen sein, oder hat vielleicht auch schon lange eine andere
Muse heimlich in dir gesteckt.
Sokrates: Schon lange, mein guter Kratylos, befremdet mich selbst die eigene Weisheit, und ich
traue ihr nicht. Daher muß man wohl nochmals untersuchen, was dran ist. Das allerschlimmste
Begegnis nämlich ist doch die Selbsttäuschung. Denn sollte es nicht übel sein, wenn doch der, der
uns täuschen soll, nicht einen Augenblick sich entfernt, sondern immer bei uns ist? Daher muß
man sich, denke ich, häufig wieder nach früheren Sätzen und Behauptungen zurückwenden und
suchen, wie der Dichter sagt, zu schauen zugleich vorwärts und euch rückwärts. So laß uns denn
auch jetzt unsere Resultate überblicken: Die Richtigkeit des Wortes, behaupten wir, besteht darin,
die Beschaffenheit des Dinges kund zu tun. Soll diese Erklärung genügen?
Kratylos: Ich halte sie für ganz vollkommen genügend, o Sokrates.
Sokrates: Der Zweck der Worte ist also Mitteilung?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Ist das auch eine Kunst, und gibt es Meister in ihr?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Wer sind sie?
Kratylos: Die du anfangs nanntest, die Gesetzgeber.
Sokrates: Wollen wir weiter behaupten, daß auch diese Kunst unter den Menschen in derselben
Weise vorkomme wie die übrigen, oder nicht? Ich meine es so: Unter den Malern gibt es doch
schlechtere und bessere?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Bringen nicht die besseren ihre Werke, die Gemälde, zu größerer Vollkommenheit, die
anderen aber bringen es nur zu schlechteren? Ebenso bauen auch unter den Baumeistern die
einen schönere, die anderen häßlichere Häuser.
Kratylos: Ja.
Sokrates: Stellen auch die Gesetzgeber ihre Werke teils vollkommen, teils mißlungen dar?
Kratylos: Das glaube ich nicht mehr.
Sokrates: Also glaubst du nicht, daß es bessere und schlechtere Gesetze gibt?
Kratylos: Nein.
32
Modul Philosophie
Sokrates: Danach glaubst du wahrscheinlich auch nicht, daß ein Wort schlechter sei, ein anderes
besser?
Kratylos: Nein.
Sokrates: Folglich sind alle Namen und Worte richtig?
Kratylos: Wenigstens alle wahren Namen und Worte.
Sokrates: Wie also? Ein Beispiel, das eben vorkam: Wollen wir behaupten, unser Hermogenes
führe gar nicht diesen Namen, sofern ihm nicht Abstammung von Hermes (Hermou genesis) zu­
kommt, oder er führe ihn zwar, jedoch gewiß nicht mit Recht?
Kratylos: Ich bin der Ansicht, Sokrates, daß er den Namen nicht einmal führe, sondern nur zu
führen scheine, daß aber dieser Name einem anderen gehöre, dessen Wesen mit dem in dem
Namen ausgeprägten eins ist.
Sokrates: Sagt man dann auch nicht etwas Falsches, wenn man ihn für Hermogenes erklärt? Soll­
te nämlich auch die Behauptung nicht möglich sein, er sei Hermogenes, wenn er es nicht ist?
Kratylos: Wie meinst du?
Sokrates: War das der Kern deines Satzes, daß Falsches zu reden durchaus unmöglich sei? Denn
es gibt viele, die das behaupten, lieber Kratylos, heute wie vor Zeiten.
Kratylos: Wie kann man denn, Sokrates, wenn man wirklich das sagt, was man sagt, nicht das
sagen, was ist? Oder besteht nicht das Falschessagen darin, daß man sagt, was nicht ist?
Sokrates: Der Satz ist für meinen Verstand und meine Jahre zu hoch, mein Freund; doch sage mir
so viel: Glaubst du, man könne Falsches zwar nicht behaupten, doch wohl sagen?
Kratylos: Auch nicht einmal sagen, glaube ich.
Sokrates: Auch nicht reden und anreden? Wenn dir z. B. jemand in fremdem Lande begegnete,
dich bei der Hand faßte und sagte: »Sei gegrüßt, athenischer Fremdling, Sohn des Smikrion, Her­
mogenes«, – behauptete, oder sagte, oder sprach, oder redete er damit nicht dich an, sondern
unseren Hermogenes, oder niemanden?
Kratylos: Ich glaube, o Sokrates, er würde das ganz umsonst gesprochen haben.
Sokrates: Ich muß auch damit zufrieden sein. Denn würde er Wahres oder Falsches sprechen?
Oder zum Teil etwas Wahres, zum Teil Falsches? Denn auch das würde genügen.
Kratylos: Ich möchte sagen, er mache nur ein Geräusch und setze seine Zunge wirkungslos in
Bewegung, so gut als wenn er auf einem ehernen Kessel trommelte.
Sokrates: Wohlan denn, ob wir uns vielleicht ausgleichen, o Kratylos: Sollte nicht auch nach dei­
ner Ansicht der Name verschieden sein von dem Gegenstand, dessen Name er ist?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Gestehst du zu, daß auch der Name eine Nachahmung des Gegenstandes sei?
Kratylos: Ganz gewiß.
Sokrates: Sind nicht auch die Gemälde in anderer Weise Nachahmungen von Gegenständen?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Wohlan denn! Vielleicht verstehe ich nur nicht den eigentlichen Inhalt deines Satzes;
du aber kannst ganz recht haben. Kann man diese beiden Arten von Nachbildern, die Gemälde
nämlich und jene Namen, unter die Dinge, deren Nachahmung sie sind, verteilen und mit ihnen
zusammenstellen, oder nicht?
Kratylos: Jawohl.
Sokrates: So überlege denn zunächst folgendes: Könnte man nicht das Bild des Mannes dem Man­
ne zusprechen, das des Weibes dem Weibe, und so fort?
Kratylos: Allerdings.
Sokrates: Nicht auch umgekehrt das des Mannes dem Weibe und des Weibes Bild dem Manne?
Kratylos: Auch das ist möglich.
Sokrates: Sind beide Verteilungen richtig, oder ist es nur die eine?
Kratylos: Nur eine.
33
Modul Philosophie
Sokrates: Die wohl, die jedem Ding das Entsprechende und Ähnliche zuspricht?
Kratylos: Das ist meine Ansicht.
Sokrates: Damit wir also in unserer Untersuchung nicht in Kampf geraten, ich und du, zwei
Freunde, so vernimm meine Ansicht: Ich nenne nämlich, mein Freund, eine derartige Verteilung
bei beiden Arten der Nachahmung, den Gemälden und den Namen, richtig, bei den Namen aber
außer richtig auch wahr; die andere aber, die Zuteilung und Zusammenstellung mit Unähnlichem,
nicht richtig, und wenn sie sich auf Namen bezieht, auch falsch.
Kratylos: Doch daß nur nicht, lieber Sokrates, bei Gemälden eine unrichtige Verteilung wohl mög­
lich ist, bei Namen aber nicht, sondern da immer eine richtige notwendig wäre.
Sokrates: Wie meinst du? Was ist da für ein Unterschied? Ist es nicht möglich, zu einem Manne
hinzutreten und zu ihm zu sagen: »Das ist dein Porträt«, und ihm, wenn sich‘s trifft, wirklich sein
Bild zu zeigen, wo nicht, das eines Weibes? Unter »zeigen« aber verstehe ich, etwas dem Sinne der
Augen wahrnehmbar machen.
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Weiter: Kann man nicht wiederum zu ihm treten und zu ihm sagen: »Das ist dein
Name«? Der Name ist doch auch eine Nachahmung, gerade wie das Gemälde. Folgendes also mei­
ne ich: Sollte man nicht zu ihm sagen können: »Das ist dein Name« und darauf dem Sinn des Ge­
hörs, wenn sich‘s trifft, die wahre Nachahmung von jenem vernehmbar machen, indem man sagt,
er sei ein Mann, oder, wenn sich‘s trifft, die Nachahmung des weiblichen Geschlechtes, indem
man sagt, er sei ein Weib? Scheint dir das nicht möglich zu sein und bisweilen vorzukommen?
Kratylos: Ich will dir das zugeben, Sokrates, es mag so sein.
Sokrates: Da tust du wohl, mein Freund, wenn sich die Sache wirklich so verhält. Denn wir brau­
chen jetzt nicht gerade darüber einen Entscheidungskampf einzugehn. Wenn es also auch hierbei
eine solche Art der Verteilung gibt, so wollen wir die eine wahr reden, die andere falsch reden
nennen. Wenn dem aber so ist, und wenn es möglich ist, jedem Gegenstand die Namen nicht rich­
tig zuzuteilen und die zukommenden zuzusprechen, sondern bisweilen auch die, die ihnen nicht
zukommen, so mag es auch mit den Aussagewörtern ebenso zu machen möglich sein. Wenn man
aber Aussagewörter und Gegenstandswörter so stellen kann, dann notwendigerweise auch Sätze.
Denn Sätze sind doch, glaube ich, die Verbindung dieser beiden. Oder wie meinst du, Kratylos?
Kratylos: Ebenso. Denn du scheinst mir recht zu haben.
Sokrates: Wenn wir nun wieder die Stammwörter mit Zeichnungen vergleichen, kann man es da
ebenso machen, wie man bei Gemälden bald alle ihnen zu kommenden Farben und Züge anbrin­
gen, bald wieder nicht alle, sondern einige weglassen kann, andere auch hinzusetzen, bald mehr,
bald weniger? Oder geht das nicht?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Macht nun nicht der, der alles anbringt, die Zeichnungen und Bilder schön, wer jedoch
zusetzt oder wegläßt, bringt zwar auch Zeichnungen und Bilder zuwege, aber schlechte?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Ferner: Wer mittels Silben und Buchstaben das Wesen der Dinge nachahmt, – wird nicht
auch in demselben Grade sein Bildschön sein, wenn er alle wesentlichen Bestandteile angebracht
hat? Dies Bild aber ist eben das Wort. Wenn er aber manchmal weniges wegläßt oder zusetzt, so
wird auch ein Bild entstehen, aber kein schönes? Also wird ein Teil der Worte schön gebildet sein,
ein anderer schlecht?
Kratylos: Vielleicht.
Sokrates: Vielleicht also wird der eine ein guter Meister im Wortbilden sein, der andere ein
schlechter?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Hatte er nicht den Namen Gesetzgeber?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Vielleicht also, beim Zeus, wird auch, wie in anderen Künsten, ein Gesetzgeber bald gut,
bald schlecht sein, wenn uns jene Voraussetzungen zugestanden werden.
34
Modul Philosophie
Kratylos: Gut. Aber du siehst doch, Sokrates, wenn wir diese Buchstaben, das a und b, und jeden
einzelnen von den Lauten den Regeln der Schreibekunst in den Worten anbringen, und wenn wir
dann einen, weglassen oder zusetzen oder versetzen, so haben wir zwar das Wort geschrieben,
aber nicht richtig, oder vielmehr wir haben es ganz und gar nicht geschrieben, sondern gleich ist
es ein anderes, wenn so etwas eintritt.
Sokrates: Daß wir nicht etwa den unrichtigen Gesichtspunkt haben, wenn wir so schließen, o
Kratylos!
Kratylos: Inwiefern?
Sokrates: Wohl alles, was notwendig aus einer bestimmten Zahl besteht oder sonst gar nicht exis­
tiert, mag dem von dir angeführten Satze unterworfen sein, wie z. B. die Zehnzahl selbst oder
jede beliebige andere Zahl gleich eine andere wird, wenn man etwas wegnimmt oder zufügt. Die
Richtigkeit eines qualitativ Bestimmten aber, und so jeder Abbildung, dürfte nicht darin beste­
hen, sondern im Gegenteil dürfte man nicht einmal durchweg alle Bestandteile anbringen, die
dem Gegenstand der Abbildung gehören, wenn es noch ein Bild sein soll. Bedenke, ob ich recht
habe: Wenn etwa zwei Dinge da wären, z. B. Kratylos und ein Bild des Kratylos, und ein Gott
bildete nicht bloß deine Farbe und Gestalt ab, wie die Maler, sondern machte auch alle inneren
Teile dergestalt, wie sie in dir sind, brächte dieselben Grade von Weichheit und Wärme an und
gäbe dann Bewegung, Seele und Denken, ganz wie bei dir, hinein und, um es mit einem Worte zu
sagen, stellte alles, was du hast, gerade so noch einmal neben dich, – wäre das dann Kratylos und
ein Bild von Kratylos, oder zwei Kratylos?
Kratylos: Ich denke, Sokrates, zwei Kratylos.
Sokrates: Du siehst also, mein Lieber, daß wir die Richtigkeit des Bildes und der eben besproche­
nen Dinge in etwas anderem suchen müssen und nicht darauf bestehen dürfen, es sei kein Bild
mehr, wenn etwas fehle oder zukomme. Oder merkst du nicht, wieviel den Bildern fehlt, bis sie
die Gegenstände erreichen, deren Bilder sie sind?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Wahrlich, Kratylos, in einen lächerlichen Zustand würden die Dinge, auf die sich die
Namen beziehen, durch diese versetzt werden, wenn sie ihnen alle ganz und gar gleich gemacht
würden! Denn alles würde verdoppelt, und man könnte gar nicht sagen, welches von beiden das
Ding ist und welches der Name.
Kratylos: Du hast recht.
Sokrates: Sei also, mein edler Freund, ohne Sorge, und laß auch unter den Worten das eine tref­
fend sein, das andere nicht, und wolle sie nicht zwingen, alle Buchstaben zu haben, damit sie
vollständig dem Gegenstände gleichen, auf den sie sich beziehen, sondern laß auch den nicht
wesentlichen Buchstaben hinzubringen! Und wie einen Buchstaben, so auch ein Wort im Satze,
und wie ein Wort, so laß auch einen Satz in einer Entwicklung vorbringen, der mit den Dingen
nicht stimmt, und gib zu, daß nichtsdestoweniger das Ding genannt und daß gesprochen werde,
solange nur der Charakter des Dinges drin liegt, von dem die Rede ist, wie in den Namen der Lau­
te, wenn du dich dessen erinnerst, was ich vorhin mit Hermogenes besprach!
Kratylos: Ei gewiß.
Sokrates: Gut also. Denn wenn dieser drin liegt, so wird das Ding, auch wenn das Wort nicht alle
zutreffenden Laute enthält, ausgesprochen, und zwar gut, wenn es eben alle, schlecht, wenn es
nur wenige enthält. Daß aber gesprochen werde, laß uns zugeben, damit wir nicht in Strafe verfal­
len, wie die Leute, die in Aigina des Nachts spät auf der Straße umhergehen, und wir in den Augen
der Wahrheit so bei den Dingen später, als wir sollten, angelangt zu sein scheinen! Oder suche die
Richtigkeit des Wortes in etwas anderem und gib nicht zu, es sei ein Zeichen für ein Ding durch
Silben und Buchstaben! Denn wenn du diese beiden Behauptungen aufstellen willst, kannst du
unmöglich mit dir selbst im Einklang bleiben.
Kratylos: Allerdings, denke ich, bemerkst du das treffend, o Sokrates, und ich nehme es an.
Sokrates: Da wir nun hierin übereinstimmen, so laß uns Herauf folgendes erwägen: Soll das Wort,
sagen wir, richtig sein, so muß es die ihm wesentlichen Buchstaben enthalten?
Kratylos: Ja.
35
Modul Philosophie
Sokrates: Wesentlich sind ihm aber die, die den Dingen ähnlich sind?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: So also sind die treffend gebildeten Worte. Ein Wort aber, das nicht gut gebildet ward,
bestände wohl meistens aus ihm wesentlichen und dem Dinge ähnlichen Buchstaben, wenn es
überhaupt noch Bild sein soll; es kann aber auch etwas Unwesentliches enthalten, wodurch das
Wort nicht gut und nicht richtig gearbeitet sein dürfte. Sagen wir so, oder anders?
Kratylos: Ich darf den Kampf nicht fortsetzen, Sokrates, obwohl mir die Annahme nicht gefällt, es
sei zwar ein Wort, jedoch richtig sei es freilich nicht.
Sokrates: Gefällt dir der Satz nicht, das Wort sei ein Zeichen für das Ding?
Kratylos: O ja.
Sokrates: Doch der Satz, die Worte seien teils aus anderen zusammengesetzt, teils Stammwörter,
scheint dir wohl nicht richtig?
Kratylos: Doch.
Sokrates: Wenn nun aber die Stammwörter Zeichen für die Dinge werden sollen, weißt du eine
bessere Art dafür anzugeben, wie sie Zeichen werden sollen, als daß man sie so viel wie möglich
den Gegenständen ähnlich macht, die sie darstellen sollen? Oder gefällt dir die Art besser, die
Hermogenes mit vielen anderen annimmt, die Worte seien Sache der Übereinkunft und bezeich­
neten nur für die, die übereingekommen wären, die Dinge aber im voraus kennten, und das sei
die Richtigkeit eines Wortes, die Übereinkunft; es mache aber gar keinen Unterschied, ob man
übereinkomme, wie jetzt die Worte bestimmt seien, oder auch auf das Gegenteil, und groß nenne,
was man jetzt klein, und klein, was groß heißt? Welche Art gefällt dir besser?
Kratylos: Jedenfalls verdient es durchaus den Vorzug, o Sokrates, mit einer Verähnlichung zu
bezeichnen, was man bezeichnen will, nicht aber mit jedem beliebigen Mittel.
Sokrates: Du hast recht. Wenn also das Wort dem Dinge ähnlich sein soll, müssen doch auch die
Laute den Dingen ähnlich geartet sein, aus denen man die Stammwörter zusammensetzt. Ich
meine es aber so: Würde wohl jemand, wovon wir ja eben sprachen, ein Gemälde zusammen­
stellen können, das einem Dinge gliche, wenn es nicht von Natur Farbstoffe gäbe, aus denen das
künftige Gemälde zusammengefügt wird, die jenen Dingen ähnlich sind, die die Kunst des Malers
nachahmt? Oder wäre das unmöglich?
Kratylos: Unmöglich.
Sokrates: Geradeso würden also auch nie Worte entstehen können, die einem Dinge gleichen,
wenn nicht jene Teile, aus denen die Worte bestehen sollen, zuerst eine gewisse Ähnlichkeit mit
den Gegenständen hätten, deren Nachahmungen die Worte sind? Es sind aber die Laute, aus de­
nen man zusammensetzen muß?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Jetzt nimm denn auch du an dem Satze Anteil, wie eben Hermogenes: Sage, scheint
dir die Annahme richtig, daß das p der Bewegung, dem Strome und der Rauhigkeit gleicht, oder
nicht?
Kratylos: Richtig.
Sokrates: Das l dem Glatten und Milden und Begriffen, wie wir sie eben ja nannten?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Weißt du, daß eben dasselbe, was wir sklêrotês (Rauhigkeit) nennen, die Eretrier
sklêrotêr nennen?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: Entsprechen nun beide Laute, das r und das s, derselben Sache und stellt sie sich als das
gleiche für jene dar, während r den Schluß macht, wie für uns, während es s tut, oder stellt sie sich
dem einen von uns gar nicht dar?
Kratylos: Gewiß beiden.
Sokrates: Nun, inwiefern das r und das s ähnlich sind, oder inwiefern sie es nicht sind?
Kratylos: Insofern sie ähnlich sind.
36
Modul Philosophie
Sokrates: Sind sie allseitig ähnlich?
Kratylos: Wenigstens wohl, sofern sie eine Bewegung darstellen.
Sokrates: Doch das eingeschobene l – bezeichnet es nicht das Gegenteil der Rauhigkeit?
Kratylos: Vielleicht, Sokrates, ist es auch mit Unrecht eingefügt. Wie in den Beispielen, die du
dem Hermogenes vorhieltest, da du Buchstaben wegnahmst und einsetztest, je nach Bedürfnis –
und mir schien das ganz richtig –, so muß man vielleicht auch jetzt r statt l sprechen.
Sokrates: Gut. Wie nun? Jetzt verstehen wir, wie wir sagen, einander nicht, wenn einer sklêron
spricht, und auch du weißt jetzt nicht, was ich damit meine?
Kratylos: O ja, durch die Gewohnheit, mein Teuerster.
Sokrates: Wenn du »Gewohnheit« angibst, meinst du etwas von Übereinkunft Verschiedenes?
Oder verstehst du unter »Gewohnheit« etwas anderes als ich: wenn ich das spreche, denke ich mir
das, du aber verstehst, daß ich mir das denke? Meinst du nicht so?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Wird dir nicht, wenn du meine Worte verstehst, von mir eine Mitteilung?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Und doch drücke ich es durch etwas dem Gedachten Unähnliches aus, wenn ja das l
der Rauhigkeit, wie du sagst, unähnlich ist. Wenn aber dem so ist, nicht wahr, so bist du mit
dir selbst übereingekommen, und die Richtigkeit des Wortes wird dir zu einer Übereinkunft, da
ja mit Hilfe der Gewohnheit und des Übereinkommens die ähnlichen sowohl als unähnlichen
Buchstaben bedeutsam werden? Wenn aber gar die Gewohnheit nicht ein Übereinkommen ist, so
wäre der Satz nicht mehr richtig, die Ähnlichkeit sei eine Bezeichnung, sondern die Gewohnheit
wäre es. Denn sie bezeichnet offenbar durch Ähnliches und Unähnliches. Da wir aber diesen Satz
zugeben, Kratylos, – denn dein Schweigen will ich als Zugeständnis ansehen –, so muß doch auch
Übereinkunft und Gewohnheit beitragen zur Darstellung unserer Gedanken in Worten. Denn,
mein Bester, wenn du an die Zahlen gehen willst, woher sollte man nur ähnliche Worte nehmen,
die man jeder einzelnen Zahl beilegte, wenn du für die Richtigkeit der Worte deiner Beistimmung
und Übereinkunft keine Geltung zuerkennen läßt? Auch mir selbst kommt es darauf an, daß die
Worte nach Möglichkeit den Dingen ähnlich seien; aber in Wahrheit mag, wie Hermogenes sagt,
dieser Zug nach der Ähnlichkeit schlüpfrig und mag es notwendig sein, auch diesen Ballast, die
Übereinkunft, für die Richtigkeit der Worte zu Hilfe zu nehmen, während vielleicht ein Ausdruck
nach Möglichkeit am schönsten wäre, wenn er aus lauter oder möglichst vielen ähnlichen Teilen
bestände – das sind solche, die dem Dinge wesentlich sind –, und im entgegengesetzten Falle am
häßlichsten. Aber sage mir danach noch folgendes: Welche Wirksamkeit haben die Worte, und
was sollen sie Gutes zuwege bringen?
Kratylos: Ich denke, sie teilen mit, o Sokrates, und das ist ganz einfach: Wer die Worte weiß, der
kennt auch die Dinge.
Sokrates: Vielleicht meinst du nämlich, Kratylos, folgendes: Wenn einer das Wesen des Wortes
kennt – es ist aber gerade so wie das Ding –, muß er natürlich auch das Ding kennen, wenn es ja
dem Worte ähnlich ist; es gibt also nur eine Kunst für alles, was einander ähnlich ist. In dieser
Beziehung, glaube ich, behauptest du, wer die Worte kenne, der werde auch die Dinge kennen.
Kratylos: Ganz richtig.
Sokrates: Halt einmal! Laß uns zusehen, worin denn eigentlich diese Art der Mitteilung über die
Dinge besteht, von der du eben sprichst, und ob es noch eine andere gibt, diese jedoch besser ist,
oder ob es weiter keine gibt als diese. Wie meinst du?
Kratylos: So: es gibt gar keine andere, diese aber ist die einzige und beste.
Sokrates: Soll auch das Auffinden der Dinge damit zusammenfallen, daß, wer die Worte aufgefun­
den hat, auch die Dinge aufgefunden habe, deren Worte sie sind? Oder muß man auf andere Weise
nachforschen und auffinden, lernen aber auf diese Weise?
Kratylos: Jedenfalls muß auch Nachforschen und Auffinden in bezug auf dieselben Dinge ganz
mit dieser Weise zusammenfallen.
37
Modul Philosophie
Sokrates: Wohlan denn, laß uns bedenken, Kratylos, ob jemand, wenn er über die Dinge nach­
forscht, den Dingen folgt und ergründet, was der Sinn eines jeden sei, – oder bemerkst du wohl,
daß darin eine nicht geringe Gefahr der Täuschung besteht?
Kratylos: Inwiefern?
Sokrates: Offenbar hat ja der erste Namenbildner nach unserer Angabe die Worte so gestaltet, wie
er sich die Dinge vorstellte. Nicht wahr?
Kratylos: Ja.
Sokrates: Wenn er also unrichtige Vorstellungen hatte und danach die Worte bildete, – wie soll es
ausgehen, wenn wir ihm folgen? Nicht wahr, wir werden getäuscht werden?
Kratylos: Doch vielleicht mag es so nicht sein, o Sokrates, sondern notwendig so, daß der Namen­
bildner die Worte durchaus mit Erkenntnis bildete. Wo nicht, was ich früher wiederholt sagte,
wären seine Gebilde auch keine Worte. Ein sehr starker Beweis aber, daß der Namengeber nicht
von der Wahrheit abgewichen ist, mag dir folgendes sein: es stünde nämlich sonst nicht alles in
solcher inneren Übereinstimmung. Oder merktest du nicht während deiner eigenen Erklärungen,
wie alle Worte nach demselben Prinzip und auf dasselbe Ziel hingebildet waren?
Sokrates: Doch darin, mein guter Kratylos, liegt gar kein Grund zur Verteidigung. Denn wenn
der Wortbildner sich anfangs täuschte und dann alles übrige dem Muster anquälte und ihm inne­
re Übereinstimmung abnötigte, so ist das gar nicht auffallend, wie bei mathematischen Figuren
manchmal, wenn der erste geringfügige und unscheinbare Fehler entstand den ist, die folgenden
noch in großer Zahl sich anschließen und doch mit einander stimmen. Jedermann muß eben die
meiste Sorgfalt und das meiste Nachdenken auf den Anfang jeder Sache verwenden und zusehen,
ob die Grundlage richtig ist oder nicht. Ist sie hinlänglich erforscht, so muß das übrige offenbar
jenem konsequent sein. Indes sollte es mich doch wahrlich wundem, wenn die Worte wirklich mit
einander übereinstimmten. Laß uns also nochmals überdenken, was wir vorher durchnahmen:
Die Worte, sagen wir, bezeichnen das Wesen der Dinge in der Voraussetzung, daß alles in Gang,
Bewegung und Fluß sei. Nicht wahr, in dieser Weise stellen sie deiner Meinung nach dar?
Kratylos: Ganz vollkommen, und sie bezeichnen ja das Wesen gewiß richtig.
Sokrates: Laß uns also zuerst das Wort epistêmê (Erkenntnis) nochmals vornehmen und beden­
ken, wie gar zweideutig es ist und wie es eher wohl bedeutet, daß sie unsere Seele bei den Dingen
zum Stehen bringt (histêsin), als daß sie mit in die Bewegung sich fortreißen läßt. Auch ist es
richtiger, wie jetzt den Anfang auszusprechen, als das e abzuwerfen und pistêmê zu sagen, ja
vielmehr statt an dem e an dem i eine Einfügung vorzunehmen. Dann heißt es bebaion (sicher),
weil es die Nachahmung einer Unterlage (basis) und eines Stillstandes (stasis) ist, nicht einer Be­
wegung. Ferner historia (die Geschichte) deutet wohl gar an, daß sie den Fluß zum Stehen bringt
(histêsi ton rhoun). Auch piston (treu) deutet ganz und gar auf ein Stillstehn (histan). Ferner
mnêmê (Gedächtnis) macht wohl jedem kund, daß es ein Bleiben (monê) sei in der Seele und nicht
eine Bewegung. Und wenn du willst, so wird hamartia (der Fehler) und xymphora (Mißgeschick),
wenn man nach dem Worte schließen darf, sich als identisch herausstellen mit der genannten
Einsicht (xynesis) und Erkenntnis (epistêmê) und allen anderen auf gewichtige Dinge bezügli­
chen Namen. Ferner auch amathia (Unwissenheit) und akolasia (Frechheit) steht offenbar diesen
Bedeutungen nahe. Denn das eine, die amathia nämlich, ist ja der Marsch eines mit der Gottheit
zugleich Gehenden (hama theô iontos), die Frechheit (akolasia) aber stellt sich ganz als das Gefol­
ge (akolouthia) der Dinge dar. Auf diese Weise würden sich die Worte, die wir den schlechtesten
Begriffen beigelegt denken, als ganz ähnlich mit den für die alleredelsten herausstellen. Wenn
man sich aber Mühe gäbe, so würde man auch noch viele andere finden, aus denen man schließen
könnte, der Namenbildner bezeichne die Dinge nicht als gehend und sich bewegend, sondern als
beharrlich.
Kratylos: Aber, Sokrates, du siehst doch, daß die größte Zahl jenen Sinn darstellen.
Sokrates: Was beweist das, Kratylos? Sollen wir die Worte gegeneinander abzählen, wie Stimm­
steine, und soll darauf die Richtigkeit sich gründen? Soll wirklich das die Wahrheit sein, was sich
als die Bedeutung der meisten Worte herausstellt?
Kratylos: Das ziemte sich gewiß nicht.
38
Modul Philosophie
Sokrates: Allerdings nicht im mindesten, mein Freund. Doch hier wollen wir das auf sich beruhen
lassen [und folgendes erwägen, ob du auch darin beistimmst oder nicht: Also stimmten wir nicht
eben darin überein, die jedesmaligen Namenbildner, in hellenischen so gut wie in ausländischen
Städten, seien Gesetzgeber, und die Kunst, die sich darauf verstünde, sei die gesetzgeberische?
Kratylos: Gewiß.
Sokrates: So gib denn an: Bildeten die ersten Gesetzgeber die Stammwörter mit Erkenntnis der
Dinge, denen, sie sie beilegten, oder in Unkenntnis derselben?
Kratylos: Ich denke doch, Sokrates, mit Erkenntnis.
Sokrates: Denn gewiß nicht, mein lieber Kratylos, in Unkenntnis.
Kratylos: Ich denke nicht.
Sokrates: Laß uns denn wieder zu jenem Punkt zurückkehren, von dem aus. wir hierher gelang­
ten! Denn eben in der vorhergehenden Erörterung hast du, wenn du dich erinnerst, behauptet,
der Namenbildner bilde notwendig die Namen für die Dinge indem er sie kenne. Scheint dir das
noch so, oder nicht?
Kratylos: Noch immer.
Sokrates: Behauptest du auch, daß der Bildner der Stammwörter sie kenne?
Kratylos: Jawohl.
Sokrates: Aus welchen Worten hatte er denn die Dinge kennen gelernt und erforscht, wenn die
Stammwörter noch nicht da waren, während wir doch behaupten, man könne die Dinge unmög­
lich anders kennen lernen und erforschen als dadurch, daß man die Worte lerne oder selbst ihr
Wesen ausfindig mache?
Kratylos: Da hast du wohl recht, lieber Sokrates.
Sokrates: In welcher Weise sollen sie also mit Erkenntnis die Worte gebildet haben oder Gesetz­
geber sein, ehe auch nur irgend ein Wort vorhanden war und sie eines kennen konnten, wenn es
doch nicht möglich ist, die Dinge anders kennen zu lernen als aus den Worten?
Kratylos: Ich denke, die richtigste Erklärung darüber sei, o Sokrates, eine übermenschliche Macht
sei es gewesen, die den Dingen die ersten Namen gab, so daß sie notwendig richtig sein müssen.
Sokrates: Und dann, glaubst du, hätte der Bildner im Bilden sich selbst widersprochen, mochte es
ein Dämon sein oder ein Gott? Oder sollte unsere Behauptung eben keinen Grund gehabt haben?
Kratylos: Doch mögen die einen davon gar keine richtigen Worte sein.
Sokrates: Welche denn? Die auf Ruhe hinleiten, oder die auf Bewegung? Denn nach unserer Be­
hauptung, die wir eben aufstellten, wird das doch nicht durch Majorität entschieden.
Kratylos: Freilich wäre das auch gar nicht die rechte Art, Sokrates.
Sokrates: Da nun die Worte mit einander im Streite sind und die einen behaupten, sie seien der
Wahrheit ähnlich, die anderen, nein, sie seien es, – wonach werden wir da entscheiden, oder nach
welchem Maßstab? Doch wohl gewiß nicht nach anderen, von diesen verschiedenen Worten. Das
geht nicht; vielmehr muß man offenbar etwas anderes aufsuchen als die Worte, das uns ohne
Worte deutlich machen kann, welche dieser beiden Wortklassen die Wahrheit enthält, indem es
uns offenbar das wahre Wesen der Dinge enthüllt.
Kratylos: So scheint es mir.
Sokrates: Folglich ist es doch wohl, o Kratylos, möglich, ohne Worte die Dinge kennen zu lernen,
wenn dem so ist.
Kratylos: Offenbar.
Sokrates: Durch welches andere Mittel erwartest du also noch sie kennen zu lernen? Etwa durch
ein anderes als das wahrscheinlichste und sachgemäßeste, nämlich durch einander, wenn sie ir­
gend verwandt sind unter sich, und durch sich selbst? Denn etwas anderes als sie und ihnen Frem­
des möchte auch etwas anderes und Fremdes bezeichnen und nicht sie zur Darstellung bringen.
Kratylos: Da hast du offenbar recht.
Sokrates: Doch halt, beim Zeus! Haben wir nicht oft übereinstimmend erklärt, die richtig gebilde­
ten Worte seien den Dingen, deren Namen sie sind, ähnlich und seien Bilder derselben?
39
Modul Philosophie
Kratylos: Ja.
Sokrates: Gesetzt, es ist auch wirklich in hohem Grade möglich, die Dinge aus Worten kennen zu
lernen, aber auch durch sie selbst,– welches wäre der schönere und sicherere Weg der Erkenntnis:
aus dem Bilde zu erkennen, ob es selbst gut nachgebildet ist und die Wirklichkeit, die es abbildete,
oder aus der Wirklichkeit sie selbst und ob das Abbild von ihr richtig geraten ist?
Kratylos: Aus der Wirklichkeit, scheint es mir notwendig.
Sokrates: In welcher Weise man also die Dinge kennen lernen oder ergründen muß, das zu erken­
nen geht vielleicht über meine und deine Kraft. Doch es muß auch das Zugeständnis schon genü­
gen, daß man die Dinge nicht aus den Worten, sondern viel mehr aus sich selbst kennen lernen,
und erforschen soll als aus anderen Worten.
Kratylos: Offenbar, Sokrates.
Sokrates: Laß uns also ferner noch folgendes erwägen, damit uns nicht die Beziehung der meisten
dieser Worte auf ein Ziel und Prinzip täusche: Wenn nämlich wirklich die Wortbildner mit dem
Gedanken sie bildeten, alles sei immer in Gang und Fluß – denn auch ich glaube, daß sie von die­
sem Gedanken ausgingen, – wenn das wirklich stattfand, so verhält sich darum doch die Sache
nicht so, sondern sie selbst sind gleichsam in einen Wirbel geraten, treiben darin herum, ziehen
auch uns nach und stürzen uns mit hinein. Denn bedenke, mein trefflicher Kratylos, was ich mir
oft träumen lasse: Sollen wir denn behaupten, es gebe etwas Schönes und Gutes an sich und von
jedem einzelnen unter allen, was ist, ebenso, – oder nicht?
Kratylos: Ich meine, ja, o Sokrates.
Sokrates: Laß uns also jenes an sich betrachten, nicht ob ein Gesicht schön ist oder etwas derglei­
chen und das alles im Fluß zu sein scheint, sondern laß uns sagen: Ist das Wesen des Schönen an
sich nicht immer einmal wie das anderemal?
Kratylos: Notwendig.
Sokrates: Wenn es sich uns also immer entzieht, ist es dann möglich, richtig von ihm auszusagen,
und zwar zuerst, daß es jenes sei, und dann, daß es so beschaffen sei? Oder ist es notwendig, daß,
während wir sprechen, es alsbald zu einem andere? werde, uns entweiche und nicht mehr so sich
verhalte?
Kratylos: Notwendig.
Sokrates: Wie könnte nun das überhaupt ein bestimmtes Sein haben, das niemals sich gleichmä­
ßig verhält? Denn wenn es sich je gleichmäßig verhält, so verändert es sich offenbar in jener Zeit
nicht. Wenn aber etwas immer sich gleichmäßig verhält und dasselbe ist, – wie sollte das sich
verändern oder in Bewegung sein, da es doch nie aus derselben Gestalt heraustritt?
Kratylos: Durchaus nicht.
Sokrates: Doch es könnte ja wahrlich auch nicht einmal von jemand erkannt werden. Denn sowie
der herantritt, der es erkennen will, so würde es ein anderes und Verändertes: daher könnte seine
Qualität oder sein Zustand nicht mehr erkannt werden. Gewiß erkennt doch keine Erkenntnis
ihren Gegenstand, ohne daß er sich in einem bestimmten Zustande befände.
Kratylos: So ist es, wie du sagst.
Sokrates: Nicht einmal die Möglichkeit der Erkenntnis darf man annehmen, Kratylos, wenn alle
Dinge sich verändern und nichts Bestand hat. Denn wenn eben dieser Begriff, die Erkenntnis,
sich darin nicht verändert, daß sie Erkenntnis ist, so würde die Erkenntnis immer Bestand haben
und sein. Wenn aber auch selbst der Begriff der Erkenntnis sich verändert, so würde er zugleich
in einen anderen Begriff als den der Erkenntnis sich verwandeln und wäre nicht mehr Erkennt­
nis. Wenn er sich aber gar immer verwandelt, so würde es nie eine Erkenntnis geben. Und aus
diesem Grunde wäre weder ein Subjekt noch ein Objekt der Erkenntnis möglich. Wenn aber ein
Subjekt der Erkenntnis existiert und ein Objekt, ferner das Schöne, das Gute und jede Art des
Seienden existiert, so sind diese Begriffe offenbar nicht, wie wir jetzt behaupten, dem Strome
und der Bewegung irgend ähnlich. Ob sich das allerdings eigentlich auf diese Weise verhält oder
auf jene, wie die Anhänger des Herakleitos und viele andere behaupten, das mag nicht leicht sein
zu ergründen; doch sollte auch ein Mensch, der Anspruch auf Vernunft macht, nicht sich selbst
und die Pflege seiner Seele den Worten überlassen und im Vertrauen auf sie und die Wortbildner
40
Modul Philosophie
fest glauben, er wüßte was Rechtes, und über sich und das Seiende das Verdammungsurteil aus­
sprechen, es gebe nichts Gesundes an keinem Ding, sondern alles laufe aus wie Tongeschirr, und
glauben, die Dinge seien gerade in demselben Zustande wie die an Katarrh und Flüssen leidenden
Menschen, und alle Dinge seien vom Fluß und Katarrh ergriffen. Vielleicht, mein Kratylos, ver­
hält es sich wirklich so, vielleicht aber auch nicht. Daher mußt du tapfer und wacker nachdenken
und nicht leicht ein Urteil annehmen – denn du bist noch jung und hast Jugendfrische –, sondern
mußt forschen und, wenn du etwas findest, das Resultat auch mir mitteilen.
Kratylos: Ja, das will ich tun. Doch sei überzeugt, Sokrates, daß ich auch jetzt die Sache wohl
überlegt habe; aber bei allem Nachdenken und aller Anstrengung scheint mir die Sache vielmehr
so zu stehen, wie Herakleitos annimmt.
Sokrates: Ein andermal also, mein Freund, magst du es mir mitteilen, wenn du zurückkommst.
Jetzt aber gehe, wie du vorhast, aufs Land! Unser Hermogenes wird dich begleiten.
Kratylos: Das soll geschehen, Sokrates. Doch versuche auch du, das noch weiter zu ergründen!
Aus: Platon. Sämtliche Werke in drei Bänden, Band I. Hrsg. von Erich Loewenthal. Unveränderter Nachdruck der 8., durchgesehenen Auflage der Berliner Ausgabe von 1940. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 2004, S. 543–553, 591–616.
F ragen
1. Fassen Sie mit eigenen Worten zusammen, was Hermogenes in den ersten zwei Repliken
des Dialogs seinem Kontrahenten Kratylos vorwirft. Leiten Sie aus dem Vorwurf ab, welche Position hinsichtlich des Prozesses der „Benennung“ Kratylos, und welche Hermogenes
vertritt.
2. Vergleichen Sie die beiden Positionen im Bezug auf den modernen Begriff der „Arbitrarität“
des sprachlichen Zeichens.
3. In seiner Antwort operiert Sokrates in erster Linie mit den Begriffen wahr und falsch. Beschreiben Sie mit eigenen Worten die einzelnen Schritte seiner Argumentation.
4. Die Definition des Redens als einer Handlung eröffnet Sokrates die Möglichkeit, einen komplexen metaphorisch angelegten Vergleich zwischen verschiedenen Tätigkeiten (etwa Weben)
und dem Akt des Benennens zu ziehen. Wozu führt bei Sokrates dieser Vergleich?
5. Was oder wen meint Sokrates mit dem Begriff „Gesetzgeber“? Welche Funktion spielt diese
Institution im Prozess der Benennung?
6. Im dritten Teil des Dialogs macht Sokrates explizit auf den Unterschied zwischen den abgeleiteten Wörtern und den „Grundwörtern“ („Stammwörtern“) aufmerksam. Worin besteht
dieser Unterschied? Welche Rolle spielt dabei die Nachahmung?
7. Bei der Auseinandersetzung mit dem Charakter der Grundwörter wird ein besonderer Akzent auf die Analyse der einzelnen Laute gelegt. Erwägen Sie, inwieweit die Überlegungen
von Sokrates mit der modernen Klassifikation der Laute übereinstimmen.
8. Bei der Beweisführung, dass der Name eine Nachahmung des Dinges sei, bedient sich Sokrates eines metaphorischen Vergleichs mit dem Prozess des Malens. Beschreiben Sie mit
eigenen Wörtern, wie er argumentativ vorgeht und zu welcher Schlussfolgerung er kommt.
9. Wie werden die Kategorien „falsch reden“ und „wahr reden“ innerhalb dieser Metapher
bewertet?
10.Aus den abschließenden Überlegungen von Sokrates geht seine Position deutlich hervor.
Spezifizieren Sie, welche Einstellung er selbst hinsichtlich des Bezugs zwischen den „Namen“ und dem „Seienden“ einnimmt.
41
Modul Philosophie
Text 6
Jürgen Trabant: Platon
„Phainetai, o Sokrates!“ Dies ist das Ende des Dialogs über Sprache. Und es zeigt, was Europa von
der Sprache hält: nichts. Statt sich mit der Sprache aufzuhalten, wendet es sich lieber gleich den
Sachen zu. Diesem Denken ist die Sprache fremd (diesem Denken, das unser Denken, das unser
Denken ist, wird die Sprache fremd bleiben, bis heute). Und zwar, weil es wenig bis nichts von
fremden Sprachen weiß. Zwar wird die Frage, die der Dialog am Anfang noch diskutiert, ob näm­
lich die Richtigkeit der Wörter natürlich oder nach menschlicher Übereinkunft gegeben sei, mit
dem Hinweis auf die fremden Sprachen, auf die Sprachen der Barbaren, in Gang gesetzt: Wenn
die Sprache natürlich wäre, müsste sie ja bei allen Menschen gleich sein. Es ist aber evident, dass
die Barbaren andere Wörter haben. Immerhin wird den Barbaren das Sprechen zugestanden, was
im Ausdruck barbaros nicht unbedingt mitgesagt ist. Barbaros ist ja der brbr-Sager, eigentlich
jemand, der keine Sprache hat, quasi ein Tier. Dennoch wird deren anderes Sprechen auch nicht
besonders ernst genommen, denn sonst hätte sich die Frage nach der Natürlichkeit der Wörter
schneller erledigt, als dies der Fall ist. Fremde Wörter werden im Kratylos nur an einer einzigen
Stelle diskutiert. Stattdessen wird Hermogenes der Gegner des Kratylos und Vertreter der thesei-These, seitenlang gezwungen, die Abbildungen der Sachen in den griechischen Signifikanten
anzuerkennen. Und Kratylos muß zugeben, dass doch viel Nicht-Abbildliches in den griechischen
Wörtern ist. Aber letztlich ist dann diese Frage einfach nicht wichtig: Die platonische Lösung der
Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Welt ist diejenige der Sprachlosigkeit. Es kommt für
das Erkennen gar nicht auf die Sprache an.
Dennoch reden die Philosophen gern und viel. Und ihr Wort ist ihnen lieb und teuer wie ein eige­
nes Kind (…). Daher verteidigt Sokrates in einem anderen Dialog, im Phaidros, auch die Sprache.
Allerdings geht es dort um einen anderen Aspekt der Sprache: Es geht um die Materialität der
Kommunikation, um lautliche Rede gegenüber der Schrift im Miteinander der Menschen, nicht um
das Verhältnis der Wörter zu den Sachen in der Erkenntnis-Relation der Welt. In kommunikativer
Hinsicht wird hier die Schrift als eine Entfremdung des gesprochen Wortes kritisiert. (…) Äußere
fremde Zeichen, allotrioi typoi, stehen beim Schreiben anstelle der aus dem Inneren strömenden
Laute oder der „lebenden und beseelten Rede“ (Phaidros 276a). Hier ist die Quelle, Derrida hat es
ja beklagt, der abendländischen Verachtung der Schrift. Also ist diesem Denken die Sprache doch
nicht fremd?
Es erscheint die klassische Doppeltheit der Funktionen der Sprache: In der einen Hinsicht ist die
Sprache fremd und in der anderen ist sie es nicht. Es werden in den beiden platonischen Dialogen
zwei verschiedene Funktionen von Sprache befragt: die kognitive und die kommunikative. Der
Kratylos thematisiert die Kognition, also die weltbearbeitende Funktion der Sprache, der Phaidros die kommunikative Funktion. Was das erste angeht, so können wir nach Platon der Sprache
entraten: Denken oder emphatischer: erkennen können (oder sollten) wir eigentlich besser ohne
Sprache. Hinsichtlich des zweiten, der Kommunikation, besteht aber gar kein Zweifel: die Sprache
als klingende Rede dient der Kommunikation, dem Zusammensein. Es ist kein Zufall, dass die
Rede als Miteinandersein in einem Dialog über die Liebe thematisiert wird. Die Liebe, das eigent­
liche Thema des Phaidros, realisiert sich besser in der Nähe als per Korrespondenz. Und in dieser
Hinsicht ist gerade an der Sprache als lautlichem Ereignis festzuhalten als dem Eigentlichen der
Sprache: Das Schreiben, gegen das hier polemisiert wird, entfremdet die Rede demjenigen, dem
sie gehört, dem sprechenden Meister. Die äußerlichen fremden Zeichen – allotrioi typoi – stehen
dem Eigenem, dem Inneren und wahrhaft Erinnerten gegenüber. Zum Wichtigsten, zum Denken,
brauchen wir die Sprache (letztlich besser) nicht. Sie dient als Lautliches aber dem Miteinander­
sein – und da ist sie besser als das Schreiben, das etwas Fremdes ist.
Aus: Jürgen Trabant: Was ist Sprache? München: Beck 2008, S. 64–66.
F ragen
1. Welchen Stellenwert hat laut Trabant die Sprache in der (alt)europäischen Philoso­phie?
2. Ist der platonischen Philosophie zufolge das Denken sprachgebunden?
42
Modul Philosophie
3. Geben Sie die im Text angeführte doppelte Funktionsbestimmung der Sprache mit Ihren
eigenen Worten wieder. Welche Bedeutung haben diese beiden Funktionen für die antike
Philosophie?
4. Welche Einstellung hat die platonische Philosophie gegenüber der Schrift?
43
Modul Philosophie
2.3 Sprachphilosophie in der Spätscholastik
Die in der griechischen Antike gewonnenen Erkenntnisse über die Sprache wurden später von
den Römern in ihre Sprachauffassung integriert. Sie erhielten dadurch aber kaum eine andere
sprachphilosophische Komponente. In der mittelalterlichen Philosophie, die weitgehend von
den Grundsätzen der christlichen Religion geprägt war, wurde das Werk Platons zunächst kaum
rezipiert, da es sich mit dem Christentum nicht vereinbaren ließ. Dagegen wurde Aristoteles
zum Leitphilosophen. Die Frage nach dem Wesen der Sprache wurde kaum mehr berührt. Die
Frage nach dem Ursprung der Sprache war hingegen geklärt: sie stammte von Gott. Allgemein
wurde angenommen, dass die Sprache des Alten Testaments, das Hebräische, die Ursprache der
Menschheit war. Latein wurde, nachdem eine von der Kirche allgemein und offiziell akzeptierte
Übersetzung des griechischen Textes des neuen Testaments vorlag (die sog. Vulgata von lat. Vulgatus = allgemein bekannt, überall verbreitet), zur Wissenschafts- und Verkehrssprache.
Dies änderte sich erst als in der Zeit der Reformation, als der Bibeltext in andere Sprachen übersetzt wurde, die dadurch eine Aufwertung erfuhren. Diese Übersetzungen stellten oft den ersten
Schritt zur Literarisierung der bisher nur mündlich tradierten Sprachen und den Beginn ihrer
Nationalliteraturen dar. Das gilt z. B. für die deutsche ebenso wie für verschiedene slawische
Sprachen.
Eine der wenigen philosophischen Streitfragen, die von der religiös-theologischen Struktur des
mittelalterlichen Wissenschaftsdiskurses zugelassen wurden, war der sog. Universalienstreit. Unter Universalien versteht man Allgemeinbegriffe, durch die einzelne individuelle Einzeldinge
zusammengefasst werden können. So fassen wir etwa die verschiedenen haarigen Lebewesen,
die bellen, beißen und die Strassen und Parks unserer Städte verschmutzen, unter dem universalen Gattungsbegriff Hund zusammen. Die Streitfrage war nun, ob diesen Universalien (Allgemeinbegriffen) die einzige oder mindestens höhere Realität und die Priorität gegenüber den
Einzeldingen zuzusprechen ist.
In der Frühscholastik wurde, am deutlichsten wohl von Johannes Scotus Eriugena (ca. 810–877),
die Position des Realismus vertreten, die besagt, dass neben den vielen Einzeldingen auch noch
die Allgemeinbegriffe existierten (Realität haben). Die Gegenposition dazu ist der Nominalismus, der annimmt, dass die Allgemeinbegriffe nur sprachliche Namen (latein. Nomen) sind,
also nur Worte, die als Zeichen für die Dinge und ihre Eigenschaften stehen, aber außerhalb
unseres Denkens nichts objektiv Reales bezeichnen. Der Nominalismus wurde von Johannes
Roscelinus (1050–1125) begründet. Als wichtiger Gegenspieler gilt der bedeutendste zeitgenössische Vertreter des Realismus, Anselm von Canterbury (1033–1109). Erst Thomas von Aquin
(1225–1274) entwickelte eine vermittelnde Position („gemäßigter Realismus) und befriedete diesen Streit aus theologischer Sicht.
Innerhalb der modernen Sprachwissenschaft hat sich die nominalistische Sichtweise durchgesetzt, wie sie von dem Franziskanermönch Wilhelm von Ockham (ca. 1280–1348) präzisiert
wurde, der heute allgemein als Begründer einer neuzeitlichen Denkweise (via moderna) angesehen wird. Damit berührt unsere Betrachtung zum erstenmal deutschen Boden, denn auch Ockham geriet wegen seines Nominalismus in Streit mit der Kirche und musste nach Bayern fliehen.
Er starb dann allerdings bald während einer Pestepidemie in München.
Seine nominalistische Position begründete Ockham ganz praktisch durch ein Ökonomie­prinzip,
das auch seither häufig (meist unter der Bezeichnung ‚Ockhams Rasiermesser’) als Grundlage für wissenschaftliche und/oder philosophische Argumentationen verwendet wurde. Dieses
Ökonomieprinzip lautet: „Eine Vielheit ist ohne Notwendigkeit nicht zu setzen“, das heißt alle
zur Klärung einer Frage nicht notwendigen Begründungen sind wegzuschneiden oder auszuschalten. Zu den überflüssigen Begründungen zählen für Ockham eben auch Entitäten wie die
als real existierend angenommenen Allgemeinbegriffe (Universalien). Bei Ockham existieren die
Allgemeinbegriffe nur „im Geiste“. Sie sind eine Leistung unseres Erkenntnisvermögens und
ermöglichen es uns, sich sprachlich auf etwas zu beziehen. Begriffe (latein. ‚Termini’) sind Zeichen, die auf etwas anderes verweisen. Wer einen Terminus verstehen will, muß wissen, wofür
er steht bzw. was durch ihn bezeichnet wird. Diese exakte Begriffsklärung war für Ockham die
Voraussetzung einer wissenschaftlich einsetzbaren Logik, in der die Begriffe zu Aussagen ver-
44
Modul Philosophie
bunden werden. Als Wahrheitsbedingung für Aussagen formulierte er, dass ein Satz dann wahr
ist, wenn Subjekt und Prädikat dasselbe bedeuten.
Text 7
Jürgen Villers: Nominalistischer Aristotelismus und die Sprache (Ockham)
Die Konstitution der Allgemeinbegriffe – das alte Problem des Aristotelismus seit Aristoteles –
will Ockham […] durch die Annahme einer einfachen naturgegebene Kausalbeziehung zwischen dem
Begriff und dem konkreten Gegenstand erklären, welche vom Verstand in Form einer intuitiven
und verknüpften Erkenntnis, die in einer äußeren und zugleich inneren, intellektuellen Erfah­
rung evident gegeben sei, erfasst werden soll. […] Für Ockham handelt es sich hierbei um eine
Evidenz, die nicht weiter erklärt werden kann. Jede Erfahrung muß deshalb letztendlich auf di­
rekte Gegenstandserfassung zurückzuführen sein, womit also auch die Ockhamsche Logik einen
rein extensionalen Bedeutungsbegriff impliziert.
Der „Nominalismus“ der Ockhamschen Philosophie besteht nun darin, dass für Ockham nicht
nur die Namen, sondern auch die Begriffe keine Bilder der Sachen mehr sind, sondern Zeichen,
die für die Sachen stehen. Der Begriff beinhaltet nicht mehr die Form der Sache, sondern ist nur
noch ein Zeichen, das nicht mehr mit der Bedeutung der Sache zusammenfällt. Das begriffliche
Zeichen hat zwar eine bestimmte Beziehung zu den Dingen, aber keine begriffliche Ähnlichkeit
mehr mit ihnen.
Gemäß seiner Aufteilung der Termini der Rede in geschriebene und gesprochene auf der einen
und in begriffliche auf der anderen Seite unterscheidet er zwei Arten von Zeichen:
Erstens das natürliche Zeichen (universale naturale), der allgemeine Verstandes-Begriff, der eine
Intention der Seele ist: das intuitive und damit kausal-natürliche Zeichen der Seele [die oratio
mentalis oder innere geistige Sprache].
Zweitens das konventionelle Universale (universale per voluntariam institutionem), das geschriebe­
ne oder gesprochene Zeichen, das wie das natürliche Zeichen die Dinge repräsentiert, aber eben
nicht auf unmittelbare Weise, sondern nachträglich und rein willkürlich [oratio vocalis oder ge­
sprochene äußere Sprache] […]
Und damit bereitet auch der Nominalismus mit seiner Subordination der lautlichen Rede unter
die Sprache des Geistes der neuzeitlichen Trennung von oratio und ratio, von Sprechen und Den­
ken den Boden: „Mit dieser Theorie ist die Abwertung der Sprache durchgeführt. Nur der Bedeu­
tungsakt des Intellekts erreicht die Realität; die Sprache ist nur Mittel, ein Etikett, das wir den
Sachen aufkleben, um sie handhaben zu können.“ […]
Aus: Jürgen Villers: Kant und das Problem der Sprache. Die historischen und systematischen Gründe für
die Sprachlosigkeit der Transzendentalphilosophie. Konstanz: Verlag am Hockgraben 1997, S. 140–142.
F ragen
1. Beschreiben Sie mit Ihren eigenen Worten, welches Problem im Rahmen des Univer­
salienstreits diskutiert wurde.
2. Was versteht man unter ‚Ockhams Rasiermesser’? Welche Konsequenzen hat diese Denkweise für Ockhams Sprachphilosophie?
3. Was versteht man unter einer extensionalen Bedeutungskonzeption?
4. Welche Arten von Zeichen unterscheidet Ockham?
5. Inwiefern wird durch Ockhams Philosophie die Sprache abgewertet?
45
Modul Philosophie
Text 8
Johann Huizinga: Herbst des Mittelalters
Der Symbolismus verliert jedoch den Anschein von Willkür und Unreife, sobald man sich darüber
im Klaren ist, dass er unverbrüchlich mit jener Weltanschauung verbunden ist, die im Mittelalter
Realismus hieß.
Nur dann hat die symbolische Gleichsetzung auf Grund gemeinschaftlicher Merkmale Sinn, wenn
diese das Wesentliche der Dinge sind, wenn die Eigenschaften, die das Symbol und das Symboli­
sierte gemeinsam haben, wirklich als Wesenheiten aufgefasst werden. Weiße und rote Rosen blü­
hen zwischen Dornen. Der mittelalterliche Geist sieht sogleich eine symbolische Bedeutung da­
rin: Jungfrauen und Märtyrer erstrahlen in Herrlichkeit zwischen ihren Verfolgern. Wie kommt
die Gleichsetzung zustande? Dadurch, dass die Eigenschaften dieselben sind: die Schönheit, Zart­
heit, Reinheit, das blutige Rot der Rosen sind auch diejenigen (Eigenschaften) der Jungfrauen
und Märtyrer. Doch ist dieser Zusammenhang nur dann wahrhaft sinnvoll […], wenn in dem Bin­
deglied, in der Eigenschaft also, das Wesen der beiden Glieder des Symbolismus beschlossen liegt,
mit anderen Worten, wenn Rot und Weiß nicht als bloße Benennung physischer Unterschiede auf
quantitativer Grundlage aufgefasst, sondern als Realien, als Wirklichkeiten gesehen werden. […]
So besteht ein unverbrüchlicher Zusammenhang zwischen Symbolismus und Realismus (im
mittelalterlichen Sinn). Man darf hier nicht zu sehr an den Universalienstreit denken. Gewiß,
der Realismus, der die universalia ante res verkündete, der den allgemeinen Begriffen Wesen und
Präexistenz zuerkannte, ist auf dem Gebiet des mittelalterlichen Denkens nicht Alleinherrscher
gewesen. Es hat auch Nominalisten gegeben: auch der Satz universalia post rem hat seine Vertre­
ter gehabt. Die These ist jedoch nicht zu gewagt, dass der radikale Nominalismus niemals etwas
anderes gewesen ist als eine Gegenströmung, als Reaktion und Opposition, und dass der jüngere
gemäßigte Nominalismus nur gewissen Bedenken gegen einen extremen Realismus entgegen­
kam, jedoch der wesensgemäß realistischen Denkrichtung der gesamten mittelalterlichen Geis­
teskultur nichts in den Weg legte.
Der ganzen Kultur wesensgemäß. Denn es kommt in erster Linie nicht auf den Streit scharfsinni­
ger Theologen an […], weil der Realismus, jenseits aller Philosophie, die primitive Denkweise ist.
Für den primitiven Geist nimmt alles, was benennbar ist, sofort Wesen an, seien es nun Eigen­
schaften, Begriffe oder was auch immer. […] Aller Realismus im mittelalterlichen Sinne ist letzten
Endes Anthropomorphismus.
Aus: Johann Huizinga: Herbst des Mittealters. Stuttgart: Kröner 1975, S. 288–300.
F ragen
1. Welche sprachphilosophische Position (Realismus, Nominalismus) dominierte laut Huizinga
im mittelalterlichen Alltagsdenken? Aus welchen Gründen?
2. Inwiefern gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Realismus und Symbolismus?
3. Was versteht man unter Anthropomorphismus?
4. Nach Huizinga gilt: „Aller Realismus im mittelalterlichen Sinne ist letzten Endes Anthropomorphismus.“ Erläutern Sie diese Aussage.
Z usatzfrage zu
T ext 7 und 8
5. Villers setzt sich eingehender mit dem mittelalterlichen Nominalismus auseinander, während
Huizinga dessen Bedeutung relativiert. Liegt hierin ein Widerspruch? Begründen Sie Ihre
Antwort.
46
Modul Philosophie
2.4Sprache in Aufklärung und deutschem Idealismus
Alle Epochen der Philosophie sind durch besondere Fragestellungen ausgezeichnet, die wiederum eine besondere Disziplin der Philosophie hervorbringen, bevorzugen oder verfeinern. Die
Leitdisziplin der Aufklärung ist die Erkenntnistheorie (vgl. Text 3; vgl. auch den Reader Erkenntnistheorie), die zunächst zwei Fragen in den Vordergrund rückte:
1. die Frage nach dem Ursprung der Erkenntnis;
2. die Frage nach der Realität der Außenwelt.
Wie beim Universalienstreit im Mittelalter ist auch diese Epoche von einer grundlegenden Auseinandersetzung geprägt. Auf der einen Seite stehen die Rationalisten (u.a. Descartes), die glauben,
dass beim Vorgang des menschlichen Erkennens der Verstand die zentrale und vordringlichste
Rolle spielt, auf der anderen Seite die Empiristen (u.a. Locke, Hume), die dieses Vorrecht für
die Erfahrung der Welt durch die Sinne reservieren. Die Sprache als Mittel der Erkenntnis geriet
dabei außer Acht bzw. wurde lediglich als sekundäres Ausdrucksmittel der jeweiligen Philosophie
gesehen. Bei den Empiristen eher in einer Art Pragmatismus, der auch die Sprache als Element
der Erfahrung verwendete, bei den Rationalisten eher aus systemimmanenten Gründen.
Gerne wird Descartes Begründung des Rationalismus auf die Formel reduziert: „Ich denke, also
bin ich“ (Cogito ergo sum), dem jedoch der eigentlich noch elementarere Satz vorausgeht: „Ich
zweifle, also bin ich“ (Dubito ergo sum). Dieses Zweifeln bleibt jedoch unhinterfragt. Aus sprachphilosophischer Sicht könnte man hier einhaken und nachfragen, was ich denn genau tue, wenn
ich zweifle, und ob dieser Akt des Zweifelns (wie auch derjenige des Denkens) nicht eigentlich
ein sprachlicher Akt ist. Damit wäre aber der sichere Boden der Erkenntnis, den Descartes mit
der nicht mehr hinterfragbaren Feststellung Dubito ergo sum gewinnen will, um daraufhin die
soeben angezweifelte Welt wieder schlüssig aufzubauen, abermals unsicher geworden. Fragen
nach der Sprache bleiben deswegen innerhalb der rationalistischen Modelle absichtlich unberücksichtigt.
Ende und Höhepunkt der Aufklärung ist die Philosophie Immanuel Kants, die schließlich auch
die beiden Positionen des Rationalismus und Empirismus zu einem versöhnlichen Ausgleich
bringt. Nach Kant müssen am Anfang aller Erkenntnis immer zugleich beide Erkenntnisvermögen beteiligt sein:
Unsre Natur bringt es so mit sich, dass die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann,
d. i. nur die Art enthält, wie wir von Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen,
den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser Eigenschaften ist
der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Ver­
stand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind
blind. (I. Kant: Kritik der reinen Vernunft B 74,75)
Kants Bedeutung für die europäische Philosophie bis in die Gegenwart ist kaum zu überschätzen. Besonders die drei kritischen Werke Kants (Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft) wurden zu Standardwerken, mit denen sich nachfolgende Philosophen immer wieder auseinandersetzen mussten. Vor allem als es daran ging, die
Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften am Ende des 19. Jahrhunderts in Einklang mit
den philosophischen Theoremen zu bringen, gewann Kants Erkenntnistheorie nochmals gesteigerte Aktualität (Neukantianismus). Deswegen ist es verwunderlich, dass erst relativ spät die
Frage nach der Bedeutung der Sprache und Sprachphilosophie in Kants Werk gestellt wurde.
Noch nach dem Zweiten Weltkrieg formulierte der österreichische Philosoph Rudolf Haller das
Problem als Forschungsdesiderat:
Warum gerade Kants kritische Philosophie das Problem des Zeichens so gut wie in keiner Weise
berührt, ist eine Frage, deren Beantwortung bis heute nicht versucht wurde. (Haller 1959, S. 133)
Dazu hatte die Kantforschung lange Zeit nur zwei Thesen zu bieten:
a. Kant konnte als Angehöriger des 18. Jahrhunderts, da die Sprachphilosophie noch nicht
fortgeschritten war, für die inneren Zusammenhänge der Sprache noch kein Problembewusstsein entwickeln.
47
Modul Philosophie
b. Kant hatte keine Zeit mehr für eine ausführliche Kritik der Sprache.
Während die zweite These dafür spricht, dass Kant der Sprache im Erkenntnisprozess nur eine
sekundäre oder tertiäre, jedenfalls gegenüber der Vernunft untergeordnete Rolle zusprach, ist
an der ersten These bereits der Einfluss des Neopositivismus und der Analytischen Philosophie
spürbar, die sprachphilosophischen Ansätzen vor dem linguistic turn keine adäquate wissenschaftliche Bedeutung zugesteht (siehe Text 1 und 3).
F ragen
1. Warum gab es in Descartes’ Philosophie keinen Platz für Sprachkritik?
2. Wie lässt sich der Unterschied zwischen Rationalismus und Empirismus charakteri­sieren?
3. Wie lässt sich Kants Stellung zum Rationalismus und Empirismus bestimmen?
4. Wie wurde zu erklären versucht, dass Kant sich nicht mit sprachphilosophischen Fragen
befasst hat?
48
Modul Philosophie
2.5Sprachphilosophie im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert kommt es zu einer Annäherung von Sprachphilosophie und empirischer
Sprachwissenschaft. Besonders deutlich wird dies im Werk Wilhelms von Humboldt (1767–
1835), welcher als Begründer der Allgemeinen Sprachwissenschaft angesehen werden kann.
Humboldt pflegte seine sprachvergleichenden Studien sprachphilosophisch zu ‚unterbauen’, indem er diesen sehr ausgiebige philosophische Reflexionen vorausgehen ließ.
Im 19. Jahrhundert gab es auch diverse – mehr oder weniger gelungene – Versuche, die Sprachbetrachtung mit Psychologie und Logik zu verbinden. Ein Beispiel hierfür ist der unten aufgeführte Text von Adolf Stöhr.
Text 9
Wilhelm von Humboldt: Zum Ursprung der Sprache
Die Sprache muß [...], meiner vollsten Überzeugung nach, als unmittelbar in den Menschen ge­
legt angesehen werden; denn als Werk seines Verstandes in der Klarheit des Bewusstseins ist
sie durchaus unerklärbar. Es hilft nicht, zu ihrer Erfindung Jahrtausende und abermals Jahrtau­
sende einzuräumen. Die Sprache ließe sich nicht erfinden, wenn nicht ihr Typus schon in dem
menschlichen Verstande vorhanden wäre. Damit der Mensch nur ein einziges Wort wahrhaft,
nicht als bloßen sinnlichen Anstoß, sondern als artikulierten, einen Begriff bezeichnenden Laut
verstehe, muß schon die Sprache ganz und im Zusammenhang in ihm liegen. Es gibt nichts Ein­
zelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kündigt sich nur als Teil eines Ganzen an. So natürlich
die Annahme allmählicher Ausbildung der Sprache ist, so konnte die Erfindung nur mit Einem
Schlage geschehen. Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache; um aber die Sprache zu erfinden,
müsste er schon Mensch sein.
So wie man wähnt, dass dies allmählich und stufenweise (…) geschehen, durch einen Teil mehr
erfundener Sprache der Mensch mehr Mensch werden, und durch diese Steigerung wieder mehr
Sprache finden könne, verkennt man die Untrennbarkeit des menschlichen Bewusstseins und der
menschlichen Sprache, und die Natur der Verstandeshandlung, welche zum Begreifen eines einzi­
gen Wortes erfordert wird, aber hernach hinreicht, die ganze Sprache zu fassen. Darum aber darf
man sich die Sprache nicht als etwas fertig Gegebenes denken, da sonst ebenso wenig zu begreifen
wäre, wie der Mensch die gegebene verstehen und sich ihrer bedienen könnte. Sie geht notwendig
aus ihm selbst hervor und gewiß auch nur nach und nach, aber so, dass ihr Organismus nicht
zwar als eine tote Masse im Dunkel der Seele liegt, aber als Gesetz die Funktionen der Denkkraft
bedingt, und mithin das erste Wort schon die Sprache antönt und voraussetzt. Wenn sich aber
dasjenige (…) mit etwas anderem vergleichen lässt, so kann man an den Naturinstinkt der Tiere
erinnern, und die Sprache einen intellektuellen [Instinkt] der Vernunft nennen.
Aus: Wilhelm von Humboldt: Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. In: Ders.: Gesammelte Werke Band 3, Berlin: Reimer 1843,
S. 252–254.
F ragen
1. Was ist das Thema dieses Textauszugs?
2. Warum kann nach Humboldt die Sprache keine Erfindung des Menschen sein?
3. Humboldt bestimmt Sprache als einen ‚Instinkt der Vernunft’. Erläutern Sie dies.
49
Modul Philosophie
Text 10
Adolf Stöhr: Über den Unsinn
Vereinigen sich zwei Worte, wie „rotes Grün“, die in ihren Bedeutungsfeldern kein gemeinsames
Gebiet haben, so heben sie sich in ihren Reproduktionswirkungen auf. Darin besteht der Unsinn.
Gäbe es keine Worte, so gäbe es keinen Unsinn, im schlimmsten Falle nur Irrtümer. Der Unsinn
kann nicht gedacht, er kann nur geredet werden.
Mitunter ist der Unsinn schon an den grammatischen Derivationszeichen erkennbar. Was auch
immer A bedeuten möge, „A Nicht-A“ ist ein Unsinn. Nun sind aber die Derivationszeichen selbst
nichts anderes als häufig gebrauchte gekürzte Begriffszeichen. Daher ist zwischen „rotem Grün“
und „A Nicht-A“ bezüglich der Unsinnigkeit kein wesentlicher Unterschied. „Setzung Wegneh­
mung von A“ ist dem „roten Grün“ analog.
Setzt man das grammatische Prädikat eines unsinnigen Satzes in das Negativum, und gibt dieser
Satz einen Sinn, so heißt dieser Sinn apodiktisch. „A ist Nicht A“ ist ein Unsinn. Setzt man das
grammatische Prädikat dieses Satzes in sein Negativum, so erhält man: „A ist Nicht-Nicht-A“ =
„A ist A“. Wenn nun die zweimalige Setzung des A mehr besagen könnte als die einmalige, was
allerdings nicht der Fall ist, dann wäre der Sinn des Satzes „A ist A“ apodiktisch. Der Satz: „es ist
möglich, in einer Ebene in demselben Punkt mehr als zwei Geraden zueinander normal zu ziehen“
ist ein Unsinn. Übersetzt man das grammatische Prädikat in sein Negativum, so erhält man den
apodiktisch geltenden Satz: „es ist unmöglich, in einer Ebene in demselben Punkt mehr als zwei
Geraden zueinander normal zu ziehen“.
Da die Apodiktizität nur durch die Beziehung auf den Unsinn möglich wird, und der Unsinn nur
durch die Sprache, so hängt auch die Apodiktizität nur an der Sprache.
Aus: Adolf Stöhr: Psychologie. Wien: Braumüller 1917, S. 396.
F ragen
1. Laut Stöhr haben die Wörter rot und grün „in ihren Bedeutungsfeldern kein gemein­sames
Gebiet“. Erläutern Sie, wie Stöhr das gemeint haben könnte. (Sie können hierbei auch die
Ausführungen aus Text 4 berücksichtigen.)
2. In seinen Ausführungen gebraucht Stöhr den Ausdruck „Unsinn“ nicht im alltags­sprach­
lichen Sinne, sondern als Terminus. Erläutern Sie dies.
3. Versuchen Sie zu erschließen, in welchem Sinne Stöhr den Terminus „apodiktisch“ gebraucht.
4. Voraussetzung dafür, dass ein Satz apodiktisch gilt, ist nach Stöhr, dass „dieser Satz einen
Sinn“ gibt. Wie kann das gemeint sein?
Z usatzfrage
5. Stöhr führt als Beispiel für eine unsinnige Aussage einen Satz aus der Geometrie an. Wie
wäre diese Aussage vor dem Hintergrund der modernen Mathematik zu werten?
50
Modul Philosophie
2.6 Die Sprachkrise am Ende des 19. Jahrhunderts
Am Ende des 19. Jahrhunderts wird in wachsendem Maße ein Misstrauen gegenüber der Sprache
und ihrer Funktionsfähigkeit artikuliert. Eine derart skeptische Haltung vertreten etwa die Philosophen Friedrich Nietzsche (1844–1900) und Fritz Mauthner (1849–1923). Auch in literarischen
Werken wird sie geäußert, beispielsweise von Hugo von Hofmannsthal (1874–1929; vgl. seinen
‘Chandos-Brief ’).
Text 11
Friedrich Nietzsche: Sprache und Wahrheit
Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und
Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesen­
heiten ganz und gar nicht entsprechen. […]
Denken wir […] an die Bildung der Begriffe: jedes Wort wird sofort dadurch Begriff, dass es eben
nicht für das einmalige ganz und gar individualisierte Urerlebnis, dem es sein Entstehen ver­
dankt, etwa als Erinnerung dienen soll, sondern zugleich für zahllose, mehr oder weniger ähn­
liche, d. h. streng genommen niemals gleiche, also auf lauter ungleiche Fälle passen muss. Jeder
Begriff entsteht durch Gleichsetzen von Nicht-Gleichen. […]
Wir nennen einen Menschen ehrlich; „Warum hat er heute so ehrlich gehandelt?“ fragen wir.
Unsere Antwort pflegt zu lauten: seiner Ehrlichkeit wegen. Die Ehrlichkeit! […] Wir wissen ja
gar nichts von einer wesenhaften Qualität, die die Ehrlichkeit hieße, wohl aber von zahlreichen
individualisierten, somit ungleichen Handlungen, die wir durch Weglassen des Ungleichen gleich­
setzen und jetzt als ehrliche Handlungen bezeichnen; […]
Das Übersehen des Individuellen und Wirklichen gibt uns den Begriff, wie es uns auch die Form
gibt, wohingegen die Natur keine Formen und Begriffe […] kennt. […]
Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphis­
men, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert,
übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, kanonisch
und verbindlich dünken: die Wahrheit sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie
welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild
verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen.
Aus: Friedrich Nietzsche: Ueber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Kritische Studienausgabe
(KSA). Band 1. Berlin: de Gruyter 1988, S. 879–881.
F ragen
1. Klären Sie die Bedeutung der Termini ‚Metapher’, ‚Metonymie’ und ‚Anthropomor­phismus’.
2. Erläutern Sie, in welchem Sinne die menschliche Sprache – nach Nietzsche – durch Metaphern, Metonymien und Antropomorphismen geprägt ist.
3. Welche Auswirkung hat laut Nietzsche dieser Charakter der menschlichen Sprache auf den
Wahrheitsbegriff ?
51
Modul Philosophie
2.7 Der linguistic turn
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bemühte sich eine Reihe Philosophen darum, die Philosophie
auf solide Grundlagen zu stellen. Dies geschah insbesondere im Rahmen des Neopositivismus
und der Analytischen Philosophie. Den Vertretern dieser Richtungen zufolge sollte ein Philosoph nicht im Stile eines Priesters dunkle, unverständliche ‚Wahrheiten’ verkünden, sondern vielmehr seine Darlegungen so transparent und eindeutig (und damit auch angreifbar) wie möglich
gestalten. Dieses Deutlichkeitsethos führte zu einer starken Anbindung an die exakten Wissenschaften, an die Mathematik, Logik und die Naturwissenschaften.
Das Bemühen um Klarheit förderte auch das philosophische Interesse an einer möglichst eindeutigen Sprache. Bereits der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) hatte
von einer solchen Sprache geträumt, die es ermöglichen sollte, Argumentations­strukturen offenzulegen und damit dazu beizutragen, Streitfragen zu klären (oder evtl. auch als Scheinprobleme
zu entlarven). Der Mathematiker und Philosoph Gottlob Frege (1848–1925) schuf um die Wende zum 20. Jahrhundert wichtige Grundlagen für die moderne formale Logik, welche als ein erfolgreicher Schritt in Richtung zu der von Leibniz erträumten Formalsprache angesehen werden
konnte. Gerade Frege wurde mit seiner detaillierten, auf Klarheit bedachten Art des Philosophierens zum Vorbild und zur Inspirationsquelle der Analytischen Philosophie. Das kommt im
Vorwort von Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus besonders deutlich zum Ausdruck:
Wieweit meine Bestrebungen mit denen anderer Philosophen zusammenfallen, will ich nicht be­
urteilen. Ja, was ich hier geschrieben habe, macht im Einzelnen überhaupt nicht den Anspruch
auf Neuheit; und darum gebe ich auch keine Quellen an, weil es mir gleichgültig ist, ob das, was
ich gedacht habe, vor mir schon ein anderer gedacht hat.
Nur das will ich erwähnen, dass ich den großartigen Werken Freges und den Arbeiten meines
Freundes Betrand Russell einen großen Teil der Anregung zu meinen Gedanken schulde.
Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in zweierlei. Erstens darin, dass in ihr Gedanken
ausgedrückt sind, und dieser Wert wird umso größer sein, je besser die Gedanken ausgedrückt
sind. (…) Mir scheint die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich
bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich
mich nicht hierin irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie
wenig damit getan ist, dass diese Probleme gelöst sind.
Bescheidenheit gehört nicht zu den Stärken Wittgensteins, Klarheit schon. Der gesamte Text ist
anhand einer präzisen Gliederung aufgebaut.
Text 12
Wittgenstein: Die Hauptsätze aus dem Tractatus-logico philosophicus
1. Die Welt ist alles, was der Fall ist.
2. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.
3. Das logische Bild der Tatsache ist der Gedanke.
4. Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.
5. Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. (Der Elementarsatz ist eine Wahr­
heitsfunktion seiner selbst).
6. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [p,ξ, N (ξ)]
Dies ist die allgemeine Form des Satzes.
52
Modul Philosophie
7. Worüber man nicht sprechen kann, davon muß man schweigen.
Aus: Ludwig Wittgenstein: Tractatus-logico philosophicus. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1990, S. 11–85.
F ragen
1. In welche zwei Gruppen lassen sich diese sieben Hauptsätze anhand der sprachlichen und
argumentativen Vorgehensweise teilen?
2. Inwiefern spiegelt sich in Wittgensteins Hauptsätzen aus dem Tractatus logico-philosophicus das
wissenschaftliche Ethos der Analytischen Philosophie?
Es ist eben dieser letzte, seither immer wieder (und meist falsch) zitierte Satz 7, der die Argumentation sprengt, da er anscheinend nicht mit den Vordersätzen verbunden ist. Dieser Satz ist
zugleich der letzte im Tractatus. Er wird nicht näher erläutert, so dass er eben diese Lösung zu
beinhalten scheint, die Wittgenstein in seinem Vorwort als die endgültige Lösung der wesentlichen Probleme annoncierte. Die Hinleitung zu diesem markanten Schlusspunkt findet sich in
den Ausführungen zu Hauptsatz 6:
Text 13
Wittgenstein: Von der Logik zur Philosophie
6.1.Die Sätze der Logik sind Tautologien
6.2.
Die Mathematik ist eine logische Methode.
Die Sätze der Mathematik sind Gleichungen also Scheinsätze.
6.3.
Die Erforschung der Logik bedeutet die Erforschung aller Gesetzmäßigkeit. Und außer­
halb der Logik ist alles Zufall.
6.4.
Alle Sätze sind gleichwertig.
6.5.
Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aus­
sprechen.
Das Rätsel gibt es nicht.
Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden.
6.51 Skeptizismus ist nicht unwiderleglich, sondern offenbar unsinnig, wenn er bezweifeln
will, wo nicht gefragt werden kann.
Denn Zweifel kann nur bestehen, wo eine Frage besteht; eine Frage nur, wo eine Antwort
besteht, und diese nur wo etwas gesagt werden kann.
6.52
Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen, wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind,
unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage
mehr; und eben dies ist die Antwort.
6.521 Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am verschwinden dieses Problems. (…)
6.522 Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.
6.53
Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich
sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft – also etwas, was mit Philosophie nichts zu
tun hat –, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm
nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat.
Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend – er hätte nicht das Gefühl, dass wir
ihn Philosophie lehrten – aber sie wäre die einzig streng richtige.
6.54
Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig
erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen
die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig.
Modul Philosophie
7
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
Aus: Ludwig Wittgenstein: Tractatus-logico philosophicus. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1990, S. 70–85.
F ragen
1. Ist die Mathematik eine tautologische Wissenschaft? Begründen Sie ihre Antwort.
2. Wie überwindet Wittgenstein das Problem des Skeptizismus?
3. Wie bestimmt Wittgenstein das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Philosophie?
4. Welche einzelnen Disziplinen der Philosophie werden im Text angesprochen?
5. Wittgenstein argumentiert auf dem Boden der analytischen Philosophie. Lassen sich Stellen
im Text angeben, wo er davon abweicht oder die analytische Argumentation verläßt?
54
Modul Philosophie
2.7.1Philosophie der idealen Sprache vs. Philosophie der normalen
Sprache
Das Ethos der Analytischen Philosophie hatte zur Folge, dass man die natürliche Sprache als
zu unpräzise und irreführend ablehnte. Für die Belange einer exakten Philosophie sollte eine
präzise Kunstsprache konstruiert werden, die die Mehrdeutigkeiten und anderen Mängel der natürlichen Sprache nicht aufweisen sollte. Zu diesem Zwecke orientierte man sich an den exakten
Kunstsprachen der Mathematik und formalen Logik. Eine derartige Ausrichtung innerhalb der
Analytischen Philosophie wird als ‚Philosophie der idealen Sprache’ bezeichnet.
Die Philosophie der idealen Sprache stieß in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf eine Gegen­
bewegung, die ‚Philosophie der normalen Sprache’. Dieser Richtung zufolge (welche ebenfalls
der Analytischen Philosophie zugerechnet wird), ist es weder möglich noch sinnvoll, eine vollkommen eindeutige Kunstsprache zu konstruieren. Stattdessen sollte man sich darauf beschränken, die natürlichen Sprachen kritisch zu untersuchen und (punktuell) auf Mängel hinzuweisen,
die Fehler in philosophischen Argumentationen evozieren können. Die Philosophie der normalen Sprache verfährt gewissermaßen sprachtherapeutisch: Sie betrachtet die natürliche Sprache
kritisch und weist auf Mängel hin, doch erkennt sie den Wert und die Berechtigung der natürlichen Sprache an.
Im Folgenden sollen zwei Texte vorgestellt werden, in denen diese unterschiedlichen Auffassungen artikuliert werden.
Text 14
Gottlob Frege: “Über die wissenschaftliche Berichtigung einer
Begriffsschrift”
In den abstrakteren Teilen der Wissenschaft macht sich immer aufs Neue der Mangel eines Mit­
tels fühl­bar, Mißver­ständnisse bei anderen und zugleich Fehler im eigenen Denken zu vermeiden.
Beide haben ihre Ursache in der Unvollkommenheit der Sprache. Denn der sinnlichen Zeichen
bedürfen wir nun einmal zum Denken. Unsere Aufmerksamkeit ist von Natur nach außen ge­
richtet. Die Sinneseindrücke über­ragen die Erinnerungsbilder an Lebhaftigkeit so sehr, daß sie
den Verlauf unserer Vorstellungen zu­nächst wie bei den Tieren fast allein bestimmen. Und dieser
Abhängigkeit würden wir auch kaum je entrinnen können, wenn nicht die Außenwelt auch eini­
germaßen von uns abhängig wäre. Schon die meisten Tiere haben durch die Fähigkeit zur Orts­
veränderung einen Einfluß auf ihre Sinneseindrücke: sie können die einen fliehen, die andern
suchen. Und das nicht allein: sie können auch umgestaltend auf die Dinge wirken. Diese Fähigkeit
hat nun der Mensch in bei weitem größeren Maße. Dennoch würde unser Vorstellungsverlauf
auch dadurch noch nicht die volle Freiheit gewinnen; er würde auf das beschränkt sein, was un­
sere Hand gestalten, unsere Stimme zu tönen vermag, ohne die große Erfindung der Zeichen, die
uns gegenwärtig machen, was abwesend, unsichtbar, vielleicht unsinnlich ist. Ich leugne nicht,
daß auch ohne Zeichen die Wahrnehmung eines Dinges einen Kreis von Erinnerungsbildern um
sich sammeln kann. Aber wir können diesen nicht weiter nach­gehen: eine neue Wahrnehmung
läßt diese Bilder in Nacht versinken und andere auftauchen. Wenn wir aber das Zeichen einer
Vorstellung hervorbringen, an die wir durch eine Wahr­nehmung erinnert werden, so schaffen wir
damit einen neuen festen Mittelpunkt, um den sich Vorstellungen sammeln. Von diesen wählen
wir wiederum eine aus, um ihr Zeichen hervorzu­bringen. So dringen wir Schritt für Schritt in
die innere Welt unserer Vorstellungen ein und bewegen uns darin nach Belieben, indem wir das
Sinnliche selbst benutzen, um uns von seinem Zwange zu befreien. Die Zeichen sind für das Den­
ken von derselben Bedeutung wie für die Schifffahrt die Erfindung, den Wind zu gebrauchen, um
gegen den Wind zu segeln. Deshalb verachte niemand die Zeichen! Von ihrer zweckmäßigen Wahl
hängt nicht wenig ab. Ihr Wert wird auch dadurch nicht vermindert, daß wir nach langer Übung
nicht mehr nötig haben, das Zeichen wirklich hervorzubringen, daß wir nicht mehr laut zu spre­
chen brauchen, um zu denken; denn in Worten denken wir trotzdem und, wenn nicht in Worten,
55
Modul Philosophie
doch in mathematischen oder andern Zeichen. Wir würden uns ohne Zeichen auch schwerlich
zum begrifflichen Denken erheben. Indem wir nämlich verschiedenen aber ähnlichen Dingen das­
selbe Zeichen geben, bezeichnen wir eigentlich nicht mehr das einzelne Ding, sondern das ihnen
Gemeinsame, den Begriff. Und diesen gewinnen wir erst dadurch, daß wir ihn bezeichnen; denn
da er an sich unanschaulich ist, bedarf er eines anschaulichen Vertreters, um uns erscheinen zu
können. So erschließt uns das Sinnliche die Welt des Unsinnlichen. Hiermit sind die Verdiens­
te der Zeichen nicht erschöpft. Es mag indessen genügen, ihre Unentbehrlichkeit darzutun. Die
Sprache aber erweist sich als mangelhaft, wenn es sich darum handelt, das Denken vor Fehlern
zu bewahren. Sie genügt schon der ersten Anforderung nicht, die man in dieser Hinsicht an sie
stellen muß, der, eindeutig zu sein. Am gefährlichsten sind die Fälle, in denen die Bedeutungen
des Wortes nur wenig verschieden sind, die leisen und doch nicht gleich­gültigen Schwankungen.
Von vielen Beispielen mag nur eine durchgängige Erscheinung hier erwähnt werden: dasselbe
Wort dient zur Bezeichnung eines Begriffes und eines einzelnen unter diesen fallenden Gegen­
standes. Überhaupt ist kein Unterschied zwischen Begriff und Einzelnem ausgeprägt. ‘Das Pferd’
kann ein Einzelwesen, es kann aber auch die Art bezeichnen, wie in dem Satze: ‘Das Pferd ist ein
pflanzenfressendes Tier.’ Pferd kann endlich einen Begriff bedeuten wie in dem Satze: ‘Dies ist ein
Pferd.’ Die Sprache ist nicht in der Weise durch logische Gesetze beherrscht, daß die Befol­gung
der Grammatik schon die formale Richtigkeit der Gedankenbewegung verbürgte. Die For­men,
in denen das Folgern ausgedrückt wird, sind so vielfältige, so lose und dehnbare, daß sich leicht
Voraussetzungen unbemerkt durchschleichen können, die dann bei der Aufzählung der notwen­
digen Bedingungen für die Gültigkeit des Schlußsatzes übergangen werden. Dieser erhält so eine
größere Allgemeinheit als ihm von Rechts wegen zukommt. Selbst ein so gewissenhafter und
strenger Schriftsteller wie Euklid macht vielfach stillschweigend von Voraussetzungen Gebrauch,
die er weder unter seinen Grundsätzen noch unter den Voraussetzungen des beson­deren Satzes
aufführt. [...] Ein streng abgegrenzter Kreis von For­men des Schließens ist in der Sprache eben
nicht vorhanden, so daß ein lückenloser Fortgang an der sprach­lichen Form von einem Über­
springen von Zwischengliedern nicht zu unterscheiden ist. Man kann sogar sagen, daß ersterer
in der Sprache fast nicht vorkommt, daß er dem Sprachgefühle widerstrebt, weil er mit einer
unerträglichen Weitschweifigkeit verbunden wäre. Die logischen Verhältnisse werden durch die
Sprache fast immer nur angedeutet, dem Erraten überlassen, nicht eigentlich ausge­drückt. [...]
Die hervorgehobenen Mängel haben ihren Grund in einer gewissen Weichheit und Veränder­lich­
keit der Sprache, die andererseits Bedingung ihrer Entwicklungsfähigkeit und vielseitigen Taug­
lichkeit ist. Die Sprache kann in dieser Hinsicht mit der Hand verglichen werden, die uns trotz
ihrer Fähigkeit, sich den verschiedensten Aufgaben anzupassen, nicht genügt. Wir schaffen uns
künstliche Hände, Werkzeuge für besondere Zwecke, die so genau arbeiten, wie die Hand es nicht
vermöchte.
Und wodurch wird diese Genauigkeit möglich? Durch eben die Starrheit, die Unveränderlichkeit
der Teile, deren Mangel die Hand so vielseitig geschickt macht. So genügt die Wortsprache nicht.
Wir bedürfen eines Ganzen von Zeichen, aus dem jede Vieldeutigkeit verbannt ist, dessen stren­
ger logischer Form der Inhalt nicht entschlüpfen kann. [...]
Erstdruck in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. NF 81, 1882, S. 48–56. Hier zitiert
nach: Gottlob Frege: Funktion, Begriff, Bedeutung. Hrsg. von Günther Patzig. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, S. 91–97 (Auszug).
F ragen
1. Inwiefern hält Frege die natürliche Sprache für unvollkommen?
2. Worin liegt nach Frege der Wert der (sprachlichen) Zeichen?
3. Wie bestimmt Frege das Verhältnis von Sprache/Zeichen und Denken?
4. Erläutern Sie im Anschluss an Freges Ausführungen den Unterschied zwischen den folgenden beiden Aussagen:
Der Kaktus in unserer Küche blüht.
Der Kaktus ist eine sehr zähe Pflanze.
56
Modul Philosophie
Inwiefern ergibt sich hieraus aus wissenschaftlicher oder logischer Sicht ein Problem?
5. “Die logischen Verhältnisse werden durch die Sprache fast immer nur angedeutet, dem Erraten überlassen, nicht eigentlich ausgedrückt.” Erläutern Sie diese Feststellung Freges in
Bezug auf das folgende Beispiel:
Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme! Mein Wagen hatte einen Motorschaden.
6. Wie möchte Frege die Mängel der natürlichen Sprache überwinden?
Text 15
Eike von Savigny: “Das Normalsprachenprogramm in der Analytischen
Philosophie”
1. Einleitung
Als ›ordinary language philosophy‹ (oder: Philosophie der normalen Sprache) bezeichnet man seit
den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts eine Arbeitsweise innerhalb der Analytischen Philoso­
phie, welche für die Klärung, Auflösung und Lösung philosophischer Fragen nur die Ausdrucks­
mittel der normalen Sprache verwendet und in ihren Untersuchungen und Argumentationen
auf Feststellungen über die normale Sprache zurückgreift. Unter normalen Sprachen werden in
diesem Zusammenhang gesprochene Gebrauchssprachen verstanden. Meistens stützen sich die
Vertreter dieser Philosophie auf die Umgangssprache. Es ist jedoch klar, daß auch gewisse funk­
tionierende Fachsprachen, etwa die Sprache einer funktionierenden Wissenschaft oder Disziplin,
zu den in diesem Sinne normalen Sprachen gerechnet werden. Gegenübergestellt wird ›ordinary
language‹ an erster Stelle den künstlich konstruierten Sprachen der Logik, mit deren Hilfe die so­
genannten idealsprachlichen Philosophen (Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Willard Van Orman
Quine, u. a.) philosophische Probleme klären und entscheidbar machen wollten.
Die bedeutendsten Vertreter der normalsprachlichen Richtung sind Gilbert Ryle (1900–1976),
[der späte] Ludwig Wittgenstein (1889–1951) [...] (mit der Philosophie der Philosophischen Un­
tersuchungen und deren Umfeld) und John Langshaw Austin (1911–1960). Die meisten der üb­
rigen Vertreter hängen von einem oder mehreren der drei genannten Philosophen ab. [...] In der
folgenden auch sonst in hohem Maße auswählenden Übersicht beschränken wir uns daher auf
Ryle, Wittgenstein und Austin.
2. Gilbert Ryle
Ryle war schriftstellerisch sehr produktiv. Vom Ende der zwanziger bis in die siebziger Jahre hi­
nein publizierte er zahlreiche Aufsätze, eine Fülle von Rezensionen, sowie mehrere Bücher. Ryles
Hauptwerk, The Concept of Mind, erschien 1949. Die 1953 gehaltenen Tarner Lectures wurden
1954 unter dem Titel Dilemmas veröffentlicht. Das dritte Buch, Plato’s Progress (1966), bekundet
neben vielen Aufsätzen Ryles philologische und philosophiehistorische Bemühungen. Posthum
erschien On Thinking, eine Reihe von Aufsätzen aus den letzten Lebensjahren, die ergänzend
an The Concept of Mind anknüpfen. – Bei aller Vielfalt verbindet die meisten Arbeiten ein reges
Interesse an der Klärung der Natur und der Methode des Philosophierens. Was bezweckt man mit
dem Philosophieren, was kann man erreichen, und vor allem: wie stellt man es sinnvollerweise
an? Welcher Art sind die Probleme, denen man in der Philosophie begegnet? Wie entstehen sie?
Wie behandelt man sie? Welche Argumentationsstrategien sind in der Philosophie brauchbar?
– Aufsätze wie Systematically Misleading Expressions (1932), Philosophical Arguments (1945),
Proofs in Philosophy (1954) u. a., und die Vorlesungen Dilemmas beschäftigen sich unmittelbar
mit diesen Fragen. [...] Klar und konzise trägt Ryle seine sprachphilosophischen Auffassungen in
The Theory of Meaning (1957) vor. Selbst das Hauptwerk ist unter der ausdrücklichen Zielset­
zung geschrieben, die Methoden der ›ordinary language philosophy‹ auf einem geeigneten Felde
als fruchtbar zu erweisen. Wie Ryle in seiner schönen autobiographischen Skizze erzählt, hielt
er einige Zeit das Problem der Willensfreiheit für den geeignetsten ›Gordischen Knoten‹, bis er
sich dem Leib-Seele-Problem zuwandte. – Das von Ryle zeitlebens gehegte Interesse, sich über
das Philosophieren klar zu werden, hindert ihn freilich nicht daran, inhaltliche Meinungen und
57
Modul Philosophie
Theorien zu historischen und systematischen Fragen auszubilden. Die bedeutendsten systemati­
schen Arbeiten liegen auf dem Gebiet der Philosophie des Geistes – man könnte auch sagen: der
philosophischen Anthropologie.
In Ryles Lehrjahren hatte sich die Frage, was Philosophie sein könne, wieder einmal verschärft.
Die Philosophie über einen nur ihr eigenen Gegenstandsbereich zu kennzeichnen, erschien zu­
sehends schwieriger. Insbesondere konnte man nicht gut sagen, man untersuche mentale oder
psychische Phänomene – im Unterschied zu den ›materiellen‹ Phänomenen, die die Naturwissen­
schaftler erforschen. Zum einen mußte man fürchten, da sich eine empirische Wissenschaft der
Psychologie mehr und mehr entfaltete, als dilettierender Apriori-Psychologe dazustehen. Zum
anderen hatten Gottlob Freges (1848–1925) (s. Art. 34), Edmund Husserls (1859–1938) (s. Art.
46) und Russells (1872–1970) Attacken gegen den Psychologismus in der Logik gezeigt, daß Un­
tersuchungen der tatsächlichen geistigen Prozesse schlicht das Thema verfehlen, wenn es wie in
der Logik (und auch sonst oft in der Philosophie) um Geltungsfragen geht. In dieser Lage gaben
viele Befürworter eines solchen Anti-Psychologismus der Versuchung nach, den Gegenstandsbe­
reich der Logik und Philosophie in einem (mit Freges Ausdruck) ›dritten Reich‹ weder mentaler
noch materieller Gegenstände zu suchen. Man hatte es demnach mit Gedanken (in Freges Sinne),
Propositionen, Universalien, etc. zu tun. Für Ryle führte dieser Schritt vom Regen in die Traufe.
Das platonistische Großreich roch nicht nur nach unseligen Hypostasierungen; es brachte vor
allem auch den Zwang zum Postulieren merkwürdiger Beziehungen (beispielsweise epistemischer
Zugangsweisen) zu diesen eigentümlichen Entitäten mit sich. Besonders der frühe Ryle ist ausge­
sprochen anti-platonistisch eingestellt. In seinen Gesellenstücken macht er regelmäßig Gebrauch
von Ockhams Rasiermesser. – Vielleicht sollte man die Philosophie am besten gar nicht als Lehre
über einen besonderen Gegenstandsbereich charakterisieren, sondern wie Wittgenstein im Trac­
tatus, den Ryle früh las, als Tätigkeit, die es nicht mit spezifischen Gegenständen, sondern mit
einer besonderen Art von Schwierigkeiten zu tun hat. Ryle gelangte zu der Ansicht: „Philosophical
problems are problems of a special sort; they are not problems of an ordinary sort about special
entities“ (Ryle 1971, II, vii).
2.1. Systematisch irreführende Ausdrücke
In dem Aufsatz Systematically Misleading Expressions (1932) stellt Ryle seine neue Auffassung
von Philosophie vor. Diese Arbeit gilt zugleich als eines der ersten Zeugnisse der Philosophie der
normalen Sprache. Dieser Einschätzung kann man nicht uneingeschränkt zustimmen, denn Ryle
steht in dieser Zeit noch unter dem Einfluß der andersartigen Analyse-Programme Russells, des
frühen Wittgenstein und des Wiener Kreises. – Sprachliche Ausdrücke können irreführen, wenn
man sich durch ihre grammatische Ähnlichkeit zu anderen Ausdrücken dazu verleiten läßt, sie
auch in logischer Hinsicht gleich zu behandeln. ‘Unpünktlichkeit ist tadelnswert’ hat dieselbe
grammatische Form wie ‘Hans ist tadelnswert’. Deshalb könnte es den Anschein haben, es gebe
die Unpünktlichkeit, wie es Hans gibt, und beide könne man auf dieselbe Weise tadeln. Ryle be­
tont nun, daß sich die Auflösung möglicher Verwirrungen, die durch systematisch irreführende
Ausdrücke veranlaßt werden, nicht an die nichtphilosophierenden Sprachbenutzer richtet, son­
dern an die Philosophen selbst, die oft sprachliche Analogien fehldeuten. Die normale Sprache
braucht nicht geklärt zu werden; und Nichtphilosophen brauchen sich von Philosophen nicht
sagen zu lassen, was ihre Äußerungen bedeuten. – Bei der Formulierung seines Programms, mit
dessen Hilfe die systematisch irreführenden Ausdrücke philosophisch unschädlich gemacht wer­
den sollen, wird jedoch offenkundig, daß Ryle seine Kriterien zur Entscheidung darüber, ob ein
Ausdruck mißlich und wie er umzuformulieren ist, nicht aus Feststellungen über die normale
Sprache gewinnt. ‘Unpünktlichkeit ist tadelnswert’ sei nämlich irreführend, weil die syntakti­
sche Form dieser Beschreibung die ›eigentliche‹ oder ›logische‹ Form des Sachverhalts verdecke
oder gar entstelle. Stattdessen solle man Sachverhalte so beschreiben, daß man die eigentliche
Struktur des Sachverhalts ans Licht bringe: ‘Alle, die unpünktlich sind, sind tadelnswert’. Wer
sich von den vielen ‘logisch’, ‘wirklich’ bzw. ‘eigentlich’ nicht einschüchtern läßt, muß sich nach
den Gründen für die Annahme fragen, es gebe eine logische Form des Sachverhalts, und diese
komme ausgerechnet durch die vorgeschlagene Umformulierung zum Vorschein. Ein Philosoph
mit platonistischen Neigungen könnte demgegenüber vorschlagen, ‘Hans ist tadelnswert’ müsse
eigentlich heißen: ‘Hans hat an der Idee des Tadelnswerten teil’ oder: ‘Hans hat die Eigenschaft,
tadelnswert zu sein’.
58
Modul Philosophie
2.2. Kategorienfehler
Von solchen metaphysischen Voreingenommenheiten hat sich Ryle nur allmählich gelöst. Das
Verständnis mancher Arbeiten aus der Übergangsphase wird dadurch erschwert, daß Ryles Ter­
minologie oft an Programme erinnert, denen er sich methodisch und inhaltlich nur noch sehr
eingeschränkt anschließt. Was bleibt, ist die Suche nach einer Grenze zwischen Sinn und Unsinn,
die der Philosophie eine sinnvolle Aufgabe läßt. – In dem Aufsatz Categories (1938) entwickelt
Ryle seine neue Diagnose philosophischer Fehler, die bekannte Theorie der Kategorienfehler, die
zum methodischen Ansatzpunkt seines Hauptwerks The Concept of Mind und auch noch von
Dilemmas werden sollte. – Ersetzt man in einem sinnvollen Satz einen Satzteil durch einen an­
deren, so kann ein sprachlich sinnloser Satz entstehen, selbst wenn beide Sätze nach den Regeln
der Schulgrammatik in Ordnung sind, z. B. ‘Ich traf gestern den Durchschnitts­steuerzahler’ (nach
dem Muster von ‘Ich traf gestern den Sohn unseres Postboten’), ‘Karl weiß irrtümlich, daß die
Premiere verschoben wird’ (nach dem Muster von ‘Karl glaubt irrtümlich, daß die Premiere ver­
schoben wird’). Resultiert durch eine Substitution der beschriebenen Art ein sprachlich absurder
Satz, so kann man sagen, daß die füreinander ersetzten Elemente verschiedenen Kategorien an­
gehören. Den Fehler der Verwechslung von Kategorien nennt Ryle kurz ‘Kategorienfehler’. – Die
Wiederbelebung des Terminus ‘Kategorie’ und die Anknüpfung an Aristoteles’ (384–322 v. Chr.)
Kategorienschrift, Immanuel Kants (1724–1804) Tafeln der Urteilsformen und Kategorien so­
wie die Anspielungen auf Russells Theorie der logischen Typen dürfen nicht darüber hinwegtäu­
schen, daß Ryle sprachimmanente Kriterien für Kategorien­gleichheit, Kategorienverschiedenheit
und Kategorienfehler angibt. Ryle teilt einige der kritischen Intentionen von Aristoteles (s. Art.
15), Kant und Russell, ohne sich ihren ontologischen und erkenntnistheoretischen Systemen
anzuschließen. Er lehnt sowohl die Verfahren ab, die Aristoteles und Kant zur Ermittlung ih­
rer Kategorienlisten bzw. –tafeln benutzen, als auch die ermittelten Kategorienkataloge selbst.
Überhaupt hält er es nicht für möglich, eine kurze Liste von zehn, zwölf oder auch hundert Kate­
gorien anzugeben, die Anspruch auf Abgeschlossenheit und Vollständigkeit erheben könnte. Ka­
tegorienverschiedenheit wird nicht ein für alle Male festgelegt, sondern von Fall zu Fall durch die
sprachlichen Ersetzungsproben ermittelt. Gerade bei philosophischen Aussagen wird häufig nicht
offensichtlich sein, ob ein Kategorienfehler vorliegt. Um einsichtig zu machen, daß eine philoso­
phische Lehre auf Kategorienfehlern beruht, muß eine Vielzahl von Formulierungen gründlich
untersucht werden. – Ryle hatte in Categories eine theoretische Definition des Kategorienfehlers
vorgeschlagen, die viel zu wünschen übrigläßt [...] Das scheint ihn nicht sonderlich beunruhigt
zu haben. An der Suche nach einer hieb- und stichfesten Definition hat er sich nicht beteiligt. In
The Concept of Mind genügt es ihm, mit Beispielen deutlich zu machen, was für Fehler er aufs
Korn nehmen will, und durch anschauliche Metaphern seine Arbeitsweise zu beschreiben. Die
Methode der Kategorienfehler gewinnt in Ryles philosophischer Praxis auch dadurch an Stärke,
daß stets mehrere Ersetzungsproben durchgeführt werden. In Dilemmas wird an die Sprechweise
von Kategorien noch bescheidener angeknüpft. Die Rede von Kategorien sei kein philosophischer
Universalschlüssel, aber sie könne helfen, philosophische Rätsel unter einem fruchtbaren Blick­
winkel anzugehen und uns auf die richtigen Fragen zu stoßen. – In den späteren Arbeiten, die die
Theorie der Kategorienfehler auf philosophische Rätsel anwenden, wird besonders deutlich, wa­
rum Ryle die Bezeichnung ‘Analyse von Begriffen’ für seine Vorgehensweise wenig hilfreich fand.
Der Terminus ‘Analyse’ kann fälschlich nahelegen, der Philosoph nähme sich schön der Reihe
nach einzelne Begriffe vor und zergliederte sie auf irgendeine Weise. Aber erstens betreffen philo­
sophische Fragen nicht einzelne Begriffe für sich genommen, sondern – bildlich gesprochen – Be­
griffsknäuel. Und zweitens zwingt die Behandlung eines philosophischen Problems in aller Regel
dazu, zu einer Reihe anderer philosophischer Fragen Stellung zu nehmen. Will man die Rätsel von
Freiheit und Determinismus lösen, so zergliedert man nicht einen Begriff, z. B. ‘Freiheit’, sondern
man versucht, eine Übersicht über die logischen Zusammenhänge solcher Begriffe wie ‘Freiheit’,
‘Zwang’, ‘Notwendigkeit’, ‘Verursachung’, ‘Wille’, ‘Verantwortung’, ‘Schuld’ etc. in ihren vielfälti­
gen Verwendungen zu gewinnen. Viele Verwirrungen entstehen erst dadurch, daß man mehrere
von ihnen in einem Atemzug verwendet. Und man kann nicht umhin, gewisse handlungstheoreti­
sche, ethische u. a. Annahmen ins Spiel zu bringen. Die Arbeit des Philosophen am Begriff ähnelt
auch nicht der des Kochs, der einen Hasen zerlegt (noch der des Chemikers, der ein Stoffgemisch
in seine Bestandteile zerlegt, nachdem er es von verunreinigten Beimengungen befreit hat). Ryle
untersucht vielmehr, mit welchen komplizierten Techniken unterschiedlich vorbereitete Zutaten
59
Modul Philosophie
zu Hasenpfeffer verbunden werden müssen, damit im Gefolge der übrigen Gänge ein wirkliches
Jagdmenü entsteht. Weniger bildlich gesprochen: Er untersucht die Rolle von Begriffswörtern
(und Adverbien etc.) in verschiedenen sprachlichen Kontexten, ihre Zusammenhänge mit ande­
ren Aussagen, und achtet insbesondere darauf, in welchen Fällen die Kombination der Begriffe zu
sprachlichem Unsinn führt. Ryle zieht aus den angedeuteten Gründen der Redeweise von ‘Analy­
se’ andere Bilder vor; am liebsten spricht er von ‘logischer Geographie’.
In seinem Hauptwerk The Concept of Mind versucht Ryle durch gründliche systematische Unter­
suchungen der normalen Sprache die ›logische Geographie‹ des Vokabulars für das geistige oder
seelische Leben von Personen im Gegenzug gegen philosophische Fehldeutungen zurechtzurü­
cken. Die traditionelle, herrschende Lehre des Dualismus von Körper und Geist (bzw. Leib und
Seele) beruht auf einem Kategorienfehler. Das ›Dogma vom Gespenst in der Maschine‹, wie Ryle
den Substanzdualismus polemisch nennt, beinhaltet unter anderem die folgenden Vorstellungen:
Jede Person setzt sich aus Körper und Geist zusammen, während Tiere und Menschen bloße
Körper sind. Der Körper ist der Naturkausalität unterworfen, der Geist nicht. Den Körper können
alle wahrnehmen, den Geist nimmt nur der Geist wahr. Der Geist denkt, will, fühlt und so weiter;
der Körper tut, was mechanisch dazu paßt, vom Geist gesteuert. Der Geist braucht nicht mit
dem Körper unterzugehen. Einige Empörung hat Ryle dadurch ausgelöst, daß er das geschilderte
Dogma zusätzlich mit dem Etikett ‘Descartes’ Mythos’ bedachte. Freilich ging es ihm darum, eine
bestimmte philosophische Vorstellung vom Geist ad absurdum zu führen, die Gemeingut ist (oder
war) und die in mehr oder minder gebildeten Kreisen häufig mit dem Namen René Descartes
(1596–1650) verknüpft ist. Ob sich in Descartes’ Werken alle diese Behauptungen finden lassen,
ob Mißverständnisse und Popularisierungen geschehen mußten, damit aus der cartesischen Leh­
re (gemeinschaftlich mit vielfältigen anderen Einflüssen) die von Ryle attackierte Auffassung ent­
stehen konnte, dies sind in höchstem Maße untersuchenswerte Fragen. Nur muß Ryle nicht auf
sie eingehen, um sein Ziel zu erreichen: eine äußerst verbreitete und wirksame Vorstellung vom
menschlichen Geist zu widerlegen. – Dem großen Kategorienfehler, über den Geist so zu reden,
als sei er ein ›Gespenst in der Maschine‹, leisten eine Reihe ›kleiner‹ Kategorienverwechslungen
Vorschub. Die grundlegendste besteht in der Verwechslung von Dispositionen auf der einen und
Ereignissen, Handlungen, Vorgängen auf der anderen Seite. Obwohl man in der Schule lernt, Ver­
ben seien Tätigkeitswörter, bezeichnen offenbar nicht alle Verben Tätigkeiten, Handlungen oder
auch nur Vorgänge oder Ereignisse. Dies sieht man schon an Wörtern wie ‘besitzen’, ‘ähneln’ und
dergleichen. In unserem alltagspsychologischen Vokabular beziehen sich einige Verben auf – wie
man etwas irreführend sagen könnte – geistige Handlungen oder Vorgänge, z. B. ‘sich etwas ins
Gedächtnis rufen’, ‘angestrengt nachdenken’. Auf keinen Fall darf man diese Beobachtung da­
hingehend übertreiben, alle Verben (Adverbien usw.) aus unserem Wortschatz für das Geistige
stünden für geistige Handlungen, Vorgänge, Ereignisse, also auch ‘glauben’, ‘wissen’, ‘anstreben’,
‘verachten’, usw. Ein großer Teil der ›psychologischen Verben‹ sind Dispositionswörter und nicht
Ereigniswörter. – Mit Dispositionswörtern, die natürlich nicht nur im Wortschatz für Mentales
vorkommen, wird einzelnen Gegenständen die Eigenschaft zugeschrieben, unter bestimmten Be­
dingungen sich auf eine charakteristische Weise zu verhalten. Sagt man von einem Kamm zu
Recht, er sei zerbrechlich, so heißt das u. a., daß er zerbrechen wird, wenn man ihn stark biegt.
Bezeichnet man jemanden als Raucher, so will man sagen, daß er regelmäßig raucht, eine Ziga­
rette, Zigarre o. ä. nicht immer ausschlägt, wenn ihm eine angeboten wird und dergleichen mehr.
Manche Dispositionen manifestieren sich (im wesentlichen) immer auf dieselbe Weise (einspuri­
ge Dispositionen), andere können sich auf viele verschiedene Weisen manifestieren. Stets ist je­
doch die Disposition von den sie manifestierenden Ereignissen und überhaupt von Ereignissen zu
unterscheiden. Behandelt man hingegen Dispositionswörter wie Wörter für Ereignisse, so begeht
man einen Kategorienfehler. – Ein beträchtlicher Teil der Wörter in unserem Wortschatz für das
geistige Leben von Personen sind Dispositionswörter. Sie bezeichnen Neigungen, Fertigkeiten,
Fähigkeiten und dergleichen, aber nicht Episoden im Geist. Die Unterschiede zwischen Wörtern
für Dispositionen und Wörtern für Episoden zeigen sich sprachlich. Vor allem gewisse zeitliche
Modifikationen ergeben meist nur mit Ausdrücken der einen Gruppe Sinn. ‘Er war gerade damit
beschäftigt, die Lottozahlen zu wissen’ ist genauso unsinnig wie ‘Er war gerade damit beschäftigt,
sein Fahrrad zu besitzen’; denn weder ‘besitzen’ noch ‘wissen’ stehen für Episoden. Die Verwech­
selung der Kategorie der Dispositionen mit der der Ereignisse kann auf verschiedene Weise die
Vorstellung vom ›Gespenst in der Maschine‹ fördern. Da manche Wörter sowohl für Ereignisse
60
Modul Philosophie
als auch für Dispositionen gebraucht werden, ist nicht immer leicht zu sehen, wofür sie jeweils
benutzt werden. Und oft gibt es Umformulierungen, die ein Mißverständnis begünstigen. Mit
‘Hans handelt mit Überlegung’ schreibt man Hans in aller Regel eine Disposition zu. Aber ‘über­
legen’ kann auch episodisch verwendet werden, z. B. in ‘Psst, Hans überlegt’; und die Disposition
beschreibt man oft mit den Worten: ‘Hans überlegt, bevor er etwas tut’. Diese Umstände können
die Fehldeutung veranlassen, jeder Mensch, der mit Überlegung handelte, täte zweierlei: erst das
Überlegen und dann aufgrund dessen die Handlung. Andere Dispositionswörter verleiten zu ähn­
lichen Verdoppelungen. Ein weiteres Mißverständnis: Da Überlegen, Beabsichtigen u. ä. in der
Regel keine Vorgänge sind, kann man natürlich auch keine solchen Vorgänge entdecken. Hält
man an dem Glauben fest, es müsse solche Vorgänge geben, so kommt man auf den Gedanken,
sie müßten unsichtbar sein – geistige Vorgänge im Inneren, die man nicht sehen kann. – Die Ver­
wechselung von Dispositionen und Ereignissen ist nicht der einzige sprachlich bedingte Fehler,
der zum Dualismus verleiten kann. Bei Verben ist weiterhin der Unterschied zwischen Erfolgsver­
ben (bzw. Mißerfolgsverben) und Unternehmensverben zu beachten. Erfolgswörter wie ‘treffen’
(= ‘erfolgreich schießen’), ‘finden’ (= ‘erfolgreich suchen’) usw. drücken aus, daß eine Tätigkeit
mit Erfolg abgeschlossen worden ist (oft gibt es entsprechende Mißerfolgswörter: zu ‘treffen’
etwa ‘verfehlen’). Wie bei den Paaren aus Dispositionswort und Ereigniswort (z. B. ‘sich beeilen’
– ‘laufen’) kann bei den Paaren aus Erfolgswort und Unternehmenswort (z. B. ‘treffen’ – ‘schie­
ßen’) der falsche Eindruck aufkommen, es handele sich um jeweils zwei Vorgänge. Aber: Wer sich
beeilt und läuft, tut nur eines auf bestimmte Weise – er läuft eilig. Und wer schießt und trifft,
hat auch nicht zweierlei getan, sondern eines mit Erfolg. – Das kognitive Vokabular enthält eine
große Anzahl von Erfolgswörtern (und Paaren aus Erfolgs- und Unternehmenswort). Zunächst
‘erkennen’; ferner: ‘wissen’, ‘hören’ etc.. Der kategoriale Unterschied kann wiederum durch eine
Reihe von Ersetzungsproben festgestellt werden; in diesem Falle am leichtesten durch die Variati­
on von Adverbien. Die zum Erfolgsverb passenden adverbialen Bestimmungen passen nicht zum
Unternehmensverb und umgekehrt: ‘endgültig beweisen’ – ‘erfolglos argumentieren’, ‘sich klar
erinnern’ – ‘sich vergeblich besinnen’, usw. Aus den Verwendungsregeln für Erfolgswörter können
abwegige Folgerungen gezogen werden, die dem Dualismus Vorschub leisten, z. B. daß die eigent­
lichen Akte des Sehens, Wahrnehmens, Wissens, Sicherinnerns usw. unfehlbar sein müßten, da
sie ja nicht erfolglos sein können. Analytische Aussagen wie ‘Man kann nichts Falsches wissen’
werden als inhaltliche Einsichten über besondere geistige Akte mißverstanden.
Aus: M. Dascal, D. Gerhardus, K. Lorenz, G. Meggle (Hg.): Sprachphilosophie. Ein internatio­na­les Hand­
buch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1. Berlin, New York: de Gruyter 1992, S. 859–872 (Auszug).
F ragen
1. Was sind ‚normale Sprachen’ im Sinne der ordinary language philosophy? Welche Sprachen werden in der ordinary language philosophy nicht berücksichtigt?
2. Ryle hatte ein besonderes Interesse für die philosophische Methodologie. Erläutern Sie dies.
3. Welche Einstellung hatte Ryle dem Psychologismus und dem Platonismus gegenüber? Was führte
ihn zu dieser Auffassung?
4. Lässt sich Ryles Aufsatz Systematically Misleading Expressions bereits eindeutig der ordinary language
philosophy zuordnen?
5. Inwiefern ließe sich der Ansatz von Ryles Aufsatz Categories als ‚sprachtherapeutisch’ charakterisieren?
6. „Ryle hatte in Categories eine theoretische Definition des Kategorienfehlers vorgeschlagen, die viel
zu wünschen übrigläßt“. – Paraphrasieren Sie den Relativsatz.
7. Warum distanziert sich Ryle von der Behauptung, er betreibe Begriffsanalyse? Inwiefern ist sein
Anspruch bescheidener?
8. Beschreiben Sie, auf welche Weise Ryle den traditionellen Dualismus von Körper und Geist kritisiert.
9. Nach Ryle verleitet auch die traditionelle Wortartenlehre zu Fehlschlüssen. Erläutern Sie dies.
10.Was versteht Ryle unter ‚Dispositionswörtern’? Inwiefern ist auch hier die Gefahr von Fehlschlüssen gegeben?
61
Modul Philosophie
3. Ausblick: Sprache und Kulturwissenschaft
Im Vorwort zu dem Sammelband Der Paradigmenwechsel in der Sprachphilosophie (Darmstadt WBG
1996, S. 4) überblickt Edmund Braun die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung der letzten
Jahrzehnte und kommt zu einem eindeutigen Befund: „Sprache ist seit dem Beginn unseres Jahrhunderts zu einem zentralen Leitthema, wenn nicht sogar zu dem zentralen Thema der Philosophie und Wissenschaft überhaupt geworden“. Der linguistic turn zu Beginn des 20. Jahrhunderts
erreichte, dass eine Konzentration auf die Sprache, ihre Beschaffenheit, ihr Ausdrucksvermögen
und ihre Regularien zur grundlegenden Agenda jeder ernstzunehmenden wissenschaftlichen Beschäftigung wurden. Das gilt auch heute noch und das ist bemerkenswert, da inzwischen ein
weiterer Paradigmenwechsel stattgefunden hat, der als cultural turn bezeichnet wird.
Wir haben in diesem Reader zu zeigen versucht, dass sprachphilosophische Überlegungen die
Menschen von ihren kulturellen Anfängen an umtrieben. Die Leistungen von der Antike über
die Aufklärung und das 19. Jahrhundert wurdfen ausreichend gewürdigt, aber der linguistic turn
gewinnt eben dadurch gegenüber diesen sprachphilosophischen Ansätzen eine höhere Wertigkeit, dass er die Sprache unwiderruflich als Grundlage des philosophischen und wissenschaftlichen Denkens festschrieb. Das gilt auch dann, wenn einige postmoderne Ansätze versuchen,
diese feste Verankerung der Wissenschaften in der Sprache zu erschüttern.
Durch die Weiterführung des linguistic turn im cultural turn kam es zu Verschmelzungen zwischen
sprachwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen, sowie zwischen sprachphilosophischen
und kulturtheoretischen Modellen und Denkweisen. Vielfach wurde der Sprachwissenschaft gerade eine ausgleichende oder modellhafte Wirkung bei diesen neuen Verschmelzungsprozessen
zugeschrieben (vgl. Ludwig Jäger: Linguistik als transdisziplinäres Projekt. In: Böhme/Schärpe
(Hrsg.): Literatur- und Kulturwissenschaften. Rowohlt Reinbek 1996, S. 300–319). Dies kann
hier nicht mehr im Detail nachgezeichnet werden, muß einer eigenen Publikation vorbehalten
bleiben. Allerdings sollte anhand eines Textes wenigstens präsentiert werden, inwieweit sich linguistische, sprachphilosophische, erkenntnistheoretische und kulturwissenschaftliche Theoreme
in aktuellen Wissenschaftstexten überlappen. Da dieser Text als Ausblick verstanden wird, wurden keine textbezogenen Fragen mehr formuliert. Es genügt, die im Text verwendeten wissenschaftlichen Termini herauszusuchen und über Wikipedia oder eine wisenschaftliche Enzyklopädie herauszufinden, welchem wissenschaftlichen Kontext sie entstammen.
Der folgende Text von Claudia Fahrenwald entwickelt die neue kulturtheoretische Denkweise
anhand der Interpretation des Spätwerks Wittgensteins durch den französischen Philosophen
Lyotard (1924–1998). Wittgenstein erweitete den im Tractatus besprochenen logischen Sprachgebrauch der analytischen Philosophie zu einer Betrachtung der Aussageweisen der alltäglichen
Sprache. Wittgenstein führt dafür den Begriff „Sprachspiele“ ein, worunter er linguistische Aktionen oder sprachliche Tätigkeiten versteht, die nach festen Regeln und Definitionen ablaufen
(z.B. die Frage und Antwort Struktur eines Interviews, das Bestellen im Lokal oder das Bitten
um etwas). In seinem Werk kulminiert also die Auseinandersetzung zwischen Philosophie der
Idealsprache und Philosophie der Normalsprache.
Text 16
Claudia Fahrenwald: Vom Ende der großen Erzählungen
Der Beginn einer Veränderung im kulturellen Bewusstsein wird allgemein mit der Beschleuni­
gung der technologischen Entwicklung in den achtziger Jahren verbunden. Wohl nicht zufällig
beginnt die literarische Postmoderne nach dem Zweiten Weltkrieg auch in dem Land, das in seiner
Entwicklung am frühesten von der postindustriellen Revolution geprägt wurde – in den USA. Als
das Initialwerk der philosophischen Postmoderne gilt Jean François Lyotards Text Das postmoderne Wissen. In diesem Text versucht Lyotard, den strukturellen gesellschaftlichen Wandel zu
beschreiben, der mit der Transformation der Industriegesellschaften in Informationsgesellschaf­
ten einhergeht. Dabei rekurriert er auf das Konzept des Sprachspiels aus dem Spätwerk Ludwig
62
Modul Philosophie
Wittgensteins, das er als ein Kommunikationsmodell begreift, welches sowohl die Notwendigkeit
von Regeln als auch die Möglichkeit der Flexibilität impliziert. Von diesem zentralen Begriff aus­
gehend lassen sich, in Anlehnung an die Argumentation Lyotards und über den Erklärungszu­
sammenhang seiner Schrift hinausgehend, entscheidende Bruchstellen im Philosophieren Witt­
gensteins als Bruchstellen zwischen Moderne und Postmoderne verstehen. Im Gegensatz zur
traditionellen Wittgenstein-Forschung, die lange Zeit einen Zusammenhang zwischen seinem
frühen und seinem späteren Philosophieren verneinte, eröffnet sich mit dieser These ein neues
und ganzheitliches Lektüremodell des Gesamtwerks, das mit einer Akzentverschiebung von der
Logik zur Ästhetik einhergeht.
Ausgangspunkt für Lyotards Untersuchung stellt die Hypothese dar, dass wir mit unseren tradi­
tionellen Theorien die aktuellen Entwicklungen nicht mehr adäquat erfassen können. Notwendig
erscheint daher eine umfassende Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Formen des Wissens, die
Lyotard mit den traditionellen Formen des Wissens kontrastiert. Das traditionelle vormoderne
Wissen zeichnet sich dabei als grundsätzlich narrativ in seiner Pragmatik aus: Die Maßstäbe,
Grundwerte und Zielvorstellungen einer Gesellschaft werden in Erzählungen formuliert. Dieser
narrative Aufbau des kollektiven Gedächtnisses ermöglicht die Koexistenz ganz unterschiedli­
cher Sprachspiele (Beschreibungen, Fragen, Werturteile), aus denen sich mosaikartig ein multiperspektivisches (mythisches oder religiöses) Gesamtpanorama einer Epoche zusammensetzt.
Mit dem Beginn der Neuzeit entsteht nach Lyotard eine neue Form des Wissens, die von einer
wissenschaftlichen Signatur geprägt ist und mit dem narrativen Paradigma von Anfang an in Kon­
flikt steht. Dabei verschiebt die zunehmende Ausdifferenzierung des wissenschaftlichen Wissens
die kulturelle Norm für den Wahrheitsbegriff und führt langsam zu einer umfassenden „Krise
der Erzählungen“. Das Programm einer theoretisch-wissenschaftlichen Erfassung der Welt erfor­
dert die systematische Ausarbeitung des begrifflichen Wissens und fördert die Dominanz eines
bestimmten Typs von Sprachspiel: das der eindeutig beschreibenden und ihrer Intention nach
wahren Sätze. Dieses Sprachspiel beruht auf dem Prinzip von Verifikation und Falsifikation und
funktioniert grundsätzlich nur im „Horizont des Konsens“, ist durch Widerspruch und Dissens
also tendenziell in seiner Kohärenz bedroht. Die Legitimation des modernen Wahrheitsbegriffs
erfolgt daher hauptsächlich selbstreferentiell, das heißt, sie leitet sich systemintern aus den
Sprachregeln des Spieles selbst ab. In dieser allgemeinen Disposition der Modernität, die Bedin­
gungen eines Diskurses in einem Diskurs über diese Bedingungen zu definieren, liegt bereits die
Aporie der Moderne verborgen.
Historisch betrachtet führt diese neue Form des Wissens jedoch zunächst zur Entstehung einer
neuen Art von Erzählungen: den sogenannten méta-récits, den großen metaphysischen Entwür­
fen der Neuzeit und Moderne (wie zum Beispiel die Aufklärung und ihr Glaube an die Emanzi­
pation der Menschheit mit Hilfe von Wissenschaft und Vernunft im 18. Jahrhundert oder die
Geschichtsphilosophie und ihre Suche nach einer Hermeneutik des Sinns im 19. Jahrhundert).
Den umfassenden Geltungsanspruch dieser Universalentwürfe beschreibt Lyotard in einem Re­
kurs auf das humanistische Bildungsideal Wilhelm von Humboldts als ein dreifaches Prinzip der
extremen Vereinheitlichung: „einmal alles aus einem ursprünglichen Prinzip abzuleiten“, „fer­
ner alles einem Ideal zuzubilden“ und schließlich „jenes Prinzip und dies Ideal in Eine Idee zu
verknüpfen“. Diese lineare Perspektive der Moderne entwickelte eine unerbittliche Dynamik des
Fortschritts und verlagerte den kollektiven Erwartungshorizont immer weiter in die Zukunft.
Die permanente Entwertung der Gegenwart endete in ihrer radikalsten Konsequenz in einem
offenen Nihilismus.
Die Postmoderne beginnt mit einer Einsicht in den latent despotischen Charakter des moder­
nen Rationalismus. Das Scheitern der großen Utopien im 20. Jahrhundert stürzt den rationalen
Diskurs in eine Legitimationskrise und setzt einen riesigen Prozess des Sinnverlustes in Gang.
Mit dem Zerfall der sinnstiftenden großen Erzählungen erfolgt der Eintritt in die postmoderne
Situation: „in äußerster Vereinfachung kann man sagen: Postmoderne bedeutet, dass man den
Meta-Erzählungen keinen Glauben mehr schenkt“. Fortan gilt es, den Dissens als eine Diskursva­
riable zu akzeptieren.
Im Rekurs auf dieses Analysemodell kann Wittgensteins Tractatus als die Vollendung der neuzeit­
lichen Rationalisierungstendenz in der Philosophie angesehen werden. Wittgenstein thematisiert
unter den Prämissen der Moderne eine alte philosophische Fragestellung: Wie korrespondiert
63
Modul Philosophie
unser Denken mit der Wirklichkeit? Diese Frage erhebt zwangsläufig die Sprache zum zentralen
Reflexionsgegenstand und leitet den linguistic turn des 20. Jahrhunderts ein. Die Antwort des
Tractatus steht in erkenntnisoptimistischer, abendländischer Tradition und vollendet das Spra­
chideal seit der Aufklärung: Sprache, Denken und Welt stehen in einer abbildenden Beziehung
zueinander. Der im Satz ausgesprochene Gedanke gibt ein Bild der Wirklichkeit wieder.
Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit.
Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken (Tractatus 4.01)
Dieses Sprachmodell knüpft im Prinzip an eine Repräsentationslehre der Sprache an, wie sie be­
reits bei Augustinus formuliert ist und versucht, diese auf einer dem 20. Jahrhundert angemesse­
nen Grundlage neu zu legitimieren.
Aus: Claudia Fahrenwald: Aporien der Sprache. Ludwig Wittgenstein und die Literatur der Moderne.
Wien: Passagen 2000, S. 18–21.
Abschlussfrage zum gesamten Reader
In seinem Text zur (modernen) Sprachphilosophie (Text 1) formuliert Haag die These: „Systematische Philosophie ohne Einbeziehung sprachphilosophischer Fragestellungen ist heute kaum
noch denkbar.“ – Erläutern Sie diese These im Hinblick auf die Texte und Darstellungen dieses
Readers.
64
Bibliografie zu Texten 1–16
Dascal, M. / Gerhardus, D. / Lorenz, K. / Meggle, G. (Hg.): Sprachphilosophie. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1. Berlin, New York: de Gruyter 1992.
Fahrenwald, Claudia: Aporien der Sprache. Ludwig Wittgenstein und die Literatur der Moderne. Wien:
Passagen 2000
Fischer, Eugen / Vossenkuhl, Wilhelm (Hg.): Die Fragen der Philosophie. Eine Einführung in Disziplinen
und Epochen. München: Beck 2003.
Frege, Gottlob: Funktion, Begriff, Bedeutung. Hrsg. von Günther Patzig. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht JAHR.
Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. Band 2. Frankfurt/Main: Zweitausendeins 2001.
Huizinga, Johann: Herbst des Mittealters. Stuttgart: Kröner 1975.
Humboldt, Wilhelm von: Gesammelte Werke. Band 3. Berlin: Reimer 1843.
Martens, Ekkehard / Schnädelbach, Herbert (Hg.): Philosophie. Ein Grundkurs. Band 1. Reinbek: Rowohlt 1991.
Nietzsche, Friedrich: Ueber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Kritische Studienausgabe.
Band 1. Berlin: de Gruyter 1988.
Platon: Sämtliche Werke in drei Bänden. Band 1. Hrsg. von Erich Loewenthal. Unveränderter Nachdruck
der 8., durchgesehenen Auflage der Berliner Ausgabe von 1940. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004.
Stöhr, Adolf: Psychologie. Wien: Braumüller 1917.
Trabant, Jürgen: Was ist Sprache? München: Beck 2008.
Tugendhat, Ernst / Wolf, Ursula: Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart: Reclam 1983.
Villers, Jürgen: Kant und das Problem der Sprache. Die historischen und systematischen Gründe für die
Sprachlosigkeit der Transzendentalphilosophie. Konstanz: Verlag am Hockgraben 1997.
Wittgenstein, Ludwig: Tractatus-logico philosophicus. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1990.
Vzniklo v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0320 řešeného na Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity
Palackého. Sazba a grafická úprava: Jaromír Czmero; grafická úprava obálky: Veronika Opletalová, s použitím fotografií
Jiřího Kolomazníka a Jana Lachnita, s laskavým souhlasem Arcibiskupství olomouckého. Olomouc 2013.