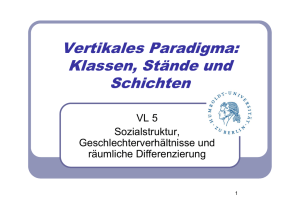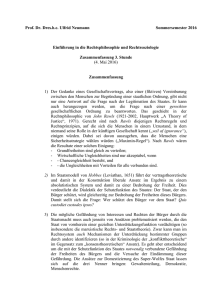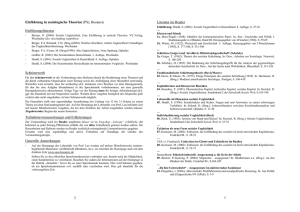Peter A. Berger1 Soziale Unterschiede auf hohem Niveau
Werbung
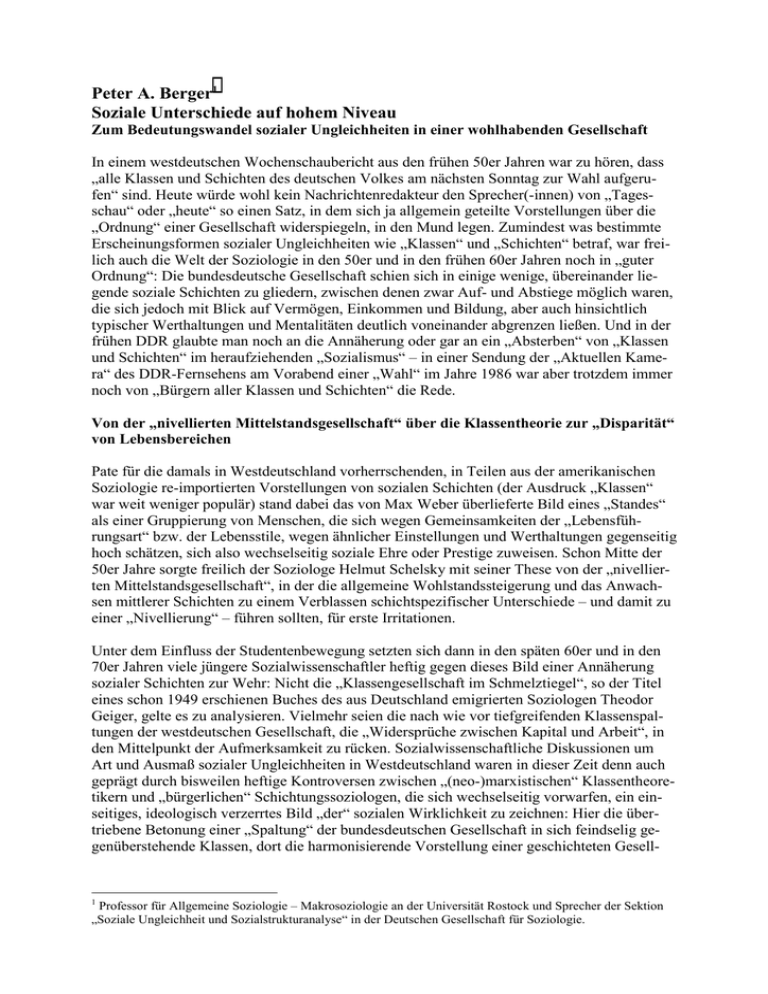
Peter A. Berger1 Soziale Unterschiede auf hohem Niveau Zum Bedeutungswandel sozialer Ungleichheiten in einer wohlhabenden Gesellschaft In einem westdeutschen Wochenschaubericht aus den frühen 50er Jahren war zu hören, dass „alle Klassen und Schichten des deutschen Volkes am nächsten Sonntag zur Wahl aufgerufen“ sind. Heute würde wohl kein Nachrichtenredakteur den Sprecher(-innen) von „Tagesschau“ oder „heute“ so einen Satz, in dem sich ja allgemein geteilte Vorstellungen über die „Ordnung“ einer Gesellschaft widerspiegeln, in den Mund legen. Zumindest was bestimmte Erscheinungsformen sozialer Ungleichheiten wie „Klassen“ und „Schichten“ betraf, war freilich auch die Welt der Soziologie in den 50er und in den frühen 60er Jahren noch in „guter Ordnung“: Die bundesdeutsche Gesellschaft schien sich in einige wenige, übereinander liegende soziale Schichten zu gliedern, zwischen denen zwar Auf- und Abstiege möglich waren, die sich jedoch mit Blick auf Vermögen, Einkommen und Bildung, aber auch hinsichtlich typischer Werthaltungen und Mentalitäten deutlich voneinander abgrenzen ließen. Und in der frühen DDR glaubte man noch an die Annäherung oder gar an ein „Absterben“ von „Klassen und Schichten“ im heraufziehenden „Sozialismus“ – in einer Sendung der „Aktuellen Kamera“ des DDR-Fernsehens am Vorabend einer „Wahl“ im Jahre 1986 war aber trotzdem immer noch von „Bürgern aller Klassen und Schichten“ die Rede. Von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ über die Klassentheorie zur „Disparität“ von Lebensbereichen Pate für die damals in Westdeutschland vorherrschenden, in Teilen aus der amerikanischen Soziologie re-importierten Vorstellungen von sozialen Schichten (der Ausdruck „Klassen“ war weit weniger populär) stand dabei das von Max Weber überlieferte Bild eines „Standes“ als einer Gruppierung von Menschen, die sich wegen Gemeinsamkeiten der „Lebensführungsart“ bzw. der Lebensstile, wegen ähnlicher Einstellungen und Werthaltungen gegenseitig hoch schätzen, sich also wechselseitig soziale Ehre oder Prestige zuweisen. Schon Mitte der 50er Jahre sorgte freilich der Soziologe Helmut Schelsky mit seiner These von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“, in der die allgemeine Wohlstandssteigerung und das Anwachsen mittlerer Schichten zu einem Verblassen schichtspezifischer Unterschiede – und damit zu einer „Nivellierung“ – führen sollten, für erste Irritationen. Unter dem Einfluss der Studentenbewegung setzten sich dann in den späten 60er und in den 70er Jahren viele jüngere Sozialwissenschaftler heftig gegen dieses Bild einer Annäherung sozialer Schichten zur Wehr: Nicht die „Klassengesellschaft im Schmelztiegel“, so der Titel eines schon 1949 erschienen Buches des aus Deutschland emigrierten Soziologen Theodor Geiger, gelte es zu analysieren. Vielmehr seien die nach wie vor tiefgreifenden Klassenspaltungen der westdeutschen Gesellschaft, die „Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit“, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken. Sozialwissenschaftliche Diskussionen um Art und Ausmaß sozialer Ungleichheiten in Westdeutschland waren in dieser Zeit denn auch geprägt durch bisweilen heftige Kontroversen zwischen „(neo-)marxistischen“ Klassentheoretikern und „bürgerlichen“ Schichtungssoziologen, die sich wechselseitig vorwarfen, ein einseitiges, ideologisch verzerrtes Bild „der“ sozialen Wirklichkeit zu zeichnen: Hier die übertriebene Betonung einer „Spaltung“ der bundesdeutschen Gesellschaft in sich feindselig gegenüberstehende Klassen, dort die harmonisierende Vorstellung einer geschichteten Gesell- 1 Professor für Allgemeine Soziologie – Makrosoziologie an der Universität Rostock und Sprecher der Sektion „Soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse“ in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Peter A. Berger: Soziale Unterschiede auf hohem Niveau 2 schaft, in der sich die Lebensbedingungen zwischen den Schichten nicht fundamental, sondern nur noch graduell unterscheiden. Übersehen wurde in diesen Auseinandersetzungen zunächst, dass (spät-)marxistische Klassentheorien und nicht-marxistische Schichtungskonzepte sich spätestens dann annäherten, wenn es um die empirische Erfassung und Beschreibung von Ungleichheitsmustern ging: In einer stillschweigenden Koalition stand nämlich auf beiden Seiten meist die sog. „meritokratische Triade“ aus Bildung, Beruf (bzw. beruflicher Stellung) und Einkommenschancen im Zentrum – ein Mechanismus der leistungsgesellschaftlichen Statuszuteilung und Legitimation sozialer Ungleichheiten, der als typisch für „offene“, westliche Gesellschaften gelten kann, dessen Wirksamkeit und Reichweite aber in jüngster Zeit vor allem von Sighard Neckel bezweifelt wird. Und auch in den vielfältigen Untersuchungen zu Klassenstrukturen, sozialer Ungleichheit und sozialer Mobilität in Westdeutschland (z.B. von Karl-Ulrich Mayer, Walter Müller und Johann Handl), die sich von einem neo-marxistischen Klassenbegriff abwandten und u.a. unter dem Einfluss des englischen Soziologen Anthony Giddens mehr oder weniger explizit auf den von Max Weber vorgeschlagenen Begriff der durch die „Marktgängigkeit von Gütern und Leistungen“ bestimmten „Erwerbsklassen“ zurückgriffen, konzentrierte man sich in der Regel auf die sog. „Bezahlte-Arbeit-Gesellschaft“ (Reinhard Kreckel). Die Ungleichheitsforschung lief damit jedoch Gefahr, ihren Blickwinkel auf jene rund 50 Prozent der westdeutschen Bevölkerung zu verengen, deren Lebenslagen unmittelbar und hauptsächlich von Art und Höhe ihres Erwerbseinkommens beeinflusst werden; die anderen 50 Prozent sind je etwa zur Hälfte von privaten Versorgungsleistungen (z.B. von Eltern an ihre Kinder oder von Ehepartnern untereinander) oder von sozialstaatlichen Transfers (wie z.B. Bafög, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Renten u.a.m.) abhängig. Auf die wachsende Bedeutung staatlicher (Um-)Verteilungsmaßnahmen für die „Disparität“ von Lebensbereichen – und damit für die Muster sozialer Ungleichheiten – hatten freilich Claus Offe u.a. bereits Ende der 60er Jahre aufmerksam gemacht; und Rainer M. Lepsius hatte Ende der 70er Jahre dazu vorgeschlagen, sozialstaatlich erzeugte Lebenslagen unter dem Begriff „Versorgungsklassen“ zusammenzufassen und diese neuartigen Ungleichheiten in die von Max Weber stammende Begrifflichkeit von Besitz- und Erwerbsklassen einzubinden. „Individualisierung“: Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile In den 80er Jahren erschienen dann in relativ schneller Folge einige Sammelbände, Monographien und Aufsätze, die sich als stilbildend für weitere Debatten erweisen sollten: Herausgegeben von Reinhard Kreckel sorgte 1983 zunächst ein Sonderband der Sozialen Welt für Unruhe, sollte doch der Titel „Soziale Ungleichheiten“ signalisieren, dass jenseits der klassischen Konzepte von „quasi-ständischen“ Schichten und (Besitz- oder Erwerbs-)Klassen weitere, möglicherweise „neue“ Ungleichheiten an Bedeutung gewonnen haben. „Jenseits von Stand und Klasse?“, so lautete denn auch der Titel des Beitrages von Ulrich Beck zu diesem Band, in dem er erstmals die seither mit seinem Namen verbundene und in der deutschen Soziologie heiß diskutierte „Individualisierungsthese“ formulierte: Durch „Niveauverschiebungen (Wirtschaftsaufschwung, Bildungsexpansion usw.)“ würden „subkulturelle Klassenidentitäten zunehmend weggeschmolzen, ‘ständisch’ eingefärbte Klassenlagen enttraditionalisiert und Prozesse einer Diversifizierung und Individualisierung von Lebenslagen und Lebenswegen ausgelöst werden, die das Hierarchiemodell sozialer Klassen und Schichten unterlaufen und in seinem Realitätsgehalt zunehmend in Frage stellen“. Diese Niveauverschiebungen bei weitgehend konstanten Abständen zwischen Oben und Unten, für die Beck dann in seiner „Risikogesellschaft“ (1986) die prägnante Metapher vom „Fahrstuhlef- Peter A. Berger: Soziale Unterschiede auf hohem Niveau 3 fekt“ fand, führen, so eine der Folgerungen, „der Tendenz nach zur Auflösung ungleichheitsrelevanter (‘ständisch’ gefärbter, ‘klassenkultureller’) lebensweltlicher Gemeinsamkeiten“. Damit war ein erster – und bis heute umstrittener – Anstoß für eine Verlagerung der soziologischen Aufmerksamkeit weg von „klassischen“ Ungleichheitsdimensionen wie Bildung, Besitz, Einkommen, Macht und Prestige und hin zu „neuen“ sozialen Milieus und Lebensstilen gegeben. Im gleichen Band fand sich auch ein Plädoyer von Stefan Hradil für ein Modell „sozialer Lagen“, das er als eine „Alternative“ zur Schichtungssoziologie verstanden wissen wollte: Dabei geht es nicht mehr ausschließlich darum, wie sich bestimmte Ressourcen (etwa Bildung oder Einkommen) in der Bevölkerung verteilen, sondern darum, ob und in welchem Maße sich vielfältigste Vor- und Nachteile für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu sozialen Lagen bündeln (lassen). In seinem 1987 erschienenen Buch „Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft“ wurden soziale Ungleichheiten dann definiert als „gesellschaftlich hervorgebrachte, relative dauerhafte Lebensbedingungen, die es bestimmten Menschen besser und anderen schlechter erlauben, so zu handeln, dass allgemein anerkannte Lebensziele für sie in Erfüllung gehen“. Die damit angesprochenen Vorstellungen von einem „guten Leben“ beziehen sich freilich nicht allein auf die klassischen oder „alten“ Ungleichheitsdimensionen wie Bildung, Geld, Macht und Prestige, und auch eine Erweiterung um wohlfahrtsstaatlich erzeugte Ungleichheiten reicht hier nicht mehr aus. Vielmehr treten nun, so Hradil, „neue“ Ungleichheiten wie z.B. Freizeit- und Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen, ungleiche Behandlungen (z.B. Diskriminierungen) u.a.m. hinzu – und altbekannte Ungleichheiten der „Zuschreibung“ (etwa entlang der Geschlechterdifferenz oder entlang ethnischer Zugehörigkeiten) werden spürbarer. Im Sinne eines „guten Lebens“ interessieren zugleich unterschiedliche Wertorientierungen und Handlungsmuster, über die Menschen verfügen (können). Unterschiede (und Ungleichheiten) zwischen sozialen Milieus und Lebensstilen also, die dann – u.a. angeregt durch die Arbeiten des im Frühjahr dieses Jahres verstorbenen, französischen Soziologen Pierre Bourdieu – im Laufe der 80er und 90er Jahre zunächst in West-, dann aber auch in Ostdeutschland intensiv erforscht wurden und zu breit rezipierten Gesellschaftsdiagnosen wie Gerhard Schulzes „Erlebnisgesellschaft“ oder Michael Vesters Studien zur Milieustruktur Deutschlands führten. Neben dieser gesteigerten Aufmerksamkeit für Lebenslagen und Lebensstile richtete sich schließlich im gleichen Zeitraum und im Rahmen der u.a. von Karl-Ulrich Mayer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung initiierten Lebenslaufforschung ein großer Teil des sozialwissenschaftlichen Interesses auf Risiken und Chancen, die mit verschiedenen Lebenslaufereignissen (wie z.B. Bildungsentscheidungen, Arbeitsmarkteintritt, Heirat, Geburt eines Kindes, Arbeitslosigkeit, Scheidung etc.) verknüpft sein können. Deutlich wurde dabei, welches Gewicht hier biographische „Fehlentscheidungen“ und die Ungleichheiten zwischen Generationen bzw. Kohorten haben können. Zudem können, wie vor allem die neuere Arbeitslosigkeits- und Armutsforschung gezeigt hat, viele Ungleichheiten durchaus „transitorischer“, also vorübergehender Art sein. Es handelt sich dann aber nicht mehr so sehr um ungleiche, aber dauerhafte Lebenslagen, sondern eher um „Ungleichheitsphasen“ und damit verbundene „Statusunsicherheiten“ (Peter A. Berger), aus denen sich nur mehr schwer ein wohlgeordnetes Gesamtbild übereinanderliegender Schichten oder einander entgegengesetzter Klassen gewinnen lässt. Um 1990 schienen sich damit neue Konturen der Ungleichheitsforschung abzuzeichnen, die Stefan Hradil und ich unter dem Titel „Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile“ in einem weiteren Sonderband der Sozialen Welt zu bündeln versuchten. Peter A. Berger: Soziale Unterschiede auf hohem Niveau 4 „Neue“ soziale Ungleichheiten Darüber, welche Dimensionen und Aspekte vor dem Hintergrund dieser Diskussionen in der westdeutschen Soziologie als die „klassischen“ oder „alten“ gelten sollen, besteht nun, jedenfalls so weit ich sehe, weitgehend Einigkeit: Neben „ökonomischen“ Ungleichheiten (Besitz, Einkommen) werden meist noch Bildung und berufliche Positionen, etwas seltener schon Prestige und Macht aufgeführt. Sehr viel unklarer ist jedoch, welche – und vor allem: wie viele – „neue“ Ungleichheiten es geben könnte: Sind wohlfahrtsstaatlich erzeugte oder „politisch regulierte“ Ungleichheiten (Rolf G. Heinze) „neu“, obwohl sie in ihren Mustern oftmals den durch den Arbeitsmarkt produzierten Ungleichheiten folgen (so ist ja die Höhe der Renten im deutschen Sozialversicherungssystem eng an die Höhe der Arbeitseinkommen gekoppelt). Sind sog. „Disparitäten“, die aus der unterschiedlichen Ausstattung von Gemeinden oder Regionen mit öffentlich (mit-)finanzierten Infrastruktureinrichtungen (z.B. Verkehrswege, Schulen, Freizeiteinrichtungen) entstehen können, „neu“ – oder sind sie lediglich Ausdruck „alter“ Machtverhältnisse, also abhängig von jenen wohlbekannten Mechanismen, die verantwortlich sind für ungleiche Zugangschancen zu politischen, wirtschaftlichen und anderen „Eliten“, die z.B. Investitionsentscheidungen treffen? Und was ist in diesem Zusammenhang mit den Ungleichheiten zwischen West- und Ostdeutschland, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Infrastrukturausstattung, die ja in Ostdeutschland mit milliardenschweren Investitionen langsam auf „Westniveau“ angehoben wird, sondern auch mit Blick auf die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West, die weiterhin und fast flächendeckend gegen den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ verstoßen? Ungünstige Arbeitsbedingungen, oftmals ebenfalls zu den „neuen“ Ungleichheiten gezählt, sind meist eng mit schlecht bezahlten und gering angesehenen Berufstätigkeiten verknüpft, was sich auch heute noch in ungleichen „Risiken vor Krankheit und Tod“ ausdrückt. Andererseits klagen aber auch gutbezahlte Topmanager oder Spitzenpolitiker über zu viel „Stress“ und zu wenig Freizeit. Damit kommen zugleich Ungleichheiten der Belastung durch unterschiedliche Arbeitszeiten in den Blick, wobei geringere Arbeitszeiten keineswegs durchgängig zu mehr Freizeit oder gar zu mehr „Spaß“ in der Freizeit führen. Dies gilt insbesondere für viele berufstätige und verheiratete Frauen, die oftmals nach wie vor – und wie es scheint in Ost und West gleichermaßen – zusätzliche Belastungen durch Arbeiten in Familie und Haushalt zu tragen haben. Gerade im Bereich von Familie und Haushalt zeichnen sich aber nun möglicherweise wirklich „neue“ Ungleichheiten ab: Nämlich die zwischen Familien mit Kindern, wobei Kinder in den unteren Einkommensbereichen mittlerweile als „Armutsrisiko“ gelten, und den sog. „dinks“ (double income – no kids); einige sozialwissenschaftliche Beobachter sprechen schon von einer drohenden „Polarisierung“ zwischen familienorientierten (Ehen bzw. Partnerschaften mit Kindern bzw. Alleinerziehende) und erwerbsorientierten Lebensformen (Paare ohne Kinder bzw. Alleinlebende/„Singles“). Dass der Geburtenrückgang in Deutschland Folgen für die Systeme der sozialen Sicherung haben wird, ist mittlerweile allgemein bekannt. Unklar ist aber, ob sich hier zugleich „neue“ Ungleichheiten zwischen den Generationen ausbilden, die möglicherweise verstärkt werden durch jene Ungleichheiten, die aus unterschiedlichen Chancen zur privaten Vermögensbildung und -vererbung resultieren. Und noch kaum unabsehbar ist, welche Konsequenzen die neuen gentechnischen Möglichkeiten für die Erzeugung dann im vollen Wortsinn „neuer“ Ungleichheiten (etwa durch eine vorgeburtliche „Selektion“ zwischen einer „guten“ oder „schlechten“ genetischen Ausstattung) haben könnten. Mit Blick auf Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern können vor allem jüngere Frauen als „Gewinnerinnen“ der in den 60er Jahren eingeleiteten Bildungsexpansion gelten – trotz Peter A. Berger: Soziale Unterschiede auf hohem Niveau 5 vieler fortbestehender Diskriminierungen in anderen Bereichen: „Alte“ geschlechtsspezifische Ungleichheiten der Zugangschancen sind im allgemeinbildenden Schulsystem so gut wie verschwunden – freilich setzen sich diese „Gewinne“ bislang noch nicht genügend im Abbau von Barrieren auf dem Arbeitsmarkt, in Privatunternehmen oder öffentlich finanzierten Organisationen fort. Ungleiche Bildungschancen finden sich aber, wie jüngst die PISA-Studien wieder eindrucksvoll gezeigt haben, zwischen den Kindern von Deutschen und Migranten und nach wie vor auch entlang verschiedener Stufen in der Hierarchie von Berufsgruppen: Weil (Kinder aus) Angestellten-, und Beamten- und Selbständigenfamilien ihre Bildungsanstrengungen erhöht haben, liegen die (Kinder aus) Arbeiterfamilien hier immer noch zurück. Und bei einer anscheinend zunehmenden Zahl von Kindern, die unter Bedingungen relativer Armut aufwachsen, zeichnen sich nicht nur Benachteiligungen in der Teilhabe an den Gütern einer Wohlstandsgesellschaft ab, sondern hier besteht auch die Gefahr gravierender Auswirkungen auf die Bildungs- und Berufschancen. Verschärft durch das Dauerproblem der Arbeitslosigkeit sehen hier manche Beobachter die Herausbildung einer neuen „underclass“ oder einer Gruppe von „Überflüssigen“ (Heinz Bude), die nicht nur schlechte Chancen im Bereich von Bildung und Arbeitsmarkt haben, sondern „einfach“ von der Gesellschaft „nicht mehr gebraucht“ werden und deshalb auch in den Kämpfen um soziale Anerkennung und „Respekt“, deren Bedeutung vor kurzem erst Richard Sennet wieder hervorgehoben hat, schlechte Karten haben. Das „Tocqueville-Paradox“ und der „Fahrstuhl-Effekt“ In all diesen Beispielen zeichnet sich nun eine nicht gerade übersichtliche „Gemengelage“ von alten und möglicherweise neuen Dimensionen und Erscheinungsformen sozialer Ungleichheiten ab. Einige der als „neu“ diskutierten Ungleichheiten sind zweifelsohne nicht „neu“ in dem Sinne, dass es sie früher nicht gab. „Neu“ an ihnen ist vielmehr, dass sie ein mehr an sozialwissenschaftlicher und öffentlicher Aufmerksamkeit erfahren. Dies weist nicht nur auf eine gewachsene Fähigkeit zur gesellschaftlichen „Selbstbeobachtung“ hin, sondern erinnert an das von Alexis de Tocqueville auf der Grundlage seiner Erfahrungen in den USA schon 1835 formulierte und nach ihm benannte Paradox, nach dem die Sensibilität für verbleibende – „neue“ – Ungleichheiten in einer Periode abnehmender – „alter“ – Ungleichheiten zunimmt. Ob die Bundesrepublik Deutschland nun seit den 60er Jahren generell eine Zeit „abnehmender“ Ungleichheiten erlebt hat, ist umstritten: Denn einerseits konnten zwar im Bereich von Bildung und Mobilität einige Ungleichheitsbarrieren abgebaut werden, andererseits weisen aber verfügbare Einkommensstatistiken nicht darauf hin, dass sich seit dieser Zeit an der Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen viel geändert hätte – und seit den späten 80er Jahren scheint sich eher eine wieder wachsende „Kluft“ zwischen Arm und Reich abzuzeichnen. All dies spielt sich jedoch, worauf ja Ulrich Beck mit seiner „Fahrstuhlmetapher“ aufmerksam machen wollte, auf einem im historischen und internationalen Vergleich nach wie vor bemerkenswert hohen Niveau materiellen Wohlstandes und sozialer Sicherheit ab. Und auch wenn Ungleichheiten – im Sinne relativer Abstände zwischen „viel“ und „wenig“, zwischen „oben“ und „unten“ – sich nur wenig oder gar nicht verringert haben, dürfte dieser allgemeine Niveauanstieg doch erhebliche Folgen für die alltägliche Bedeutung und Wahrnehmung von Ungleichheiten haben: Denn auch ein im Vergleich zu den Topgehältern von Vorstandsvorsitzenden geringes Einkommen ermöglicht ja heute meist einen Lebensstandard, von dem die meisten unserer Großeltern nur träumen konnten. Deutlich wird dieser paradoxe Zusammenhang von fortbestehenden Abständen zwischen ungleichen Lebenslagen und einer generellen Wohlstandssteigerung vor allem am Beispiel der Peter A. Berger: Soziale Unterschiede auf hohem Niveau 6 Armut. „Absolute“ Armut im Sinne eines Lebens am Rande des physischen Existenzminimums oder darunter ist in Deutschland erfreulicherweise ziemlich selten geworden. Nach wie vor verbreitet und nach vielen Untersuchungen sogar im Wachsen ist jedoch die sog. „relative“ Armut, die meist durch Einkommensgrenzen definiert wird: Wer weniger als 50% des durchschnittlichen Netto-Pro-Kopf-Einkommens bezieht, gilt als „arm“. Das bedeutet aber, dass die so definierte und gemessene „relative“ Armut nur dann verschwinden könnte, wenn der Abstand zwischen hohen und geringen Einkommen, also die Ungleichheit, verringert würde. Wenn jedoch in einem fiktiven Emirat am arabischen Golf der gesellschaftliche „Durchschnitt“ durch den Besitz von zwei Rolls Royce mit vergoldeter Karoserie definiert würde, wäre eben der „arm“, der nur einen Rolls Royce mit versilberter Karoserie sein eigen nennen kann. „Relative“ Armut kann, wie dieses vielleicht etwas konstruiert wirkende Beispiel zeigen soll, deshalb auch in einer reichen Gesellschaft verbreitet sein! Von der „Knappheit der Mittel“ zum „Mangel an Zielen“ Ersichtlich wird daraus auch, was es jenseits der Vervielfachung „neuer“ Ungleichheiten mit der Rede von einem „Bedeutungswandel“ der hergebrachten Muster sozialer Ungleichheiten auf sich haben könnte: Es geht, jedenfalls für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, nicht mehr um ein Leben, das unter dem Diktat von „Knappheiten“ steht, sondern um ein Leben, dass eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten bereithält. Gerhard Schulze hat diesen Übergang von einer Knappheits- zu einer Reichtumsungleichheit einmal so beschrieben, dass in einer reichen Gesellschaft nicht mehr die Handlungsmittel, sondern die Handlungsziele knapp sind. Damit verlagern sich gesellschaftliche Konflikte zumindest teilweise weg von Auseinandersetzungen um knappe Ressourcen und hin zu einem „Kampf“ um knappen „(Lebens-)Sinn“. Solche Auseinandersetzungen dürften freilich in der Regel kaum mehr entlang der Grenzen zwischen Schichten und Klassen, die vor diesem Hintergrund zu bloß noch statistischen Konstrukten verblassen, geführt werden. Denn oftmals geht es dabei auch um Fragen eines „guten“ Lebens, mithin um Fragen der „angemessenen“ Lebensführung, des „richtigen“ Lebensstils oder des passenden „Milieus“, die nicht allein auf der Grundlage von Einkommen, Bildungstiteln oder Macht beantwortet oder gelöst werden können, sondern zugleich Momente eines Kampfes um „Distinktion“ (P. Bourdieu), um Anerkennung und „Respekt“ umfassen. In der zunehmend massenmedial geprägten Öffentlichkeit einer heraufziehenden „Wissensgesellschaft“, die immer neue Angebote zur Stilisierung und Deutung des „eigenen Lebens“ bereit stellt, scheinen sich freilich solche (sub-)kulturellen Konflikte und semantischen Definitionskämpfe auszubreiten und in schneller Folge abzulösen. Und weil solche Konflikte eben nicht nur – und vermutlich nicht einmal mehr hauptsächlich – entlang der Grenzen von sozialen Klassen, Schichten oder Milieus verlaufen, sondern oftmals „quer“ zu altbekannten Strukturmustern sozialer Ungleichheiten liegen, würde heute auch die eingangs zitierte, öffentliche Rede von „den Klassen und Schichten des deutschen Volkes“ eher befremdlich und seltsam antiquiert wirken.