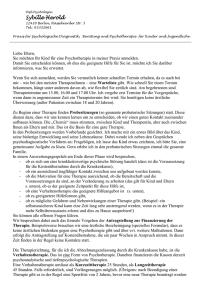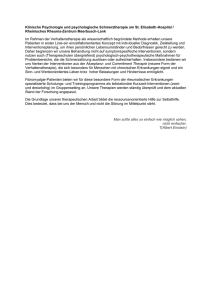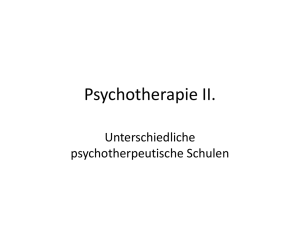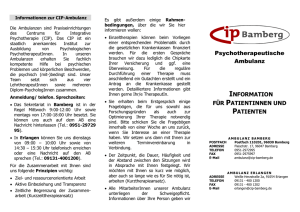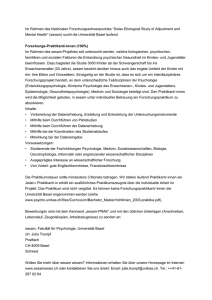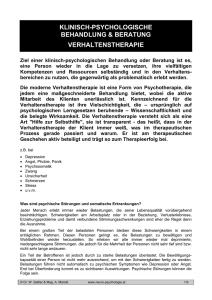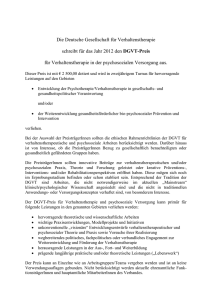Silvia Schneider, Jürgen Margraf (Hrsg.) Lehrbuch der
Werbung

Silvia Schneider, Jürgen Margraf (Hrsg.) Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 3: Störungen im Kindes- und Jugendalter Silvia Schneider Jürgen Margraf (Hrsg.) Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 3: Störungen im Kindes- und Jugendalter Mit 134 Abbildungen und 95 Tabellen 123 Prof. Dr. Silvia Schneider Klinische Kinder- und Jugendpsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstraße 60–62 4055 Basel, Schweiz Prof. Dr. Jürgen Margraf Klinische Psychologie und Psychotherapie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstraße 60–62 4055 Basel, Schweiz ISBN 978-3-540-79544-5 Springer Medizin Verlag Heidelberg Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Springer Medizin Verlag springer.de © Springer Medizin Verlag Heidelberg 2009 Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Planung: Renate Scheddin Projektmanagement: Renate Schulz Lektorat: Annette Allée, Dinslaken, Dr. Astrid Horlacher, Dielheim Layout und Einbandgestaltung: deblik Berlin Satz: Fotosatz-Service Köhler GmbH, Würzburg SPIN: 10998915 Gedruckt auf säurefreiem Papier 2126 – 5 4 3 2 1 0 V Vorwort Warum Lehrbuch, warum Neuauflage? Die Verhaltenstherapie befindet sich in ständiger Weiterentwicklung. Während sich Anfang der 1960er Jahre noch mancher fragte, ob denn überhaupt genügend Substanz für eigene Zeitschriften oder Handbücher vorhanden sei, ist heute die Informationsflut kaum noch zu übersehen. Mittlerweile ist die Verhaltenstherapie die am besten abgesicherte Form von Psychotherapie, bei vielen Störungen ist sie die Methode der Wahl. Dennoch sind Patienten, Fachleute und Administrationen unzureichend informiert und wird kompetente Verhaltenstherapie nach wie vor zu selten angeboten. Mit seinen ersten beiden Auflagen 1996 und 2000 hatte sich das Lehrbuch der Verhaltenstherapie die Aufgabe gestellt, die wachsende Bedeutung der Verhaltenstherapie in Versorgung, Ausbildung und Forschung adäquat abzubilden. Zusammen mit den Autoren freuen sich die Herausgeber sehr, dass Umfragen bei Universitäten, Ausbildungsinstituten und klinischen Einrichtungen zeigen, dass das Lehrbuch nicht nur nahezu flächendeckend in Lehre und PsychotherapieAusbildung eingesetzt wird, sondern auch in der klinischen Praxis weit verbreitet ist. Die anhaltende Weiterentwicklung macht nun eine neue Auflage des Lehrbuches notwendig. Diese soll sicherstellen, dass die Verhaltenstherapie umfassend und auf dem neuesten Wissensstand dargestellt wird. Dabei werden erneut Grundlagen, Forschung, Praxis und Rahmenbedingungen behandelt. Besondere Aufmerksamkeit gilt der praxisrelevanten Darstellung des konkreten therapeutischen Vorgehens sowie der Verankerung der Therapieverfahren in der klinischen Grundlagenforschung. Daneben soll erstmals explizit auch die Verhaltenstherapie bei Störungen des Kindes- und Jugendalters in einem eigenen Band behandelt werden. Aus diesem Grund fungiert auch Silvia Schneider, Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Basel, als Herausgeberin. Darüber hinaus werden in einem künftigen vierten Band zu den Themen der ersten drei Bände die notwendigen konkreten Werkzeuge (z. B. Anschauungsmaterial, Fragebogen, Patientenmerkblätter) für den alltäglichen therapeutischen Gebrauch kompakt zur Verfügung gestellt. Insgesamt geht die Neuauflage deutlich über eine bloße Aktualisierung hinaus. Sie stellt eine wesentliche Erweiterung dar, die notwendig ist, um dem faszinierenden Gebiet der Verhaltenstherapie und ihren Grundlagen gerecht zu werden. Warum der Begriff »Verhaltenstherapie«? Die meisten Psychotherapeuten betrachten sich als Eklektiker, und der Wunsch nach einer Überwindung des Schulenstreites und dem Aufbau einer »allgemeinen Psychotherapie« ist weit verbreitet. Warum also nicht ein Lehrbuch der allgemeinen Psychotherapie? Aussagen zu einer allgemeinen Psychotherapie können leicht auf einem so hohen Abstraktionsniveau liegen, dass sie kaum noch konkrete Inhalte aufweisen. Zudem erscheint es uns nicht sinnvoll, eine nur oberflächliche Gemeinsamkeit vorzugeben. Ob die breite psychotherapeutische Grundorientierung, die die Verhaltenstherapie heute ist, einmal mit anderen Ansätzen zu einer »allgemeinen Psychotherapie« zusammenwachsen wird, ist nicht absehbar. Fraglich ist auch, ob der Psychotherapie anders als anderen Wissenschaften jemals der große Wurf einer »allgemeinen« Theorie gelingen kann (man denke nur an die Physik). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die psychotherapeutischen Grundorientierungen jedenfalls zu unterschiedlich, als dass sie problemlos zusammengeführt werden könnten. Darüber hinaus sind Konkurrenz und gegenseitige Kritik ein wichtiger Entwicklungsantrieb, wie nicht zuletzt die Geschichte der Verhaltenstherapie zeigt. Als genuin psychologischer Heilkundeansatz könnte die Verhaltenstherapie mit besonderem Recht als psychologische Behandlung oder (in der Sprache des deutschen Psychotherapeutengesetzes) als psychologische Psychotherapie bezeichnet werden. Andererseits hat sich Verhaltenstherapie als Begriff eingebürgert, ist quasi ein »Markenbegriff« geworden, unter dem sich immer mehr Menschen etwas vorstellen können. Der Begriff und die ihm innewohnende Tradition sollten daher nicht leichtfertig aufgegeben werden. Auch eine genauere Festlegung einer bestimmten Ausrichtung (z. B. »kognitive Verhaltenstherapie«) erscheint uns für ein umfassendes Lehrbuch wenig sinnvoll. Verhaltenstherapeutische und kognitive Verfahren sind Teile einer gemeinsamen Grundströmung, deren wichtigste gemeinsame Klammer die Fundierung in der empirischen Psy- VI Vorwort chologie ist. Folgerichtig wird in Studium und postgradualen Ausbildungsgängen zwischen kognitiven und verhaltensorientierten Methoden nicht stärker unterschieden als innerhalb der Gruppe der kognitiven und oder der verhaltensorientierten Verfahren. Deshalb wird im vorliegenden Lehrbuch darauf verzichtet, eine neuere oder »modernere« Form begrifflich abzugrenzen. Allerdings muss die Auffassung von Verhaltenstherapie, die dem Lehrbuch zugrunde liegt, explizit kenntlich gemacht werden. Dies geschieht ausführlich in dem einleitenden Kapitel von Band 1 »Hintergründe und Entwicklung«. Warum in dieser Form? Die Differenziertheit der Verhaltenstherapie stellt hohe theoretische und praktische Ansprüche an diejenigen, die sie ausüben. Ihre kompetente Anwendung setzt daher eine fundierte Ausbildung voraus. Diese muss nicht nur Grundlagenwissen aus der Psychologie und ihren Nachbardisziplinen, sondern auch klinisch-psychologisches Störungs- und Veränderungswissen sowie hinreichend konkrete Anwendungsfertigkeiten vermitteln. Wenngleich kein Lehrbuch alle diese Punkte umfassend abdecken kann, so wird doch die Aufbereitung des Wissensstandes in einem praxisorientierten Rahmen einen Beitrag zur besseren Verfügbarkeit leisten, so dass mehr Menschen von den in der verhaltenstherapeutischen Forschung erzielten Fortschritten profitieren können. Da die Verhaltenstherapie heute von keinem Einzelnen mehr im Detail überblickt werden kann, wurde eine Gruppe von Experten aus dem deutschsprachigen und internationalen Raum als Autoren gewonnen. Die der großen Autorenzahl innewohnende Vielfalt kann eine Stärke, aber auch ein Problem darstellen. Durch Vorgabe gemeinsamer Richtlinien und intensive Bearbeitung haben Herausgeber und Verlag versucht zu erreichen, dass sich vor allem die positiven Seiten der Vielfalt auswirken. Der beachtliche Umfang des demnächst vierbändigen Lehrbuches geht dabei sowohl auf die große Differenziertheit der Verhaltenstherapie als auch auf den Wunsch zurück, die Beiträge hinreichend konkret für die praktische Umsetzung zu gestalten. Auch wenn dies manchmal schwerer als erwartet war, hoffen wir doch, dass wir uns unserem Anspruch angenähert haben. Der neue Band zu Kindern und Jugendlichen trägt der Bedeutung dieses vernachlässigten Gebietes für das Gesundheitswesen Rechnung. Dies wird nicht zuletzt durch neue Forschungsbefunde aus Epidemiologie und Risikoforschung unterstrichen: Demnach sind psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters ähnlich häufig wie die des Erwachsenenalters und zudem wichtige Risikofaktoren für das Auftreten psychischer Störungen des Erwachsenenalters. Gleichzeitig hat es in den letzten Jahren eine erfolgreiche Weiterentwicklung in der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen gegeben. Ziel des neuen Bandes ist es daher, das Wissen um die moderne verhaltenstherapeutische Behandlung im Kindes- und Jugendalter einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Die im künftigen Band 4 geplante kompakte Zusammenstellung der konkreten Arbeitswerkzeuge für den alltäglichen psychotherapeutischen Gebrauch ist im deutschsprachigen Raum vollkommen neu. Bisher bieten Fachbücher höchstens Materialien zu einigen wenigen Störungsbildern, so dass für den Praktiker umfassende Buchsammlungen notwendig sind, um die wichtigsten Themen abzudecken. Außerdem sind Materialien zu einer Störung oft nicht umfassend, sondern beinhalten nur einzelne der benötigten Kategorien: Fragebogen, Anschauungsmaterial oder Patientenmerkblätter etc. Daneben müssen sich die Praktiker oftmals benötigte störungsübergreifende Materialien aus unterschiedlichen Quellen zusammensuchen. Im vierten Band des Lehrbuchs für Verhaltenstherapie, der im Moment in Vorbereitung ist, sollen deshalb überwiegend von den Autoren der ersten drei Bände störungsspezifische und störungsübergreifende Materialien für die psychotherapeutische Praxis vorgestellt werden (z. B. Anschauungsmaterial, Arbeitsanweisungen, Patientenmerkblätter, Fragebogen, allgemeine Informationen). An wen wendet sich das Lehrbuch? Das Lehrbuch wendet sich vor allem an Studenten, Ausbildungskandidaten, Praktiker und Forscher aus den Bereichen klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie sowie deren Nachbardisziplinen. Darüber hinaus sollen auch Interessenten aus Gesundheits- und Erziehungswesen, Kostenträgern, Verwaltung und Politik angesprochen werden. Die einzelnen Kapitel sollen möglichst auch ohne Bezug auf den Rest des Buches verständlich sein, was natürlich manchmal auf Grenzen stößt. Weiterführende Literaturempfehlungen, ein aus- VII Vorwort führliches Glossar und ein praktischer Anhang (mit Informationen z. B. zu Fachgesellschaften, Fachzeitschriften etc.) sowie der künftige Band 4 mit seinen Therapiematerialien sollen die Nutzbarkeit erhöhen. Das Lehrbuch wurde nicht in erster Linie für Patienten und ihre Angehörigen geschrieben. Bücher reichen als Therapie meist nicht aus, sie können aber sehr wohl über Therapie informieren. Solche Informationen können nützliche Entscheidungsgrundlagen sein. Für den knappen Überblick stehen im deutschsprachigen Raum mehrere populärwissenschaftliche Bücher zur Verfügung. Wenn jedoch Umfang, Preis oder Fachsprache nicht abschrecken, spricht auch nichts gegen die Lektüre eines Lehrbuches. Sollte eine Behandlung angebracht sein, wird es in der Regel aber sinnvoll sein, die schriftlichen Informationen noch einmal persönlich mit Therapeut oder Therapeutin zu besprechen. Aufbau und Gestaltung des Lehrbuches Das Lehrbuch besteht aus vier einander ergänzenden Bänden, die folgendermaßen aufgebaut sind: Band 1: Verhaltenstherapie – Grundlagen und Verfahren Grundlagen – Diagnostik – Verfahren – Rahmenbedingungen Band 2: Verhaltenstherapie – Störungen im Erwachsenenalter Störungen – Spezielle Indikationen – Glossar Band 3: Verhaltenstherapie – Störungen im Kindes- und Jugendalter Spezifische Grundlagen für die VT mit Kindern und Jugendlichen – Verfahren – Spezifische Störungen – Spezielle Indikationen – Rahmenbedingungen Band 4: Therapiematerialien (in Vorbereitung) Störungsspezifische und störungsübergreifende Therapiematerialien zu allen relevanten Themenbereichen der ersten drei Bände Die praktische Arbeit mit dem Lehrbuch wird durch ausführliche Sachwort- und Autorenregister sowie ein umfassendes Glossar erleichtert. Die Methoden-, Störungs-, Diagnostik- und Grundlagenkapitel folgen einheitlichen Gliederungen, deren zentrale Elemente im folgenden Kasten dargestellt sind. Da jede Regel schädlich werden kann, wenn sie zu dogmatisch ausgelegt wird, konnten die Autoren aber im Einzelfall von diesen Vorgaben abweichen. Aufbau der Verfahrenskapitel 1. 2. 3. 4. 5. Theoretische Grundlagen Praktische Voraussetzungen und Diagnostik Darstellung des Verfahrens Anwendungsbereiche und mögliche Grenzen (Indikationen und Kontraindikationen) Empirie: Wirkmechanismen und Effektivität Aufbau der Diagnostikkapitel 1. Hintergrundwissen 2. Praktische Hinweise für den Einsatz 3. Grenzen und typische Probleme Aufbau der Störungskapitel 1. 2. 3. 4. 5. 6. Darstellung der Störung Modelle zu Ätiologie und Verlauf Diagnostik Therapeutisches Vorgehen Fallbeispiel Empirische Belege VIII Vorwort Zwei Bemerkungen zur Terminologie: 4 Es gibt verschiedene Wege, das Problem unangemessener geschlechtsspezifischer Begrifflichkeiten anzugehen. Am wenigsten geeignet erscheinen uns Doppelnennungen, Schrägstrichlösungen oder das große »I«. Sofern die Geschlechtszugehörigkeit keine spezielle Rolle spielt, werden im vorliegenden Lehrbuch Begriffe wie »Patient« oder »Therapeut« grundsätzlich geschlechtsneutral verwandt, betreffen also stets beide Geschlechter. Abweichungen von dieser Regel werden explizit vermerkt. 4 Dem in der Medizin etablierten Patientenbegriff wurde im Zuge der Kritik am »medizinischen Modell« vorgeworfen, er drücke ein Abhängigkeitsverhältnis aus und entspreche nicht dem Ideal des aufgeklärten, mündigen Partners in der therapeutischen Beziehung. Als Alternative wurde mancherorts der Klientenbegriff vorgeschlagen, der frei von den genannten Bedeutungen sein sollte. Aufschlussreich ist hier die Wortgeschichte [vgl. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (22. Aufl.). Berlin: De Gruyter, 1989]. »Patient« bedeutet wortwörtlich »Leidender«. Im 16. Jahrhundert wurde der Begriff aus dem lateinischen »patiens« (duldend, leidend) gebildet, um kranke oder pflegebedürftige Personen zu bezeichnen. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde »Klient« ebenfalls aus dem Latein entlehnt (von »cliens«, älter »cluens«). Die wörtliche Bedeutung dieses Begriffes lautet »Höriger« (abgeleitet vom altlateinischen Verb »cluere«: hören). Klienten waren ursprünglich landlose und unselbstständige Personen, die von einem Patron abhängig waren. Dieses Abhängigkeitsverhältnis bedingte zwar gewisse Rechte (z. B. Rechtsschutz durch den Patron), vor allem aber eine Vielzahl von Pflichten. Drei Gründe sprachen demnach für die Verwendung von »Patient« anstelle von »Klient«: 5 Die tatsächliche Bedeutung des Begriffes »Klient« widerspricht der erklärten Absicht seiner Einführung. 5 Eine bloße terminologische Verschleierung des teilweise realen »Machtgefälles« zwischen Behandelnden und Behandelten ist wenig sinnvoll. 5 Der Begriff »Patient« beschreibt adäquat das Leiden hilfesuchender Menschen. Danksagungen Ein Projekt wie das vorliegende Lehrbuch erfordert umfangreiche Unterstützung, die wir anerkennen und für die wir uns bedanken möchten. Die Neuauflage des Lehrbuches hat in ganz besonderer Weise von der Kompetenz, Geduld und positiven Ausstrahlung von Eva Wilhelm profitiert. Ihre Mitarbeit war ein enormer Gewinn. Daneben haben auch Frank Wilhelm, Claudia Arnold, Helen Kessler, Sonja Hilbrand und Martina Tremp an der Universität Basel tatkräftig geholfen. Sehr herzlich möchten wir uns bei den Autoren der Kapitel bedanken, die manchmal viel Geduld aufbrachten (wegen Anpassungen an das Gesamtkonzept, langwierigen Überarbeitungen oder Zeitverzögerungen durch die unvermeidbaren Nachzügler). Unsere Entschuldigung gilt denjenigen, die die Terminvorgaben einhielten, unser zusätzlicher Dank denen, die wegen Krankheiten oder anderer Unwägbarkeiten kurzfristig »einsprangen«. Ihre Ausdauer ganz besonders unter Beweis gestellt haben Renate Scheddin, die das Projekt beim Springer-Verlag kompetent betreute, sowie Renate Schulz, Annette Allée und Christine Bier, die das sachkundige Lektorat besorgten. Alle zusammen haben wir den Patienten zu danken, deren aktive Mitarbeit in der Verhaltenstherapie besonders wichtig ist. Für die langjährige Unterstützung unserer Forschung zur Verhaltenstherapie durch Sachbeihilfen und Personalmittel danken wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem deutschen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) und dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Während unserer Marburger Zeit profitierten wir sehr von der aktiven, uneigennützigen Förderung durch unsere damalige Chefin Irmela Florin und vom Austausch mit den dortigen Kollegen. Später bot uns die TU Dresden ein anregendes Umfeld, wobei der Aufbau der klinischen Psychologie und Psychotherapie der tatkräftigen und entscheidungsstarken Unterstützung durch die Universität viel verdankte. Der Aufbau eigener verhaltenstherapeutischer Ambulanzen in Marburg, Dresden und Basel, die Zusammenarbeit mit psychosomatischen, verhaltensmedizinischen und psychiatrischen Kliniken, insbesondere der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel unter der Leitung von Franz Müller-Spahn, der ständige Kontakt mit niedergelassenen Kollegen und die jahrelange Tätigkeit in der psychotherapeutischen Fortund Weiterbildung gaben ebenfalls wesentliche Impulse, die ihren direkten Niederschlag in Kon- IX Vorwort zeption und Autorenschaft des Lehrbuches fanden. Um den fruchtbaren Austausch fortzusetzen, möchten wir ausdrücklich darum bitten, Rückmeldungen oder Vorschläge an unsere im Innenumschlag angegebene Anschrift zu schicken. In den ersten beiden Auflagen galt der Dank zudem den Mitarbeitern der Klinischen Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden, allen voran Kerstin Raum für die organisatorische Koordination sowie Frank Jacobi, Klaus Dilcher, Juliane Junge und Heiko Mühler. Im SpringerVerlag leistete Heike Berger zusammen mit Stefanie Zöller, Bernd Stoll, Renate Schulz, Simone Ernst, Miriam Geissler und Regine Körkel-Hinkfoth tatkräftige Hilfe. Das vorliegende Buch ist ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt, widmen möchten wir es unseren Eltern. Silvia Schneider und Jürgen Margraf Riehen, im Frühjahr 2009 Lehrbuch der Verhaltenstherapie: Das Lehrbuch besteht aus vier einander ergänzenden Bänden, die jedoch auch unabhängig voneinander genutzt werden können. Die Bände haben folgende Inhalte: Band 1: Verhaltenstherapie – Grundlagen, Diagnostik, Verfahren, Rahmenbedingungen 4 4 4 4 4 4 Grundlagen Diagnostik Verfahren Rahmenbedingungen Personenverzeichnis Sachverzeichnis Band 2: Verhaltenstherapie – Störungen im Erwachsenenalter – Spezielle Indikationen – Glossar 4 4 4 4 4 4 Störungen im Erwachsenenalter Spezielle Indikationen Glossar Anhang Personenverzeichnis Sachverzeichnis Band 3: Verhaltenstherapie – Störungen im Kindes- und Jugendalter 4 4 4 4 4 4 4 Spezifische Grundlagen für die Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen Verfahren Spezifische Störungen Spezielle Indikationen Rahmenbedingungen Personenverzeichnis Sachverzeichnis Band 4 (in Vorbereitung): Therapiematerialien zu den relevanten Themen der ersten drei Bände 4 4 4 4 Störungsspezifische Therapiematerialien Störungsübergreifende Therapiematerialien Personenverzeichnis Sachverzeichnis XI Inhaltsverzeichnis Band 3 I Spezifische Grundlagen für die Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen III Spezifische Störungen 19 Regulationsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Dieter Wolke 1 Entwicklungspsychologische Grundlagen . . . . 3 20 Bindungsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabina Pauen, Eva Vonderlin 2 Entwicklungspsychopathologie. . . . . . . . . . . . Franz Petermann, Franziska Damm 3 Biologische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . Kerstin Konrad 4 Klinische Bindungsforschung . . . . . . . . . . . . Margarete Bolten 5 Klinisch-psychologische Familienforschung . . Meinrad Perrez, Guy Bodenmann 6 Medien und Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Messner 7 Klassifikation psychischer Störungen . . . . . . Andrea Suppiger, Silvia Schneider 8 Diagnostisches Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . Carmen Adornetto, Silvia Schneider 9 Entwicklungsdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Grob, Priska Hagmann-von Arx, Nancy M. Bodmer 10 Psychotherapieforschung . . . . . . . . . . . . . . . Manfred Döpfner 23 21 Autistische Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Fritz Poustka . 43 22 Intellektuelle Beeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . 55 23 . 77 24 . 95 . 111 . 123 . 145 Germain Weber, Johannes Rojahn Stottern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Fiedler Enuresis und Enkopresis . . . . . . . . . . . . . Susanne Schreiner-Zink, Pia Fuhrmann, Alexander von Gontard Lese-/Rechtschreibstörung . . . . . . . . . . . Karin Landerl Aufmerksamkeitsstörung . . . . . . . . . . . . Peter F. Schlottke, Ute Strehl, Gerhard W. Lauth 351 .... 367 .... 381 .... 395 .... 411 27 Hyperkinetische Störung und oppositionelles Trotzverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 25 26 Manfred Döpfner 28 Störungen des Sozialverhaltens . . . . . . . . . . . . 159 29 .............. 503 .............. 531 .............. 555 .............. 573 34 Generalisierte Angststörung . . . . . . . . . . . . . . 593 31 32 183 33 Michael Borg-Laufs 12 Psychoedukation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Franz Petermann, Judith Bahmer 13 Operante Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 221 233 243 647 38 Depression/Suizidalität . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Patrick Pössel 39 Adipositas und Binge Eating Disorder . . . . . . . 255 Nina Heinrichs, Kurt Hahlweg 18 Familienintervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ticstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manfred Döpfner Ulrike Petermann, Johanna Pätel 17 Elterntrainings zur Steigerung der Erziehungskompetenz . . . . . . . . . . . . . . . 629 Michael Simons Veronika Brezinka 16 Entspannungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 Markus A. Landolt 36 Zwangsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhard W. Lauth, Katja Mackowiak 15 Computerspiele in der Verhaltenstherapie mit Kindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tina In-Albon 35 Posttraumatische Belastungsstörung . . . . . . . Friedrich Linderkamp 14 Kognitive Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 481 II Verfahren 11 Erstkontakt und Beziehungsgestaltung mit Kindern und Jugendlichen . . . . . . . . . . . . Friedrich Lösel, Daniela Runkel Trennungsangst . . . . . . . . . Silvia Schneider, Judith Blatter Spezifische Phobien . . . . . . Barbara Schlup, Silvia Schneider Soziale Phobie . . . . . . . . . . Siebke Melfsen, Andreas Warnke Selektiver Mutismus . . . . . . Siebke Melfsen, Andreas Warnke Prüfungsängste . . . . . . . . . Lydia Suhr-Dachs .............. 30 Fritz Mattejat 313 Ute Ziegenhain 277 689 Simone Munsch 40 Anorexia nervosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 Beate Herpertz-Dahlmann, Reinhild Schwarte 41 Schlafstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonie Fricke-Oerkermann 739 XII Inhaltsverzeichnis 42 Substanzmissbrauch und -abhängigkeit . . . . . Eva Hoch, Roselind Lieb 43 Neurodermitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viktoria Ritter, Ulrich Stangier 44 Chronischer Schmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birgit Kröner-Herwig 45 Asthma bronchiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petra Warschburger 763 V Rahmenbedingungen 785 803 52 Verhaltenstherapie in der Pädiatrie . . . . . . . . . 819 53 Verhaltenstherapie in der Pädagogik . . . . . . . . 843 Silvia Schneider 865 56 Supervision in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Fritz Mattejat, Kurt Quaschner 57 Fallberichte von Psychotherapien mit Kindern und Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Franz Moggi 49 Verhaltenstherapie und psychopharmakologische Behandlung . . . . . . 55 Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Kinder- und Jugendlichenverhaltenstherapie in Deutschland, der Schweiz und Österreich . . . . . . . . . . . . . . . 987 Josef Könning, Tina In-Albon, Bibiana Schuch 855 Beate Schwarz 48 Kindesmisshandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 Jürg Forster IV Spezielle Indikationen 47 Kinder nach Trennung und Scheidung . . . . . . . 959 Ulrike Petermann, Mara Zoe Krummrich 54 Berufsethische und rechtliche Aspekte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen . . . 46 Kinder psychisch kranker Eltern . . . . . . . . . . . 937 Meinolf Noeker 887 Gunther Meinlschmidt, Marion Tegethoff Hans-Christoph Steinhausen 50 Prävention psychischer Störungen . . . . . . . . . 901 Juliane Junge-Hoffmeister 51 Sport und psychische Gesundheit . . . . . . . . . . Anhang 923 Tim Hartmann, Uwe Pühse Personenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 XIII Autorenverzeichnis Adornetto, Carmen, Dr. Borg-Laufs, Michael, Prof. Dr. Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Schaffhauserrheinweg 55 4058 Basel Schweiz [email protected] Fachbereich Sozialwesen an der Hochschule Niederrhein Richard-Wagner-Straße 101 41065 Mönchengladbach [email protected] Brezinka, Veronika, Dr. Dr. Bahmer, Judith, Dr. Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation Universität Bremen Grazer Straße 6 28359 Bremen Psychopathologie des Kindes und Jugendalters Universität Zürich Neptunstrasse 60 8032 Zürich Schweiz [email protected] Blatter, Judith, Dr. Zentrum für Kinder- und Jugendpsychotherapie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] Damm, Franziska, Dipl.-Psych. Bodenmann, Guy, Prof. Dr. Döpfner, Manfred, Prof. Dr. Psychologisches Institut der Universität Zürich Klinische Psychologie Binzmühlestrasse 14/23 8050 Zürich Schweiz [email protected] Psychotherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik Köln Robert-Koch-Straße 10 50931 Köln [email protected] Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation Universität Bremen Grazer Straße 6 28359 Bremen [email protected] Fiedler, Peter, Prof. Dr. Bodmer, Nancy, Dr. Entwicklungs-und Persönlichkeitspsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] Bolten, Margarete, Dr. Klinische Kinder-und Jugendpsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Birmanssgasse 8 4009 Basel Schweiz [email protected] Psychologisches Institut der Universität Heidelberg Hauptstraße 47–51 69117 Heidelberg [email protected] Forster, Jürg, Dr. Schulpsychologischer Dienst Zürich Seestrasse 346 8038 Zürich Schweiz [email protected] Fricke-Oerkermann, Leonie, Dr. Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes und Jugendalters der Universität zu Köln Robert-Koch-Straße 10 50931 Köln [email protected] XIV Autorenverzeichnis Fuhrmann, Pia, Dipl.-Psych. Herpertz-Dahlmann, Beate, Prof. Dr. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum des Saarlandes 66421 Homburg/Saar [email protected] Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Universitätsklinikum Aachen Neuenhofer Weg 21 52074 Aachen [email protected] Gontard, Alexander, von, Prof. Dr. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum des Saarlandes 66421 Homburg/Saar [email protected] Grob, Alexander, Prof. Dr. Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] Hagmann-von Arx, Priska, Lic. phil. Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] Hahlweg, Kurt, Prof. Dr. Institut für Psychologie Technische Universität Braunschweig Konstantin-Uhde-Straße 4 38106 Braunschweig [email protected] Hoch, Eva, Dr. Klinische Psychologie und Psychotherapie Technische Universität Dresden Chemnitzer Straße 46 01187 Dresden [email protected] In-Albon, Tina, Dr. Klinische Kinder- und Jugendpsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] Junge-Hoffmeister, Juliane, Dr. Dipl.-Psych. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik Universitätsklinikum »Carl Gustav Carus« an der Technischen Universität Dresden Fletcherstraße 74 01307 Dresden [email protected] Könning, Josef, Dr. AKJP GmbH Bohmter Straße 1 49074 Osnabrück [email protected] Hartmann, Tim, M. Sc. Institut für Sport und Sportwissenschaften Universität Basel Brüglingen 33 4052 Basel Schweiz [email protected] Heinrichs, Nina, Prof. Dr. Abt. für Psychologie Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft Universität Bielefeld Postfach 100131 33501 Bielefeld [email protected] Konrad, Kerstin, Prof. Dr. LFG Klinische Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Universitätsklinikum Aachen Neuenhofer Weg 21 52074 Aachen [email protected] Kröner-Herwig, Birgit, Prof. Dr. Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie Abteilung 7: Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Göttingen Goßlerstraße 14 37073 Göttingen [email protected] XV Autorenverzeichnis Krummrich, Mara Zoe, Dipl.-Psych. Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation Universität Bremen Grazer Straße 6 23359 Bremen [email protected] Institute of Criminology University of Cambridge Sidgwick Avenue Cambridge CB3 9DT United Kingdom [email protected] Landerl, Karin, Prof. Dr. Mackowiak, Katja, Prof. Dr. Psychologisches Institut Abteilung Klinische und Entwicklungspsychologie Universität Tübingen Gartenstraße 29 72074 Tübingen [email protected] Pädagogische Psychologie Pädagogische Hochschule Weingarten Kirchplatz 2 88250 Weingarten [email protected] Mattejat, Fritz, Prof. Dr. Landolt, Markus, Priv.-Doz. Dr. Kinderspital Zürich Steinwiesstrasse 75 8032 Zürich Schweiz [email protected] Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Universitätsklinikum Gießen und Marburg Hans-Sachs-Straße 6 35039 Marburg/Lahn [email protected] Meinlschmidt, Gunther, Dr. Lauth, Gerhard, Prof Dr. Psychologie und Psychotherapie Heilpädagogische Fakultät Universität zu Köln Klosterstraße 79b 50931 Köln [email protected] Klinische Psychologie und Psychotherapie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60-62 4055 Basel Schweiz [email protected] Melfsen, Siebke, Dr. Lieb, Roselind, Prof. Dr. NFS sesam Universität Basel Birmannsgasse 8 4009 Basel Schweiz [email protected] Linderkamp, Friedrich, Priv.-Doz. Dr. Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik Rehabilitationspsychologie Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fk I Ammerländer Heerstraße 114–118 26129 Oldenburg [email protected] Lösel, Friedrich, Prof. Dr. Dr. Institut für Psychologie I Universität Erlangen-Nürnberg Bismarckstraße 1 91054 Erlangen [email protected] Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg Messner, Claude, Dr. Sozial- und Wirtschaftspsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60-62 4055 Basel Schweiz [email protected] Moggi, Franz, Priv.-Doz. Dr. Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie Bern Bolligenstrasse 111 3000 Bern Schweiz [email protected] XVI Autorenverzeichnis Munsch, Simone, Priv.-Doz. Dr. Poustka, Fritz, Prof. Dr. Klinische Psychologie und Psychotherapie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60-62 4055 Basel, Schweiz [email protected] Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt Deutschordenstraße 50 60590 Frankfurt am Main [email protected] Noeker, Meinolf, Dr. Psychologischer Dienst Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn Adenauerallee 119 53113 Bonn [email protected] Pätel, Johanna, Dipl.-Psych. IVB Institut für Verhaltenstherapie Berlin Hohenzollerndamm 125/126 14199 Berlin Pauen, Sabina, Prof. Dr. Psychologisches Institut der Universität Heidelberg Hauptstraße 47–51 69117 Heidelberg [email protected] Perrez, Meinrad, Prof. Dr. Institut für Psychologie Universität Fribourg Rue de Faucigny 2 1700 Fribourg Schweiz [email protected] Petermann, Franz, Prof. Dr. Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation Universität Bremen Grazer Straße 6 28359 Bremen [email protected] Petermann, Ulrike, Prof. Dr. Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation Universität Bremen Grazer Straße 6 28359 Bremen [email protected] Pössel, Patrick, Prof. Dr. Department of Educational and Counseling Psychology University of Louisville 2301 S. Third Street Louisville, KY 40292 USA [email protected] Pühse, Uwe, Prof. Dr. Institut für Sport und Sportwissenschaften Universität Basel Brüglingen 33 4052 Basel Schweiz [email protected] Quaschner, K., Dr. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Philipps-Universität Marburg Hans-Sachs-Straße 6 35039 Marburg/Lahn [email protected] Ritter, Viktoria, Dipl.-Psych. Klinische Psychologie und Psychotherapie Institut für Psychologie der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt Varrentrappstraße 40–42 60486 Frankfurt am Main [email protected] Rojahn, Johannes, Ph. D. George Mason University Department of Psychology 10340 Democracy Lane, Suite 202 Fairfax, VA 22030-4444 USA [email protected] Runkel, Daniela, Dipl.-Psych. Institut für Psychologie I Universität Erlangen-Nürnberg Bismarckstraße 1 91054 Erlangen [email protected] Schlottke, Peter F., Prof. Dr. Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie Psychotherapeutische Hochschulambulanz Medizinische Fakultät Universität Tübingen Gartenstraße 29 72074 Tübingen [email protected] XVII Autorenverzeichnis Schlup, Barbara, Dr. Stangier, Ulrich, Prof. Dr. Psychiatrische Poliklinik Inselspital Murtenstrasse 21 3010 Bern Schweiz [email protected] Klinische Psychologie und Psychotherapie Institut für Psychologie der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt Varrentrappstraße 40–42 60486 Frankfurt am Main [email protected] Schneider, Silvia, Prof. Dr. Steinhausen, Hans-Christoph, Prof. Dr. Dr. Klinische Kinder- und Jugendpsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] Universitätsklinik für Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters Medizinische Universität Wien Währingerguertel 18–20 1090 Wien Österreich [email protected] Chair of Child and Adolescent Psychiatry Psykiatrien – Region Nordjylland Alborg Psychiatric Hospital Aarhus University Hospital Mølleparkvej.10 9000 Aalborg Denmark und Klinische Kinder- und Jugendpsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60-62 4055 Basel Schweiz [email protected] und Zentrum für Kinder- und Jugendpsychologie der Universität Zürich Neumünsterallee 3 8008 Zürich Schweiz [email protected] Schwarte, Reinhild, Dipl.-Psych. Strehl, Ute, Priv.-Doz. Dr. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Universitätsklinikum Aachen Neuenhofer Weg 21 52074 Aachen [email protected] Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie Universität Tübingen Gartenstraße 29 72074 Tübingen [email protected] Schreiner-Zink, Susanne, Dr. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum des Saarlandes 66421 Homburg/Saar [email protected] Schuch, Bibiana, Dr. Schwarz, Beate, Dr. Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60-62 4055 Basel Schweiz [email protected] Suhr-Dachs, Lydia, Dr. Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie an der Universtität zu Köln (AKIP) Robert-Koch-Straße 10 50931 Köln [email protected] Simons, Michael, Dr. Dipl.-Psych. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Universitätsklinikum Aachen Neuenhofer Weg 21 52074 Aachen [email protected] Suppiger, Andrea Doris, Dr. Klinische Psychologie und Psychotherapie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] XVIII Autorenverzeichnis Tegethoff, Marion, Dipl.-Psych. Weber, Germain, ao. Prof. Dr. Klinische Psychologie und Psychotherapie Fakultät für Psychologie der Universität Basel Missionsstrasse 60–62 4055 Basel Schweiz [email protected] Institut für Klinische, Biologische und Differentielle Psychologie Universität Wien Liebiggasse 5 1010 Wien Österreich [email protected] Vonderlin, Eva, Dr. Psychologisches Institut Universität Heidelberg Hauptstraße 47–51 69117 Heidelberg [email protected] Warnke, Andreas, Prof. Dr. Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg [email protected] Warschburger, Petra, Prof. Dr. Institut für Psychologie der Universität Potsdam Beratungspsychologie Postfach 601553 14415 Potsdam [email protected] Wolke, Dieter, Prof. Dr. Department of Psychology and HSRI Warwick Medical School The University of Warwick Coventry CV4 7AL United Kingdom [email protected] Ziegenhain, Ute, Priv.-Doz. Dr. Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Universitätsklinikum Ulm Steinhövelstraße 5 89070 Ulm [email protected] I I Spezifische Grundlagen für die Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen 1 Entwicklungspsychologische Grundlagen – 3 Sabina Pauen, Eva Vonderlin 2 Entwicklungs-psychopathologie – 23 Franz Petermann, Franziska Damm 3 Biologische Grundlagen – 43 Kerstin Konrad 4 Klinische Bindungsforschung – 55 Margarete Bolten 5 Klinisch-psychologische Familienforschun – 77 Meinrad Perrez, Guy Bodenmann 6 Medien und Gewalt – 95 Claude Messner 7 Klassifikation psychischer Störungen – 111 Andrea Suppiger, Silvia Schneider 8 Diagnostisches Vorgehen – 123 Carmen Adornetto, Silvia Schneider 9 Entwicklungsdiagnostik – 145 Alexander Grob, Priska Hagmann-von Arx, Nancy M. Bodmer 10 Psychotherapieforschung Manfred Döpfner – 159 1 1 Entwicklungspsychologische Grundlagen Sabina Pauen, Eva Vonderlin 1.1 Einleitung – 4 1.2 Was ist an Kindern so besonders? 1.3 Wie nützen entwicklungspsychologische Kenntnisse Kinderund Jugendtherapeuten? – 5 1.4 Verschiedene Lernformen und ihre Entwicklung – 7 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Klassische Konditionierung – 7 Operante Konditionierung – 8 Beobachtungslernen – 9 Lernen durch Einsicht – 10 1.5 Entwicklungspsychologische Veränderungen mit Bedeutung für die Verhaltenstherapie – 12 1.5.1 1.5.2 1.5.3 Entwicklung kognitiver Grundfunktionen – 12 Entwicklung emotionaler Grundfunktionen – 14 Entwicklung sozialer Grundfunktionen – 18 1.6 Ausblick – 20 Zusammenfassung Literatur – 21 – 21 Weiterführende Literatur – 22 –4 4 1 Kapitel 1 · Entwicklungspsychologische Grundlagen 1.1 Einleitung Wer sich mit den Grundlagen der Verhaltenstherapie beschäftigt, mag sich fragen, warum es eigentlich notwendig sein soll, Kinder als etwas Besonderes zu betrachten. Gelten die allgemeinen Lerngesetze nicht genauso für Neugeborene wie für Erwachsene? Der vorliegende Beitrag wird diese These bestätigen und gleichzeitig deutlich machen, warum eine differenzierte Auseinandersetzung mit entwicklungspsychologischen Kenntnissen zu einem besseren Verständnis der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen führt. Ein kurzer Rückblick auf das psychologische Bild vom Kind im historischen Wandel soll dies zunächst an Beispielen illustrieren. Anschließend wird systematisch begründet, inwiefern entwicklungspsychologische Kenntnisse für die Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen wichtig sind. Die nachfolgenden Abschnitte beziehen sich auf verschiedene Lernformen und bieten dem Leser Einblick in empirische Erkenntnisse zur Entwicklung dieser Lernformen über das Lebensalter. Am Ende des Beitrags folgt eine Beschreibung der wichtigsten entwicklungspsychologischen Veränderungen für ausgewählte Verhaltensbereiche, die in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle spielen. 1.2 ihrer Wirklichkeit« seien – Wesen also, die nicht blind auf Belohnung und Bestrafung reagieren, sondern Erfahrungen stets interpretieren und einordnen, um ihnen dadurch Bedeutung zu verleihen. In den 1970er Jahren vollzog sich auch innerhalb der Verhaltenstherapie ein Perspektivwandel: Die sog. »kognitive Wende« führte dazu, dass man zunehmend nach den Gedanken von Menschen fragte, um ihr Verhalten zu verstehen. Ferner machte Piaget deutlich, dass die Formen der Auseinandersetzung mit der Umwelt (in der Terminologie seiner Theorie ist von »Schemata« oder »Denkstrukturen« die Rede) sich in systematischer Weise mit dem Alter verändern. Damit war klar: wer das Verhalten von Kindern richtig deuten oder ihre Lerngeschichte nachhaltig beeinflussen will, muss über Kenntnisse ihrer altersspezifischen Denkstrukturen verfügen. Diese Überzeugung wurde im Informationsverarbeitungsansatz, der sich kritisch mit Piagets Theorie auseinandersetzte, weitergeführt. Hier stellte man die genaue Analyse der Anforderungen einer Aufgabe an das handelnde Kind in Beziehung zu dem, was man über seine geistigen Ressourcen wusste. Neu an diesem Ansatz war, dass nun auch die Frage, wie sich basale mentale Prozesse mit dem Alter verändern, Eingang in die Forschung fand. Es begann eine Phase der verstärkten Untersuchung solcher Prozesse, wie etwa der Veränderung von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen, die schließlich die Grundlage von höheren Denkprozessen bilden. Was ist an Kindern so besonders? Einbeziehung der emotionalen Entwicklung Das Bild vom Kind im historischen Wandel Noch bis ins 19. Jahrhundert betrachtete man Kinder als kleine Erwachsene. Man zog sie so an, man verlangte ihnen Ähnliches ab, und man dachte, dass sie im Prinzip genauso funktionieren würden wie die Großen – nur eben ein bisschen langsamer und auf niedrigerem Leistungsniveau. Auch die ersten Behavioristen und Lerntheoretiker machten zunächst keinen grundlegenden Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Alle Menschen lernen demnach in allen Altersstufen nach den gleichen Prinzipien und in vergleichbarer Weise. Allerdings konstatierte Watson, einer der berühmtesten Vertreter der klassischen Lerntheorie, dass Kinder noch keine lange Lerngeschichte hinter sich haben und man sie daher durch gezielten Einsatz von Belohnung und Bestrafung zu beliebigen Persönlichkeiten machen könne. Auch wenn diese Aussage heute wohl niemand mehr unterschreiben würde, weil wir inzwischen auch viel darüber gelernt haben, dass Kinder nicht als unbeschriebene Blätter geboren werden, bleibt es wahr, dass Kinder offen sind für unterschiedlichste Arten von Erfahrungen und dass das frühe Lernen für das spätere Leben eine zentrale Rolle spielt. Was hat sich seit den Anfängen des Behaviorismus noch geändert an unserem Bild vom Kind? Zunächst erfuhr die Welt von Jean Piaget, dem Begründer der kognitiven Entwicklungspsychologie, dass schon Kinder »Konstrukteure Auch wenn dieser veränderte Blick auf Kinder zweifellos einen großen Gewinn bringt, besteht ein Nachteil aller bislang genannten Ansätze immer noch darin, dass sie die emotionale Seite der Kindesentwicklung weitgehend unbeachtet lassen. Kinder haben aber nicht nur Gedanken, sondern auch Gefühle, und der Umgang mit Gefühlen verändert sich mit dem Alter. Meistens sind es gerade Probleme mit der Gefühlswelt, die Eltern dazu veranlassen, professionelle psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Ausführungen zur Dynamik, die hinter dieser emotionalen Entwicklung steht, finden sich bis heute vor allem in psychoanalytisch geprägten Entwicklungstheorien. Neuerdings gibt es jedoch eine ganze Reihe von theoretischen Ansätzen aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen, die versuchen, die Gefühls- und Kognitionsentwicklung direkt aufeinander zu beziehen. Einige Beispiele mögen den engen Zusammenhang zwischen beiden Bereichen verdeutlichen: Sprachentwicklung. Die Sprachentwicklung macht bekanntlich im Altern zwischen 2 und 6 Jahren entscheidende Fortschritte. Diese Fortschritte tragen ganz wesentlich mit dazu bei, dass Kinder ihre Gefühle auf sozial akzeptierte Weise zum Ausdruck bringen können. Sie können schimpfen anstatt zu schlagen, wenn sie wütend sind; sie können sich beschweren anstatt zu heulen, wenn ihnen Unrecht angetan wird, und sie können ihre Bedürfnisse 5 1.3 · Wie nützen entwicklungspsychologische Kenntnisse Kinder- und Jugendtherapeuten? differenziert mit Worten mitteilen. Die Entwicklung dieser Fähigkeiten hat Konsequenzen für das Verhalten. So weiß man etwa, dass insbesondere Kinder, die eine Sprache nicht beherrschen, eher zu aggressivem Verhalten neigen und soziale Schwierigkeiten haben. Die Sprache ist also eine kognitive Leistung mit wichtigen Implikationen für den Gefühlsausdruck und die Möglichkeit, in einen befriedigenden Austausch mit anderen Menschen zu kommen. Wir werden uns wesentliche Meilensteine der Sprachentwicklung aus diesem Grund später noch genauer vor Augen führen. Theory of Mind. Ein zweites Beispiel ist die Entwicklung einer »Theory of Mind«: gemeint ist die Fähigkeit, mentale Zustände anderer Personen zu repräsentieren. Dazu gehört etwa, dass man nachvollziehen kann, was eine andere Person weiß und was nicht oder welche Motive sie dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Auch diese Errungenschaft, die an ganz spezifische geistige Leistungen geknüpft ist, hat große Bedeutung für den Umgang mit eigenen Gefühlen: In Auseinandersetzungen sind die Chancen, befriedigende Lösungen für beide Seiten zu finden, wesentlich größer, wenn man sich in die Lage des Gegenübers versetzen kann. Außerdem hilft einem diese Form der »sozialen Intelligenz« ganz allgemein, befriedigende Beziehungen mit anderen Menschen zu haben. Sie macht Mitgefühl und gegenseitiges Verständnis überhaupt erst möglich. Auch hier zeigt sich folglich der enge Zusammenhang zwischen Denken und Fühlen, der für therapeutische Prozesse von Relevanz ist. Obwohl die Entwicklung einer Theory of Mind ihrerseits systematische Bezüge zur Sprachentwicklung aufweist, stellt sie dennoch einen eigenen Forschungsbereich dar, der in der modernen Entwicklungspsychologie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Auf entsprechende Befunde werden wir daher später noch eingehen. gang mit Gefühlen und die Verhaltensplanung. Indem wir heute nach hirnphysiologischen Korrelaten für beobachtbares Verhalten fragen, wird uns deutlich, wie eng verschränkt die kognitive und emotionale Entwicklung sind. Gleichzeitig wird damit klar, wie wichtig es ist, die biologische Perspektive mit im Blick zu behalten, wenn wir entwicklungspsychologische Voraussetzungen der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen diskutieren. In diesem Zusammenhang mag es interessant sein zu erfahren, dass auch die Sprachproduktion und die Entwicklung einer Theory of Mind mit Frontalhirnfunktionen in Verbindung gebracht werden. > Fazit Unsere Sicht auf Kinder hat sich seit Beginn der psychologischen Forschung entscheidend verändert. Heute ist uns bewusst, dass das Verhalten von Kindern und Jugendlichen nicht in jeder Hinsicht auf gleichen Voraussetzungen basiert wie das von Erwachsenen. Ein Grund dafür ist die biologische Reifung des Gehirns. Ein weiterer Grund sind noch fehlende Kompetenzen in einzelnen Bereichen des Denkens und Fühlens, die als Grundlage für höhere mentale Leistungen dienen und die erst ganz allmählich aufgebaut werden. Wer das Verhalten von Kindern in seiner Veränderung mit dem Lebensalter richtig verstehen will, muss behaviorale, mentalistische und biologische Aspekte von Entwicklung gleichermaßen beachten. Ausgehend von diesen Grundannahmen soll im nächsten Abschnitt ausgeführt werden, in welcher Hinsicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit altersbedingten Veränderungen für Verhaltenstherapeuten nützlich sein kann. 1.3 Neurobiologie. Ein drittes Beispiel weist auf einen ganz neuen Trend innerhalb der entwicklungspsychologischen Forschung hin: Heute interessieren wir uns verstärkt für die neurobiologischen Grundlagen, die Verhalten erklären: So ist die Fähigkeit zur exekutiven Kontrolle (zur Kontrolle darüber, welches Verhalten wann wie gezeigt wird) für planvolles Handeln genauso unabdingbar wie für die Kontrolle von Gefühlsäußerungen. Die Entwicklung kognitiver und emotionaler Fähigkeiten hängt also auch hier eng miteinander zusammen. Das ist kein Zufall, sondern lässt sich damit erklären, dass im Gehirn in beiden Fällen ein evolutionär besonders junger Bereich, das Frontalhirn, zur Steuerung dieser Funktion wichtig ist. Wie wir inzwischen wissen, reift das Frontalhirn vergleichsweise spät. Das gilt sowohl für die Verschaltung der Nervenzellen untereinander als auch für die Myelinisierung (die Isolierung einzelner Neurone). Außerdem verändert sich die Hormonproduktion noch einmal ganz wesentlich während der Pubertät, und das hat ebenfalls Konsequenzen für den Um- Wie nützen entwicklungspsychologische Kenntnisse Kinderund Jugendtherapeuten? Die Relevanz entwicklungspsychologischer Forschung als Grundlage der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen lässt sich an drei Kernthemen verdeutlichen: 4 Entwicklungsnormen, 4 Entwicklungsaufgaben und 4 altersabhängige Kompetenzen. Entwicklungsnormen Kinder und Jugendliche verhalten sich in vielen Situationen anders als Erwachsene und können daher nur bedingt an den Normen für Erwachsene gemessen werden. So ist es zwar nicht unbedingt wünschenswert, aber durchaus im Bereich des Normalen, wenn ein Grundschüler sich im Streit mit anderen rauft – im Erwachsenenalter wäre ein vergleichbares Verhalten dagegen von der Norm abweichend. 1 6 1 Kapitel 1 · Entwicklungspsychologische Grundlagen > Die Entwicklungspsychologie bietet Definitionen des Normalen und Abweichenden, die altersspezifisch sind. Eine detaillierte Kenntnis solcher Normen ist wichtig für Störungskonzeptionen und die Beurteilung der Therapiebedürftigkeit im Einzelfall. Entwicklungsaufgaben Im Laufe seines Lebens muss der Mensch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Entwicklungsaufgaben meistern. Beispielsweise muss ein Kleinkind lernen, seine Körperfunktionen allmählich selbst zu kontrollieren, ein Kindergartenkind muss lernen, sich in größeren sozialen Gruppen auch ohne Anwesenheit primärer Bezugspersonen zurechtzufinden, von einem Grundschüler wird erwartet, dass er sich an die Regeln des Schulalltags hält und Leistungsbereitschaft zeigt, und ein Jugendlicher steht vor der Herausforderung, seinen Umgang mit dem anderen Geschlecht neu zu bestimmen. Die Gesellschaft beurteilt Kinder danach, wie gut sie diese Entwicklungsaufgaben zur rechten Zeit erfüllen. Gelingt ihnen dies nicht, so kann das ein wichtiges Motiv für eine Verhaltenstherapie sein. ! Entwicklungspsychologische Theorien geben Aufschluss darüber, welche Entwicklungsaufgaben in welchem Alter relevant sind. Daraus ergeben sich insbesondere die Therapieziele (z. B. Autonomie, Selbststeuerung, Identitätsentwicklung). Altersabhängige Kompetenzen Auch wenn es für alle Altersstufen allgemeine Prinzipien des Lernens und der Verhaltensmodifikation gibt, ist es doch nicht das Gleiche, wenn man einem Zweijährigen helfen möchte, sein Verhalten zu ändern, als wenn man das mit einem Jugendlichen versucht. Je jünger ein Kind ist, desto wichtiger sind Eltern für den Therapieerfolg. Je älter die Kinder werden, desto bedeutsamer sind Gespräche und eigene Einsichten. Zudem durchläuft das Gehirn in bestimmten Phasen der Entwicklung wesentliche Reifungsschritte, die für die Verhaltenssteuerung, das Denken und Fühlen des Kindes und damit für die Auswahl geeigneter Interventionsmöglichkeiten durch den Therapeuten von Bedeutung sind. ! Die Entwicklungspsychologie bietet Anhaltspunkte dafür zu beurteilen, welche Interventionsformen für welche Altersstufen besonders Erfolg versprechend sind. Sie klärt, ob wichtige soziale, emotionale und kognitive Voraussetzungen für die Durchführung von Interventionsprogrammen in einem gegebenen Alter erfüllt sind. Bereits vorliegende Beiträge zu entwicklungspsychologischen Voraussetzungen für die Therapie von Kindern und Jugendlichen beziehen sich vorzugsweise auf Entwicklungsnormen oder Entwicklungsaufgaben (Borg-Laufs u. Trautner 1999). In Ergänzung und Erweiterung solcher Beiträge wollen wir das Hauptaugenmerk auf altersabhängige kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen richten, da diese als Voraussetzung für die Umsetzung von verhaltenstherapeutischen Konzepten von herausragender Bedeutung sind. Diese Orientierung scheint vor dem Hintergrund jüngster Entwicklungen besonders nützlich, da sich gerade in den letzten Jahren verhaltenstherapeutische Konzepte etabliert haben, die auf komplexen Lernprinzipien basieren und höhere kognitive Leistungen und Selbststeuerungsprozesse vom Klienten erwarten. Während Interventionsansätze früher sehr stark lerntheoretisch orientiert waren (klassisches und operantes Konditionieren) führte die kognitive Wende in der Verhaltentherapie dazu, dass heute neben der Veränderung der funktionellen Bedingungszusammenhänge die Veränderung von vermittelnden Gedanken, Situationswahrnehmungen, Überzeugungen und Einstellungen im Mittelpunkt der Therapie stehen (Lauth et al. 2001). Das therapeutische Arbeiten an und mit den Kognitionen erfordert aber sprachliche Interventionsstrategien, wie beispielsweise Selbstexploration oder Selbstinstruktion. In der Folge entstand eine Reihe von Therapiemanualen mit vielfältigen Übungen insbesondere zur sozialen Wahrnehmung sowie zum Aufbau geeigneter Selbstanweisungen, die vom Patienten in der Therapie geübt und in den Alltag übertragen werden sollen (Reduzierung aggressiven Verhaltens, Abbau von Impulsivität). Diese Erweiterung des Methodenspektrums stellt höhere Anforderungen an den Patienten. Das gilt etwa für seine Ausdrucksmöglichkeiten, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Wahrnehmung eigener Gefühle oder die Einsicht in das Verständnis in die Situation anderer sowie das planvolle Handeln. Neben der Betonung der altersspezifischen Voraussetzungen für den Therapieprozess verfolgt der vorliegende Beitrag noch ein weiteres Ziel: Er will den Bereich der frühen Kindheit, der von der Verhaltenstherapie bislang nicht explizit aufgegriffen wurde, stärker beleuchten. Dieser neue Fokus scheint gleich aus mehreren Gründen sinnvoll: Zunächst wird eine Analyse der Kompetenzen von Säuglingen und Kleinkindern dokumentieren, dass verhaltenstherapeutische Interventionen auch schon für diese Altersgruppe interessant sind. So werden wir zeigen, dass die Basislernformen, auf denen Verhaltensprogramme für ältere Kinder aufbauen, bereits Neugeborenen zur Verfügung stehen. Bedenkt man zudem, dass eine Vielzahl von Verhaltensstörungen ihre Wurzeln in Erfahrungen der frühen Kindheit haben, dann scheint es naheliegend, rechtzeitig einzuschreiten, bevor sich Teufelskreisläufe und schlecht angepasste Verhaltensmuster fest etablieren. Während es für die frühe Säuglingszeit überwiegend therapeutische Konzepte auf systemischer und tiefenpsychologischer Grundlage gibt (Reck et al. 2001), sind verhaltenstherapeutische Interventionen für diese Altersgruppe noch im Entstehen und müssen weiter etabliert werden (Papousek et al. 2001). 7 1.4 · Verschiedene Lernformen und ihre Entwicklung Ausgehend von dieser Überlegung wollen wir im nächsten Schritt zunächst verschiedene Lernformen besprechen, die für die Verhaltenstherapie relevant sind. Dabei werden wir jeweils aufzeigen, welche Anforderungen ein solches Lernen an das Kind stellt, welche Voraussetzungen zur Umsetzung das Kind von Beginn an mitbringt und welche Fähigkeiten es erst im Verlauf seiner Entwicklung erwirbt. Anschließend werden für eine Auswahl von kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen, die im Rahmen von Therapieprozessen eine entscheidende Rolle spielen, wichtige Meilensteine der Entwicklung näher erläutert. Wir analysieren entwicklungspsychologische Voraussetzungen für verhaltenstherapeutische Interventionen damit aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: zunächst aus der Perspektive der Lerntheorie und dann aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie. ! Da die kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten bei Kindern erst in Entwicklung befindlich sind, bedarf es differenzierter Kenntnisse seitens des Therapeuten bezüglich des Leistungsniveaus von Kindern eines gegebenen Alters, um geeignete Interventionen auswählen zu können. 1.4 Verschiedene Lernformen und ihre Entwicklung In der Verhaltenstherapie spielen neben der klassischen und operanten Konditionierung auch das Beobachtungslernen sowie das Lernen durch Problemeinsicht eine wichtige Rolle. Auf jede dieser Lernformen und ihre Entwicklung wird nachfolgend ausführlicher eingegangen (vgl. hierzu auch 7 Kap. I/5 und I/8). 1.4.1 Klassische Konditionierung Die klassische Konditionierung ist eine der elementarsten Lernformen. Sie setzt voraus, dass es eine unbedingte, natürliche Reaktion auf eine gegebene Reizart gibt. Beim Pavlow’schen Hund erzeugt der Anblick von Futter (unkonditionierter Stimulus, UCS) eine Speichelreaktion (unkonditionierte Reaktion, UCR). Auch beim Neugeborenen gibt es unbedingte Reaktionen auf bestimmte Reize. So fängt ein hungriges Babys sofort an, nach der Mutterbrust zu suchen (UCR), sobald es Kontakt mit menschlicher Haut hat (UCS). Tritt nun kurz vorher immer ein konditionierter Reiz auf – ein Reiz also, der allein keine Reaktion auslöst (z. B. ein Glockenton), so lernt der Pavlow’sche Hund, ihn als Hinweis zu interpretieren und zeigt die Speichelsekretion auch dann, wenn der Glockenton nicht vom Futter gefolgt wird (konditionierte Reaktion, CR). In ähnlicher Weise kann man beobachten, dass hungrige Neuge- borene bevorzugt immer dann nach der Brust suchen (CR), wenn sie auf dem Arm ihrer Mutter sind. Sie haben offensichtlich innerhalb kürzester Zeit gelernt, den spezifischen Körpergeruch und die Stimme der eigenen Mutter als Hinweis auf eine baldige Nahrungszufuhr zu interpretieren (CS). Auch wenn solche klassischen Lernleistungen beeindruckend erscheinen mögen, wurden sie doch lange in ihrer Bedeutung überschätzt. Wie Tierversuche eindrucksvoll belegen, wird Mutterliebe nicht nur durch die Suche nach Nahrung geprägt: Erhielten junge Äffchen, die man von ihrer Mutter getrennt aufzog, immer nur bei einer Drahtgestell-Mutter Milch, nicht aber bei einer Fellmutter, dann hielten sie sich trotzdem nur zur Nahrungsaufnahme bei der Drahtgestell-Mutter auf und suchten ansonsten die Nähe zur Fellmutter. Wenn Babys sich allein bewegen könnten, würden sie sich sicher ähnlich verhalten (Harlow u. Zimmerman 1959). Beispiel An einem anderen Beispiel für frühe Lernleistungen konnte man zeigen, dass Neugeborene beim Erklingen einer Melodie, zu der sich ihre Mutter in der Schwangerschaft regelmäßig entspannt hat, postnatal ebenfalls mit Entspannung reagieren. Offensichtlich hörte der Fötus den unkonditionierten Reiz (hier: die Melodie), und weil das Hören der Melodie physiologisch mit Entspannung gekoppelt war – zunächst, indem es den Körper der Mutter entspannte und auf diese Weise auch beim Kind Wohlbehagen auslöste –, wurde die Melodie zu einem Hinweisreiz auf Entspannung, der postnatal zu entsprechenden Reaktionen beim Kind führte (DeCaspar u. Spence 1986). Allerdings besteht ein großer Teil früher Lernerfahrungen auch aus der Koppelung von Reizen und negativen Erlebenszuständen, wie Schmerz. Das Pieksen in den Fuß zwecks Blutentnahme ist ein typisches Beispiel für einen schmerzhaften unkonditionierten Stimulus. Diese Erfahrung löst beim Neugeborenen mit einiger zeitlicher Verzögerung den Rückzug des Fußes aus (UCR). Geht dem Pieksen (UCS) regelmäßig ein neutraler Reiz voraus (z. B. die Desinfektion der Einstichfläche, CS durch einen Arzt), dann löst diese an sich harmlose Pflegemaßnahme schon nach wenigen Wiederholungen beim Kind Rückzugsverhalten aus (CR). Konditionierungsprozesse können die Desinfektion zu einem Hinweisreiz (CS) auf eine nahende Bedrohung machen und schließlich zu Abwehrverhalten beim Anblick des Artztes führen. Dieses Problem lässt sich häufig bei Frühgeborenen beobachten, die im Rahmen medizinischer Maßnahmen vergleichsweise oft Schmerz auslösenden Situationen ausgesetzt sind. 1 8 1 Kapitel 1 · Entwicklungspsychologische Grundlagen Beispiel Auch im sozialen Bereich gibt es Belege für frühe Konditionierungsprozesse auf negative Reize: So hat man etwa festgestellt, dass Kinder von depressiven Müttern, denen es oft schwerfällt, in direkten Interaktionen mit ihrem Kind einen gelungenen Austausch von positiven Gefühlen zu etablieren, schon mit 3–4 Monaten aktives Blickvermeidungsverhalten zeigen, wenn sie mit ihren Müttern (aber nicht unbedingt mit anderen Personen) kommunizieren (Reck et al. 2001). Sie assoziieren einen bestimmten emotionalen Gesichtsausdruck der Mutter (CS) mit Stress oder Aversion (UCS) und reagieren mit Abwendung und Unbehagen (CR). Die genannten Beispiele sollen Folgendes verdeutlichen: ! Die Voraussetzungen für klassische Konditionierungsprozesse sind bereits ab dem Säuglingsalter gegeben. Sie führen dazu, dass an sich neutrale Reize eine positive oder negative Bedeutung erlangen und als Hinweisreize für bestimmte Reaktionen des Kindes dienen. Ganz allgemein sind konditionierte Reaktionen wichtig, damit das Kind von Anfang an ein Bewertungssystem aufbauen kann und Hinweise zur Vorhersage für später folgende Ereignisse nutzen lernt. Prinzipiell ist es von Geburt an möglich, klassische Konditionierungsprozesse einzusetzen, um das Verhalten von Kindern zu steuern. Dies geschieht im Alltag ganz automatisch und ungeplant. Es kann aber auch bewusst eingesetzt werden, um das Verhalten des Kindes zu beeinflussen. Petermann (2003) benennt verschiedene Methoden der Kinderverhaltenstherapie, die auf klassischer Konditionierung beruhen: 4 die Aversionsbehandlung, 4 das Entspannungstraining und 4 die systematische Desensibilisierung. Für ältere Kinder spielen andere Lernformen, wie etwa die operante Konditionierung oder das Beobachtungslernen insgesamt eine größere Rolle. 1.4.2 Operante Konditionierung Im Unterschied zur klassischen Konditionierung gilt für die operante Konditionierung, dass ein spontan auftretendes Verhalten durch Belohnung oder Bestrafung, die der Reaktion nachfolgt (Konsequenz), in seiner Auftretenshäufigkeit beeinflusst wird. Auch diese Lernform ist sehr früh nachweisbar, wie Säuglingsstudien belegen. Ganz allgemein scheint es bemerkenswert, dass gerade zu Beginn des Lebens die Auswahl an materiellen Verstärkern vergleichs- weise gering ist (z. B. Milch), während eine ganze Palette unterschiedlicher sozialer Verstärker, die einen positiven zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen (z. B. Lächeln, Ammensprache, Streicheln) zur Verfügung stehen. Wie das Beispiel zur Saugpräferenz (s. unten) anschaulich dokumentiert, können auch in der frühkindlichen Entwicklung Handlungsverstärker (hier: vertraute Geschichte hören) zum Einsatz kommen. Beispiel Das Saugpräferenzparadigma (DeCaspar u. Fifer 1980) Um nachzuweisen, dass sich Föten an während der Schwangerschaft vorgelesene Geschichten erinnern können, setzte man wenige Tage alten Babys einen Kopfhörer auf und erfasste zunächst, wie häufig sie spontan saugten. Dann spielte man ihnen entweder eine Geschichte ein, die sie noch nicht kannten, oder die bereits vertraute Geschichte (beide von einer fremden Person vorgelesen). Welche Geschichte zu hören war, hing von ihrer Saugrate ab: Die Hälfte der Kinder musste schneller saugen, um die vertraute Geschichte zu hören, und die andere Hälfte der Kinder musste langsamer saugen. Die Kinder lernten sehr schnell, ihr Nuckelverhalten so anzupassen, dass sie die vertraute Geschichte zu hören bekamen. Hieran sieht man, dass neben primären Verstärkern, wie etwa Nahrung, auch sekundäre Verstärker, wie etwa ein vertrautes Lautmuster, zur Verhaltenssteuerung (hier: der Steuerung des Nuckelverhaltens) eingesetzt werden können. Neues Wissen über die Gehirnentwicklung passt zur Beobachtung früher Lern- und Gedächtnisprozesse: Demnach scheint der Hippocampus, eine Struktur im Temporallappen, die beim Lernen und Erinnern sowie bei der Zuordnung von unterschiedlichen Gedächtnisinhalten eine zentrale Rolle spielt, bereits zum Zeitpunkt der Geburt weit entwickelt zu sein. Der Hippocampus ist eng verschaltet mit dem limbischen System, das als Gefühls- und Bewertungszentrum des Menschen diskutiert wird. Man kann also zunächst einmal davon ausgehen, dass Babys prinzipiell als lern- und erinnerungsfähige Wesen im umfassenden Sinne zur Welt kommen. Ferner ist es möglich, ihr Verhalten sowohl über klassische als auch operante Konditionierung zu steuern. Dabei sind neben primären auch sekundäre Verstärker unterschiedlicher Art wirksam. Bis heute ist noch sehr wenig darüber bekannt, ob unterschiedliche Verstärkerpläne bei Säuglingen und Kleinkindern eine vergleichbare Wirkung haben wie bei älteren Kindern und Erwachsenen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Prinzipien der Kontingenz (enge zeitlich Koppelung von auftretendem Verhalten und folgender Verstärkung), der Reihenfolge (erst Zielverhalten, dann Ver- 9 1.4 · Verschiedene Lernformen und ihre Entwicklung stärkung) sowie Wiederholung (kontinuierliche oder zumindest intermittierende Verstärkung) für alle Altersgruppen gleichermaßen wichtig sind. Beobachtungen aus Interaktionsstudien legen den Schluss nahe, dass bei jüngeren Kindern ein hohes Maß an Kontingenz für den Aufbau neuer Reaktionsweisen sehr wichtig sein dürfte. Das zeigt sich besonders anschaulich am Lernen von kommunikativem Verhalten: Mütter/Väter, die mit ihren Säuglingen so umgehen, dass sie in aller Regel prompt und angemessen auf die Kommunikationssignale ihres Kindes reagieren, schaffen damit die Basis für ein sicheres Bindungsverhalten und fördern die Tendenz ihrer Kinder, sich mitzuteilen (Papousek et al. 2001). Dabei sollten die Reaktionen der Eltern in der Regel zeitlich eng an die Äußerungen des Kindes gekoppelt sein. Außerdem muss es sich um ein stabiles Antwortmuster handeln. Mütter/Väter, die sich wenig kontingent verhalten und widersprüchliche Signale aussenden, erzeugen unsicheres Bindungsverhalten. Bereits wenige Monate alte Säuglinge quittieren dies durch Blickabwendung und geringe Kommunikationsbereitschaft gegenüber den betreffenden Personen. Konditionierungsprozesse sind von Geburt an möglich. Ob die Anzahl von Wiederholungen zum Aufbau einer konditionierten Reaktion in jüngeren Jahren kleiner oder größer ist als bei älteren Kindern, wissen wir noch nicht sicher. Die Beantwortung dieser Frage dürfte stark mit der Art des zu lernenden Inhalts variieren. Die Eltern werden umso eher Einfluss auf das Verhalten des Kindes haben, je eindeutiger sie bestimmte Hinweisreize setzen, je besser sie darauf achten, dass das Kind in einem lernbereiten Zustand (aufmerksam) ist, wenn der Hinweisreiz gegeben wird und je zuverlässiger auf den unbedingten Reiz bzw. auf die spontane Verhaltensweise bedeutsame Konsequenzen folgen. Zu beachten gilt es ferner, dass sozialen Verstärkern, wie Zuwendung und Ansprache, von Geburt an ein großer Stellenwert beizumessen ist. Was sich mit dem Alter verändert, ist vor allem, wie unmittelbar die Belohnung auf das erwünschte Verhalten folgen muss. Während eine prompte Reaktion, die in Mimik und Sprachmelodie eindeutig erkennbar sein sollte, für Säuglinge extrem wichtig ist, können Dritt- oder Viertklässler durchaus auch sehr indirekte Formen der Anerkennung, wie etwa eine gute Schulnote, die erst eine Woche nach der gezeigten Leistung als Belohnung zum Tragen kommt, mit dem gewünschten Verhalten (hier: für die Schule üben) in Verbindung bringen. Kindergartenkinder und jüngere Grundschüler befinden sich in einem Zwischenstadium. Sie profitieren stärker von direkt spürbaren Konsequenzen ihres Verhaltens, sind z. T. aber auch schon in begrenztem Umfang zu Belohnungsaufschub in der Lage. Wichtig ist es in diesen Fällen, den Zusammenhang zwischen Verhalten und Konsequenz verbal zu verdeutlichen, da diese Verdeutlichung gleichzeitig als Gedächtnisstütze dient und die Reflexion über das eigene Handeln und seine Folgen fördert. Wachsende Gedächtnis- und Sprachkompetenzen sind also ganz wesentlich für die Fähigkeit von Kindern, Belohnungsaufschub akzeptieren zu können. Die Verwendung von Tokensystemen, die bei der operanten Konditionierung im Rahmen der Kindertherapie eine herausragende Rolle spielt (Lauth et. al. 2001, 7 Kap. III/13), setzt Symbolverständnis voraus, denn das Kind muss verstehen, dass die erworbenen Tokens (Punkte, Sternchen, Smileys etc.) für konkrete Belohnungen stehen, die zu einem späteren Zeitpunkt in materielle oder soziale Verstärker umgetauscht werden können. Grundschulkinder lernen, sich auf etwas zu freuen. Zusätzlich finden in der Schule Lernprozesse statt (wie etwa das Grundrechnen auch mit Geld), die ihnen die Bedeutung von Tokens nahebringen. Der Umgang mit solchen Systemen macht ihnen auch aus diesem Grund häufig Spaß. Folglich gibt es verschiedene entwicklungspsychologische Gründe, warum Tokensysteme im Rahmen der operanten Konditionierung ab dem Grundschulalter besonders gut anwendbar sind. ! Eine Verhaltensformung im Sinne von klassischer und operanter Konditionierung findet von Geburt an statt, die primären Bezugspersonen spielen dabei eine zentrale Rolle. 1.4.3 Beobachtungslernen Wie die beiden vorangegangen Lernformen, so kann auch das Beobachtungslernen von früh an nachgewiesen werden. Sieht man einmal von der Neugeborenenimitation ab, die sich auf einfache mimische Gesten beschränkt, kann man ab dem 3.–4. Lebensmonat auch die gezielte Nachahmung von einfachen Handlungen beim Kind beobachten, die vor allem in direkter Interaktion von Angesicht zu Angesicht zum Tragen kommt. Babys werden in der Folge zu aufmerksamen Betrachtern ihrer Umgebung. Sie lieben es, Erwachsenen bei Haushaltstätigkeiten zuzusehen, und sobald es ihre motorischen Kompetenzen erlauben, ahmen sie dieses Verhalten nach. Das zeigt sich z. B. am Werkzeuggebrauch: Spielzeugmodelle realer Objekte werden bereits gegen Ende des 1. Lebensjahres in ihrer funktionsspezifischen Weise gehandhabt: Die Bürste wandert zum Kopf, das Handy ans Ohr, das Puppentässchen zum Mund, und das Auto wird über den Tisch geschoben. Die Mimik und der Tonfall der Eltern oder von Geschwisterkindern werden ebenfalls imitiert. Auffällig ist dabei, dass Kinder zu Beginn des 2. Lebensjahres vor allem an den Zielen einer Handlung interessiert sind. Das bedeutet, dass sie unter Umständen nicht das exakte Verhalten eines Erwachsenen nachahmen, aber das Verhaltensziel übernehmen. Es interessiert sie also weniger das Wie als das Was. Erst etwas später, ab Mitte des 2. Lebensjahres, bemühen sie sich, eine beobachtete Verhaltensweise in möglichst ähnlicher Weise auszuführen wie das Vorbild (Hurley u. Chater 2006). Wichtig erscheint an dieser Stelle der Hinweis, dass auch der Umgang mit Aus- 1 10 1 Kapitel 1 · Entwicklungspsychologische Grundlagen einandersetzungen, die für Kinder emotional bedeutsam sind, aufmerksam verfolgt wird. Die Bedeutung von Lernen durch Beobachtung verstärkt sich im Verlauf der Kleinkind- und Kindergartenzeit noch weiter. Imitiert werden bevorzugt Modelle, die für das Kind wichtig sind. Das können Erwachsene, aber auch Altersgenossen sein. Die Imitation erfolgt nicht immer unmittelbar, sondern kann unter Umständen auch erst Tage später zum Tragen kommen. Im Alltag lässt sich diese Vorliebe zum Imitieren u. a. am Spielverhalten der Kinder beobachten: Das Rollenspiel, in dem Kinder in unterschiedliche Persönlichkeiten schlüpfen, ist im Kindergartenalter besonders verbreitet – nicht zuletzt deshalb, weil Kinder in dieser Spielform üben können, in die Haut anderer zu schlüpfen und deren Verhaltensrepertoire aktiv zu spiegeln. Während in früher Kindheit vor allem Eltern und Geschwister für Imitationshandlungen als Vorbild dienen, nimmt ab dem Kindergartenalter die Bedeutung von Peers immer weiter zu. Kinder imitieren mit höherer Wahrscheinlichkeit Modelle, die ihnen ähnlich sind, und bevorzugen solche Verhaltensweisen, für die das Modell vor ihren Augen belohnt wird. Dabei kann die Interpretation dessen, was als Belohnung wahrgenommen wird, durchaus variieren: Ein jüngeres Kind, das Zuwendung und Aufmerksamkeit vermisst, und beobachtet, wie sich die Erzieherin länger mit einem anderen Kind unterhält, welches zuvor jemanden geschlagen hat, wird diese Form der Zuwendung möglicherweise als Belohnung für das aggressive Verhalten deuten und mag demnächst versuchen, auf ähnliche Weise Zuwendung zu erhalten. Ein anderes Kind, das Aufmerksamkeit und Zuwendung nicht in gleicher Weise vermisst, muss nicht den gleichen Effekt zeigen. In ähnlicher Weise mag ein Jugendlicher, der beobachtet, wie ein anderer Jugendlicher für riskantes Verhalten Achtung und Respekt durch seine Peers erfährt, sich geneigt fühlen, selber auch riskantes Verhalten zu zeigen, um Anerkennung zu erlangen – und zwar mit umso größerer Wahrscheinlichkeit, je abhängiger er von der Wertschätzung seiner Peers ist. ! Was sich hier mit dem Alter verändert, ist vor allem der Bezugsrahmen für die Interpretation von Belohnung: Bei jüngeren Kinder spielt das Verhalten und die Bewertung durch Erwachsene eine zentrale Rolle, aber mit zunehmendem Alter steigt die Relevanz der Bewertung durch Gleichaltrige immer weiter an. Soziale Zuwendung und Aufmerksamkeit durch andere bleiben konstante Motive, die Beobachtungslernen wahrscheinlich machen. Es können immer nur solche Handlungen imitiert werden, die im Verhaltensrepertoire des betreffenden Kindes oder Jugendlichen liegen. Naturgemäß erweitert sich damit das Spektrum der potenziell nachahmbaren Handlungen mit dem Alter – schon allein, weil die motorischen Kompetenzen zunehmen. In den meisten verhaltenstherapeutischen Therapiekonzepten wird das Lernen am Modell als wichtiger Wirk- faktor angesehen. Zum einen vermittelt der Therapeut selbst als Modell, wie eine bestimmte Anforderung bewältigt werden könnte (»teilnehmendes Modelllernen«). So beinhaltet z. B. das »Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern« nach Lauth und Schlottke (2002) wiederholte Demonstrationen des Therapeuten zum Problemlösen: [er] löst eine Aufgabe und demonstriert, wie er vorgeht. Er verdeutlicht sein Vorgehen, um die Regeln und Strategien zu veranschaulichen, denen er folgt (Lauth u. Schlottke 2002, S. 127). Zum anderen stehen Therapiematerialien zur Verfügung, die zeigen, wie sich andere Personen/Kinder in einer bestimmten Situation verhalten bzw. mit welchen Strategien sie bestimmte Konflikte lösen (symbolisches/medienvermitteltes Modelllernen; z. B. »Wackelpeter & Trotzkopf« aus Döpfner et al. 2002). Damit Kinder von solchen therapeutischen Maßnahmen profitieren können, müssen sie aber bereits in der Lage sein, Gemeinsamkeiten zwischen sich und dem Modell herzustellen und das Verhalten der anderen Person auf ihre eigene Situation übertragen können. Wie bereits dargelegt, entwickeln sich die entsprechenden Kompetenzen im Verlauf der Grundschulzeit. ! Im Rahmen der Behandlung von Verhaltensstörungen ist es wichtig zu explorieren, welche Personen für das Kind besonders wichtig sind und wem es nacheifern möchte. Dabei gilt zu beachten, dass unerwünschte Verhaltensweisen unter Umständen durch Lernen am Modell zustande gekommen sein können. 1.4.4 Lernen durch Einsicht Einsicht setzt die Fähigkeit zur Reflexion voraus. Mit Reflexion ist nichts anderes gemeint, als dass man über ein gegebenes Problem, über eine Situation oder ein Verhalten bewusst nachdenkt. Doch nicht nur ein Nachdenken über externe Situationen spielt für die psychische Gesundheit und Therapie eine große Rolle, sondern ebenso die Fähigkeit zur Reflexion über die eigene Person und das eigene kognitive und emotionale Erleben. Dieses bewusste Nachdenken ist nicht notwendigerweise an Sprache gebunden. So konnten wir in eigenen Studien dokumentieren, dass selbst 7 Monate alte Babys über Ursache und Wirkung nachdenken und komplex unterschiedliche Arten von Erfahrungen integrieren, um eine gegebene Situation zu interpretieren. Doch trotz solcher eindrucksvoller Denkleistungen im vorsprachlichen Alter darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Sprache sehr wichtig für die Vermittlung von Einsichten durch Dritte ist, wie dies vor allem im Rahmen von therapeutischen Prozessen der Fall ist. Im vorliegenden Fall interessieren dabei insbesondere Einsichten in Verhaltensnormen, die nachfolgend näher beleuchtet werden: 11 1.4 · Verschiedene Lernformen und ihre Entwicklung Jüngeren Kindern bis Eintritt in das Schulalter gelingt es nur schwer, eigene Fehler einzusehen; im Allgemeinen verinnerlichen sie Verhaltensregeln, die ihnen von Erwachsenen oder Gleichaltrigen vermittelt werden, weitgehend unreflektiert und stellen Abweichungen von dieser Regel fest, ohne die Regeln selbst zu begründen oder zu hinterfragen. Dennoch macht es einen großen Unterschied, ob man Kindergartenkinder einfach nur für richtiges Verhalten belohnt und für falsches Verhalten bestraft oder ob man ihnen eine Begründung dafür gibt. Insbesondere müssen sie erst lernen zu verstehen, warum bestimmte zwischenmenschliche Regeln (z. B. sich nicht gegenseitig zu belügen, zu bestehlen, zu beleidigen oder zu schlagen; höflich zueinander zu sein, sich gegenseitig zuzuhören) wichtig für das Zusammenleben sind. Man kann dieses Verständnis fördern, indem man ihnen die Erklärung in konkreten Situationen liefert. Hört das Kind die Begründung solcher Regeln wiederholt, so erlangen diese allmählich an Bedeutung. Ein konkretes Beispiel mag die Wichtigkeit von Lernen durch Einsicht auch bei kleinen Kindern verdeutlichen: Beispiel Wenn ein fünfjähriger Junge ein anderes Kind auf der Straße schlägt, und seine Mutter reagiert darauf konsequent und prompt mit der Aussage: »Das macht man nicht! Du gehst jetzt sofort rein auf Dein Zimmer!«, dann hat sie gute Chancen zu erreichen, dass ihr Sohn seine Spielkameraden schon bald nicht mehr in ihrer Gegenwart schlägt, um zu vermeiden, dass er auf sein Zimmer gehen muss. Hier greift das Prinzip der operanten Konditionierung. Schaut die Mutter beim nächsten Mal aber gerade weg, dann gibt es aus der Sicht ihres Sohnes keinen Grund, das Hauen zu unterlassen, denn er hat noch nicht verstanden, warum er nicht schlagen soll. Die negativen Konsequenzen sind vor allem daran gebunden, dass die Mutter sieht, was geschieht. Ist sie abwesend, besteht keine entsprechende Gefahr. Stellen wir uns im Kontrast dazu eine Mutter vor, die ihrem fünfjährigen Sohn erklärt, dass er andere Kinder nicht schlagen darf, weil das weh tut. Um Lernen durch Einsicht zu fördern, bittet die Mutter ihren Sohn sich vorzustellen, selbst geschlagen worden zu sein. Gelingt diese Vorstellung, dann sind die Voraussetzungen dafür gegeben, einzusehen, warum man nicht schlagen soll. Auch wenn der Sohn vielleicht noch nicht in der Lage ist, sich wirklich in sein Opfer hineinzuversetzen, macht die Mutter auf diese Weise doch deutlich, dass es eine Erklärung gibt und regt an, nach Gründen für Verhalten oder Verhaltensregeln zu fragen. Diese Grundhaltung ist nicht selbstverständlich und muss Kindern erst durch Lernen am Modell vermittelt werden. In der Grundschulzeit konsolidieren Kinder ihr bisher gelerntes Wissen über den richtigen Umgang miteinander. Außerdem werden ihnen eine ganze Reihe neuer Regeln zusätzlich vermittelt. Nicht umsonst dominieren in dieser Zeit auch auf dem Schulhof oder zuhause Regelspiele – seien es Brettspiele, Sportspiele oder Kartenspiele. Kinder ermahnen sich gegenseitig zur Einhaltung der Regeln und stellen fest, was passiert, wenn man Regeln überschreitet, trickst oder sich unfair verhält. Kinder üben den »korrekten« Umgang miteinander – auch ohne Aufsicht von Eltern. Spätestens mit Beginn der Pubertät werden viele Regeln noch einmal neu hinterfragt. Der Jugendliche setzt sich nun aktiver als bisher mit den Erwartungen von Erwachsenen auseinander und kontrastiert sie mit Erwartungen von Gleichaltrigen und seinen eigenen Vorstellungen. Jetzt wird das Lernen durch Einsicht besonders wichtig, gleichzeitig aber auch schwieriger, weil es Pubertierenden im Allgemeinen nicht leicht fällt, sich Einsichten durch Erwachsene vermitteln zu lassen. Häufig sehen sich Eltern deshalb entweder mit verschlossenen Jugendlichen konfrontiert, die zuhause nicht über ihre Werte diskutieren wollen, oder mit solchen, die endlos diskutieren, um ihre Eltern von eigenen Vorstellungen zu überzeugen. ! Zunehmende Fähigkeiten, über kognitives und emotionales Erleben nachzudenken und sprachlich zu kommunizieren, ermöglichen eine bewusste Auseinandersetzung mit sozialen Regeln und Normen. Dies schafft die Voraussetzung für eine Verhaltensmodifikation durch Einsicht. > Fazit Alle wichtigen Lernformen sind von Geburt an im Repertoire von Kindern vorhanden. Das gilt sowohl für die klassische und operante Konditionierung als auch für das Beobachtungslernen und das Lernen durch Einsicht. Dennoch verändert sich ihre Umsetzung auf verschiedenen Ebenen. Dazu trägt einerseits die Verschiebung der potenziellen Verstärkermechanismen bei. In jedem Alter sind andere Verstärker wirksam, wobei soziale Anerkennung immer einen hohen Stellenwert einnimmt. Unmittelbare positive Gefühlsreaktionen von emotional bedeutsamen Personen sind von Geburt an wirksam; mit zunehmendem Sprachverständnis spielt Lob eine immer wichtigere Rolle, und ab dem Kindergarten- bzw. Grundschulalter, wenn Kinder das Prinzip des Belohnungsaufschubs verstehen, können Tokensysteme zum Einsatz kommen. Weiterhin verändert sich die Reflexionsfähigkeit über das eigene Tun, die vor allem sprachgebunden ist. Sie beeinflusst insbesondere höhere Lernformen wie etwa das Beobachtungslernen und das Lernen durch Einsicht. 1 12 1 Kapitel 1 · Entwicklungspsychologische Grundlagen 1.5 Entwicklungspsychologische Veränderungen mit Bedeutung für die Verhaltenstherapie Im nächsten Schritt werden ausgewählte Bereiche der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die für die Umsetzung verhaltenstherapeutischer Konzepte von besonderer Bedeutung sind, näher beleuchtet. Dazu zählen die Bereiche 4 kognitive Grundfunktionen: 5 Aufmerksamkeit, 5 Lernen und Gedächtnis; 4 emotionale Grundfunktionen: 5 emotionale Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit sowie 5 Selbstregulation; 4 soziale Grundfunktionen: 5 Sprache und Kommunikation sowie 5 Sozialverhalten und soziale Fertigkeiten. 1.5.1 Entwicklung kognitiver Grundfunktionen Das Ziel von Verhaltenstherapie ist Verhaltensänderung. Verhaltensänderung setzt ihrerseits Aufmerksamkeits-, Lern- und Gedächtnisprozesse beim Kind voraus. Wenn wir Verhaltensänderungen gezielt induzieren wollen, müssen wir folglich über die Entwicklung solcher basaler kognitiver Funktionen Bescheid wissen. Aufmerksamkeit Der Mensch verfügt grundsätzlich über limitierte geistige Ressourcen. Das fängt schon damit an, dass wir unsere Augen auf einen ganz bestimmten Bereich der Außenwelt lenken und auch nur einen eng umgrenzten Teil des Raumes scharf sehen. Innerhalb dieses Bereiches können wir unsere Aufmerksamkeit wiederum auf ganz bestimmte Teilaspekte richten und die fokussierten Teile besonders intensiv verarbeiten. Es ist also der Normalfall, dass ein Großteil der prinzipiell zur Verfügung stehenden Information nicht verarbeitet wird. Damit stellt sich die Frage, wie Kinder lernen, sich auf Teilaspekte zu konzentrieren. Solche Kenntnisse sind für Verhaltenstherapeuten gleich aus mehreren Gründen wichtig: Zum einen muss sichergestellt sein, dass Trainingsprogramme für Kinder ihren altersbezogenen Fähigkeiten entsprechen. Zum anderen sind Probleme mit der Aufmerksamkeitssteuerung häufig Anlass für therapeutische Interventionen. Auf die eher praktisch orientierten Aspekte wird später noch genauer eingegangen (7 Abschn. 1.5.2, »Selbstregulation«). An dieser Stelle sollen zunächst die Grundlagen der Aufmerksamkeitsentwicklung näher erläutert werden. Visuelle Aufmerksamkeit. Im Kontext der Wahrnehmung nimmt der Sehsinn eine zentrale Stellung ein: Beim Neuge- borenen ist das Sehen noch vergleichsweise schlecht entwickelt, und es dauert bis ca. Mitte des 1. Lebensjahres, bevor ein Kind annähernd so gut sehen kann wie ein Erwachsener. Auch das Zusammenspiel der beiden Augen, das für die Tiefenwahrnehmung bedeutsam ist, entwickelt sich im Verlauf des 1. Lebensjahres. Es scheint daher kaum verwunderlich, dass für die Steuerung des Blickverhaltens zunächst nur subkortikale Regionen im Gehirn (die im Stammhirn gelegenen Colliculi superiores) verantwortlich sind. Sie ermöglichen es dem Baby, von Geburt an auf bewegte Reize mit Blickzuwendung zu reagieren. Aber auch, wenn das Kind ein plötzliches Geräusch hört, dreht es seinen Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Etwas später, mit ca. 3–4 Monaten folgt eine Phase, die man »obligatory looking« nennt. Hat das Kind jetzt einmal einen Gegenstand fixiert, so »klebt« es förmlich daran und kann seinen Blick nicht ohne Weiteres wieder auf etwas anderes richten. Dieses Verhalten wird dann abgelöst durch willentlich gesteuerte visuelle Aufmerksamkeit, die das Kind in der Folge zunehmend schult. Diese willentlich gesteuerte Aufmerksamkeit ist gebunden an Hirnprozesse, die den Thalamus, das anteriore Cingulum sowie die frontalen Augenfelder einschließen (einen guten Überblick zur visuellen Aufmerksamkeitsentwicklung aus neurologischer Sicht gibt Johnson 2006). Man kann nun feststellen, dass der Aufmerksamkeitszustand eines Kindes variiert, während es einen Gegenstand fixiert. So unterscheidet man zwischen einfachem »looking« (Anschauen) und »examining« (Examinieren, Untersuchen), wobei der letztgenannte Zustand mit einer Verlangsamung des Herzschlags zusammenfällt, was seinerseits als Hinweis auf eine kortikale Beteiligung gewertet wird (Elsner et al. 2006). Kortikal vermittelte Prozesse ermöglichen es dem Kind auch, antizipatorisch fließende Blickbewegungen auszuführen: Wenn ein Objekt hinter einem Wandschirm verschwindet, eilt der Blick des Kindes dem Gegenstand nun voraus und erwartet ihn am anderen Ende des Wandschirmes. In Babyversuchen spielt die visuelle Aufmerksamkeit und die Blickpräferenz (als Maß des Interesses an einem Gegenstand) eine zentrale Rolle. Sie wird als Indikator für höhere Denkprozesse unter Beteiligung des Großhirns gewertet. Aufmerksamkeitsspanne. Auch im weiteren Leben eines Kindes ist sein Aufmerksamkeitsverhalten für das Lernen und Denken von entscheidender Bedeutung. Dabei gilt es zu beachten, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes im Normalfall mit zunehmendem Alter anwächst. Während ein Baby im Durchschnitt nur wenige Sekunden bis Minuten mit einem interessanten Gegenstand beschäftigt ist, fällt diese Spanne beim Kindergartenkind schon deutlich länger aus und beträgt etwa eine halbe Stunde. Im Grundschulalter sind Kinder unter Umständen auch mal eine ganze Stunde mit einem Objekt beschäftigt. Jugendliche oder Erwachsene bleiben schließlich bis zu mehreren 13 1.5 · Entwicklungspsychologische Veränderungen mit Bedeutung für die Verhaltenstherapie Stunden konzentriert und aufmerksam bei der Sache. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Möglichkeiten, den Gegenstand aktiv zu explorieren, also auch mit den Händen zu manipulieren, ebenfalls wachsen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Kind sein Interesse in aktiver Auseinandersetzung mit Objekten länger erhält. Aufmerksamkeitssteuerung. Wie bereits erwähnt, ist es für den therapeutischen Prozess von großer Bedeutung, die Aufmerksamkeitskapazitäten eines Kindes zu berücksichtigen – vor allem, wenn es um die Anregung neuer Lernprozesse geht. Aber noch ein zweiter Aspekt scheint an dieser Stelle wichtig zu sein. Aufmerksamkeitsprobleme können nämlich in zwei unterschiedlichen Richtungen bestehen: Entweder wird nicht genug Aufmerksamkeit/Konzentration aufgebracht, um einen gegebenen Reiz zu verarbeiten, oder die Aufmerksamkeit konzentriert sich zu stark auf ganz spezifische Aspekte und kann nicht von ihnen gelöst werden. Gerade bei jüngeren Kindern ist das Aufmerksamkeitssystem noch sehr stark außengesteuert. Eine ablenkende Umgebung macht es vielen von ihnen schwer, sich zu konzentrieren. Sie haben also vor allem Probleme der ersten Art. Die einseitige Fokussierung auf ganz spezifische Reize bei gleichzeitiger Ausblendung anderer Aspekte findet sich dagegen vermehrt im Jugendalter. Diese Veränderungen auf der Verhaltensebene haben u. a. mit physiologischen Reifungsprozessen zu tun. In einem späteren Abschnitt zum Thema Selbstregulation (unter 7 1.5.3) wird die Aufmerksamkeitssteuerung nochmals aufgegriffen und aus einer etwas anderen Perspektive beleuchtet. ! Nur in einem aufmerksamen Zustand ist das Kind wirklich aufnahmebereit. Gezielte Interventionen sollten nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass das Kind diese auch bewusst wahrnimmt. Lernen und Gedächtnis Verhaltenstherapeutische Maßnahmen wollen Verhalten ändern. Dies setzt Lern- und Gedächtnisprozesse voraus. Sämtliche bereits besprochenen Lernformen gründen sich auf die Fähigkeit von Kindern, Kontingenzen zu erkennen, Wissen zu vernetzen und Erfahrungen zu konsolidieren. Wie aber entwickeln sich diese Fähigkeiten? Bereits im Mutterleib beginnen Kinder, Erfahrungen dauerhaft zu speichern. Das konnte für unterschiedliche Sinnesmodalitäten, wie etwa das Riechen, Schmecken oder das Hören nachgewiesen werden. In Bezug auf die akustische Wahrnehmung belegen empirisch gut kontrollierte Studien, dass Babys die Stimme ihrer Mutter unmittelbar nach der Geburt wiedererkennen. Ebenso können sie sich offensichtlich an eine Geschichte erinnern, die ihnen in den letzten Wochen vor der Geburt einmal pro Tag laut vorgelesen wurde. Diese Befunde waren bereits im Zusammenhang mit klassischer und operanter Konditionierung besprochen worden. Implizites Lernen. Ein Lernmechanismus, der Kindern von Geburt an zur Verfügung steht, aber noch nicht besprochen wurde, ist das implizite Lernen. Darunter versteht man nichtbewusstes Lernen, das mehr oder weniger automatisch erfolgt. Auf der Seite des Gedächtnisses differenziert man zwischen a) prozeduralem Gedächtnis, das sich vor allem auf motorische Abläufe bezieht, und b) Priming, einer Art Bahnung zum Abruf von Gedächtnisinhalten durch die Wahrnehmung. Während im erstgenannten Fall das Kleinhirn und die Basalganglien beteiligt sind, spielt im zweiten Fall das Großhirn mit seinen für die Wahrnehmung zuständigen sensorischen Arealen eine entscheidende Rolle. Habituation und Dishabituation. Einen Lernmechanismus, der z. T. mit Priming in Verbindung gebracht wird, stellt die Habituation dar: Präsentiert man immer wieder den gleichen Reiz, dann wird ein Kind sich daran gewöhnen und mit der Zeit weniger stark darauf reagieren. Habituationsvorgänge lassen sich schon vor der Geburt beobachten, wenn Föten zunächst Schreckreaktionen (Blinzeln, Zucken) und eine Beschleunigung ihrer Herzrate zeigen, sobald man einen vibratorisch-akustischen Reiz durch die Bauchdecke der Mutter sendet. Diese Reaktion nimmt bei wiederholter Darbietung ab. Interessant scheint dabei, dass der gleiche Reiz auch nach 24 Stunden zu einer schwächeren Reaktion führt als bei seiner ersten Präsentation. Der Fötus hat sich also durchaus etwas gemerkt. Mit zunehmendem Alter wird das Behaltensintervall größer. Die Habituation/Gewöhnung an angstauslösende Situationen ist für die Verhaltenstherapie mit älteren Kindern und Erwachsenen wichtig. Konkret geht es um das Verfahren der Desensibilisierung. Wie wir aus Studien mit Föten schließen können, scheint Desensibilisierung, ähnlich wie Konditionierung, eine Lernform zu sein, der man sich von Anfang an bedienen kann, um Verhalten zu formen. Habituationsprozesse sind für Studien, die das frühe Lernen und Gedächtnis untersuchen wollen, ein überaus wichtiges Phänomen – vor allem in Kombination mit Dishabituationsprozessen, die immer dann auftreten, wenn nach Gewöhnung an einen Reiz ein anderer Reiz präsentiert wird, den das Kind als neu wahrnimmt und der deshalb eine Orientierungsreaktion (verstärkte Aufmerksamkeit) auslöst. Präsentiert man etwa ein bestimmtes Gesicht auf einem Foto, bis das Baby daran gewöhnt ist, und gibt ihm dann zwei Gesichter zur Auswahl – noch einmal das bereits bekannte und ein anderes –, so wird das Baby bevorzugt das neue Gesicht anschauen. Diskriminationslernen. Damit eine solche Orientierungsreaktion entstehen kann, muss das Kind in der Lage sein, Reize zu unterscheiden. Es geht im vorliegenden Zusammenhang also vor allem um die Möglichkeiten eines Kindes, Dinge als vertraut wahrzunehmen. Man spricht daher 1 14 Kapitel 1 · Entwicklungspsychologische Grundlagen 1 . Abb. 1.1. Modell von Habituation- und Dishabituationsleistungen. (Aus Kavsek 2000) auch von »recognition« oder Wiedererkennung. Das Diskriminationslernen ist im Rahmen von verhaltenstherapeutischen Verfahren von größter Relevanz, wenn es um die Angemessenheit von Reaktionen geht. Nur wenn ein Kind Reize sicher unterscheiden kann, kann es auch lernen, unterschiedlich auf sie zu reagieren. Wie . Abb. 1.1 deutlich macht, spielen bei Habituations- und Dishabituationsprozessen eine ganze Reihe latenter kognitiver Operationen eine zentrale Rolle, von denen einige auch für das das Diskriminationslernen von großer Bedeutung sind. Recall. Bislang war ausschließlich von Verhaltensweisen die Rede, die in Reaktion auf einen gegebenen Reiz deutlich wer- den. In vielen Fällen ist es aber auch wichtig, dass Kinder in einer gegebenen Situation von sich aus bestimmte Aktivitäten zeigen oder sich etwas in Erinnerung rufen. Dazu müssen sie sich aktiv an die passende Verhaltensweise erinnern. Man spricht auch von Recall. Ein berühmtes Beispiel für frühe Recall-Leistungen liefert das Mobile-Paradigma (s. unten). Recall ist u. a. für die verzögerte Imitation im Rahmen des Beobachtungslernens (s. oben) von Bedeutung. Einen Überblick über die Lern- und Denkentwicklung in den ersten Lebensjahren gibt Pauen (2006). Entwicklungspsychologische Veränderungen der Gedächtnisleistung bei älteren Kindern (z. B. Metagedächtnis) werden in anderen Zusammenhängen später noch besprochen. Beispiel Das Mobile-Paradigma zur Untersuchung von Recall im Säuglingsalter (Rovée-Collier u. Hayne 1987) Zunächst wird das spontane Strampelverhalten eines Babys in einem Bettchen unter einem Mobile beobachtet (Basisphase). Anschließend folgt eine Lernphase, in der Bein und Mobile verknüpft werden. In einer dritten Phase wird dann nochmals unter Basisbedingungen gemessen, wie sich die Strampelaktivitäten gegenüber der ersten Phase verändern. Wie sich zeigte, stellen bereits Babys einen systematischen Zusammenhang zwischen den Bewegungen des Mobiles und denen ihrer Beine her. Dass sie ihr implizites Wissen über diesen Zusammenhang aktiv erinnern, zeigt sich daran, dass sie selbst Tage bzw. Wochen später mehr strampeln, wenn man das gleiche Mobile wieder über ihr Bettchen hängt. Indem man systematisch die Zeitabstände zwischen Lern- und Testphase vari- ierte und außerdem die Kontextbedingungen (anderes Bettchen, anderes Mobile) veränderte, konnte man untersuchen, wie sich die Lern- und Erinnerungsleistungen mit dem Alter verändern. Dabei sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung: 4 Die Zeitabstände, nach denen Erinnerungsleistungen festgestellt wurden, vergrößerten sich systematisch über das 1. Lebensjahr hinweg von einem Tag auf bis zu 2 Wochen. 4 Während die Kinder am Anfang nur dann in der Lage waren, die Erinnerung wachzurufen, wenn die Kontextbedingungen identisch mit den Lernbedingungen waren, generalisierte diese Leistung mit dem Alter auch auf andere Kontextbedingungen.