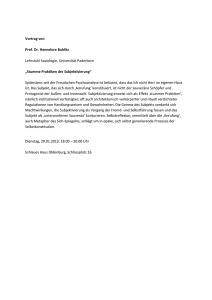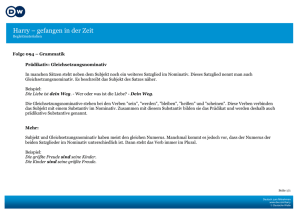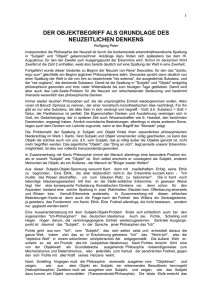Zum Nachwort
Werbung
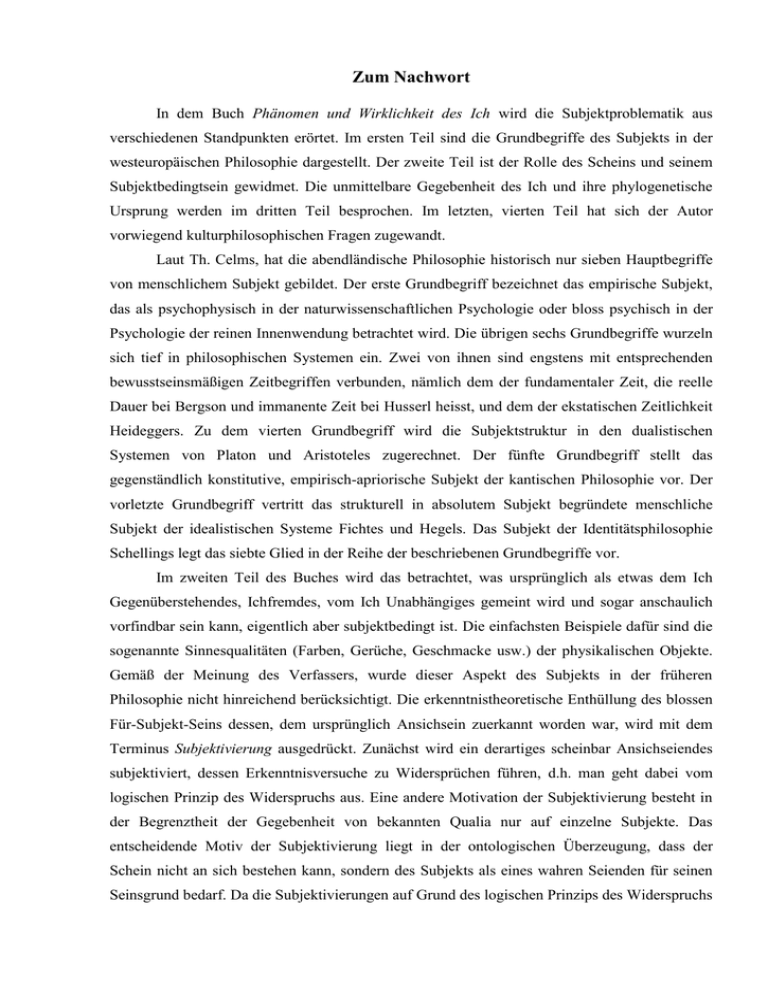
Zum Nachwort In dem Buch Phänomen und Wirklichkeit des Ich wird die Subjektproblematik aus verschiedenen Standpunkten erörtet. Im ersten Teil sind die Grundbegriffe des Subjekts in der westeuropäischen Philosophie dargestellt. Der zweite Teil ist der Rolle des Scheins und seinem Subjektbedingtsein gewidmet. Die unmittelbare Gegebenheit des Ich und ihre phylogenetische Ursprung werden im dritten Teil besprochen. Im letzten, vierten Teil hat sich der Autor vorwiegend kulturphilosophischen Fragen zugewandt. Laut Th. Celms, hat die abendländische Philosophie historisch nur sieben Hauptbegriffe von menschlichem Subjekt gebildet. Der erste Grundbegriff bezeichnet das empirische Subjekt, das als psychophysisch in der naturwissenschaftlichen Psychologie oder bloss psychisch in der Psychologie der reinen Innenwendung betrachtet wird. Die übrigen sechs Grundbegriffe wurzeln sich tief in philosophischen Systemen ein. Zwei von ihnen sind engstens mit entsprechenden bewusstseinsmäßigen Zeitbegriffen verbunden, nämlich dem der fundamentaler Zeit, die reelle Dauer bei Bergson und immanente Zeit bei Husserl heisst, und dem der ekstatischen Zeitlichkeit Heideggers. Zu dem vierten Grundbegriff wird die Subjektstruktur in den dualistischen Systemen von Platon und Aristoteles zugerechnet. Der fünfte Grundbegriff stellt das gegenständlich konstitutive, empirisch-apriorische Subjekt der kantischen Philosophie vor. Der vorletzte Grundbegriff vertritt das strukturell in absolutem Subjekt begründete menschliche Subjekt der idealistischen Systeme Fichtes und Hegels. Das Subjekt der Identitätsphilosophie Schellings legt das siebte Glied in der Reihe der beschriebenen Grundbegriffe vor. Im zweiten Teil des Buches wird das betrachtet, was ursprünglich als etwas dem Ich Gegenüberstehendes, Ichfremdes, vom Ich Unabhängiges gemeint wird und sogar anschaulich vorfindbar sein kann, eigentlich aber subjektbedingt ist. Die einfachsten Beispiele dafür sind die sogenannte Sinnesqualitäten (Farben, Gerüche, Geschmacke usw.) der physikalischen Objekte. Gemäß der Meinung des Verfassers, wurde dieser Aspekt des Subjekts in der früheren Philosophie nicht hinreichend berücksichtigt. Die erkenntnistheoretische Enthüllung des blossen Für-Subjekt-Seins dessen, dem ursprünglich Ansichsein zuerkannt worden war, wird mit dem Terminus Subjektivierung ausgedrückt. Zunächst wird ein derartiges scheinbar Ansichseiendes subjektiviert, dessen Erkenntnisversuche zu Widersprüchen führen, d.h. man geht dabei vom logischen Prinzip des Widerspruchs aus. Eine andere Motivation der Subjektivierung besteht in der Begrenztheit der Gegebenheit von bekannten Qualia nur auf einzelne Subjekte. Das entscheidende Motiv der Subjektivierung liegt in der ontologischen Überzeugung, dass der Schein nicht an sich bestehen kann, sondern des Subjekts als eines wahren Seienden für seinen Seinsgrund bedarf. Da die Subjektivierungen auf Grund des logischen Prinzips des Widerspruchs im ontologischen Prinzip des Widerspruchs fundiert sind, ist der Autor vor die Frage nach der Art und Geltung des letzteren gestellt. Th. Celms hebt ausdrücklich hervor, dass im Rahmen der vorliegenden Problematik das Prinzip des Widerspruchs nur in seiner nichtdialektischen Formulierung angewandt werden muss. Die unmittelbare (phänomenale) Gegebenheit des Ich wird im dritten Teil des Buches in der Hinsicht auf Gefühlen, Willenserlebnissen, des körperlichen Selbst und Nicht-Selbst, als auch das fremde Selbst dargestellt. Die Entwicklung des Bewusstseins wird als auf biologischen Grundlagen gestützt verstanden. Der Autor hält sich an der evolutionistischen Einstellung fest, dass das Auftauchen des Bewusstseins biologisch zweckdienlich gewesen sei und in Kampfsituationen um Lebensentfaltung stattgefunden habe. Th. Celms stimmt dem Psychologen Konstantin Oesterreich bezüglich des ichhaften Charakters von Gefühlen und Aktivitätszuständen weitgehend bei. Besonders ist ihm Oesterreich durch die Feststellung verwandt, dass der ganze Umfang des Ich durch phänomenale Deskription nicht erschöpft werden kann, sondern auch in gedanklichem Verfahren erworbene Schlussfolgerungen enthalten muss. Zum Unterschied von Oesterreich setzt sich unser Autor bedingt für die Ichhaftigkeit der Empfindungen ein, obwohl er die Argumente für die entgegensetzte Meinung eingehend auslegt. Gäbe es keine ichhaften Empfindungen, wäre die unmittelbar erlebte Zweiteilung von Selbst und Nicht-Selbst unerklärlich. Die Kultur, der Th. Celms sich im vierten Teil des Buches zuwendet, wird von ihm nur als die menschliche Kultur verstanden. Dadurch weist er die Anschauung derjenigen Soziologen zurück, die den Begriff der Kultur auch auf das Tierleben verbreiten, sofern das Lernen von anderen in der Tierwelt nachweisbar sei. Der Verfasser beginnt seine Ausführung mit der Übersicht der Werkzeuge, zu welchen er nicht nur materielle Geräte, sondern auch Wissenschaften und Künste rechnet. Danach erörtet er inartikulierte und artikulierte Symbole und definiert die Kultur als ein Gebiet, das durch den Gebrauch von artikulierten Symbolen gekennzeichnet ist. In der Objektivierung als dem Mittel, das die eigene Innerlichkeit einem fremden Bewusstsein fassbar macht, unterscheidet er drei Formen: 1) die innerhalb der Grenzen des Leibes des Objektivierenden bleibende (Gesichtsausdruck und Gebärde); 2) die ausserhalb des Leibes, aber doch in aktuellem Zusammenhang mit dem Leibe stattfindende (Sprechen, Singen); die als geformte Realkörper fortan unabhängig vom Schöpfer bestehende (Schriften, Kunstwerke). Betreffs des objektiven Geistes hat Th. Celms die Inkonsequenz des von ihm im allgemeinen hochgeachteten Nicolai Hartmanns bemerkt und die zugelassene Verwirrung beseitigt. In der letzten Abhandlung beschreibt der Autor das Subjekt in der realen Umwelt und seiner Bewusstseinsumgebung und klagt über die Sichentfremdung, das Gefühl des Verlassens und Verlorenseins in der modernen Gesellschaft. In einem einzelnen Kapitel ist die Kritik der Philosophie Heideggers und Sartres gegeben, die Th. Celms als den extremen Existenzialismus bezeichnet. Hauptsächlich wendet er gegen die ekstatische Zeitlehre ein, in der die Zeit nicht mehr universal, sondern nur identisch mit individuellen Subjekten verstanden und also als „Kleinkram von einzelnen Zeitinseln“ gedeutet wird. Th. Celms ist überzeugt, dass die Annahme von nur zwei Arten der Zeitlichkeit – der ekstatischen und der vulgären – für die Beschreibung des Seins ungenügend ist, unter anderem mit der Geltung der Resultate von Objektwissenschaften nicht zurechtkommen kann. Für die Behauptung Heideggers, dass die Zukunft den Vorrang unter den Zeitmodi habe, findet Th. Celms keine Rechtfertigung im Rahmen der Existenzphilosophie. Jedenfalls kann das auf die Zukunft gerichtete Sollen diesen Vorrang nicht gründen, weil dieses Sollen nicht ein im kantischen Sinne apriorishes Prinzip, sondern nur faktisch und also kontingent ist. Die existenzphilosophische Forderung, dass die Entscheidung für die Eigentlichkeit das Subjekt immer aufs neue zu treffen muss, hält Th. Celms für allzu rigorös. Eine erkenntnistheoretische Parallele dieser Forderung bestünde darin, dass der pythagoreische Lehrsatz für wahr gehalten werden könnte, nicht weil man ihn früher bewiesen hat, sondern nur sofern, als man diesen Beweis aktuell im Bewusstsein vollzieht. Im vorliegenden Buch gibt es Seiten, die als selbstständige Informationsquelle benutzt werden können. Zu ihnen gehören Ausführungen Windelbands zugunsten seines neu-kantischen Idealismus und die Erklärung der eigenartigen Terminologie der Existenzialisten. Leider enthält der Text des Buches in der Weise, in welcher er uns zugänglich ist, einzelne Momente, die unseres Erachtens eine Zurechtstellung zulassen und sogar verdienen. Die Behauptung (Einleitung, Kapitel III, a), dass die neuere Philosophie allgemeine Wesenheiten immer als subjektive versteht, geht über die Untersuchungen, die abstrakten Objekten eigenartiges Sein zuschreiben, hinweg. Auch sind wir mit der Bezeichnung der Philosophie Nicolai Hartmanns als einer radikal antiidealistischen Ontologie nicht einverstanden: dieser Denker setzte sich wohl entschieden für Realismus in der Gnoseologie ein, jedoch gab den zeitlosen allgemeinen Wesenheiten ein eigentliches ideales Reich zu. Die Beurteilung der Anschauung Platons vom unvollständigen Sein der Sinnenwelt als eines Ausdrucks seiner Rückständigkeit in der Subjektlehre (Kapitel IX, Einleitung), dünkt uns auf ein blosses Missverständnis zu ruhen. Der protagoreischen Entdeckung der theoretischen Subjektheit kannte Platon sich aus; in seiner Polemik gegen die Relativität beliebiger Meinungen prägte er selbst einen besonderen Terminus für eine Ansicht, die von der Wahrheit abweicht, – Allodoxia (Theaitetos, 189c). Die Wesen-Erscheinung-Problematik ist doch von der vom Sein und Schein verschieden. Dass das Veränderliche nicht zum wahren Sein gehören kann, war eine gewöhnliche Ansicht der antiken Philosophie; auch Aristoteles charakterisierte das Werden als den mittleren Zustand zwischen Sein und Nicht-Sein. Ferner, wir finden keine Rechtfertigung dafür, dass Augustins Philosophie zum Unterschied von anderen theistischen Systemen zum subjektzentrischen Idealismus dank seiner Theorie der kontinuierlichen Schöpfung gerechnet wird (Kapitel III, b); diese Lehre sieht keinen zusätzlichen Eingriff Gottes in die Prozesse der geschöpften Welt voraus, sondern betont nur die begrenzte Schöpfungsfunktion der endlichen Wesen. Bei Erörterung der sensorischen Qualia und Träume werden nur die Außenwelt und psychische Inhalte betrachtet (Kapitel VII, b). Dennoch haben diese seelischen Prozesse auch gerade Beziehung zur Anatomie des körperlichen Subjekts als auch der Physiologie des Schlafes. Th. Celms sieht Zeitlichkeit und Individualität als Grundmerkmale alles Realen an (Kapitel I). Da in der Quantenphysik das Identitätsprinzip der Elementarteilchen erkannt wird, kann Individualität als universale Eigenschaft alles Seienden nicht mehr aufrechterhalten werden. A. Mazlovski