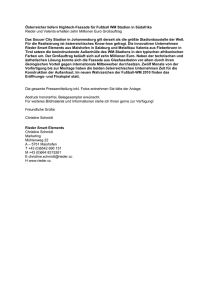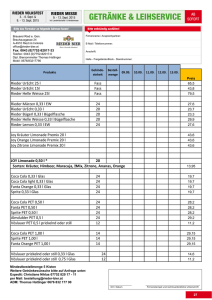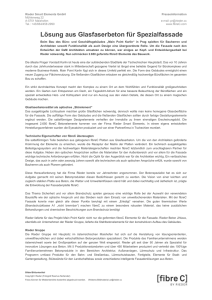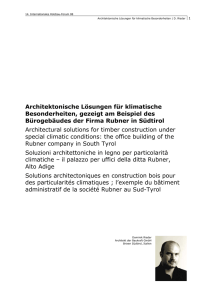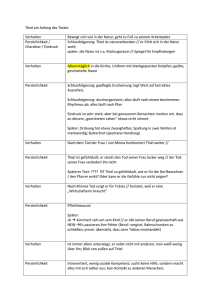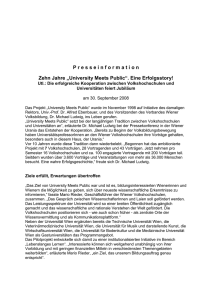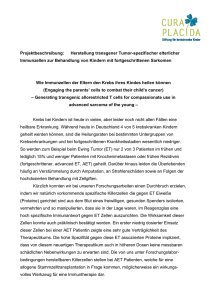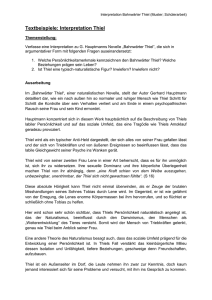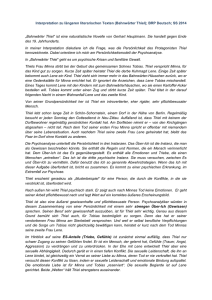Gespräch vom
Werbung

Gespräch vom 21. Oktober 1999 mit Architekt Max Rieder, zum Thema „Museum am Mönchsberg“ Thiel: Wir sind sehr dankbar, dass Herr Architekt Rieder heute Zeit gefunden hat, uns über sein Projekt Auskunft zu geben, das er zum Thema „Museum des 20. Jahrhunderts am Mönchsberg“ eingereicht hat und für das er auch den 3. Preis bekommen hat. Wir haben zufällig auch die Pläne des 1. und 2. Preises da, darüber können wir dann auch kurz reden. Wichtig ist aber, dass wir mit ihm ganz intensiv vor allem über sein Projekt reden, weil er natürlich darüber am besten Auskunft geben kann, über all die Absichten, die Hintergründe, die Abläufe, die Intentionen, also all das, was eben hinter so einem Projekt steckt. Wir haben uns also folgendes vorgestellt: Da Ihr bereits intensiv 2 Doppelstunden an einer eigenen Lösung gebastelt habt, würde ich jetzt diejenigen bitten, deren Objekte ich herausgestellt habe, darüber kurz zu sprechen. Das ist insofern ganz interessant, weil so Herr Architekt Rieder merkt, mit welchen Vorstellungen ihr an die Sache herangegangen seid. Das können wir dann im Spannungsfeld mit dem, was momentan ein Experte an Lösungen vorzulegen hat, diskutieren. Wer ist denn so nett und fängt gleich an? Da gleich links, dieses schöne rot - blaue Objekt - ganz kurz zu den Absichten und um was es dir gegangen ist. Daniela: Das ist erst einmal der Turm. Thiel: Ganz kurz sollte man dazu sagen: jeweils als Orientierungssymbolik haben wir diesen Turm aufgestellt. Daniela: Also, hier vorne soll ein Glasvorbau sein, da kann man dann auch schön auf Salzburg sehen. Oben soll dann so eine Art Kuppel sein, mit einem Höhenunterschied, für einen besseren Lichteinfall. Thiel: Das bedeutet, daß ein Teil deines Museums im Berg drinnen ist. Daniela: Man kommt eben auch durch den Berg, von hinten durch einen Lift hinauf. Thiel: Das heißt also, das einzige, was man von deinem Museum sieht, ist die Kuppel und dieser Aussichtserker. Dein Museum wölbt sich also nach vorne. Das nächste... Rieder: Darf ich noch kurz etwas sagen: Die Idee habe ich bis jetzt noch nicht verbalisiert gehört - außer dem, was ich sehe. Daniela: Idee? Es ist ein Museum... Rieder: Das schon, aber das ist ja keine Idee, das ist eine Funktion. Daniela: Dass das Museum eben mit Salzburg noch stärker in Verbindung steht, damit die Stadt durch diesen Aussichtsplatz noch mehr hervorgehoben wird. Rieder: Das würde also, übertrieben gesagt, bedeuten, dass Sie eine besondere Beziehung zur Stadt aufbauen möchten. Warum ist die Idee - Beziehung zur Stadt - so wichtig für Sie? Daniela: Ich habe mir gedacht, da oben hat man so einen schönen Ausblick über die Stadt, das sollte man doch irgendwie nützen. Rieder: Das heißt, weil der Ort für Sie so besonders ist! Glauben Sie, dass ein Museum immer eine Beziehung zur Stadt haben muß? Daniela: Nein. Rieder: Ist es ein Widerspruch, dass das Museum eine Beziehung zu Salzburg hat? Daniela: Nein, aber ich habe mir überlegt, dass man es so lösen kann, wenn der Standort oben auf dem Berg ist. Rieder: Ich will damit nur sagen, dass es aus Funktion oder aus politischem Wunsch, etwas auszustellen, nicht nötig ist, dass ein Museum eine Beziehung zur Stadt aufbaut. Das Museum beschäftigt sich doch, herkömmlicher Natur, mit den Kunstwerken, nach innen bzw. ist es natürlich so, dass ein Museum ein Gebäude ist, das in einer Stadt steht und eine Beziehung dazu hat. Hier ist es jedoch durch die besondere Lage ein anderes Thema, meiner Meinung nach. Warum ist die Colaflasche (Teil des Modells - stellt einen transparenten Baukörper dar) leer? Daniela: Damit man hineingehen kann? Rieder: Aber ein Museum hat doch einen Inhalt, da muß doch Cola drinnen sein! Warum frage ich? Sie benutzen ein Symbol, das in unserer Gesellschaft des 20. Jahrhunderts gar nicht extremer existiert. Daniela: Ich habe ehrlich gesagt kein anderes Material zur Verfügung gehabt. Rieder: Ja, aber Sie sehen, wenn Sie Ideen transportieren, benützen Sie Symbole, in diesem Fall die Colaflasche! Sie müssen sich überlegen, ob Sie eine Stiegl - Bierflasche, eine Colaflasche oder einen Plastikbecher verwenden. Das ist immer etwas anderes, denn Sie können diesen symbolischen Gehalt irgendwann, wenn jemand lange darüber nachdenkt, entschlüsseln. Colaflasche verbindet man mit Pop-Art, man denkt also an ein 60er Jahre -Museum. Dann würde man in einer ganz bestimmten Zeitepoche der 80er oder auch 60er Jahre sagen: Das ist eine Konstruktion der 60er/80er, weil sich hier auch Pop-Art Elemente nach außen hin mitteilen - die Colaflasche. Sehen Sie, wenn Sie aus großen Komponenten etwas zusammensetzen, hat das immer mehr Bedeutung als nur eine Sache. Die Frage ist, warum eine Sichtweise oder eine Beziehung zur Stadt bei Ihnen eine Fernglassymbolik hat, von innen? Sie waren doch auch da oben? Daniela: Ja. Rieder: Was ist denn jetzt da oben? Was für eine „Idee“, um eine Beziehung zur Stadt herzustellen? Jetzt existiert da oben ein Panorama. Ihr „Panorama“ ist jedoch ganz fokussiert, wie ein Fernrohr, nur auf einen Punkt. Thiel: Ich sehe da eine Parallele, vielleicht nur unterbewusst, denn da oben steht ja momentan auch ein Fernrohr. Es gibt jetzt auch ein Projekt eines Künstlers, der auf dem Berg gegenüber ebenfalls ein Fernrohr aufgestellt hat, damit man sich sozusagen in die Augen schauen kann! Damit haben wir hier das Fernrohr, das man normalerweise nicht beachtet, das aber eigentlich sehr symbolisch ist! Rieder: Möglicherweise ziehe ich jetzt ein paar Sachen vor, die alle betreffen, Sie sollen sich deswegen nicht besonders kritisiert vorkommen. Wenn man eine Beziehung zur Stadt herstellt, kann man, so wie Sie es ausgewählt haben, ganz genau auf einen Punkt und auf sehr spezifische Form, die den großen Kontrast zur Felswand stellt, im Sinn eines Rohrs, oder wie es üblicherweise dort oben ist, in Form eines horizontalen Panoramafensters ausführen. Gut, noch eine letzte Frage habe ich: Warum ist das Dach sozusagen aus dem Berg heraus, mit so einer besonderen Form? Daniela: Damit man es besonders gut sieht! Rieder: Gibt es da irgendeine Beziehung? Daniela: Es ist rund... Rieder: Das ist eine formale Beziehung! Thiel: Zu welchen Gebäuden in der Stadt steht es in Beziehung? Katharina: Zu den Kuppeln der vielen Kirchen! Rieder: War das Ihr Gedanke? Daniela: Wir haben im Unterricht darüber gesprochen. Rieder: Hier sehen Sie, Sie machen das und jemand anderer assoziiert. Das ist das große Problem meines Entwurfes und eines künstlerischen Entwurfes - will ich, dass die Leute so assoziieren, wie ich gedacht habe, dann nennt man das meistens konsequent - das kann natürlich nicht alle Meinungen der Welt einfassen - aber es gibt Interpretationen, die außerhalb meiner Gedankenwelt sind, die aber trotzdem sehr schöne und interessante Aspekte bieten. Jetzt geh ich einmal weiter, ich komme dann am Schluß darauf zurück. Bitte! Eva-Maria: Also, hier steht wiederum der Turm. Im Großen und Ganzen handelt es sich hier vorne um eine Wasserfassade, die sollte durch diese blauen Streifen symbolisiert werden, das ist leider schon etwas kaputt. Das Museum selbst befindet sich zum größten Teil im Berg, kommt dann hervor und man sieht dann von unten nur diese Fassade. Da habe ich mir vorgestellt, dass das Wasser überall herunter rinnt, so dass es eine geschlossene Wasserfront bildet. Der Gedanke dahinter war die Kombination zwischen dem fließenden Wasser und dem Felsen, so dass man die Natürlichkeit bewahrt und nicht einen umweltfremden Betonklotz hinstellt. Seitlich gibt es mehrere Eingänge und da oben könnte man auch eine Aussichtsterrasse anlegen. Reingard: Geht man dann durch Wasser durch. Eva-Maria: Nein, der Eingang befindet sich auf der Seite, durchs Wasser sollte man nicht gehen. Rieder: Es war zwar als witzig geplant, aber durchs Wasser zu gehen ist etwas Elementares. Warum geht man dann nicht durch? Eva-Maria: Das habe ich mir gar nicht überlegt, aber man könnte das Eröffnungsevent durchaus so gestalten. Trotzdem, ehrlich gesagt: Wer geht gern durchs Wasser, wenn er nachher ins Museum geht, da ist man dann ganz nass. Reingard: Wenn man hinter dem Wasser durchgehen kann, ist das ja ebenso symbolträchtig. Rieder: Sie spielen also mit einem Wasservorhang vor dem Berg, etwas Fließendem, wie ein großer bewegter Vorhang könnte man sagen. Der Berg ist auch bewachsen und gibt sehr vielen Lebewesen Schutz, auf der anderen Seite ist auch etwas Allegorisches dabei, sozusagen eine Wanderung von der Realität zur Imagination. Das ist meiner Meinung nach, eine sehr schöne Situation für ein Museum, sozusagen eine andere Welt, könnte man klassisch sagen. Eva-Maria: Ja, das könnte man so sehen! Rieder: Ihre Idee könnte man also mit „Es war einmal“ formulieren. Es gibt dann natürlich für einen Künstler viele Möglichkeiten den Leuten diesen Weg symbolisch immer wieder aufzuzeigen, ohne dass sie wirklich nass werden. Eva-Maria: Man könnte vielleicht einen durchsichtigen Plastikdurchgang machen, so dass man das Wasser sieht, aber selbst nicht nass wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Museumsbesucher unbedingt nass werden wollen, selbst wenn es symbolische Bedeutung hätte. Rieder: Das glaube ich auch nicht, aber Sie sehen, dass zwischen einer Idee und der Nutzung Ihrer Idee ein Problem liegt. Man könnte die Idee konsequent weiter verfolgen oder die Handhabung der Idee überflüssig machen, indem sie z.b. eine Pelerine oder etwas ähnliches zum Durchschreiten verwenden, nur damit Sie diesen Vorgang gemacht haben. Die nächste Frage wäre dann, warum Sie doch sehr weit vom Felsen zurückgehen? Warum rinnt das Wasser nicht ganz vorne die 60 Meter bis auf den Anton Weimarer Platz hinunter? Eva-Maria: Ich muß sagen, diesen Aspekt habe ich nicht bedacht. Aber ich glaube, auch wenn ich ihn bedacht hätte, hätte ich es auch nicht getan, weil mir die Vorstellung nicht gefällt. Ich möchte die Wasserfront lieber abgeschlossen halten. Rieder: Ist sie jetzt abgeschlossen? Eva-Maria: Ja, da unten soll ein Auffangbecken sein. Rieder: Ach so, das ist ein Wasserbecken. Eva-Maria: Ja, da wäre ein Wasserbecken direkt an den Säulen und davor eine Parkgestaltung. Rieder: Ist da vorne ein schwacher Halbkreis oder einfach eine freie Wiese? Eva-Maria: Es ist wellenförmig angeordnet, um eben auch den weichen Aspekt hervorzuheben, im Gegensatz zum Gestein. Rieder: Ein Architekt, wenn er einer ist, denkt immer in Räumen. Sie (Daniela) machen hier eine Fuge, ein Loch, dahinter geben sie den großen, basilikalischen Raum, auch hier im Modell sichtbar. Er steht in einer metaphorischen Spannung zu anderen großen Räumen der Stadt, wie z.b. Kirchen. Zu diesem Raum gibt es eben jedoch nur eine kleine Öffnung. Hier (Eva - Maria) muss ich als Architekt fragen, was entsteht davor für ein Raum? Wir werden dann in der Begründung der anderen Projekte und auch des Preisträgers immer den Gedanken wiederfinden, daß das Gebäude nicht ganz vorne sein darf. Das wäre ein Skandal, denn lange Zeit durfte kein Gebäude so nahe am Abgrund stehen. Genau das ist meine Sorge, dass Sie auch diesen Gedanken gehabt haben. Durch den Brechungswinkel sieht man das Gebäude fast nicht, bzw. nur aus sehr weiter Entfernung. Das ist sozusagen die Zurücknahme des Raumvolumens oder auch eines Zeichens und damit auch ein kleiner Widerspruch, indem dass Sie sehr stark die Idee oder ein Element vom Berg nehmen, es dann aber doch als Gebäude begreifen und nicht als Berg. Wenn es ganz vorne wäre, wäre sozusagen der ganze Berg ein Museum. Eva-Maria: Wenn man aber jetzt zum Beispiel die Leute da vorne hineinschickt, das Museum aber ganz vorne ist, können sie auch nicht mehr ordentlich durchgehen. Das wäre ein Problem, wenn man das so weiterdenkt. Rieder: Ja, das stimmt. Im künstlerischen Entwurf geht es immer darum, dass keine Probleme auftreten, beziehungsweise, dass man diese Probleme löst! Man muss dann eben solche Raumbedingungen schaffen, dass diese Probleme weg sind, oder dass sie so schwach sind, dass alles andere viel faszinierender ist. Jetzt noch eine kleine Sache, das ist schon ein Detail: Wenn Sie hier eine freie Linie machen, muss man sich immer überlegen, mit welchen Mitteln man sie ausgestaltet. Die Frage ist jetzt, Sie haben Pfeiler gemacht? Eva-Maria: Ja, Säulen sollten das eigentlich sein. Rieder: Da kommen wir dann noch zur Modellfrage, da es natürlich keine Säulen sind, sondern Pfeiler. Eva-Maria: Wieso? Rieder: Weil sie nicht rund sind. Eva-Maria: Aber mit dem Ton kann man das nicht besonders gut machen! Rieder: Aber es ist ein fundamentaler Unterschied. Ein Modell hat immer Abstraktionen, aber ein Pfeiler hat immer eine scharfe Kante zum Raum. Auch wenn Sie das hier nicht beabsichtigt haben, ist es noch keine Säule. Eine Säule kann ich mir für ihre Gedankenwelt logisch vorstellen, es ist auch etwas barock. Eva-Maria: Ja, vielleicht. Thiel: Ist es nicht in dem Sinn barock, dass die Stadt eine ganze Menge von solchen symbolischen Wasserspielen hat, die ganzen Brunnen, Pferdeschwemmen, bis hinaus nach Hellbrunn, wo dieser Gedanke des Wassers und der Kultur eine große Rolle spielt. Rieder: Es ist bei beiden Objekten ein Unterbewußtsein mit der Stadt, auch wenn Sie das nicht ausgesprochen haben, mit dem großen Raum beim ersten Modell und hier mit dem Wasser. Falls Sie noch etwas anderes Fragen wollen, oder auch wenn ich etwas falsch verstanden habe, Sie müssen es mir sagen! Ist alles klar für Sie? Eva-Maria: Ja, alles klar. Rieder: Dann gehen wir weiter zum dritten Modell. Johanna: Meine Idee war, dass sich mein Museum eher schlicht, im Berginnern, befindet, auch damit es nicht so auffällt und von den anderen Sachen ablenkt. Hier von der Seite kann man mit einem Lift hinauffahren. Rieder: Man geht also in den Berg hinein, ist das die Idee? Johanna: Nein, ich wollte das Museum eben nicht auf dem Berg, damit es nicht so auffällt. Ich wollte es eher verstecken. Rieder: Glauben Sie das ist eine künstlerische Idee? Johanna: Nein. Rieder: Aber was bedeutet das, in ein Material hineinzugehen? Der Berg ist ja ein Material. Johanna: Vielleicht ist es spannender? Rieder: Wenn man das Museum einfach darauf setzt, könnte man sagen, es thront. Was ist aber jetzt, wenn man hineingeht? Wenn jemand in Sie hineingeht, was ist denn das? Das ist im Grund genommen das Gleiche. Bei der Architektur, oder auch bei diesem Material, wenn man den Berg simpel und als etwas real existierendes begreift, könnte man auch sagen, es ist ein Leib. Ein Gebäude kann theoretisch auch einen Leib besitzen, es lebt ja auch. Auf diesem Berg leben viele Tiere und auch das Wasser macht ihn lebendig. Dieser Einschnitt ist somit auch eine Verletzung, man geht hinein. Sie haben es so begründet, dass sie es an der Oberfläche nicht ausformulieren wollen, aber genau das, dass Sie es nicht ausformulieren wollen, das steht auch für etwas. Vielleicht, weil Sie glauben, dass Kunst nicht ausgestellt werden sollte, oder halten Sie die Lage da oben für so außergewöhnlich, dass da nichts stehen darf? Johanna: Nein, ich wollte nur nicht, dass es auffällt und dass es ablenkt von den anderen Dingen da oben, dass es nicht zu sehr im Vordergrund steht. Rieder: Das heißt Sie hatten so eine Idee wie Luigi Fontana, den ihr vielleicht kennt. Er hat ungefähr von 1940 bis 1960, vielleicht auch ein wenig früher, versucht, Kunst oder Malerei wieder in das Räumliche zu übersetzen. Das heißt, er hat zum Beispiel weiße Leinwände mit einem Schlitz versehen, dadurch hat das Ganze Tiefe bekommen, da ist ein Raum entstanden. Es war jetzt nicht mehr 2-, sondern durch diesen Schlitz 3dimensional und natürlich ist so ein Riß ein äußerst spannendes Raummittel. Es ist ein künstlerischer Eingriff um Spannung zu erzeugen, das Besondere zu erzeugen. Sie machen hier einen Schlitz und zusätzlich gehen Sie nicht heraus. Sie machen sozusagen eine Fuge und gehen aber nicht heraus, sondern betonen diese Fuge noch einmal mit einem vertikalen Element. Ist das gescheit, wenn man so oft das Selbe wiederholt? Ist es gut, wenn man einen Schlitz macht und ein vertikales Element noch zusätzlich dazu? Wenn jemand gelb angezogen ist und dazu noch gelbe Haare, gelbe Augen, gelbe Brille und gelbe Schuh trägt, und dann redet er auch noch gelb, das wird doch zuviel! Ihr Aspekt war zuerst, besonders zu reagieren, deshalb rede ich jetzt so lange darüber. Eine andere Frage wäre noch, wie wird das dann oben im Terrain bewältigt und was passiert dann an der wichtigen Kante? Bei ihnen könnte man sagen, dass die Kante da entscheidend ist! Sie (Eva-Maria) haben die Kante gar nicht ausgeführt, indem, dass Sie das Museum zurückgesetzt haben. Sie haben die Kante sozusagen neu gebaut. Sie (Johanna) dagegen rutschen zuerst etwas zurück, dann kommen Sie wieder hervor und machen da vorne so eine weiche Sache. Gibt es da irgendwelche Gedanken dazu, warum das jetzt so ist? Johanna: Nein, eigentlich nicht. Rieder: Und dass Sie so einen Deckel darauf legen? Johanna: Ich wollte, dass es flach ist, dass es nicht herausragt. Ich wollte es ganz verstecken. Rieder: Warum haben Sie überhaupt ein Dach gemacht? Johanna: Weil es sonst hineinregnen würde. Rieder: Ich wollte bei ihnen nur einmal illustrieren, dass, wenn man mit einer Idee beginnt, diese Idee, fast wie ein mathematischer Satz, immer wieder neue Indizien und Beweise braucht, dass sie ständig neu begründet werden muss. Eine Idee habe ich ganz einfach. Oft ist es so bei Architekten, sie haben eine gute Idee, können sie aber nicht verwirklichen, weil es zu teuer oder zu verrückt ist oder auch, weil die Idee nicht weiter geht, es gibt keine Begründung für sie, weder eine Logik, die den Gebrauch, noch die die Kostenfrage beinhaltet. Man muss diese Sachen sammeln und dann kann es natürlich passieren, dass sich die Idee verändert. Bei der Architektur sieht man das besonders, weil sie immer eine Sache zwischen einer normalen Dienstleistung, das heißt, jemand bestellt ein Haus und will dann auch darin wohnen, und Kunst ist, da Architektur auch etwas mehr sein sollte. Ansonsten könnte ich auch einen Baumeister beschäftigen, dem sagt man, wie man es haben will und der baut es dann so. Der Architekt steht in einem sozialen und kulturellem Umfeld und reflektiert, wenn er halbwegs geschickt ist, die Gesellschaft, ihre Ideen und den Ort. Wenn er es nicht in einzigartiger Weise macht, dann ist er eben ein Baumeister und baut nur ein Museum. Ein Baumeister hat meistens eine Idee für zum Beispiel ein Erlebnisbad, oder eine Kugel. Der Stronach hat als Idee eine Kugel, die schiebt er dauernd hin und her und es gibt außer dieser Kugel keine zusätzlichen Ideen. Diese Idee hat es aber theoretisch schon in der Französischen Revolution gegeben. Die Idee steht dann, wie Sie sehen, weil es nicht mehr weiter geht. Teresa: Warum muß eigentlich eine Idee immer begründet werden? Rieder: Wenn die Idee so stark ist, dass man selbst eine Begründung dazu findet, dann braucht man keine Begründung, aber die Idee muss diskutabel sein, für einen Kunstkritiker, einen Galeristen, für Sie selbst muss sie für etwas stehen, denn Ideen haben wir alle! Phillippe: Die Idee steht ja in einem Kontext. Rieder: Ja, in welchem steht sie, wie ist sie zu prüfen? Es gibt schließlich verschiedene Vorgänge, wie man zu einer Idee kommt. Manche machen Analysen, sammeln, interpretieren, bewerten sie und dann synthetisieren sie eine künstliche Idee. Andere machen sie aus dem Bauch, intuitiv, spontan. Andere machen sie aus einer Gruppenarbeit, wieder andere schauen nur, was schon für Ideen da waren, formalisieren sie auf die Zeit, thematisieren sie neu, kleiden sie in eine neue Form. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber für eine künstlerische Idee, die gesellschaftlich relevant und bedeutend wird, ist es Voraussetzung, dass sie eben entweder noch nie da war, denn das ist das Image des Künstlers, oder einfach ganz einzigartig. Thiel: Da würde ich direkt einen Vergleich versuchen: Die Sprache artikuliert sich ja auch nicht in einzelnen Begriffen, sondern semantisch in einem Bezugssystem, dass die einzelnen Worte sich miteinander begründen und das produziert dann Sinn. Genauso steht das, was ein Architekt baut oder ein Künstler macht in einem bestimmten Zusammenhang. Dadurch, dass die Zusammenhänge sich so artikulieren, dass einer intuitiv oder auch analytisch nachvollziehen kann, wird eine Idee plötzlich so überzeugend. Genauso, wie wir kulturell eine hoch artifizierte Sprache haben, haben wir sie auf anderen Gebieten ja genauso. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum sich eine Idee begründet, in einem Zusammenhang. Rieder: Man könnte auch sagen: Was ist das toll am Michael Jackson? Die Idee, dass er sich andauernd körperlich verändert und sozusagen kaum noch maskulin oder feminin ist, ist in seiner Musik nicht zu finden. Es ist das phantastische und das transportiert er in seine Musik. Deswegen verstehe ich ihn auch, sonst wäre er als Musiker eigentlich nicht wichtig. Sehen Sie, da stimmt alles zusammen. Er ist eben ein Trendsetter, während Prince oder ein Jazzmusiker wieder eine völlig andere Haltung haben. Da stimmt sozusagen alles in seiner Einzigartigkeit. Thiel: Darf ich zu den Objekten noch etwas sagen? Rieder: Bitte. Thiel: Mir kam es so vor, als wäre es die Idee, dass eine Form sich in einer zweiten artikuliert, so wie der Körper sich in einem Gewand verbirgt und gleichzeitig zeigt. Wenn man dann um die runde Form herumgehen kann, sieht man neben sich den Felsen und vor sich das Gebäude. Das Gebäude ist aber nicht für die ganze Stadt sichtbar, sondern nur erahnbar durch diesen Schlitz. Rieder: Richtig, ich habe das zu sehr aus dem Vorgang des Schaffens des Schlitzes gesehen. Man könnte natürlich auch sagen, das hier oben ist eine Warze, ein Appendix von dem hier und zeigt sich deshalb auch außen. Es ist eine Art Subraum und verweist dadurch, dass da ein ähnlicher Raum dahinter ist, eine Möglichkeit. Insofern bei dem Projekt noch schlüssiger, weil sie des Öfteren das selbe Wellpappmaterial verwendet hat, das heißt, es gibt hier auch eine Wahl des Materials in diesem Modell, das ist sehr wichtig. Wir haben von den Pfeilern gesprochen, die eigentlich Säulen sind und wir haben von der Pappe gesprochen. In dem Fall ist sie immer wieder perforiert, insofern ist das hier künstlerisch nicht konsequent, weil sonst das hier drauf liegen müsste, wenn es miteinander zu tun hat. Sie verstehen schon wieder, was ich meine. Johanna: Ja, aber das hat man irgendwie nicht ankleben können. Rieder: Aber Sie haben zumindest artverwandtes Material verwendet und damit auch von der Textur etwas ähnliches gesehen. Sie haben darüber geredet, deswegen habe ich gedacht, dass diese beiden Sachen etwas miteinander zu tun haben? Johanna: Ja, das ist eben der Aufzug. Rieder: Dann ist es gut. Der Lift benötigt Raum, das habe ich auch gedacht. Beim Lift kommen wir auch noch auf diese besondere Problematik, dass es natürlich sehr faszinierend ist, an einer langen Wand entlang nach oben zu gleiten und den Blick über die Stadt Salzburg zu erleben. Natürlich ist es auch schöner, den Lift außen zu haben, als innen. Sie kennen wahrscheinlich nur aus der Geschichte den Beruf des Liftboys. Bis 1986 gab es einen Liftboy, bei einem Portugiesen, das wurde damals von den Salzburger Nachrichten und den konservativeren Kreisen nicht befürwortet und stark kritisiert. Das hat dann auch zum Fall dieses Projektes geführt. Der Herr hat damals Albero Sisa geheißen, war in Salzburg bekannt, war in Salzburg einer der berühmtesten Architekten. Gut, drei Objekte haben wir hier noch. Thiel: Das müsste sich bis zum Läuten noch ausgehen. Phillippe: Ich habe es relativ verwinkelt gestaltet, weil man von da oben auch die ganzen Dächer der Häuser der Stadt sieht. Die sind eben auch eher verwinkelt, außerdem habe ich auch noch versucht, die kleinen Gassen widerzuspiegeln. Rieder: Bei Ihnen wird es sicher augenscheinlich, dass Sie versucht haben, das Material, aus dem der Berg gemacht ist, abstrahiert auch in eine neue Topographie zu übersetzen. Diese Topographie, also Terrassen und Wände werden entweder zu einem Innenraum, der dahinter liegt, oder zu einem Außenraum, der davor ist und damit auch seinen Teil zum Volumen beiträgt. Es ist eine extreme Symbiose zwischen Natur und Technik oder auch Bauwerk und Ort. Ihre Argumente, Stadtlandschaft, ist so weit nachvollziehbar. Es hat einen gewissen Gesamtkunstwerksanspruch. Was, meiner Meinung nach, die uninteressanteste Lösung ist, das kriegen wir dann noch einmal als ersten Preis, nämlich eine Konglomeratfassade. Da ist die Fassade noch einmal das gleiche Material, wie das Museum, der Berg, wenn auch nur verkleidet, denn Ihr künstlerischer Vorgang ist ja herausstemmen und drüberbauen. Damit ist es wieder ein sehr typisches Programm Salzburgs, das den Berg als Kulisse begreift und die Kulisse gestaltet, wo immer alle Bergwände Theaterbühnen der Stadt sind. Thiel: Wisst Ihr, worauf da jetzt angespielt wird? Teresa: Auf den ersten Preis? Katharina: Nein, auf das Felsentheater, die Felsenreitschule. Rieder: Also, das symmetrische hier, würde ich bestätigen. In der freien Naturform, die der Berg dort gibt, ist sicher etwas, das den Blick einengt, etwas zentrales, das sich möglicherweise in ihrem Fall noch stärker darstellen kann, wenn es aus dem selben Material ist. Es kommt aus dem Material, ist aber etwas Anderes, weil es von Menschen erdacht und erbaut worden ist. Eine andere Frage ist, ob es wirklich, in ihrer besonderen Sensibilität, notwendig gewesen wäre, das Gestaltungselement der Symmetrie einzubringen. Was bringt Ihnen das für Vorteile? Hier haben Sie sozusagen eine sympathische Symmetrie und jetzt wird das Ganze sozusagen noch einmal mit einer Kuppelhalle gekrönt. Was ist denn das hier? Es ist etwas asymmetrisch, ist das bereits vorhanden? Phillippe: Nein, ich fand es einfach interessant. In der Stadt ist es nirgends vorhanden, aber es soll das Verwinkelte noch einmal unterstreichen. Thiel: Wenn du schlau bist, sagst du, das sind Platten von Richard Sera, also Ausstellungsobjekte. Rieder: Ist das hier auch ein Ausstellungsstück oder ist das eine Halle? Phillippe: Es ist eher eine große Halle. Ich habe mir gedacht, dass man von hier aus die Stadt betrachten kann und indem, dass es rund ist und man so von allen Seiten hinaussehen kann, soll die Stadt noch mehr in das Museum hineintransferiert werden. Rieder: Da kommt natürlich, wenn Sie so etwas machen, auch Bauund Kulturgeschichte mit hinein. Man könnte zwar sagen, dass es passt, aber es gibt einen Punkt unserer Zeit, an dem man sagt, man kann nicht wieder mit Symmetrie und Achse überhöhen, wie es früher gebräuchlich war. Man kann nicht mehr die Pallas Athenae auf den Mönchsberg stellen, die Kunst ist längst nicht mehr so sacro sancti. Ein weiterer Punkt wäre auch die politische Anschauung. Im Nationalsozialismus hat man auch immer wieder den Berg benutzt, ihm Symmetrie, ein krönendes Haupt gegeben, die „Erleuchtung“. Das wisst Ihr vermutlich nicht, aber es hat auch am Kapuzinerberg, in der Achse von Schloss Kleßheim eine Gauburg gegeben, genauso wie in Nürnberg, in Linz usw. Also das ist ein Punkt, wo man aufpassen müsste, obwohl es sich natürlich vom Geist her eindeutig unterscheidet, es gibt eben baugeschichtliche Vor- und Nachteile. Ich sehe das eher als psychologische Antwort, dass Sie solche Sachen hineingelegt haben, weil es Ihnen zu starr geworden ist. Phillippe: Ja, vielleicht um das hier zu brechen. Rieder: Weil, Sie tun da etwas, ... das ist erst am Schluss entstanden, oder? Phillippe: Ja. Rieder: Das wäre dann für mich aber noch nicht aus. Ich hätte es noch verschoben, es wieder zusammen gedrückt, ihm einen neuen Impuls gegeben. Sie sehen ja, das ändert wieder alles. Es kommt immer etwas dazu und dann muss man wieder zurückreflektieren, bis es einen harmonischen Stillstand hat. So ist es ein repräsentativer Stillstand, Symmetrie ist von der Antike herauf bis heute immer noch, wenn man nicht lange über Form nachdenken muss, bewahrend, stabilisierend, repräsentativ. Wir haben allerdings unterdessen andere Möglichkeiten der Repräsentation. Thiel: Die Ästhetik der Erhabenheit. Rieder: Ja genau und da kommen wir dann zum Programm der Museen und dadurch natürlich zur Geschichte der Museen. Die sind natürlich immer um 1820 herum entstanden – aber Sie sehen, man kramt ein bisschen in der Ideengeschichte der Kultur herum und kommt von einem Gedanken zum Anderen. Thiel: Besprechen wir da das letzte Objekt noch, das Hinterste ist, glaube ich, noch nicht fertig. Rieder: Ja gerne. Andi: Man kommt mit dem Aufzug hinauf, bleibt dann aber im Berg drinnen, geht hier durch und kommt dann da in das Museum hinein. Das Museum selbst ist mit dem Berg verwachsen, es ist zur Hälft im Berg drinnen und das wird auch durch dieses felsähnliche Material unterstützt, so dass es keine klaren Grenzen gibt. Rieder: Sie arbeiten Formen oder Räume heraus, die fast elementar sind. Es gibt Kreislinien und Geraden, es gibt aber keine Schrägen. Es gibt in dem Sinne auch keine Symmetrie. Sie bauen etwas auf, dann legen Sie etwas quer dazu in der Achse, Sie brechen es allerdings wieder, weil Sie es doch nicht parallel machen, Sie machen keinen Kuppelraum, sondern dehnen nach hinten aus. Sie fangen eigentlich an, verschiedene Räume zueinander zu stellen. Hier bricht etwas besonderes heraus, wie eine Art Juwel. Sie haben das als Einziger so besonders integriert, durch Ihre Breitlagerung jedoch wieder zentriert. Soweit ich das jetzt sehe, sollten Sie mir noch etwas über den Innenraum erzählen. Die erste Interpretation als Künstler ist immer, dass jeder versuchen sollte, seine Empfindungen wahrzunehmen. Es ist wichtig, da man ja auch als Unbeteiligter etwas empfindet, das wahrzunehmen und dann immer mehr Informationen zu bekommen, entweder durch längere Betrachtung oder, in dem Falle, durch Sprache und Erklärung, damit man den Hintergrund auch richtig versteht. Wenn man dann etwas verstanden oder auch nicht verstanden hat, kann man es assoziieren, interpretieren, kritisieren. Etwas, was man nicht kennt, zu interpretieren, könnte man als intoleranten Vorgang hinnehmen und sagen, dass man sich damit nicht auseinandersetzen will. Andi: Durch das Glas hat man die Möglichkeit in den Berg zu schauen. Rieder: Haben sie sich nie vor dem Problem gesehen, mehr Glas zu verwenden oder vielleicht weniger und es dafür mit einem anderen Material zu mischen? Andi: Mir standen eigentlich keine anderen Materialien zur Verfügung, außer Metall, dass ich noch mit einbeziehen hätte können. Rieder: Das Problem, dass ich hier sehe ist, dass ihre Raumübergänge nur außen definiert sind. Sie gehen zwar auf den Reiz des Materials ein, blocken aber die Innenraumproblematik ab und vermitteln die Idee der Röhre. Da könnten Sie jetzt mit ihrer Kollegin diskutieren warum sie die Röhre vertikal verwendet und Sie horizontal. Da können Sie vielleicht erkennen was für ein Dilemma entsteht, wenn man vor einer Jury argumentieren muss und wenig Material über eigene Überlegungen vorzeigen kann. Jeder Betrachter von Kunst hat andere Assoziationen dazu, aus diesem Grund ist es wichtig Pläne, Zeichnungen, Modelle, Texte und eventuell auch Videos zu verwenden. Thiel: Wenn ich noch etwas zu diesem Modell sagen darf: Es ist mir beim ersten Anblick aufgefallen, dass es sich sehr stark von allen anderen unterscheidet, und zwar durch die Idee, den Raum nicht aus einer musealen Überlegung, sondern aus einer technischen Philosophie heraus zu entwickeln. Der Bau macht auf mich den Eindruck einer Maschine, einer Drehbank, die ins Großplastische umgesetzt wurde und etwas von der Ästhetik des sozialen Realismus an sich hat. Es beinhaltet auch in diesem Sinn die historisierenden Tendenzen überhaupt nicht, ich assoziiere damit viel stärker die industrielle Revolution. Rieder: Es ist richtig, dass dieses Modell die autonomste Form ist, die wir bis jetzt diskutiert haben. Insofern könnte man ihren Entwurf auch positiv unterlegen, indem man sagt, das Glas ist von sich aus so stark, dass es keinen anderen Raum braucht. In diesem Sinne hätte man sogar noch eine Spur radikaler werden sollen und sich mit der Frage beschäftigen : Wie trifft die Lehmfuge auf den starken Raum? Gehe ich richtig in der Annahme, dass dieses Projekt noch nicht ganz fertig ist? Kati: Ja Rieder: Ich glaube, dass von allen bisherigen Projekten dieses das am weitesten fortgeschrittenste und fertigste ist, da es sich am stärksten mit dem Ziegelblockmaterial auseinandersetzt. Es ist sehr wichtig mit welchem Material man seine Gedanken transportiert. Sie gehen am stärksten darauf ein, entfernen sich dadurch auch am weitesten vom Thema Museum, haben aber in diesem Sinne die größte künstlerische Freiheit. Es gibt viele Aspekte, die man der Architektur zuschreibt, von der reinen Funktion bis zur Möglichkeit ein Statement zur Gesellschaft abzugeben, das für mich eine sehr große Rolle spielt. Da stellt sich für Sie oft die Frage warum ich nicht Künstler sein kann ohne mir etwas dabei zu denken. Ob alles wirklich Sinn haben muss hängt mit ihrem Selbstverständnis zusammen und ob sie sagen alles das ich mache, macht für mich Sinn. Eines der wesentlichen Dinge ist, dass Sie durch ihre Kunst oder Architektur mit jemandem in Kommunikation treten, das sich natürlich auch in Kritik definieren kann. Besprechung der Museumspläne für das Museum am Mönchsberg (1.,2., und 3. Preis des Wettbewerbes) Der erste Preis des Wettbewerbs hat versucht, die bereits bestehende Struktur in ein sich stark mitteilendes Bild und den passenden Rahmen, zu verwandeln – das ideale Ikonogramm eines Bildermuseums, indem das Gebäude der Rahmen und die Stadt das Bild darstellt. Sie sehen, man könnte sagen, entweder war die Jury so politisch und sorgenvoll besetzt, dass es keinen Skandal gibt, oder man geht heute davon aus, dass die Kunst nicht Bestandteil des ganzen Lebens ist, sondern nur diesen Rahmen füllt. Das ist natürlich schon eine Interpretation der Aufgabe. Ich bin der Meinung, dass man mehr braucht um Bilder aufzuhängen, während dieser Entwurf das Thema Bild zum Zeichen der Stadt und des Hauses macht. Der zweite Preis ist von Laurenz Orca, einem sehr sachlichen und ästhetischen Architekten, der auch das Museumsquartier in Wien baut. Er hält das in einer ähnlichen Weise wie der erste Preis, nur etwas abstrakter, indem er das Glas nicht als Produkt in seiner Zartheit zu etablieren versucht. Seine Geradlinigkeit, die eine Zäsur bildet, stellt die Felswand nicht in Frage und lässt durch das Zurückrücken von der Kante den Turm als stärkstes und historisierendes Element wirken. Phillippe: Gibt es ein Projekt, das versucht auf die Felsform einzugehen? Rieder: Es gibt ein Modell, das mit einem Schlitz arbeitet, der dann sozusagen zu einem großen Raum im Berg wird. Man arbeitet hier sehr stark mit Oberlicht und einem versunkenen Raum. Phillippe: Gibt es einen Architekten, der zum Beispiel das Wechselspiel von Wald und Fels in sein Konzept mit einbezieht? Rieder: Das, das Sie hier ansprechen ist eine Interpretation des Ortes. Wir sehen hier beim zweiten Preis eine extreme Abstraktion im Sinne der Interpretation des Ortes. Ich beseitige die weißen Stahlträger und das kalte Glas, setzte es um eine Spur zurück, verschönere und ästhetisiere es, ansonsten lasse ich alles wie gehabt und mache es innen funktional. Das ist diese Position. Das Modell des ersten Preises erscheint wie ein aufgesetztes Implantat. In diesem Fall ist ein Museum erstens ein Gebäude, zweitens teilt es sich als solches in Form eines Bilderrahmens mit und drittens hat es etwas völlig absurdes – einen Ausblick. Als ob die Stadt selbst das größte Museum ist, was vielleicht war ist, aber dennoch bleibt die Frage wie es der Kunst Referenz erweist offen. Dieses Projekt arbeitet noch mit einigen Images. Es wird zum Beispiel die Idee des Grabendachs aufgenommen, wodurch das Gebäude vorgaukelt sich in der Altstadt zu befinden. Der Grundriss des Projekts ist definiert, bereinigt und ausgeräumt er hat nur einen räumlichen Anspruch – die Treppe, sozusagen als Orientierungspunkt, die genau auf den alten Wasserturm ausgerichtet ist. Die räumliche Auseinandersetzung besteht hier aus großen Räumen, die durch eine Treppe strukturiert werden, im Erdgeschoss, im ersten Stock und im Dachgeschoss. Sie sehen Architektur hat sehr viel mit Ordnung zu tun, die kann aber auch, wenn sie zu oft verwendet wird, eingrenzend sein und eine gewisse Unsicherheit vermitteln. Meine Gedanken waren folgende: Ich wollte eigentlich kein Gebäude machen, das war auch der Ansatzpunkt an dem einige klassische Jurymitglieder sagten, es muss schon als Haus identifizierbar sein. Dennoch war ich der Meinung, dass dort oben kein Gebäude mehr stehen sollte, da es bis jetzt immer Probleme mit Häusern am Mönchsberg gab. Folge dessen suchte ich raumbildendes und strukturierendes Element, dass im Zusammenhang mit einem Museum ein Gebäude entstehen lässt und fand die „Wand“. Diese Wände kann man schaffen wie Sie, indem man mit der Flex in das Gestein arbeitet. Dann hat man eine inverse, also eine nicht existierende, Wand – einen Schlitz, den man ausgießen kann um eine reale Wand zu erhalten oder man baut die Wand einfach auf. Diese beiden Elemente, positiv – negativ, habe ich immer wieder eingesetzt und gleichzeitig versucht die Grenzen des Gebäudes und des Bauplatzes aufzulösen. Sie sehen hier, dass es Elemente gibt, die weiter hinaus gehen als die engen Begrenzer, das Gebäude dehnt sich an diesen Stellen aus. Die Wände laufen unterschiedlich weit hinaus und vernetzten sich sozusagen mit dem Ort. Sie sind mit vertikalen Jalousien ausgebildet, die je nach Anforderung geschlossen, halb geöffnet oder offen sein können. Der Blick nach draußen bleibt fast immer erhalten, die Kunst hat keinen Innenraum mehr. Ein weiterer Gedanke war, dass es in diesem Sinne auch kein geometrisch, geschlossenes Dach mehr gibt. Es gibt Teilflächen aus verschiedenen Materialien, die wie Blätter auf dem „Wandgeäst“ liegen. Die unterschiedlichen Materialien fungieren als Lichtfilter, wodurch sich in den Räumen verschiedenste Lichtverhältnisse manifestieren. Durch das Fehlen einer durchgehenden Decke ist der Raum weder gedanklich noch gefühlsmäßig begrenzt. Gleichzeitig erscheint es mir wichtig so viele Wände wie möglich zu haben um dementsprechend viel Kunst aufhängen zu können. Diese Wände sind nie frontal, lenken jedoch nicht von der Kunst ab indem man bewusst ein Stiegenhaus betritt. Die Konsequenz meines Denkens war, dass sie Treppe nicht als eigenes Element im Raum steht, sie ist Teil einer doppelschaligen Wand. Dadurch können sie alle von mir angebotenen Räume koppeln oder abtrennen und dennoch „frei“ gehen. Natürlich können sie auch den klassischen Museumsrundgang in einem Einbahnsystem machen. Thiel: Gab es in der Ausschreibung irgendwelche Vorgaben? Rieder: Gerade was das Licht betrifft, gibt es große Unterschiede zwischen Museen, die nur Gemälde, Skulpturen oder in etwa Druckgraphiken ausstellen. Hier handelt es sich um eine Gemäldeausstellung, die einige Plastiken beinhaltet, die im Freien ausgestellt werden sollen. Es war keine bestimmte Raumordnung vorgegeben außer einer, vom Museumskomplex abtrennbaren, großen Halle, die für Wechselausstellungen verwendbar ist. Später hat sich dann die Tendenz herausgestellt, dass man doch einen Bau möchte, indem man Zimmer für Zimmer durchschreiten kann. Durch die extreme Anordnung meines Museums ist der durchführende Weg stark definiert, fast eine Konditionierung für den Besucher, während man im Objekt des ersten Preises, fast alltäglich, im Kreis gehen kann. Grundsätzlich ist das auch bei mir möglich, aber die Zuschnitte der Räume verweisen eben nach außen. Der perspektivische Fluchtpunkt liegt immer Außen, wodurch mein Bau, im Gegensatz zum ersten Preis, vertikal offen ist. Der Vorwurf, der in der letzten Phase aufkam, war die Platzfrage, bis man dann nach einigen Diskussionen einsah, dass doch mein Bau die meisten Hängeflächen bietet, wenn auch etwas unüblich. Diese Wandkonstruktionen werden, durch die steuerbaren Jalousien, mit jeder weiterer Etage komplizierter. Folge dessen kann man die Beleuchtung stark variieren, zum Beispiel je nach Epoche oder Stilrichtung. Phillippe: Wie ist bei Ihnen der Dialog mit der Stadt zu sehen? Rieder: Eines meiner wesentlichen Dinge ist, dass es keine einmalige Kante gibt, sondern viele fallende Linien, sozusagen wie die verschiedenen Vegetationsstufen oder Felsformationen, die sich zurückstaffeln, sich wie Kulissen auftürmen. Vorne gibt es einen kleinen Sichtschlitz mit einer minimalen Glasfront. Thiel: Ich habe den Vorwurf gelesen, dass Sie sich so der Stadt verweigern. Rieder: Wenn der Besucher mit dem Lift herauf fährt und heraustritt hat er einen Panoramablick auf die ganze Stadt, ebenso wenn er das Museum wieder verlässt. Also, warum ein Panoramakaffe bauen, wenn ein Museumskaffe ausgeschrieben wurde? Thiel: Ist nicht gleichzeitig der Gedanke vorhanden, dass die eitle Selbstinszenierung der Altstadt, Rechtfertigung für das Museum ist? Rieder: Vom dem her repräsentiert das Projekt, dass den ersten Preis gewonnen hat, Salzburg sicher am Besten. Es klärt nicht ob es ein Panoramakaffe, ein Kasino oder ein Museum ist, arbeitet mit dem selben Material zur Beruhigung, verwendet im Vergleich das wenigste Glas und ist sicherlich ein ordentlicher und stabiler Rahmen. Thiel: Gibt es andere Museen, die Sie vom Konzept her kennen? Rieder: Vorher möchte ich noch kurz etwas sagen: Ich glaube, daß mein Konzept, so eigenwillig die Räume auch gestaltet sind, für jede Art von Kunst zugänglich ist. Durch den Verzicht von sichtbaren Stiegen und Nischen behält der Bau eine bestimmte Neutralität, die sich durch die bloßen Elemente Wand und Licht bestärkt. Es gibt natürlich auch Museen, die von einem bestimmten Kunstwerk ausgehen, weil sie schon wissen was ausgestellt werden soll. Zum Beispiel von Hans Hollein, in Frankfurt oder Mönchengladbach. Das andere Extrem wäre ein Museum, das vom Kunstwerk völlig weg geht und sich selbst als solchen darstellt. Eines der besten Beispiele dafür ist das jüdische Museum in Berlin von Daniel Liebeskind, das eigentlich nur noch über Räume existiert, die als Denkmal der jüdischen Vertreibung und des Holocausts inszeniert sind, egal was darin hängt. Da verlässt man die Gebrauchsarchitektur und nimmt sich das Recht auch als Architekt eine Mitteilung zu machen. Dadurch entstand die momentane Debatte ob das Museum selbst ein Raumkunstwerk ist, und was es als dieses den Bildern bringt, weil es Spannung erzeugt, oder ob es auch eine neutrale Industrieschachtel sein kann. Thiel: Welches Beispiel würden Sie momentan in dem Wechselverhältnis Selbstdarstellung des Baues und Funktionalität des Museums sehen? Rieder: Das eine Extrem ist, wenn sie zum Beispiel das Guggenheim Museum in Venedig besuchen, wo die Ausstellungsstücke wunderschön sind und das Gebäude – ein alter Palazzo– einfach halbwegs vorbereitet wurde. Im Gegensatz dazu steht das Guggenheim Museum in Bilbao, wo das Gebäude im Sinne der freien Architektur errichtet wurde und für sich spricht. Hier bin ich ein bisschen von der Land Art ausgegangen, weil der Ort so stark ist, dass ich mich mit ihm und der außergewöhnlichen Lage zur Stadt auseinandersetzen wollte – nach dem Motto: Alles, was ich dort finde mache ich zu einem Museum. Der Gedanke war, dass, wenn schon eine Idee im Ort vorhanden ist, sozusagen brach liegt, diese nie im Gegensatz zu der Kunst stehen kann, die dort später einmal aufgehängt wird. Denn sie versucht sich nicht als Front oder Gebäude zu etablieren, sondern als das was sie ist, Mauern auf denen Bilder ausgestellt sind. Wolfi: Wie lange haben Sie gebraucht um diese Pläne anzufertigen? Rieder: Wir zeichnen für diese Art von Plänen circa drei Wochen, geistig beschäftigt man sich ungefähr zwei bis drei Monate damit. Durch langjährige Erfahrung entwickelt man dann schon eine bestimmte Raumauffassung, die man immer wieder anwendet. Thiel: Wir müssen jetzt leider aufhören, da es zur Pause geläutet hat. Vielen herzlichen Dank für ihr Kommen!