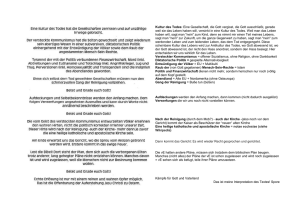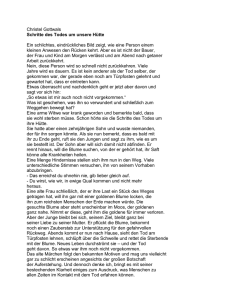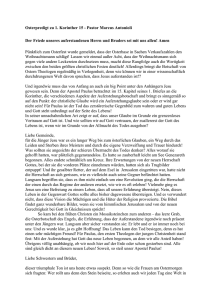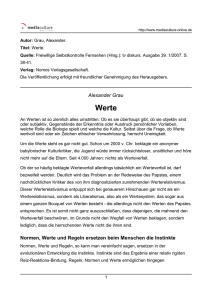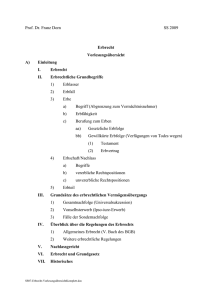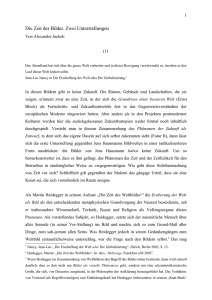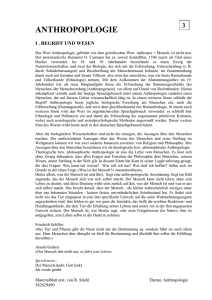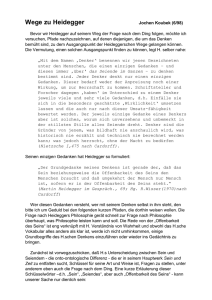Mors certa, hora incerta! Über die Gewissheit des eigenen Todes als
Werbung

1 Armin G. Wildfeuer: Mors certa? Mors certa, hora incerta! Über die Gewissheit des eigenen Todes als Problem der Philosophie von Armin G. Wildfeuer I. Dass wir sterben werden und der Tod unser irdisches Leben beenden wird, dessen können wir uns, so unsere feste Überzeugung, gewiss sein. Ja, diese Prognose scheint alle anderen menschlichen Erkenntnisse an Gewissheit zu übertreffen. Denn von allen Dingen in der Welt ist nur der Tod nicht ungewiss „incerta omnia, sola mors certa“, so hat dies dem Sinne nach bereits Augustinus (354-430) formuliert.1 Freilich partizipiert an dieser Gewissheit der unausweichlichen Faktizität unseres Lebensendes nicht auch das Wissen um den Zeitpunkt, den Ort und die Umstände des Todes eines jeden „ Mors certa, hora incerta“, „Der Tod ist gewiss, ungewiss nur die Stunde“2, so stand vielfach auf frühneuzeitlichen Sonnenuhren 3 und auf Uhren an öffentlichen Gebäuden 4 zu lesen. Kurzum Der Mensch ist sich in dem Wissen sicher, dass der Tod ihn erwartet, er weiß aber weder den genauen Zeitpunkt, noch kennt er die Umstände, welche die Stunde seines Todes begleiten werden. Er ist gezwungen, im Rahmen dieser Spannung von „mors certa“ einerseits und „hora incerta“ andererseits zu leben. Danach gefragt, kann sich jeder Mensch diese Spannung bewusst machen und sie in ihrer faktischen Gegebenheit bestätigen. Weil der Tod, so die in der antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Geistesgeschichte einhellig geteilte Überzeugung, mithin als gewiss gelten muss, erschien die 1 Der Satz ist wörtlich bei den antiken Autoren nicht zu belegen. Dem Sinne nach jedoch findet sich eine analoge Formulierung bei Augustinus in Sermon 97 „De verbis evangelii Mc 13, 32: de die autem illo vel hora nemo scit neque angeli in caelo, neque filius, nisi pater“: „caetera nostra et bona et mala incerta sunt: sola mors certa est” 2 Die wortidentische Quelle ist auch hier nicht mehr zu eruieren. Wahrscheinlich kommt ebenfalls Sermon 97 von Augustin in Frage, wo der Tod als die Strafe des erbsündlichen Menschen gedeutet wird. „poena certa est, hora incerta: et de ista poena sola certi sumus in rebus humanis“. Der Sinnspruch findet sich auch in einer abgewandelten Form: „Mors certa, ultima latet“ (Der Tod ist gewiss, die letzte Stunde bleibt veborgen!). Eine direkte Quelle lässt sich aber auch hierfür nicht mehr ausfindig machen. 3 Man findet alte Sonnenuhren mit dieser Inschrift in Berlin am Kroegel (Altberlinergasse), an der Spree; in Hof, oberh. Torbogen; in Dresden, Schloss, Stallhof, Langer Gang; in Rottweil an der Stadtmauer. 4 So etwa auf der Leipziger Rathausuhr. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 2 Problematisierung dieser Überzeugung als überflüssig. An dem Urteil „Alle Menschen sind sterblich“ konnte daher ernsthaft nicht gezweifelt werden. Es musste vielfach als Beispiel herhalten, um die Schlagkraft rationalen Argumentierens, etwa in Form des Syllogismus5, zu belegen. Für die vormoderne Philosophie6 waren mit Blick auf das Problem des Todes vor allem zwei Fragen von Interesse - Zum einen diejenige danach, was der Tod denn an sich betrachtet sei. Die klassische Antwort, die freilich eine heute problematisch gewordenen Metaphysik und Anthropologie voraussetzt, lautete Er bedeutet das Ende des menschlichen Lebens schlechthin und muss – so die seit Platon (427/428-347) übliche Einsicht - als das Ergebnis der Trennung von Leib und Seele7, mithin die „Entseelung“ des Leibes vorgestellt werden. - Zum anderen schloss sich daran wie selbstverständlich die Frage an Gibt es für den Menschen eine Hoffnung über die Todesgrenze hinaus und wie kann diese gedacht werden? Diese zweite Frage hängt mit der ersten unauflöslich zusammen. Wer fragt, was der Tod sei, fragt nicht nur nach dem Geschehen des Sterbens, sondern auch nach dem, was darin aus dem Menschen wird, wo er ist bzw. nicht ist, wenn er gestorben ist. Die klassische Antwort auf diese zweite Frage war die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, wie sie mit großer geistesgeschichtlicher Wirkung in Platons Dialog „Phaidon“ zum Gegenstand philosophischer Reflexion gemacht worden ist.8 Beide Fragen, sowohl die nach dem, was der Tod seinem Wesen nach sei, als auch die nach einer Hoffnung über den Tod hinaus, haben mit erheblichen erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten zu kämpfen, die unmittelbar einleuchten. Denn, so formuliert es der Philosoph Georg Scherer „was der Tod ist, weiß keiner der Lebenden aus eigener Erfahrung. Die Verstorbenen vermögen wir nicht zu befragen. Allein sie könnten uns aus eige- 5 Im klassischen Syllogismus wird aus einem als gesichert geltenden Obersatz: „Alle Menschen sind sterblich“ und dem Untersatz: „Sokrates ist ein Mensch“ mit Notwendigkeit der Schlussatz gefolgert: „Sokrates ist sterblich“. Der Syllogismus ist also ein Schluss aus zwei Sätzen, von denen jeder zwei allgemeine Wörter (Termini) enthält, wobei eines dieser Wörter in jedem der beiden Sätze vorkommt, auf einen dritten Satz, der aus den beiden anderen Wörtern der ersten beiden Sätze besteht. 6 Zur Geschichte des Denkens über den Tod im Rahmen der Philosophie vgl. A. Hügli 1998 sowie kulturgeschichtlich allgemein das inzwischen zum Klassiker gewordene, in deutscher Übersetzung bereits in der 10. Auflage erschienene Buch von P. Ariès 2002. 7 Vgl. etwa wirkmächtig Platon, Phaidon 67 C, D. 8 Zur Gesamtinterpretation des Unsterblichkeitsgedankens in Platons Phaidon siehe H. M. Baumgartner 1980. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 3 ner Erfahrung sagen, was dem Menschen im Tod geschieht, falls sie durch ihn hindurch zu einer neuen Existenzweise gelangt sind. Auch durch logische Deduktionen lässt sich nichts über den Tod ausmachen.“ (G. Scherer 1989, 572f.) Die einzige Gewissheit ist, dass die personale Existenz in der uns bekannten Existenzweise unwiderruflich zu Ende gegangen ist. Und die Frage ob es nicht doch möglich ist, dass der Verstorbene in einer todestranszendenten Wirklichkeit zu einem neuen Leben gelangt ist, muss auf einer anderen Ebene und von anderen Gesichtspunkten her diskutiert werden, als dies die Philosophie leisten kann. Religion und Theologie bieten hier gehaltvollere Antworten als dies die Philosophie ob ihrer methodischen Beschränkung auf das durch Vernunft erschließbare leisten kann.9 Für die Philosophie des 20. Jahrhunderts verbietet sich insbesondere die Frage nach einem Weiterleben nach dem Tod, auch wenn der Stachel der Frage nach einer postmortalen Existenz nicht zu leugnen ist.10 Gefragt wird jetzt vielmehr, welche Bedeutung und welche Konsequenzen es für das Selbstverständnis des Menschen hat, im Bewusstsein des eigenen Todes sein Leben zu führen. Will die Philosophie dabei überhaupt noch Aussagen über den Tod wagen, so ist sie „auf Todesphänomene diesseits der Todesgrenze angewiesen“ (G. Scherer 1989, 573). Der Tod und seine Bedeutung nämlich, so die Grundüberzeugung, erschließen sich nicht aus einem uns sowieso nicht zugänglichen Jenseits, sondern nur aus dem Diesseits, d.h. aus dem Leben. Das Leben ist mithin für den Philosophen der einzig legitime Schlüssel zum Tod. Die Aufforderung „Memento mori!“, „Gedenke, dass Du sterblich bist!“ ist mithin auch der eigentlicher Ertrag des Nachdenkens über den Tod in der modernen Philosophie. Als Ausgangpunkt wählt sie dabei den Zweifel an dem, was in der Tradition als unhinterfragtes Faktum vorausgesetzt war, nämlich die Gewissheit unseres Todes selbst? Woher nehmen wir überhaupt die Gewissheit, dass wir sterben werden? Und wie steht es tatsächlich um die ra9 Zum Umgang mit dem Unsterblichkeitsgedanken in der Philosophie siehe Q. Huonder 1970, G. Frankenhäuser 1991, A. Ruprecht 1993. Wieweit die Philosophie in der Antwort nach einem postmortalen Leben gehen kann, hat exemplarisch M. Scheler 1957, 36-64 argumentativ triftig dargelegt. 10 Vgl. die treffende Formulierung von G. Scherer 1989, 573: „Der Tod ebnet die Unterschiede von sinnvollem Leben und Sinnlosigkeit, von Wahrheit und Lüge, Gut und Böse, auf eine leere Gleichgültigkeit hin ein. Die Opfer von Auschwitz und ihre Schlächter, die Lebensretter und die Geretteten, die Betrogenen und Ausgebeuteten, die Betrüger und Ausbeuter würden alle in dem einen alle Unterschiede auslöschenden Aus endigen, wenn der Tod das letzte Wort hätte. Dies wäre absurd, weil so das elementarste Postulat unserer Vernunft, dass nämlich menschliches Leben sinnvoll sein sollte, selber der Absurdität überführt würde. Von daher vermag unser Denken auf der Forderung einer postmortalen Existenz des Menschen zu bestehen, ohne einen Beweis für diese vorführen zu können. Kant hat ein solches Postulat von den Bedingungen und Notwendigkeiten der Moralität her gefordert.“ Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 4 tionale Ausweisbarkeit und Bewiesenheit des prima vista als unumstößlich wie absolut gewiss geltenden und intuitiv immer schon plausibel erscheinenden Urteils „Alle Menschen sind sterblich!“? Und wie, so lässt sich diese dem kritischen Anspruch der Philosophie wahrlich würdige Frage fortführen, kommen wir überhaupt zu diesem Wissen? Wie zur Überzeugung von der Gewissheit unseres eigenen Todes? Und wie wissen wir eigentlich um den Tod? Woher erlangt der Mensch seine Todesgewissheit? II. Letztere Frage ist die „Kernfrage“ einer „Erkenntnistheorie des Todes“ (M. Scheler 1957, 17-36), auf die der 1928 verstorbene Philosoph Max Scheler in seiner im Nachlass erhalten und zwischen 1911 und 1914 entstanden Schrift „Tod und Fortleben“11 als einer der ersten das philosophische Fragen aufmerksam gemacht hat. Ohne eine Untersuchung dieser Kernfrage ist – jedenfalls in der modernen Philosophie des 20. Jahrhunderts - eine Antwort auf die Frage „Was ist der Tod?“, „Welche Bedeutung hat er für uns?“, ja „Welchen Sinn hat er?“, kaum möglich. Auf den ersten Blick freilich mag die Frage, ob wir uns unseres Todes auch gewiss sein können, als überflüssig, als gekünstelt, gar als kontraintuitiv und daher als nicht wirklich bedeutungsvoll erscheinen – eine „Luftnummer“, wie mancher sie als typisch für Fragestellungen der Philosophie überhaupt hinzustellen geneigt ist. Denn würden wir gefragt, woher und mit welchen Gründen wir wissen bzw. uns gewiss sind, dass wir eines Tages sterben müssen, so würden wir diese Frage nach der Herkunft unserer Todesgewissheit wahrscheinlich durch den spontanen Verweis auf die allgemeine Erfahrung begründen, wie sie jeder macht oder zumindest machen kann. Denn wer könnte schon an der Gewissheit des Todes für ausnahmslos alle Menschen ernsthaft zweifeln, wo es doch von allen Menschen, die je gelebt haben, ausnahmslos heißt, sie seien gestorben. Gleiches bestätigt uns die Erfahrung des Sterbens derer, die mit uns gelebt haben. Und wir schließen spontan aus dieser Erfahrung, dass unser Wissen vom Tod und seinem sicheren Eintreten auf der Beobachtung einer Reihe von Todesfällen beruht. Es handelt sich also hierbei, so unsere feste Überzeugung, um „ein auf Induktion gegründetes Erfahrungswissen“, d.h. um eine Erkenntnis, die durch das Schließen vom Besonderen auf das Allgemeine zustande kommt, bzw. „auf der Beobachtung einer Reihe von 11 M. Scheler 1957. Vgl. dazu E. Ströker 1975. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 5 Todes-,fällen’“ (E. Ströker 1975, 203) beruht, woraus ein allgemeiner Sachverhalt generiert wird. Gestützt wird diese solchermaßen induktiv gewonnene Gewissheit zudem durch Hinweise aus Biologie und Medizin bezüglich der natürlichen Alterungsvorgänge. Für den naturwissenschaftlich aufgeklärten, „modernen“ Menschen ist das Faktum der Verschlechterung der Zellreproduktion oder der Hinweis auf molekularbiologische Vorgänge, welche uns das Alter vielleicht als ein Naturgesetz vorstellen, hinreichendes Indiz für die Gewissheit von der Unabwendbarkeit des Todes, nicht nur des Menschen, sondern aller Lebewesen. Selbst wenn das Leben von Lebewesen nicht durch Unfall, Krankheit, Krieg, Mord oder durch gesellschaftliche Missstände ein Ende findet, so ist der „natürliche Tod“12 doch ein unabwendbares Schicksal. Max Scheler freilich lehnt eine solche auf bloßer Induktion gegründete oder sich auf Empirie stützende Behauptung unserer Todesgewissheit ab, wie sie den angeführten Überlegungen zugrunde liegt. Denn wäre unser Wissen vom Tode nur empirisch und induktiv gewonnen, dann dürfte ein Mensch, der niemals die Erfahrung des Sterbens und des Todes eines anderen gemacht hat, keinerlei Wissen vom Tod überhaupt und schon gar nicht von seinem eigenen Tode haben. Selbst die Erfahrung des Alterns, der Niedergangserscheinungen der Kräfte führt nicht zur Einsicht in die Gewissheit des Todes, dessen Idee den Endpunkt dieser Entwicklung markiert. Denn was gibt dem Menschen die Sicherheit, dass die Richtung der Kurve, die ihm jede dieser Erfahrungen gibt, einen Endpunkt hat? „Denn woher wüsste der Mensch, dass diese Kurve nicht grenzenlos in diesem Rhythmus weitergehe?“ (M. Scheler 1957, 16) Scheler widerspricht daher engagiert der „Vorstellung, welche den Begriff des Todes zu einem rein empirisch aus einer Anzahl von Einzelfällen entwickelten Gattungsbegriff macht“ (M. Scheler 1957, 16). Denn man kommt durch Induktion nur zu „jenem ein wenig kindischen Syllogismus Herr N. wird sterben, weil der Herzog von Wellington und noch einige starben. Das notieren wir uns dann in der Form ‚alle Menschen sind sterblich’“ (ebd. 30). In der Tat führt das bloße Erfahrungswissen zwar zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, könnte aber, mindestens solange, als wir das zum Tode führende Altern nicht als Naturgesetz erkannt haben, die Gewissheit des Todes keineswegs begründen. Außerdem macht die vor wenigen Jahren verstorbene Kölner Philosophin Elisabeth Ströker mit Recht darauf aufmerksam, dass die bloße Induktion kein „zuverlässiger Anhaltspunkt für meinen Tod“ zu sein vermag, sofern ich ihn wirklich und im Ernst als den meinen zu denken versuche. Denn in meiner Erfahrung ist mir immer nur der Tod anderer gegeben „Höchstwahrscheinlich ereilt ... der Tod sie alle - aber als andere. 12 Vgl. dazu den Überblick bei G. Scherer 1988, 19-24 und neuerdings H. Hoping 1996. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 6 Schließe ich daraus, dass auch ich sterben werde, so würde ich mir nur vorstellig ... als einer der anderen, unter denen ich mich doch niemals finde, da ich ja der andere nie sein kann. In solcher Art der Erfahrung wäre mir also mein Tod nicht nur niemals ganz gewiss; er bliebe mir auch als meiner völlig fremd, wäre als meiner nur zu fassen in Analogie zu dem der anderen. Und dass ich überhaupt von ihm weiß, bliebe dann überdies gebunden an die Zufälligkeit der Erfahrung fremden Sterbens.“ (E. Ströker 1975, 203) Meine eigene Todesgewissheit wäre sozusagen nur von außen begründet, erreichte gar nicht mich selbst in meinem Selbstverständnis. Es wäre daher schwer zu erklären, wie es möglich ist, dass Menschen sich durch die Todesgewissheit radikal in Frage gestellt sehen, dass sie in der Angst vor dem Tode mitten im Leben schon gleichsam den Boden unter den Füßen verlieren können und entwurzelt werden. Es ist doch gerade dieses Ineinander von Gewissheit und Fraglichkeit, welche die charakteristische Betroffenheit ausmacht, mit der uns die Todesgewissheit überfällt, sobald wir sie wirklich ernst nehmen. Diese ihre Struktur ist aus einem bloßen, auf Empirie gegründeten Induktionsschluss unableitbar. Grundsätzlich gilt zudem Mein eigener Tod kann mir überhaupt nie Gegenstand der Erfahrung werden. Erfahren hätte den Tod nur, wer schon gestorben ist und dennoch lebte. Nur er wüsste, was das Sterben und was der Tod ist. Auch die immer wieder als Hinweise auf ein Leben nach dem Tode herangezogenen Erfahrungen und Berichte derjenigen, die vermeintlich schon tot waren, aber wieder ins Leben zurückgekommen sind, können nicht wirklich Auskunft darüber geben, was der Tod ist und was nach ihm folgt. Denn der Tod ist geradezu durch seine Irreversibilität mitdefiniert Es gibt für denjenigen, der den Rubikon überschritten hat, kein Zurückkommen mehr. Wer dieses freilich behauptet, mag gewesen sein wo er will, er war mit Sicherheit jedoch nicht tot. Vorsichtiger und richtiger sind solche Erfahrungen daher bestenfalls als Nah-Todeserfahrungen eines Lebenden zu bezeichnen.13 Über den Tod selbst geben sie keine Auskunft. Er ist von Lebenden – so das Resümee - nicht erfahrbar. Wenn der Tod überhaupt - und schon gar der eigene Tod - nicht erfahrbar ist und wenn wir von dem in unserer Umwelt erfahrenen Tod der anderen nicht auf unseren eigenen schießen können, wie ist dann einem Lebenden ein wissender Zugang zum Tode und eine Todesgewissheit überhaupt möglich, welche die Erkenntnis in sich trägt, dass der Tod ihn zutiefst betrifft? Es haben sich in der Tradition der Philosophie drei mögliche Antworten auf diese Frage herausgebildet - Folge man einer ersten Antwort, dann gibt es ein in unserer Selbsterfahrung mitgegebenes Bewusstsein der „Todesrichtung“ unseres Daseins, gleichsam eine intuitiv- 13 So bei D. Lorimer u. R. Moody 1993, P. Atwater 1995, I. Currie 2000. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 7 immanente Todesgewissheit, die unsere Lebensvollzüge begleitet. Dies ist die Antwort, die Max Scheler (1874-1928) gibt Nach Scheler ist der Mensch das Lebewesen, das sowohl ein konkretes Wissen vom Sterbenwerden als auch vom Sterbenmüssen hat. Diese Todesgewissheit, so Scheler, besitze der Mensch jedoch nicht aufgrund äußerer Beobachtungen, sondern es sei ein intuitives Wissen, würde also wesensmäßig zum Menschsein gehören. Die „Todesidee“ ist ein konstitutives Element des Bewusstseins, dass sich in einer intuitiven Gewissheiten von unserer Sterblichkeit ausdrückt. diese „intuitive Todesgewissheit“ gehört „zum Wesen der Erfahrung, welche das Leben von sich selbst macht und ist daher in jedem Leben, als auch dem menschlichen, anwesend " (M. Scheler 1957, 22). - - Folgt man einer zweiten Antwort auf die Frage, auf welche Weise uns Sterben und Tod in ihrem ganzen Ernst so zur Gegebenheit kommen, dass wir einer Auseinandersetzung mit ihnen, die an die Wurzeln unserer Existenz greift, nicht mehr ausweichen können, dann geschieht dies durch das „Vorlaufen“ in den eigenen Tod, welches bereit ist, sich der Angst vor dem Tode auszusetzen. Sören Kierkegaard (1813-1855), der Vater der modernen Existenzphilosophie, sowie Martin Heidegger (1889-1976) haben in ihren Philosophien eine Antwort in diesem Sinne gegeben. Eine dritte Antwort lautet, ein solches Betroffensein vom Tode ereigne sich durch den Verlust geliebter Menschen, die uns durch den Tod entrissen werden. Als Vertreter einer solchen Theorie der Todeserfahrung im Horizont der Interpersonalität gelten der bereits genannte Aurelius Augustinus und im 20. Jahrhundert Gabriel Marcel (1889-1973). III. Folgen wir zunächst dem Gedankengang Max Schelers in seiner Schrift „Tod und Fortleben“ (M. Scheler 1957). Für Scheler gibt es so etwas wie eine „intuitive Todesgewissheit“. Sie „liegt schon in jeder noch so kleinen ‚Lebensphase’ und ihrer Erfahrungsstruktur“ (ebd. 16). Kraft ihrer weiß ein Mensch ganz unabhängig von äußerer Erfahrung in irgendeiner Form, dass ihn der Tod ereilen wird, auch wenn er das einzige Lebewesen auf Erden wäre. Er wüsste es, selbst wenn er niemals andere Lebewesen jene Veränderungen hätte erleiden sehen, die zur Erscheinung des Leichnams führten. Für Scheler hat der Mensch zudem eine intuitive Einsicht in das Wesen des Todes. Dieses Wesenswissen um den Tod gründet, so Scheler, „in einer besonderen Bewusstseinsart“, die mit dem zusammenhängt, „was wir Leben im biologischen Sinne nennen“. In ihr ist Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 8 uns der Leib als „Hintergrund für alle sog. Organempfindungen“ (ebd. 18) gegeben.14 Das Wissen um das Wesen des Todes als mit dem Leben gegebene Bewusstseinsart ist wie das Leben selbst Prozess. Er lässt sich als eine Art von „Abfluss“ mit einer wesenseigentümlichen Form und Struktur charakterisieren, die für alle möglichen Lebewesen dieselbe sein muss. In ihr ist auch „das Wesen des Todes bereits ... enthalten“ (ebd.), so dass der Tod nicht erst am Ende des Prozesses steht. Am Ende steht nur „die mehr oder weniger zufällige Realisierung dieses ‚Wesens’ ‚Tod’, ... nur sein zufälliges Gestorbenwerden, sein Verwirklichung von diesem oder jenem Individuum“ (ebd.). In dieser seiner intuitiv erfahrenen Wesenhaftigkeit ist der Tod „ein Apriori für alle beobachtende, induktive Erfahrung von dem wechselnden Gehalt eines jeden realen Lebensprozesses“ (ebd.). Der Tod ist im Wesen des Lebens und in der Erfahrungsart, die das Leben von sich selbst hat, mitgegeben. Darin gründet nach Scheler die Todesgewissheit. Ungewiss sind nur Art und Zeitpunkt seiner Verwirklichung. Eben „Mors certa, hora incerta!” Der Tod selbst aber bringt in dieser ungewissen letzten Stunde dem Menschen nur die Bestätigung dessen, was ihm als Lebewesen schon immer intuitiv gewiss war und sein ganzes Erleben mitbestimmte. Um das zu verstehen, muss man sich bei Scheler den Grund dieses intuitiven, vom Vollzug des Lebens selbst hervorgebrachten Todeswissens genauer vergegenwärtigen. Denn Scheler denkt hier einen Zusammenhang zwischen der intuitiven Todesgewissheit und den drei Erstreckungen des als zeitlich erfahrenen Lebensprozesses. Diese drei zeitlichen Erstreckung des Lebensprozesses sind nach Scheler „unmittelbares Gegenwärtigsein, Vergangensein und Zukünftigsein“ (M. Scheler 1957, 18f.). Ihnen entsprechen die drei qualitativ verschiedenen Aktarten unmittelbares Wahrnehmen, unmittelbares Erinnern und unmittelbares Erwarten. Sie sind nach Scheler in jeder möglichen Auffassung von einem Ding, einem Vorgang, einer Bewegung, einer Veränderung der Natur, aber auch in jeder inneren Erfahrung von einem sog. psychischen Erlebnis enthalten. Sie unterscheiden sich fundamental von jeder „mittelbaren“ Wahrnehmung, Erinnerung oder Erwartung, die „durch Schluss oder vermittelnde Reproduktion und Assoziation“ konstituiert werden. Ihre Unmittelbarkeit zeigt sich darin, dass sie in jedem Moment anwesend sind und jederzeit den „Gesamtgehalt“ unserer Erfahrung gliedern. „Dass wir Vergangenheit haben, dass wir Zukunft haben, das wird nicht erschlossen oder nur aufgrund symbolischer Funktionen sog. ‚Erwartungsbilder’ oder ‚Erinnerungsbilder’, die primär in dem ‚Gegenwärtigsein’ enthalten wären, bloß geurteilt; sondern wir erleben und sehen in jedem unteilba- 14 Zur Theorie des Leibes bei M. Scheler vgl. B. Lorscheid 1962. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 9 ren Moment unseres Lebensprozesses ‚etwas enteilen’ und ‚etwas herankommen’. Ferner Sowohl der Gehalt der unmittelbaren Erinnerung als jener der unmittelbaren Erwartung ist als wirksam auf unser gegenwärtiges Erleben (nicht als Vorstellung voraus) gegeben.“ (M. Scheler 1957, 19) In der sog. „objektiven Zeit“, wie wir sie dem Werden und Vergehen der toten Dinge und Geschehnisse unterlegen, findet sich freilich nichts von dieser Zeitstruktur, wie sie für das lebendige Sein charakteristisch ist. „Ihre Dramatik gibt es nicht … im Epos der objektiven Zeit.“ (M. Scheler 1957, 19) Damit stoßen wir auf das für unseren Zusammenhang Entscheidende. In jedem unmittelbaren Zeitpunkt eines lebendigen Seins ist ein Gesamtgehalt oder Gesamtumfang vorhanden, der sich aus den Teilgehalten des Gegenwärtigseins, Vergangenseins und Zukünftigseins zusammensetzt, wobei jeder dieser Teilgehalte einen bestimmten Umfang hat. Dabei nimmt der Gesamtumfang mit der Entwicklung des Individuums zu. Und gleichzeitig verändert sich das Verhältnis der Erstreckungen der Zeit, nämlich von Gegenwärtigsein, Vergangensein und Zukünftigsein. Das Verhältnis verteilt sich „mit dem objektiven Fortschreiten des Lebensprozesses in einer charakteristischen Richtung ... neu. ... Der Umfang des Gehalts in der Erstreckung der Vergangenheit ... wächst und wächst, während zugleich der Umfang des Gehalts in der Erstreckung der unmittelbaren Zukunft ... abnimmt und abnimmt.“ (M. Scheler 1957, 19) Dabei wird das Gegenwärtigsein zwischen Vergangenheit und Zukunft sozusagen immer stärker „zusammengepresst“, so dass sich die „Menge des Erlebenkönnens“ im Laufe des Lebens zunehmend „vermindert“ „Für das Kind ist die Gegenwart eine breite und helle Fläche des buntesten Seins. Aber diese Fläche nimmt mit jedem Fortschritt des Lebensprozesses ab. Sie wird enger und enger, immer gepresster und gepresster zwischen Nachwirksamkeit und Vorwirksamkeit. Für den Jüngling und Knaben steht seine erlebte Zukunft da wie ein breiter, heller, ins Unabsehbare sich erstreckender glänzender Gang, ein ungeheurer Spielraum in der Erlebnisform ‚Erlebenkönnen’, in den Wunsch, Verlangen, Phantasie tausend Gestalten malt. Aber mit jedem Stück Leben, das gelebt ist, und als gelebt in seiner unmittelbaren Nachwirkung gegeben ist, verengert sich fühlbar dieser Spielraum des noch erlebbaren Lebens. Der Spielraum seines Leben-könnens nimmt ab an Reichtum und Fülle, und der Druck der unmittelbaren Nachwirksamkeit wird größer.“ (M. Scheler 1957, 20) So steht der Lebensprozess im „Erlebnis der Todesrichtung“, d. h. der stetigen „Aufzehrung des erlebbaren, als zukünftig gegebenen Lebens durch gelebtes Leben und sei- Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 10 ne Nachwirksamkeit“ (ebd.). Das ist „das Richtungserlebnis“ des „Wechsels“, also von einer weiten, vor uns liegenden Zukunft und eines geringen Umfangs von Vergangenheit zugunsten eines Anwachsens der Vergangenheit und einer stetigen Verkürzung der noch zur Verfügung stehenden Zukunft. Und Scheler resümiert „In dieser Wesensstruktur jedes erfahrenen Lebensmoments ist es nun das Richtungserlebnis dieses Wechsels, das auch Erlebnis der Todesrichtung genannt werden kann.“ (M. Scheler 1957, 20) Dieses Erlebnis der Todesrichtung ist unabhängig von der äußeren Erfahrung unseres Alterns und den dazugehörigen Merkmalen des Verfalls. Es ist intuitiv und unserer Zeiterfahrung immanent Es ist ein konkomitantes, nicht empirisch verursachtes, aber jeder möglichen Erfahrung vom eigenen Leben wesensnotwendig mitgegebenes Erlebnis. Man könnte auch anders formulieren. Das Leben vollzieht sich als permanenter Prozess des Übergangs von vor uns liegenden Möglichkeiten, die wir ergreifen können, und die, wenn wir sie ergriffen haben, zur Wirklichkeit des Vergangenen werden. Im Laufe des Lebens werden die vor uns liegenden Möglichkeiten, die wir ergreifen können, immer geringer, die Wirklichkeit dessen, wofür wir uns ehedem entschieden haben, immer größer. Leben ist der Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Ist die Gesamtmenge des jeweils gegebenen Lebens so verteilt, dass der Umfang der Zukunftserstreckung zu Null wird, anders gewendet Haben wir keine Möglichkeiten mehr vor uns, sondern nur mehr Wirklichkeit hinter uns, so tritt nach Scheler der Tod ein. Dass er auf uns zukommt, wissen wir, weil er „wesensnotwendig“ (M. Scheler 1957, 21) in dem spezifischen Richtungserlebnis der Todesrichtung des Lebensprozesses selbst mitgegeben ist. Das „Grundphänomen des Alterns, das Wesen ‚Altern’“ (ebd.) ist daher im Lebensprozess und seiner Erfahrung selbst mitgegeben – noch vor der Erfahrung konkreter Erscheinungsweisen und Indikatoren des Alterns. Das Leben selbst erzeugt, so könnte man zusammenfassen, die Todesgewissheit. Die Einsicht, alt oder älter geworden zu sein, folgt dabei aus der wachsenden Einsicht in die Todesrichtung des Lebens. Die Todesgewissheit wird also gerade nicht – und das ist die Essenz des Schelerschen Gedankengangs - aus der Erfahrung der „faktischen Alterserscheinungen“ wie wachsender Ermüdung, Krankheit, Abnahme der Fähigkeit zu reagieren, graue Haare usw. geschlossen, sondern umgekehrt Erst das vom Leben selbst erzeugte Wissen um den Tod lässt uns unser Älterwerden wahrnehmen. „Der Tod ist also nicht bloß ein empirischer Bestandteil unserer Erfahrung, sondern es gehört zum Wesen der Erfahrung jedes Lebens, und auch unseres eigenen, dass sie die Richtung auf den Tod hat.“ (M. Scheler 1957, 22) Der wirklich eintretende Tod eines Menschen ist immer nur die nach Zeitpunkt und Art des Eintretens unvorhergesehene Bestätigung („hora incerta“) der intuitiven Todsgewissheit („mors certa“), die selbst nicht von irgendwelchen Affekten begleitet ist. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 11 Schelers Lehre von der „intuitiven Todesgewissheit“ ist nicht ohne Widerspruch geblieben.15 Denn man muss Scheler gegenüber durchaus kritisch fragen, ob die Verlagerung der Anteile von Vergangenheit und Zukunft innerhalb des Gesamtumfangs unseres Zeitbewusstseins wirklich zum Wissen um den Tod führen könnte, wenn wir nicht doch empirisch und durch Induktion um den Tod anderer wüssten. Dass im Fortgang unseres Lebens Vergangenheit wächst und Zukunft abnimmt, setzt das Wissen um den Tod bereits voraus. Wüssten wir nicht, dass wir sterben müssen, so wüssten wir auch nicht, dass der „Vorrat“ erlebbarer Zeit, in der wir noch unsere Möglichkeiten ergreifen können, immer geringer wird. Diese Gewissheit hat ja etwa z. B. das Kind noch nicht, obwohl sich auch in seinem Leben jene Richtungstendenz schon durchsetzt. Wir kommen zu der Einsicht, dass wir dem Tod verfallen sind, doch wohl nur, wenn wir die Erfahrung der Todesrichtung unseres zeitlichen Daseins mit der Erfahrung verbinden, dass andere sterben. Allerdings muss Scheler zugegeben werden Indem wir den Tod der anderen im Licht der Gewissheit von jener Richtungstendenz, welche unserer Selbsterfahrung angehört, sehen lernen, „verinnerlicht“ sich unser Wissen um den Tod, geht uns auf, womit wir es zu tun haben und womit wir selber zu tun bekommen werden, wenn wir andere sterben sehen. Die Schwierigkeit, in welche Schelers Versuch sich verstrickt, liegt dabei wohl darin, dass er den Tod zum Gegenstand einer „Wesenserkenntnis“ gemacht hat. Immer wieder betont er, die intuitive Todesgewissheit sei als Wesenserkenntnis völlig unabhängig von allen konkreten Situationen, aller leiblich erfahrenen Todesferne oder Todesnähe, allen faktischen Umständen des konkreten Sterbens. Schelers „Todesgewissheit“ darf also auf keinen Fall verwechselt werden mit in bestimmten Situationen erlebter Todesangst oder einer Ahnung des herannahenden Todes, sondern entspringt der Erfahrung des Lebensprozesses und seiner Gerichtetheit als solcher. Aber ob die Intuition der Todesgewissheit schon dem reinen Lebensprozess für sich betrachtet inne liegt, darf bezweifelt werden. Man muss auch darauf hinweisen, dass Schelers Theorie nicht deutlich zu machen vermag, dass wir den Tod immer wieder „als ein Gegensinniges zur spezifisch menschlichen Lebendigkeit“ (E. Ströker 1975, 211) erfahren. Kann der Tod einfach aus dem Wesen des Lebens verstanden werden oder ist er nicht vielmehr der wesenlose Widerspruch zum Leben überhaupt, zumindest zum Leben des Menschen? Weiter muss gefragt werden, ob uns nicht der Tod gerade kein intuitiv-anschauliches „Was“, keinen Wesensgehalt entgegenhält, sondern gerade den Entzug jeder anschaulich gegebenen Qualität bedeutet und wir so, wenn wir überhaupt von einem „Wesen des Todes“ spre- 15 Vgl. etwa die kritischen Einwänden bei G. Scherer 1988, 45-49 und E. Ströker 1975. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 12 chen wollen, sagen müssen, sein „Wesen“ bestehe gerade darin, uns jedes erfahrbare Wesen zu entziehen.“ Denn gerade das, was der Tod ist, ist uns verhüllt, wie Martin Heidegger später betonen wird. Vor allem ist aber auch auf folgendes hinzuweisen Scheler versucht den Tod im Bereich des Lebens anschaulich und die Gewissheit von ihm als ein Lebensphänomen verständlich zu machen. Muss sich aber der Mensch zum Tode verhalten, so steht er in einem einzigartigen Bezug zum Tode, den wir sonst bei keinem anderen Lebewesen finden. Es scheint also, dass das Spezifische des Menschentodes und des menschlichen Wissens um den Tod einem ganz anderen Bereich zugehören als dem des bloßen Lebens. Damit soll natürlich nicht geleugnet werden, dass der Tod durch unsere biologische Verfassung bedingt ist und ohne die Tatsache nicht gedacht werden kann, dass der Mensch auch ein Lebewesen ist. Trotz der vorgetragenen Bedenken kommt dem Schelerschen Ansatz eine bleibende Bedeutung zu. Sie liegt in seinem Hinweis auf die Todesrichtung unseres Lebensgangs. Damit hat Scheler zweifellos eine Zeiterfahrung getroffen und in die philosophische Diskussion eingebracht, welche zwar nicht als die Quelle der Todesgewissheit angesehen werden darf, wohl aber, zusammen mit anderen Momenten, die im folgenden erörtert werden müssen, zu den Strukturen unserer Existenz zählt. Scheler hat mit seiner Analyse einen wichtigen Beitrag zur philosophischen Erhellung der Struktur der Zeitlichkeit überhaupt geleistet, in der sich die menschliche Existenz vollzieht, indem er im Zusammenhang mit der Frage nach der Todesgewissheit die eigentümliche Gerichtetheit der ursprünglichen Zeiterfahrung aufzeigt. IV. Einen anderen, insgesamt plausibler erscheinenden Weg, die Gewissheit des Todes über alles bloß empirisch-induktive Wissen hinaus in ihrer Bedeutsamkeit für die menschliche Existenz aufzuschließen und eine Weise des Wissens um den Tod freizulegen, stellt das Denkmodell des „Vorlaufens“ in den Tod dar. Es ist erstmals von dem dänischen Religionsphilosophen Sören Kierkegaard entwickelt worden, wobei für unsere Ausführungen vor allem seine fiktive, aus dem Jahre 1845 stammende Rede „An einem Grabe“ (S. Kierkegard 1964) von Bedeutung sein wird. Martin Heideggers existentiale Analyse der Zeitlichkeit des menschlichen Daseins, wie sie in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“ von 1927 (M. Heidegger 1979) insbesondere in den §§ 46-53 vorgetragen wurde, Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 13 ist mit dem Ansatz Kierkegaards aufs engste verwandt. Mit den Ansätzen on Kierkegaard und Heidegger lässt sich zudem das Todesproblem im Existenzialismus exemplarisch darlegen.16 Beginnen wir mit den relevanten Ausführungen von Sören Kierkegaard Für ihn ist der Tod Gegenstand des „Ernstes“17. Der Ernst steht bei Kierkegaard immer in einer Beziehung zum „Selbst“ des Menschen. Es geht in der Existenz des Menschen gerade darum, ein solches „Selbst“ zu gewinnen. Folgt man den entsprechenden Ausführungen zum Selbst in der Schrift „Die Krankheit zum Tode“ (S. Kierkegard 1957, hier 127 f.), dann gewinnt der Mensch das Selbst, wenn er sich so zu sich selbst verhält, dass er sich als die Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit, Zeitlichem und Ewigen, von Freiheit und Notwendigkeit realisiert. Außerdem muss er sich, indem er sich zu sich selbst verhält, zugleich zu dem verhalten, welches ihn in das ganze Verhältnis eingesetzt hat. Das ist für Kierkegaard Gott, so dass er das Selbst auch als ein Selbst vor Gott oder als „theologisches Selbst“ bezeichnen kann. In das Verhältnis, zu welchem sich der Mensch verhalten muss, gehört auch das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit. An diesem Punkt bereits wird einsichtig, dass der Ernst, welcher auf das Selbstsein zielt, notwendig mit dem Tode zu tun hat und in dem Verhalten zum Tod sozusagen kulminiert. Denn das Verhältnis von Zeitlichem und Ewigem erhält durch den Tod erst seine Schärfe. Der Tod kann aber nur dann zum Gegenstand des Ernstes werden, wenn von ihm nicht – wie Kierkegaard sagt - „im allgemeinen“ geredet wird, wie das der Fall ist, wenn wir sagen, „alle Menschen sterben“ oder meinen, der Tod sei nun einmal das Geschick des Menschengeschlechtes. So zu reden wäre nach Kierkegaard nicht Ernst, sondern Scherz. Für ihn ist der Ernst auch dann noch nicht erreicht, wenn wir philosophische Betrachtungen über Werden und Vergehen anstellen, uns in wehmütigen Stimmungen ergehen, melancholisch werden und „seufzen über den Hohn des Lebens“ (S. Kierkegard 1964, 177). Selbst das Trauern und Klagen um den Tod des Geliebten bliebe dem von Kierkegaard geforderten Ernst noch äußerlich. Der Ernst kommt in unser Verhältnis zum Tod erst, wenn wir den Tod in einen ausgezeichneten Bezug zu uns selbst setzen, wenn er uns – wie er sagt - zum „Gedanken im Innern“ wird. Das geschieht dann, wenn wir uns selbst als tot denken, mit dem Tod ineins denken, also durch das „Vorlaufen in den Tod“. Nur so werden wir zu Zeugen des eigenen Todes. Dieses Vorlaufen macht ernst damit, dass im Tode alles Weltliche und Irdische, welches jetzt unseren Sinn erfüllt, aufhört. Der je persönliche Tod ist für Kierkegaard Weltuntergang, ein Gedanke, der uns immer wieder beschäftigen wird. Dabei 16 Siehe zur Todesproblematik im Existenzialismus den erhellenden Überblick, den die Arbeit von A. Lohner 1997 gibt. 17 Vgl. zur Interpretation M. Theunissen 1958 und neuerdings M. Theunissen 2000. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 14 ist für ihn das Entscheidende, dass wir den auf uns zukommenden Weltuntergang, die noch ausstehende Zukunft des Todes, jetzt in unsere Existenz hineinnehmen. Das können wir nur im Gedanken an den Tod. Darum ist für Kierkegaard nicht eigentlich der Tod, sondern der Gedanke an den Tod die Spitze des Ernstes. Dieser Gedanke ist aber eben kein „bloßer Gedanke“, der keine Folgen hat. Wir verhalten uns in diesem Gedanken ja zu uns selbst und ergreifen uns selbst. Dabei haben wir zu realisieren, dass der Tod jederzeit möglich ist und dass er uns gewiss ist. Er wird mit Gewissheit kommen, aber wir wissen nicht wann. So gibt es „in der Gewissheit des Todes dessen Ungewissheit und in der Ungewissheit die Gewissheit“ (M. Theunissen 1958, 144). Denn der Tod ist „unbestimmbar das einzige Gewisse und das einzige, worüber nichts gewiss ist“ (S. Kierkegard 1964, 194). An dieser Struktur des Todes entfaltet sich der Ernst: „Wird der Gewissheit erlaubt, dahingestellt zu bleiben als das, was sie nun sein kann, als eine allgemeine Überschrift über das Leben, nicht, wie es vermöge der Ungewissheit geschieht, als die Unterschrift, welche die Anwendung unter das Einzelne und Tägliche setzt, dann lernt man den Ernst nicht. Die Ungewissheit tritt hinzu und verweist als der Lehrer ständig auf den Gegenstand der Lehre und sagt zum Lernen Achte wohl auf die Gewissheit so entsteht der Ernst.“ (S. Kierkegard 1964, 198) Es ist dieser Ernst, der den jetzt und hier Lebenden mahnt grundsätzlich im Blick zu behalten, „dass eine Zeit kommt, da es vorbei ist“ (S. Kierkegard 1964, 182), und zugleich, dass sie in jedem Augenblick hereinbrechen kann. „Die Unbestimmtheit einer Zukunft, in der alles verloren sein wird, erlangt im Ernst des Vorlaufens in den Tod eine die Gegenwart bestimmende Mächtigkeit.“ (G. Scherer 1988, 51) Denn im Vorlaufen in den je eigenen Tod, in „seinen“ Tod, gewinnt der Mensch erst seine Gegenwart. Das Sichergreifen des Menschen im Heute wird erst durch das Vorlaufen in den Tod ermöglicht. Denn wenn es jederzeit mit uns vorbei sein kann, dann ruft uns das Vorlaufen in den Tod zum Handeln in der unmittelbaren Gegenwart auf. Das Bewusstsein des Todes hat Auswirkungen auf die Gestaltung der Gegenwart. Das Bewusstsein, dass wir eines Tages tot sein werden, erzeugt gleichzeitig das Bewusstsein, dass es heute noch nicht vorbei ist, obgleich jeder Tag der letzte sein kann. Dies sagt uns die gewisse Ungewissheit des Todes. Von daher wird es dann „der Ernst, jeden Tag zu leben, als wäre er der letzte und zugleich der erste in einem langen Leben“ (S. Kierkegaard 1964, 187). Der Tod hat gleichsam eine „rückwirkende Kraft“ (ebd. 200), indem er es vermag, den Menschen aus seiner Todeszukunft auf die Gegenwart zurückwerfen. Erst eigentlich in dieser Weise erlangen wir die Gegenwart. „Der im Ernst gedachte Gedanke an den Tod Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 15 ermöglicht erst wahres, wirklich gelebtes und gerichtetes Leben.“ (M. Theunissen 1958, 147) Auch Martin Heidegger (M. Heidegger 1979) hat eine Theorie des Vorlaufens in den Tod entworfen.18 Diese Vorlaufen in den Tod gründet in der eigentümlichen Struktur der „Sorge“, die selbst darin gründet, dass es dem Menschen, oder existentialontologisch gesprochen dem „Dasein“ in seinem Sein immer um dieses Sein selbst geht (vgl. M. Heidegger 1979, §§ 39-44). Das Dasein existiert „je umwillen seiner selbst“, indem es sich „bis zu seinem Ende … zu seinem Seinkönnen“ (ebd. § 46) verhält. Diese Seinkönnen ist das eigentliche, um das es dem Menschen geht. Verhält sich der Mensch in seinem Dasein nicht zu sich selbst, mithin zu seinem Seinkönnen, dann verfällt er der Uneigentlichkeit. Wenn das Dasein sich zu sich selbst verhält, dann ist in diesem Verhältnis – so Heidegger - immer notwendig auch ein Verständnis eingeschlossen, das, weil das Verhalten auf das Seinkönnen zielt, immer ein ursprüngliches Verständnis von Sein bedeutet. Dasein meint gerade diese Erschlossenheit des Seins im „Da“ des Menschseins. In diesem Verhältnis zu seinem Seinkönnen ist es „sichvorweg“. Denn im „Wesen der Grundverfassung des Daseins liegt ... eine ständige Unabgeschlossenheit“. Denn uns steht immer noch etwas bevor, und solange wir sind, haben wir unsere Ganzheit nie erreicht. Dabei bedeutet diese Unganzheit „einen Ausstand an Seinkönnen“. Selbst wenn wir meinen, wir hätten nichts mehr vor uns und unsere Rechnung sei abgeschlossen, bleiben wir noch durch das „Sichvorweg“ bestimmt. Das Gezeichnetsein durch den „Seinsausstand“ bestimmt uns bis zum Tod. Erst wenn er uns erreicht, haben wir nichts mehr vor uns. Denn mit dem Tode endigt unser In-der-Welt-Sein, wird uns der Spielraum genommen, in dem wir allein uns zu unseren Möglichkeiten verhalten und sie ergreifen können, nämlich die Welt. Der Tod ist „Weltuntergang“ und eben damit, weil wir alle unsere Möglichkeiten nur im In-der-Welt-Sein realisieren können, zugleich das Ende unseres Seinkönnens „Die Behebung des Seinsausstandes besagt“ für den Menschen die „Vernichtung seines Seins. Solange das Dasein als Seiendes ist, hat es seine Gänze nie erreicht. Gewinnt es sie aber, dann wird der Gewinn zum Verlust des In-der-Welt-Seins schlechthin. Als Seiendes wird es dann nie mehr erfahrbar.“ (M. Heidegger 1979, § 46) Steht es so, dann ist zu befürchten, dass die Erfassung der ontologischen Seinsganzheit des Daseins „ein hoffnungsloses Unterfangen“ (ebd.) bleibt. 18 Zur Interpretation und Darlegung siehe D. Sternberger 1934, K. Lehmann 1938, J. M. Demske 1984, F. S. Gardiner 1984, P. Edwards 1985, T. Rentsch 1989, H. Rubio 1989, G. Knörzer 1990, C. Müller 1999, K.-P. Lehmann 2000, D. Frede 2001. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 16 Wie ist diesem Dilemma zu entkommen. Etwa im Blick auf den Tod der anderen? Wird uns in ihnen, wenn sie im Tod das Sichvorweg hinter sich gelassen haben, eine Ganzheit des Daseins erfahrbar? Das ist nach Heidegger deshalb nicht möglich, weil die Verbleibenden zwar unter dem Verlust des Verstorbenen leiden können und im „trauernd gedenkenden Verweilen“ mit ihm „zu sein vermögen, wobei aber der Verstorbene selbst faktisch nicht mehr“ da ist. Denn „Mitsein meint ... immer Miteinandersein in derselben Welt“. Sie aber hat der Verstorbene im Tode ja gerade verlassen, während die Hinterbliebenen noch in ihr sind. Dennoch können sie „aus ihr her ... noch mit ihm sein“. Sie erfahren aber in einem solchen Mitsein mit dem Toten gerade nicht den „Seinsverlust“, welchen der Sterbende an sich „erleidet“, nämlich „das eigentliche Zuendegekommensein des Verstorbenen“ (M. Heidegger 1979, § 47). Folglich kann keiner den Tod eines anderen erfahren. Jeder muss seinen Tod selbst sterben. Der Tod als „existentiales Phänomen“ ist immer der je meinige und nie der Tod der anderen. Wir können uns in mancherlei Hinsicht von anderen vertreten lassen. Indes scheitert diese Vertretungsmöglichkeit, so Heidegger, völlig, wenn es um die Vertretung der Seinsmöglichkeit geht, die das Zu-Ende-Kommen des Daseins ausmacht und ihm als solche seine Gänze gibt. Keiner kann dem anderen sein Sterben abnehmen. Eben das verkennt man, wenn „das Sterben Anderer als Ersatzthema für die Analyse der Ganzheit“ (M. Heidegger 1979, § 47), die unauflöslich mit dem Tode verbunden ist, vorgeschoben wird. Auch hier stimmt Heidegger völlig mit dem überein, was wir bei Kierkegaard über die den Menschen vereinzelnde Macht des Todes fanden. Mit den Worten Heideggers formuliert heißt dies Es stirbt nie ein „Man“, sondern immer ein Ich. „Man stirbt“ nicht, sondern „ich sterbe“. Die Rede vom „Man stirbt“ würde das Sterben auf ein reines Vorkommnis nivellieren und die Unvertretbarkeit des Todes verdecken. Man würde in die Uneigentlichkeit im Verhältnis zu seinem Tod verfallen. Der Mensch muss sich daher von der alltäglichen, auf die empirische Erfahrung des Todes anderer Bezug nehmende Auslegung des Todes befreien und ihn als seine eigenste Möglichkeit begreifen. Weil das Vorlaufen in den Tod den Menschen vereinzelt, gehört, so Heidegger weiter, zu diesem Sichverstehen des Daseins aus seinem Grunde die Grundbefindlichkeit der Angst. Das Sein zum Tode ist wesenhaft „Angst“ (M. Heidegger 1979, § 53/266). Die Angst aber hat – im Gegensatz zur Furcht – kein bestimmtes Etwas, vor dem sie sich ängstet. In ihr befindet sich das Dasein vor dem Nichts der möglichen Unmöglichkeit seiner Existenz. Dabei ist das Wovor der Angst mit dem, worum die Angst sich ängstet, identisch. Diese Stimmung der Angst stellt uns, so Heidegger, vor das Nichts. Den Tod verstehen heißt darum immer auch, Mut zur Angst zu besitzen, die in der Angst sich aufdrängende Bedrohung des Daseins auf sich zu nehmen und die Flucht vor Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 17 der Angst zu durchstoßen, die dem alltäglichen, verfallenden und entfremdenden Verhältnis des „Man“ zum Tode eigentümlich ist. Die „Freiheit zum Tode“ ist, so Heidegger, nur in der Angst möglich: „Das Vorlaufen enthüllt dem Dasein die Verlorenheit in das Man-selbst und bringt es vor die Möglichkeit, auf die besorgende Fürsorge primär ungestützt, es selbst zu sein, selbst aber in der leidenschaftlichen, von den Illusionen des Man gelösten, faktischen, ihrer selbst gewissen und sich ängstenden Freiheit zum Tode.“ (M. Heidegger 1979, § 53/266) Wie steht es dabei aber um die „Gewissheit des Todes“? Heideggers Antwort fügt sich nahtlos in die Erkenntnis von der Gewissheit des Todes ein, wie sie bereits bei Max Scheler und Sören Kierkegaard formuliert ist „Dass das Ableben als vorkommendes Ereignis ‚nur’ empirisch gewiss ist, entscheidet nicht über die Gewissheit des Todes.“ (M. Heidegger 1979, 257). Der „voll existenzial-ontologische Begriff des Todes“ dagegen lässt sich nach Heidegger folgendermaßen bestimmen „Der Tod als Ende des Daseins ist die eigenste, unbezügliche, gewisse und als solche unbestimmte, unüberholbare Möglichkeit des Daseins. Der Tod ist als Ende des Daseins im Sein dieses Seienden zu seinem Ende.“ (ebd. 258f.) V. Die Auffassungen vom Vorlaufen in den Tod, wie sie von Sören Kierkegaard und Martin Heidegger vertreten werden, können mit einer anderen Auffassung konfrontiert werden, welche die Betroffenheit des Menschen durch den Tod nicht aus dem Vorlaufen in den je eigenen Tod zu interpretieren versucht, sondern gerade vom Tode des anderen her. Man mag hier aufhorchen, denn gerade der Bezug auf den „Tod der anderen“ war es, der im Lichte der Ausführungen der bisher behandelten Autoren die Erfahrung des eigenen Todes wie dessen Gewissheit gerade nicht adäquat begreifen lassen konnte. Bei den nun zu besprechenden Autoren ist freilich nicht irgendein anderer gemeint, sondern es geht um den Tod dessen, den wir lieben, wie es bei Gabriel Marcel in seiner Schrift „Gegenwart und Unsterblichkeit“ (G. Marcel 1961) heißt. Folgt man Gabriel Marcel, dann ist die Erfahrung des Todes von einem herausgehobenen interpersonalen Ereignis her zu interpretieren. Eigene biographische Erlebnisse bilden den Hintergrund seiner Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 18 Auffassung.19 Marcel sucht zu zeigen, dass das Getroffenwerden durch den Tod eines anderen offenbar etwas völlig anderes sein kann als das Verfallen an die Uneigentlichkeit des Verhältnisses zum Tode, von welcher das „Man-selbst“- im Sinne Heideggers beherrscht ist. Während dieses auf Beruhigung der Lebenden und das Abrücken der Todeserfahrung in eine beliebige, uninteressierte Objektivität mündet, trifft mich der jetzt und hier erfahrene Tod eines Menschen, den ich liebe, möglicherweise tiefer und zentraler als der noch so ernst genommene Gedanke an meinen eigenen Tod.20 Es kann durch die Betroffenheit des Todes des geliebten anderen gar zu so etwas kommen wie zur „Tragödie des Überlebens“, die eintritt, wenn wir beim Tod eines anderen Menschen sagen „Sein Tod ist mein Tod.“ Dies ist ein „Schrei ... ein Funke, der dem absoluten Schmerz entspringt“. Das „vom Tod zertretene Wesen scheint weiter zu leben“, weil es den Zurückgebliebenen mit seiner Gegenwart erfüllt. Denn durch seine Trauer ist er ganz durch den Verstorbenen und dessen anwesende Abwesenheit bestimmt. Diese berührende Gegenwart eines Abwesenden kann der Überlebende von sich her nicht überbrücken. In der Sicht der Zurückgebliebenen trägt der Tod daher einen „Widerspruch in sich“, ja er „ist dieser Widerspruch“ (G. Marcel 1964, 75ff.). Eine solche Erfahrung tiefster Betroffenheit durch den Tod eines anderen hat zur Voraussetzung, dass der andere Mensch als ein um seiner selbst willen würdiges Wesen angesehen wird. Dazu gehört auch, dass damit die Anerkenntnis verbunden ist, dass er ein ureigenes Recht besitzt da zu sein. Dieses von seinem Sein ausgehende Recht auf Dasein hängt mit einem unbedingten Sinn zusammen, so dass ein Anruf von ihm ausgeht. Die Erfahrung dieses Anrufes wiederum setzt die Offenheit voraus, welche Marcel „Intersubjektivität“ oder „Interpersonalität“ nennt. Sie ist „wesentlich Öffnen, und Offen-sein“ (G. Marcel 1961, 297). Dieses „Offen-sein“ ist Ergebnis der – wie er es nennt - „oblativen Liebe“. Sie setzt voraus, dass der andere nicht als Gegenstand z. B. der Begierde oder des Gebrauchens, mithin unter zweckrationalen Gesichtspunkten gesehen wird. Dies würde einer „possessiven Form der Liebe“ entsprechen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Ich dabei über den anderen zu verfügen sucht, um ihn zu beherrschen. Freilich bleiben dabei das Ich und der andere voneinander geschieden. Sie treten 19 Er berichtet von sich selber, er habe „schon in frühester Kindheit durch den Tod des Nächsten ein Trauma erhalten“, nämlich durch „das Hinscheiden meiner Mutter, die ich verloren habe, als ich noch nicht ganz vier Jahre alt war. Ich stelle ohne Zögern fest, dass sich mein Leben schlechthin - und auch mein geistiges Leben - unter dem Zeichen des Todes des Nächsten entwickelt hat.“ (G. Marcel 1961, 287) 20 Gabriel Marcel erklärt: „Ich habe nämlich einsehen müssen …, dass ich angesichts des Abgrunds, der durch das Verschwinden eines geliebten Wesens geöffnet wird, eine ganz andere und wahrscheinlich tiefere Bestürzung als vor meinem eigenen ‚Sterbenmüssen' empfinde.“ (G. Marcel 1964, 75f.) Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 19 sich wie sich voneinander isolierende und dadurch isolierte Subjekte gegenüber. Insofern bewegen sie sich in einer Subjekt-Objektspaltung, wie sie für die Welt des Habens charakteristisch ist.21 Im Modus der „possessiven Form der Liebe“ erscheint auch der Tod „unter einem praktischen und funktionellen Gesichtspunkte“ und daher „als ein Ausrangieren, ein Sturz ins Unbrauchbare“. Die Welt universeller Funktionalität und technologischer Machbarkeit ist daher in einem besonderen Maße eine Todeswelt. Der Tod ist eine letzte Bestätigung für die Nichtigkeit des menschlichen Lebens selbst, das allein von seinen sozialen wie vitalen Funktionen her bestimmt wird. Für eine Hoffnung über den Tod hinaus ist daher kein Platz. Der Übergang von der Welt des Habens in die Welt des interpersonalen Seins fällt mit dem Übergang zum Modus der oblativen Form der Liebe zusammen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sich – entsprechend dem Wortsinn von „oblativ“ - ein Mensch dem anderen gleichsam darbringt. Die beteiligten Personen überwinden den Autozentrismus der possessiven Liebe und werden ohne Selbstverlust „heterozentrisch“, indem sie sich gegenseitig einander öffnen. „Intersubjektivität“ ist das Ergebnis dieser Offenheit. Sie kann verstanden werden als „eine Wechselseitigkeit, die so tief ist, dass sich der Heterozentrismus verdoppelt“, weil nämlich jede Person „zum Mittelpunkt für die andere wird“. (G. Marcel 1961, 293). Wichtig ist für Gabriel Marcel, dass die Möglichkeit einer solchen gegenseitigen Entgrenzung des Ich nicht nur in dem z. B. liebenden Verhältnis der beteiligten Personen zueinander begründet sein kann. Denn indem die Menschen einander gegenwärtig werden und den Status gegenseitiger Verdinglichung überschreiten, werden sie nicht nur füreinander offen, sondern in ihrer Offenheit öffnet sich vielmehr ein „Worin“ ihrer Offenheit und Verbundenheit, so dass alles Wirkliche nun in einem neuen Horizont erscheint. Die Realität verliert dadurch ihre Angst machende Bedrohlichkeit. Aufgelöst wird die tödliche Fremdheit nicht nur zwischen Mensch und Mensch, sondern auch zwischen Mensch und Natur. Aus der Erfahrung der Intersubjektivität erschließt sich uns der Sinn des Seins. Es „lichtet“ sich die Wirklichkeit auf das hin, was alles immer schon durchstimmt, trägt, umgreift und an sich zieht, obwohl es in unserer normalen Alltagswelt zumeist verdeckt ist. Die normale Welt dagegen erscheint als eine zerbrochene, unwahre, entwirklichte, wenngleich sie für uns Erfahrungen einer schöpferischen Erneuerung bereithält. Diese Überlegungen zur erschließenden Bedeutung der Intersubjektivität sind der Hintergrund, auf dem Gabriel Marcel deutlich machen will, dass die Überlebenden im 21 Siehe auch G. Marcel 1968. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 20 Tod derer, die sie lieben, eine Todeserfahrung machen, die die Gewissheit des eigenen Todes mit umfasst. Der Tod lässt sich daher bestimmen als Trennung von dem, den wir lieben, eine Bestimmung, die wohl erstmals von dem im KZ Oranienburg ermordeten Paul-Ludwig Landsberg in seinem Buch „Die Erfahrung des Todes“ (P. L. Landsberg 1973) vertreten worden ist und die in F. Wiplingers 1970 erstmals erschienenen Werk „Der personal verstandene Tod“ (F. Wiplinger 1985) zur Kernaussage der dortigen Ausführungen avanciert ist. Landsberg und der Sache nach auch Wiplinger gehen von der Voraussetzung aus, wir seien in der Liebe mit dem nächsten zu einem „Wir“ zusammengeschlossen. Stirbt einer der Partner, wird die Verbindung mit ihm abgebrochen. Da ich selbst „in gewissem Maße ... diese Verbindung“ war, „spüre ich den Tod im Herzen meiner eigenen Existenz“ (P. L. Landsberg 1973, 28f. u. 31f.). Der Unterschied zwischen Fremd- und Eigentod wird hinfällig. An die Stelle der Deutung des Todes als Trennung von Leib und Seele, tritt die Deutung des Todes als einer Trennung vom geliebten Menschen. Der Tod erscheint dabei zugleich als Weltverlust wie als Selbstverlust. Denn da Liebe Verbundenheit im Wir und in einer gemeinsamen Welt bedeutet, wird die Trennung vom Anderen durch den Tod auch als Weltverlust erfahren. Und weil das eigene Selbstsein als Mitsein, als Mitsein in der Liebe und in der von ihr getragenen Welt verstanden wird, erscheint der Tod zugleich als Selbstverlust. Vor allem aber gilt Angesichts des Todes eines geliebten Menschen kann es zu einer Verfinsterung des Verständnisses der Wirklichkeit im Ganzen kommen, welche wir als Verdüsterung des Seinshorizontes bezeichnen wollen. Ich erfahre dann nicht nur den Verlust des anderen Menschen, sondern – wie Wiplinger schreibt - „den Verlust jeglichen Halts am Leben, am Sein, absolute Halt-losigkeit, das Nichten des Nichts“ (F. Wiplinger 1985, 44). Ergebnis dieser fundamentalen Betroffenheit ist, dass wir uns vor eine Entscheidung gestellt sehen Verstehen wir die Beziehung zu dem verstorbenen Partner angesichts seines Todes als Absurdität? Verurteilt der Tod jede Liebe zur Absurdität? Oder kann diese Liebe trotz des Todes weitergehen, hat sie noch eine Zukunft? Und wie soll das Leben, das von dieser Liebe so tief beansprucht war, nun weitergehen? Indem ich zu all dem Stellung nehmen muss, bin ich aufgefordert, über Sinn oder Absurdität meines Lebens und damit der Wirklichkeit überhaupt zu entscheiden. Die Deutung der Todeserfahrung primär vom Verlust eines geliebten Menschen her begegnet bereits in besonders eindrucksvoller Weise bei dem frühchristlichen Theologen und Kirchenlehrer Aurelius Augustinus. Im IV. Buch seiner „Confessiones“ (Bekenntnisse)22, die er als 45-jähriger, nicht lange nach seiner Wahl zum Bischof der afri- 22 Im Folgenden zitiert nach der Übersetzung von W. Thimme: Augustinus 1979. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 21 kanischen Hafenstadt Hippo verfasst hat, kommt er auf den Tod seines Jugendfreundes zu sprechen, welcher schon Jahre zurückliegt. Alle uns von Marcel her bekannten Momente der Todeserfahrung finden sich in der Erinnerung des Augustinus an den Tod des Freundes wieder. Die Basis dieser Todeserfahrung ist schon bei ihm die Einheit des Wir in der Richtung der Intersubjektivität im Sinne Marcels, welche die Unverwechselbarkeit und Einzigkeit der beteiligten Personen nicht auslöscht, sondern in ihrer Wechselbeziehung erst recht zu sich selbst kommen lässt, indem sie sie zugleich von der Gemeinsamkeit des Wir umgriffen sein lässt. Er nennt ihn gar in Anlehnung an Horaz „die Hälfte seiner Seele“ „Auch ich empfand es so, als wäre meine und seine Seele nur eine Seele in zwei Leibern gewesen. So ward mir grauenhaft das Leben, weil ich nicht als halber Mensch leben wollte, und vielleicht hatte ich darum solche Angst vor dem Tode, weil ich fürchtete, stürbe auch ich, dann würde er, den ich so sehr geliebt, ganz und gar hinsterben“ (Augustinus 1979, 100 – IV, 6). Weil die Einheit dieses Lebens durch den Tod des Freundes zerbrochen wird, verfinstert sich für Augustinus die ganze Welt. „Wie wurde mir damals mein Herz von Gram verdüstert! Wohin ich auch blickte, überall begegnete mir der Tod. Die Vaterstadt war mir zu Pein, das elterliche Haus zu unsagbarem Elend. Woran ich einst mit ihm gemeinsam mich gefreut, ohne ihn verkehrte es sich zur Folterqual. Überall suchten ihn meine Augen und fanden ihn nicht. Alles war mir verhasst, weil er fehlte und nicht mir sagen konnte Da kommt er! Wie früher, wenn er fort gewesen war und zurückerwartet wurde. Ich ward mir selbst zu einem großen Rätsel und fragte meine Seele, ‚warum sie sich betrübe und so unruhig sei in mir’, aber sie konnte keine Antwort geben.“ (Augustinus 1979, 98 – IV, 4) Die Nichtigkeit des Todes durchdringt alles mit ihrer Finsternis. Der Tod des Freundes breitet sich gleichsam über die ganze Welt aus. Die Macht des Todes, welche ihn, Augustinus, im Tod des Freundes mit getroffen hat, scheint ihm nun von so furchtbarer Gewalt zu sein, dass er meinte, „er müsse jählings alle Menschen hinwegraffen“, da er ihn, den Freund, verschlingen konnte. „Ich wunderte mich nämlich, dass überhaupt die anderen, die Sterblichen, lebten, da doch der, den ich geliebt hatte, als könnte er nie sterben, gestorben war.“ (Augustinus 1979, 99f. – IV, 6) Die im Blick auf den Tod des Freundes gemachte Todeserfahrung wird so übermächtig, dass für Augustinus nicht nur die Allgemeinheit des Todesschicksals der Menschen zur Gewissheit wird, sondern er sich darüber wundert, dass die anderen Menschen, obwohl sie schon durch den Tod gekennzeichnet sind und die „Sterblichen“ heißen, überhaupt noch leben. Noch mehr ist er aber darüber verwundert, dass er selbst noch lebt, obgleich der Freund gestorben ist. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 22 Der Tod des Freundes reißt derart in den eigenen Tod mit, dass die Frage aufkommen kann, wie es überhaupt möglich ist, dass der Zurückgebliebene weiterlebt, da er doch aus der Einheit der Welt herausgerissen ist, die er mit dem anderen teilte und die bisher sein Leben war. Diese Situation des Gestorbenseins mit dem Freunde und des doch Überlebens verdichtet sich daher in der Frage nach sich selbst. Sie ist aber so gestellt, dass dabei schlechthin alles in Frage gerät und zur Frage steht „Factus eram ipse mihi magna quaestio“, „Ich war mir selbst zu einer großen Frage geworden.“ Diese „Factus eram ipse mihi magna quaestio“ ist übrigens der Anfang und der Stachel der gesamten Philosophie, insbesondere der Religionsphilosophie des Augustinus. Sie hat – wenn man so will - in der Verlusterfahrung des geliebten Menschen ihren Ausgangspunkt. Gabriel Marcel übrigens spricht in ähnlichem Zusammenhang von einer „Stunde des tragischen Pessimismus“ (G. Marcel 1964, 285) Dem eigenen Tod gegenüber kann man sich darin üben, ihn „als Ruhepunkt zu betrachten, den ich mir nach der aufreibenden Arbeit des Lebens wünschen will. Aber diese Betäubung wird in dem Augenblick unwirksam, in dem ich mich dem Tod des anderen gegenüber sehe sofern er tatsächlich ein Du für mich war.“ (G. Marcel 1961, 268) „Ein Band ist in unerträglicher Weise zerrissen - andererseits aber doch nicht zerrissen, denn selbst im Riss bleibe ich, und zwar noch stärker als zuvor, dem Wesen, das mir fehlt, verbunden. Das Unerträgliche ist gerade dieser Widerspruch. Es liegt darin ein Ärgernis, das auf die gesamte Wirklichkeit den schimpflichen Schatten der Absurdität wirft.“ (G. Marcel 1964, 80f.) Die Erfahrung der Absurdität ist freilich nicht der Zielpunkt der Todeserfahrung. Gleichursprünglich damit geht – so Gabriel Marcel – auch eine metaphysische Erfahrung einher, die Hoffnung gibt. Denn die Erfahrung der oblativen Liebe ist von einer „unbesiegbaren Gewissheit“ erfüllt, der Gewissheit der Hoffnung, die sich weder methodisch kontrollieren noch wie ein Gegenstand verobjektivieren lässt. Sie findet ihren Ausdruck in der Behauptung, dass der geliebte Mensch, der durch den Tod entzogen worden ist, mir dennoch gegenwärtig bleibt, ja ich auf seine Unsterblichkeit hoffen muss. Denn wir können uns unmittelbar gewiss sein, „dass eine Welt, die von der Liebe verlassen ist, im Tod versinken muss, dass aber dort, wo die Liebe fortdauert … der Tod endgültig besiegt wird“ (G. Marcel 1961, 287). Wer an dieser intuitiven Gewissheit auch nur zu zweifeln geneigt ist, oder wer angesichts des Todes eines geliebten Menschen auch nur annimmt, es sei mit ihm nun schlechterdings aus und vorbei, begeht nach Marcel einen Verrat. In die Nähe eines solchen Verrates geraten wir bereits, wenn wir in einer unverbindlichen Unbestimmtheit beharren und uns nicht entscheiden können, darauf zu hoffen, dass der andere jenseits Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 23 der Todesgrenze als diese einmalige Person weiter besteht. Wer annimmt, der andere Mensch sei im Tode dem Nichts anheim gefallen, beraube daher die Liebe ihres eigenen Sinnes, denn Liebe erfährt den anderen ja immer als jemanden, der ein Recht hat zu sein, ein Recht, das durch nichts in Frage gestellt werden darf. Da aber gerade der Tod dieses Seinsrecht dennoch radikal in Frage stellt, muss gefragt werden, ob es der Liebe, solange sie bei sich selber bleibt, überhaupt möglich ist, dem Gedanken zuzustimmen, im Tode falle der andere Mensch der Vernichtung anheim. Daher hat Marcel immer wieder betont, die Liebe schließe immanent und konstitutiv eine Art von „Ewigkeitsversprechen“ ein (vgl. G. Marcel 1952, 474) „Einen Menschen lieben, heißt sagen Du wirst nicht sterben“ (ebd. 472) Der „Geist der Treue“ verlange, so sagt er, „von uns ... eine ausdrückliche Weigerung“, nämlich die Weigerung, den Tod „jener, die wir lieben“ als deren letztes Schicksal anzunehmen (G. Marcel 1964, 79). VI. Blicken wir, nachdem wir uns die Todeserfahrung innerhalb der dialogischen Interpersonalität vergegenwärtigt haben, auf den Gedanken vom Vorlaufen in den Tod zurück, welchen wir bei Kierkegaard und Heidegger gefunden haben, so wird wohl deutlich, dass er zumindest nicht als die einzige Weise der Todesgewissheit angesehen werden darf. Das Vorlaufen in den eigenen Tod und die Erfahrung des Todes eines geliebten anderen Menschen bringen uns vor denselben Abgrund. Überhaupt scheint es nicht nur eine, sondern mehrere Weisen bzw. Quellen und Wurzeln zu geben, der Unausweichlichkeit des Todes so inne zu werden, dass sozusagen unser ganzes Leben in seinen Schatten fällt und er nicht bloß ein irgendwann einmal eintretendes Ende ist, um welches wir aus empirischer Erfahrung wissen. Und evtl. ist die Verlusterfahrung des geliebten Menschen dafür die grundlegendste. Der vor wenigen Jahren verstorbene Bonner Philosoph Hans Michael Baumgartner behauptet gerade dies (vgl. H. M. Baumgartner 1994, 209ff.). Denn der Verlust des anderen ist Ursprung unserer Zeiterfahrung, Bewusstwerdung unserer Zeitlichkeit, ein Bewusstsein, das erst den Vorlauf in den Tod ermöglicht. Unsere Todesgewissheit wäre demnach, und das scheint plausibel, zu interpretieren als das Ergebnis einer dramatischen und krisenhaften Verlusterfahrung. Diese Verlusterfahrung wäre gleichsam der Ursprung und der Anlass des „Memento mori!“, des „Gedenke, dass du sterblich bist!“. Weil für uns heutige dramatische Verlusterfahrungen seltener geworden sind, weil wir den Tod aus unserem Leben verbannt und gleichsam ins Krankenhaus abgeschoben haben, und weil der moderne Mensch insgesamt dazu neigt, den Tod aus dem Leben zu Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 24 verdrängen, wird uns die Bedeutung des Todes für die Gestaltung unseres Lebens und unseres Selbstverständnisses nur mehr selten bewusst.23 Auch begnügen wir uns zumeist mit einem bloß oberflächlichen Todesverständnis, das primär „katastrophisch“ ist. Der Tod ist für die meisten weder Durchgang in ein erhofftes Jenseits, noch Bezugspunkt, auf den hin und von dem her als zeitliche Grenze wir unser Leben – auch unser soziales - gestalten. Er wird schlichtweg als Katastrophe, als Hemmnis unseres Lebens und Antipode unserer Freiheit empfunden. Er wird im Bewusstsein reduziert auf den bloß „natürlichen“, den biologischen Tod, in dem wir unbezweifelbar alle gleich sind, weil er uns alle gleich ereilt – wie alle anderen nicht-menschlichen Lebewesen auch. Bloß In dieser biologischen Gleichheit und als bloßes Naturereignis betrachtet wäre der Tod zu Recht der Rede nicht wert. Er wäre ein „ver-enden“ im Sinne des Zu-Ende-Kommens wie beim Tier, das im Leben nichts von seinem Tod weiß, nicht auf ihn zulebt und von ihm her das Ganze seines Lebens nicht gestaltet kann. Das ist zwar misslich, aber rückwirkungslos auf unser Leben, weil wir dieses dann schon gelebt haben. Als bloß naturales oder biologisches Faktum betrachtet, das am Ende des Lebens steht, ist der Tod tatsächlich bedeutungslos für uns. Und würde der Tod nur das Leben beenden, ansonsten aber bedeutungslos für das Leben sein, dann wäre es nur konsequent, wenn wir an die Stelle des „Memento mori!“ bedenkenlos das „Carpe diem!“, „Pflücke und genieße den Tag“ setzen würden, solange wird das noch können. Und es gäbe erst recht keinen Anlass dafür, sich vor dem Tod zu ängstigen, wie schon die Vertreter der Stoa betont haben Denn wenn wir sind, dann ist der Tod nicht, und wenn der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr da.24 Die Bedeutung des Todes für den Menschen ist, wie unter Bezugnahme auf das Denken über den Tod in der Philosophie insbesondere des 20. Jahrhunderts zu zeigen versucht wurde, eine andere. Es ist nicht ausreichend, den Tod als rein biologisches Phänomen zu betrachten, wenngleich seine Bedingtheit biologischer Natur ist. Denn es ist weniger der Tod als biologisches Phänomen, das den Menschen mit Angst, Furcht und Bedrängnis erfüllt, sondern das Wissen und die unterschiedlich zustande kommende Gewissheit um den Tod. Wir müssen gerade mitten im Leben immer wieder das „Me- 23 Es war übrigens Max Scheler, der den Gedanken der „Todesverdrängung“ des modernen Menschen erstmals ausgesprochen hat: vgl. M. Scheler 1957, 15ff. Siehe zur Geschichte der Todesverdrängung A. Nassehi u. G. Weber 1989 sowie ferner N. Elias 1991. Auch die Renaissance von Seelenwanderungstheorien, wie sie vielfach für das Denken der sog. New-AgeBewegung kennzeichnend sind und darüber auch ins Popularbewusstsein abgesunken sind, nimmt dem Todesereignis seinen Stachel, indem der Tod schlechterdings negiert wird. 24 Vgl. Cicero, Cato maior 18, 66 sowie Tusc. disp. I: De contemnenda morte. Siehe auch Epikur, Diog. L. X, 139 und Marc Aurel, In se ips. VI, 28. Zum Todesproblem in der stoischen Philosphie siehe E. Benz 1929. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 25 mento mori!“ vollziehen, nicht nur um gut sterben, sondern auch um menschenwürdig leben zu können. Dabei steht die Existenz des einzelnen Menschen im Blickpunkt. Er muss seinen Tod erleiden, zu ihm Stellung nehmen, ihn in Beziehung zu dem Ganzen seines Daseins bringen und dieses in die Beziehung zum Tode. Im Tode wird deutlich, dass jeder sein eigenes Leben zu leben hat, weil jeder seinen Tod unvertretbar allein und für sich sterben muss. Der Tod zwingt uns zur Individualisierung, zur Selbstwerdung und zur Entscheidung in unserem Leben. Das Sterben ist einsam und unvertretbar. Als Sterbender muss jeder das letzte Wort über sein Leben im Ganzen sprechen, ein letztes, alles zusammenfassendes Ja oder Nein in einem letzten, alles zusammenfassenden Verhalten zum Sinn oder zum Unsinn seines Lebens. Merkwürdigerweise fällt gerade im Tod bzw. in dem jederzeit möglichen, mitten im Leben vollziehbaren „Vorlaufen“ in den Tod das Leben dem Menschen als das unvertretbar Seine zu, weil es sich im Verhältnis zum Tode zu sich selbst verhält, im Verhältnis zum Tode als das erscheint, welches von dem jeweils sich selbst gehörenden Ich gelebt werden muss. Wahrscheinlich ist der Gedanke an den Tod - ähnlich wie das Ernstnehmen des Rufes des Gewissens oder wie eine persönliche Liebeserfahrung - eine der Möglichkeiten des Menschen, auf sich selbst zurückzukommen und die bleibende Differenz zwischen sich selbst und jeder möglichen sozialen Umwelt zu entdecken. Das „Memento mori!“ ist, wie Ebehard Jüngel (E. Jüngel 1983, 64 u.ö.) zurecht sagt, nur eine andere Form der Aufforderung, die nach Platon den Ausgangspunkt des Philosophierens bildet nämlich dem – wie es griechisch heißt - „gnothi sauton”, dem „Erkenne Dich selbst“. Wir müssen daher nicht nur lernen, mit uns selbst leben zu lernen, sondern auch „Lernen, mit dem Tod zu leben“, wie es der Titel eines Buches von S. Brathuhn (S. Brathuhn 1999) formuliert. Leben und Tod sind keine antagonistischen Pole des Daseins, sondern müssen als Komplementaritäten begriffen werden. Wo Leben, dort Tod und wo Tod, dort Leben. „Der Tod wirft von Anbeginn seinen Reflex auf das Leben und prägt dessen Sinn.“ (S. Brathuhn 1999, 11)25 Er ist daher nicht einfach das Ende des Lebens, sondern Teil des Lebens selbst. Das Leben findet – so ein Buchtitel (W. Schweidtmann 1988) „im Angesicht des Todes“ statt. Leben lernen heißt daher notwendig auch sterben lernen (vgl. den Buchtitel von G. Heinz-Mohr 1986)26. Und wir müssen 25 Wie sinnlos ein Leben wird, wenn es ein Unendliches ist, schildert Simone de Beauvoir in eindrucksvoller Weise in ihrem Roman: „Alle Menschen sind sterblich“ (S. d. Beauvoir 1970) Sie lässt in Fosca eine Figur entstehen, der in geheimnisvoller Weise Unsterblichkeit verliehen ist. Anhand dieses fiktiven Unsterblichen, der der Welt keinen Sinn abzugewinnen vermag, verdeutlicht de Beauvoir, dass Sinngebung für alles, was als relevant erlebt werden kann, durch den bevorstehenden Tod mitbestimmt wird. 26 Vgl. schon Seneca: „zu leben aber muss man das ganze Leben lang lernen und, worüber du dich vielleicht noch mehr wunderst, man muss das ganze Leben lang lernen zu sterben.“ (L. A. 26 Armin G. Wildfeuer: Mors certa? sterben lernen, um leben zu können.27 Leben ist eine Zeit des Sterbens und das Sterben eine Zeit des Lebens, wie es ganz ähnlich im Titel des Handbuchs der Hospizbewegung formuliert ist (H. Beuthel u. D. Tausch 1989). Eine „Kultur des Sterbens“ (vgl. A. Heller 1994) beginnt daher nicht erst am Lebensende, sondern die „ars vivendi“ und die „ars moriendi“ fallen in eins. Wenn das gelingt, wenn wir die Gewissheit, dass wir sterblich sind, in unser Leben integriert haben, sie zu unser eigenen Sache machen und nicht nur objektivierend als empirisches Faktum begreifen, ja sie vielleicht sogar als Chance des Menschen sehen, zu sich selbst zu kommen, dann können wir auch die Worte von Max Frisch nachvollziehen „Das Bewusstsein unserer Sterblichkeit ist ein köstliches Geschenk, nicht die Sterblichkeit allein, die wir mit den Molchen teilen, sondern unser Bewusstsein davon; das macht unser Dasein erst menschlich, macht es zum Abenteuer (...)“ (M. Frisch 1977, 349). Literatur Ariès, P. 2002: Geschichte des Todes, 10. Aufl München. Atwater, P. 1995: Nah-Todeserfahrungen Rückkehr zum Leben, Flensburg. Augustinus 1979: Bekenntnisse ("Confessiones"). Eingeleitet und übertragen von Wilhelm Thimme, Stuttgart. Baumgartner, H. M. 1980: Die Unzerstörbarkeit der Seele. Platons Argumente im Dialog "Phaidon", in N. A. Luyten (Hrsg.), Tod Ende oder Vollendung? (= Grenzfragen Bd. 10), Freiburg i. Br./München, 67-110. --- 1994: Zeit und Zeiterfahrung, in H. M. Baumgartner (Hrsg.), Zeitbegriffe und Zeiterfahrung (= Grenzfragen Bd. 21), Freiburg i. Br./München, 189-211. Beauvoir, S. d. 1970: Alle Menschen sind sterblich, Reinbek bei Hamburg. Benz, E. 1929: Die stoische Lehre vom Tod, Stuttgart. Beuthel, H. u. Tausch, D. 1989: Sterben – eine Zeit des Lebens. Ein Handbuch der Hospizbewegung, Stuttgart. Birkenstock, E. 1997: Heißt philosophieren sterben lernen? Antworten der Existenzphilosophie Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Rosenzweig, Freiburg (Breisgau) [u.a.]. Seneca 1996, 21) Dass Philosophieren als eine für endliche Vernunftwesen ausgezeichnete Tätigkeit Sterben lernen heißt, ist klassische Einsicht der Philosophie. Siehe dazu das Werk von E. Birkenstock 1997. 27 Vgl. den Titel des Artikels von J. Hoffmann 1991. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 27 Brathuhn, S. 1999: Lernen, mit dem Tod zu leben Menschenwürdiges Sterben – Möglichkeiten der Sterbebegleitung - Hospizbewegung, Bad Iburg. Currie, I. 2000: Niemand stirbt für alle Zeit Nah-Todeserfahrungen, Genehmigte Sonderausg. München. Demske, J. M. 1984: Sein, Mensch und Tod das Todesproblem bei Martin Heidegger, 3., unveränd. Aufl Freiburg [u.a.]. Edwards, P. 1985: Heidegger und der Tod eine kritische Würdigung, Darmstadt. Elias, N. 1991: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, 7. Aufl Frankfurt am Main. Frankenhäuser, G. 1991: Die Auffassungen von Tod und Unsterblichkeit in der klassischen deutschen Philosophie von Immanuel Kant bis Ludwig Feuerbach, Frankfurt am Main. Frede, D. 2001: Heidegger und die Eigentlichkeit des Todes, in (Hrsg.), Bilder vom Tod, Münster [u.a.], 9-27. Frisch, M. 1977: Tagebuch 1946-1949, Frankfurt a. M.. Gardiner, F. S. 1984: Die Abstraktheit des Todes die ethische Problematik in der daseinsanalytischen Grundlage von Heideggers Kehre zum seinsgeschichtlichen Denken, Frankfurt am Main [u.a.]. Heidegger, M. 1979: Sein und Zeit, 15., an Hand der Gesamtausg. durchges. Aufl. mit den Randbemerkungen aus dem Handex. des Autors im Anhang Tübingen. Heinz-Mohr, G. 1986: Vom Licht der letzten Stunde – Leben lernen heißt sterben lernen, Freiburg/Basel/Wien. Heller, A. (Hrsg.) 1994: Kultur des Sterbens. Bedingungen für das Lebensende gestalten, Freiburg i. Br. Hoffmann, J. 1991: Sterben lernen um leben zu können – Reifen im Bewußtsein der Endlichkeit des Lebens, in: W. Scheiblich (Hrsg.), Abschied, Tod und Trauer in der sozialtherapeutischen Arbeit, Freiburg i. Br., 37-57. Hoping, H. 1996: Die Negativität des Todes. Zur philosophischlogischen Kritik der Vorstellung vom natürlichen Tod, in: Theologie und Glaube 86, 296-312. Hügli, A. 1998: Art. "Tod", in: J. Ritter u. K. Gründer (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Bd. 10, 1227-1242. Huonder, Q. 1970: Das Unsterblichkeitsproblem in der abendländischen Philosophie, Stuttgart [u.a.]. Jüngel, E. 1983: Tod, 2. Aufl. Gütersloh. Kierkegaard, S. 1964: Erbauliche Reden 1844/45, in: Gesammelte Werke Bd. VIII, hrsg. u. aus dem Dänischen übertragen v. E. Hirsch, H. Gerdes u.a., 2. Aufl. Düsseldorf. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 28 Kierkegard, S. 1957: Die Krankheit zum Tode, in: Gesammelte Werke Bd. XI, hrsg. u. aus dem Dänischen übertragen v. E. Hirsch, H. Gerdes u.a., 2. Aufl. Düsseldorf. --- 1964: Erbauliche Reden 1844/45, in: Gesammelte Werke Bd. VIII, hrsg. u. aus dem Dänischen übertragen v. E. Hirsch, H. Gerdes u.a., 2. Aufl. Düsseldorf. Knörzer, G. 1990: Tod ist Sein? eine Studie zu Genese und Struktur des Begriffs "Tod" im Frühwerk Martin Heideggers, Frankfurt am Main [u.a.]. Landsberg, P. L. 1973: Die Erfahrung des Todes, Frankfurt a. M.. Lehmann, K. 1938: Der Tod bei Heidegger und Jaspers Ein Beitrag zur Frage Existenzialphilosophie Existenzphilosophie und protestantische Theologie, Heidelberg. Lehmann, K.-P. 2000: Der Philosoph als Priester des Todes Heideggers "Sein und Zeit" als Vorbereitung zum Heldentod und Auslöschung von Ethik, Tübingen. Lohner, A. 1997: Der Tod im Existentialismus eine Analyse der fundamentaltheologischen, philosophischen und ethischen Implikationen, Paderborn [u.a.]. Lorimer, D. u. Moody, R. 1993: Die Ethik der Nah-Todeserfahrungen mit einem Vorwort von Raymond Moody, 1. Aufl Frankfurt am Main [u.a.]. Lorscheid, B. 1962: Das Leibphänomen eine systematische Darbietug der Schelersche Wesensschau des Leiblichen in Gegenüberstellung zu leibontologgischen Auffassungen der Gegenwartsphilosophie, Bonn. Marcel, G. 1952: Der Tod und die Hoffnung, in: ders. (Hrsg.), Geheimnis des Seins, Wien, . --- 1961: Gegenwart und Unsterblichkeit, Frankfurt am Main. --- 1964: Tod und Unsterblichkeit, in: ders. (Hrsg.), Auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, Frankfurt, . --- 1968: Sein und Haben, 2. Aufl Paderborn. Müller, C. 1999: Der Tod als Wandlungsmitte zur Frage nach Entscheidung, Tod und letztem Gott in Heideggers "Beiträgen zur Philosophie", Berlin. Nassehi, A. u. Weber, G. 1989: Tod, Modernität und Gesellschaft Entwurf einer Theorie der Todesverdrängung, Opladen. Rentsch, T. 1989: Martin Heidegger - das Sein und der Tod eine kritische Einführung, Orig.-Ausg München [u.a.]. Rubio, H. 1989: Tod und Tragik bei Heidegger und Aristoteles, Münster. Ruprecht, A. 1993: Tod und Unsterblichkeit Texte aus Philosophie, Theologie u. Dichtung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Stuttgart. Scheler, M. 1957: Tod und Fortleben, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 10 Schriften aus dem Nachlass, Bd. 1, Bern. Scherer, G. 1988: Das Problem des Todes in der Philosophie, 2., unveränd Darmstadt. Armin G. Wildfeuer: Mors certa? 29 --- 1989: Tod, philosophisch, in: W. K. Korff, L. Beck u. P. Mikat (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Gütersloh, Bd. 3, 572-574. Schweidtmann, W. 1988: Leben im Angesicht des Todes, Münster. Seneca, L. A. 1996: Von der Kürze des Lebens, Stuttgart. Sternberger, D. 1934: Der verstandene Tod Eine Untersuchung zu Martin Heideggers Existenzialontologie. Mit e. monogr. Bibliographie Martin Heidegger, Leipzig. Ströker, E. 1975: Der Tod im Denken Max Schelers, in: P. Good (Hrsg.), Max Scheler im Gegenwartsgeschehen der Philosophie, Bern/München, 199-213. Theunissen, M. 1958: Der Begriff Ernst bei Søren Kierkegaard, Freiburg. --- 2000: Das Erbauliche im Gedanken an den Tod. Traditionale Elemente, innovative Ideen und unausgeschopfte Potentiale in Kierkegaards Rede ‚An einem Grabe’, in: Kierkegaard Studies 40-73. Wiplinger, F. 1985: Der personal verstandene Tod Todeserfahrung als Selbsterfahrung, 3., unveränd. Aufl. Freiburg i.Br. [u.a.].