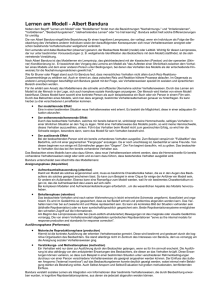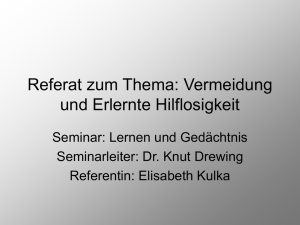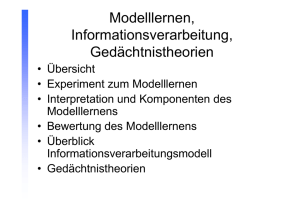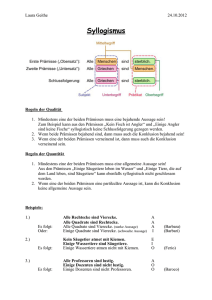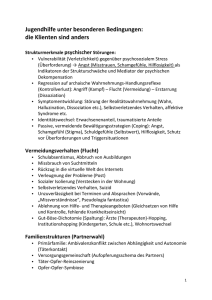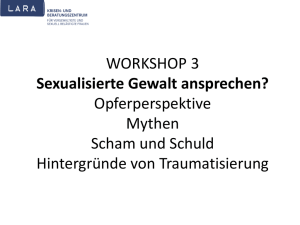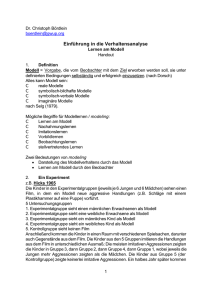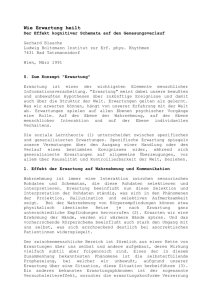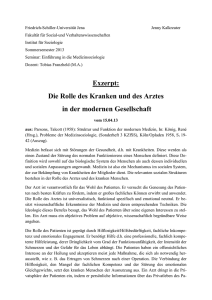1 2.2 Kritik/Reinterpretation kognitiver Erweiterungen des SR
Werbung

1 2.2 Kritik/Reinterpretation kognitiver Erweiterungen des SR-psychologischen Lernkonzeptes Vorbemerkung Um die sechziger Jahre wurde (wie schon gesagt) die bis dahin seit über dreißig Jahren unbestrittene Vorherrschaft der SR-Psychologie durch die Dominanz der Kognitiven Psychologie abgelöst. Dies führte dazu, daß der Begriff des »Lernens«, der in der SR-psychologischen Phase eine theoretische Schlüsselstellung innehatte, nun von anderen Zentralkonzepten, wie etwa »Gedächtnis«, abgelöst wurde, deren Bedeutung für das Lernkonzept nicht offen zu tageliegt, sondern erst analytisch herauszuarbeiten wäre. Ehe wir (im Kapitel 2.3) dazu kommen, haben wir jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die SR-Psychologie von der Kognitiven Psychologie keineswegs gänzlich verdrängt wurde, sondern - obzwar unter der Hegemonie der Kognitiven Psychologie - bis heute fortbesteht, dabei allerdings unter dem Einfluß des herrschenden Kognitivismus bestimmte »kognitive« Vorstellungen und Konzepte in sich aufgenommen hat: Es sind diese kognitiven Erweiterungen der SR-Theorie, die wir als darstellungslogisch vorgeordnetes Problem zunächst unter begründungsanalytischen Vorzeichen zu reinterpretieren versuchen müssen. Unterscheidung zwischen Lernen und Ausführung damit Ausdifferenzierung eines Konzeptes selbständiger Lernmotivation Die mit der kognitiven Wende einsetzenden Versuche, SR-theoretische Konzepte »kognitiv« zu erweitern, haben einen Vorläufer in Edward Chase Tolmans »purposivem« oder »molarem Behaviorismus«, der schon in den dreißiger Jahren entwickelt, dann aber durch die immer verstärkte Dominanz der orthodoxen SR-Psychologie verdrängt und sodann im Zuge der neueren »Kognitivierung« der SR-Theorie reaktualisiert und (mindestens partiell) rehabilitiert wurde. Da Tolman wesentliche Grunddifferenzierungen einer »kognitiven« Lerntheorie einführte, die dann später aufgegriffen und in dieser Forschungsrichtung zum Allgemeingut wurden, soll in unserer folgen den Diskussion - obwohl er ausschließlich Rattenexperimente durchführte - Tolmans Vorläuferfunktion berücksichtigt werden. Den wesentlichen Ansatz für die tierexperimentelle Realisierung seiner (damals unzeitgemäßen) Versuche einer kognitiven Ausweitung der SR-psychologischen Lerntheorien gewann Tolman durch eine Umstrukturierung der traditionellen Standardanordnung des »Labyrinths« von einem Gangsystem, in welchem ausschließlich Fehler und Durchlaufzeiten registrierbar sind, in ein Orientierungsfeld mit unterschiedlichen räumlichen Anordnungen und Verbindungen der Gänge und der Möglichkeit für die Tiere, die Futterkammer auf verschiedenen Wegen zu erreichen: Schon diese Anordnung legt sozusagen eine kognitive Sicht auf die Aktivitäten der Tiere nahe. Eine globale Variation der Versuchsbedingungen, die sich Tolman bei der dergestalt neugefaßten Standardanordnung anbot, war das Weglassen und Wiedereinführen der Futterkammer bzw. deren Füllung selbst: Eine solche Variation wäre in der SRpsychologischen Labyrinth-Konstruktion mit ihren theoretischen Implikationen weitgehend sinnlos gewesen, da ja so über die Kumulation der Auswirkung von Verstärkungsbedingungen auf das Lernen in Abhängigkeit von der Anzahl der Durchgänge nichts zu registrieren ist. Für Tolman mit seinem in der genannten Version des Labyrinths vergegenständlichten Interesse an kognitiven Leistungen der Tiere bot sich indessen damit die Möglichkeit, den Aspekt der Orientierung im Labyrinth von dem Aspekt der Verstärkungswirkungen experimentell zu trennen und damit auch das SR-psychologische Postulat, daß die Verstärkung als Verhaltenskonsequenz eine notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen der Lerneffekte ist, zu problematisieren. Eine der wichtigsten theoretischen Fassungen dieses Ansatzes ist Tolmans Konzept des »latenten Lernens« bzw. »inzidentellen Lernens«, zu dem Tolman (1932, S.343) Experimente von Blodgett (1929), Williams (1924), Elliot (1929), und Tolman & Honzik (193Db, 1930c) nennt und referiert. 2 Bei solchen Untersuchungen wird typischerweise in der Experimentalgruppe zunächst eine erste Orientierungs- bzw. Inspektionsphase eingeführt, in welcher die Ratten ohne gefüllte Futterkammer (also unter Abwesenheit von »Verstärkungsbedingungen«) in das Labyrinth gelassen werden und dort mehr oder weniger beiläufig hin- und hergehen, herumschnüffeln etc. In einer zweiten, der Testphase, werden dann mit den gleichen Tieren die üblichen Lernversuche bei gefüllter Futterkammer durchgeführt. In der Kontrollgruppe durchlaufen andere Ratten nur die Testphase. Beim Vergleich der Lerneffekte in der Experimental- und der Kontrollgruppe stellte sich in den benannten Untersuchungen heraus, daß die Tiere der Experimentalgruppe in der Testphase weniger Durchgänge bis zum fehlerfreien Erreichen der Futterkammer brauchten als die der Kontrollgruppe. Tolman interpretierte dies mit der Annahme, daß die Tiere während der Inspektionsphase trotz der Abwesenheit von »Verstärkungen« die Anordnung und die Abzweigungen der Gänge im Labyrinth gelernt hätten, wobei diese zunächst »latenten« oder »inzidentellen« Lerneffekte dann innerhalb der Testphase unter Verstärkungsbedingungen manifest geworden sind, also vergleichsweise bessere Lernleistungen ermöglicht hätten. Aus derartigen Konzepten und Resultaten ergaben sich nun für Tolman zwei für die spätere Entwicklung der kognitiv erweiterten Lerntheorien sehr bedeutsame begriffliche Differenzierungen: Zum einen die Unterscheidung zwischen »learning« und »performance« (Lernen und Ausführung), wobei er heraushob, daß die jeweiligen »Effekte« eines Verhaltens als Verstärkungsbedingungen zwar für die Ausführung bzw. Realisierung des Gelernten, nicht aber für den Lernprozeß selbst wesentlich seien (1932, S.364); zum anderen zur begrifflichen Ausdifferenzierung einer von der Verstärkung unabhängigen, d.h. auch selbständig »motivierten« tierischen Orientierungsaktivität, die von Tolman (etwa 1932, S.32) als Explorationsverhalten umschrieben wurde. Die Unterscheidung zwischen Lernen und Ausführung wurde nach der kognitiven Wende (nun unter Bezug auf humanpsychologische Experimente) von Bandura populär gemacht: »Die sozial-kognitive Lerntheorie (dies Banduras Version einer kognitiv erweiterten SRTheorie/K.H.) unterscheidet zwischen Erwerb und Ausführung, weil Menschen nicht alles in die Tat um setzen, was sie lernen« (1979, S.37). Dabei geht auch Bandura davon aus, daß »Verstärkungen« nur für die Ausführung, nicht aber für den Erwerb von Verhaltensmöglichkeiten relevant seien. Die dazu von ihm und seinen Mitarbeitern (mit Kindern) durchgeführten Experimente haben eine ähnliche Struktur wie die geschilderten Untersuchungen zu Tolmans Konzept des »latenten Lernens«. So wird in einem Experiment von Bandura (1965) zum »Modell- Lernen« (s.u.) der Erwerb von Verknüpfungen ohne Verstärkung aus dem Umstand erschlossen, daß Kinder Einzelheiten einer Filmszene, die sie (ohne Belohung) betrachtet hatten, später unter Belohnungsbedingungen berichten konnten, also offensichtlich vorher »latent« gelernt haben müssen. Die Tolmansche Vorstellung eines selbständig motivierten Explorationsverhaltens wurde etwa von Berlyne aufgegriffen und gehört seit dessen zusammenfassenden Darstellungen zum »Neugier- und Explorationsverhalten« mit der Annahme eines eigenständigen Neugier- bzw. Explorationstriebes schon bei Tieren (1960, 1963) weitgehend zum Allgemeingut insbesondere auch unter Vertretern kognitiv erweiterter Lerntheorien. In diesem Zusammenhang bürgerte sich die allgemeinere (wesentlich auf Menschen bezogene) Unterscheidung zwischen »extrinsischer« und »intrinsischer« Lernmotivation ein, wobei unter »extrinsischer« Motivation der Antrieb zu Lernaktivitäten aufgrund außengesetzter »Verstärkungen« im überkommenen SRtheoretischen Sinne verstanden wurde, und die »intrinsische Motivation« im wesentlichen den Umstand bezeichnete, daß es auch Lernprozesse (wie das geschilderte explorative Lernen) gibt, die ohne solche außengesetzten Verstärkungen zustandekommen, bei denen mithin die »Motivation« zu einer Lernaktivität auf irgendeine Weise in dieser selbst liegen müsse. Das Konzept der »intrinsischen Motivation« wurde in der Folge auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen theoretischen Zusammenhängen genauer zu bestimmen versucht. Heck- 3 hausen (1989, S.455f) unterscheidet in einer zusammenfassenden Darstellung folgende Bedeutungsvarianten dieses Konzeptes: 1. Triebe ohne Triebreduktion (im Sinne des benannten »Neugiertriebes«, durch den keine Gewebedefizite reduziert werden), 2. Zweckfreiheit (als aus sich selbst stimulierter, insbesondere spielerischer oder schöpferischer Aktivitätsantrieb), 3. Optimalniveau von Aktivation oder Inkongruenz (unteroptimale Aktivation bzw. überoptimale Inkongruenz, etwa zwischen Erwartungen und eingehender Information, implizieren die Tendenz zur Aktivitätserhöhung bzw. Verminderung der Inkongruenz), 4. Selbstbestimmung (etwa die Erfahrung eigener Verursachung als Motivator), 5. Freudiges Aufgehen in einer Handlung (völliges Absorbiertwerden durch das Erlebnis der voranschreitenden Handlung). Heckhausen stellt nach einer kritischen Analyse der verschiedenen Konzepte von »intrinsischer Motivation« eine weitere, 6. Fassung, »Gleichthematik (Endogenität) von Handlung und Handlungsziel«, zur Diskussion: »Intrinsisch ist Handeln dann, wenn Mittel (Handlung) und Zweck (Handlungsziel) thematisch übereinstimmen; mit anderen Worten, wenn das Ziel gleichthematisch mit dem Handeln ist, so daß dieses um seiner eigenen Thematik willen erfolgt. So ist Leistungshandeln intrinsisch, wenn es nur um des zu erzielenden Leistungsergebnisses willen unternommen wird, weil damit die Aufgabe gelöst ist oder die eigene Tüchtigkeit einer Selbstbewertung unterzogen werden kann. Das Handlungsergebnis, eine bestimmte Leistung, ist dabei selbst nicht wieder ein Mittel im Dienste eines anderen, nichtleistungsthematischen Zweckes; wie etwa damit, einem anderen zu helfen oder ihm zu imponieren oder um eine Geldsumme für einen bestimmten Zweck zu verdienen ...« (1989, S.459). Als weitere Form von »intrinsischer« Motivation akzeptiert Heckhausen nur noch das benannte »freudige Aufgehen in einer Handlung«, das als »sachinhärente Stimulation« bezeichnet wird und besonders eindringlich dann erfahrbar sein soll, »wenn das schnelle Wechselspiel zwischen einzelnen Tätigkeitsschritten und den teils ‘eigensinnigen‘ Rückantworten des Gegenstandes dem Handelnden alle Kompetenz abfordert, damit der angezielte Geschehensablauf weder blockiert wird noch eine sonstwie unbeeinflußbare Wendung nimmt«. Als Beispiel wird auf den »kaum zu überbietenden Grad von Fesselung« durch die Beschäftigung mit einem Flipperautomaten verwiesen (Heckhausen und Rheinberg 1980, S22). - Ich komme später darauf noch zurück. Mit der Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation ergab sich zwangsläufig die Frage, unter welchen Bedingungen bzw. bei welcher Art von Aktivitäten Lernprozesse eher durch intrinsische bzw. durch extrinsische Motivation gefördert würden. Dabei impliziert ja bereits die Annahme, jemand könne (auf welche Weise auch immer) »intrinsisch« motiviert werden, daß es die interessanten, anregenden, spannenden Aktivitäten, insbesondere aber auch kreativen, etwa künstlerischen oder handwerklichen, Tätigkeiten sind, die das Individuum »von sich aus«, also intrinsisch motiviert, ausüben und entwickeln wird. Dies wiederum enthält die Konsequenz, daß extrinsische Motivatoren, also außengesetzte Belohnungen nur dann leistungs- bzw. lernfördernd wirken, wenn die jeweiligen Aktivitäten eben nicht schon in sich belohnend, nicht interessant etc. seien. So stellte McGraw (1978) in einem Überblick über die einschlägigen Untersuchungen fest, daß es gerade die langweiligen Routineaufgaben, wie einfache Rechenaufgaben, Auswendiglernen von Listen etc, sind, die durch außengesetzte Belohnungen verbessert werden können, während derartige Belohnungen bei in sich interessanten Aufgaben, wie kniffligen Denksportaufgaben o.ä. überflüssig wären. Im Gegenteil: Hier könnten sich die zusätzlichen Belohnungen unter bestimmten Umständen sogar eher als behindernd erweisen, nämlich dann, wenn in Antizipation der in Aussicht gestellten Belohnung die Zuwendung zur Aufgabe nachlasse, schnelle Routinelösungen bevorzugt würden, etc. Von da aus formulierte McGraw in Auswertung seines Überblicks ein »two-factor prediction model«, (»ZweifaktorenVorhersagemodell«) (S.57), dem gemäß die förderliche oder behindernde Wirkung von Belohungen auf zwei Dimensionen variieren soll: Je »aversiver« bzw. »algorithmisch« festgelegter 4 eine Aufgabe, um so stärker sei die begünstigende Wirkung ‚ je »attraktiver« bzw. »heuristisch« offener die Aufgabe, umso stärker die behindernde Wirkung äußerer Belohnungen. Die damit angesprochenen Interferenzen aufgrund der zusätzlichen »extrinsischen« Belohnung »intrinsisch« motivierter Aktivitäten waren in der Folge Gegenstand einer eigenen Forschungstradition. Die dabei erzielten Effekte werden in Untersuchungen wie der von Lepper, Greene & Nisbett (1973) demonstriert: Kinder, denen in der Erstsituation eine extrinsische »Belohnung« (eine mit lobenden Worten überreichte Urkunde) versprochen und verabreicht worden war, gaben Malaktivitäten mit besonders attraktiven Buntstiften in Wiederholungssituationen eher auf als Kinder, die keine Belohnung bzw. eine unangekündigte Belohnung erhalten hatten. Die Autoren führen dies darauf zurück, daß in der Erstsitzung bei den Kindern aufgrund der Erwartung des Preises eine extrinsische Motivation geweckt worden sei, und diese habe - wie in der Wiederholungssitzung offenbar wurde - den »inneren Antrieb« zu der Malaktivität zerstört. Den allgemeineren theoretischen Kontext der Arbeit bildet eine damals häufiger diskutierte » Überrechtfertigungs-Hypothese«, die die Autoren durch ihre Befunde als bestätigt betrachteten: As in the »overjustification hypothesis ... predicted, children in the expected award condition spent less time playing with the drawing materials than children in the other conditions« (S.134). Mit solchen Überlegungen und Demonstrationen wurde also nicht nur - wie mit der Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation - eine Geltungseinschränkung der SR-psychologischen Doktrin der Verstärkung als Lernbedingung auf in sich uninteressante Aufgaben vorgeschlagen: Vielmehr sollte gezeigt werden, daß Verstärkung in bestimmten Situationen (nämlich dann, wenn eine Aufgabe als solche interessant ist, also »intrinsische Motivation« zu ihrer Ausführung weckt) darüber hinaus lernbehindernd, also kontraproduktiv sein kann. Ein Überblick über die vielfältigen Ansätze und Befunde zur »Überveranlassung« beliebter Tätigkeiten findet sich bei Heckhausen (1989, S.461ff) unter der Überschrift: »Korrumpierung intrinsischer Motivation durch extrinsische Bekräftigungen«. In einem speziellen theoretischen Kontext wurde die allgemeinere Frage nach den Bedingungen gestellt, unter denen äußere Anreize und Belohnungen bei den Individuen sogar aktiven Widerstand gegen die Realisierung der belohnten Aktivität hervorrufen können. Derartige Verhaltensweisen wurden von Brehm (1966) als Reaktion auf den mit der Belohnung verbundenen Verlust der Wahlfreiheit des Individuums interpretiert und dem von ihm so bezeichneten Phänomen der »Reaktanz« zugeordnet. In einer typischen Untersuchung, die Brehm zusammen mit Judith Weiner durchgeführt hat (vgl. Brehm 1966, S.82ff), wurden in einem Supermarkt Handzettel mit der Werbung für eine bestimmte Brotsorte verteilt, an denen jeweils ein Vierteldollar befestigt war: Das war genau der Preis für eine Packung des angepriesenen Brotes. Dies führte zu einer beträchtlichen Steigerung des Absatzes dieser Brotsorte. Als andere Versuchsbedingung heftete man an die Handzettel einen Geldbetrag, der um zehn Cents höher war als der Kaufpreis für das Brot. Dadurch wurde nun aber keineswegs (wie nach der Verstärkungs-Konzeption zu erwarten gewesen wäre) eine noch größere Umsatzsteigerung erreicht, sondern im Gegenteil, der einschlägige Umsatz nahm eher ab. Brehm interpretiert dies so: Während die Beigabe des passenden Geldbetrages quasi wie eine Einladung zum Gratiseinkauf gewirkt habe, hätten sich die Käufer durch den überhöhten Betrag persönlich genötigt, d.h. in ihrem Entscheidungsspielraum eingeschränkt gefühlt und mithin Widerstand gegen das Ansinnen der Werbemaßnahme geleistet. Dies sei ein spezifischer Fall von »Reaktanz« als Versuch, den eigenen »Verhaltensspielraum« zu rückzugewinnen (»to reestablish one‘s behaviorial freedom«, S.90). Wenn wir nun die bisher dargestellten, mit kognitiven Erweiterungen der SR-Psychologie verbundenen begrifflichen Differenzierungen unter begründungstheoretischem Aspekt betrachten, so erweist sich zunächst die geschilderte Unterscheidung zwischen »Lernen« und 5 »Ausführung« als in dieser Hinsicht äußerst bedeutsam: Während nämlich in der orthodoxen SR-Theorie »Lernen« und »Verhaltensänderung« praktisch gleichgesetzt wurden, also das Lernkonzept noch so universell wie unspezifisch bleiben mußte, hebt sich nunmehr das »Lernen« als von den übrigen Handlungen unterscheidbare spezielle Form von Handlungen heraus, und es stellt sich demgemäß die Frage, durch welche besondere Begründungsstrukturen das Lernhandeln gegenüber anderen Handlungen ausgezeichnet sein mag. Weiterhin legt sich aus der auf gewiesenen Möglichkeit, »inzidentell«, d.h. ohne speziellen Vorsatz zu lernen, die Frage nahe, wie denn ein derartiges beiläufig-nichtintendiertes Lernen hinsichtlich seiner Begründungsstruktur vom eigentlichen, d.h. »intentionalen« Lernen abhebbar sein könnte. Wenn mithin in diesem Kontext neue Fragen an eine zu entwickelnde Begründungstheorie des Lernens sich verdeutlichen, so heißt dies jedoch nicht, daß damit auch schon weiterführende Gesichtspunkte für die Klärung dieser Fragen, d.h. die nähere Bestimmung der speziellen Begründungsstruktur des Lernens bzw. des intendierten gegenüber dem »inzidentellen« Lernen, gewinnbar seien. Im Gegenteil: In der Art, wie hier das Konzept der Lernmotivation an die Stelle einer differenzierten Begründungsanalyse von Lernhandlungen gesetzt wird, werden die genannten Fragen eher verdunkelt als einer Lösung nähergebracht. Schon die Rede von einem verselbständigten »Neugier- und Explorationstrieb« erweist sich (mit Bezug auf menschliche Individuen) bei näherem Hinsehen als (in der traditionellen Psychologie verbreitete) reifizierende (verdinglichende) »Verdoppelung« des Phänomens, indem die »neugierigen«, »explorativen« Aktivitäten der Individuen aus einem dem zugrundeliegenden Trieb »erklärt« werden, womit (in unserem theoretischen Kontext) die weitere Frage, welche Gründe die Individuen für diese Aktivitäten haben können, genauer: unter welchen Prämissen und bei welchen Intentionen sie subjektiv begründet sind, von vornherein abgeschnitten ist. Diese Gefahr reifizierender Begriffsbildung ist auch im Konzept der »intrinsischen Motivation« - trotz der dargestellten verschiedenen Versionen - keineswegs ausgeräumt: Hierbei handelte es sich offensichtlich zunächst um eine Art von Lückenbüßer, der da einspringen soll, wo das SR-psychologische Verstärkungskonzept nicht greift. Dabei kam man mangels anderer Konzeptualisierungsmöglichkeiten zu der Konsequenz, daß Aktivitäten bzw. Lernprozesse, die ohne außengesetzte Verstärkungen erfolgen, aus sich heraus, um ihrer selbst willen, eben »intrinsisch motiviert« sich vollziehen müssen. Aber auch den dargestellten entwickelteren, kognitive Aspekte in höherem Grade einbeziehenden Konzeptionen von »intrinsischer Motivation« sind m.E. - schon aufgrund des Begriffs »intrinsisch« als gemeinsamen Nenners - bestimmte Implikationen inhärent, die mindestens »tautologieverdächtig« erscheinen: Interessante Tätigkeiten werden ausgeführt, weil sie interessant sind, schöpferische Tätigkeiten werden ausgeführt, weil sie schöpferisch sind, oder allgemeiner: Die intrinsisch motivierten Handlungen werden ausgeführt, weil sie ausgeführt werden. Im Begründungsdiskurs würde dies bedeuten: Bei intrinsischer Motivation handeln die Individuen, obwohl sie keinen Grund dazu haben. Durch diese in der Vorstellung von »Handlungen um ihrer selbst willen« liegende Kurzschlüssigkeit wäre auch hier die weitere Frage nach den Prämissen abgeschnitten, unter denen die Individuen »gute Gründe« haben, bestimmte Handlungen in Abwesenheit von äußeren Belohnungen auszuführen oder auch nicht auszuführen. Dieselbe Frage stellt sich nun aber auch im Hinblick auf die Belohnungen als Agenzien »extrinsischer Motivation«, da es auch hier sowohl gute Gründe geben kann, die belohnten Handlungen auszuführen, wie dies nicht zu tun oder dem sogar Widerstand entgegenzusetzen. So erweist sich unter begründungsanalytischen Kriterien die Unterscheidung zwischen »intrinsischer« und »extrinsischer Motivation« als unangemessen ausschließende Gegenüberstellung, durch welche die um fassende Klärung und Differenzierung der Prämissen- und Intentionsstruktur von Lernhandlungen abgeschnitten wird, wobei die Terminologisierung von Lerngründen als »Lernmotivati- 6 on« in diesem Kontext nicht nur über flüssig ist, sondern den geschilderten Reifikationen und Tautologisierungen eher Vorschub leistet (vgl. dazu Holzkamp 1986, S.227). Die damit aufgewiesenen Widersprüche und Kurzschlüssigkeiten prägen auch die dargestellten theoretischen Ansätze über mögliche Interferenzen bei zusätzlicher extrinsischer Motivation intrinsisch motivierter Aufgaben: Einerseits hat man es hier durchgehend mit (obzwar nicht als solche reflektierten) offenen Ausformulierungen von Begründungsmustern zu tun. Andererseits ist aber aufgrund der geschilderten Verkürzungen des Begriffspaars »intrinsische-extrinsische Motivation« eine hinreichende Klärung/ Differenzierung der jeweiligen Prämissen-/Intentionsstrukturen unterbunden. So handelt es sich in McGraws »Zweifaktoren-Vorhersagemodell« bei dem dort unterstellten empirischen Zusammenhang zwischen Unattraktivität/Festgelegtheit einer Aufgabe und der Wirksamkeit von Belohnungen einerseits tatsächlich um ein BGM etwa der folgenden Art: Wenn Aufgaben langweilig sind bzw. die Art ihrer Lösung sich von selbst versteht, so wird man sie vernünftigerweise nur dann ausführen, wenn irgend etwas anderes dabei herausspringt. Dementsprechend ist die Gegenannahme, langweilige Aufgaben würden gerade dann besonders gern ausgeführt, wenn nichts dabei herausspringt, nach begründungslogischen Kriterien unsinnig, und McGraw befindet sich im Irrtum, wenn er meint, hier eine empirisch prüfbare »Vorhersage« formuliert zu haben. Andererseits aber ist der weiterhin angesetzte Zusammenhang zwischen wachsender Attraktivität bzw. heuristischer Offenheit, also »intrinsischer« Motivierbarkeit einer Aufgabe und der Behinderung ihrer Bewältigung durch zusätzliche Belohnungen in dieser Form unterbestimmt. Dies nicht etwa deswegen, weil es sich hier nun plötzlich doch um einen empirischen Zusammenhang handeln würde, sondern deswegen, weil, im gleichen BGM-Gesamtkontext, an dieser Stelle durch das Konzept der »intrinsischen Motivation« eine zureichende intersubjektive Differenzierung der Prämissen/Intentionen, unter denen es zu den genannten Behinderungen kommen kann, abgeschnitten ist: Hier wird aufgrund der kurzschlüssigen Gleichsetzung von Attraktivität und intrinsischer Motivation nichts über die Gründe gesagt, aus denen eine bestimmte Aufgabe (ohne äußere Belohnung) »vernünftigerweise« auszuführen ist. Demgemäß läßt die dergestalt unklare Struktur des angesetzten BGMs auch keine Inferenzen darüber zu, aus welchen Gründen man sich unter der zusätzlichen Bedingung/Prämisse der äußeren Belohnung von der Aufgabe abwenden bzw. abbringen lassen könnte. Entsprechend unterbestimmt müssen mithin die experimentellen »Anwendungsfälle« solcher unzulänglicher BGMs sein - mit den üblichen unklaren Befunden und anschließender reichlicher Gelegenheit zur »Prämissenspekulation«. Dies läßt sich an der als Beispiel geschilderten Untersuchung von Lepper, Greene und Fisbett verdeutlichen. Einerseits ist die hier »geprüfte« »Overjustification«-Hypothese explizit als BGM formuliert, denn ein Handeln mit »Justification« bedeutet »gerechtfertigtes», also gut begründetes Handeln (vgl. Messinger 1971, S.514); demnach ist hier ein Begründungsmuster angesetzt, durch welches man »zu viele« und sich deswegen wechselseitig behindernde »gute Gründe« für eine Handlung haben kann. Dennoch bleibt auch in diesem Zusammenhang aufgrund der Unterstellung »intrinsischer Motivation« weitgehend unklar, warum die Kinder, da sie für ihre Zeichenaktivitäten einmal eine Belohnung antizipieren konnten, beim nächsten mal vergleichsweise früher damit aufhören - so sich nicht weiterhin für das Malen engagieren und die Belohnung als zusätzlichen Bonus mitnehmen. Vielleicht deswegen, weil sie aus dem Umstand, daß sie für das Malen eigens mittels »Belohnung« bestochen worden sind, schließen, daß es dann schon nicht so interessant gewesen sein kann? Oder weil für sie Leistungen, die »zensiert« wurden, prinzipiell als abgeschlossen erscheinen? Man könnte sich unter den Bedingungen der Schulsituation sicherlich noch vielfältige weitere Gründe dafür denken (s.u.). Jedenfalls sollte sich auch hieran verdeutlichen, wie durch die verdoppelnde Hypostasierung einer besonderen »Motivation« die begründungsanalytische Aufklärung eines typischen Handlungszusammenhangs abgeschnitten wird. 7 Auch Brehms »Reaktanz»-Konzept steht sein BGM-Charakter deutlich auf die Stirn geschrieben. Indessen ist auch darin eine Reifikation enthalten, die Unterstellung einer genuinen Motivation des Menschen in Richtung auf die Erhaltung oder Rückgewinnung an »Verhaltensspielraum«; und diese Hypostasierung nährt auch hier, indem dadurch hinreichende Klärungen der jeweiligen Intentions- bzw. Prämissenstrukturen abgeschnitten sind, die Illusion einer empirischen Prüfbarkeit des Konzeptes. So wird etwa im Kontext der vorliegenden Untersuchung nicht erwogen, daß man ja durchaus auch gute Gründe haben könnte, trotz des Gewinns von 10 Cents über dem Verkaufspreis (und dem nach Brehm dadurch eingeschränkten Verhaltensspielraum) die hier angesprochene Brotsorte zu kaufen: Etwa deswegen, weil man diese Art Brot sehr gerne ißt, weil man das zu Werbezwecken verteilte Geld trotz des Übereifers der Werbeleute nicht einfach einstecken will, weil man den Umstand, daß hier Psychologen ein Feldexperiment anstellen, durchschaut und diesen wegen der darin liegenden Unterstellung der eigenen Manipulierbarkeit die Resultate etwas verderben will etc.: Nur, wenn man aus den hier ansetzbaren möglichen Begründungszusammenhängen ein bestimmtes Begründungsmuster »herausschneidet« und alle anderen Möglichkeiten ignoriert, kann man zu so etwas wie einer Theorie, z.B. der »Reaktanz«, kommen, die ihren Charakter als besondere »Theorie« geradezu aus der Beliebigkeit der Auswahl gerade dieses Begründungszusammenhangs gewinnt. Aus diesen letzten Darlegungen verdeutlicht sich eine spezifische kritische Funktion der begründungstheoretischen Analyse vorfindlicher Ansätze: Die Identifizierbarkeit solcher Konzepte, die durch die zirkuläre Unterstellung bestimmter Erscheinungsformen als »Ursache ihrer selbst« deren begründungsanalytische Aufklärung abschneiden, indem sie ein Wort an die Stelle psychologischen Verständnisses setzen. Im gegenwärtigen Diskussionszusammenhang haben wir dies am Konzept der (»extrinsischen-intrinsischen«) Motivation aufgewiesen, das sich somit nicht als Konstrukt zur Erklärung psychischer Erscheinungen, sondern als Deckbegriff mit dem Effekt der Verhinderung einer solchen Erklärung erwiesen hat. Der analytische Begriff, durch welchen unserer Auffassung nach im gegenwärtigen Kontext der Deckbegriff der »Lernmotivation« ersetzt werden muß, ist das Konzept der »Lernbegründungen«, in welchem die Notwendigkeit immer weitergehender Prämissen- bzw. Intentionsaufklärung und -differenzierung impliziert ist. Dies bedeutet (um auch an dieser Stelle einem verbreiteten Mißverständnis entgegenzutreten) keineswegs, daß wir damit den Bezug auf die emotionale Verankerung des Lernens »rationalistisch« suspendiert hätten: Dieser Bezug ist ja mit unserer kategorialen Explikation der Gegründetheit von Handlungs-, also auch Lernintentionen in den subjektiven Lebensinteressen der Individuen von vorn herein mitgemeint. Was wir allerdings leugnen, ist, daß mit dem gängigen Konzept der »Motivation« die Bedeutung der Emotionalität für menschliches Lernhandeln adäquat begrifflich faßbar ist. Die Frage, wie unter Einbeziehung unserer Kategorialbestimmungen zum emotional-motivationalen Aspekt des Handelns eine angemessene theoretische Entfaltung des Problems der Lernmotivation im Begründungsdiskurs möglich sein kann, setzt zu ihrer Klärbarkeit indessen noch weitere Zwischenstufen unseres Darstellungsganges voraus und wird deswegen erst später systematisch aufgegriffen. Bestätigung von Erwartungen als/anstatt Verstärkung Mit der geschilderten Abhebung des eigentlichen Lernens von der »Ausführung« und der Annahme, daß nicht das Lernen, sondern lediglich die Ausführung durch »Verstärkungen« bedingt sei, stellte sich bereits für Tolman die Frage, mit welchen Prinzipien man das Zustandekommen von Lernprozessen und -ergebnissen sonst zu erklären habe. In diesem Problemzusammenhang führte er einen Begriff ein, der später geradezu zum Zentralkonzept der kognitiv erweiterten Lerntheorien werden sollte, das Konzept der Erwartung. »Erwartungen« (»expectations«) sind nach Tolman (etwa 1932, S.7lff) die elementaren Einheiten des Orientierungslernens, in welchen das Tier zu antizipieren lernt, daß angesichts eines Stimulus S seine Reak- 8 tion R zu einem zweiten Stimulus 2 führen wird. Solche Erwartungen als dreigliedrige S haben nach Tolman eine dem Verstärkungskonzept analoge Funktion, wobei hier aber nicht eine von außen gesetzte Belohnung, sondern das Eintreffen der jeweiligen Erwartungen innerhalb der Orientierungsaktivität den Lerneffekt bedingen soll: Wenn die »Erwartung«, daß bei Vorliegen von S die Orientierungsaktivität R zum Auftauchen von S führt, sich erfüllt, wird diese (die Erwartung) erhöht, wenn nicht, abgeschwächt. Die Lernaktivitäten regulieren sich mithin, (wie Tolman, 1932, S.440, sagt) durch das »Testen« der in den Erwartungen antizipierten »Kontingenzen«. I. Krechevsky, der wohl bekannteste Schüler von Tolman (der sich später in D. Krech umbenennen ließ) bezeichnete in diesem Zusammenhang die Explorationsaktivitäten von Ratten als Bildung und Testen von »Hypothesen« (1932, vgl. auch Tolman & Krechevsky 1933) und kam so (meines Wissens als erster) darauf, kognitive Aktivitäten nach Analogie wissenschaftlicher Verfahren zu konzeptualisieren: eine Vorgehensweise, die später innerhalb der Kognitiven Psychologie zu einer der zentralen Modalitäten der Theorienbildung werden sollte (s.u.). Die bereits bei Tolman antreffbare Unentschiedenheit zwischen einer gänzlichen Ablösung des Verstärkungskonzeptes und, seiner Umdeutung bzw. Ergänzung durch das Erwartungskonzept kennzeichnet auch die kognitiv erweiterten SR-Theorien des Lernens nach der kognitiven Wende. So bürgerte sich hier die Lesart ein, daß für das Zustandekommen von klassischen wie instrumentellen Verstärkungseffekten nicht die bloße zeitliche Kontiguität ausreicht, sondern daß darüber hinaus der CS »Information« über das Auftreten des US bzw. die Verhaltenskonsequenz Information über die zu künftigen Effekte des Verhaltens vermitteln muß. Innerhalb der Forschungstradition eines kognitiv liberalisierten Behaviorismus, in welcher Verstärkungsvorgänge unter kognitivistischen Vorzeichen als Prozesse der Informationsübermittlung untersucht werden, haben seit den frühen siebziger Jahren bis heute die Ansätze und Experimente von Rescorla und seinen Mitarbeitern einen wichtigen Stellenwert. Um zu zeigen, wie in diesem Kontext versucht wurde, die bloße Kontiguität vom Informationsgehalt der Verstärker experimentell unterscheidbar zu machen, sei die folgende Untersuchung von Rescorla (1972) mit dem Titel: »Informational variables in Pavlovian condi tioning« etwas genauer dargestellt: Rescorla geht in diesem Experiment der Frage nach, ob die bloße Kontiguität (zeitliche Nähe) des CS zum US ausreicht, um den klassischen Konditionierungseffekt herbei zuführen, oder ob der CS als (zunächst) neutraler Reiz »reliable Information« über das Auftreten des US enthalten muß, wenn es zur Konditionierung kommen soll. Der Grad der reliablen Information wird dabei operational definiert als Höhe der Korrelation des Auftretens des (späteren) CS und des US, anders ausgedrückt, der bedingten Wahrscheinlichkeit bzw. des Vorhersagewerts, mit der/dem aufgrund des Auftretens des CS das Auf treten des US antizipiert werden kann. Um diese Fragestellung experimentell realisieren zu können, müssen die Kontiguität zwischen CS und US einerseits und der so gefaßte Informationsgehalt des CS für das Auf treten des US andererseits in ihrer Verstärkungswirkung voneinander unterscheidbar gemacht werden. Dazu ist aber die übliche Prozedur des Klassischen Konditionierens, bei der der CS immer vom US gefolgt ist, ungeeignet, da hier die beiden Faktoren sich notwendigerweise zusammen verändern. Dies ist aber anders, wenn man nicht durchgehend, sondern nur »intermittierend« verstärkt, d.h. den US nicht jedesmal, sondern nur mit einer bestimmten Häufigkeit zusammen mit dem neutralen Reiz darbietet. Hier kann man nämlich die Häufigkeit des gemeinsamen Vorkommens von US und CS und den Vorhersagewert des CS für das Auftreten des jeweils nächsten US unabhängig voneinander variieren. So ist der genannte Vorhersagewert gleich Null, wenn die intermittierende Darbietung des US lediglich zufällig auf die Serie der CS verteilt wird: Hier erhält z.B. der Hund, wenn zusammen mit der Glocke der Futtergeruch auftaucht, keinerlei Information darüber, ob - wenn es das nächste mal klingelt - ihm wieder Futter(pulver) vorgesetzt wird oder nicht. Entsprechend wächst der so gefaßte Informationsgehalt 9 in dem Grade, wie zwischen dem Auftreten eines bestimmten und des jeweils nächsten US in der Gesamtserie ein systematischer, überzufälliger Zusammenhang hergestellt ist. Entscheidend bei dieser Art von Versuchsanordnung ist, daß hier bei gleicher Anzahl von Verstärkungen der Informationsgehalt des CS für das Auftreten des US von null in Richtung auf positive (und negative) Vorhersagewerte variiert werden kann. Sofern nur die Häufigkeit der jeweils einzelnen Koppelungen zwischen CS und US, also die Kontiguität, den Konditionierungseffekt herbeiführt, müßte die konditionierte Reaktion hier in jedem Falle mit gleicher Stärke auftreten. Sofern hingegen der Konditionierungseffekt nur aufgrund des Informationsgehalts des CS für das Auftreten des jeweils nächsten US in der Gesamtserie zustande kommt, dürfte allein im Falle des positiven Vorhersagewerts eine Konditionierung resultieren, bei einem Informationsgehalt von Null dagegen dürfte es - trotz gleicher Anzahl von Koppelungen - zu keiner klassischen Konditionierung kommen. Genau dieses Verhältnis hat sich nun im Experiment von Rescorla ergeben. Das würde aber bedeuten, daß eine Klassische Konditionierung nur unter den traditionellen Bedingungen der Kontiguität zwischen CS und US nicht zustande kommt, sondern daß hier eine irgendwie geartete kognitive Repräsentation der bedingten Wahrscheinlichkeit, mit der innerhalb der gesamten Reizserie aufgrund eines CS das Auftauchen des US »vorhersagbar« ist, angenommen werden muß. (Ein Überblick über seine einschlägigen Untersuchungen zum KK findet sich bei Rescorla 1980; vgl. auch Rescorla & Wagner 1972 sowie die Überblicksdarstellungen zu dieser Art »kognitiver« SR-Theorien von Dickinson 1989 und Amsel 1990.) Rescorla selbst hat sich - soweit ich sehe - (vielleicht zur Vermeidung des darin liegenden Anthropomorphismus) gescheut, die »Information« des CS für das Auftreten des US bzw. einer bestimmten Verhaltenskonsequenz für weitere Verhaltenskonsequenzen mit dem hier naheliegenden Konzept der »Erwartung« zu konkretisieren (wieweit kann beim Auftauchen des CS das anschließende Auftauchen des US »erwartet« werden bzw. wieweit sind angesichts einer bestimmten Verhaltenskonsequenz als instrumenteller Verstärkung weitere gleichartige Verhaltenskonsequenzen zu »erwarten«). Diese terminologische Zurückhaltung wurde jedoch naturgemäß in dem Maße aufgegeben, wie das tierexperimentelle Untersuchungsschema zugunsten humanpsychologischer Anordnungen zurücktrat. So gesehen liegt etwa Bolles (1972) durchaus im Trend, wenn er in die SR-Theorien des Lernens explizit das »Erwartungs«-Konzept einführen will und dabei das Klassische Konditionieren als »Erwartung einer Situations-Folge-Kontingenz« und das Instrumentelle Konditionieren als »Erwartung einer Verhaltens-Verhaltensfolge-Kontingenz« umschreibt. Typisch in diesem Kontext ist es auch, wenn Bolles dabei den »Erwartungs«-Begriff unter den Vorzeichen der kognitiven Wende als »Speicherung von Information aufgrund des Lernens von Umweltkontingenzen« spezifiziert. In der Folge findet sich geradezu eine Inflation des Erwartungs-Konzeptes. Dabei sind die zwei »Erwartungs«-Formen, die sich aus der Parallelisierung mit dem Klassischen und Instrumentellen Konditionieren er geben, manchmal als Ersatz, manchmal als nähere Bestimmung des »Verstärkungs«-Konzeptes, häufig anzutreffen (so unterscheidet etwa Bandura zwischen »Reiz-Reiz-« und »Verhaltens-Reiz-Erwartungen«). Darüber hinaus werden aber mannigfache weitere Erwartungsformen eingeführt, wie »Erfolgserwartungen« aufgrund der »Erfolgswahrscheinlichkeit« (Atkinson), »Kontrollerwartungen« (Seligman), »Ergebnis-« und »Wirksamkeitserwartungen« (Bandura) etc. (vgl. dazu etwa den Überblick bei Mielke 1984, S.4Off). - Ich komme später noch darauf zurück. Bis heute besonders intensiv diskutiert ist eine bestimmte Variante von »Erwartungstheorien«, in welcher der »Wert« eines angestrebten Gegenstandes als weitere Variable hinzugenommen wird und bestimmte einschlägige »Vorhersagen« aus dem Produkt von »Erwartung« und »Wert« gewinnbar sein sollen. Eine besonders folgenreiche motivationspsychologische Version der artiger »Erwartungs-mal-Wert-Theorien« ist das »Risikowahl-Modell« von Atkinson (1957, 1964). Dieses Modell (in seiner ursprünglichen Form) will durch Erfassung der »Motivierungsstärke« die Wahl von Aufgaben, also Handlungstendenz zur Aufgabenbewältigung, 10 vorhersagen. Dazu werden von Atkinson - in einer Aufdifferenzierung des Lewinschen Konzeptes der »Valenz«, d.h. des »Aufforderungscharakters« von Umweltgegebenheiten - folgende situative Motivierungsbestimmungen unterschieden: die subjektive »Erfolgswahrscheinlichkeit« der Aufgabenlösung als »Erwartungs«-Variable und der »Anreiz« der Aufgabe als »Wert«-Variable. Zu diesen Situationsvariablen als Bestimmungen der Motivierungsstärke kommen nach Atkinson zwei überdauernd personabhängige Variablen, nämlich das Motiv, Erfolg zu erzielen und Mißerfolg zu vermeiden. Diese situativen und personabhängigen Variablen wurden von Atkinson in eine Formel gefaßt, durch welche sie additiv bzw. multiplikativ gegeneinander gewichtet werden. Dabei wird u.a. die Abhängigkeit der Motivierungsstärke von der Erfolgswahrscheinlichkeit (unter Absehung von den personalen Faktoren) in der Formel als umgekehrte U-Kurve gefaßt: Motivierungsstärke = Erfolgswahrscheinlichkeit X (1 — Erfolgswahrscheinlichkeit). Bei zunehmender Erfolgswahrscheinlichkeit nimmt demnach zunächst die Motivierungsstärke zu, bis zu einem Kulminationspunkt, hinter dem sie wieder abnimmt. Am meisten »motivierend« wären danach Aufgaben mit mittlerer subjektiver Erfolgswahrscheinlichkeit, d.h. mittlerem wahrgenommenen Schwierigkeitsgrad. Die Variable der Stärke des personalen Erfolgs- bzw. Mißerfolgsmotivs ist weiterhin so in die Formel eingebracht, daß von der Stärke des persönlichen Motivs die Steilheit der benannten umgekehrten U-Kurve abhängt: Nur bei maximaler personaler Motivstärke führt der mittlere Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zu maximaler Motivierungsstärke, bei abnehmender Motivstärke dagegen flacht sich die U-Kurve immer mehr ab etc. Atkinsons Risikowahl-Modell trug entscheidend zur Theoretisierung der »Leistungsmotivations«-Forschung bei, wie sie von McClelland (seit 1953) inauguriert und bei uns vor allem von Heckhausen (etwa 1963, Übersicht 1989, Kap. 8) vertreten wurde, und kann als »die« Theorie der Leistungsmotivation betrachtet werden. Der Grad der erlebten Leistung wird in dieser Forschungstradition als Resultat der Selbstbewertung von Handlungsergebnissen an einem externen Gütemaßstab und die Stärke der Leistungsmotivation als Grad der Antizipation eines durch Vergleich mit diesem Maßstab entstehenden Erfolgs bzw. Mißerfolgserlebnisses (als Erwartungs-mal-Wert-Variable) verstanden. Hinzu kommt auch hier das Leistungsmotiv als Persönlichkeitsvariable, näher bestimmt als »Hoffnung auf Erfolg« bzw. »Furcht vor Mißerfolg«. Dieses Konzept wurde (auch angesichts der üblichen widersprüchlichen Resultate von Versuchen seiner empirischen Realisierung) in der Folge auf mannigfache Weise differenziert und verändert. Dies geschah etwa durch die selbständige quantitative Erfassung des Erfolgsund des Mißerfolgsmotivs (Heckhausen bestimmte von da aus den Wert, der von der Stärke des Erfolgsmotivs übrig bleibt, wenn die Stärke des Mißerfolgsmotivs davon subtrahiert wird, als »Nettohoffnung«. Weiterhin führte man (in für die Trendgeschichte traditioneller theoretischer Konzepte in der Psychologie typischer Weise) sukzessiv zusätzliche Variable ein, die über die von Aktinson berücksichtigten Dimensionen hinaus die Stärke der Leistungsmotivation bestimmen sollen (s.u.). Eine andere, genuin lernpsychologisch gemeinte Variante der Erwartungs-mal-Wert-Theorien wurde von Rotter als »soziale Lerntheorie« entwickelt. Da mit hatte er zunächst (1954) lediglich vor, für die Klinische Psychologie neue theoretische Grundlagen zu schaffen, wobei diese Theorie aber später (1972) verallgemeinert und von Rotter (1975, 1978) selbst ausdrücklich als der Versuch bezeichnet wurde, die SR-psychologischen Verstärkungstheorien und die kognitiven Theorien zu integrieren. Außerdem sollte dabei - anders als in bloßen Persönlichkeitstheorien - die Interaktion des Individums, insbesondere mit den sozial relevanten Aspekten seiner Umgebung, berücksichtigt werden. Der »Wert« wird von Rotter SR-psychologisch als Verstärkungswert definiert, der als das Ausmaß bestimmt ist, in dem ein bestimmter Verstärker vom Individuum gegenüber anderen Verstärkern bevorzugt wird. »Erwartung« als »kognitive« Variable ist für Rotter (1952) die subjektive Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Verstärkung als Folge eines spezifischen Verhaltens auftreten wird, was Bolles‘ »Erwartung der Verhaltens-Verhaltensfolge-Kontingenz« entspricht. (Spä- 11 ter, 1972, führte Rotter noch eine weitere Art von Erwartungen, solche hinsichtlich generalisierter Ereignisklassen, ein und kam in diesem Zusammenhang zu der berühmten Unterscheidung von Erwartungen über die interne vs. externe Kontrolle des Verhaltens, was ich hier noch beiseitelasse und in der Folge innerhalb eines anderen Problemzusammenhangs diskutiere). Aus den Faktoren des »Verstärkungswerts« und der »Erwartung« konstruierte Rescorla nun (unter Einbeziehung von situationalen Faktoren) eine Formel, aus der das »Verhaltens Potential« als Wahrscheinlichkeit der Ausführung eines bestimmten Verhaltens in der gegebenen Situation »vorhersagbar« sein soll: Diese Formel (die in der Struktur an die Formeln in Hulls »System« erinnert) besagt grob gesprochen: Das Verhaltenspotential in einer bestimmten Situation hängt einmal davon ab, wie hoch die Erwartung ist, daß ein bestimmter Verstärker in einer bestimmten Situation als Folge des eigenen Verhaltens auftritt, und zum anderen davon, wie groß der Verstärkungswert ist, den diese Verhaltensfolge für die Person hat. Dabei setzt Rotter voraus, daß die Variablen der »Erwartung« und des »Wertes« unabhängig voneinander sind, und faßt im übrigen deren Verhältnis nicht streng als Produkt (»Erwartung X Wert«), sondern als variables Verhältnis (»Erwartung & Wert«), das jeweils empirisch genauer zu bestimmen ist. In der durch die Rottersche Theorie eröffneten Tradition einschlägiger experimenteller Untersuchungen wurde z.B. die These der Unabhängigkeit von »Erwartung« und »Wert« überprüft« und vielfältig in Zweifel gezogen. Weiterhin ging es um die genaue Fassung des Verhältnisses zwischen diesen beiden Variablen, wobei man ebenfalls zu den üblichen widersprüchlichen Befunden kam (vgl. etwa den Kurzüberblick von Grabitz, 1985). Darüber hinaus wurde bis in die neuere Zeit eine Vielzahl von Abänderungen und Ergänzungen der Rotterschen Theorie vorgelegt und experimentell »geprüft«. Ein Überblick darüber findet sich etwa bei Krampen & Wünsche (1985), die selbst ein »differenziertes Erwartungs-WertModell« entwickelt und damit empirische »Vorhersagen« über verschiedene Aspekte der Bereitschaft zu politischer Partizipation versucht haben. Um einen Einsatzpunkt für die nun wiederum anstehende begründungstheoretische Diskussion des Erwartungskonzeptes zu finden, beziehe ich mich auf unsere früheren Versuche, die in den SR-Theorien enthaltenen Begründungsmuster an Beispielen zu veranschaulichen. Dabei wird deutlich, daß in den einschlägigen Schilderungen die Kennzeichnung der jeweiligen Konditionierungseffekte in Termini von »Erwartungen« der jeweils Betroffenen - wenn nicht tatsächlich ausformuliert ist - so doch inhaltlich unmittelbar naheliegt: Steiners anderthalbjähriges Kind schrie und strampelte beim Anblick des »weißen Kittels«, weil es daraufhin eine Wiederholung der schmerzhaften Prozedur des Tränenkanal-Stechens »erwartete«. Lefrancois‘ zweiter Angler konnte, nachdem er bisher nur gelegentlich einen Fisch gefangen hatte, beim Ausbleiben jedes Fanges eher »erwarten«, daß doch wieder ein Fisch anbeißt, als der erste bisher permanent erfolgreiche Angler. Steiners »Störefried« Michael kann, da die Lehrerin ihn plötzlich mit seinen Störaktionen leerlaufen läßt, allmählich immer weniger »erwarten«, wiederum ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Dies alles deutet darauf hin, daß mit der geschilderten Reformulierung des klassischen bzw. instrumentellen Konditionierens etwa als »Reiz-Reiz-« bzw. »Reiz-Reizfolge-Erwartung« o.ä. lediglich jene Begründungsmuster explizit terminologisiert und damit (obzwar unreflektiert) in der Theorie anerkannt worden sind, die faktisch »schon immer« in den jeweiligen Konditionierungsschemata enthalten waren und aus denen - wie dargestellt - allein verständlich wird, daß bzw. unter welchen Umständen Versuchspersonen sich den Verstärkungsgesetzen gemäß verhalten. Indem somit im Grundkonzept der »Erwartung« der BGM-Charakter der jeweiligen theoretischen Annahmen in höherem Grade als in den orthodoxen Lerntheorien offengelegt ist, verschärft sich aber auch der Widerspruch, der daraus entsteht, daß dabei trotz aller kognitiver Erweiterungen der SR-psychologische Theorierahmen letztlich unangetastet bleibt. Dies führt zu einer charakteristischen Zweideutigkeit und Verfremdung des im Phänomen der »Erwartungen« liegenden Subjektbezuges: Einerseits ist mit der Einführung des Erwartungs- 12 Konzeptes prinzipiell eine gewisse Relativierung des SR-psychologischen Außendeterminismus verbunden, indem hier dem Subjekt eine spezifische Möglichkeit der Einschätzung von »Umweltkontingenzen« eingeräumt wird, die der Annahme von deren mechanischer Wirksamkeit auf das Verhalten entgegenzustehen scheint. In der Tat werden darin häufig kognitive Liberalisierungen der SR-theoretischen Konditionierungsschemata gesehen und wird dabei etwa vorgebracht, daß »Reize« nicht als solche wirken, sondern in der Art, wie das Individuum sie einschätzt und seine Schlußfolgerungen daraus zieht. So stellt etwa Steiner (1988) bei der Diskussion einer seiner früher benannten »Szenarien« fest, »daß es nicht der Reiz als eine physikalische Gegebenheit (etwa ein visuell oder akustisch wahrgenommenes Muster) ist, der ein entsprechendes Verhalten ... auslöst, sondern daß noch weitere, gar nicht unmittelbar beobachtbare Informationen mit im Spiel sind, die einen Einfluß auf die Art und Weise haben, wie eine Situation wahrgenommen und wie dann darauf reagiert wird. Mit anderen Worten, der Reiz als Informationsträger wird interpretiert« (S.27). Andererseits muß man aber im Rahmen des offiziellen SR-psychologischen Rahmenschemas angesichts derartiger »kognitiver« Unbestimmtheitsbereiche mit den eigenen Ansprüchen der möglichst exakten Vorhersage von Verhaltensweisen aus den Reizbedingungen in Konflikt geraten. Daraus resultiert dann der Versuch, die zugestandenen kognitiven Prozesse doch wieder möglichst weitgehend außendeterministisch einzuschränken, d.h. hier: »Erwartung« so näher zu bestimmen und zu operationalisieren, daß diese in ihrer Ausprägung und in ihren Wirkungen objektiv »vorhersagbar« wird. Seinen deutlichsten Ausdruck findet diese Ambivalenz in den dargestellten, sehr verbreiteten Versuchen, den »Erwartungs«-Begriff wahrscheinlichkeitstheoretisch zu fassen: Hier wird die alltagssprachliche Redeweise: Wenn ich etwas erwarte, dann halte ich sein Eintreffen für nicht sicher, sondern nur mehr oder weniger »wahrscheinlich«, unversehens in eine mathematische Bestimmung verkehrt: »Erwartung« ist ausdrückbar in Termini der Ereigniswahrscheinlichkeit (so bei Bolles und Rotter) bzw. der relativen Häufigkeit (bei Rescorla) etc. In Konsequenz dieser Mathematisierung des Erwartungskonzeptes muß man versuchen, dieses objektiv, d.h. unter Ausklammerung es Subjekts der Erwartung, zu definieren: Dies schon bei Tolman (1932), der (zur Bekräftigung seines behavioristischen Bekenntnisses) »Erwartung« nicht »subjektiv«, sondern lediglich »explanativ« verstanden wissen wollte. Weiterhin hob nach der kognitiven Wende Bolles (1972) hervor, »Erwartung« sei von ihm - da als »Speicherung von Information aufgrund des Lernens von UmweltKontingenzen« bestimmt - »objektiv« definiert. Entsprechende Bestimmungen finden sich auch bei Rotter etc.. Da der Erwartungs-Begriff als solcher im Begründungsdiskurs steht und damit ein Subjekt impliziert, das was erwartet, würden derartige Versuche der Objektivierung des Erwartungskonzeptes, konsequent durchgehalten, nichts anderes als dessen Eliminierung bedeuten, indem hier allein direkte, in wahrscheinlichkeitstheoretischen Termini ausdrückbare »Vorhersagen« vom »Reiz« auf die »Reaktion« übrigbleiben (s.u.). Die damit aufgewiesenen Widersprüchlichkeiten sind naturgemäß auch nicht dadurch zu vermeiden, daß man - wie in den »Erwartungs-mal-Wert-Theorien« - zur Erwartungsdimension eine weitere, eben die »Wert«-Dimension, hinzunimmt. Zunächst muß man sich klar machen, daß es sich auch hierbei um Begründungsmuster handelt: Der »implikative« bzw. »inferentielle« Charakter dieser Theorien ergibt sich keineswegs erst aus der (häufig diskutierten) möglichen begrifflichen Abhängigkeit der Wert- von der Erwartungsdimension (oder umgekehrt), sondern allein schon aus dem geschilderten BGM-Charakter der Theorien, wie er im Erwartungs-Konzept akzentuiert ist. So ist Atkinsons Risikowahl-Modell - wovon man sich leicht überzeugen kann - in seinen situativen Dimensionen die »formelhafte« Verkleidung eines Begründungsmusters über die Prämissen, unter denen die Wahl einer bestimmten Aufgabe »vernünftig« sein könnte. Eine der Hauptaussagen des Modells, die umgekehrt U-förmige Beziehung zwischen Motivierungsstärke und erlebter Aufgabenschwierigkeit, läßt sich entsprechend etwa so umschreiben: 13 Wenn eine Aufgabe »zu leicht« bzw. »zu schwer« ist, gibt es keinen vernünftigen Grund, sich mit ihr zu befassen, im ersten Falle, weil es sich nicht lohnt, im zweiten Falle, weil es zu nichts führt (wobei die Prämissen, unter denen dies ein in sich schlüssiges BGM darstellt, natürlich spezifiziert werden müssen). Ebenso ist die in der erwähnten Rotter‘schen Formel enthaltene Aussage, jemand habe eine umso stärkere Bereitschaft, zur Erreichung eines bestimmten Ziels aktiv zu werden, je sicherer er ist, daß das Ziel für ihn erreichbar ist, und je mehr ihm die Zielerreichung bedeutet, selbstredend mitgemeint, daß er »vernünftigerweise« bzw. »mit guten Gründen« diese Bereitschaft habe: Nur so ist überhaupt verständlich, warum Rotter gerade diesen und nicht einen beliebigen anderen Zusammenhang formuliert hat. Dies verdeutlicht sich noch durch die »Gegenprobe«: Jemand strebt besonders intensiv ein Ziel an, das er für nicht erreichbar hält und dessen Erreichung ihm nichts bedeutet. Da dies »unvernünftig« bzw. »unverständlich« wäre, würde niemand ein entsprechendes Resultat als empirische Gegenevidenz gegen Rotters »Gesetz« betrachten, sondern vielmehr herauszufinden suchen, warum (in unserer Sprache) die im »Gesetz« enthaltenen Prämissen für »vernünftiges« Handeln in diesem Falle offensichtlich nicht realisiert sind. Dies heißt aber, daß auch positive experimentelle Befunde nicht im »Gesetz« formulierte Vorhersagen empirisch bestätigen, sondern bestenfalls einen Anwendungsfall oder ein »Beispiel« für »vernünftiges« Verhalten bei Vorliegen der darin implizierten Prämissen und Intentionen darstellen. Dementsprechend stehen die erwähnten weiteren Theorienbildungen als Kritik, Präzisierung, Differenzierung der Rotterschen Theorie keineswegs (wie man glaubt) nach dem Kriterium der empirischen Gültigkeit in Konkurrenz mit dieser oder untereinander: Vielmehr handelt es sich hier (wie früher unter allgemeineren Gesichtspunkten aufgewiesen, vgl. S.37f) lediglich um unterschiedliche Begründungsmuster, in denen verschiedene Handlungsprämissen und -intentionen angesetzt sind, wobei die dazu beigebrachten empirischen Befunde, sofern positiv, Anwendungsfälle oder Beispiele dafür darstellen: Alle theoretischen Versionen stehen hier also aufgrund ihres BGM-Charakters gleichberechtigt und empirisch unentscheidbar nebeneinander. So könnte man sich prinzipiell der globalen Einordnung von Volimer (1982) anschließen, der als Resultat seiner Analyse des implikativen Charakters des »expectancy value models« feststellt: »The expectancy-value model in psychology is therefore probably best understood as a special version of a general hermeneutical model of explanation called the practical syllogism« (S.97). Aus dem Selbstmißverständnis, es handle sich bei den Erwartung-mal-Wert-Modellen um empirische Gesetzesaussagen, ergibt sich nun aber, daß ihr möglicher Erklärungswert im Sinne der Explikation typischer Begründungsmuster menschlichen Handelns bei eingeschränkten Begründungprämissen durch die Art ihrer Fassung in den dargestellten Formeln weitgehend wieder zunichte gemacht wird: Hier sind bestimmte Dimensionen voneinander isoliert und auf spekulative Weise in einen mathematischen Funktionszusammenhang gebracht. Dadurch wird die Illusion genährt, es handle sich um universelle quantitative Gesetzmäßigkeiten, und in dem (notwendigerweise letztlich vergeblichen) Versuch, experimentelle Daten zu gewinnen, die den hypostasierten Kurvenverläufen entsprechen, wird wiederum das Weiterfragen nach der spezifischen Prämissenstruktur der zugrundeliegenden typischen BGMs unterbunden. Aus den allfälligen Abweichungen zwischen den vermeintlichen theoretischen Vorhersagen und den Daten wird nicht die Notwendigkeit einer Spezifizierung und Differenzierung der Prämissen, unter denen eine Versuchsanordnung als »Beispiel« für das Begründungsmuster taugt, abgeleitet. Statt dessen werden immer weitere, als universell empirisch gültig gedachte Dimensionen in die Formeln der Modelle aufgenommen, womit durch die pseudoquantitative Verfremdung menschlicher Handlungsgründe der Weg intersubjektiver Klärung ihrer typischen Prämissen- und Intentionsstrukturen versperrt ist. Der mögliche Erkenntniswert solcher Modelle als bruchstückhafter Ansätze zu typischen Begründungsfiguren menschlichen Handelns unter spezifischen Prämissen wäre mithin gegen das in ihnen vergegenständlichte »mathematische« Selbstmißverständnis erst begründungstheoretisch zu rekonstruieren. 14 Ein Problem, das noch gesondert zu behandeln wäre, manifestiert sich in der dargestellten Einführung des Erfolgs- bzw. Mißerfolgsmotivs als »Persönlichkeitsvariable« in das Risikowahl-Modell Atkinsons und weiterhin die allgemeine Theorie der Leistungsmotivation. Ein entsprechender Ansatz findet ich auch in Rotters Erwartung-mal-Wert-Theorie, als Einführung der Persönlichkeitsvariablen »interne-externe Kontrollerwartungen«. Da wir die Darstellung dieses Konzeptes indessen (wie gesagt) aus darstellungssystematischen Gründen auf später verschoben haben, soll auch die begründungsanalytische Kritik der Einführung von Persönlichkeitsvariablen erst dort im Zusammenhang entfaltet werden. Der andere Mensch als Lernagens: »Lernen am Modell« Eine weitere Ebene der kognitiven Ausgestaltung SR-psychologischer Lernkonzepte ergibt sich aus der Berücksichtigung des Umstandes, daß man nicht nur aufgrund eigener Erfahrungen, sondern auch in Verwertung der Erfahrungen anderer Individuen lernen kann. Eine Frühform dieser Sichterweiterung findet sich in der - noch orthodox SR-theoretischen - Konzeption von Miller & Dollard (1941) zum »Imitationslernen«. Einen ersten Schritt in Richtung auf kognitive Erweiterung der SR-Theorie geht ein Ansatz des »sozialen Lernens«, in dessen Mittelpunkt das Konzept des »vicarious reinforcement«, also der »stellvertretenden Verstärkung« steht. Ein solcher stellertretender Verstärkungseffekt wurde etwa von Berger (1962) im Schema des »klassischen Konditionierens« experimentell demonstriert. Seine Versuchsanordnung (mit Menschen) war folgendermaßen beschaffen: Der jeweilige Beobachter sah mit an, wie das Modell - eine vermeintlich andere Vp, die in Wirklichkeit vom Experimentator instruiert worden war - (wie aus ihrem Verhalten angenommen werden mußte) elektrische Schocks erhielt. Die Beobachter zeigten beim Anblick des scheinbar geschockten Modells mittels GSR (galvanischer Hautreaktion) festgestellte emotionale Reaktionen, was Berger als stellvertretende Verstärkung interpretierte. Das »Schock«-Verhalten des Modells wurde als US und die emotionale Reaktion des Beobachters als UER (unkonditionierte emotionale Reaktion) aufgefaßt. Kurz vor dem »Schockverhalten« des Modells bot Berger den Beobachtern einen neutralen Stimulus, Abdunkeln des Lichtes, dar, der nach mehreren Durchgängen schließlich allein die emotionale Reaktion hervorrief, die somit zur konditionierten emotionalen Reaktion (CER) wurde. Die Spezifik des Konzeptes der »stellvertretenden Verstärkung« gegenüber dem Imitationskonzept von Miller & Dollard besteht in folgendem: Während Miller & Dollard im Sinne der traditionellen SR-psychologischen Auffassungen davon ausgingen, daß Lernprozesse an die Verstärkung von Verhaltensweisen des Lernenden gebunden sind, also Imitation nur qua Verstärkung des imitierenden Beobachter-Verhaltens gelernt werden kann, ist hier vorausgesetzt, daß die Übernahme des Modell-Verhaltens durch den Beobachter allein schon dadurch zustande kommt, daß der Beobachter wahrnimmt, wie das Modell verstärkt wird, also ohne daß der Beobachter selbst für sein imitatives Verhalten irgendeine Verstärkung erhält. Dabei wird die Imitation durch »stellvertretende Verstärkung« von Berger nicht lediglich als ein Sonderfall neben der Imitation aufgrund der Verstärkung des imitierenden Verhaltens, sondern als Modell des sozialen Lernens überhaupt aufgefaßt, somit kritisch gegen den älteren Imitationsansatz gewendet. Einen Schritt weiter in die gleiche Richtung (der kognitiven Erweiterung SR-theoretischer Vorstellungen) geht nun Bandura mit seinem Konzept des »observational learning«, »beobachtenden Lernens«, das im Mittelpunkt seiner »sozial-kognitiven Lerntheorie« in ihrer ersten Ausarbeitungsstufe steht (vgl. etwa Bandura 1976; die zweite Ausarbeitungsstufe um das Konzept der »Selbstwirksamkeit« wird von mir später dargestellt). Bandura unterscheidet (wie schon gesagt) im Anschluß an Tolman zwischen dem Prozeß des Erwerbs der Bereitschaft zur sozialen Verhaltensangleichung einerseits und dem Prozeß der Aktualisierung dieser Bereitschaft in manifestem Verhalten andererseits. Beide Prozesse können nach Bandura 15 zeitlich mehr oder weniger weit auseinanderliegen und sind in ihrer Eigenart von verschiedenartigen Bedingungen abhängig. Der Prozeß des Erwerbs der Bereitschaft zur sozialen Verhaltensangleichung wird dabei als eine Folge von verborgenen, »covert«, Wahrnehmungsresponses auf das Modell-Verhalten verstanden. Deswegen redet Berger hier auch nicht von »Imitation«, sondern eben von »beobachtendem Lernen«. Dabei ist nach Bandura der stellvertretende Verstärkungswert der vom Beobachter wahrgenommenen Konsequenzen des ModellVerhaltens eine mögliche, aber keine notwendige Bedingung der Verhaltensangleichung. Vielmehr reiche die bloße Kontiguität zwischen den verschiedenen Elementen des ModellVerhaltens (bzw. deren kognitive Verarbeitung, s.u.) für den Erwerb der Bereitschaft zur Verhaltensangleichung aus. Der Prozeß der Aktualisierung der genannten Verhaltensbereitschaft zu manifestem Verhalten des Beobachters ist dagegen nach Bandura von den jeweils besonderen Verstärkungsbedingungen, unter denen der Beobachter steht, etwa auch von dem instrumentellen Verstärkungswert der auf dem Wege über das beobachtende Lernen ermöglichten Verhaltensweisen, abhängig. Bandura und seine Mitarbeiter führten - wie üblich - zur empirischen Konkretisierung dieser theoretischen Konzeption eine Reihe von Experimenten durch, von denen eine typische Untersuchung (Bandura 1965) als Beispiel geschildert werden soll. In diesem Experiment wurden drei Versuchsgruppen hergestellt. In der ersten Gruppe sahen die Beobachter - 66 Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren - einen Fernsehfilm, in welchem ein erwachsenes Modell zunächst aggresives Verhalten produzierte und später für dieses Verhalten großzügig belohnt wurde. In der zweiten Gruppe wurde ein Film dargeboten, der mit dem ersten Film identisch war, nur daß hier das Modell im Anschluß an das aggressive Verhalten bestraft wurde. In der dritten Gruppe - der Kontrollgruppe - wurde den Kindern nur der erste Teil des Films gezeigt. Es folgte also weder eine Belohnung noch eine Bestrafung des Modells. Das dargebotene aggressive Verhalten bestand in einer recht komplizierten Folge von Schlägen, Beschimpfungen etc., die das Modell einer großen Puppe zufügte, die ihm »im Wege stand«. in dem Film mit der Belohnungsbedingung wurde dem Modell von einem weiteren Erwachsenen im Anschluß an das aggressive Verhalten eine große Menge von für Kinder attraktiven Getränken, Süßigkeiten etc. überreicht, wobei das Modell - während es die Nahrung eifrig konsumierte - als »strong champion«, der es der Puppe aber richtig gegeben habe, gefeiert wurde. In dem Film mit der Bestrafungsbedingung wurde von dem zweiten Erwachsenen (im Film) das Modell wegen seiner Aggression gegenüber der Puppe so lange heftig gescholten, bis es sich ängstlich zurückzog. In einem zweiten Versuchsabschnitt wurden alle Kinder - jeweils einzeln - in einen »Überraschungsspielraum« geführt, in welchem sich - neben einer großen Menge anderen Spielzeugs - auch die Puppe aus dem Film sowie die Gegenstände, mit denen die Puppe dort vom Modell traktiert worden war, befanden. Das Verhalten der Kinder wurde von zwei Beurteilern hinter einer Einwegscheibe nach einem Schema, das quantitative Abstufungen ermöglichte, registriert. Im dritten Versuchsabschnitt wurden den Kindern - ohne daß ihnen die Filme noch einmal gezeigt worden waren - attraktive Getränke und Süßigkeiten dafür in Aussicht gestellt, daß sie möglichst viele Einzelheiten des vorher im Film beobachteten Modellverhaltens in ihrem eigenen Verhalten reproduzierten. Jedesmal, nachdem eine richtige Reaktion erfolgt war, erhielt das jeweilige Kind einen Teil der Süßigkeiten bzw. Getränke. Bandura kam zunächst zu dem Befund, daß sich die Kinder in den drei Versuchsgruppen auf die erwartete Weise hinsichtlich ihrer Imitationsraten unterschieden. Kinder, die den Film mit der Belohnungsbedingung gesehen hatten, zeigten gegenüber der Kontrollgruppe höhere Imitationsraten, die Kinder, die den Film mit der Bestrafungsbedingung gesehen hatten, niedrigere Imitationsraten als die Kontrollgruppe. Im dritten Versuchsabschnitt, in dem die möglichst vollständige Reproduktion des Modell-Verhaltens durch die Kinder belohnt worden war, tra- 16 ten jedoch hinsichtlich der Imitationsraten zwischen den drei Gruppen keine Unterschiede mehr auf. Dieses letzte Resultat wurde von Bandura als besonders bedeutsam betrachtet. Er schloß daraus, daß die wahrgenommenen Belohnungen bzw. Bestrafungen des Modells - also »stellvertretenden Verstärkungen« - nicht den Erwerb der vorgängigen aggressiven Modell- Verhaltensweisen, sondern lediglich die Ausführungs-Responses in der ersten, unbelohnten Imitationssituation beeinflußt haben. Nur so sei erklärlich, daß durch die spätere Belohnung einer möglichst vollständigen Reproduktion der Modell-Aggressionen weitere Aggressions-Items reproduzierbar wurden und die Wirkungsunterschiede der verschiednen stellvertretenden Verstärkungen verschwanden. Die lernende Übernahme der Verhaltensweisen des Modells ist demnach laut Berger als ein verborgener, »mediativer« Prozeß unabhängig von der stellvertretenden Verstärkung zu betrachten: Die entsprechenden Verhaltensmöglichkeiten müßten in allen drei Versuchsgruppen sozusagen »bereitgelegen« haben, da es ja möglich war, sie durch Belohnung der Beobachter zu aktualisieren. Wie ersichtlich, ist es die von uns früher diskutierte Differenzierung zwischen eigentlichem »Lernen« und »Ausführung«, durch welche Bandura quasi die Leerstelle innerhalb der SRpsychologischen Begrifflichkeit fand, in die er seine Vorstellung der Möglichkeit unverstärkten Lernens einfügen konnte. Dabei wurde also - indem Bandura die Annahme der Notwendigkeit von Verstärkung als Vorbedingung für das Ausführen des durch Beobachtung anderer Gelernten beibehielt - der SR-psychologische Erklärungsrahmen zwar kognitiv erweitert, blieb aber im Prinzip erhalten. Im weiteren wurde das hier angenommene »verborgene«, »mediative« Zwischenglied, in welchem das eigentliche beobachtende Lernen des ModellVerhaltens erfolgen soll, von Bandura durch Hereinnahme von Vorstellungen aus der zeitgenössischen Kognitiven Psychologie differenziert und ausgestaltet (vgl. etwa Bandu ra 1976, S.23ff und 1979, S.3lff). Um nun auch die damit geschilderten Konzeptionen des Beobachtungs- bzw. Modell-Lernens begründungstheoretisch reinterpretieren zu können, sei zunächst der allgemeine Umstand herausgehoben, daß unter den Vorzeichen des »Lernens von anderen« an den Handlungsbegründungen der früher (S.25) benannte Aspekt, daß begründete Handlungen als solche für mich und andere verständlich sind, in bestimmter Weise hervortritt. Wenn ich mir ein Urteil darüber bilde, wieweit ich in einem bestimmten Fall von anderen lernen kann, so schließt die Klärung meiner eigenen Gründe nämlich notwendig in irgendeiner Weise das Verständnis der Gründe ein, die andere für ihre Handlungen haben könnten. Anders: Wenn ich mich frage, warum ich für mich übernehmen soll, was andere tun, so frage ich mich gleichzeitig, warum die anderen das tun, dessen Übernahme hier zur Frage steht. Im Schema des »Beobachtungslernens« bzw. »Modell-Lernens« sind es dabei entweder nur die Handlungsgründe des Modells, oder - in jenen Dreierkonstellationen, innerhalb welcher ich beobachte, wie das Modell von einem Dritten »belohnt« oder »bestraft« wird - darüber hinaus die Gründe des Dritten für sein belohnendes oder bestrafendes Verhalten, die in meine eigenen Lerngründe eingehen. Eine implizite Einsicht in die Eigenart solcher intersubjektiv verschränkter Begründungsmuster läßt sich z.B. aus vielen Ventilationen Banduras über die Gründe von Verhaltensangleichungen ablesen, so in Formulierungen wie: »Menschen ... werden modellierte Verhaltensweisen dann eher in ihr eigenes Repertoire aufnehmen, wenn diese zu Ergebnissen führen, die einen gewissen Wert für sie besitzen, als wenn sie nicht-belohnende oder bestrafende Wirkungen zeitigen« (1979, S.37f). »Unter den zahllosen Reaktionen, die auf dem Wege der Beobachtung erworben werden, werden jene Verhaltensweisen, die für andere von Nutzen zu sein scheinen, gegenüber solchen Verhaltensweisen bevorzugt, bei denen sich negative Konsequenzen beobachten lassen. Auch die Art, wie Menschen ihr Verhalten selbst einschätzen, entscheidet darüber, welche durch Beobachtung erlernten Reaktionen tatsächlich ausgeführt werden. Menschen zeigen die Verhaltensweisen, die sie selbst als befriedigend empfinden, und lehnen diejenigen ab, die sie persönlich mißbilligen« (S.38). »Sieht man, wie Modelle 17 bestraft werden, neigt man dazu, ähnliche Verhaltensweisen zu hemmen. Sieht man dagegen, wie andere bedrohliche oder verbotene Tätigkeiten ausführen, ohne daß sie aversive Konsequenzen erfahren, kann dies unter Umständen die eigenen Hemmungen reduzieren« (S.58). Man mag sich den (von Bandura nicht identifizierten) BGM-Charakter derartiger Aussagen wiederum selbst durch Einfügen von .vernünftigerweise« sowie die Einfügung von »nicht» als »Gegenprobe» in die Dann-Komponente solcher Formulierungen Banduras evident machen und sich sodann verdeutlichen, wie die »guten Gründe« des Beobachters hier jeweils (mehr oder weniger implizit) mit den angenommenen »guten Gründen« des Modells und ggf. des genannten »Dritten« vermittelt sind. So offensichtlich also auch die Eigenart der theoretischen Aussagen über Beobachtungslernen und Modell-Lernen als Begründungsmuster ist, so deutlich treten bei genauerem Hinsehen die Verkürzungen dieser Konzepte zu tage, die daher rühren, daß man ihren Charakter als BGMs wiederum nicht reflektiert und deswegen die hinreichende Klärung der Prämissen bzw. Intentionen, unter denen sie »begründet/verständlich« sind, unterläßt. Damit bleiben zwangsläufig auch die zugehörigen experimentellen Befunde hinsichtlich ihrer Geeignetheit als Beispiele/Anwendungsfälle für die jeweiligen BGMs unterbestimmt und vieldeutig. So ist etwa in der geschilderten Untersuchung von Berger (1962) zur »stellvertretenden Verstärkung« - obwohl hier dem Anspruch nach ein universelles Modell sozialen Lernens realisiert werden soll - sowohl in den theoretischen Konzepten wie in den experimentellen Anwendungsfällen die Prämissen- und Intentionslage der involvierten Instanzen aus der Sicht des Beobachters weitgehend unbestimmt: Warum wird z.B. das Modell vom Experimentator geschockt? Warum läßt sich das Modell dies gefallen? Warum darf ich als Beobachter dabei zusehen? Warum dunkelt der Experimentator immer, kurz bevor das Modell den Schock erhält, das Licht ab? Etc. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Beobachter im Zuge seiner eigenen Handlungsbegründungen notwendigerweise (und wenn auch u.U. nur implizit) irgendwelche, dem Experimentator unbekannten Antworten auf diese Fragen gefunden hat, so imponiert auch hier die Beliebigkeit der Interpretation des resultierenden »Verhaltens« im Sinne des um das Konzept der stellvertretenden Verstärkung erweiterten klassischen Konditionierungsschemas. Im Kontext von Banduras Theorie des Beobachtungslernens korrespondiert der mangelnden Spezifizierung der Prämissen- und Intentionslage in den theoretischen Annahmen häufig geradezu die experimentelle Strategie, auch die Vpn auf diese Beschränkungen festzunageln, d.h. ihr implizites Weiterfragen nach den Gründen von Modellen und Dritten für deren vorgeführtes Verhalten zu unterbinden. So wird im dargestellten Banduraschen Experiment (1965) einerseits in den theoretischen Bestimmungen unklar gelassen, welche Gründe das Modell haben soll, die Puppe mit so komplizierten (zum Zwecke später differenzierter Erfassung der Behaltensleistung erfundenen) Handlungsfolgen zu attackieren und zu traktieren, warum der Dritte (obwohl doch nur eine Puppe das Objekt ist) dieses Verhalten in einem Falle mit allen möglichen Getränken und Süßigkeiten belohnt, im anderen Falle mit Beschimpfungen und Drohungen darauf reagiert. Andererseits wird davon ausgegangen sowie durch die Darbietungsweise und Instruktion sicherzustellen versucht, daß die Beobachter solche Vorführungen tatsächlich schlucken und im Sinne der Experimentatoren für bare Münze nehmen. Von da aus versteht sich auch, daß hier (wie öfter in Experimenten aus dem Bandura-Kreis) ohne inhaltliche Gründe kleinere Kinder als Versuchspersonen herangezogen wurden: Offensichtlich ist von diesen weniger als von erwachsenen Vpn zu befürchten, daß sie angesichts der geschilderten Merkwürdigkeiten der Versuchsanordnung nicht mehr mitziehen; vielleicht auch sind die Kinder eher bereit, die gesamte Versuchsprozedur als ein von den Erwachsenen angezetteltes, etwas seltsames Spiel hinzunehmen, bei dem man immerhin einiges erben kann. Um zur Verdeutlichung der Grundstruktur solcher Versuchsanordnungen noch ein anderes, ebenfalls mit Kindern angestelltes Experiment aus dem Bandura-Kreis (Walters & Parke 1975) anzuführen: Hier ging es um die »Prüfung« des BGMs, daß »abweichendes Verhalten« 18 durch die Beobachtung eines belohnten Modells verstärkt, bei Bestrafung des Modells bzw. bei Ausbleiben negativer Konsequenzen dagegen »gehemmt« wird. Die Modellsituation bestand wiederum aus einem Film, wobei hier eine erwachsene Frau (offensichtlich die Mutter) ein Kind anwies, nicht mit einem Spielzeug zu spielen, das auf einem Tisch lag, und sodann den Raum verließ. In ihrer Abwesenheit begann das Kind (im Film) mit dem verbotenen Spielzeug zu spielen. Als Fortsetzung der Szene wurden sodann drei Versionen hergestellt: Im »Belohnungsfilm« gab die zurückkehrende Mutter, obwohl sie sah, daß das Kind mit dem verbotenen Spielzeug spielte, diesem noch weiteres Spielzeug und beschäftigte sich liebevoll mit ihm. Im »Bestrafungsfilm« riß die Mutter bei ihrer Rückkehr dem Kind das Spielzeug aus der Hand, schüttelte es (das Kind), etc. Im »Film ohne Konsequenzen« betrat die Mutter die Szene nicht noch einmal. Die Kinder, die als Reobachter« fungieren sollten, wurden (ebenso wie Kontrollgruppen-Kinder ohne Filmdarbietung) einzeln in einem Raum mit Spielzeug geführt und folgendermaßen instruiert (Übers. K.H.): »,Du setzt Dich jetzt hier hin ... Dieses Spielzeug hier ist für jemand anders bereitgelegt worden. Deshalb faßt Du es besser nicht an‘.« Dann wurde ggf. angekündigt ‚Nun werde ich (Dir) einen Film zeigen und einer der Filme vorgeführt. Anschließend sagte die Vl zu dem jeweiligen Kind: »,Ich komme gleich und spiele ein Spiel mit Dir, aber ich habe etwas vergessen und muß es holen gehen. Während ich fort bin, kannst Du Dir dieses Buch ansehen ... Ich werde die Tür schließen, damit niemand Dich stört, und wenn ;h zurückkomme, klopfe ich an, damit Du weißt, daß ich es bin (S.159). Danach wurde das Kind 15 Minuten allein gelassen und hinter einer Einwegscheibe daraufhin beobachtet, wieweit es verbotswidrig mit dem Spielzeug spielte. (Weitere Versuchsstadien und Instruktionen lasse ich beiseite). In dem damit geschilderten Experiment (das im übrigen die »erwarteten » Ergebnisse erbrachte) wimmelt es geradezu vor theoretisch unbestimmten und experimentell unerfaßten Begründungen, d.h. mangelnder Spezifizierung der in ihnen enthaltenen Prämissen und Intentionen: Welche Gründe hat die Mutter im Film, dem Kind das Spielen mit dem Spielzeug zu verbieten? Aus welchem Grund ist die Mutter in der »Belohnungsversion«, obwohl das Modellkind ihr Verbot übertreten hat, besonders freundlich zu diesem? Warum darf ich (als BeobachterKind) nicht mit dem vorhandenen Spielzeug spielen, nur, weil es für jemand anders »bereit gelegt« worden ist? Warum wird mir ggf. ein Film gezeigt, in welchem auch ein Kind vorkommt, das mit einem bestimmten Spielzeug aus unerfindlichen Gründen nicht spielen darf? Warum kündigt die Versuchsleiterin vor Verlassen des Raumes entgegen den sonstigen Gepflogenheiten der Erwachsenen vorher an, daß sie anklopfen wird, wenn sie zurückkommt? All solche Fragen werden hier weder bei der Theorienbildung noch der experimentellen Realisierung als möglich zur Kenntnis genommen; statt dessen wird die Korrespondenz zwischen der mangelnden Prämissen- und Intentionsspezifizierung in den theoretischen Konzepten und entsprechend eingeschränkten Sichtweisen der Vpn einfach unterstellt, d.h. ein mögliches Weiterfragen der Kinder nach den Gründen der beteiligten Instanzen für ihre Verhaltensweisen, wo möglich, autoritär unterbunden und im übrigen als nichtexistent vernachlässigt: So sind die experimentellen Anordnungen wegen des BGM-Charakters der Theorien selbstredend nicht deren »Prüfungen«, aber noch nicht einmal hinreichend gesicherte Beispiele für das darin Gemeinte, da die theoretisch angesetzte reduzierte Prämissen/Intentionslage des Beobachters beim Modell-Lernen in das Verhalten der Vpn hineingedeutet anstatt daraus expliziert ist. All derartige Praktiken der Umdeutung, Unterdrückung etc. von möglichen Äußerungen der Vpn ergeben sich mit Zwangsläufigkeit aus der allgemeinen SR-psychologischen Doktrin, der gemäß das Verhalten der beteiligten Individuen in der Konstellation des Modell-Lernens nur als Konsequenz der hergestellten Umweltkontingenzen betrachtet werden darf: So müssen die »Freiheitsgrade« der Vpn, die man einerseits durch die Einbeziehung kognitiver Aspekte in die Versuchskonstellation zugelassen hat, andererseits bei der Erhebung und Interpretation der Befunde wieder weggebügelt werden (ich komme noch darauf zurück). 19 Das Konzept des »Selbst« im SR-theoretischen Kontext Da Reflexivität/Selbstreflexivität als eine elementare Gegebenheitsweise menschlichen Bewußtseins zu betrachten ist, wundert es nicht, daß mit der Rehabilitation des »Bewußtseins« nach der kognitiven Wende in der Psychologie auch das »Selbst« als Begriff und als Phänomen wiederum Beachtung fand. Faktisch kann man gerade in neuester Zeit eine Art von Selbst-Boom konstatieren, wobei die Vorsilbe »Selbst« in verschiedenen Verbindungen vorkommt: »Selbstkonzept«, »Selbstwahrnehmung«, »Selbstkontrolle«, »Selbstaufmerksamkeit«, »Selbsterfahrung«. Uns interessiert dieses Konzept hier wiederum nur in seinen lerntheoretischen Implikationen: Wir müssen uns fragen, welche neuen Gesichtspunkte und Konsequenzen sich innerhalb unserer begründungstheoretischen Reinterpretationsversuche daraus ergeben, daß - in gewisser Hinsicht als Komplementärbegriff zur Berücksichtigung des »anderen« als Lernagens - unter kognitivistischer Hegemonie SR-theoretische Ansätze um das »Selbst«-Konzept erweitert wurden. Dabei ist auch hier zunächst auf Vorformen im Rahmen der orthodoxen SR-Psychologie zu verweisen: So hat etwa Skinner (wenn auch erst spät) in seine Theorie der operanten Konditionierung das Konzept der »Selbstverstärkung« als Grundlage der »Selbstkontrolle« hineingenommen, wobei er den Verdacht, daß er damit seine Theorie »mentalistisch« erweitert habe, aber gleich wieder zurückweist: Selbstverstärkung sei grundsätzlich nichts anderes als Fremdverstärkung, nur, daß hier die Verstärkungskontingenzen nicht vom Experimentator, sondern eben vom Individuum selbst hergestellt würden (vgl. etwa Skinner 1953, S.285). Diese Vorstellung fand auch in die technologischen Anwendungsbereiche der Verhaltenstheorie Eingang, indem hier den Klienten eine Art von Selbstmanipulation der Verstärkungsbedingungen als besonders wirksames Mittel der Erzielung gewünschten bzw. Beseitigung unerwünschten Verhaltens empfohlen wurde (vgl. dazu etwa Kanfer & Phillips, 1970, S.407ff, und insbesondere Watson & Thorpe, 1975, mit ihrem verbreiteten Lehrbuch »Einübung in die Selbstkontrolle«). Die theoretische Schwierigkeit, die aus der hier implizierten Verdoppelung des Individuums in den Akteur und das Objekt der Verstärkung für die SR-Theorie entstehen muß, wurde dabei (soweit ich weiß) nicht gesehen, jedenfalls nicht diskutiert. Die Funktion einer wirklichen kognitiven Erweiterung SR-psychologi scher Vorstellungen gewann das »Selbst«-Konzept dadurch, daß es in lerntheoretische Konzeptionen Eingang fand, die bereits die früher diskutierte kognitive Ausweitung mittels expliziter Ergänzung oder Ersetzung des Verstärkungsbegriffs durch den Begriff der Erwartung vollzogen hatten. Von besonderer Bedeutung war in diesem Problemzusammenhang die dargestellte »soziale Lerntheorie« von Rotter: Hier wurde (wie schon angedeutet) das ursprüngliche SR-theoretisch formulierte »Erwartung-mal-Wert«-Konzept in der Folge dadurch ausgeweitet, daß Rotter neben den speziellen, auf das Eintreffen von Verstärkungen bezogenen Erwartungen eine weitere Art von Erwartungen, nämlich verschiedene Formen »generalisierter Erwartungen« ein führte. Das wichtigste (oder mindestens folgenreichste) Rottersche Konzept dieser Art ist die Erwartung der »internen versus externen Kontrolle der Verstärkung«, auch als »locus of control« bezeichnet, heute bei uns unter dem Terminus »interne/externe Kontrollüberzeugung« tradiert: Nach Rotter werden die »Erwartungen« eines Individuums (gemäß der früher erwähnten Formel eine der Determinanten des »Verhaltenspotentials«) verstärkt / abgeschwächt oder bleiben unverändert, je nachdem, ob das Individuum das (positive bzw. negative) Ereignis auf seine eigenen Aktivitäten oder auf von ihm unbeeinflußbare Faktoren zurückführt. In der Folge wurde dieses zunächst situationale Konzept dann in eine »Persönlichkeitsvariable« umgedeutet und sollte mit entsprechend konstruierten Skalen meßbar gemacht werden (zur deutschen Fassung vgl. Piontkowski 1989). Die persönlichkeitstheoretische Version des Konzepts der externen/internen Kontrollüberzeugung ist für unsere Themenstellung jedoch irrelevant: Wir beziehen uns in der Folge nur auf die ursprüngliche (und später gelegentlich reaktualisierte) situationale Fassung. 20 Das erste Experiment, in welchem dieser Effekt situationell erzeugt werden sollte, stammt von Phares, einem Schüler Rotters: Phares (1957) arbeitete in seinem Experiment mit »skill versus chance situations«: Seine Versuchspersonen erhielten die Aufgabe, Farben bzw. Längen von Linien miteinander zu verg1eichen. Einer Gruppe von Vpn wurde gesagt, diese Aufgabe sei so schwierig, daß der Erfolg weitgehend vom Zufall oder Glück abhängen würde. Eine andere Gruppe wurde instruiert, daß Erfolg bei der Aufgabenlösung möglich sei und - gemäß früheren Erhebungen als abhängig von den Fähigkeiten der jeweiligen Individuen betrachtet werden müsse. Der Hälfte der »Skill«-Vpn wurde die Linienvergleichs-Aufgabe und der anderen Hälfte die Farbenvergleichs-Aufgabe gegeben. Die »Chance«-Vpn wurden in gleicher Weise behandelt. Durch diese Anordnung, in der die »Skill«- und die »Chance«-Vpn jeweils die gleiche Aufgabe erhielten, sollte nach Phares jede Möglichkeit ausgeschaltet werden, daß Unterschiede des Erwartungs-Verhaltens durch die Art der Aufgabe und nicht durch die unterschiedliche Instruktion als kritische Variable zustande kommen. Alle Gruppen wurden in einer fixierten Ordnung partiell positiv bzw. negativ verstärkt (in dem ihnen gesagt wurde, daß ihre Aufgabenlösung falsch oder richtig sei). Zur Messung der Erwartungs-Stärke wurde die Anzahl von (gegen Geld eintauschbaren) Plastik-Chips benutzt, die die Versuchspersonen bereit waren, auf ihre Erfolgschancen beim jeweils nächsten Schätzversuch zu verwetten. Als Resultat dieses Experiments ergab sich unter anderem, daß verstärkungsbedingte Erwartungsänderungen sowohl der Ausprägung wie der Häufigkeit nach bei den »Skill«-Vpn größer waren als bei den »Chance«-Vpn. Neben der hier verwandten experimentellen Technik, interne bzw. externe Kontrollerwartungen (als »skill« vs. »chance») bei gleicher Aufgabe über die Instruktion zu erzeugen, wurde in anderen Experimenten der entsprechende Effekt durch Einführung unterschiedlicher Aufgaben, die als nur durch Zufall bzw. durch eigene Fähigkeiten lösbar erscheinen sollten, zu erzielen versucht (so etwa in einer Untersuchung von Rotter, Liverant & Crown, 1961, einer Aufgabe zur »außersinnlichen Wahrnehmung« und einer Aufgabe zur Prüfung einer »ruhigen Hand«).Dabei wurden mehr oder weniger eindeutig die gleichen Befunde: ausgeprägtere und häufigere Erwartungsänderungen bei der »Skill«-Aufgabe, eingebracht. In der daran anschließenden Serie weiterer Experimente hatten jedoch - wegen ihrer größeren bedingungsanalytischen Stringenz - die Anordnungen mit Verwendung der Instruktions-Technik offenbar besonderes Gewicht (ein Überblick findet sich etwa bei Krampen 1982, S.79ff). Im »Locus of Control«-Ansatz von Rotter wird faktisch das »Selbst« als »Ursprung« von Handlungen in die theoretischen Bestimmungen des Erwartungslernens aufgenommen, indem die Situation des Lernens potentieller Kontrolle der Verstärkungsbedingungen durch das Subjekt einer Lernsituation, in der ein solcher Einfluß auf die Verstärkungsbedingungen nicht möglich ist, gegenübergestellt wird. Dabei ist allerdings einmal präzisierend festzustellen, daß im »locus of control« nur die verallgemeinerte Erwartung (»generalized expectancy«) der subjektiven Kontrolle/Nichtkontrollierbarkeit, nicht aber die reale Möglichkeit des Subjekts, Kontrolle über die Lernbedingungen auszuüben, angesprochen ist. Zum anderen wird die Annahme des Einflusses des »locus of control« auf das Erwartungslernen hier auf soweit unstrukturierte Situationen eingeschränkt, daß der Grad der tatsächlichen Beeinflußbarkeit der Aufgaben durch eigene Aktivitäten für die Vpn nicht eindeutig beurteilt werden kann: Nur für diesen Fall können die verallgemeinerten Kontrollerwartungen bei der Einschätzung des subjektiven Einflusses auf die Bewältigung einer konkret vorliegenden Aufgabe durchschlagen. Rotter hat in einem Artikel zur Klärung von Mißdeutungen seines Locus of control Konstruktes (1982, S.50) ausdrücklich die Vernachlässigung dieser beiden Momente als Gründe für Fehleinschätzungen herausgehoben. Eine weitere Konzeption, in welcher SR-theoretische Vorstellungen unter den Vorzeichen der »Selbstkontrolle« kognitiv erweitert wurden, und die - wie Rotters »Locus of Control«Konzept - auf das Lernen von generalisierten Erwartungen bezogen ist, ist die Theorie der 21 »gelernten Hilflosigkeit« von Seligman. Auch dieser Ansatz enthält für uns thematisch irrelevante persönlichkeitstheoretische Implikationen, indem hier »gelernte Hilflosigkeit« als Entstehungsvoraussetzung von Depressionen betrachtet wurde (vgl. Seligman 1975/1979): Wir diskutieren Seligmans Hilflosigkeits-Konzept ebenfalls nur als kognitiv erweiterte Theorie des Erwartungs-Lernens. Die erste Fassung der Theorie der gelernten Hilflosigkeit stand im Zusammenhang mit Tierexperimenten. Zunächst wurde in Untersuchungen mit Hunden aufgewiesen, daß Tiere, die die Unbeeinflußbarkeit des Auftretens und Aufhörens eines elektrischen Schocks durch ihr eigenes Verhalten gelernt hatten - anders als Tiere, die den Schock aktiv beenden konnten, und Kontrolltiere - in einer zweiten Versuchsphase die Gelegenheit, dem Schock zu entkommen, nicht ausnutzen konnten (Overmier & Seligman 1967, Seligman & Maier 1967). Diese Konzeption des Lernens von Hilflosigkeit als quasi übergeordnetem Kontingenz-Lernen, in welchem nicht einzelne Verknüpfungen zwischen Verhaltensweisen und (negativen) Verstärkungen als Verhaltensfolgen, sondern die Erwartung der generellen Nichtkontingenz zwischen eigenem Verhalten und dem Fortdauern oder Aufhören des aversiven Reizes gelernt wird, wurde in weiteren Experimenten mit Katzen, Fischen, Ratten und schließlich auch mit Menschen realisiert (Überblick bei Maier & Seligman 1976, vgl. auch Maier 1989). Repräsentativ für solche Untersuchungen, in welchen »menschliche« Analogien zu den genannten Tierstudien hergestellt werden sollten, ist die folgende Arbeit von Hiroto (1974): In diesem Experiment wurden College-Studenten in der ersten Untersuchungsphase auf drei Versuchsgruppen verteilt: Der ersten Gruppe (Vermeidbarkeits-Gruppe) wurde ein sehr lautes Geräusch dargeboten, das die Vpn durch viermaliges Drücken eines Knopfes beenden konnten. Der zweiten Gruppe (Unvermeidbarkeits-Gruppe) wurde der Lärm nach dem Muster der ersten Gruppe in gleicher Intervallfolge exponiert wie der ersten Gruppe, nur daß er hier unabhängig von Reaktionen der Vpn begann und aufhörte. Die dritte Gruppe (Kontrollgruppe) erfuhr keinen Lärm. In der zweiten, der Testphase des Experiments erhielten alle Vpn eine Vorrichtung, mit der sie durch Bewegung eines Hebels nach Darbietung eines roten Lichts als diskriminativem Hinweisreiz den Lärm vermeiden (»avoidance«) bzw. ihm, nachdem er jeweils begonnen hatte, entkommen konnten (»escape«). Auch hier lernten (analog zu den Resultaten der Tierexperimente) die »Vermeidbarkeits-Gruppe« und die Kontrollgruppe schnell, dem Lärm zu entkommen, während das typische Individuum der »UnvermeidbarkeitsGruppe« unfähig war, den Lärm abzuschalten, und ihm jeweils bis zum Ende passiv lauschte. Diese Unterschiede traten nur bei den Flucht-Reaktionen, nicht aber bei den Vermeidungsreaktionen auf. Das Konzept der »Hilflosigkeit« wurde zunächst in enger Anlehnung an die geschilderten Experimente bestimmt. So spricht etwa Hiroto (1974, S.187) vom »failure to escape«, als »the defining characteristic of learned helplessness«. Später kam Seligman (1975/1979, S.52) zu folgender allgemeinerer Definition: »Die Erwartung, daß eine Konsequenz von den eigenen willentlichen Reaktionen unabhängig ist, (a) senkt die Motivation, diese Konsequenz kontrollieren zu wollen, (b) interferiert mit der Fähigkeit zu lernen, daß die eigenen Reaktionen die Konsequenz tatsächlich kontrollieren ...« Dies wird an anderer Stelle (Abramson, Seligman & Teasdale 1978) noch so erläutert: Die Hypothese der gelernten Hilflosigkeit »is ‚cognitive‘ in that it postulates that mere exposure to uncontrollability is not sufficient to render an organism helpless, rather, the organism must come to expect that outcomes are uncontrollable in order to exhibit helplessness« (S.50, Hervorh. K.H.). Die in dieser Definition vollzogene Generalisierung der ursprünglichen, mehr »operationalen« Bestimmungen von Hilflosigkeit besteht wesentlich darin, daß als Voraussetzung für die Entstehung der Hilflosigkeit nicht mehr lediglich die Ausgeliefertheit (»inescapabilty«) an zufällig, d.h. unabhängig vom eigenen Verhalten, auftretende und wieder verschwindende negative Ereignisse (Strafreize), sondern allgemeiner die Unkontrollierbarkeit von positiven wie negativen Ereignissen benannt wurde. Entsprechend versuchten Hiroto & Seligman (1975) aufzuweisen, daß »Hilflosigkeit« nicht 22 nur mittels unvermeidbaren Lärms, sondern auch mittels unlösbarer Problemaufgaben (Anagramme) erzeugt und geprüft werden kann, wobei die Autoren aus dem Umstand, daß unvermeidbarer Lärm auch »Hilflosigkeit« bei der Problemlösung und umgekehrt die Unlösbarkeit von Problemaufgaben auch »Hilflosigkeit« in Lärmsituationen erzeugte, die Fassung dieses Konzeptes als eine Art von generalisierter »Eigenschaft« (»induced trait«) begründeten. Abgesehen von solchen mehr systemimmanenten Varianten kam es aber auch zu seiner grundsätzlichen Revision der Hilflosigkeitstheorie (Abramson, Seligman & Teasdale 1978), mit der insbesondere attributionstheoretische Gesichtspunkte adaptiert wurden. Ich gehe - weil damit der theoretische Gehalt des Hilflosigkeitskonzeptes m.E. eher verwässert wird - darauf nicht näher ein. Für die weitere Diskussion sei die ursprüngliche, enge Fassung des Konzeptes der »gelernten Hilflosigkeit« zusammenfassend auf den Begriff gebracht: »Failure to escape«, also subjektive Unfähigkeit, trotz objektiv bestehender Möglichkeiten einer schmerzhaften, bedrohlichen Situation durch eigenes Handeln zu entkommen. Diese Unfähigkeit wurde vorgängig »gelernt« als eine generalisierte Erwartung aufgrund erfahrener Unabhängigkeit zwischen dem Gang der schmerzhaften Ereignisse und den Aktivitäten des Individuums zu ihrer Abwendung (was ich auch tue, es hat ja doch keinen Zweck). Eine dritte Konzeption, in welcher die erwartungstheoretische Ausweitung SRpsychologischer Vorstellungen durch Einbeziehung des »Selbst«-Konzeptes zugespitzt wird und die mit Rotters und Seligmans Konzepten in offensichtlicher Beziehung steht - ist die Theorie der »Selbstwirksamkeits-Ewartungen« (»expectations of self-efficacy«) von Bandura. Dieser Ansatz stellt die zweite Entwicklungsphase der »sozial-kognitiven Lerntheorie« Banduras dar, in die seine (von mir auf S.88ff dargestellte und diskutierte) frühere Theorie des »Beobachtungs«- bzw. »Modell-Lernens« als Teilaspekt einbezogen ist. Banduras Darlegungen über »Selbstwirksamkeit« stehen - anders als Rotters und selbst Seligmans Konzeptionen - ihrem Ursprung nach eindeutig im Kontext von Ansätzen zur kognitiven Ausweitung der SR-theoretischen Verhaltenstherapie, von wo aus dann allgemeinpsychologische Generalisierungsversuche unternommen wurden. In diesem Zusammenhang wird von Bandura (1977b) ein »theoretical framework« entwickelt, »in which the concept of self-efficacy is assigned a central role for analyzing changes in fearful and avoidant behavior«. »In this conceptual system, expectation of personal mastery affects both initiation and persistence of coping behavior« (S.193) . Es geht also um die Herausarbeitung der Funktion der SelbstwirksamkeitsErwartungen bei der Bewältigung furchterregender, Vermeidungstendenzen hervorrufender Situationen. Bandura definiert sein Konzept der Selbstwirksamkeits-Erwartungen in Abhebung von bloßen »Ergebnis-Erwartungen«: »An outcome expectancy is defined as a person‘s estimate that a given behavior will lead to certain outcomes. An efficacy expectation is the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce the outcome. Outcome and efficacy are differentiated, because individuals can believe that a particular course of action will produce certain outcomes, but if they entertain serious doubts about whether they can perform the necessary activities such information does not influence their behavior« (S.193). In den Selbstwirksamkeits-Erwartungen spricht sich also - wie Bandura noch näher ausführt - das Individuum nicht bloß die Fähigkeit zu, eine bestimmte Situation zu bewältigen, und es meint auch nicht lediglich, über das Wissen darüber zu verfügen, was in der Situation zu tun ist: Zur Antizipation der tatsächlichen Wirksamkeit muß das Individuum darüber hinaus annehmen, daß es auch mit aktuellen Widerständigkeiten der Situation und eigenen Beeinträchtigungen bei der Umsetzung seiner Fähigkeiten und seines Wissens fertig werden wird. Dabei wird von Bandura die Selbstwirksamkeits-Erwartung folgendermaßen gegenüber anderen Verhaltensdeterminanten qualifiziert: Die Erwartung kann dann nicht in Ausführungsaktivitäten umgesetzt werden, wenn die faktischen Fähigkeiten dazu fehlen und wenn das Indiduum keinen Anreiz (»incentive«) hat, in dieser Weise zu handeln: »Given appropriate skills und adequate incentives, however, efficacy expectations are a major determi- 23 nant of people‘s choice of activities, how much effort they will expend, and how long they will sustain effort in dealing with stressful situations« (1977b, S.94). Die erste und gleichzeitig methodisch repräsentative Untersuchung, in der die Selbstwirksamkeits-Erwartungen als Verhaltensänderungen vermittelnder kognitiver Prozeß experimentell realisiert werden sollten, ist die Arbeit von Bandura, Adams & Beyer (1977) über die Selbstwirksamkeits-Erwartungen als »mediative« Variable bei verschiedenen therapeutischen Unterstützungen zur Bewältigung von Schlangen-Phobien: Die Versuchspersonen für diese Studie waren über Zeitungsanzeigen rekrutierte Individuen mit einer schweren, die alltägliche Lebenspraxis beeinträchtigenden Schlangenphobie. Die Stärke des phobischen Vermeidungsverhaltens wurde durch eine Serie von 28 Stationen zunehmend bedrohlicheren Umgangs mit einer rotschwänzigen boa constrictor erhoben, angefangen von der Annäherung an den Glaskäfig, in dem die Schlange sich befand, über das Herausnehmen der Schlange mit behandschuhten und bloßen Händen bis zum Halten der Schlange 12 cm vor dem Gesicht und schließlich dem Tolerieren des Herumkriechens der Schlange auf dem eigenen Körper ohne Abwehr mit den Händen. Die SelbstwirksamkeitsErwartungen wurden nach der Höhe, Stärke und Generalisierbarkeit getrennt erhoben: Die Höhe der Selbstwirksamkeits-Erwartungen war operationalisiert als die Einstufung der antizipierten Situationsbewältigung anhand einer Liste mit den genannten Stationen wachsend bedrohlicherer Interaktion mit der Schlange; die Stärke der Erwartungen wurde für die je angegebene Station mit einer 100 %-Wahrscheinlichkeitsskala (von geringerer zu höherer Sicherheit der Bewältigung der Situation) eingeschätzt; zur Bestimmung der Generalisierbarkeit der Selbstwirksamkeitserwartungen schätzten die Vpn die Höhe und Stärke ihrer antizipierten Fähigkeit zur Situationsbewältigung mit Bezug auf eine unbekannte Schlange gleicher Art. Außerdem wurde die mit jeder Station des Schlangen-Umgangs verbundene Stärke der Furcht mit einer 10-Punkte Skala mündlich angegeben. Die Wirksamkeits-Erwartungen wurden jeweils nach dem Pretest des Vermeidungsverhaltens, vor dem Posttest und nach dem Posttest gemessen. Zur (ungefähr einwöchigen) therapeutischen Behandlung der Phobien zwischen Pretest und Posttest wurden drei Bedingungen eingeführt: (1) Teilnehmendes Modellieren (»participant modeling«), bei dem die Vpn nach kurzem angstreduzierendem Vormachen durch den Therapeuten die aufgelisteten Schlangen-Interaktionen mit einer anders gefärbten boa constrictor von der »leichtesten« zur »schwersten« Station aktiv ausführten (»enaktive« Information); (2) Reines »Modellieren« (»modeling«), bei welchem die Versuchspersonen lediglich zusahen, wie der Therapeut die gleiche Serie von zunehmend bedrohlichem Schlangenumgang ausführte (»stellvertretende« Information); (3) Kontrollgruppe ohne jede Behandlung. Als Resultate wurden u.a. angeführt, daß nach der Behandlung mit enaktiver Information, aber fast in gleicher Höhe auch nach der Behandlung mit stellvertretender Information, das Vermeidungsverhalten (verglichen mit der Kontrollgruppe) reduziert werden konnte, und daß die Veränderungen der Selbstwirksamkeits-Erwartungen (nach ihrer Höhe, Stärke und Generalisierbarkeit) von der Erhebung nach dem Pretest bis zur Erhebung vor dem Posttest einen genauen »Prädiktor« für die entsprechenden Veränderungen des Bewältigungsverhaltens beim Umgang mit der Schlange durch die verschiedenen therapeutischen Behandlungen darstellten. In ähnlich geplanten Experimenten wurden z.B. der Effekt »systematischer Desensibilisierung« (Entspannung, verbunden mit vorgestellten Schlangenszenen wachsender Bedrohlichkeit) auf die Selbstwirksamkeits-Erwartungen und Bewältigungs-Fortschritte von Bandura & Adams (1977) untersucht, ebenso die Verallgemeinerbarkeit der Befunde auf eine andere Art von Phobie, die Agoraphobie (Platzangst), von Bandura, Adams, Hardy & Howells (1980). Weitere Arbeiten befaßten sich (über die Analyse von Phobien hinausgehend) mit Effekten der Selbstwirksamkeits-Erwartungen bei der Bewältigung von sozialer Unsicherheit, der Angst vor öffentlichem Reden, und der Rauchgewohnheit (Überblick bei Mielke 1984, S. l00ff, bzw. 113ff). Darüber hinaus wurde auch bei der Selbstwirksamkeits-Theorie eine Aus- 24 weitung auf das Leistungsverhalten versucht, so in der Untersuchung von Bandura & Schunk (1981) über das Lösen von Mathematik-Aufgaben, wobei anstelle der Annäherungsschritte an das gefürchtete Objekt Lösungsschritte bei Aufgaben zunehmender Schwierigkeit als Index der Verhaltensänderung dienten. In derartigen Untersuchungen war indessen - wie Mielke (1984, S.121, S.123) hervorhebt - die Operationalisierung der SelbstwirksamkeitsErwartungen ungleich schwieriger als in den Experimenten zum Vermeidungsverhalten; außerdem verwischen sich hier - wie analog bei den entsprechenden Ausweitungsversuchen von Seligmans Theorie der »gelernten Hilflosigkeit«, s.o. - zunehmend die Grenzen des Selbstwirksamkeits-Konstruktes mit Konstrukten aus dem Bereich der Leistungsmotivation, wie »Hoffnung-auf-Erfolg/Furcht vor Mißerfolg« o.ä. Zum Verhältnis zwischen seiner Theorie der »Selbstwirksamkeits-Erwartungen« und den Konzepten der »internen/externen Kontrollerwartungen« von Rotter sowie der »gelernten Hilflosigkeit« von Seligman hat sich Bandura (1977b, S.204f) selbst geäußert: Das Locus of Control-Konstrukt bezieht sich nach Bandura mehr auf »causal beliefs about action-outcome contingencies« als auf »personal efficacy«; die Erwartung, daß eine bestimmte Aktivität von den eigenen Fähigkeiten (»skills«) abhängig sei, könne ganz unterschiedliche Effekte auf die Selbstwirksamkeits-Erwartungen haben; so müsse die interne Attribution von Fähigkeiten dann die Erwartungen der eigenen Wirksamkeit stark beeinträchtigen, wenn das Individuum über die entsprechenden Fähigkeiten nicht zu verfügen meint. Auch Seligmans Ansatz der »gelernten Hilflosigkeit« leidet nach Bandura an einer unzureichenden Unterscheidung zwischen »efficacy« und »outcome expectations«: Ein Individuum könnte es aufgegeben haben, einem aversiven Ereignis zu entgehen, weil es sich dessen Bewältigung nicht zutraut, oder weil es meint, daß sein Verhalten deswegen keinen Effekt hat, weil die Umwelt als solche unbeeinflußbar ist, bzw. weil es annimmt, permanent für seine Bewältigungsversuche bestraft zu werden (Bandura 1977b, S.204f). Diese Passage hat offensichtlich einen bestimmten Aspekt der erwähnten attributionstheoretischen Revision des »Hilflosigkeits«Konzeptes angeregt: Bei Abramson, Seligman & Teasdale (1978, S.51) ist sie anläßlich der Begründung der Unterscheidung zwischen »persönlicher« und »universeller Hilflosigkeit« wörtlich und im Ganzen zitiert. Diese Differenzierung kann aber m.E. nur die Funktion einer Präzisierung des ursprünglichen Hilflosigkeits-Konzeptes haben, da dort von vornherein persönliche Hilflosigkeit gemeint war, womit man diese also auch als Erwartung mangelnder Selbstwirksamkeit umschreiben könnte. Entsprechend konnte der Unterschied zwischen Ergebnis- und Selbstwirksamkeits-Erwartungen mit der Gegenüberstellung von »Hoffnungslosigkeit« (Beck 1967) und »Hilflosigkeit« verdeutlicht werden: »Hoffnungslosigkeit« ist demnach eine Konsequenz geringer Ergebnis-Erwartungen und »Hilflosigkeit« eine Konsequenz geringer Selbstwirksamkeits-Erwartungen. Diese Unterscheidung wird von Weiner & LitmanAdizes (1980) mit dem Beispiel eines Schiffbrüchigen illustriert, der sich zwar selbst nicht in der Lage sieht, seine Rettung zu bewerkstelligen, also »hilflos« ist und entsprechend geringe Selbstwirksamkeits-Erwartungen hegt, womit er aber noch nicht »hoffnungslos« zu sein braucht, da er - etwa bei Berücksichtigung des Umstandes, daß er sich in der Nähe einer vielbefahrenen Schiffsroute befindet - durchaus hohe Ergebnis-Erwartungen hinsichtlich seiner Rettung haben kann (vgl. Mielke 1984, S.64f). Im folgenden geht es nun wieder darum, die vorher dargestellten Konzeptionen begründungstheoretisch zu reinterpretieren. Dabei soll zunächst (mehr pflichtgemäß) auf den offensichtlichen Tatbestand hingewiesen werden, daß es sich bei den drei dargestellten Theorien nicht (wie die Autoren meinen) um Annahmen über empirische Wenn-Dann-Zusammenhänge, sondern um Begründungsmuster handelt: Interne/externe Kontrollerwartungen: Wenn ich annehmen muß, daß ich durch mein eigenes Verhalten bestimmte positive oder negative Ereignisse herbeiführen bzw. meiden kann (»Skill«-Instruktion), so werde ich vernünftigerweise diesen Effekt meines Verhaltens auch für die Zukunft (den nächsten Durchgang) erwarten. Muß ich dagegen annehmen, daß be- 25 stimmte positive oder negative Ereignisse nicht durch mich zustandezubringen sind (»Chance«-Instruktion), so werde ich vernünftigerweise auch nicht die Erwartung haben, sie zukünftig (im nächsten Durchgang) herbeiführen bzw. meiden zu können. Gegenprobe: Der Befund, daß jemand positive/negative Ereignisse, die er beeinflussen zu können meint, nicht zukünftig herbeiführen bzw. meiden zu können erwartet (und umgekehrt), widerspricht der hier unterstellten Definition von »vernünftigem Verhalten«, ist also keine empirische Nichtbestätigung, sondern lediglich kein »Anwendungsfall« oder »Beispiel« des hier implizierten BGMs. Gelernte Hilflosigkeit (Urfassung): Wenn ich permanent die Erfahrung gemacht habe, daß ein aversives Ereignis unabhängig von meinen Aktivitäten auftritt und verschwindet, so werde ich von einem bestimmten Zeitpunkt an vernünftigerweise nicht mehr versuchen, Einfluß auf dieses Ereignis auszuüben - dies auch dann, wenn die früher fehlende Einflußmöglichkeit nunmehr objektiv besteht. Gegenprobe: Das Resultat, daß jemand, der »gelernt« hat, daß er bestimmte Ereignisfolgen nicht beeinflussen kann, nunmehr gerade versucht, sie zu beeinflussen, ist keine empirische Nichtbestätigung, sondern lediglich der Anwendungsfall für ein BGM mit anderen bzw. spezifizierteren Prämissen (s.u.). Selbstwirksamkeits-Erwartungen: Wenn ich gemäß den von Bandura genannten Informationsquellen (1) bisher mit bestimmten Mitteln eine Situation bewältigen konnte, und / oder (2) wahrgenommen habe, daß andere mit den gleichen Mitteln die Situation bewältigen können, und/oder (3) mich jemand verbal davon überzeugen konnte, daß ich mit den und den Mitteln die Situation bewältigen kann, so werde ich angesichts der gleichen oder einer ähnlichen anstehenden Bedrohungssituation vernünftigerweise erwarten, daß ich diese bewältigen kann und diese Erwartung (entsprechende Fähigkeiten und Motivation vorausgesetzt) auch in Handlungen umsetzen. Wenn ich dagegen (4) aktivitätsstörende emotionale Reaktionen bei mir wahrnehme, deren Auftreten ich auch für die künftige Bedrohungssituation antizipieren muß, so werden meine Erwartungen, diese Situation bewältigen zu können, vernünftigerweise weniger hoch und stark ausfallen. Gegenprobe (auszugsweise): Der Befund, daß jemand, der bisher mit gleichen Mitteln eine Situation bewältigen konnte, dies in einer gleichartigen zukünftigen Situation nicht schaffen zu können erwartet, ist keine empirische Falsifikation, sondern ein Beispiel für ein anderes BGM, dessen Prämissen entsprechend zu spezifizieren wären. Die empirische Prüfbarkeit der Selbstwirksamkeits-Theorie ist auch von Smedslund, in seinem Artikel »Bandura‘s theory of self-efficacy: A set of common sense theorems« (1978a) angezweifelt worden. Smedslund übersetzt in dieser Arbeit - gemäß seiner früher, S. 32, dargestellten Auffassung von psychologischen Theorien als Explikationen logisch notwendiger Beziehungen in Alltagstheorien - wesentliche Annahmen der Selbstwirksamkeits-Theorie in alltagssprachliche Statements und versucht auf diesem Wege nachzuweisen, daß diese keinen empirischen Gehalt haben, sondern lediglich begriffliche Implikationen darstellen. Er kommt dabei zu überzeugenden »Formalisierungen«, die allerdings daran leiden, daß Smedslund (wie dargestellt) nicht bis zur Erfassung des Charakters psychologischer Theorien als Annahmen über Handlungsbegründungen vorgedrungen und so deren implikative Strukturen nicht als Beziehungen zwischen Prämissen, interessenfundierten Intentionen und Handlungsvorsätzen spezifizieren kann. So ist er nicht in der Lage, z.B. Banduras in seiner Replik (l978b) formuliertem Gegenargument, wenn psychologische Theorien auf logisch notwendige Alltagstheoreme zurückgingen, seien die doch gravierenden Unterschiede und Widersprüche verschiedener theoretischer Annahmen mit Bezug auf das gleiche Phänomen unverständlich, etwas entgegenzusetzen und übergeht es entsprechend in seinem »letzten Wort«, 1978b). Tatsächlich ist (wie früher, S.37f dargelegt) das Phänomen der Theorienkonkurrenz keineswegs mit dem »implikativen« BGM-Charakter von Theorien unvereinbar, sondern verweist lediglich darauf, daß in den scheinbar konkurrierenden Theorien implizit unterschiedliche Annahmen über die Prämissen bzw. Intentionen innerhalb des angenommenen Begründungszusammenhangs enthalten sind: Sofern die jeweiligen Prämissen/Intentionen nur hinreichend expliziert und spezi- 26 fiziert werden, löst sich jedoch das scheinbare Konkurrenzverhältnis auf, indem sich herausstellt, daß die Theorien in Wirklichkeit verschiedene BGMs mit unterschiedlichen Anwendungsfällen darstellen, also gar nicht auf derselben Ebene vergleichbar sind. Wenn man nun die hier zu diskutierenden drei Ansätze unter begründungstheoretischen Gesichtspunkten miteinander vergleicht, so deutet sich zunächst an, daß man diese unter einem bestimmten Aspekt als BGMs betrachten kann, in denen vom Subjektstandpunkt typische Situationen von Lernschwierigkeiten angesprochen sind: Im Konzept der »internen/externen Kontrollerwartungen« etwa die Schwierigkeit, daß ich bei der Urteilsbildung über erreichbare Erfolge oder Mißerfolge meines Handelns aus früheren Erfolgen/Mißerfolgen dann nichts lernen kann, wenn ich von der Prämisse ausgehen muß, daß diese Erfolge/Mißerfolge nicht durch mich (Skill-Situation), sondern ohne mein Zutun, etwa durch bloßen Zufall, zustande gekommen sind (Chance-Situation); im Konzept der »gelernten Hilflosigkeit« die Schwierigkeit, daß ich unter der Prämisse, ein aversives Ereignis sei in seinem Auftreten und Verschwinden von meinem Handeln unabhängig, keinen vernünftigen Grund für weitere Kontroll-Versuche mehr sehen mag (»why try?«) und mir so einschlägige Lernmöglichkeiten verbaut hätte; im Konzept der »Selbstwirksamkeits-Erwartungen« schließlich die Schwierigkeit, daß ich - als »Phobiker« - von vornherein von der Prämisse ausgehe, eine bestimmte bedrohliche Situation nicht bewältigen zu können und so erst gar nicht versuchen kann, den Umgang damit zu lernen, etc. - Bei solchen Reformulierungsversuchen stellt sich allerdings gleich heraus, daß die damit angesprochenen Lernschwierigkeiten irgendwie noch unterbestimmt sind, so daß sie weder klar voneinander abgegrenzt werden können noch unter den aus den jeweiligen Ansätzen entnehmbaren Prämissen in ihrer Begründung subjektiv hinreichend zwingend erscheinen. Ein intersubjektiv nachvollziehbarer Aufweis der Eigenart und Besonderheit derartiger typischer Schwierigkeiten würde also vor allem weiteren eine genauere Spezifikation der dabei an gesetzten Prämissen erfordern. Im Hinblick auf das Konzept der »gelernten Hilflosigkeit« läßt sich dies an einem von Wortman & Brehm (1975) stammenden Ansatz zur theoretischen Integration der HilflosigkeitsTheorie mit der Reaktanz-Theorie bis zu einem gewissen Grade veranschaulichen: Aus den beiden Konzepten - so wie sie sind - scheinen zunächst entgegengesetzte »Vorhersagen« über das Verhalten der Versuchspersonen angesichts von »Kontrollverlust« ableitbar: Nach der (von uns bereits früher, S.77f, angesprochenen) Reaktanz-Theorie müßten die Vpn auf Kontrollverlust als »Freiheitsentzug« mit vermehrten Anstrengungen, die Kontrolle wiederzugewinnen, reagieren; gemäß der Theorie der gelernten Hilflosigkeit dagegen wäre als Konsequenz des Kontrollverlustes gerade das Aufgeben weiterer Kontrollversuche, eben »Hilflosigkeit«, zu erwarten (wobei für beide Versionen empirische Evidenz beizubringen ist). Wortman & Brehm versuchen nun diese »at first glance ... opposing predictions« (S.307) dadurch zu überwinden, daß sie für den Reaktanz- und den Hilflosigkeitseffekt unterschiedliche Ausgangsbedingungen setzen, denen gemäß Individuen, die noch erwarten, die verlorene Kontrolle wiedergewinnen zu können, auf den Freiheitsverlust mit »Reaktanz« zu dessen Überwindung antworten, während Individuen, die sich von der Unmöglichkeit, Kontrolle zu erlangen, überzeugt haben, Hilflosigkeit zeigen: »Thus, among individuals who initially expect control, the first few trials of helplessness training should act as a threat to their freedom. They should experience increased motivation to exert control and improved performance should occur. But despite his increased motivation to do so, the individual comes to learn through extended helplessness training that he can not control the outcome. When a person becomes convinced that he cannot control his outcomes, he will stop trying«. Also: »Reactance will precede helplessness for individuals who originally expect control« (S.308). Gemäß diesem integrativen Modell sind nach Wortman & Brehm die genannten widersprüchlichen, teilweise für die Reaktanztheorie und teilweise für die Hilflosigkeitstheorie sprechenden experimentellen Befunde darauf zurückzuführen, daß dabei u.a. die Variablen der Höhe des anfänglichen Kontrollstrebens und der Länge des Hilflosigkeitstrainings nicht identifiziert und erfaßt worden 27 sind; bei Berücksichtung dieser Variablen müßte demnach »vorhersagbar« sein, unter welchen experimentellen Bedingungen »Reaktanz« bzw. »Hilflosig keit« auftritt (wofür denn auch entsprechende Befunde beigebracht werden konnten). Es muß wohl nicht ausführlich dargelegt werden, daß der hier vorgelegte Integrationsversuch tatsächlich einen Fall der (früher, S.37f, prinzipiell auseinandergelegten) Aufhebung scheinbarer Konkurrenz zwischen BGMs durch Prämissenspezifikation darstellt: Unter der Prämisse, daß die verlorene Kontrolle noch zurückgewonnen werden kann, ist die vermehrte Anstrengung in dieser Richtung vernünftig/begründet, unter der Prämisse, daß die zunächst außer Kontrolle geratenen Ereignisse tatsächlich unabhängig von meiner Aktivität eintreten und verschwinden, hingegen das Aufgeben des Kontrollversuchs. Aufgrund dieser Prämissenspezifikation lassen sich dann auch experimentelle Anordnungen herstellen, deren Befunde Anwendungsfälle/Beispiele für die eine bzw. die andere BGM Version sind, so daß der Schein der Konkurrenz des empirischen Geltungsanspruchs verschiedener Theorien aufgehoben ist (vgl. dazu auch Brandtstädter 1982, S.272f). In unserem gegenwärtigen Argumentationszusammenhang relevant ist der Umstand, daß hier von Wortman & Brehm im Bemühen, die Anwendungsvoraussetzungen der beiden Theorien von einander abzugrenzen, die Hilflosigkeitstheorie (als BGM) in ihren Prämissen ein Stück weit über die Originalfassung hinaus spezifiziert worden ist: Es ist damit der »Umschlagspunkt« genauer expliziert, von dem an die Erfahrung der Unbeeinflußbarkeit des Auftretens/Verschwindens aversiver Ereignisse begründetermaßen zu >Hilflosigkeit< führt, nämlich dann, wenn diese Unbeeinflußbarkeits-Erfahrung als Handlungsprämisse stärker geworden ist als die etwa vorher bestehende Überzeugung, die Ereignisse wieder in den Griff bekommen zu können. Mit dieser Präzisierung ist das vorher unklare Verhältnis der Situation der »Hilflosigkeit« zu der Reaktanz-Situation als an derem typischen Begründungsmuster nunmehr verdeutlicht, und somit können für die >Hilflosigkeits<-Problematik Anwendungsfälle aufgesucht oder hergestellt werden, die mit Anwendungsfällen des Reaktanz-BGM nicht mehr kollidieren. Sofern man den BGM-Charakter von Theorien wie den hier zu diskutierenden erkannt hat, ist also auch in diesem Kontext klar, daß die Vereindeutigung des Verhältnisses zwischen Theorien und empirischen Befunden nur durch die Spezifizierung der in den Theorien enthaltenen Prämissen (oder intentionalen Bestimmungen) möglich ist, wobei theoretische Verallgemeinerungen (was später noch genauer darzulegen ist) hier soweit erreichbar sind, wie mit der Spezifik gleichzeitig die »typischen« Bestimmungen einer Begründungskonstellation präziser zu fassen sind. Allerdings ist dies - aufgrund des »nomologischen Selbstmißverständnisses« auch innerhalb der Forschungstraditionen zu den genannten Lernschwierigkeiten keineswegs systematisch realisiert worden (selbst Wortman & Brehm sitzen ja, wie aus der vorstehenden Schilderung hervorgeht, diesem Mißverständnis auf, indem sie die prinzipielle Bedeutung ihrer »prämissenspezifizierenden« Denkbewegung nicht erkennen können, sondern hier eher einen Zufallstreffer erzielt haben). Nachdem wir die drei dargestellten Ansätze unter begründungstheoretischem Aspekt als verschiedene Formen von typischen Lernschwierigkeiten expliziert haben, die zu ihrer präzisen Fassung und Unterscheidung weitergehende Spezifizierungen der ihnen inhärenten Begründungsmuster erfordern würden, stoßen wir nun auf eine damit zusammenhängende weitergehende Frage: Wieweit ist angesichts der Art der jeweiligen Begründungsmuster die Überwindbarkeit der je besonderen Lernschwierigkeiten theoretisch abbildbar? Anders: Wieweit ist die in unserer Konzeption kategorial angelegte Gegründetheit von Handlungsintentionen im Interesse an erweiterter Verfügung über meine Lebensverhältnisse in den geschilderten Theorien über Handlungseinschränkungen durch Lernschwierigkeiten berücksichtigt oder ausgeklammert? Mit der Theorie der internen/externen Kontrollerwartungen ist - wie dargelegt - ausgesagt, daß - sofern das Zustandekommen einer Leistung Bedingungen, die von mir nicht beeinflußt 28 werden können, zugeschrieben wird (externe Kontrollerwartungen) - Erfahrungen über bisherige Erfolge oder Mißerfolge die Erwartung des Erfolgs/Mißerfolgs bei der Bewältigung der nächsten Aufgabe vergleichsweise weniger verändern. Darauf bezieht sich die Feststellung von Phares, daß unter solchen Umständen Individuen »learn a great deal less, and this decrement in learning seems directly attributable to the effects on expectancy of a belief that, in a given situation, they do not control the relationship between behavior and reinforcement« (1976, S.30, Hervorh. geändert/K.H.). Von da aus erscheint die Frage nach der Überwindbarkeit der hier vorliegenden Schwierigkeiten zunächst einfach zu beantworten: Mittels der Ersetzung der externen durch interne Kontrollerwartungen, womit nunmehr frühere Erfolgs/Mißerfolgserfahrungen in höherem Maße auf die Erwartungsbildung hinsichtlich des Erfolgs bei der nächsten Aufgabe durchschlagen, also in diesem Sinne »Lernen« stattfindet. Dabei ergibt sich aber in begründungstheoretischer Sicht sogleich eine erste Komplikation: Auf welche Weise soll das Subjekt selbst eigentlich den Übergang von externer zu interner Kontrollerwartung vollziehen können? Im Experiment wird dies den Vpn ja durch den Wechsel etwa von der »Chance«- zur »Skill«-Instruktion, also von außen, nahegelegt. Das Problem, ob und wie die Individuen durch eigene kognitive Aktivitäten zu »internen« Kontrollerwartungen gelangen und so ihr Erwartungs-Lernen befördern können, ist im Kontext von Rotters Theorie (soweit ich sehe) nicht einmal formulierbar. Bei genauerem Hinsehen stößt man im Zuge des begründungstheoretischen Reinterpretationsversuchs hier jedoch noch auf eine weitere Schwierigkeit, aus der sich besonders weitreichende prinzipielle Konsequenzen ergeben. Dabei wird nämlich deutlich, daß die hier aufgewiesene Lernschwierigkeit genau genommen auch durch das Lernen auf der Grundlage interner Kontrollerwartungen nicht wirklich überwunden ist, da das Subjekt nach Lage der Dinge weder durch die Übernahme externer noch interner Kontrollerwartungen tatsächlich Aufschluß über seine Möglichkeiten der Problembewältigung gewinnen kann. Besonders prägnant verdeutlicht sich dies aus dem Umstand, daß in den geschilderten Standard-Experimenten (wie dargestellt, vgl. S.95f) die »Chance«- und die »Skill«-Instruktion (aus Gründen methodischer Vergleichbarkeit) den Vpn angesichts der gleichen Aufgabenstellungen (die, wie gesagt, entsprechend unstrukturiert sein müssen) gegeben wird, womit also Einblicke in die inhaltliche Beschaffenheit der Aufgabe als Grundlage der Erwartungsbildung von vornherein ausgeschlossen sind. Offenbar resultiert es schon aus Rotters Definition der »internen/externen Kontrollerwartungen« als besonderer Form »generalisierter Erwartungen« (s.o., S.96), daß man es hier nicht mit »veridikalen«, d.h. realitätshaltigen Urteilen, sondern recht eigentlich mit Überverallgemeinerungen, also Vorurteilen zu tun hat, wobei sowohl die Meinung, bestimmte Aufgabenlösungen entspringen »externen« Faktoren, wie die Meinung, die Lösung der Aufgabe hänge von einem selbst ab, in diesem Sinne sachlich unbegründet, also »vorurteilshaft« ist. Aus alldem ergibt sich nun aber die Konsequenz, daß die hier zur Frage stehenden Lernschwierigkeiten nicht durch einen Wechsel der Kontrollerwartungen, sondern nur dadurch überwindbar ist, daß man im Lernen die Alternative externe vs. interne Kontrollerwartungen überwindet, also über die Ebene solcher »generalisierter Erwartungen« als »Vorurteilen« im Ganzen hinausgelangt. Wie derartige Lernaktivitäten zur Durchdringung von Vorurteilen hinsichtlich der subjektiven Bewältigbarkeit von Aufgaben theoretisch zu bestimmen wären, darüber findet sich naturgemäß im Rahmen der Rotterschen Theorie kein Hinweis, so daß es hier auch nichts begründungstheoretisch zu reinterpretieren gibt (s.u.). Auch die Theorie der »gelernten Hilflosigkeit« (in ihrer Urfassung), als Begründungsmuster einer Lernschwierigkeit verstanden, krankt zunächst an der gleichen Problematik wie die Rottersche Theorie: Der Übergang vom Zustand der »Hilflosigkeit« zu dem der »Nichthilflosigkeit« ist an den Übergang von der Erfahrung der Nichtkontrollierbarkeit zur Erfahrung der Kontrollierbarkeit des Auftauchens und Verschwindens aversiver Ereignisse gebunden. Damit ist die Vp hier zwar nicht von der Instruktion des Vl abhängig, aber davon, wieweit von diesem im Experiment andere Bedingungen, nämlich jene der »Kontingenz« zwischen eigenem 29 Verhalten und aversiven Ereignissen, hergestellt werden. Die Frage, auf welche Weise das Subjekt selbst einen solchen Übergang vollziehen und damit die »Hilflosigkeit« durch eigene Lernaktivitäten überwinden könnte, bleibt auch in diesem theoretischen Kontext unklärbar. Weiterhin ist - wie früher dargestellt - auch die »gelernte Hilflosigkeit« als »generalisierte Erwartung«, also »Vorurteil« zu betrachten, wobei dies - anders als in Rotters Konzept - allerdings in der Hilflosigkeitstheorie als explizite Bestimmung enthalten ist, indem hervorgehoben wird, daß aufgrund der »Hilflosigkeit« vom Individuum Möglichkeiten des Entkommens aus der aversiven Situation, obwohl objektiv vorhanden, nicht aus genutzt werden können. Jedoch lassen sich offenbar auch daraus keine theoretischen Gesichtspunkte darüber ableiten, wie das Individuum lernenden Zugang zu diesen objektiven Möglichkeiten erlangen und so die Ebene des Hilflosigkeits-Vorurteils durchdringen könnte: Aus dem vorgängigen »Hilflosigkeits-Training« kann (sofern dies hinreichend lange durchgeführt wurde) das Subjekt mangels anderer Realitätsaufschlüsse nur zu der Konsequenz gelangen, daß hier »nichts zu machen« und jeder weitere Versuch unvernünftig ist. Die Änderung der Versuchsanordnung in der Testphase, wodurch jetzt vorher nicht gegebene objektive Entkommensmöglichkeiten bestehen, ist zwar dem Experimentator bekannt, aber der Vp nach effektivem Hilflosigkeitstraining notwendig unzugänglich: Diese Chance kann für sie nicht zur subjektiven Realität werden, womit die Feststellung, bei Hilflosigkeit würden gegebene Möglichkeiten nicht ausgenutzt, eigentlich an der Sache vorbei geht. Vielmehr könnte die Vp hier paradoxerweise nur hinter die neue Fluchtmöglichkeit kommen, soweit sie aus dem Hilflosigkeitstraining nichts »gelernt« hätte, nämlich trotzdem gelegentlich »probieren« würde, ob die ursprüngliche Unkontrollierbarkeit der aversiven Ereignisfolge noch besteht. Wie aber eine solche Distanzierung vom vorgängigen »Erwartungslernen« als Voraussetzung für die Überwindbarkeit der Hilflosigkeit seinerseits »gelernt« werden könnte, ist wiederum im Rahmen der theoretischen Vorstellungen, diesmal der Seligmanschen Theorie, nicht ausmachbar. Banduras Selbstwirksamkeits-Theorie unterscheidet sich mit Bezug auf das gegenwärtig diskutierte Problem insofern grundsätzlich von den beiden vorher besprochenen Konzeptionen, als hier die Bedingungen, unter denen Selbstwirksamkeits-Erwartungen gefördert und damit die Voraussetzungen zur Bewältigung von furchterregenden Situationen geschaffen werden können - also das Problem der Überwindbarkeit der einschlägigen Lernschwierigkeit - im Mittelpunkt der (klinisch ausgerichteten) Konzeptionen und Experimente steht: Erfahrungen aufgrund direkter Verhaltensausführung, »stellvertretende« Erfahrungen, verbale Überzeugung und Rückschlüsse aus dem eigenen emotionalen Erregungszustand sollen hier ja die Prämissen hergeben, unter denen das Subjekt Gründe für den Handlungsvorsatz haben kann, mit der furchterregenden Situation schrittweise umgehen zu lernen. Allerdings werden auch hier die verschiedenen »Informationsquellen« als Prämissen der Erwartungsänderung den Vpn durch den Experimentator zur Verfügung gestellt: Die Frage, wie die Individuen im Zuge ihrer eigenen Lernaktivitäten sich derartige Informationen zugänglich machen können (d.h. auch, warum sie dies bisher nicht getan haben) bleibt wiederum theoretisch ungeklärt. Wieweit aber sind (abgesehen davon) in der Selbstwirksamkeits-Theorie Konzepte enthalten, mit denen die prinzipielle Überwindbarkeit der zur Frage stehenden Lernbehinderung verständlich zu machen ist, und wieweit sind auch hier nur Veränderungen innerhalb einer bestimmten Ebene von Lernschwierigkeiten konzeptualisierbar? Dies ist mit Bezug auf die Standard-Untersuchungen zur Selbstwirksamkeits-Theorie schwerer zu beantworten als im Kontext der Experimente zu Rotters und Seligmans Theorie, und zwar deswegen, weil hier die Lernbehinderung nicht (per Instruktion, durch Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit aversiver Ereignisfolgen etc.) im Experiment herbeigeführt, sondern durch die Auswahl von Phobikern quasi »fertig« in die Versuchsanordnung hineingetragen wurde, wobei über die außerexperimentellen Lernprozesse, die zu den Phobien geführt haben könnten, soweit ich sehe, nirgends etwas ausgesagt ist. So lassen sich die hier implizierten theoretischen Vorstellungen hinsichtlich der Begründungsstruktur der Phobien als typische Lernbehinderungen nur mit 30 Blick auf die im Experiment angesetzten Lernprozesse zur Überwindung der Phobien erschließen: Durch das (über die gestärkten Selbstwirksamkeits-Erwartungen vermittelte) Lernen des Umgangs mit dem gefürchteten Objekt soll auch schon die Phobie als Lern- bzw. Lebensproblem zu beseitigen sein. Hier wird also nach verhaltenstherapeutischer Manier das Symptom der psychischen Schwierigkeiten mit diesen selbst gleichgesetzt. Das heißt aber, daß die Konzepte der Selbstwirksamkeits-Theorie die Überwindbarkeit der einschlägigen Lernbehinderung eben nur unter der Voraussetzung verständlich machen können, daß diese tatsächlich nur durch diejenigen Lern- bzw. Informationsdefizite gekennzeichnet ist, die in der experimentellen »Behandlung« reduziert wer den sollten. Sofern in den Phobien aber subjektive Lebensschwierigkeiten beschlossen sind, die sich in den phobischen Symptomen nur (in wie immer mystifizierter Form) äußern, aber nicht damit zusammenfallen, ist die Überwindbarkeit der Lernbehinderung gleichbedeutend mit der Bewältigbarkeit der hier zugrundeliegenden Lebensschwierigkeiten, also wiederum anhand der vorfindlichen theoretischen Vorstellungen nicht begründungstheoretisch begreiflich ZU machen. Im Gegenteil: so gesehen könnte das hier konzeptualisierte und in den Experimenten praktizierte bloße »Weglernen« der phobischen Symptome - da damit den Bemühungen um Selbstklärung eine falsche Richtung gewiesen und zudem der Ansatzpunkt, von dem aus herausgefunden werden könnte, was »wirklich dahinter steckt«, beseitigt wird - eher das Verkennen als das Erkennen der in den Phobien verkapselten Lebensproblematik fördern. (Bandura selbst hat allerdings in seinem Konzept des »reziproken Determinismus« die Beschränkungen seiner »Selbstwirksamkeitstheorie« schrittweise aufzuheben versucht, vgl. 1977b/1979, 1978a, 1981 und 1986, wobei er jedoch, soweit ich sehe, zu lerntheoretischen Konkretisierungen dieses kategorial erweiterten Ansatzes bisher kaum gekommen ist.) Als Resultat unserer Diskussion der Theorie der »internen-externen Kontrollüberzeugungen«, der »gelernten Hilflosigkeit« und der »Selbstwirksamkeit« unter dem Aspekt, wieweit dabei die Überwindbarkeit der implizierten Lernbehinderungen konzeptuell abbildbar ist, können wir zunächst festhalten: In keiner dieser durch das »Selbst«-Konzept erweiterten »Erwartungstheorien« sind begriffliche Möglichkeiten enthalten, um theoretisch verständlich zu machen, daß und in welcher Weise das Subjekt selbst dazu kommen kann, die jeweilige Lernbehinderung durch eigene Lernaktivitäten zu überwinden, d.h. die Bedingungen/Prämissen, unter denen die dargestellten Verkürzungen des Realitätszugangs als einzig verbleibende, also »vernünftige« Urteilsbildung erscheinen, zu verändern (auf prinzipiellere Implikationen und Konsequenzen dieser Beschränkung komme ich noch zurück). Gesamteinschätzung: Realitätsbezug des Subjekts als bloße Sichtweise unter Ausklammerung der Möglichkeit aktiver Welteinwirkung Am Schluß unserer Begründungsanalyse der orthodoxen SR-psychologischen Konditionierungstheorien (in Kap. 2.1) haben wir uns die Frage gestellt, welche Aspekte der bedeutungsvollen Welt sachlich-sozialer Handlungszusammenhänge, aus der die Prämissen für unsere Handlungsbegründungen stammen und in die wir von da aus handelnd hineinwirken, von den so verstandenen Lerntheorien tatsächlich abbildbar sind. Dabei hat sich erwiesen, daß dort nur Grenz- und Sondersituationen des »induktiven« Lernens von »Kontingenzen«, d.h. Regelhaftigkeiten isolierter Gegebenheitszufälle bei rigoros eingeschränkten Handlungsalternativen konzeptuell faßbar werden. Inzwischen haben wir nun die vorfindlichen Versuche kognitiver Erweiterungen der SR-psychologischen Lerntheorien begründungsanalytisch diskutiert. Entsprechend erhebt sich für uns jetzt (am Ende von Kap. 2.2) die Frage, in welchem Maße und in welcher Hinsicht durch solche Erweiterungen die aufgewiesenen theoretischen Restriktionen überwindbar und – über die schon hervorgehobenen begrifflichen Differenzierungsmöglichkeiten zwischen »Lernen« und »Ausführung« bzw. inzidentellem und intentionalem Ler- 31 nen hinaus - neue Perspektiven einer subjektwissenschaftlichen Lerntheorie sichtbar werden. Unter diesem Aspekt sollen zunächst die drei früher begründungstheoretisch reinterpretierten Erweiterungs-Konzepte: Erwartung«, »Modell-Lernen«, »Selbst«, nochmals durchgegangen werden. Im Hinblick auf das Erwartungs-Konzept hatten wir am Ort herausgehoben, daß hier einerseits in der begründungsanalytischen Fassung von »Erwartung« als Urteilsbildung potentiell das subjekthaft-aktive Moment des Lernens heraushebbar gewesen wäre, wobei aber diese Möglichkeit durch die Gleichsetzung von »Erwartung« und (operational bestimmbarer) »Wahrscheinlichkeit« praktisch wieder zurückgenommen wurde. In unserem gegenwärtigen erweiterten Problemzusammenhang ist dem hinzuzufügen, daß durch diese widersprüchliche »Wahrscheinlichkeits«-Fassung des Erwartungskonzeptes dessen lerntheoretischer Erklärungswert wiederum gravierend eingeschränkt und verarmt ist: Um Erwartungen in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken zu können, werden nämlich Einzelereignisse, deren relative Häufigkeit bzw. Übergangswahrscheinlichkeit bestimmbar ist, benötigt. Dies heißt, daß die »Welt« hier wiederum auf Folgen isolierter Gegebenheitszufälle (»Umweltkontingenzen«) reduziert ist. Auf diese Weise ist aber das so verkürzte Erwartungslernen dem induktiven Lernen weitgehend angenähert. #######bedeutet, daß auch das Konzept des Erwartungslernens aufgrund seiner rscheinlichkeitstheoretischen Reduktion (bestenfalls) Lernprozesse in en Grenz- und Sondersituationen des Alltags abzubilden vermag, bei hen die Erfassung von sachlich-sozialen Bedeutungszusammenhängen — m auch immer — unmöglich ist und nur zufällige Ereignisfolgen als ilsgrundlage übrig bleiben. Dabei kann eine derartige Situation begrenz X‘ekaufschlusses wiederum mangels übergreifender Gesichtspunkte nicht Begrenztheit theoretisch identifizierbar werden, sondern wird mit en überhaupt gleichgesetzt. Ei habe dies früher bezüglich des induktiven Lernens als SR-psychologisch faßbarer Drm am Beispiel des Lernens der Funktion des Bremslichtes beim Autofahren veran licht (vgl. S.60f). Hier sei, unter Einbeziehung des Erwartungskonzeptes, darüber angeführt, daß, wenn ich z.B. gelernt habe, per Lichtschalter die Lampe anzu en, dies normalerweise keineswegs als Resultat des Erwerbs von »Erwartungen« auf der Wahrscheinlichkeit, mit der auf das Knipsen das Lichtangehen folgt, also Ler on »Verhaltens-Verhaltensfolge-Kontingenzen« o.L, zu betrachten ist. Vielmehr habe ier den sachlichen Zusammenhang zu verstehen gelernt, daß der Schalter den StromLampe freigibt, so daß - in Abwesenheit von Störbedingungen - bei der Schalter gung die Lampe angehen muß. Ein Rest von Unsicherheit, durch welchen man hier von »Wissen«, sondern nur von »Erwartung« reden kann, ergibt sich lediglich daraus, daß das Vorliegen der Störbedingungen eben nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann: Wenn die Birne oder der Schalter entzwei ist o.ä., kann ich die Lampe nicht mit dem Schal ter zum Leuchten bringen. Sofern ein solcher Fall eintritt, mindert dies aber keinesfalls notwendig meine »Erwartung« in der Weise, daß ich beim nächsten Schaltversuch das An gehen der Lampe für weniger »wahrscheinlich« halten werde. Ich »weiß« jetzt vielmehr (eventuell nach einer kurzen Desorientierungsphase, s.u.), daß - wenn die Störung nicht beseitigt wird — die Lampe nicht einschaltbar sein kann, und werde dies — vernünftiger weise — keineswegs solange immer wieder versuchen, bis die subjektive Wahrscheinlich keit, daß ich das Licht doch noch ankriege, auf Null gesunken ist, sondern statt dessen so fort die Birne auswechseln oder den Elektriker rufen. Aus diesem Beispiel sollte sich verdeutlichen, daß die »erwartungstheoreti sche« Vorstellung von normalen Lernprozessen im Alltag nach Art von Er wartungsbildungen durch Wahrscheinlichkeitsschätzungen genau genom men eine schwerwiegende Fehlorientierung ausdrückt und vermittelt: Man lernt innerhalb der realen Lebenspraxis, soweit möglich, zur Bewältigung der Alltagsprobleme nicht Übergangswahrscheinlichkeiten (bzw. relative Häufig keiten), sondern eben (wie immer verkürzt und unvollkommen) die Er fassung sachlicher bzw. sozialer Bedeutungszusammenhänge. Die Reduzie rung der gelernten Urteile auf »Er- 32 wartungen« heißt dabei nicht das Zurück geworfensein auf bloße Wahrscheinlichkeitsurteile, sondern ergibt sich aus bestimmten Begrenzungen der Einsicht in die jeweiligen sachlichsozialen Bedeutungsstrukturen, führt also nicht einfach zu verringerter Urteilssicher heit, sondern vielmehr zum Versuch, die fehlenden Einsichten doch noch zu erreichen. Wahrscheinlichkeits-Urteile sind dabei zwar nicht ausgeschlossen, finden sich aber eher »in den Falten« der auf die sachlich-soziale Bedeutungs erfassung gerichteten Lernaktivitäten, etwa als vorübergehende Ratlosigkeit (z.B. kurzes zielloses Herumprobieren am Lichtschalter, bis man sich klar ge macht hat: es geht nicht, mal Birne auswechseln o.ä.), oder eben in Grenz situationen extremer Verunsicherung und Orientierungslosigkeit etc. In jedem Falle aber ist »Lernen« hier in seiner Eigenart und Funktion gänzlich verfehlt, wenn man es lediglich als Gewinnung größerer Sicherheit im Rah men von Wahrscheinlichkeitsurteilen bestimmen will: Vielmehr muß es darum gehen, theoretisch verständlich zu machen, wie im Lernen die Ebene bloßer Gegebenheitszufälle/ »Wahrscheinlichkeiten« immer wieder in Rich tung auf die Ebene sachlich-sozialer Zusammenhangseinsicht überschritten werden kann (vgl. unsere späteren Ausführungen über »qualitative Sprünge« im Lernprozeß). Bei der früheren Diskussion des »Modell-Lernens« haben wir aufgewiesen, daß hier zwar im Prinzip mit der Berücksichtigung der intersubjektiven Ver ständlichkeit von Handlungen eine neue begründungstheoretische Theoriene akzentuierbar ist, wobei aber durch das Selbstmißverständnis der »Be igtheit« des Verhaltens der Vpn (im Experiment) die Prämissen der Hand igsgründe des Lernenden, des Modells und der involvierten Dritten weit end unspezifiziert bleiben und so die Daten mehrdeutig und letztlich un :erpretierbar sind. Im Anschluß daran lassen sich im gegenwärtigen Dar llungskontext gewisse charakteristische kategoriale Verkürzungen bei der oretischen Abbildung der typischen Gründe für das Lernen von anderen -deutlichen: Im Konzept des Modell-Lernens wird nämlich (wie geschil rt) prinzipiell davon ausgegangen, daß es lediglich die unmittelbaren Kon iuenzen des Modeliverhaltens für das Verhalten Dritter sind, durch welche Beobachter zur (zunächst implizit gespeicherten und bei entsprechenden rstärkungsbedingungen entäußerten) Angleichung an das Verhalten des )dells bzw. zur Hemmung ähnlicher Verhaltensweisen sich veranlaßt ht. Die Welt des Beobachters besteht also auch in dieser Sicht (wie in den psychologischen Theorien einschließlich ihrer erwartungstheoretischen weiterungen) aus zufälligen Kontingenzen, nur daß diese jetzt nicht nur als ntingenzen für den Beobachter, sondern auch als Kontingenzen für das be achtete Modell gefaßt, also quasi einen Schritt nach außen verlagert sind. anderer Wendung: Auch innerhalb der hier theoretisch konzipierten Ge ntstruktur des Beobachtungs- bzw. Modell-Lernens sind nur (ob nun bst erfahrene oder beobachtete) unmittelbare Reizeinwirkungen auf den ganismus berücksichtigt, die unabhängige Bedeutungstruktur der sachlich ialen Weltzusarnmenhänge, auf die sich die Handlungen/Handlungsgründe dehen, bleibt aber auch hier ausgeklammert. Dies schließt ein, daß auch im Konzept des Modell-Lernens die SR-psytho ische Doktrin von der zwangsläufigen Determiniertheit des Verhaltens rch die gesetzten Bedingungen nicht aufgegeben ist: So meint man, daß die gestellte Modellierungssituation als »Reizkonstellation« automatisch auch entsprechendes (ob nun implizites oder explizites) Verhalten des Beob iters hervorrufen muß, und macht deswegen (obwohl diese hier implizit tgedacht sind) auf der Theorieebene keine »offiziellen« und systematischen igaben über die Begründungsstruktur der Modellsituation und die Grün- aus denen der Beobachter angesichts der gegebenen Prämissenlage sein rhalten an das Modellverhalten angleichen soll. Demgemäß ist auch die thodische Problematik nicht faßbar, woher man in der jeweiligen Ver :hsanordnung eigentlich wissen kann, daß die theoretisch angenommenen riindungszusammenhänge nun auch tatsächlich von den Vpn realisiert rden sind. Diese Kritik läßt sich noch radikalisieren, wenn man die Analyse auf das nzept des ModellLernens als ganzes in seinem Verhältnis zu der Diskursebene 33 subjektiver Handlungsgründe ausweitet. Dabei stellt sich nämlich heraus, daß hier zwar einerseits das herkömmliche SR-psychologische Lernverständ nis durch Einbeziehung der sozialen Dimension des »Lernens von anderen« unter kognitiven Aspekten bereichert und differenziert wird, daß dies aber andererseits mit einer charakteristischen, aus der Verhaftetheit in SRpsycho logischen bzw. bedingtheitsanalytischen Vorstellungen resultierenden Pro blemverkürzung geschieht: Wie schon aus der hier eingeführten Begrifflich keit: »Beobachter«, »Modell« etc., hervorgeht, ist dabei nämlich lediglich ein seitig der mögliche Einfluß des Modells auf den Beobachter berücksichtigt, die Beobachterposition aber auf die passive Außensicht des Modell-Verhal tens reduziert, also die andere Seite des Beobachter-Einflusses auf das Modell ausgeklammert. Damit ist der Beobachter in seinem Bemühen, sich das Ver halten des Modells bzw. des Dritten auf ihre Gründe hin verständlich zu machen, quasi auf sich selbst zurückgeworfen: Er kann sich nur »innerlich« die Frage stellen, warum dieser oder jener dies oder das tun mag, aber er kann nicht die (meist auch nur im Film o.ä. gezeigten) Referenzpersonen selbst da- nachfragen. Damit ist nicht nur der »Beobachter« systematisch an der Erwei terung des für den Prozeß der lernenden Urteilsbildung relevanten Realitäts aufschlusses gehindert, sondern der intersubjektive Beziehungsmodus menschlichen Handelns kategorial verfehlt, damit auf theoretischer Ebene das interpersonale Frage- und Antwortspiel mit der Möglichkeit wechselseiti ger Rückfragen, damit auch die Perspektive des fragenden Lernens suspen diert (s.u.). Bei der begründungsanalytischen Diskussion des »Selbst«-Konzeptes haben wir früher am Beispiel von Rotters Theorie der gelernten Hilflosigkeit und Banduras Theorie der Selbstwirksamkeit - nachdem diese als Konzepte typi scher Lernschwierigkeiten bei unzulänglicher Prämissenspezifikation expli ziert worden waren - herausgehoben, daß - obwohl hier der Standpunkt des Subjekts in gewisser Weise thematisiert wird — die subjekthaft-aktive Über windbarkeit der jeweiligen Behinderungssituationen dennoch nicht theore tisch abbildbar, also die hier thematisierte besondere Form von Erwartungs lernen letztlich nur als Lernen von Realitätsverkennungen, »Vorurteilen«, o.ä. faßbar wird. Der prinzipiellere Grund für diese theoretischen Beschränkun gen liegt (wie wir im gegenwärtigen Diskussionskontext hinzufügen) offen sichtlich auch hier in der nicht überwundenen Verhaftetheit im SR-psycholo gischen Kontingenz-Denken. Demgemäß sind die dabei angesprochenen Er wartungsänderungen - über welche »kognitiven« Zwischenstationen auch im mer - letztlich nur aus Anderungen von Umwelt-Kontingenzen erklärlich zu machen, die in der Regel von dritter Seite hergestellt worden sein müssen, da mit es zur Anderung der Erwartungen kommen kann. Begründungstheoretisch bedeutet dies: In der Sicht solcher Theorien ist das Subjekt den Beding gen/Prämissen, unter denen es begründet nur zu Lernprozessen mit dem Resultat der Vorurteilsbildung, der Hilflosigkeit, der objektspezifischen Furcht etc. kommen kann, ausgeliefert: Hier führt aus eigener Aktivität, also ohne fremdgesetzte Bedingungsänderungen, kein Weg hinaus. Aus dem gleichen Zusammenhang versteht sich eine zweite prinzipielle Beschränkung der diskutierten »Selbst«-Theorien: Die Überwindung der je weiligen Lernbehinderungen - und sei es mittels außengesetzter Bedingungs-/ Prämissenänderungen — ist hier nur soweit konzeptualisierbar, wie dabei die gleiche Art von Lernprozessen unterstellt werden kann, die auch zur Ent stehung der Lernschwierigkeit geführt haben, nämlich das Erwartungslernen als induktive Urteilsbildung, d.h. Fortschreibung von zufälligen Kontingen zen innerhalb erfahrener Ereignisfolgen bei der Einschätzung zukünftiger Ereignisse: Rotter hat seinen Erwartungs-Begriff (wie dargestellt) explizit der gestalt wahrscheinlichkeitstheoretisch definiert; entsprechend sind die Er wartungsänderungen oder deren Ausbleiben aufgrund interner bzw. externer Kontrollüberzeugungen als induktive Verallgemeinerungen der (vermeint lieb) bisher selbst herbeigeführten bzw. nur zufällig eingetretenen Erfolge/ Mißerfolge mit Bezug auf den nächsten Versuch der Aufgabenlösung zu be trachten. Die »gelernte Hilflosigkeit« beeinhaltet nichts weiter als den induk tiven Schluß: Weil bisher nichts zu machen war, wird auch jetzt 34 nichts zu machen sein. Und auch in Banduras »Informationsquellen« für die Ande rung der Selbstwirksamkeits-Erwartungen ist (wenn auch vermittelter) im wesentlichen die induktive Verallgemeinerung früherer (eigener oder fremder) Erfahrungen bei der Einschätzung der eigenen Wirksamkeit angesprochen. Wenn nun aber (was in Rotters und Seligmans Theorie offensichtlich ist und bei Banduras Theorie angenommen werden kann) die jeweiligen Lernschwie rigkeiten selbst als Resultate des induktiven Erwartungslernens aufzufassen sind, so kann bei einer Konzeptualisierung der Lernprozesse zur Überwind barkeit dieser Schwierigkeiten nicht wiederum die gleiche Art des induktiven Erwartungslernens angesetzt werden. Um dies zuzuspitzen: Da es gerade die früher herausgehobenen) Beschränkungen der induktiven Urteilsbildung sind, aus denen hier die Verkürzungen des Realitätszugangs herrühren, kön nen die Lernaktivitäten in Richtung auf eine Aufhebung solcher Verkürzun gen nicht wiederum als Prozesse induktiver Urteilsbildung gefaßt werden. Viel mehr müßte man hier über theoretische Mittel zur Konzeptualisierung von Lernaktivitäten verfügen, in welchen eine neue Ebene der Urteilsbildung über Jie sachlich unfundierten, bloß induktiven Urteile (vgl. S. 58J) hinaus erreicht werden kann (vgl. dazu wiederum unsere späteren Ausführungen über quali :ative Lernsprünge). Derartige Denkmittel sind aber in den durch das Kontin enzKonzept gesetzten theoretischen Schranken der hier diskutierten Theorien nicht zu entwickeln. So sehen wir uns vor dem merkwürdigen Umstand, daß angesichts der geschilderten Lernbehinderungen in solchen Theorien Lern- prozesse offensichtlich nur als Verkürzung, nicht aber als Aufschlüsseiung des Realitätszugangs durch die Lernenden konzeptualisierbar sind. Daraus verdeutlicht sich auf kategorialer Ebene, welchen Beschränkungen das in die diskutierten Erwartungstheorien einbezogene »Sei bst«-Konzept auf grund der benannten, nicht hinterfragten SR-theoretischen Rahmenbestim mungen unterliegt: Die Mächtigkeit des Subjekts als Ursprungs seiner eige nen Handlungen ist hier zurückgestutzt auf die subjektive Veränderbarkeit von Erwartungen hinsichtlich dieser Mächtigkeit. Dabei werden - minde stens in Rotters und Seligmans Theorie — implizit die »subjektiven« Erwar tungen als Verkennungen der wirklichen Sachverhalte aufgefaßt, also das »Subjektive« mit dem »Objektiven« in Gegensatz gebracht. Aber auch bei Bandura geht es in diesem Kontext nicht um »Selbstwirksamkeit«, sondern lediglich um »Selbstwirksamkeits-Erwartungen«. In jedem Falle also wird Subjektivität als bloße Sichtweise des Individuums von dessen wirklichen, realitätsverändernden Handlungen abgekoppelt. Aufgrund der damit abgeschlossenen Diskussion der verschiedenen An sätze zur kognitiven Erweiterung der SR-psychologischen Lerntheorien ver deutlicht sich, daß offenbar der psychologiegeschichtliche Kompromiß- charakter solcher Erweiterungsversuche selbst — Zugeständnisse an die Kogni tive Psychologie ohne Aufgeben der eigenen SR-theoretischen Grundposi tion - wirkliche konzeptuelle Neuorientierungen verhindert: Da »S« und »R« als kategoriale Rahmenbestimmungen hier unangetastet bleiben, können nämlich die einbezogenen kognitiven Konzepte gar keinen anderen Charak ter haben als den von »Zwischenvariabien«, die zwischen 5 und R eingescho ben sind. Es handelt sich hier mithin um eine — wenn auch exzessive — begriff liche Ausgestaltung der »Black Box«, deren Relation zur Welt und zu menschlichem Handeln (damit auch empirische Verankerung) mithin im mer noch als lediglich über »Reize« und »Reaktionen« vermittelt denkbar ist. Die außendeterministische und assoziationistische Grundlage der SR-Theo rien bleibt also erhalten. Dies impliziert auf der einen Seite, daß die kognitiven Konzepte, in denen doch eigentlich Möglichkeiten und Dimensionen menschlicher Welterkennt nis abbildbar sein müßten — indem sie nur als über »Reizkonstellationen« mit der Welt in Kontakt stehend vorgestellt werden können — auf eigentümliche Weise »in sich« zurückgebogen und auf von der Weitbeziehung abgehobene, biof? »innerliche« Prozesse verwiesen sind: Statt des kognitiven Zugriffi auf die sachlich-sozial bedeutungsvolle Welt bloße realitätsentbundene »Erwartungen«, Desorientierungen, Vorurteile o.ä.. Auf der anderen Seite bedeutet dies, daß 35 [ Ergebnisse kognitiver Urteilsprozesse hier immer nur als in »Reaktionen« Lmsetzbar erscheinen, wobei diese aber per definitionem nicht unmittelbar [ die Kognitionen, sondern — mit diesen »vorhersagbar« vermittelt — quasi über deren Kopf hinweg) durch die Reizkonstellation determiniert ge [ werden. So wird menschliche Subjektivität im Prinzip zu einem bloßen piphänomen. Das Subjekt als Ursprung von Handlungen, damit auch als Jrsprung seiner eigenen Lernaktivitäten, ist in diesem theoretischen Rahmen nvorstellbar. Dies schließt ein, daß die Frage nach meinen Lerngründen in hrem Interessenbezug auch hier nicht einmal gestellt werden kann: Das Sich inlassen des Lernsubjekts auf (experimentell oder »technologisch« herge tellte) Zwangslagen als subjektive Scheinbestätigung der bedingungsanalyti chen Doktrin der Außendetermination des Verhaltens wird hier — trotz aller :ognitiven Erweiterungen — nach wie vor als einzige Form menschlichen ernens universalisiert. So stehen wir nunmehr vor der Frage, wieweit die Perspektive einer Über vindung der benannten außendeterministischen Einseitigkeiten, damit der (onzeptualisierbarkeit lernenden Weitzugangs des aktiven Lernsubjekts, ichtbar wird, wenn wir jetzt — jenseits der bloßen Diskussion kognitiv er veiterter SR-Theorien - die Kognitive Psychologie als den »Hegemon« der poche selbst in die Analyse einbeziehen. Wieweit also sind die aus der be ;ründungstheoretischen Reinterpretation vorfindlicher Ansätze gewonne Gesichtspunkte einer subjektwissenschaftlichen Lerntheorie quasi »vom (opf auf die Füße zu stellen«, wenn nun die einschlägigen kognitivistischen rundkonzepte in die Reinterpretationsbemühungen einbezogen werden?