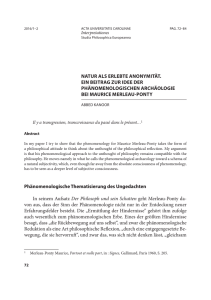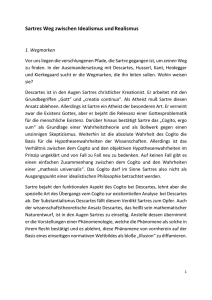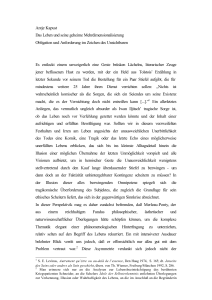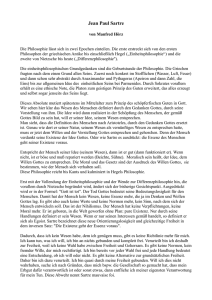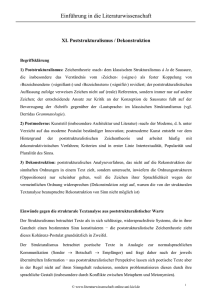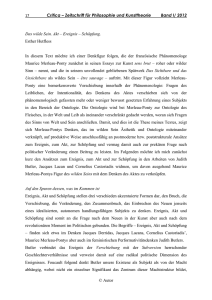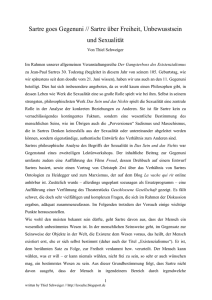Grundlinien der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts
Werbung

Grundlinien der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts Übersichtsreferat anlässlich des Wochenendseminars über die Existenzphilosophie Gabriel Marcels der Vennland-Akademie für philosophische Erwachsenenbildung am 25.-26.06.2011 Dr. Hermann Wehr 1. Einleitung und Übersicht Das folgende Referat steht im Zusammenhang mit dem Seminar über Gabriel Marcel in der Vennland Akademie vom 25.-26. Juni 2011. Es beabsichtigt, einen Überblick über das Denken der französischen Philosophie von Bergson bis zur Postmoderne zu geben als Verständnishilfe und zur besseren Einordnung der Philosophie Marcels in ihren zeitlichen Kontext. Solche im Nachhinein der Philosophiegeschichte auferlegten Strukturen sind natürlich immer der Neigung des menschlichen Geistes nach Ordnung und Systematik geschuldet, die nicht unbedingt das wiedergeben, was geschah, sondern das, was der Interpret heute darunter versteht. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass die Darstellung wegen der beschränkten Zeit kursorischen Charakter hat (vgl. auch die Übersichtsdarstellung im Anhang). Da jede Geschichte eine Vorgeschichte hat, so liegen auch die Wurzeln der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts weiter zurück. Eine dieser Wurzeln, genauer gesagt, ein Stein des Anstoßes zur philosophischen Auseinandersetzung und zur Anregung zum Weiterdenken, geht zurück auf Descartes. So bemerkte beispielsweise Merleau-Ponty in einem Interview aus dem Jahre 1946, dass er und seine Zeitgenossen mit der Frage konfrontiert waren, wie man einen Ausweg aus dem Idealismus finden könne, ohne in die Naivität des Realismus zu verfallen. Diesen Weg, so Merleau-Ponty weiter, hätten Husserl und Heidegger gewiesen (Merleau-Ponty, Parcours I, S.66f.). Unter Idealismus versteht man diejenigen philosophischen Richtungen, die das Subjekt zum Ausgangspunkt der Welterschließung nehmen. Ihr Wegbereiter in der Moderne war Descartes. Sein ego cogito steht im Zentrum des Philosophierens. Es denkt sich selbst und alles das, womit es umgeben ist, z.B. den eigenen Körper, das Andere oder auch Gott. Der Mensch besteht aus einer res cogitans und einer res extensa, aus einem Inneren, Geistigen oder Seelischen und einem Äußeren, Körperlichen. Weltbetrachtung ist für Descartes Subjekt-Objekt-Betrachtung. Bei näherem Hinsehen wirft diese dualistische Sichtweise eine Reihe von Fragen auf, die in der Philosophiegeschichte unter dem Begriff ‚Leib-Seele Probleme’ bekannt wurden und die die Philosophen bis heute zu immer neuen Überlegungen herausfordern. Die Überwindung des cartesianischen Dualismus durch eine angemessenere Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Bewusstsein und Welt ist das große Thema der französischen Philosophie – und nicht nur dieser – bis etwa in die 60iger Jahre des 20. Jahrhunderts. Dieser Herausforderung stellte sich auch Gabriel Marcel (1889-1973), den man zu den frühen französischen Existenzphilosophen zählt. Im Zentrum seines Gegenentwurfs zum Idealismus und Rationalismus stehen die Themenbereiche: die Leiblichkeit, die 1 Beziehung zum anderen ‚Du’ und das Engagement, mit denen er eine Beschreibung menschlicher Existenz unternimmt. Dabei nimmt der Mensch zwei Grundhaltungen ein, die Marcel mit ‚Haben’ und ‚Sein’ bezeichnet. Mit dem ‚Haben’ verfüge ich über Objekte, ich beherrsche sie. Das ‚Sein’ hingegen ist nichts, dem ich gegenüberstehe wie einem äußeren Gegenstand. Ich bin immer schon von ihm betroffen, wie von einem Mysterium. Über das Sein kann ich nicht wie über ein Objekt verfügen. Nur der intellektuellen Intuition erschließt sich die interpersonale Struktur des Wirklichen. Durch sein Schaffen prägt der Mensch die Dinge um sich und bezieht sie in sein Leben ein, sie machen damit ein Teil von dem aus, was er ist. Auf diese Weise ist ein Übergang vom ‚Haben’ zum ‚Sein’ möglich, so Marcel. Während Marcel seine philosophischen Gedanken zeitlich parallel zu, aber unabhängig von Heidegger entwickelte, entstand die Existenzphilosophie Sartres (1905-1980) in der Auseinandersetzung mit Heidegger und Husserl. Im besonderen Maße gilt dies für die phänomenologisch-hermeneutische Philosophie MerleauPontys (1908-1961) und Levinas’ (1905-1995). Überhaupt fand in Frankreich eine intensive Rezeption Husserls und Heideggers statt, die – im Falle Heideggers - weniger stark von Ressentiments geprägt war als im Nachkriegs-Deutschland. Neben Descartes, Husserl und Heidegger gibt es natürlich noch andere Einflüsse auf die französische Philosophie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da ist zum einen Bergson (1859-1941), der sich gegen die Wissenschaftsgläubigkeit des modernen Positivismus wandte, ohne einem reinen Psychologismus anzuhängen. An die Stelle einer physikalischen Erklärung der Zeit setzte er die subjektive Erfahrung der Zeit im kontinuierlichen Wechsel der Phänomene. Im Gegenwartsmoment liegt die kontrahierte Vergangenheit vor, gleichzeitig öffnet sich dieser Moment zur Zukunft hin für das tätige Handeln. Durch eine grundlegende Beschreibung dieses Erfahrungsmoments des unmittelbar Gegebenen glaubte Bergson strenge Wissenschaftlichkeit erreichen zu können. Die Intuition ist die dazu notwendige Methode. Schließlich fügte er dem kontinuierlichen Dahinfließen der Zeit durch den ‚elan vital’ eine Diskontinuität hinzugefügt. Das Dahinfließen gewinnt den Aspekt eines schöpferischen Prozesses. Schöpfung, verstanden als ein stetes Werden von Neuem, ist der eigentliche Charakter der Wirklichkeit. Die schöpferische Lebenskraft ist aber nicht nur dem Menschen gegeben. Das Werden des ganzen Kosmos ist schöpferische Entwicklung aus einer ursprünglichen Einheit. Neben Bergson spielt der Einfluss Maurice Blondels (1861-1949) insofern eine Rolle, als er mit seiner Philosophie Themen und Einsichten der späteren Existenzphilosophie vorwegnahm. Blondels Augenmerk lag auf der konkreten menschlichen Lebenssituation, aus der er die Struktur vorbegrifflicher Handlungszusammenhänge zu entwickeln suchte. Wenn die bislang genannten Philosophen das Streben nach Überwindung des Descartschen Dualismus eint, so muss der Vollständigkeit halber ein Philosoph erwähnt werden, der von diesem Problem wenig tangiert war: Jacques Maritain (1882-1973). Als führender Vertreter des Neuthomismus nimmt er erst gar nicht die 2 descartsche Form des Dualismus zum Ausgangspunkt seines Philosophierens, um ihn alsdann zu überwinden. Maritain erkennt zwar verschiedene Formen begrifflichen und diskursiven Denkens, für ihn ist aber prinzipiell die Intuition der logischen Vernunft vorgeordnet. Metaphysik geht der Erkenntnistheorie voraus. Man kann die Struktur seines eigenen Denkens nur im Lichte einer schon vorausgehenden Erkenntnis untersuchen. Ob die Dinge sich nach unserer Erkenntnis richten oder die Erkenntnis nach dem empirischen Gegenstand, sind falsch gestellte Fragen. Nur weil wir eine intuitive Erkenntnis des Seins besitzen, können wir die Frage nach dem Sein stellen. Insbesondere ist dem Menschen die Erkenntnis ethischer Werte unmittelbar und nicht-begrifflich möglich, ohne dass sie deduktiv oder in einem gesellschaftlichen Diskurs hergeleitet werden müssten. Das Denken der bisher genannten Philosophen existentialistischer, phänomenologischer oder hermeneutischer Richtung ist noch stets anthropozentrisch orientiert, der Mensch ist der Ausgangspunkt allen Betrachtens. Allerdings vollzieht bereits Merleau-Ponty – wie wir noch sehen werden – einen Übergang zu einem dezentrierten Denken, das nicht mehr nach Sinnursprüngen und durchgehenden Sinnzusammenhängen fragt. Bei den beiden anderen großen Denkrichtungen der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, dem Strukturalismus und dem Poststrukturalismus oder der Postmoderne, fällt der Mensch endgültig aus dem Zentrum des Philosophierens heraus. Der Ausgangspunkt des Strukturalismus liegt in der Linguistik, nicht in der Philosophie. Die strukturalistische Methode ist auch nicht mehr humanistisch motiviert, sie artikuliert sich vielfach als ein Antihumanismus. Einer der Begründer des Strukturalismus war der Linguist Ferdinand De Saussure (1857-1913). Seine Untersuchungen kreisten um die Frage: Was ist Sprache? Wie funktioniert sie, was sind sprachliche Tatsachen, welche Bedeutung kommt sprachlichen Ausdrücken zu? Für De Saussure ist Sprache ein System von Zeichen, bei dem die einzelnen Begriffe ihre Bedeutung nicht vermöge eines ausgezeichneten Bezugs auf den Gegenstand erlangen, sondern nur durch die Beziehung auf alle anderen Begriffe oder Elemente im Sprachsystem. Infolgedessen können die einzelnen Begriffe nicht mehr direkt auf Erfahrung bezogen oder aus ihr abgeleitet werden. Nur im Gesamtsystem der Sprache oder allgemeiner ausgedrückt, nur im Rahmen einer Theorie haben einzelne Begriffe ihren Sinn, weil nicht einzelne Begriffe sondern nur ganze Theorien auf die Realität bezogen sind. Für den Strukturalisten geht die Erkenntnis nicht mehr unmittelbar aus der Erfahrung der Realität hervor; sie ist letztlich nur im Rahmen der Theorie begründbar. Die Theorie ist jedoch nur so lange haltbar, wie ihre Hypothesen die Tatsachen richtig beschreiben. Eine Letztbegründung durch etwas Gegebenes kann es für den Strukturalisten nicht geben. Ein anderer Vertreter dieser Denkrichtung war der unlängst verstorbene C. Lévi-Strauss (1908 - 2005). Er übertrug die strukturale Methode der Linguistik auf die Anthropologie und die Ethnologie. So behauptete LéviStrauss bei seiner strukturalen Analyse von Verwandtschaftsbeziehungen, dass diese Beziehungen weder durch Abstammung noch durch objektive Bindungen begründet sind; sie sind reine Geltungsbeziehungen. 3 Sie stellen einen Symbolismus dar, der nicht durch sachliche Umstände begründet wird. Der Begriff der sozialen Struktur bezieht sich nicht auf die empirische Wirklichkeit, sondern auf die nach jener Wirklichkeit konstruierten Modelle. Ein universelles Strukturprinzip ist, so Lévi-Strauss, der Tausch. Das Inzestverbot als ursprünglich kulturelle Tatsache begründet die Regel des Frauentauschs sowie weitere Formen des Tauschs bis hin zu den gesellschaftlichen Gebräuchen, Sitten, Gesetzen und Institutionen. Die Ausdrucksformen von Kultur nehmen die Form einer Sprache an, deren Struktur einer syntaktischen Ordnung folgt. Beim späten Lévi-Strauss ist es aber nicht der autonome und freie Mensch, der diese Strukturen entwirft, es sind vielmehr die Strukturen, die sich durch den Menschen zum Ausdruck bringen. Ein weiterer Vertreter des französischen Strukturalismus ist der in Deutschland wenig bekannte Michel Serres (geb. 1930). Serres geht von einem mathematischen Strukturbegriff aus, wie er ursprünglich von der sog. Bourbaki-Gruppe definiert wurde, die eine Neubegründung der Mathematik rein auf der Basis von Strukturen (Stichwort: „Mengenlehre“) zu erreichen suchte. Eine derartige strukturalistische Analyse beschäftigt sich nicht mehr mit Sinn-Ursprüngen sondern nur noch mit dem Aufzeigen und Analysieren von Sinnverschiebungen. Diese allgemeinen Bemerkungen sollen an dieser Stelle genügen, da in einem nachfolgenden Kapitel noch etwas genauer auf Serres eingegangen wird. Einen Schritt weiter als die Strukturalisten gehen die sog. Poststrukturalisten oder Postmodernisten. Sie wenden die strukturalistische Methode nicht nur auf die menschlichen Verhältnisse an, sondern auf das, was man das Innere oder die Seele des Menschen nennt, zum Zwecke der „Dekomposition“. Eine genaue Grenzziehung zwischen Strukturalisten und Poststrukturalisten ist jedoch weder immer möglich noch hilfreich. Bei dem Stichwort Poststrukturalismus (oder Postmoderne; beide Begriffe werden oft synonym gebraucht) fallen typischerweise Namen wie: Foucault (1926-1984), Deleuze (1924-1995), Derrida (1930-2004), Lyotard (1924-1998). Während die philosophische Generation vor ihnen, die die französischen Existentialisten und Phänomenologen hervorbrachte, von Husserl und Heidegger geprägt war, griffen die Postmodernisten insbesondere Denkansätze von Nietzsche und Freud auf. In den folgenden Kapitel werden die philosophischen Kerngedanken von Sartre, Merleau-Ponty und Levinas anhand von Textbeispielen etwas genauer vorgestellt, weil sie als Zeitgenossen Marcels „konkurrierende“ Ansätze für die Erklärung des Bezugs Mensch-Welt wählen, dabei aber an dem gemeinsamen Ziel festhalten, diesen Bezug (mehr oder weniger) von Grund auf zu erklären. Diesen Zielanspruch erhebt die nächste Generation französischer Philosophen nicht mehr, wie nachfolgend auf der Basis von Schriften und Textbeispielen von Serres, Derrida, Deleuze/Guattari und Lyotard gezeigt wird. Da aber die französische Philosophie des 20. Jahrhunderts ohne Kenntnisse der Philosophie Husserls und Heideggers nicht verstanden werden kann, erfolgt zunächst eine Zusammenfassung der Grundgedanken dieser beiden Philosophen, bevor auf die französischen Philosophen übergegangen wird. 4 2. Husserl (1859-1938) – oder: zu den Sachen selbst! Einen Überblick über seine Philosophie gibt der späte Husserl in seinen „Cartesianischen Meditationen“ (CM). Sie gehen zurück auf Vorlesungen, die Husserl nach seiner Emeritierung 1928 an der Sorbonne gehalten hat. Ihr Titel ist eine unverhohlene Anspielung auf Descartes. Nach Husserl ist es das grundlegende Ziel des Philosophierens, „ [...] die Vorkommnisse des weltzugewandten Lebens [sind] rein von allen Mitmeinungen und Vormeinungen des Betrachters der Beschreibung zugänglich zu machen“ (CM, §15). Husserl beabsichtigt nicht mehr und nicht weniger, als den kantischen Formalismus der Kategorienlehre, der den Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand seiner Meinung nach nicht wirklich überwunden hatte, durch ein Verfahren zu ersetzen, welches „in der Evidenz die Sache als „sie selbst“ offenbart (vgl. CM, §4). Er will zurück zu einer Erfahrung vor jeder Interpretation. „Zu den Sachen selbst“, lautet Husserls Aufruf. Gegenstandsbezug ist aber immer nur durch die Intentionalität des Bewusstseins möglich. Die Dinge sind immer Korrelate des Bewusstseins. Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Da uns also die reale Welt nur durch unser Bewusstsein gegeben ist, gilt es, die grundlegenden Strukturen unseres Bewusstseins zu entdecken, und damit die Schemata, nach welchen Sinneseindrücke gegenständlich geordnet werden. Ein wichtiger Begriff ist Husserls ‚epoché’: Durch Urteilsenthaltung oder Ausklammerung der „natürlichen“ Einstellung des Menschen, d.h. aller Vormeinungen und Vorurteile, soll das Wesen der empirischen Realität zur Anschauung gebracht werden (vgl. CM, §8). Durch freie Variation der möglichen und grundlegenden Ordnungsstrukturen für den Gegenstand soll das Invariante als das zugrundeliegende Charakteristikum erfasst werden. Genau dieses ermöglicht die Identifikation der erfahrbaren Gegenstände. Diese Vorgehensweise nennt Husserl „eidetische Reduktion“ (vgl. CM, §34). Ihr fügt er noch die transzendentale Reduktion hinzu. Hierbei wird von jeglicher Wahrnehmung abgesehen, alle Annahmen über Seinsweisen werden aufgehoben, es wird sich im Urteil lediglich auf die unmittelbar gegebenen Bewusstseinsinhalte, auf „reine Phänomene“ beschränkt. Damit will Husserl alles Faktische und damit Zufällige in der Subjektivität ausschalten. Was übrig bleibt ist der nicht-gegenständliche Bereich der Bewusstseinszustände, die Wirklichkeitsphänomene präsentieren, nicht aber die Welt als Wirklichkeit (vgl. CM, §13 sowie §14 und §15. Da das Gegenständliche ausgeschaltet ist, gelingt es auf systematische Weise, die Tiefen des Bewusstseins zum Vorschein zu bringen, so Husserl. Durch die Beschränkung auf „reine Phänomene“ will er die Phänomenologie als strenge Wissenschaft etablieren. Ein großes Problem einer solchen intellektualistischen und extrem subjektbezogenen Philosophie ist die Erklärung des Bezugs des einzelnen Subjekts zum Anderen. Ihr wird deshalb auch der Vorwurf des Solipsismus gemacht. Husserl hat das Problem selbst erkannt und in seiner Spätphilosophie zu lösen versucht. Die Problemstellung formuliert er in seiner fünften Meditation folgendermaßen: 5 „Wenn ich, das meditierende Ich, mich durch die phänomenologische epoché auf mein absolutes transzendentales Ego reduziere, bin ich dann nicht zum solus ipse geworden, und bleibe ich es nicht, solange ich unter dem Titel Phänomenologie konsequente Selbstauslegung betreibe?“ (CM, §42) Die Lösung des Problems stellt sich Husserl folgendermaßen vor: Das Ego muss in seiner Eigenheit Fremdes konstituieren können. Durch Ausschaltung jeglicher auf Fremdes bezogenen Bewusstseinsweisen soll zunächst die „Eigenheitssphäre des Ego“ enthüllt werden. Husserl betont, dass bei dieser Abstraktion die Erfahrung der Lebenswelt, die das Ich ja erst konstituiert, nicht ausgeblendet wird. Das Ich ist konstituiert als Glied der Welt und es konstituiert gleichzeitig seine Eigenheitssphäre und die Sphäre des Fremden (vgl. CM, §44). Der Andere gewinnt seine Bedeutung, wenn ich ihn mir bewusst gemacht habe, aber gleichzeitig gewinne ich mein Ich durch den Umgang mit dem Anderen. Die objektive Welt ist somit ideales Korrelat einer intersubjektiv „vergemeinschafteten“ Erfahrung, die dadurch möglich ist, dass die Einzelsubjekte mit wechselseitig sich entsprechenden konstitutiven Systemen ausgestattet sind (vgl. CM, §49). Husserl spricht von der „Harmonie der Monaden“, der Harmonie zwischen den Einzelkonstitutionen der „Ichen“ in der Welt. Der Andere ist mein alter ego. Nach Husserl sehe ich also im alter ego mein Analogon und interpretiere seine Verhaltensweisen entsprechend den meinigen, die mir ja bewusst sind (vgl. CM, §50, §52). Damit stellt sich aber die folgende Frage: Wenn ich mir den Anderen bewusst machen will, muss ich mir zuerst selbst bewusst sein. Wenn mein Ich zugleich das Resultat meiner Lebenswelt ist, wie kann ich dann meines Ichs bewusst sein, ohne meiner Lebenswelt bewusst zu sein? Hier bahnt sich ein Regress an, den Husserl gesehen hat, den er aber nicht wirklich auflösen konnte. Am Ende der fünften Meditation schreibt er: „Ich muss erst das Eigene als solches auslegen, um zu verstehen, dass im Eigenen auch Nichteigenes Seinssinn bekommt, und zwar als analogisch Appräsentiertes“ (CM, §62) Husserl bleibt seinem System treu und letztlich in ihm gefangen. Die Husserlschen Reduktionen führen immer zum reflektierenden, transzendentalen Ich, nie aus ihm heraus. So sahen es zumindest seine Kritiker, und zu diesen gehörten Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas oder auch Derrida. 3. Heidegger (1889-1976) – oder: die Seinsvergessenheit der klassischen Metaphysik Heidegger radikalisiert die Husserlsche phänomenologische Methode der Ausschaltung von allen kontingenten Vormeinungen insofern, als er die traditionelle Herangehensweise an die Frage des Seins prinzipiell in Frage stellt. Seit Aristoteles stellt die Philosophie die Frage nach dem Sein falsch. Sie fragt nach dem Gegenstand des Seienden und bleibt blind für den eigentlichen Sinn von Sein. Sie versteht nicht den Unterschied zwischen ontisch und ontologisch – Heidegger nennt diesen Unterschied ontologische Differenz. Der Mensch ist aber ein Seiendes, dem es „in seinem Sein um dieses Sein selbst geht“ (Sein und Zeit (SuZ), §4). 6 „Ausarbeitung der Seinsfrage besagt demnach: Durchsichtigmachen eines Seienden – des fragenden – in seinem Sein. Das Fragen dieser Frage ist als Seinsmodus eines Seienden selbst von dem her wesenhaft bestimmt, wonach in ihm gefragt ist – vom Sein. Dieses Seiende, das wir selbst je sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, fassen wir terminologisch als Dasein. Die ausdrückliche und durchsichtige Fragestellung nach dem Sinn von Sein verlangt eine vorgängige angemessene Explikation eines Seienden (Dasein) hinsichtlich seines Seins“ (Heidegger, (SuZ), §2). Heidegger nennt das Sein des Daseins, das der Mensch ist, Existenz. Was der Mensch ist, lässt sich nicht in objektivierender oder transzendentalanalytischer Betrachtung eines Seienden bestimmen. Was der Mensch ist, sind seine Weisen zu sein. Zur Analyse des Seins gelangt man über die Analytik des Daseins. Diese Unternehmung bezeichnet Heidegger als Fundamentalontologie. Sie ist eine existenziale Auslegung des Seins, die allen existenziellen Untersuchungen der Einzelwissenschaften am Seienden vorausgeht und sie fundiert (ebd.). Die Grundfrage der Philosophie ist also nicht, wie die Gegebenheitsweisen von Phänomenen und die ihnen zugrundeliegenden konstituierenden Akte des Bewusstseins streng methodisch auszulegen sind; die Grundfrage ist vielmehr eine hermeneutische, nämlich die nach dem Sinn von Sein. Es geht nicht um ‚WasIst-Fragen’, es geht um Fragen der Art: Was bedeutet es, von etwas zu sagen, es sei? Die Grundverfassung des Daseins des Menschen ist sein „In-der-Welt-Sein“ (vgl. SuZ, §12). Die descartsche Subjekt-Objektspaltung ist das Ergebnis einer künstlichen und sekundären Betrachtungsweise, der eine ursprüngliche Einheit des Seiendem mit seinem Dasein vorausgeht (vgl. SuZ, §13). Da unser Dasein wesentlich ein „In-der-Welt-Sein“ ist, ist jede theoretisch-wissenschaftliche Erklärung der Welt der praktischen Zuordnung zur Welt nachgeordnet. Für den hantierenden Umgang mit der Welt benutzt Heidegger den Begriff des „Besorgens“ (ebd.). Das „zuhandene Zeug“ meiner vertrauten Welt umgibt mich ohne Distanz und unauffällig. Es ist meine mir immer schon erschlossene „Welt“, die den Voraussetzungszusammenhang bildet, in dem das Zeug mir zuhanden sein kann (vgl. SuZ, §15). Neben dem Zeug der Umwelt gibt es aber noch das Mit-Sein mit Anderen. Aber diese Anderen sind nicht erst vorhanden, und dann begegne ich ihnen. Der Bezug des Ichs zum Anderen besteht immer schon als ein praktischer Zusammenhang. Der je schon entdeckten Umwelt des Zeug entspricht eine je schon erschlossene Mitwelt der Anderen. So gesehen gibt es bei Heidegger kein Problem der Intersubjektivität. An die Stelle der gleichsam „weltlosen“ res cogitans des Descartes oder des solus ipse Husserls tritt das Realitätsbewusstsein als „eine Weise des In-der-Welt-Seins“ (vgl. SuZ, §43). Die descartsche Außenweltproblematik reduziert sich für Heidegger auf das Erfassen der exitenzialen Grundphänomene. Die beiden Weisen der Erschlossenheit des Daseins als eines In-derWelt-Seins sind für Heidegger „Befindlichkeit“ und „Verstehen“. Befindlichkeit ist eine Gestimmtheit“, die immer schon gleichursprünglich mit der Bezogenheit auf die Umwelt und das Mit-Sein ist. Sie wird als „Geworfenheit“ erfahren, weil sich das Dasein nie völlig frei entwerfen kann, sondern sich immer schon in einem gegebenen Sinnzusammenhang befindet (vgl. SuZ, §29,30). Das aktivere Moment ist das Existential des Verstehens. „Im Verstehen liegt 7 existenzial die Seinsart des Daseins als Sein-Können“ (SuZ, §31). Der Mensch versteht seine Existenz immer vor dem Hintergrund der sich ihm eröffnenden Möglichkeiten. Der Mensch ist daher das Wesen, dem es in seinem Sein auch um das Seinkönnen geht. Aber dieses Sein ist hineingehalten in das Nichts. Die Grundbefindlichkeit der Angst gibt Zeugnis davon. Nur vor ihrem Hintergrund ist der Zugang zum eigentlichen Sein des Daseins möglich. „Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen, das heißt das Freisein für die Freiheit des Sich-selbst-wählens und –ergreifens“ (SuZ, §40). Letztlich aber, so Heidegger in Sein und Zeit, gründet das für das Sein des Daseins konstitutive Seinsverständnis in der Zeitlichkeit. Das eigentliche Sein zeigt sich im Dasein zum Tode. Im Horizont der Zeit vollzieht sich der Entwurf des Sinns von Sein. In Sein und Zeit ist die Zeitlichkeit der methodisch letzte Offenbarungsraum des Seins (vgl. SuZ, §45-§53). 4. Sartre (1905-1980) – oder: zur Freiheit verurteilt Sartres philosophisches Hauptwerk trägt den Namen „Das Sein und das Nichts“ (SuN), (franz.: L’etre et le Néant), mit dem Untertitel: „Versuch einer phänomenologischen Ontologie“. Es erschien 1943. Teile des Werkes entstanden aber bereits, als Sartre noch in deutscher Gefangenschaft war. Zuvor hatte er die Werke Husserls, Heideggers und Jaspers studiert, mit „Das Sein und das Nichts“ stellt er einen Art Gegenentwurf zu „Sein und Zeit“ vor. Wenn man dieses Werk, ja das ganze Lebenswerk Sartres, das mehr literarische als philosophische Werke umfasst, auf einen Begriff bringen müsste, so würde er lauten: „Freiheit“. L’etre et le Néant ist ein Buch über die Freiheit. Das Erleben des Krieges und der Gefangenschaft wie auch die politisch engagierte Einstellung Sartres als Anhänger des politischen Marxismus mögen daran ihren Anteil haben. Ausgehend von Husserls phänomenologischem Ansatz, dass Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist, fragt Sartre, wie dieser Ansatz verstanden werden kann. Er zeigt zwei Erklärungsmöglichkeiten auf: - Das Bewusstsein ist konstitutiv für das Sein seines Objektes, oder - das Bewusstsein ist Bezug zu einem transzendenten Sein (vgl. SuN, S. 33). Für Sartre ist nur die zweite Erklärungsvariante akzeptabel. Daraus leitet er einen „ontologischen Beweis“ ab für ein bereits existierendes Sein, das außerhalb des Bewusstseins existieren muss, wenn es sich dem Bewusstsein offenbaren kann. In Abwandlung Heideggerscher Terminologie formuliert Sartre: „das Bewusstsein ist ein Sein, dem es in seinem Sein um sein Sein geht, insofern dieses Sein ein Anderessein als es selbst impliziert“ (SuN, S. 37). „Das Sein ist das, was es ist“ (SuN, S. 42). Was bedeutet also Sein für Sartre? Sein ist zunächst das Prinzip einer puren Existenz von Seiendem und nicht mehr wie bei Heidegger die Bedingung der Möglichkeit des sich Offenbarens von Seiendem. Als 8 Gegenpol zu dem so verstandenen Sein setzt Sartre das Nichts. Das pure Sein ist Fülle, Mangellosigkeit. Den Dingen selbst fehlt nichts. Der Mensch jedoch ist das Wesen, das bei seiner Frage nach dem Sein seinen Blick auf das Nichts richtet. Der Mensch fragt nach dem Imaginären, nach dem Erwarteten, Erhofften, Zukünftigen. Das, worauf sich Fragen und Streben des Menschen richten, ist ein Nicht-Sein. Die Frage nach dem Sein offenbart uns, „dass wir von Nichts umgeben sind. Die permanente Möglichkeit des Nichtseins außer uns und in uns bedingt unsere Fragen über das Sein“ (SuN, S. 53). Folgende Passage aus SuN möge verdeutlichen, was Sartre unter Sein und Nichts versteht: „Ich bin um vier Uhr mit Pierre verabredet. Ich komme eine viertel Stunde zu spät: Pierre ist immer pünktlich; hat er auf mich gewartet? Ich sehe mich im Lokal um, sehe mir die Gäste an und sage: „Er ist nicht da“. Ist das eine Intuition der Abwesenheit Pierres, oder tritt die Negation erst mit dem Urteil auf? Auf den ersten Blick erscheint es als absurd, hier von Intuition zu sprechen, weil es eben gerade keine Intuition von nichts geben kann und die Abwesenheit Pierres dieses nichts ist. Aber das populäre Bewusstsein bezeugt diese Intuition. Man sagt zum Beispiel: „Ich habe sofort gesehen, dass er nicht da war“. Handelt es sich um eine bloße Verlagerung der Negation? Sehen wir näher hin. Sicher ist das Café, durch sich selbst, mit seinen Gästen [...] eine Seinsfülle. Und alle Einzelintuitionen, die ich haben kann, sind erfüllt von diesen Gerüchen, Farben, lauter Phänomenen, die ein transphänomenales Sein haben. Ebenso ist die gegenwärtige Anwesenheit Pierres an einem Ort, den ich nicht kenne, auch Seinsfülle. Es scheint so, als fänden wir diese Fülle überall. Aber man muss beachten, dass es in der Wahrnehmung immer Konstituierung einer Form auf einem Hintergrund gibt. Kein Objekt, keine Gruppe von Objekten ist speziell bestimmt, sich als Hintergrund oder als Form zu organisieren.: alles hängt von der Richtung meiner Aufmerksamkeit ab. Wenn ich in dieses Café eintrete, um Pierre zu suchen, bildet sich eine synthetische Organisation aller Gegenstände des Cafés als Hintergrund, auf dem Pierre gegeben ist als der, der erscheinen soll. Und diese Organisation des Cafés ist eine erste Nichtung. Jedes Element des Raums, Person, Tisch, Stuhl, sucht sich zu isolieren, sich von dem durch die Totalität der anderen Gegenstände konstituierten Hintergrund abzuheben und fällt in die Undifferenziertheit dieses Hintergrunds zurück, löst sich in diesem Hintergrund auf. Denn der Hintergrund ist nur das, was nur mitgesehen wird, das Objekt einer bloß marginalen Aufmerksamkeit. So ist diese erste Nichtung aller Formen, die erscheinen und versinken in der totalen Äquivalenz eines Hintergrunds, die notwendige Bedingung für das Erscheinen der Hauptform, die hier Pierre ist. Und diese Nichtung ist meiner Intuition gegeben, ich bin Zeuge des sukzessiven Schwindens aller Gegenstände, die ich betrachte, besonders der gesichter, die mich einen Augenblick festhalten („Ob das Pierre ist?“) und die sich sofort auflösen, eben weil sie Pierres Gesicht „nicht sind“.“ (SuN, S. 59, 60) Sartre unterscheidet ein Sein der Dinge, ein ontisch fundierendes aber nicht transzendentales An-sich und ein Sein für das Bewusstsein, ein Für-sich. Damit stehen sich bei Sartre zwei absolut getrennte Seinsregionen gegenüber, das Sein eines präreflexiven Cogito und das Sein als Phänomen eines Bewusstsein. Das An-sich ist und hat das zu sein, was es ist. Das Für-sich ist aber wesentlich durch seine Möglichkeiten für ein Bewusstsein bestimmt. Das Für-sich ist das Resultat der Aktivität eines Bewusstseins, das seine eigene Ordnung in das Seiende hineinlegt bis zur Nichtung. Sollte Sartre ernsthaft das Ziel gehabt haben, den cartesischen Dualismus zu überwinden, so hat ihn dieser Ansatz dem Ziel nicht näher gebracht. 9 Nun ist zu bedenken, dass es Sartres Grundgedanke ist, dass es nur der Mensch ist, der durch sein bewusstes Fragen dem Nichts Bedeutung verleihen kann. Die Möglichkeit, ein Nichts hervorzubringen, macht die Freiheit des Menschen aus. Es ist sogar eine radikale Freiheit, weil das Sein des Menschen und sein Freisein, das nicht weiter begründet werden kann, gleich ursprünglich sind. Der Mensch schafft sich selbst, indem er wählt. Er kann, ja er muss seinen Lebensentwurf machen. Dabei ist dem Menschen bewusst, dass es sein Entwurf ist. Er kann ihn auch wieder revidieren. Was immer er tut, alles ist begründbar und damit letztlich rechtfertigungslos und absurd. Weil der Mensch ein Freiheitswesen ist, muss er wählen. „Sein ist für das Für-sich das An-sich, das es ist, nichten. Unter diesen Bedingungen kann die Freiheit nichts anderes sein als diese Nichtung. Durch sie entgeht das Für-sich seinem Sein als seinem Wesen; durch sie ist es immer etwas anderes als das, was man von ihm sagen kann, denn zumindest ist es das, was eben dieser Benennung entgeht, was schon jenseits des Namens ist, den man ihm gibt, der Eigenschaft, die man ihm zuerkennt. Dass das Für-sich das zu sein hat, was es ist, dass in ihm die Existenz dem Wesen vorausgeht und dieses bedingt oder dass umgekehrt, nach der Formulierung Hegels, für es „Wesen ist, was gewesen ist“, ist ein und dasselbe, nämlich, dass der Mensch frei ist. Denn allein dadurch, dass ich Bewusstsein von den mein Handeln hervorrufenden Motiven habe, sind diese Motive transzendente Gegenstände für mein Bewusstsein, sind sie draußen; vergeblich werde ich versuchen, mich wieder an sie zu klammern: ich entgehe ihnen durch meine Existenz selbst. Ich bin verurteilt, für immer jenseits meines Wesens zu existieren, jenseits der Antriebe und Motive meiner Handlung: ich bin verurteilt, frei zu sein“. (SuN, S. 763, 764) Sartres Existenzialismus stellt sich dar als eine Philosophie des radikalen Engagements. Eine Ethik im eigentlichen Sinn entwickelt Sartre nicht. Jedoch kann sein Freiheitsgedanke imperativisch verstanden werden. Der Mensch ist zwar frei, etwas zu tun, aber in jeder Situation hat er die Verantwortung, sich zu entscheiden. In SuN entwickelt Sartre die Beziehung zum Anderen nicht unter einem ethischen Gesichtspunkt, sondern im Rahmen einer Analyse des Phänomens des Blicks. Der Andere ist für Sartre derjenige, der mich erblickt. Ich werde gesehen, infolgedessen gibt es den Anderen. Das Erlebnis, das ich habe, wenn ich mich vom Anderen erblickt fühle, geht in mein Selbstverständnis ein. Was ich bin, ist nicht mehr nur das Ergebnis meines freien Entwurfs, sondern auch das Resultat des intersubjektiven Bezugs durch den Blick des Anderen. Ich bin durch den Anderen bestimmt. Der Blick des Anderen kann mich sogar existentiell bedrängen und ein Schamgefühl hervorrufen. Da der Andere ebenso wie ich ein Wesen der Freiheit ist, bin ich also, wenn ich vom Anderen in den Blick genommen werde, Gegenstand für eine andere Freiheit. „Ich werde in einer erblickten Welt erblickt. Insbesondere negiert der Blick des Andern [...] meine Distanzen zu den Objekten und entfaltet seine eigenen Distanzen. Dieser Blick des Andern ist unmittelbar als das gegeben, wodurch die Distanz innerhalb einer distanzlosen Anwesenheit auf die Welt kommt. Ich weiche zurück, ich werde meiner distanzlosen Anwesenheit bei meiner Welt beraubt, und ich werde mit einer Distanz zum Andern ausgestattet [...]. So empfinde ich gerade in der Erfahrung meiner Distanz zu den Dingen und zum Andern die distanzlose Anwesenheit des Andern bei mir. Jeder wird in dieser abstrakten Beschreibung die unmittelbare und brennende Anwesenheit des Blicks des Andern wiedererkennen, die ihn oft mit Scham erfüllt hat. Anders gesagt, insofern ich mich als erblickt erfahre, realisiert sich für mich eine weltjenseitige Anwesenheit des Andern [...]. [...]durch den Blick des Andern mache ich die konkrete 10 Erfahrung, dass es ein Jenseits der Welt gibt. Der Andere ist ohne irgendein Mittelglied bei mir anwesend als eine Transzendenz, die nicht die meine ist.“ (SuN, S. 485, 486) Der Blick des Anderen ist bei Sartre kein liebender Blick, sondern ein ‚Kontrollblick’. Sartres Intersubjektivitätsanalyse ist einseitig und negativ formuliert. „Die Hölle, das sind die Anderen“, so sagt er in ‚Huit Clos’. Das Solipsismusproblem Husserls taucht bei Sartre wieder auf. Ich und die Anderen sind Individuen, zwischen denen das reine Nichts steht. Waldenfels bemerkt zu dieser Philosophie: „Die Sozialität kommt über eine Interindividualität nicht hinaus“ (Waldenfels, S. 95). 5. Merleau-Ponty (1908-1961) – oder: unser immer schon vorhandenes leibliches In-der-Welt-Sein Auch wenn Merleau-Ponty für einige Jahre Weggenosse und politischer Mitstreiter Sartres war, bevor er sich politisch von der kommunistischen Weltanschauung abwandte, so vertrat er doch eine gegenüber Sartre konträre philosophische Position. Merleau-Ponty stört sich an dem extremen Dualismus Sartres, bei dem das Sein als absolute Positivität bestimmt ist, dem das als reines Nichts begriffene Bewusstsein gegenüberstellt wird (vgl. SU, 78). Eine Ontologie, die sich auf das Gegenüber von Sein und Nichts gründet, übersieht jedoch „unser Verwickeltsein mit dem Sein“ (SU, 117). Für Merleau-Ponty steht fest, dass sowohl Descartes als auch Husserl und eben auch Sartre die ursprüngliche Einheit des Seins übersehen haben, welche die Offenheit des Menschen für die Welt erst möglich macht. Zum andern idealisiert Sartre die Freiheitsfähigkeit des Menschen in einer Weise, die unserem leiblichen In-der-Welt-Sein nicht gerecht wird, so Merleau-Ponty. Nicht zur Freiheit ist der Mensch verurteilt, sondern zum Sinn, und zwar zu einem präobjektiven, immer schon vorhandenen Sinn. Wie ist das zu verstehen? Die Überwindung des cartesianischen Dualismus durch eine angemessene Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Bewusstsein und Welt ist das große Thema von Merleau-Pontys Philosophie. Er sucht die Lösung in einer Ontologie des Seins, in der die Polarität von Subjekt und Objekt verschwindet. Die Untersuchung von menschlichem Verhalten und von Wahrnehmung, beschrieben in seinen beiden ersten Werken, „Struktur des Verhaltens“ und „Phänomenologie der Wahrnehmung“ (PdW), scheinen ihm für das Vorhaben besonders aussichtsreich zu sein. In der Wahrnehmung treten Subjekt und Objekt in Kontakt, Wahrnehmung schließt immer beide ein. Für einen Empiristen ist Wahrnehmung ein sinnlicher Vorgang, der durch Reize von außen ausgelöst und aus Empfindungen und Assoziationen weiter aufgebaut wird. Für den Subjektivisten oder Rationalisten stellt sich Wahrnehmung als ein setzender Akt des Verstandes dar. Nach Merleau-Ponty erfassen aber beide Denkrichtungen in ihren Extremen nicht, was Wahrnehmung wirklich 11 bedeutet. Die empiristische Betrachtungsweise behandelt die Welt einschließlich des menschlichen Leibes als natürliche Objekte und die Wahrnehmung als einen Naturvorgang. Der subjektivistische Standpunkt hingegen mündet in den bereits aufgezeigten Dualismus eines objektiven Seins einerseits und eines Seins des reinen Subjekts. Nach Merleau-Ponty muss Wahrnehmung ganz grundsätzlich als unser Zugang zum Wissen über uns, die Anderen und die Dinge angesehen werden. Selbst die wissenschaftliche Erkenntnis nimmt ihren Ausgangspunkt in der Wahrnehmung, denn Wahrnehmung ist Ausgangspunkt und Voraussetzung der Sinnfrage (vgl. PdW, S. 80f.). Deshalb kann Wahrnehmung selbst nicht noch einmal zum Gegenstand der Sinnfrage gemacht werden, jedenfalls nicht aus einer Außenperspektive, die den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. In dieser Form ist Wahrnehmung bereits ein theoretisches Konstrukt, für das es nur verschiedene Auslegungen gibt. Im Vorwort zur „Phänomenologie der Wahrnehmung“ führt Merleau-Ponty aus: „Was immer ich – sei es auch durch die Wissenschaft - weiß von der Welt, weiß ich aus einer Sicht, die die meine ist, bzw. aus einer Welterfahrung, ohne die auch alle Symbole der Wissenschaft nichtssagend blieben oder vielmehr wären. [...] so gilt es allem voran, auf jene Welterfahrung zurückzugehen, deren bloß sekundärer Ausdruck die Wissenschaft bleibt. Nie wird Wissenschaft denselben Seinssinn wie die Erfahrungswelt haben, aus dem einfachen Grund, dass sie deren Bestimmung oder Erklärung ist. Ich bin kein „Lebewesen“, sogar kein „Mensch“, nicht einmal ein „Bewusstsein“ mit Charakteren, die Zoologie, Sozialanatomie und induktive Psychologie diesen „Phänomenen“ und Produkten von Natur und Geschichte zuweisen – ich bin vielmehr absoluter Ursprung, und meine Existenz geht nicht, als aus ihren Antezedenzien, hervor aus meiner physischen und sozialen Umwelt, sie geht vielmehr auf diese hin zu und gibt ihr den Seinsgrund erst; [...] Zurückgehen auf die „Sachen selbst“ heißt zurückgehen auf diese aller Erkenntnis vorausliegende Welt, von der alle Erkenntnis spricht und bezüglich deren alle Bestimmung der Wissenschaft notwendig abstrakt, signitiv, sekundär bleibt, so wie Geographie gegenüber der Landschaft, in der wir allererst lernten, was dergleichen wie Wald, Wiese und Fluss überhaupt ist. [...] Die Welt ist da, vor aller Analyse; jeder Versuch, sie herzuleiten aus Reihen von Synthesen – zuerst der Empfindungen, dann der Wahrnehmungsaspekte des Gegenstandes – bleibt künstlich, da Empfindungen und Erscheinungen selbst erst Produkte der Analyse und nicht dieser zuvor zu realisieren sind. [...] Die Welt ist kein Gegenstand, dessen Konstitutionsgesetz sich zum voraus in meinem Besitz befände, jedoch das natürliche Feld und Milieu all meines Denkens und aller ausdrücklichen Wahrnehmung. Die Wahrheit „bewohnt“ nicht bloß den „inneren Menschen“, vielmehr gibt es keinen inneren Menschen: der Mensch ist zur Welt, er kennt sich allein in der Welt. Gehe ich, alle Dogmen des gemeinen Verstandes wie auch der Wissenschaft hinter mir lassend, zurück auf mich selbst, so ist, was ich finde, nicht eine Heimstätte innerer Wahrheit, sondern ein Subjekt, zugeeignet der Welt“ (PdW, S. 4-7; Fußnoten innerhalb des Textes wurden weggelassen). Merleau-Pontys Phänomenologie lassen sich in fünf Grundgedanken zusammenfassen: 1. Phänomenologie ist Beschreibung vor jeder sekundären Auslegung. „Es gilt zu beschreiben, nicht zu analysieren und zu erklären“ (PdW, S. 4). Diese von Husserl ausgegebene Losung ist auch für Merleau-Pontys Phänomenologie grundlegend. 2. Phänomenologische Reduktion ist aber nicht Rückgang auf ein transzendentales Bewusstsein wie bei Husserl, sondern Aufdeckung einer vortheoretischen Dimension. Die phänomenologische Reduktion hat unser vorgängiges „Zur-Welt-Sein“ aufzudecken vor jeder Deduktion und Interpretation. Da wir selbst Teil der Welt sind, lässt sich diese nie vollständig beschreiben, unser Sichtfeld hat immer einen „blinden Fleck“. Um unser „Zur-Welt-Sein“ im Sinne des Heideggerschen „In-der 12 Welt-seins“ freizulegen, darf der Mensch es nicht zum Gegenstand machen, er kann allerdings über seinen eigenen Seinsvollzug reflektieren. Deshalb kann die philosophische Reduktion nie mit einem abschließenden Ergebnis enden, sie bleibt der Beginn einer Suche, ein fortlaufender Prozess. Es gibt kein Denken, das all unser Denken umfasst, so Merleau-Ponty in Anspielung auf Hegel (vgl. PdW, S. 7-11). 3. Phänomenologische Reduktion ist nicht Wesensschau, sondern Rückführung auf ursprüngliche Wahrnehmung. „Die Welt ist, was wir wahrnehmen“ (PdW, S. 12, 13). Die Wahrnehmung ist unser originärer Zugang zur Welt. Es gilt das Primat der Wahrnehmung. Man kann die Wahrnehmung nicht in einem sekundären Reflexionsprozess nochmals hinterfragen oder begründen wollen. „Dem Wesen der Wahrnehmung nachgehen heißt davon ausgehen, dass Wahrnehmung nicht nur angeblich oder vermeintlich wahr, sondern für uns definiert ist als Zugang zur Wahrheit. […] Die Welt ist nicht, was ich denke, sondern das, was ich lebe, ich bin offen zur Welt, unzweifelhaft kommuniziere ich mit ihr, doch ist sie nicht mein Besitz, sie ist unausschöpfbar“ (PdW, S. 13,14). 4. Intentionalität entspringt nicht einem intentionalen Bewusstsein, sondern einer natürlichen, vorprädikativen Einheit der Welt und unseres Lebens. Es gibt eine „fungierende Intentionalität, in der die natürliche vorprädikative Einheit der Welt und unseres Lebens gründet, die deutlicher als in objektiver Erkenntnis erscheint in unserem Wünschen und Schätzen […]“. Sie liefert erst den Grundtext aller objektiven Erkenntnis. In dieser vorprädikativen Einheit zeigt sich schon Sinn. „Zur Welt seiend, sind wir verurteilt zum Sinn, und nichts können wir tun oder sagen, was in der Geschichte nicht seinen Namen fände“ (PdW, S. 15,16). 5. Es gibt keine vorgegebene Rationalität, sondern Rationalität entsteht im Tun selbst. Die so aufgefasste Phänomenologie führt zwangsläufig zu einer veränderten Vernunftauffassung. Das meditierende Ich, der „uninteressierende Zuschauer Husserls“ hat nicht eine schon gegebene Rationalität aufzufassen, sondern schafft diese Rationalität. „Die phänomenologische Welt ist nicht Auslegung eines vorgängigen Seins, sondern Gründung des Seins; die Philosophie nicht Reflex einer vorgängigen Wahrheit, sondern, der Kunst gleich, Realisierung von Wahrheit. […] Der einzige präexistente Logos ist die Welt nur selbst“ (PdW, 17). Auf diese Weise erhält der Gedanke der Wahrnehmung als unser originärer Zugang zur Welt seine eigentliche Bedeutung. In der Bezugnahme auf Wahrnehmung muss sich unser „Zur-Welt-Sein“ in einer Weise zeigen, in der sich die Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt auflöst und einer Ambiguität unserer leibhaften Erfahrung weicht. Die Schwierigkeiten, in die uns die dualistischen und die empiristischen/naturalistischen Denkrichtungen führen, können nur überwunden werden, so die These Merleau-Pontys, wenn das Subjekt der Wahrnehmung als leibhaft in der Welt Seiendes begriffen wird (vgl. PdW, S. 239, S. 352). Der Leib ist die Bedingung der Möglichkeit, dass dem Menschen die Welt überhaupt begegnen kann. Der Mensch ist aufgrund seines Körpers (corps objectif) als Ding unter Dingen konstituiert. Dieser Körper ist aber nicht bloßer Körper, sondern Leib (corps phénomenal), für den die Welt sowohl sinnlich als auch sinnvoll erfahrbar ist. Durch die Präsenz des Leibes haben wir einen Platz in der Welt, von dem aus wir sehen, den wir aber selbst nicht sehen können. Das Geist-Körper Problem mündet folglich in die Frage nach der Seinsweise des Leibes als eines In-der-Welt-seins. 13 „Als die Welt sehender oder berührender ist so mein Leib niemals imstande, selber gesehen oder berührt zu werden. Weil er das ist, wodurch es Gegenstände überhaupt erst gibt, vermag er selbst nie Gegenstand, niemals „völlig konstituiert“ zu sein“ (ebd. PdW, S. 117). Wir können unser eigenes Sehen nicht sehen. Das Verflochtensein in der Welt bedingt einen nie hintergehbaren „blinden Fleck“. Und doch ist der eigene Leib die Bedingung der Möglichkeit, um überhaupt wahrnehmen zu können, er ist das Medium, in dem sich der Bezug der Wahrnehmung zur Welt vollzieht. Wir müssen unsere Auffassung von der wahrgenommenen Welt „nur“ in Einklang bringen mit einem richtigen Verständnis unseres Leibes als Mittel, um überhaupt eine Welt zu haben, so Merleau-Ponty. Die Einheit der wahrgenommenen Welt und die Identität der wahrgenommenen Objekte ist nur die andere Seite unseres vorreflexiven Bewusstseins unserer leiblichen Identität in jedem Moment des Lebensvollzugs. Die äußere Wahrnehmung und die Wahrnehmung des eigenen Aktes sind zwei Seiten ein und desselben Aktes. So vollzieht sich die Synthese des Gegenstandes im Durchgang durch die Synthese des eigenen Leibes (vgl. ebd. PdW, S. 241). Und so erfahren wir schon unser Sein in der Welt, bevor wir überhaupt den Begriff der äußeren Welt bilden können. Merleau-Pontys Rückgang auf eine vortheoretische Dimension wirft die prinzipielle Frage auf, wie man über eine vorprädikative leibliche Verfasstheit von Wahrnehmung und Denken sprechen kann, wenn uns nur die sprachlichen und reflexiven Mittel zur Verfügung stehen. Steht Merleau-Ponty nicht vor einer prinzipiell unlösbaren Aufgabe? Von einer Ambiguität ausgehend will er erklären, wie Wahrnehmung zu verstehen ist, aber alles, was er sagt, sagt er immer vom Standpunkt eines denkenden Subjekts aus. Wenn die Redeweise von präreflexiven intentionalen Strukturen mehr als Metaphorik sein soll, dann muss Merleau-Ponty zeigen, dass Denken und Sprechen selbst einer präreflexiven leiblichen Verfasstheit entspringen. Andernfalls hätte er nach den bisherigen Ausführungen bestenfalls plausibel gemacht, dass unser Wahrnehmen mit unserem leiblichen In-der-Welt-Sein unauflösbar verbunden ist, er hätte aber keine wirkliche Alternative zur traditionellen Unterscheidung von Leib und Seele, von kausalen und geistigen Vorgängen bei der Erklärung von menschlichem Verhalten anzubieten. Auch Merleau-Ponty hat sich intensiv mit Saussure beschäftigt, mit dem er sich völlig darin einig ist, dass es kein reines Denken vor der Sprache gibt und keine sprachvorgängigen Wortbedeutungen. Im Gegensatz zu Saussure geht es Merleau-Ponty aber nicht um eine Theorie eines Sprachsystems als langue, denn das wäre schon ein instrumentalisierender Umgang mit dem Sprechen. Eine so aufgebaute Erklärung der Herkunft unseres Sprechens setzt immer schon Sprache voraus und führt infolgedessen zu einem unendlichen Regress. Merleau-Ponty geht es um die gesprochene Sprache als parole parlée. Das ursprüngliche Sprechen aber ist ein sprechendes Verhalten, zu dem auch Mimik, Gestik und Gebärden gehören. 14 „In Wahrheit ist das Wort Gebärde, und es trägt seinen Sinn in sich wie die Geste den ihren. Eben das ist es, was Kommunikation möglich macht. Um die Worte eines anderen verstehen zu können, müssen sein Vokabular und seine Syntax mir selbstverständlich „schon bekannt“ sein“ (ebd. S. 217, 218). Gesten und Worte werden deshalb unmittelbar erfasst, weil Sprecher und Zuhörer eine gemeinsame Sprachwelt „leiblich“ erfahren, so wie wir schon immer im Raum und in einer Situation leiblich orientiert sind. „Es sind Gesichter, Gebärden und Worte, auf die wir mit unseren Blicken, Gebärden und Worten antworten, ohne ein Denken dazwischen zu schalten“ (PuS, S. 264). Saussures Sprache ist ein synchrones System von organisierten Zeichen. Was er übersieht, ist der dynamische, der diachrone und nie abgeschlossene Charakter von Sprache. Merleau-Ponty spricht deshalb von der parole parlante. Man könnte sie als Sprechsituation auffassen, die ein Sprechverhalten der Beteiligten hervorruft, bei dem der Sinn des Gesprochenen zwischen den Sprechern wie ein Faden immer weiter „gesponnen“ wird. Der Sinn entsteht im Sprechen immer wieder neu, weil das Gesprochene immer wieder neu, aus der jeweiligen Situation heraus, interpretiert werden muss: „Der Sinn der also „verstandenen“ Geste eines Anderen ist nicht hinter ihr gelegen, sondern fällt zusammen mit der Struktur der von der Gebärde entworfenen Welt, die ich verstehend mir zu eigen mache“ (PdW, S. 220). Ich und Welt und Ich und die Anderen befinden sich in einer gemeinsamen Welt und in einer ursprünglichen Sinnstiftung, aus der sich ein unmittelbares Wahrnehmen und Sprechen ergibt und aus der Sinn immer wieder neu entsteht. Dieses Ich ist aber nicht mehr identisch mit dem Ich Saussures oder gar dem Ich Kants, es ist ein Ich, bei dem die Grenzen zum Anderen zerfließen, weil sich beide wechselseitig beeinflussen und wechselseitig bedingen. „In dem Maße, in dem das, was ich sage, einen Sinn hat, bin ich, wenn ich spreche, für mich selbst ein anderer ‚Anderer’, und in dem Maße, in dem ich verstehe, weiß ich nicht mehr, wer spricht und wer zuhört“ (ÜPS, S. 136). Wahrnehmung, Wahrnehmender und Wahrgenommenes, Sprecher und Angesprochener sind miteinander verwoben, bedingen und schaffen sich gegenseitig. Wahrnehmen, Denken, Sprechen und Handeln sind eng verwandt. Immer denkt, spricht und handelt ein Mensch so, dass er sein In-der-Welt-Sein auf eine bestimmte Weise gestaltet; immer ist er bestrebt, durch Handlung, Entwurf und Wort, die Welt in seinem Sinn zu gestalten. Immer sind wir öffentlich. Wir bilden mit den Anderen einen Nexus in der Wahrnehmung und in der Sprache, an dem alle partizipieren und aus dem wir nur artifiziell aussteigen können (vgl. Danzer, S. 142). Der Mensch ist Sinngeber und Sinnsucher. Das cartesianische cogito ist eine Illusion. Obwohl Merleau-Ponty von den Grundgedanken seiner Philosophie, die schon in seinen ersten Werken, insbesondere in der „Phänomenologie der Wahrnehmung“, ausgearbeitet vorliegen, im Laufe seines Lebens nicht abgewichen ist, radikalisieren sich in seinen späteren Werken seine Ansichten im Hinblick auf den 15 Standpunkt, von dem aus Wahrnehmen in den Blick zu nehmen ist. In seinem letzten, unvollendeten Werk, „Das Sichtbare und das Unsichtbare“ versucht Merleau-Ponty Sinnbildung als reines Differenzierungsgeschehen in einem ontologischen Milieu entstehen zu lassen, ohne dass ein reflektierendes Subjekt dazwischengeschaltet ist. Der terminus technicus, mit dem Merleau-Ponty diesem Gedanken Gestalt gibt, ist das chair du monde (Fleisch der Welt). Das chair bezeichnet nicht die „Leiber der Subjekte“ in ihrer Verwobenheit in der Welt, es bezeichnet das Milieu, in dem sich das Selbst und Andere aufweisen, ohne dass diese völlig auseinander gehalten werden können. Durch die Einführung des verbindenden Prinzips, des chair, ist das Sehen des Menschen keine Privatangelegenheit mehr, sondern Teil einer gesamten Sichtbarkeit. Dieses konstituiert ihn als Sehenden und zugleich alle anderen Sehenden. Wie es einen Austausch zwischen meinen verschiedenen Sinneswahrnehmungen gibt, die eine konsistente Wahrnehmung erst möglich macht, so gibt es einen Austausch zwischen den Ansichten und Erfahrungen der verschiedenen Personen zu einer gesamten Sichtweise, auf deren Basis sich die individuelle Sichtweise erst bilden kann. Das Fleisch verbindet uns zu einer gemeinsamen Wahrnehmungswelt (vgl. SU, 185-189). Zwar gibt es den einzelnen Körper und die Einheit des einzelnen menschlichen Leibes. Im Prinzip des Fleisches verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen den Leibern. Dies ist der Bereich, den Merleau-Ponty das „wilde“ oder „rohe“ Sein nennt (vgl. SU, S. 215, 221). Statt von der Ambiguität spricht Merleau-Ponty auch von der Reversibilität, der Austauschbarkeit zwischen den Aspekten eines Vorgangs in diesem formenden Milieu als Voraussetzung, um die Gegensatzpaare Subjekt-Objekt, Wahrnehmend-Wahrnehmbar, SprecherAngesprochener, Ich-Anderer in einem urteilenden Denken erst denken zu können. Das chair ist das Milieu eines Differenzierungsgeschehens, hinter das es kein Zurück mehr gibt. Damit gibt Merleau-Ponty das anthropozentrische Weltbild völlig auf. Von den französischen Philosophen seiner Generation kann er als der radikalste bezeichnet werden. Sein Denken stellt den Übergang zur Postmoderne dar, viele seiner Gedanken finden sich bei Derrida wieder, ohne dass dieser es für notwendig befunden hätte, auf den Urheber – nämlich Merleau-Ponty – hinzuweisen. Nichts charakterisiert Merleau-Pontys Denken besser als folgender Satz aus Sartres Nachruf auf den 1961 unerwartet und früh verstorbenen Merleau-Ponty, der sinngemäß folgendermaßen lautet: Merleau-Ponty verglich sich gern mit einem Wellenkamm im Meer, der im Aufschäumen des Meeres entsteht, mit einem einzigen Gischtrand, und dann wieder verschwindet. 6. Levinas (1905-1995) – oder: die Andersheit des Anderen Levinas stammte aus einer litauischen, streng jüdischen Familie. Zum Studium ging er nach Strassburg, von dort für kurze Zeit nach Freiburg, wo er Vorlesungen bei Husserl und Heidegger hörte, und schließlich nach Paris, wo er die französische Staatsbürgerschaft annahm. Seine gesamte Familie fiel der nationalsozialistischen Judenverfolgung zum Opfer. Levinas Werke beziehen sich auf zwei unterschiedliche 16 Themenfelder: die Talmudischen Schriften einerseits und die Philosophie und dabei insbesondere die Auseinandersetzung mit der Phänomenologie andererseits. In Deutschland wurde Levinas einem breiteren Fachpublikum erst in den 90ger-Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt und galt zu dieser Zeit als „Geheimtipp“. Sein eigenes philosophisches Denken beschreibt Levinas in seinen beiden wichtigsten Werken Totalität und Unendlichkeit (1961) und Jenseits des Seins (1974). Wie Heidegger, wie Sartre, wie Merleau-Ponty und wie viele andere Philosophen betreibt Levinas zum Beginn seiner Überlegungen eine fundamentale Kritik am abendländischen Denken der Ontologie. Dieses Denken sei ganz auf Vereinheitlichung, Beherrschung und Besitz ausgerichtet und damit totalitär, ja sogar kriegerisch. Damit werden auch die Strukturen des Wissens und des Verhaltens totalitär; die abendländische Ontologie betreibt die Tilgung der Andersheit des Anderen. Dieses Denkmuster liegt bereits der Erzählung von der Heimkehr des Odysseus zugrunde. „[...] durch alle Abenteuer hindurch findet sich das Bewusstsein als es selbst wieder, es kehrt zu sich zurück wie Odysseus, der bei allen seinen Fahrten nur auf seine Geburtsinsel zugeht“ (Die Spur des Anderen (SdA), S. 211). Nicht das Einlassen auf den Anderen zeichnet dieses Denken aus, sondern „die Reduktion des Anderen auf das Selbe“ (ebd. S. 186). Es handelt sich um ein Geschlossenheitsdenken, das nicht die Transzendenz zum Anderen sucht. Das Bild vom Anderen wird mit dem Anderen gleichgesetzt; Wahrnehmungsgehalte werden zu bloßen Objekten herabgewürdigt. Der Philosoph, der diese Traditionslinie auf die Spitze trieb, ist für Levinas Hegel, der das einzelne Ich als Teil einer Bewegung betrachtete, die es auf das Selbe zurückführt und auf diese Weise zerstört. Selbst Heidegger mit seiner Kritik an der Seinsvergessenheit des Abendlandes entgeht nicht Levinas Vorwurf, ein Philosoph der Totalität zu sein. „Die Heideggersche Ontologie ordnet die Beziehung zum Anderen der Relation mit dem Neutrum, nämlich dem „Sein“, unter, und dadurch fährt sie fort, den Willen zur Macht, dessen Legitimität und gutes Gewissen allein der Andere erschüttern und stören kann, zu verherrlichen“ (SdA, S. 193, 194). Als Gegenmodell zu diesem besitzergreifenden und objektivierenden Denken stellt Levinas die Figur des Abraham vor. „Dem Mythos von Odysseus, der nach Ithaka zurückkehrt, möchten wir die Geschichte Abrahams entgegensetzen, der für immer sein Vaterland verlässt, um nach einem noch unbekannten Land auszubrechen, und der seinem Knecht gebietet, selbst seinen Sohn nicht zu diesem Ausgangspunkt zurückzuführen“ ((SdA, S. 215,216). Einen möglichen Ausbruch aus der Geschlossenheitsfigur abendländischen Denkens entdeckt Levinas in Descartes’ Versuch, seiner radikal angezweifelten eigenen Existenz doch eine letztendliche Gewissheit zu verleihen. Und dies gelingt ihm nur dadurch, dass er eine Öffnung zum Unendlichen als dem nicht mehr ganz zu Umfassenden und zu Beherrschenden – nämlich Gott – annehmen muss. „Bei Descartes unterhält das Ich, das denkt, eine Beziehung zum Unendlichen. Diese Beziehung ist nicht die Beziehung zwischen dem Enthaltenden und dem Inhalt – denn das Ich kann das Unendliche nicht 17 enthalten – noch die Beziehung, die den Inhalt an das Enthaltende bindet – denn das Ich ist vom Unendlichen getrennt. Diese also negativ beschriebene Relation ist die Idee des Unendlichen in uns. [...] Die Andersheit des Anderen wird nicht annuliert, sie schmilzt nicht dahin in dem Gedanken, der sie denkt. Indem das Unendliche denkt, denkt das Ich von vornherein mehr, als es denkt. Das Unendliche geht nicht ein in die Idee des Unendlichen, wird nicht begriffen; diese Idee ist kein Begriff. Das Unendliche ist das radikal, das absolut Andere. [...] Die Idee des Unendlichen ist also die einzige, die uns etwas lehrt, was wir nicht schon wissen. Sie ist in uns hineingelegt. Sie ist keine Erinnerung. Hier haben wir eine Erfahrung im einzig radikalen Sinne des Wortes: eine Beziehung mit dem Äußeren, mit dem Anderen, ohne dass dieses Außerhalb dem Selben integriert werden könnte. Der Denker, der die Idee des Unendlichen hat, ist mehr als er selbst, und diese Aufblähung, dieses Mehr, kommt nicht von Innen wie der famose Entwurf der modernen Philosophen, in dem das Subjekt sich als schöpferisches übertrifft“ (SdA, S. 196, 197). Die Idee des Unendlichen bringt eine Transzendenz ins Spiel, die nicht begriffen werden kann. Kein Begriff begreift die Extorität oder die Andersheit des Anderen. Mit dieser Idee betreibt Levinas keine Rückführung auf einen Ursprung, auf ein Eines und Ganzes; seine Metaphysik durchbricht im Gegenteil dieses Einheitsdenken zugunsten des Denkens eines Verhältnisses zu einer Exteriorität. Der Schlüsselbegriff ist „der Andere“. Dieser ist aber nicht wie bei Husserl oder auch bei Hegel ein „alter ego“; vielmehr offenbart sich die Sprengung des solipsistischen Geschlossenheitsdenkens im „Antlitz“ des Anderen. Das Antlitz ist mehr als ein Gesicht, das ich z.B. als photographische Ablichtung betrachten kann. Das Antlitz ist Eröffnung einer neuen Dimension; im Antlitz zeigt sich die Andersheit des Anderen. Das Antlitz spricht mit mir, der „Aneignungsmechanismus“ des Geschlossenheitsdenkens wird durchbrochen und der Übergang zur Transzendenz und Unendlichkeit geöffnet (vgl. SdA, S. 198, 199, 220, 221). Die Idee des Unendlichen ist der Andere, der mir von Angesicht zu Angesicht begegnet. Das Angesicht ist Ausdruck für die Art und Weise, in der sich mir der Andere zeigt und mit mir in Beziehung setzt. Aus der Vorgängigkeit dieser Beziehung zum Anderen, die jeder Handlung vorangeht, resultiert für Levinas eine Verantwortung, die er mit dem Begriff „ethischer Widerstand“ umschreibt. Der absolut Andere leistet dem Besitzergreifen ethischen Widerstand, weil die Beziehung zum Anderen das Betreten einer neuen Sphäre der Beziehung eröffnet. „Der Andere erscheint mir in seinem Gesicht weder als Hindernis noch als Bedrohung, sondern als das, was mich misst“ (ebd. S. 203). Der Andere steht mir nicht als ein Ding gegenüber. Durch sein Antlitz kommt erst die Frage des rechten Handelns und der Moral ins Spiel. Vernunft, freies und zugleich moralisches Handeln konstituieren sich erst im Angesicht des Anderen. Von daher betrachtet Levinas die Ethik als die erste Philosophie. Das Antlitz des Anderen führt einen ethischen Appell mit sich, der jedem ontologischen Seinsverständnis vorgängig ist. Wie Sartre und Merleau-Ponty neigt auch Levinas zur Überbetonung bestimmter Aspekte menschlicher Seinsweisen. Ist es bei Sartre die bedrückende Last menschlicher Freiheit in einer als bedrohlich empfundenen Umwelt, ist es bei Merleau-Ponty die Ansiedlung des Ich in einem Dazwischen bzw. in einem ontologischen Milieu, in dem Ich und die Anderen untrennbar miteinander verflochten sind, so ist es bei 18 Levinas der Begriff des Anderen, aus dem heraus die ganze Metaphysik entwickelt werden soll. Konsequenterweise wird Levinas daher auch eine Überbetonung des Anderen vorgeworfen, die das Selbst vergisst. Dieses muss aber auch noch existieren, damit ein Anderes überhaupt wahrgenommen werden kann. Kann man überhaupt von einem absolut Anderen sprechen, ist das nicht bereits ein Widerspruch in sich? Wenn das Einzelne nur im Allgemeinen erkennbar ist, wie schon Aristoteles sagt, entzieht sich die singuläre Andersheit jeder Begrifflichkeit und damit auch jedem philosophischen Erklärungsversuch. Derrida schließlich wandte gegen Levinas ein, man könne nie ganz in das Andere ausbrechen. Die Ebene des Anderen ist immer durchfurcht vom Eigenen, Vergangenen, Bekanntem (vgl. Derrida in „Gewalt und Metaphysik“). Aber dieses Argument ist bereits von Merleau-Ponty her bekannt. 7. Serres (1930 -...) – oder: der Mensch als Botschafter oder Empfänger in einem polyzentrischen Netz Serres ist, wie bereits erwähnt, ein Vertreter des modernen Strukturalismus. Sein Strukturbegriff entspricht dem des sog. mathematischen Formalismus, einer Denkrichtung in der Mathematik, die dem Nominalismus verwandt ist und die z.B. durch Hilbert und zuletzt durch die sog. Bourbaki-Gruppe in Frankreich vertreten wurde: „Eine Struktur ist eine operationale Menge mit undefinierter Bedeutung (während ein Archetyp eine konkrete Menge mit überdefinierter Bedeutung ist), die beliebig viele, inhaltlich nicht spezifizierte Elemente und eine endliche Zahl von Relationen zusammenfasst, deren Natur nicht weiter spezifiziert ist, für die jedoch die Funktion und gewisse Auswirkungen auf die Elemente bestimmt sind. Wenn man nun die Elemente inhaltlich bestimmt und die Art der Relation festlegt, erhält man ein Modell (ein Paradigma) dieser Struktur. Diese Struktur ist dann das formale Analogon sämtlicher konkreten Modelle, die sie organisiert. Modelle symbolisieren keinen Inhalt, sie ‚realisieren’ eine Struktur“ (Serres, Hermes I, S. 39). Die strukturale Analyse kann sich auf jeden Gegenstand beziehen, Gott, Tisch oder Waschschüssel. Während die traditionelle hermeneutische Methode versucht, eine eindeutige Sinnbeziehung zwischen dem Symbolisierendem und dem Symbolisierten herauszuarbeiten, geht die strukturale Methode von einer Vielfalt möglicher Beziehungen aus. Ihr geht es nicht mehr um die Entzifferung eines verborgenen Sinngehalts sondern um eine Beschreibung der Wirklichkeit anhand eines Modells, dessen Elemente inhaltlich so bestimmt werden, dass Modell und Wirklichkeit übereinstimmen. Die Bedeutung ist nichts Vorgegebenes mehr, sie entsteht vielmehr erst dadurch, dass man eine angenommene Struktur auf eine modellhafte Beschreibung der Wirklichkeit festlegt. Serres ist einer der Ersten, der dem traditionellen Denken in logisch geordneten und aufeinander aufbauenden Schritten ein strukturales Denken in Form von Netzwerken gegenüberstellt. Solche Netze, die über viele Eingänge und Verknüpfungen verfügen können, stehen dem modernen Menschen mittlerweile zur Verfügung, zum Beispiel in Form des „world-wide Web“. Es besteht aus vielen Knotenpunkten, ohne dass 19 man einen festen Referenzpunkt im Netz definieren könnte, von dem aus der Kommunikationsprozess startet oder zu dem er hinstrebt. Die Situation im Netzwerk lässt sich überhaupt nicht von einem Punkt aus erfassen. In einem solchen System sind Sinn und Bedeutung über das ganze Netz verteilt, die einzelnen Knotenstellen bilden Interferenzpunkte, jedoch keine Referenzpunkte. In einem solchen Netz hört auch das ‚klassische’ Erkenntnissubjekt auf, zu existieren. Es gibt kein Ich, das ‚hier’ ist, es ist immer auch ‚woanders’. Das vermeintliche Subjekt ist nur noch Überbringer oder Empfänger von Botschaften im Netz. Das eigentliche Subjekt aber ist das ‚Wir’, das polyzentrische Netz, das allen gemeinsam gehört. „Wer bin ich also? Eine diskontinuierliche Virtualität der Auswahl und Selektion innerhalb des intersubjektiven Denkens, ein Dämon, der die Modulationen des Rauschens der Welt trennt, ein Verkehrskreuz für Nachrichtenübermittler. Ich bin derjenige, der das Wir anzapft. Das Bewusstsein, Conscience, ist das Wissen, das zu seinem Subjekt die Gemeinschaft des Wir hat. Die Kommunikation macht den Menschen; er kann sie reduzieren, aber er kann sie nicht aufheben, ohne sich selbst aufzuheben“ (Serres, Hermes II, S. 204). Serres beschreibt den Typus eines nomadischen Denkens, den man insbesondere auch bei den Postmodernisten antrifft. 8. Derrida, Deleuze, Lyotard – oder: Abschied von den Metaerzählungen Wenn abschließend drei Vertreter der Postmoderne in einem Kapitel behandelt werden, dann soll damit nicht suggeriert werden, als gäbe es zwischen diesen dreien keine Unterschiede in den philosophischen Auffassungen. Bei aller Unterschiedlichkeit in den Details überwiegt aber das Gemeinsame: die radikale Abkehr von jeglicher Form des Einheitsdenkens, des Denkens in Sinn-Ursprüngen, logischen Entwicklungen oder logischen Systemaufbauten, des Denkens aus der Sicht eines subjektiven Selbst, kurz: des Denkens von einem stabilen Standpunkt aus. Wie, so fragt man sich, soll dann gedacht werden? Bei Derrida ist die Kritik am Ursprungsdenken der traditionellen Metaphysik mit einem Begriff verbunden: ‚le différance’ (vgl. auch die gleichnamige Schrift ‚Le différance’, die auf einen Vortrag Derridas von 1968 zurückgeht). Dieses von Derrida künstlich geschaffene Wort, bei dem das zweite ‚e’ der Substantivform ‚différence’ (=Differenz) durch ein ‚a’ ersetzt wurde, ist Ausdruck für Mehrdeutigkeit und steht damit für Derridas Kritik am Logozentrismus des traditionellen Denkens. Das französische Verb ‚différer’ (vom lat. differre) kann sowohl ‚sich unterscheiden’ als auch ‚aufschieben’ bedeuten. Diese Doppeldeutigkeit umfasst einen räumlichen und einen zeitlichen Aspekt. Die Substantivform ‚différence’ kennt diese Doppeldeutigkeit nicht mehr. Indem Derrida der ‚différence’ (mit ‚e’) die ‚différance’ (mit ‚a’) gegenüberstellt, will er dieser Doppeldeutigkeit symbolisch wieder Geltung verschaffen. Sie besteht ja darin, dass man den Unterschied der 20 beiden Wörter gar nicht hören kann. Nur am Schriftbild kann man ihn erkennen. Ansonsten erschließt sich der Bedeutungsunterschied - im Sinne von Differenz oder Aufschub - nur im Kontext des Sprechens. Was Derrida mit seinem Neologismus ausdrücken will, ist folgendes: Das traditionelle Denken war immer auf der Suche nach eindeutigen Wesenheiten, ursprünglichen Begriffen und Urprinzipien. Sinn erschien diesem Denken als solitär. Es gibt aber keine Erfahrung von reiner Anwesenheit von etwas, es gibt keine unmittelbare Zugänglichkeit zu reiner Bedeutung im Innern des Menschen. Jede Erfahrung steht in einem differentiell-relationalen Zusammenhang, der dem vermeintlichen Ursprung einer Idee in reiner Selbstevidenz immer schon vorausgeht. Der Sinn von etwas entsteht immer nur über Umweg und Aufschub über anderes. Dinge und Bedeutungen sind nur erfahrbar, sofern sie sich von anderen Dingen und Bedeutungen unterscheiden. Sinnbildung unterliegt immer der Struktur der ‚différance’, man kann Sinn aber nicht auf das Eine zurückführen. Die ‚différance’ ist somit Ausdruck für den nicht-einfachen Ursprung der Differenzen. Sie bezeichnet jene „Bewegung, durch die sich jede Sprache oder jeder Code, jedes Verweisungssystem im allgemeinen „historisch“ als Gewebe von Differenzen konstituiert“ (Die différance, S. 90). Den Primat des Logos verlagert Derrida deshalb auf die Schrift (écriture). Sie steht für die mediale Gebundenheit von Sinnzusammenhängen. Die Bewegung von Sinnzusammenhängen zeigt sich als Spur. Derrida greift hierbei auf den gleichnamigen Begriff aus der Freudschen Psychoanalyse zurück. Aber diese Spur als Wirkung von etwas Gewesenem ist nicht die Bewegung eines ursprünglichen Seins und Sinns, den man gar nicht gewahr werden kann, weil man immer nur Nachfolgendes, nie Ursprüngliches erfasst. Deshalb hat die ‚différance’ nicht nur keinen eindeutigen Anfang, sie läuft auch nicht geradlinig auf ein Ziel zu. Ihre Spur gleicht eher einem Umherirren (ebd. S. 82). Die ‚différance’ ist als „Spiel der Differenzen“ zu denken, aber dieses Spiel hat keinen Sinn, nach dem man fragen könnte. Die ‚différance’ entzieht sich der Was-istFrage, sie ist „älter“ als die ontologische Differenz, so Derrida in gut Heideggerscher Terminologie, die ‚différance’ bringt die Sinnfrage erst hervor (ebd. S. 104). Und was bedeutet das für den Menschen? Dazu sagt Derrida in einem Interview: „Nichts – kein präsent und nicht differierend Seiendes – geht also der différance und der Verräumlichung voraus. Es gibt kein Subjekt, das Agent, Autor oder Herr der différance wäre und dem sie sich möglicherweise empirisch aufdrängen würde. Die Subjektivität ist – ebenso wie die Objektivität – eine Wirkung der différance, eine in das System der différance eingeschriebene Wirkung. [...] das Subjekt, und in erster Linie das bewusste und sprechende Subjekt [ist] von dem System der Differenzen und der Bewegung der différance abhängig [...]. [...] es ist vor der différance weder gegenwärtig noch selbstgegenwärtig [...]; es schafft sich seinen Platz erst, indem es sich verräumlicht, sich „verzeitlicht“, sich differiert“ (Semiologie und Grammatologie, S. 153). Das Subjekt kann sich nur als Medium erfahren in einer Welt, die selbst aus Gefügen von Medien und Metamedien besteht. In diesen Medien prägen sich Spuren ein, aus denen heraus erst Sinn entsteht. Es gibt nur eine fortlaufende reécriture in einem Medium, ohne erkennbaren Ursprung, ohne Zentrum und ohne Ziel. 21 Sinn ist auf Text – Text im Sinne von Textur, Gewebe - angewiesen, aber nicht nur das: Sinn entsteht aus Text. Wenn man im Sinne der ‚différance’ denkt, kann man dann noch in der traditionellen Weise schreiben und denken, den Problemgegenstand tief durchdringend, das Thema präzise formulierend, das Ergebnis zielgerichtet ansteuernd? Nach Derrida ist genau dieser logozentristische Ansatz irreführend. Als Alternative propagiert er den Stil der Dekonstruktion als eine Weiterentwicklung des Heideggerschen Ansatzes der Dekonstruktion der Geschichte der Ontologie. Als Denk- und Schreibstil stellt die Dekonstruktion eine Kombination von stringenter, logischer Analyse bei gleichzeitigem Zulassen von Sprüngen in der Sicht- und Sprechweise dar. Aussagen werden gemacht und wieder in Frage gestellt, Behauptungen werden aufgestellt, und es wird ihnen widersprochen. Ziel ist ein Freilegen von Mehrdeutigkeiten bei allem, was zu einem Problemgegenstand gesagt werden kann. In der Schrift ‚Gla’ (Totenglocke) von 1974 macht Derrida diesen für den Leser allerdings anstrengenden Schreibstil besonders deutlich. Deleuze Auch Deleuze bedient sich eines einprägsamen und anschaulichen Begriffs, um seine Kritik an den Denkformen der klassischen Metaphysik auf den Punkt zu bringen: ‚Rhizom’. Mit Rhizom ist die Einleitung zu dem gemeinsam mit Guattari geschriebenen Buch „Mille Plateaux“ (1976) überschrieben. Der Begriff stammt aus der Botanik und bezeichnet Pflanzenarten, die sich wie Wurzelgeflechte, ohne erkennbare Struktur, jedoch als zusammenhängendes Ganzes, mal unterirdisch, mal oberirdisch ausbreiten. Morphologisch stellen diese Gebilde keine Wurzeln zu einem zugehörigen Stamm dar. Die Quecke ist ein Beispiel für ein pflanzliches Gewächs dieser Art. Bei Deleuze/Guattari steht das rhizomartige Gebilde für Vielheit, für den Pluralismus der Moderne, für die Emanzipation, für die Fragmentierung des Wissens etc. Es ist die Metapher für das Gegenmodell zum baumartigen Denken, der Denkform des klassischen Erkenntnismodells, das nach klaren Strukturen gegliedert und hierarchisch aufgebaut ist. Ein bekanntes Bild für das klassische Erkenntnismodell ist die Baumstruktur des Weltwissens, um 1240 unter dem Namen ‚arbor porphyriana’ bekannt geworden. Rhizomatisches Denken verlässt die traditionellen Wissenschaftskriterien. Um Phänomene der aktuellen Vielheit begreifen zu können, braucht man nach Ansicht der Autoren ein Denkmuster, das in der Lage ist, Heterogenität zu verstehen und Verbindungen zwischen Unterschiedlichem herzustellen. Dieses Denken entfaltet sich in Netzwerken, bei denen jeder Punkt mit anderen verbunden ist, sodass es immer Unterschiedlichkeit bei gleichzeitiger Verbindung gibt, jedoch ohne Zentrum und Ursprung. Unter Rhizom verstehen Deleuze/Guattari jedoch kein polyzentrisches System mit festgelegten Verbindungen. Streng 22 genommen handelt es sich überhaupt nicht um ein System, das man mit einem Modell beschreiben könnte, sondern schlichtweg um ein „Werden“ aller Art (vgl. Rhizom, S. 34,35). Deleuze/Guattari gehen damit bei der Beschreibung menschlicher Vielheit in ihrer Radikalität über Serres’ Strukturmodell des Netzwerkes hinaus. Ein solches Denken ruft natürlich nach Konsequenzen. Die Autoren fordern dazu auf, das Viele nicht nur zu propagieren, sondern es auch zu machen. Ein rhizomatisches Schreiben folgt deshalb nicht festen Spielregeln, es ist keine methodische Repräsentation von Erkenntnissen, es wird kein Bild der Welt entworfen. Vielmehr gibt es bei diesem Denk- und Schreibstil Sprünge, Variationen; immer bleibt etwas offen, es wird immer eine Aussage weniger gemacht, als zur Vervollständigung notwendig wäre. Dieses Denken protestiert gegen die traditionell bekannte – und auf andere Weise bereits von Levinas kritisierte – Einstellung eines Subjekts, das glaubt, sich aufmachen und nach draußen in die Welt gehen zu können, um mit reicher Erkenntnisbeute nach Hause zurückzukehren. Rhizomatisches Denken ist nomadisches Denken, das kein Drinnen und Draußen kennt, ganz wie die Nomaden, die überall zu Hause sind. Lyotard Einer der Auslöser der philosophischen Diskussion über die Postmoderne war Lyotards Kritik an den ‚Metaerzählungen’ (vgl. ‚Postmodernes Wissen’ von 1979). Metaerzählungen in seinem Sinn sind Denktypen mit Anspruch auf universale Deutungskompetenz. Als Beispiele für solche Metaerzählungen gibt Lyotard an: die Aufklärungsmetaerzählung, die Metaerzählung der Teleologie des Geistes (z.B. im Idealismus), die Metaerzählung von der Hermeneutik des Sinns (z.B. im Historismusstreit), die Metaerzählung des Kapitalismus. Der strukturelle Fehler dieser ‚Erzählungen’ besteht darin, dass eine einzige Verstehensweise als absolut und universal und als Heilsweg für sämtliche Lebenssituationen erklärt wird. Was ist für Lyotard konsequenterweise postmodernes Verhalten? Postmodernes Verhalten bedeutet, dass man den Metaerzählungen keinen Glauben mehr schenkt, dass man jeder Form des Einheitsdenkens eine Abfuhr erteilt, dass man jedem Versuch, innerhalb einer Pluralität nach Vereinheitlichung zu streben, Widerstand leistet. In diesem Sinn lautet die Antwort Lyotards auf die Frage „Was ist Postmodern?“ in der gleichnamigen Schrift von 1983 – der Titel der Schrift ist eine unverhohlener Anspielung auf Kants Schrift „Was ist Aufklärung?“ von 1783: „Die Postmoderne wäre dasjenige, das im Modernen in der Darstellung selbst auf ein Nicht-Darstellbares anspielt; das sich dem Trost der guten Formen verweigert, dem Konsensus eines Geschmacks, [...] das sich auf der Suche nach neuen Darstellungen begibt, [...] um das Gefühl dafür zu schärfen, dass es ein Undarstellbares gibt.“ (Beantwortung der Frage: Was ist postmodern, S. 47) Der letzte Satz der Schrift lautet: „Krieg dem Ganzen, zeugen wir für das Nicht-Darstellbare, aktivieren wir die Differenzen, retten wir die Differenzen, retten wir die Ehre des Namens.“ (ebd. S. 48) 23 Für Lyotard entsteht Vernunftverwirrung durch die Nichtbeachtung der Vielheit von (wissenschaftlichen) Lösungsmöglichkeiten, nicht aber durch die Vielheit an sich. Gerade die modernen Naturwissenschaften und die Künste zeigen, dass Metamodelle nicht konsistent anwendbar sind. Pluralität resultiert aus den neuartigen, immer komplexeren technischen Entwicklungen. Modernes Wissen ist gekennzeichnet, so Lyotard, durch Pluralisierung und Unvereinbarkeit. Für ein und dasselbe Fachgebiet gibt es unterschiedliche Theorien, es gibt eine Inkommensurabilität der Sprachspiele. Postmodernes Denken bedeutet für Lyotard deshalb, der Vielheit der Sprachspiele ihr Recht zuzusprechen und sie nicht ineinander zu übersetzen. In ‚Le differend’ (Der Widerstreit) von 1983 versucht Lyotard zu zeigen, dass es eine Heterogenität von Diskursarten geben kann, die zum Widerstreit führt, bei dem jede Seite auf Basis ihrer Prämissen Recht hat. Unterschiedliche Prämissen führen immer zum Widerstreit. Widerstreite sind deshalb nicht auflösbar, solange unterschiedliche Prämissen vorliegen. In unseren Gesellschaften werden Widerstreite i.A. aber, so die Botschaft Lyotards, wie Rechtsstreite behandelt. Dabei entscheidet die dominierende Gruppe über die Spielregeln und damit über den Ausgang des Widerstreits. In Fällen, in denen scheinbar Konsens erzielt wird, ist es aber oft so, dass die Partei, die im Streit unterliegt, einer anderen als der gültigen oder allgemein akzeptierten Diskursart folgt. Welche Diskursart dominant ist, ist aber eine Machtfrage. Dies gilt übrigens auch für die historisch überlieferten Diskursarten der Philosophie. Das Plädoyer Lyotards lautet, die verschiedenen Diskursarten zu erkennen, den Widerstreit offen zu legen und der unterlegenen oder übersehenen Diskursart zum Ausdruck zu verhelfen. Das ist insbesondere die Aufgabe der Philosophen. Auch wenn es für den Widerstreit prinzipiell keine Lösung gibt, solange eine Heterogenität der Diskursarten vorliegt, so besteht der Fortschritt doch darin, dass der Widerstreit wenigstens aufgedeckt und verstanden wird. Während es für Derrida und Deleuze zwischen Unterschiedlichem immer noch Verbindendes gab, gibt es für Lyotard genau dies nicht mehr. Seiner Meinung nach muss man heterogene Diskursarten unverbunden nebeneinander stehen lassen. Insofern ist er der radikalste von den dreien. Abschließende Anmerkungen zur „postmodernen“ Philosophie: Es ist zweifellos das Verdienst „postmoderner“ Philosophen, das Phänomen der Vielheit und Unterschiedlichkeit im Denken des modernen Menschen und moderner Gesellschaften, verursacht u.a. durch die sich schnell verändernden technischen Entwicklungen (vgl. z.B. das „world-wide web“), in den Blick genommen zu haben. Es ist auch verdienstvoll, Schwächen traditioneller philosophischer Denksysteme aufgedeckt zu haben. Ob die Zergliederung klassischer Texte im Sinne der Dekonstruktion dem Kerngedanken der kritisierten Autoren allerdings immer gerecht wird, kann z.B. bei den Husserl- und Platoninterpretationen Derridas erheblich in Zweifel gezogen werden. Prinzipiell stellt sich die Frage, ob Sinnerklärung, die beim Trennenden startet, überhaupt etwas erklären kann, wenn sie nicht zugleich etwas Gemeinsames voraussetzt. Hier liegt das irrationale Moment im postmodernen Denken. Sinnlos sind auch Aussagen der Art, dass es keine Wahrheit gibt, oder dass die Spur ein Spiel ohne Prinzip und ohne Ziel sei, weil diese Aussagen sich selbst ad absurdum führen. Dadurch, dass wir immer nur „Spuren“ in einem für uns nie zu überschauenden „Grund“ sehen, folgt noch nicht die Nichtexistenz vorgängiger Bedeutungen. Wie aus 24 dem „Spiel der différance“ Logik, Mathematik und kausale Erklärungsprinzipien hervorgehen, wenn man sie nicht schon in das Spiel hineinsteckt, müsste die Postmoderne zuerst beantworten, wenn die Redeweise von der Sinnlosigkeit des Spiels mehr als nur ein Wortspiel sein soll. Schließlich stellt sich die Frage, ob die Konsequenzen, welche die „postmodernen“ Philosophen aus ihren Befunden ziehen, als Anleitung für menschliches Handeln sinnvoll sind. Lyotards Forderung, unterschiedliche Diskursarten unaufgelöst nebeneinander bestehen zu lassen, scheint es jedenfalls nicht zu sein, weder was das Handeln des Einzelnen, noch die Konsensfindung in der Gesellschaft, noch die Arbeitsweise des Naturwissenschaften betrifft (die oft zu hörende Behauptung von den verschiedenen Diskursarten in der Physik (z.B. Welle – Teilchen) beruht schlichtweg auf einem falschen Physikverständnis). In der jeweiligen Situation das Angemessene zu tun, kann nicht einfach unterschiedlichen Diskursarten überlassen werden, ohne einen Konsens darüber anzustreben, was das Angemessene sei (vgl. die aktuelle Diskussion über die Kernenergie). Da aber die Postmodernisten, wenn sie ihrem eigenen Denkanspruch treu bleiben wollen, ihre Aussagen und Erklärungen nicht mit letzter Bestimmtheit und mit Nachdruck vorbringen können, sollte man diese auch nicht zu wörtlich (und ernst) nehmen. Denn würde man das tun, dann müsste man sofort hinzufügen: Mit euren Ausführungen habt ihr ja nur eine neue Metaerzählung geliefert. Literaturverzeichnis Danzer, Gerhard, „Merleau-Ponty – Ein Philosoph auf der Suche nach Sinn“, Kulturverlag Kadmos, Berlin (2003) Deleuze, Gilles, Guattari, Felix, “Rhizom”, Merve Verlag Berlin (1977) Derrida, Jaques, „Die différance“, in: Postmoderne und Dekonstruktion, Reclam, Stuttgart (2007) Derrida, Jaques, „Semiologoie und Grammatologie (Gespräch mit Julia Kristeva)“, in: Postmoderne und Dekonstruktion, Reclam, Stuttgart (2007) Lévinas, Emmanuel, „Die Spur des Anderen“ (SdA), Alber Studienausgabe, München (1998) Lyotard, Jean-Franvois, „Beantwortung der Frage : Was ist postmodern“, in : Postmoderne und Dekonstruktion, Reclam, Stuttgart (2007) Merleau-Ponty, Maurice, „Phénomenologie de la perception“, Paris, Gallimard, 1945 ; Textangaben gemäß der deutschen Ausgabe: „Phänomenologie der Wahrnehmung“ (PdW), in: PhänomenologischPsychologische Forschungen, Band 7, De Gruyter, Berlin (1966) Merleau-Ponty, Maurice, „Der Philosoph und sein Schatten“ (PuS) (1959), abgedruckt in: MerleauPonty, Zeichen, Hamburg (2007) Merleau-Ponty, Maurice, „Le visible et l’invisible“, Paris, Gallimard (1964); Textangaben gemäß der deutschen Ausgabe: „Das Sichtbare und das Unsichtbare“ (SU), in: Texte und Studien zu Handlung, Sprache und Lebenswelt, Band 13, Wilhelm Fink Verlag (2004) Merleau-Ponty, Maurice, „Parcours I“ (Schriften aus dem Nachlass), Lagrasse (1997 Sartre, Jean-Paul, „Das Sein und das Nichts“ (SuN), übers. H. Schöneberg, T. König, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg (1991) Serres, Michel, „Hermes I“, deutsche Ausgabe Berlin (1991) Serres, Michel, „Hermes II“, deutsche Ausgabe Berlin (1992) Waldenfels, Bernhard, „Phänomenologie in Frankreich“, Suhrkamp, Frankfurt (1987) 25 Anhang: Visuelle Übersicht über Strömungen und Vertreter der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts (incl. der Einflüsse deutscher Philosophen) Rene Descartes (1596-1650) Französische Philosophie des 20. Jahrhunderts Edmund Husserl Martin Heidegger (1859-1938) Phänomenologie (1889-1976) Fundamentalontologie Karl Jaspers (1883-1969) Existenzphilosophie Jean-Paul Sartre Henri Bergson Gabriel Marcel (1859-1941) Lebensphilosophie (1889-1973) frühe franz. Existenzphilosophie Maurice Blondel 1861-1949 Vorl. Existenzphil. Jacques Maritain (1882-1973) Neuthomismus (1905-1980) franz. Existenzphilosophie Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) (radikale) Phänomenologie Emmanuel Levinas (1905-1995) Phänomenologie des Anderen Strukturalismus (F. de Saussure, C. Levi-Strauss, J. Lacan, Serres etc.) Friedrich Nietzsche (1844-1900) Sigmund Freud (1856-1939) Poststrukturalismus/Postmoderne (G. Deleuze, M. Foucault, J. Derrida, J-F Lyotard) 26