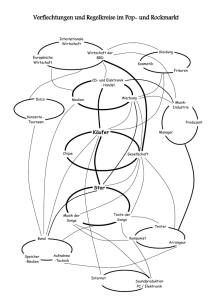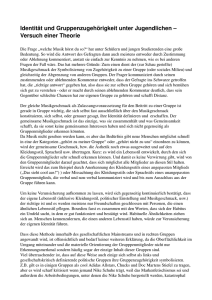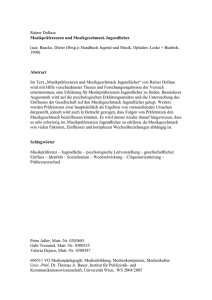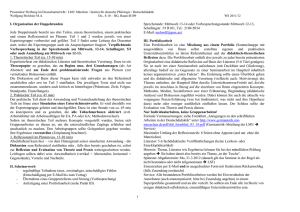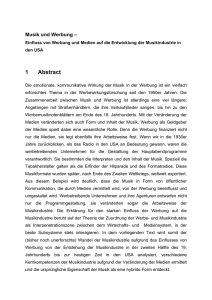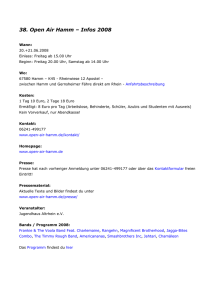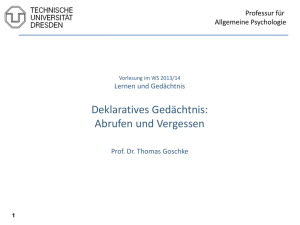Die Veränderung der Musikrezeption durch das Web 2.0 und deren
Werbung
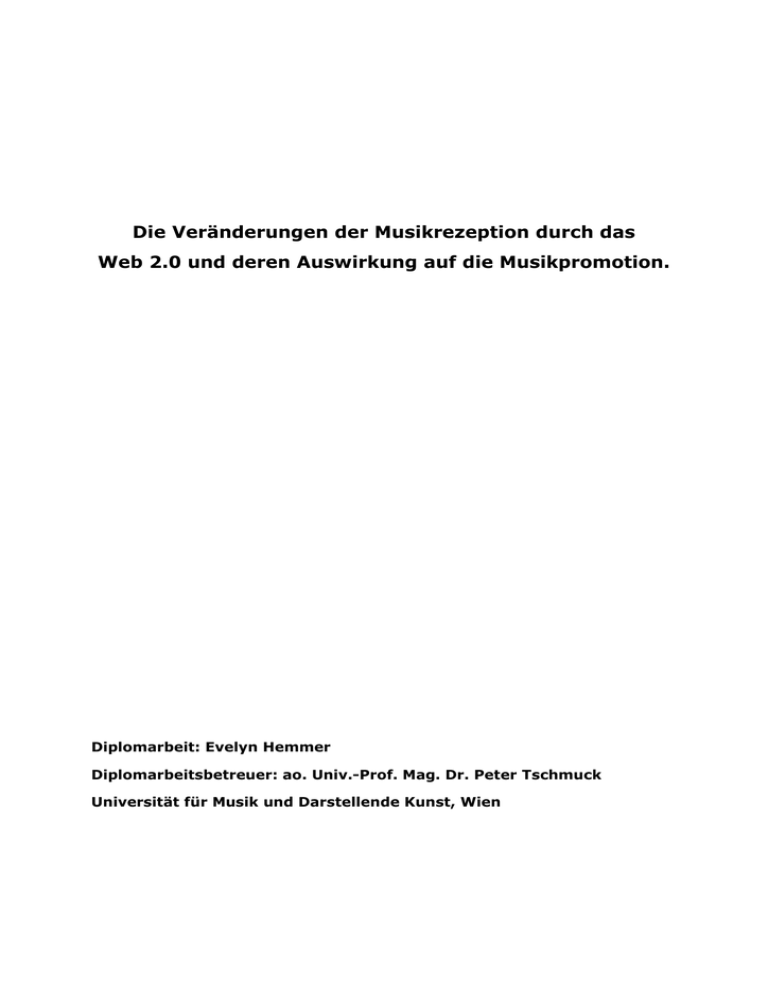
Die Veränderungen der Musikrezeption durch das Web 2.0 und deren Auswirkung auf die Musikpromotion. Diplomarbeit: Evelyn Hemmer Diplomarbeitsbetreuer: ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Tschmuck Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien Inhalt Einleitung ......................................................................................... 6 Hypothese ........................................................................................ 8 Methodik und Abgrenzung .................................................................. 8 Einteilung ......................................................................................... 9 I. Musikrezeption und Musikgeschmack ................................................. 10 1. Musikrezeption ................................................................................ 10 2. Musikgeschmack und Musikpräferenzen ............................................. 11 3. Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks .................................. 13 3.1. Entwicklung musikalischer Fähigkeiten ............................................... 14 Informationsverarbeitung ................................................................. 14 3.2. Musikalische Sozialisation ................................................................. 16 Das Elternhaus ................................................................................ 18 Die Jugend- und Schulzeit (Peer Group) ............................................. 19 Das Erwachsenenalter – Ich-Identität ................................................ 21 4. Musikgeschmack, Lebensstil und Identität .......................................... 22 Ausblick ......................................................................................... 25 II. Musikrezeption in den Massenmedien ................................................. 26 1. Massenmedial verbreitete Musik ........................................................ 27 Tonträger ....................................................................................... 28 Das Radio ....................................................................................... 29 Musikfernsehen ............................................................................... 30 Computer und Internet .................................................................... 30 2. Musik im Spannungsfeld zwischen Medien und Wirtschaft ..................... 32 2 III. Web 2.0 ......................................................................................... 36 1. Vom Internet zum Web 2.0............................................................... 36 Begriffsentstehung .......................................................................... 37 Begriffsdefinition und Kritik............................................................... 39 Aktivität im Web 2.0 ........................................................................ 40 2. Social Software ............................................................................... 40 2.1. Weblogs ......................................................................................... 43 Trackback, Permalink und Blogroll ..................................................... 44 RSS-Feed ....................................................................................... 45 Blogs und die traditionellen Medien .................................................... 46 Podcast oder AudioBlogs .................................................................. 46 2.2. Wikis ............................................................................................. 47 2.3. Social Tagging ................................................................................ 48 2.3.1. Folxonomies ................................................................................... 50 2.3.2. Recommender-Systeme ................................................................... 52 Content-based Filtering .................................................................... 53 Collaborative Filtering ...................................................................... 54 Hybride Ansätze .............................................................................. 55 2.4. Social Networking ............................................................................ 56 3. Nutzung von Web 2.0-Angeboten ...................................................... 58 Medienwirkungsforschung ................................................................ 58 Web 2.0-Nutzer............................................................................... 62 The Long Tail .................................................................................. 67 4. Erfolgsfaktoren von musikspezifischen Web 2.0-Angeboten .................. 70 IV. Typologie von Web 2.0-Angeboten .................................................... 72 1. Rezeptionsmöglichkeiten im Web 2.0 ................................................. 72 1.1. PASSIV .......................................................................................... 73 3 1.2. INFORMATIV ................................................................................... 75 1.3. INTERAKTIV: KOMMUNIKATIV und PARTIZIPATIV................................ 75 1.3.1. KOMMUNIKATION ............................................................................ 75 One-one-Kommunikation .................................................................. 76 One-many-Kommunikation ............................................................... 77 1.3.2. PARTIZIPATION............................................................................... 77 User Generated Content - Many-Many-Kommunikation ........................ 78 Profile ............................................................................................ 78 Tagging .......................................................................................... 79 1.4. PRÄFERENZAKTIV............................................................................ 80 1.5. PRODUKTIV .................................................................................... 80 Prosuming ...................................................................................... 80 Crowdsourcing und Beta................................................................... 83 2. Bewertung verschiedener Web 2.0-Angebote ...................................... 84 2.1. Last.fm .......................................................................................... 84 2.2. MySpace ........................................................................................ 89 2.3. SellaBand ....................................................................................... 93 2.4. Musikspezifische Weblogs ................................................................. 98 V. Auswirkungen auf die Musikpromotion ..............................................104 Kundenkontakt und Kundenkommunikation .......................................105 Virales Marketing............................................................................106 Kundenbindung ..............................................................................107 Selbstvermarktung .........................................................................108 Schlusswort ............................................................................................110 Literatur .................................................................................................112 4 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Musikalische Sozialisation ....................................................... 17 Abbildung 2: Die Wertschöpfungskette der Musikindustrie ............................. 34 Abbildung 3: Der Begriff Web 2.0 ............................................................... 39 Abbildung 4: Systemgruppen von Social Software ........................................ 43 Abbildung 5: Tagcloud von Last.fm über den Musikers Beck........................... 49 Abbildung 5: Passive und aktive Nutzer in Prozent ........................................ 63 Abbildung 6: Web 2.0-Nutzung durch Erwachsene und 14- bis 29-Jährige / wöchentliche Nutzung in Prozent aller Onliner .......................... 63 Abbildung 7: Typologie der Nutzer .............................................................. 64 Abbildung 8: The Long Tail ........................................................................ 68 Abbildung 9: Kategorien von Rezeptionsmöglichkeiten .................................. 73 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Vor- und Nachteile von Folxonomies ............................................ 52 Tabelle 2: Grafische Darstellung mittels Harvey Balls .................................... 72 Tabelle 3: Gegenüberstellung der Web 2.0-Angebote ...................................102 Tabelle 4: Sources of Awareness in Prozent für Promotion 2001-2007............104 5 Einleitung Die Musikindustrie wuchs im 20. Jahrhundert zu einem Industriezweig mit einer enormen Produktpalette und hoher gesellschaftlicher Relevanz heran. Sie kontrolliert Radios und Musikfernsehen. Die Programme sind vorgegeben, wir müssen hören was uns die Musikindustrie „vorsetzt“. Verschuldet durch das Internet, rutscht diese Industrie nun in die Krise. Vom „digitalen Paradigmenwechsel1“ und von „digitaler Mediamorphose2“ wird gesprochen. Es beutet, dass sich etwas tut in der Musikbranche, dass sich die Strukturen ändern und dass sich die Bedingungen für die Musikrezipienten, für die Musikschaffenden und für die Industrie ändern. Dabei haben sich die Änderungen durch das Internet schleichend vollzogen. Zu Beginn konnte nur mit einem langsamen Modem gesurft und dabei musste immer die Telefonrechnung im Auge behalten werden. Erst durch die Entwicklung von einfachen Standards wurde das Web für „normale“ Verbraucher zugänglich und zur „Gefahr“ der Musikindustrie. Die Nutzer werden immer erfahrener und verbringen immer mehr Zeit im Internet. Das Web wird als Selbstverständlichkeit und als vertrauenswürdiges Medium gesehen. Mittels Social Software können User heute zusammenarbeiten und ihre kollektiven Interessen einbeziehen. Es wird nicht nur kommuniziert sondern auch Inhalte stehen im Mittelpunkt. Mit dem Aufkommen des Internets und besonders durch die Vereinfachungen im Web 2.0 steht uns nun die ganze Musikwelt offen. Chris Anderson, Chefredakteur des Technologie-Magazins „Wired“ und Autor des Buches „The Long Tail“, meint zur Musikrezeption im Web 2.0: „Ein Jahrhundert lang haben wir die Spreu vom Weizen getrennt, um die kostbare Regalfläche, den begrenzten Sendeplatz, die wenigen Übertragungsmöglichkeiten und die Aufmerksamkeit so effektiv wie möglich zu nutzen.“3 Heute müssen wir die Hits nicht mehr mögen nur weil es nichts anderes gibt. 1 2 3 Vgl. Tschmuck 2003 Vgl. Smudits 2002 Anderson 2006 S. 6 6 Dies spiegelt eine sehr subjektive Ansicht der Musikrezeption wider. Es drängen sich einige Fragen zur kritischen Begutachtung auf: Was ist Musikrezeption und wie entsteht unser Musikgeschmack? Wie wird Musik in den Massenmedien rezipiert? Was ist das Web 2.0 und welche Veränderung bringt es? Welche Möglichkeiten der Musikrezeption stehen uns durch das Web 2.0 offen? Wie verändern diese Möglichkeiten die Musikindustrie? 7 Hypothese Durch das Aufkommen von Web 2.0 erhalten Rezipienten von massenmedial vermittelter Musik, mehr Möglichkeiten zur Musikrezeption und entwickeln sich dadurch zu einem „Prosumers“: aktiveren Konsumenten, Publikum. welche Aus freiwillig „einfachen Hörern“ Informationen werden über ihre Musikpräferenzen preisgeben und somit als eine Art Produzent die Grundlage der von ihnen rezipierten Musik bilden. Dadurch, so die Annahme, verändert sich die Musikpromotion der Industrie grundlegend. Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Rezeptionsmöglichkeiten im Web 2.0 aufzuzeigen und zu typologisieren. Diese Klassifizierung dient der Ordnung und Vergleichbarkeit von musikspezifischen Web 2.0-Angeboten. Der Begriff Aktivität zeigt sich als entscheidende Größe bei der Musikrezeption und der Bildung des Musikgeschmacks. Deshalb wird das Web 2.0 anhand von Aktivitätskriterien von passiv bis produktiv analysiert. Dieser Typologie folgt die Untersuchung ausgewählte Beispiele von Web 2.0-Angeboten und die Untersuchung der Auswirkung auf Musikrezeption, die Musikpromotion. Musikgeschmack Im und Vorfeld werden massenmedial die Themen vermittelte Musik aufgearbeitet sowie das Web 2.0 vorgestellt. Methodik und Abgrenzung Diese Arbeit verschiedensten beruht auf einer wissenschaftlichen qualitativen Disziplinen. Literaturanalyse Sozial-, aus den kommunikations-, kultur- und musikwissenschaftliche Ansichten kommen genauso zur Sprache wie wirtschaftswissenschaftliche Aspekte. Der empirische Teil in Kapitel IV stützt sich auf den theoretischen Rahmen der ersten drei Kapitel. Den Kern dieser Arbeit bildet das selbst entwickelte Analyseschema von Web 2.0-Angeboten anhand von Aktivitätskriterien und die darauf folgende Analyse von ausgewählten Beispielen. Gegenstand dieser Arbeit sind die veränderten Rezeptionsmöglichkeiten und deren Auswirkungen auf die Rezipienten. Es wird dabei auf die Musikindustrie abseits der Tonträgerindustrie und abseits der Tauschbörsen Bezug genommen. Diese Arbeit konzentriert sich nicht auf bestimmte Musikgenres, obwohl die Beschäftigung mit industriell produzierter und massenhaft distributierter Musik in den einführenden Kapiteln (I, II, III) die Konzentration auf Popmusik nahe legt. 8 Einteilung Teil I: Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der Musikrezeption und der Entstehung des persönlichen Musikgeschmacks. Dabei wird klar, dass es sich beim Rezipieren von Musik um eine aktive Tätigkeit handelt und das nur durch aktives Rezipieren sich der Musikgeschmack ausbildet. Teil II: Einen großen Anteil an der musikalischen Sozialisation eines Menschen tragen die Medien. In Teil II wird die massenmedial vermittelte Musik diskutiert. Die Hauptfunktion der Massenmedien in der Musikindustrie als Promoter wird aufgezeigt. Teil III: Im dritten Abschnitt werden die unterschiedlichen Möglichkeiten und die Besonderheiten des Web 2.0 aufgezeigt. Dabei wird auch auf Erkenntnisse über die Nutzer eingegangen. Es zeigen sich die Möglichkeiten zur aktiven Musikrezeption und die tatsächliche Nutzung durch User. Teil IV: Im empirischen Teil fließen die Ergebnisse der vorigen Kapitel in ein Analyseschema für Web 2.0-Anwendungen ein. Die Analyse erfolgt durch definierte Aktivitätskriterien von passiv bis produktiv. Anschließend werden verschiedene Web 2.0-Angebote anhand dieser Kriterien geprüft. Teil V: Im fünften Teil der Arbeit wird ein Ausblick in die Zukunft der Musikindustrie gegeben. Die Erkenntnisse des empirischen Teils werden die Möglichkeiten der Musikindustrie hinsichtlich der Musikpromotion bzw. der Musikvermarktung aufzeigen. Anmerkung: Auf eine geschlechtsneutrale Schreibung wurde in dieser Arbeit zugunsten einfacherer Lesbarkeit verzichtet. Selbstverständlich sind mit der maskulinen Verwendungsform stets beide Geschlechter gemeint. 9 I. Musikrezeption und Musikgeschmack Der erste Teil gibt eine Einführung in die Musikrezeption und diskutiert die Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks. Ein Bezug zwischen Musikgeschmack und Medien wird aufgezeigt um in weiterer Folge den Einfluss von massenmedial verbreiteter Musik auf den Rezipienten zu untersuchen. Die Wichtigkeit der aktiven Musikrezeption zeigt sich in Kapitel I und dient später als dem Forschungsinteresse zugrundeliegender Begriff bei der Kategorisierung des Musikangebots im Web 2.0. 1. Musikrezeption „Im Sprachgebrauch wird Musikrezeption als Synonym für „Musikhören“ verwendet. Gleichgültig ob ästhetische-historische, psychologisch- soziologische oder physiologische Fragen des Musikhörens angesprochen werden, gleichgültig auch ob der Hörvorgang, der Höreindruck oder das Musikverständnis des Hörenden Untersuchungsgegenstand ist – überall taucht in verschiedenen Bedeutungsvarianten der Begriff Musikrezeption auf.“ (Rösing 1983, S.1) Unter Musikrezeption wird die aktive Auseinandersetzung von Hörern mit Musik verstanden. Der Rezeptionsprozess beginnt mit der Zuwendung zum Medium. Im Mittelpunkt des Prozess steht die Hörer–Musik-Interaktion (vgl. Charlton/Schneider 1997a, S. 16). Indem die Zuhörer Wissen (erlangt durch musikalische Fähigkeiten und durch musikalische Sozialisation) an die Musik herantragen, interagieren sie auf der einen Seite mit der Musik und entwickeln so die tatsächlich rezipierte Musik, auf der anderen Seite wird diese rezipierte Musik im Alltag zur Entwicklung des Lebensstils und der Identität benutzt (vgl. Hechenberger 1999, S. 48). Diese sogenannte Aneignungsphase schließt an die eigentliche Rezeption an und setzt die Musikerfahrungen und die eigene Lebenswelt zueinander in Beziehung. Beispielsweise findet diese Aneignung in Gesprächen mit anderen Personen statt (vgl. Charlton/Schneider 1997a, S. 16). 10 In diesem Sinne ist zwischen Rezeption und Aneignung zu unterscheiden. Die Rezeption bezeichnet die konkrete Interaktion zwischen Musik und Zuhörer, in Folge dessen die rezipierte Musik hergestellt wird. Die Rezeption ist mit der Dauer der Zuwendung identisch. Unter Aneignung ist die Übernahme der rezipierten Musik in den Alltag und den lebensweltlichen Kontext der Zuhörer gemeint. Indem musikalische Information in den lebensweltlichen Kontext gebracht wird, kann neue Bedeutung entstehen, indem der musikalische Code in einer bestimmten Erlebnisdimension mit Gegenständen, Dingen, Einstellungen, Wünschen oder Sehnsüchten gekoppelt wird (vgl. Hechenberger 1999, S. 48). Inhaltlichen konstituiert sich dieser musikalische Code durch die Sozialisation des Zuhörers als außermusikalischer Faktor, der mit den musikalischen Faktoren interagiert. Die Musik kann ihrerseits die Rezeption als auch die Aneignung strukturieren indem sie entsprechende Angebote macht: ein Hit entsteht beispielsweise, wenn es gelingt, dass sich ein Musikstück im sozialen Netz spezifischer Zielgruppen mit bestimmten dort zirkulierenden Bedeutungen verankert. Die Struktur der Musik gestaltet hier zum einen die Interaktion vor, zum anderen aber ebenso die Aneignung, indem sie auf soziale Kontexte verweist, die über die Sozialisation vom Zuhörer erlernt werden können (vgl. Hechenberger 1999, S. 49). Der Rezeptions- und Aneignungsprozess kann als eine bewusste Beschäftigung mit Musik verstanden werden. Diese Prozesse helfen bei der Identitätsfindung und –entwicklung und somit auch bei der Entwicklung des Musikgeschmacks. Die äußeren Bedingungen der Rezeption haben sich allerdings durch technische Entwicklungen stark verändert. 2. Musikgeschmack und Musikpräferenzen Als Musikgeschmack kann man das umfassende Musikkonzept eines Individuums bezeichnen. Dieses Musikkonzept stellt die Grundlage für die Präferenzentscheidungen des einzelnen dar. Musikgeschmack erscheint im Gegensatz zu Musikpräferenzen als der umfassendere Begriff, Musikpräferenzen als eine der Möglichkeiten, jenen zu objektivieren. Musikgeschmack wird also 11 mittels der beobachtbaren Musikpräferenzen identifizierbar (vgl. Kunz 1998, S. 21-22). Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen aktuellen Entscheidungen (Präferenzen) und langfristigen Orientierungen (Geschmack) bezüglich des Gefallens von Musik (vgl. Kunz 1998, S. 21-22). Musikpräferenz bezeichnet etwas oder jemanden, das oder der von jemanden im Bereich der Musik bevorzugt wird. Es handelt sich um das Erlebnis einer in der Vergangenheit abgeschlossenen Tätigkeit des Bevorzugens. Musikpräferenzen sind somit als Rangskala Präferenzverhalten (Musikwerke) oder kann auf des sich jeweils auf Merkmale Vorgezogenen Personen der Musik zu verstehen. (Musiker) auf (Rhythmus) Das Gegenstände beziehen. Die persönlichen Präferenzen sind also ausschlaggebend dafür in welches Konzert ich gehe, welche CD ich mir kaufe. Musikpräferenzen bezeichnen das Entscheidungsverhalten in konkreten Situationen (vgl. Kunz 1998, S. 21-22). „Sie bilden den Bezugsrahmen für Urteile und Vorurteile, bestimmen die Selektion von musikalischen Wahrnehmungsinhalten; sie bedingen die Kontinuität des Verhaltens den wechselnden inneren und äußeren Situationen gegenüber; sie fungieren bisweilen auch als Mittel sozialer Anpassung und/oder Abgrenzung. Musikpräferenzen sind „Entscheidungen die Rangskalen bilden“ indem sie Musikstücke vorziehen oder nachordnen.“ (Jost 1982 in Rejzlik 2001 S. 31-32) Musik rezipieren wir durch die Übertragung mittels technischer Medien, in öffentlichen Darbietungen wie Konzerten und indem wir selbst musizieren. Bei der Rezeption realisiert sich unser Musikgeschmack, hier kommt er zur Anwendung und wird verändert. Erweitern wir unsere Erfahrungsräume können wir unseren Geschmack verändern, erweitern oder verschieben (vgl. Kunz 1998, S. 216). Das Augenmerk dieser Arbeit liegt auf der Änderung der Rezeption von Musik durch die Medien, genauer gesagt durch das Web 2.0. Das massenmedial 12 dargebotene Musikangebot und eine scheinbar uneingeschränkte Verbreitung spielen heutzutage bei der Ausbildung von Geschmack eine zentrale Rolle, trotzdem darf die Sozialisation abseits der Medien nicht außer Acht gelassen werden. „Der Begriff Musikpräferenz bezieht sich auf den ersten Blick lediglich auf die Tatsache, dass Menschen bestimmte Musik mögen, andere hingegen nicht, dass sie sich gegenüber Musik aber auch tolerant oder gleichgültig verhalten können. Musikpräferenzen Bei ein näherer Bündel von Betrachtung psychischen verbirgt sich hinter Phänomenen, deren Berücksichtigung unerlässlich ist, wenn man verstehen will, weshalb Individuen unterschiedliche Musik präferieren, weshalb Menschen „ihr Geschmack“ so wichtig sein kann.“ (Behne 2002, S. 339) Deshalb wird im Folgenden auf die Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks bzw. auf die musikalische Sozialisation eingegangen um danach die Zusammenhänge von Musikgeschmack, Lebensstil und Identität zu erklären. Die Medien sind Teil der Sozialisation eines Individuums werden aber hier in einem eigenem ausführlichen Kapitel behandelt. 3. Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks Bei der Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks sind zwei grundlegend verschiedene Prozesse zu unterscheiden: • Die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten • Die musikalische Sozialisation bzw. die Orientierung an einem Teil des verfügbaren Musikangebots Für den erstgenannten Prozess ist etwa das erste Lebensjahrzehnt anzusetzen. Die Anfänge des zweiten Prozesses, durch den wir individuellen Musikgeschmack entwickeln, sind schwieriger auszumachen, seine Höhepunkte sind aber sicherlich im zweiten Lebensjahrzehnt, also in der Jugend anzusetzen. Für den zweiten Prozess lassen sich vier Instanzen benennen, die nacheinander von dominierender Bedeutung sind: die Eltern, die Gleichaltrigen (Peer Group), sowie das Individuum selbst. Als vierte Instanz treten bereits im Vorschulalter die 13 Medien, die durch die Vielfalt ihres Angebots die Einflüsse von Eltern und Gleichaltrigen abschwächen, modifizieren oder verstärken können. Da die Medien sich als immer wichtiger werdende Instanz erweisen und ein zentraler Faktor dieser Arbeit sind, wird ihnen in Kapitel II besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Orientierung der eigenen Musikpräferenzen an den Eltern ist in der frühen Kindheit naheliegend. Spätestens mit der Pubertät beginnt eine zunehmende Orientierung nach außen, an Gleichaltrigen. Typisch für diese Zeit ist eine Fokussierung auf wenige musikalische Stilrichtungen und eine Ablehnung der meisten übrigen Musik, eine Einstellung die sich jedoch in den folgenden Jahren wieder zu toleranteren Haltungen entwickelt. Wenn schließlich als Ergebnis der Pubertät Ich-Identität entwickelt ist, kann man eher davon ausgehen, dass Musikpräferenzen individuellen Bedürfnissen entsprechen, dass sie – nach allmählicher Übernahme der Erwachsenenrolle – die Persönlichkeit des einzelnen widerspiegelt (vgl. Behne 2002, S. 345-353). 3.1. Entwicklung musikalischer Fähigkeiten Physiologisch gesehen hört jeder Mensch (auch schon vor der Geburt) gleich: die Schallwellen gelangen durch den äußeren Gehörgang zum Trommelfell. Im dahinter liegenden Mittelohr verstärken die Bewegungen der drei kleinsten Knöchelchen des Menschen (Hammer, Amboss und Steigbügel) den Schall um ein 20-faches, um ihn vollständig an die nächste Station, das Innenohr, weiterleiten zu können. In der dort befindlichen Chochlea (Schnecke) befinden sich die Haarsinneszellen (20.000 pro Ohr), die unterschiedliche Aufgaben haben: Einige verarbeiten hohe Töne, andere tiefe Töne. Diese Haarsinneszellen sind für die Verstärkung und Umwandlung der mechanischen Schwingungen in elektrische Impulse verantwortlich, die das Gehirn entlang des Hörnervs erreichen. Dort werden schließlich die Empfindungen des Gehörs bestimmt (Vgl. Petsche 2002, S. 630-637). Informationsverarbeitung „Das System der Informationsverarbeitung im Gehirn ist zielgerichtet und soll dem Menschen ermöglichen, sich ein kohärentes Bild seiner Welt zu 14 erarbeiten. Dazu müssen die für das Individuum relevanten Fakten registriert und irrelevante unterdrückt werden.“ (Peschke 2002, S. 637) Die Informationsverarbeitung beginnt damit, dass eine Botschaft die Sinnes- und Wahrnehmungsorgane des Rezipienten erreicht. Angesichts der allgemein hohen Informationsdichte, bzw. sogar Informationsüberlastung, wird dabei ohne eine gewisse Aktivierung kaum Bereitschaft beim Rezipienten bestehen, sich von sich aus einer bestimmten Botschaft zuzuwenden. Unter Aktivierung wird eine momentane psychologische Reaktion verstanden, die mit emotionalen und kognitiven Prozessen vernetzt ist. Momentane Reaktionen umfassen alle Vorgänge in einer Person, die sich unmittelbar oder im Anschluss an eine Darbietung einer Botschaft (z.B. Hören eines Musiktitels) abspielen. Sowohl bewusste als auch vorbewusste Vorgänge sind eingeschlossen. Es handelt sich dabei um Vorgänge im sensorischen System bzw. um Prozesse im Kurzzeitgedächtnis: Die Informationen, oder auch nur Teile davon, werden in dieser Aneignungsphase kondensiert und vereinfacht, so dass sie kurzzeitig gespeichert werden können. Im Kurzzeitspeicher spielt sich das momentane Denken ab. Die momentanen Reaktionen einer Person werden jedoch über die ablaufenden physiologischen Prozesse hinaus auch durch die jeweils bei einem Individuum bereits vorhandenen psychografischen und soziografischen Merkmale mit beeinflusst. Schließlich erfolgt ein Abgleich der aufgenommenen Information mit dem bereits im Gedächtnis vorhandenen Reservoir an Kenntnissen, Erfahrungen, Erlebnissen etc.; hierbei entscheidet sich, ob aufgenommene Information angemessen integriert werden kann. Wenn eine Integration möglich ist, dann wird die Information Bestandteil des Gedächtnisses bzw. der Erinnerung, sie gelangt in den Langzeitspeicher. Wenn dies nicht gelingt, dann verschwindet die Information aus dem Bewusstsein (vgl. Bruhn 2002, S. 439451). Diese im Langzeitspeicher enthaltenen Interessen können Rezipienten dazu motivieren, sich von sich aus aktiv bestimmten Medien oder Medieninhalten zuzuwenden und nicht nur passiv auf die Präsentation beliebiger Botschaften zu reagieren. In die Klasse von Interessen fällt auch das sogenannte „Involvement“, bzw. das Engagement, das Individuen einer Botschaft entgegenbringen und mit 15 dem sie bei der Informationsverarbeitung entsprechend vorgehen (vgl. Schenk 2007, S. 246-247). Je nach Stärke des „Involvements“ des Rezipienten bleiben die Botschaften im Langzeitgedächtnis gespeichert. Zur Einstellungsänderung führen Botschaften nur über sogenannte „zentrale Routen“ der Informationsverarbeitung. Zentrale Routen der Informationsverarbeitung können Personen über Medien beschreiten, welche gedankliche Anstrengung im Zusammenhang mit einer wahrgenommenen Botschaft ermöglichen. Der gedankliche Aufwand der vom Rezipienten an das Medium herangetragen wird, ist in der Regel sehr hoch, so dass eine gewisse Motivation oder ein Interesse am Gegenstand oder Thema vorausgesetzt werden muss. Die dadurch entstehende Einstellung wird in die vorhandenen Einstellungen integriert und erweitert diese (vgl. Schenk 2007, S. 260-263). Es wird deutlich, dass ein persönlichkeitsspezifischer Selektionsprozess stattfindet – jeder Mensch hört also anders. Aber nicht nur die physischen Voraussetzungen haben Einfluss auf das individuelle Musikempfinden und den Geschmack, ganz entscheidend kommt zu den physischen Fähigkeiten das soziale und musikalische Umfeld als großer Einflussfaktor hinzu. Nach heutigem Wissensstand ist unbestritten, dass musikalische Fähigkeiten sowohl eine Produkt von Erbanlagen als auch von Umwelteinflüssen sind (vgl. Gembris 1998, S. 189). Genau diese Umwelteinflüsse stehen im Mittelpunkt einer soziologischen Betrachtung von Musikrezeption. 3.2. Musikalische Sozialisation Die musikalische Sozialisation ist ein Teilbereich des umfangreichen Sozialisationsprozesses eines Individuums. Darunter wird das Hineinwachsen in die musikalische Umwelt und Kultur bzw. der kompetente Umgang mit musikbezogenen Erlebens- und Verhaltensweisen wie z.B. Rezeption, Reproduktion, Produktion, Reflexion, Transposition. Ob man auf der Straße die Musik aus dem MP3-Player genießt, oder nur abends in bestimmten Lokalen tanzt, ist eine Frage der musikalischen Sozialisation (vgl. Dollase 2005, S. 153155). 16 Zur musikalischen Sozialisation existieren eine Reihe von Modellvorstellungen. Schwerpunkt dieser Modelle ist die Darstellung der verschiedenen, den Musikgeschmack bedingenden Variablen und deren Beziehungen untereinander. Problematisch dabei ist, dass die vielschichtigen Zusammenhänge der Variablen kaum aufzuzeigen sind, da fast immer alles mit allem zusammenhängt. Weiterhin ist es praktisch unmöglich, alle für die Musiksozialisation relevanten Variablen in einem Modell zu berücksichtigen. Dollase versuchte 1986 einen Überblick zu schaffen: Abbildung 1: Musikalische Sozialisation Quelle: Dollase 1986 aus Kunz 1998, S. 26 Die Abbildung zeigt die Faktoren, die bei der musikalischen Sozialisation eine Rolle spielen. Neben den objektiven Lebensbedingungen Geschlecht und historische Zeit werden unter dem Oberbegriff Individuum die Lernprozesse der musikalischen Sozialisation und deren Ergebnisse zusammengefasst. Diese objektiven Lebensbedingungen formen, steuern und ermöglichen die persönlichen Aneignungsstrategien eines Individuums in Bezug auf Musik. Das Individuum, das diese Lernprozesse durchlebt interagiert aktiv in einem 17 dynamischen Prozess mit der Umwelt. Der Mensch wird hierbei grundsätzlich nicht als rein empfangendes Element im Sozialisationsgeschehen betrachtet, sondern als aktiv miterlebendes, aufnehmendes und sich entwickelndes Lebewesen. Dazu muss der gesellschaftliche Kontext einbezogen und das verfügbare musikalische Material berücksichtigt werden (vgl. Kunz 1998, S. 2326). „Wie viel Zeit zum Beispiel für Musik verwendet, wie viel Geld ausgegeben werden kann, in welchen Situationen sich überhaupt Musik machen oder hören lässt und verschiedenen wie stark Institutionen die musikalisch (Medien, Peers, Handelnden Schule, von den Elternhaus) beeinflusst werden, ist entscheidend für die Lernprozesse und die Konstitution der musikalischen Sozialisation eines Individuums“ (Rösing 1995, S. 352) Das soziale Umfeld hat also auf die musikalische Entwicklung des Menschen in seiner musikalischen Sozialisation größten Einfluss. Die wichtigsten Institutionen - Elternhaus, Peer Group, und Medien werden im folgenden Abschnitt näher beleuchtet. Das Elternhaus Kinder besitzen bereits unmittelbar nach der Geburt musikalische Fähigkeiten, die verloren gehen, wenn sie nicht in der ersten Zeit unterstützt werden. Die Anregung für die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten erwachsen aus sprachlichen und nicht-sprachlichen Vokalisationen der Bezugsberechtigten. Mit der musikalischen Entwicklung sind folgende Faktoren verknüpft (vgl. ShuterDyson 2002b, S. 307): • Eltern singen mit dem Kind • Gemeinsames Musizieren • Konzertbesuche • Musikalischer Hintergrund der Eltern etc. Kinder, die im Elternhaus Unterstützung beim Erlernen eines Musikinstrumentes erfahren, nehmen länger und mit größerer Motivation am Unterricht teil. Auch 18 der Bildungsgrad der Eltern spielt dabei eine Rolle. Ein hoher Bildungsgrad erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ein Instrument erlernt (vgl. Bastian 1991). Geht man davon aus, dass man von Musik, die man selbst gespielt hat, entscheidend geprägt wird, so ist es nachvollziehbar, dass klassische Musik wesentlich häufiger von Abiturienten, die klassische Musik produziert haben, geschätzt wird; Popmusik hingegen eher von Volks- und Hauptschülern, die diese konsumieren (vgl. Behne 2002, S. 347). Behne weist jedoch explizit darauf hin, dass Brittin4 in einer Studie 1991 mit klingenden Beispielen aus dem Pop-Bereich herausfand, dass musikalisch erfahrene Studenten Popmusik durchweg positiver beurteilen als Unerfahrene. Das Versprachlichungsausmaß scheint in einem Elternhaus mit gehobenerem Bildungshintergrund größer zu sein, wie auch das Interesse an Musik und deren Ausübung sowie die Reflexion über das Gehörte. Offensichtlich gibt es zudem eine lineare Beziehung zwischen musikalischer Entwicklung und dem sozioökonomischen Status der Eltern. So kann man festhalten, dass schichtenspezifische Musikpräferenzen u.a. die Funktion einer Aus- und Abgrenzung haben, denn sie sind Mittel, die von Bourdieu benannten „feinen Unterschiede“ zu betonen (vgl. Bourdieu 1979) „In der Tat bekunden „soziale Aufsteiger“ (Studenten aus Arbeiterfamilien) eine deutlich stärkere Präferenz für klassische Musik, als man anhand ihres sonstigem sozialen Umfeldes erwarten würde.“ (Behne 2002, S. 347) Das Elternhaus prägt somit hinsichtlich des Geschmacks, des Interesses und der Motivation, sich mit Musik (auch praktisch) in entscheidendem Maße auseinanderzusetzen. Die Jugend- und Schulzeit (Peer Group) „Musik in der Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung eines jungen Menschen ist eine besonders große Rolle zuzuschreiben. Sie nutzen die Musik in weit umfassenderem Maße als Kinder und Erwachsene, sie definieren sich geradezu über sie.“ (Baacke 1998, S. 13) 4 Brittin, R. V. (1991). The effect of overtly categorizing music on preference for popular music styles. Journal of Research in Music Education, 39, 143-151 19 Kinder entwickeln untereinander eine eigene Form der Musikkultur. Dies mag daran liegen, dass die Musik der Erwachsenen den Kindern zu komplex erscheint und sie daher zunächst in ihrer Komplexität reduzierte Musik in sich aufnehmen, z.B. Kinderlieder. Sogar von Schule zu Schule oder innerhalb einer Schule gibt es Unterschiede, die z.B. damit zusammenhängen können, dass die Lehrer mit den Kindern sehr unterschiedliche Stücke bearbeiten. Wichtig ist, dass der Austausch untereinander über Musik die (verbalen) Musikpräferenzen beeinflusst und der Persönlichkeitsentwicklung entscheidende Wendungen über Ge- und Missfallen herbeiführen kann (vgl. Shuter-Dyson 2002b, S. 308). Eine der wichtigsten Eigenschaften von Musik im Hinblick auf musikalische Sozialisation setzt bereits sehr früh ein: Heranwachsende nutzen Musik, um sich Urteile über andere Menschen in ihrer Umgebung zu machen. Freundschaften entstehen gerade in der Pubertät auf der Basis gemeinsamer musikalischer Interessen und Präferenzen. Dabei dient Musikrezeption oftmals als Basis für interpersonale Kommunikation – jugendliche Unterhaltungen drehen sich häufig um die neuesten Platten oder Musikvideos. In diesem Zusammenhang spielt auch das Konzept des Meinungsführers eine bedeutende Rolle. Jugendliche mit einem überdurchschnittlichen Interesse an Musik, das sich in einer überdurchschnittlichen CD- oder MP3-Sammlung äußert, besitzen innerhalb ihrer Peer Group oftmals eine herausragende Position, da sie als Ratgeber und Vorreiter in Sachen guten Geschmacks und Stils gelten (vgl. Lull 1985, S. 363372). Das Gefühl, bei den Gleichaltrigen (Peer Group) „ankommen“ zu wollen, mag manche dazu bringen, sich einer bestimmten modischen Musikrichtung anzuschließen. Umgekehrt gibt es auch Menschen, die sich erst einer Gruppe anschließen, wenn die Gemeinsamkeiten, in diesem Fall der Musikgeschmack, feststeht. Hier wird die Person in seiner Meinung verstärkt und kann in der Gemeinschaft ohne Probleme bestehen. Eine vorherrschende Meinung über einen bestimmten Stil kann also durchaus ansteckend sein. Empirische Untersuchungen belegen, dass die musikalische Karriere eines Menschen in großem Maße davon geprägt wird, was man in der Jugendzeit gehört hat (vgl. Rösing 2002, S. 373-375). 20 „Empirisch lässt sich zeigen, dass musikalische Vorlieben nicht isolierte Vorlieben sind, sondern zugleich auch mit einer Reihe anderer Interessen kovariieren. Wer sich für eine bestimmte Musikrichtung entscheidet, der teilt mit anderen, die diese Musik ebenfalls mögen, eine Reihe von psychologischen und sozialen Kennzeichen.“ (Dollase 1998, S. 335) Mit Hilfe von Musik kommunizieren Jugendliche demnach einerseits innerhalb der Peer Group und auf der anderen Seite extern mit ihrer Umwelt; sie bietet ihnen die Möglichkeit, sich symbolisch zu Themen zu äußern, für die sie selbst eventuell noch keine Worte finden oder die sie beschäftigen. Das Erwachsenenalter – Ich-Identität Das Erwachsenenalter ist schwer einzugrenzen. Wo hört die Jugend auf, wo liegt die Grenze zum Alter? Insgesamt umfasst das Erwachsenenalter einen Zeitraum von 60 Jahren und mehr. In den vergangenen Jahrzehnten hat eine Ausdehnung der Jugend bzw. der jugendnahen Lebensphase (Postadoleszenz) und eine soziokulturelle Verjüngung des Erwachsenenalters stattgefunden. Dieses Phänomen wirkt auch weit in die musikalische Entwicklung hinein. Der Einfluss von Sozialisierungs- und Lernprozessen auf die musikalische Entwicklung ist in der Kindheit und Jugend besonders stark und nimmt im Laufe des Erwachsenenalters ab. Die bereits in Kindes- und Jugendalter vorhandenen Unterschiede in der musikalischen Entwicklung vergrößern sich mit Beginn des Erwachsenenalters (vgl. Gembris 2008, S. 164-165). Lebensorientierung, Bedürfnisse und Werte ändern sich im Laufe des Lebens. Musikbezogene Freizeitinteressen können (z.B. durch Familiengründung) nicht mehr in früherem Umfang realisiert werden. Musik wird deshalb weniger zielgerichtet gehört, Beiläufigkeit und Beliebigkeit im Umgang mit Musik dominieren. Das noch in der Jugendzeit typische Interesse an Moden und Strömungen flacht ab. Erst mit dem Ausstieg aus dem Berufsleben ändert sich dies wieder (vgl. Gembris 2008, S. 184). Musikpräferenzen und Vorlieben von erwachsenen Musikhörern stehen im Zentrum der Medienforschung, da im Zeitalter des Formatradios die Gewohnheiten von Musikhörern gleichzeitig die Zielgruppen für die Werbung 21 definieren. Nur wenige Studien beschäftigen sich mit den Präferenzen und dem Musikgeschmack im Erwachsenenalter. Nach diesen Studien bleiben die musikalischen Präferenzen, die jemand im frühen Erwachsenenalter mit etwa 24 Jahren hat, auch für die folgenden Jahrzehnte des Lebens erhalten. Diese Studien sind aber fast ausnahmslos Querschnittsstudien, welche nur Momentaufnahmen verschiedener Altersgruppen vergleichen. Generations- bzw. Kohortenzugehörigkeit, welche auf Grund unterschiedlicher Prägungen in der musikalischen Sozialisation, einen erheblichen Einfluss auf den Musikgeschmack haben, werden mit Einflüssen des Alters vermischt (vgl. Gembris 2008, S. 184). 4. Musikgeschmack, Lebensstil und Identität Nach Friedemann Schulz von Thun ist das Selbstkonzept die Meinung, welche man von sich selbst hat (vgl. Schulz von Thun 1982, S. 167). Es entwickelt sich „als Folge definierender Erfahrungen“ (Schulz von Thun 1982, S. 174), die sich aufgrund der Kommunikation mit anderen Menschen ergeben. Umgekehrt ist das Selbstkonzept bzw. Identität wiederum Ursache für die Art und Weise der Aneignung von Wirklichkeit durch das Individuum. „Ein Hauptmechanismus des Selbstkonzeptes besteht darin, sich seine Umwelt selber zu schaffen und bestimmten Erfahrungen ganz aus dem Wege zu gehen.“ (Schulz von Thun 1982, S. 178) Unterschiedliche Selbstkonzepte sind also mitverantwortlich dafür, dass dieselben Informationen von verschiedenen Menschen anders wahrgenommen werden. Gerade in der Jugendzeit ist die Suche nach einer eigenen Identität der entscheidende Bewältigungsaspekt; diese Zeit ist die wichtigste Phase der Identitätsentwicklung, auch wenn diese das ganze Leben über stattfindet. Vor allem bietet die (Popular-) Musik den Jugendlichen Leitbilder und Lebensstile an. Deshalb liegt aufgrund der vielfältigen Funktionen von Musik in diesem Lebensabschnitt der Gedanke nahe, dass Musik die Identität vor allem von Jugendlichen prägt (vgl. Erikson 1973, S. 140-141). 22 „Unter Identität im modernen Sinn versteht man das Bewusstsein einer Person, sich von anderen Menschen zu unterscheiden (Individualität) sowie über die Zeit (Kontinuität) und über verschiedene Situationen (Konsistenz) hinweg im Kern dieselbe, durch bestimmte Merkmale ausgezeichnete Person zu bleiben.“ (Erikson 1966, S. 107) Dass besonders Musik ein wichtiges Medium zur Identitätsfindung sein kann, hängt mit den vielfältigen Funktionen von Musik zusammen, die von der Körperwahrnehmung bis zur Kompensation von seelischen Problemen reichen. Entscheidend für Zusammenhang weitergehende die Identifikationsprozesse persönliche Übernahme ist der in diesem Lebensstile und Weltanschauungen präferierter Musiker/Musikgruppen. Diese äußern sich in der Rockmusik zum Beispiel durch Liedtexte und Kleidung, aber auch durch den Musikstil. Die durch die Musik und ihr soziokulturelles Umfeld (welches zumeist die Medien bekanntmachen) vermittelten Identifikationsmuster und Lebensentwürfe werden durch individuelle Aneignungsprozesse Teil der eigenen Identität (vgl. Kunz 1998, S. 60). „Der Musikgeschmack ist eine Komponente des Lebensstils, d.h. Teil eines Syndroms mehr Orientierungen oder und Musikgeschmacks Menschen. weniger kohärenter Zu- Verhaltenspraktiken. verrät Umgekehrt daher lässt einiges sich Die über von und den Abneigungen, Kenntnis des Lebensstil eines allgemeinen Mustern des Kulturkonsums auf Grundzüge des Musikgeschmacks schließen.“(Otte S. 25-26) Es gibt in der Musikwissenschaft Ansätze, welche den Identitätsprozess auf den Prozess der Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks übertragen. Behnes Ansatz (vgl. Behne 1975, S. 38) geht beispielsweise auf das Model der „kognitiven Dissonanz“ zurück, in dessen Mittelpunkt die persönliche musikalische Erfahrung des Individuums steht: „Ein musikalisches Einstellungen, hinsichtlich Konzept Informationen, eines ist die Summe Vorurteilen bestimmten, mehr etc., oder von die Vorstellungen, ein Individuum weniger begrenzten musikalischen Objektes besitzt.“ (Behne 1975, S. 36) 23 Die „wichtigsten Determinanten bei der Entstehung musikalischer Konzepte“ sind nach Behne „die vier Grundfaktoren Sozialisation (Umwelt), Alter und Persönlichkeit (Individuum) und die Musik (Material)“ (Behne 1975, S. 38). Die musikalischen Konzepte steuern die Wahrnehmungsselektivität, die Selektion des Wahrzunehmenden, die Bereitschaft zur Produktion und Rezeption von Musik. „Wahrnehmungsselektivität und Selektion des Wahrzunehmenden wirken über das Hörerlebnis und damit über das musikalische Material wieder direkt auf das Konzept ein […].“ (Behne 1975, S. 42-43) Hörerfahrungen, denen man sich willentlich aussetzt, sind durch das bereits bestehende Konzept determiniert. Neuartige Hörerfahrungen verursachen durch Rückkopplungsprozesse Veränderungen des bestehenden Konzeptes. Diese Hörerfahrungen, die mit dem bestehenden Hörkonzept zunächst nicht in Einklang zu bringen sind, bezeichnet Behne als kognitive Dissonanzen. Neue Vorstellungen vom Begriff der Identität stellen vermehrt Veränderung und Vielfalt in den Mittelpunkt. Besonders durch das Web 2.0 weitet sich der Begriff der Identität aus. Döring schreibt 2003 (S. 325): „Identität wird heute als komplexe Struktur aufgefasst, die aus einer Vielzahl einzelner Elemente besteht (Multiplizität), von denen in konkreten Situationen jeweils Teilmengen aktiviert sind oder aktiviert werden (Flexibilität). Eine Person hat […] nicht nur eine „wahre“ Identität, sondern Verfügt über eine Vielzahl von gruppen-, rollen-, raum-, körper-, oder tätigkeitsbezogenen Teilidentitäten“ 24 Ausblick Zusammenfassend kann man sagen, dass Musikrezeption eine aktive Tätigkeit ist und zur Ausbildung des Musikgeschmacks führt. Der Musikgeschmack ist nicht willkürlich, sondern von verschiedenen Faktoren der Sozialisation abhängig. Darunter fällt auch die Prägung durch die Medien. Durch eine aktive Auseinandersetzung mit Musikmedien nehmen wir neue Musik passend zur Identität auf. „Medien verändern oder erweitern den Musikgeschmack insofern, als die Erweiterung der medialen Erfahrungsmöglichkeiten mit der Ausdehnung der sozialen Kreise korrespondiert. Neue Hörerlebnisse werden erst dann in die eigene kulturelle Praxis integriert, wenn sie in den relevanten sozialen Kontext akzeptiert und identitätsstiftend sind, also zu einer Ressource in sozialen Strategien wurden.“ (Gebesmair 2001, S. 229) Durch die Erweiterung des WWW zum Web 2.0 werden die Aktivitätsmöglichkeiten der Rezipienten, oder nunmehr User, stark erweitert. Mittels verschiedener Programme können User zusammenarbeiten und ihre kollektiven (Musik-) Interessen einbeziehen. Es wird nicht nur kommuniziert sondern auch Inhalte stehen im Mittelpunkt (vgl. Alby 2007, S. 90). Durch diese Programme entstehen erhebliche Erleichterungen der Publikation eigener Inhalte und ihre globale Zugänglichkeit. Verlage und Sender verlieren somit ihr Privileg, darüber zu entscheiden, welche Inhalte wann veröffentlicht werden (vgl. Niedermaier 2008, S. 59). Dem Musikrezipienten stehen nun um ein vielfaches mehr Möglichkeiten zur Verfügung sich mit Musik auseinanderzusetzen. Die verstärkten Aktivitätsmöglichkeiten zeigen sich im nächsten Kapitel als entscheidende Veränderung in der Musikrezeption durch das Web 2.0. 25 II. Musikrezeption in den Massenmedien Neben den verschieden Sozialisationsinstanzen, welche wir in unserem Leben durchlaufen, sind wir immer von den unterschiedlichsten Medien begleitet. In den meisten Medien hat Musik einen erheblichen quantitativen Anteil. Nicht nur Tonträger und das Musikfernsehen, sondern auch viele andere Medien nutzen Musik, um ihre Attraktivität sicher zu stellen. So finden sich z.B. in den meisten Printmedien musikjournalistische Beiträge. Selbst bei so „musikfernen“ Medien wie dem Telefon ist in der Warteschleife Musik zu hören und selbstgewählte Klingeltöne auf dem Mobiltelefon sind eine vor allem bei Jugendlichen vielgenützte Möglichkeit, um das eigene Handy durch zusätzliche Symbolik so zu gestalten, dass dem jeweiligem Publikum etwas über Status, die Einstellungen, die Interessen und Gruppenzugehörigkeit des Besitzers mitgeteilt wird (vgl. Münch; Eibach 2005, S. 462). Der größte Teil der Musikrezeption findet heute mittels technischer Medien statt. Als Folge dessen ist ein großer Forschungsbereich entstanden, der sich immer komplexer gestaltet, da ältere Medien häufig nicht völlig abgelöst werden (vgl. Münch 2008, S. 267). Medien werden nicht mehr als ein neutraler Mittler begriffen, durch den die Inhalte – nur eventuell durch Störungen beeinträchtigt - unverändert transportiert werden, sondern als wesentlicher, wenn nicht entscheidender Einflussfaktor auf die Medienbotschaft (vgl. Münch 2008, S. 268). Die heutigen Modelle sind ausdifferenziert durch Rückkopplungsschlaufen worden. Sender und und Empfänger Zusatzannahmen sind nun stark gegenseitige Wirkungsfaktoren, die ihrerseits jeweils wiederum durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden (vgl. Münch 2005, S. 464). Medien nehmen neben der Peer Group in der Gestaltung der Identität eines Menschen eine überaus wichtige Rolle ein. Sie verstärken die Ausbreitung bestimmter Trends und Einstellungen und sind somit maßgeblich an der individuellen Identitätsentwicklung beteiligt (vgl. Winterhoff-Spurk 2004, S. 85). 26 Medienwirkungsforscher stehen aber vor der bis heute nur ansatzweise gelösten Frage, wie sich Musikgeschmack der Medienkonsum des Rezipienten auf Persönlichkeit, auswirkt. Gemeinsam Identität und haben die unterschiedlichen Studien die Erkenntnis, dass die Wirkung der Massenmedien nicht nur von den präsentierten Inhalten, sondern auch von der „Rezeptionssituation und den Rezipientenmerkmalen abhängig ist“ (vgl. Brosius 2006, S. 592). Als Faktor medialer Wirkungszusammenhänge sind auch komplexe „gesellschaftliche Rahmenbedingungen“ (vgl. Brosius 2006, S. 592) zu beachten. Massenmedien sind als Instrumente der Massenkommunikation in der modernen Gesellschaft jederzeit verfügbar und stellen eine gewaltige Vielfalt an Inhalten und Informationen bereit, welche abhängig vom Interesse und der Bereitschaft des Nutzers individuell ausgewählt werden können. Die neuen technologischen Möglichkeiten ausübende erweitern Künstler den und gestalterischen Produzenten. Spielraum Vor allem für die Komponisten, zeitgenössische elektroakustische Musik und die populärer Musik gewinnen so künstlerische Impulse. Durch das Internet steigt zwar der Zwang zur billigen Musikproduktion, wodurch sich eine Veränderung der künstlerischen und technischen Qualität ergeben könnte, es erhöht aber auch die musikalische Konkurrenz und die Verbreitungschancen kleiner Musikproduktionen vor allem durch neue, interessierte, aktive Musikhörer (vgl. Maempel 2008, S. 250). „Es gehört mittlerweile zur allgemeinen geteilten Auffassung der Medienforschung, dass sich die Medienrezeption und –nutzung als aktiver Prozess bzw. als Aktivität des Zuschauers wie des Publikums beschreiben und begreifen läßt.“ (Göttlich 2008, S. 384) 1. Massenmedial verbreitete Musik Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts standen im Zentrum der Musikindustrie die Musikverleger und Musikveranstalter, deren Marktmacht auf der technologischen Basis der Musikaufführung und massenhaften Verbreitung mittels Musikdrucken beruhte (vgl. Tschmuck 2003, S. 20). Zu dieser Zeit war die Rezeption von Musik eine äußerst aktive Tätigkeit. Es bestand die Möglichkeit 27 Notendrucke zu kaufen und zu Hause selbst nachzuspielen oder eine Musikveranstaltung zu besuchen. Tonträger Durch die Erfindung des Phonographen von Thomas Alva Edison, der dessen Zukunft in der Telefonindustrie sah, und der experimentellen Forschung an Tonträgermedien durch Emile Berliner, konnten erste zufriedenstellende Musikaufnahmen durchgeführt werden. Somit war der Grundstein für die massenhafte Produktion von Musik gelegt (vgl. Tschmuck 2003, S. 24-32). Die Band-Technik hat der Schallplatte in den 1960er-Jahren ein neues Format industriell gefertigter Musikträger an die Seite gestellt: die Musik-Cassette (MC). Analoge Umwandlung des Schalls in elektrische Signale wurde in den 1970erJahren durch digitale Technik ersetzt. Sie zerlegt die analogen Signale in eine Sequenz zeitlich eng aufeinanderfolgender Daten, die im binären Code gespeichert werden. Als Speicherformat dient vor allem die mit Laserstrahl abgetastete Compact Disc (CD) (vgl. Blaukopf 2002, S. 176-177). Die Entwicklung der CD revolutioniert die Tonträgerproduktion Ende der 1990er. Mit ihr erfährt die Tonträgerindustrie einen neuerlichen Aufschwung durch die Reproduktion schon vorhandenen Materials. Radio und Fernsehen fungieren als Promotoren für die Tonträgerindustrie (vgl. Sperlich 2005, S. 45). Der erste, der sich Gedanken um den Stellenwert der Kunst und ihre wandelnde gesellschaftliche Bedeutung unter den geänderten Bedingungen der technischen Aufnahme und massenhaften Wiedergabe machte, war Walter Benjamin, der in seinem Essay „Das Kunstwerk und seine technische Reproduzierbarkeit“ (1936) Entwicklungen beschrieb, die zu seiner Zeit zum Teil noch Spekulationen darstellten, sich jedoch heute – im Zuge der immer weiter um sich greifenden Ausbreitung des massenmedialen Netzes – größtenteils bewahrheiten. Walter Benjamins Gedanken beruhen auf der Prämisse, dass durch die Reproduzierbarkeit das Kunstwerk aus seinem kultischen Kontext gerissen und in einen alltäglichen Umgang gebettet wird, in dem es Authentizität, Aura und Originalität und seinen klassischen Autor verliert“ (vgl. Rejzlik 2001, S. 50). 28 Insbesondere auf die Rezeptionsgewohnheiten der Hörer hatte die technische Vermittlung einen entscheidenden Einfluss. Beim individuellen Abspielen von Tonträgern erfolgte noch eine aktive Selektion und Hinwendung zur Musik, welche in Folge des Aufkommens des Massenmusikmediums schlechthin, dem Radio, zu einer passiven Rezeption eines massenhaft vorgefertigten Programms führte (vgl. Rejzlik 2001, S. 53). Das Radio Durch die Einführung des Rundfunks in den 1920er-Jahren wandelte sich die Musik zum ersten Mal von der materiellen Form der Schallplatte zu einer Dienstleistung (Übertragung von Livekonzerten) im Radio (vgl. Tschmuck 2003, S. 271). Musik und Radio ergänzen sich ideal, da beide den Hörer ausschließlich auditiv ansprechen. Damit eignen sich die Musik und in der Konsequenz auch das Radio hervorragend zur sogenannten Nebenbeinutzung. Ein wesentlicher Unterschied in der Nutzung von Tonträgern zum Radio liegt im Auswahlmodus: Die eigene Musikauswahl kann und muss ein Hörer aktiv gestalten. Er wählt die zu hörende CD aus oder erstellt eine Playlist auf dem MP3-Player. Das Radio muss nur eingeschaltet werden; eine weiter aktive Einflussnahme des Hörers ist nicht möglich und zumeist auch nicht erwünscht (vgl. Peters 2007, S. 247). Durch intensiven Radioeinsatz bestimmter Musiktitel entsteht eine wachsende Vertrautheit mit einem Musiktitel, was zu einer erhöhten Beliebtheit beiträgt. Hingegen schon sehr beliebte Musik nicht weiter in ihrer Beliebtheit gesteigert werden kann, da bei wiederholtem Anhören eines Musiktitels oder bei einer Abfolge sehr ähnlicher Musiktitel, die von den Musiktitel ausgehende, vom Hörer als positiv empfundene Erregung sinkt. Die Frage zum Einfluss des Hörfunks auf die Ausbildung von Musikpräferenzen bleibt also strittig (vgl. Münch; Eibach 2005, S. 477). Dieses Charakteristikum des Mediums Radio, das „Nebenbeihören“, führt dazu, dass das Musikprogramm immer stärker einen „Hintergrundteppich“ bildet, zur Stimmungsregulierung dient, und dadurch notgedrungen die Qualität und Vielfalt der gespielten Musik in Mitleidenschaft gezogen wird. Unterhaltungsmusik im Hörfunk konnte sich deshalb so erfolgreich durchsetzen, weil sie sich für ein beiläufiges Hören eignet und daher dem Rezeptionsverhalten eines 29 Massenpublikums entgegenkommt. Die Radiomusik muss also dem Hörer vertraut sein und bedarf keiner besonderen Konzentration. Die Wahl möglicher Musikstile ist damit zwar nicht auf Popmusik beschränkt, dagegen aber sehr wohl auf massentaugliches und grundsätzlich bekanntes Repertoire (vgl. Rejzlik 2001, S. 53-55). Musikfernsehen Knapp vor dem Radio ist das Fernsehen das meistgenutzte und auch subjektiv das als am wichtigsten erlebte Medium im Alltag. Programmstudien zeigen für die Vollprogramme einen Musikanteil zwischen 0,5 und 1,7 Prozent der Sendezeit. Ein besonders hoher Musikanteil findet sich im sogenannten Musikfernsehen. Entstanden als Abspielstationen für Videoclips haben sich viele inzwischen zu jugendspezifischen Vollprogrammen entwickelt (vgl. Münch 2008, S. 275) Das Musikfernsehen kann einer ähnlichen Kritik, wie der zum Radio unterzogen werden. Auch hier ist der Rezipient zur Passivität gezwungen. Computer und Internet Computer gehören zunehmend zur alltäglichen Ausstattung von Privathaushalten und des Berufslebens. In über 80 Prozent der Haushalte steht heute mindestens ein PC (Stand 2006). Die inzwischen fast überall vorhandene Ausstattung der Computer mit Soundkarten und CD- und DVD-Laufwerken zum Abspielen und Brennen sowie die zunehmende Zahl an TV- und Radio-Karten haben nicht nur ihre musikbezogene Nutzung forciert, sondern auch die Ablösung analoger Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Bearbeitung und Wiedergabe von Musik wurde durch die digitale Technik beschleunigt (vgl. Münch 2008, S. 280). Mit der Anbindung des Computers an das Internet hat sich der Funktionsumfang durch neue Möglichkeiten der Kommunikation, Recherche und Publikation deutlich erweitert (vgl. Münch 2008, S. 282). Das Internet bezeichnet den Verbund mehrerer Rechner zu einem Netzwerk, in dem Daten elektronisch ausgetauscht werden können. Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Internet-Rechnern (Servern) erfolgt über die technisch normierten Internetprotokolle. 30 Der Begriff Internet wird meist gleichgestellt mit dem World Wide Web (WWW) – dies ist jedoch nur einer mehrerer Dienste des Internets. Das WWW, bzw. „Netz“ ist ein Hypertext – System, durch welches Daten, die auf oben genannten Servern gelagert sind, mittels eines Webbrowsers dargestellt werden. „Aufgrund dieses Hypertextprinzips ist das WWW nicht nur ein technisches, sondern auch ein inhaltliches Verbundsystem. Durch die multimediale Oberfläche, die einfache Bedienbarkeit, die Vereinnahmung anderer Dienste unter die einheitliche Oberfläche der Browser und die Bereitstellung massenwirksamer Inhalte hat sich das World Wide Web (neben dem Email-Dienst) als wichtigster Internet-Dienst etabliert“ (vgl. Eibl; Podehl 2005, S. 173) Das Internet ist heute in vielfältiger Hinsicht für Nutzer bedeutsam, da es sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Funktionen erfüllen kann. Neben kognitiven Aspekten wie Informationssuche und –verarbeitung, Befriedigung der Neugierde und Erlangen bzw. Anwenden von Kompetenzen stehen sozio-emotionale Aspekte wie soziale Interaktion, soziale und personale Identitäten (vgl. Münch 2008, S. 282). Die Einführung neuer digitaler Technologien zur Komprimierung von Musik (MP3) und deren schnelle Verbreitung im Internet lässt die Grenzen zwischen Reproduktion, Distribution und Rezeption verschwimmen. Musikstücke können endlos und verlustfrei vervielfältigt werden. Musik wird nach dem erfolgreichen Produkt CD wieder als Dienstleistung wahrgenommen. „Die Umwälzungen die sich derzeit in der Musikindustrie ereignen, führen dazu, dass das Musikgeschäft nicht mehr an den Tonträger gebunden ist, sondern eine Dienstleistung darstellt, die man über das Internet in Anspruch nehmen kann.“ (Tschmuck 2003, S. 225) Größtes Medieninteresse erlangten Online-Tauschbörsen wie Napster, welche es ermöglichen, bequem und kostenlos, allerdings illegal Musikstücke aus dem WWW zu beziehen. Abgesehen vom negativen Beigeschmack durch CopyrightVerletzungen, die insbesondere der Tonträgerindustrie Schaden bereiten, bietet sich die bisher nie dagewesene Möglichkeit, verschiedenste Musikstücke, -stile 31 und Interpreten kennenzulernen. Der große Unterschied zu den Musikmedien Hörfunk und Fernsehen ist, dass die Musik nicht an den/die passive/n Rezipienten herangetragen wird, man wird nicht automatisch damit konfrontiert, sondern man muss erst aktiv danach suchen (vgl. Rejzlik 2001, S. 112-113). Somit bietet das Internet bisher ungeahnte Möglichkeiten für den, der weiß, was er sucht, der sich auf Grund von Anhaltspunkten in Musikrichtungen vertiefen bzw. Neues kennenlernen will. Der Zugang erschwert sich allerdings für diejenigen, die kaum Zugang zu musikbezogener Information haben oder für die eine Informationsbeschaffung zu mühsam ist. Auf keinen Fall erreicht ein solches Medium jene, die von sich aus kein Interesse an Musik haben, sondern sich passiv verhalten und jene Musik annehmen, die an sie herangetragen wird (vgl. Rejzlik 2001, S. 113) 2. Musik im Spannungsfeld zwischen Medien und Wirtschaft Sobald Musik von den Massenmedien transportiert wird, ist sie stets eingebettet in ein von ökonomischen Aspekten determiniertes Umfeld; in diesem Fall der Musikindustrie. Die Massenmedien fungieren in der Musikindustrie als Mittler zwischen Musikmachern und ihrem Publikum bzw. dem potentiellen Musikkonsumenten. Denn erst das direkte Hören von Musik schafft die Grundlage für deren Beurteilung. Diese Beurteilung ist ein wesentliches Kriterium bei der Kaufentscheidung (vgl. Rejzlik 2001, S. 56-57). Das Besondere am Musikgeschäft ist, dass Musik hinsichtlich der Massenmedien zugleich Programminhalt als auch Werbeobjekt ist. Promotion entsteht als „ungekaufte Werbung“ durch den Einsatz der Musikprodukte im Medienbereich. Die Industrie hat den Vorteil, dass ihr Produkt durch redaktionellen Einsatz in Radio, TV, Presse und Internet bekannt gemacht wird. Die Medien haben den Vorteil, sendefähige Programmbeiträge zu sehr günstigen Kosten (in der Regel fallen nur Lizenzkosten an) zu erhalten (vgl. Mahlmann S. 136-137). Die Massenmedien fungieren als Filter, der aus der Vielfalt musikalischer Produktionen jene herauslöst, die am besten dem wie auch immer antizipierten 32 Massengeschmack gerecht werden. Gefragt ist der kleinste gemeinsame Nenner für den größtmöglichen Markt (vgl. Gebesmair 2001, S. 227). Durch diese enge Verknüpfung zwischen Medien und Wirtschaft ist die Promotion mittlerweile zur Hauptaufgabe der Musikindustrie avanciert. Die Vermarktung von Künstlern, nicht nur in verschiedenen Ländern, sondern auch über mehrere Medienplattformen hinweg, ist sehr kostspielig und wurde bisher nur von den international tätigen Majors erfolgreich praktiziert (vgl. Biegmann; Jakob 2008 S. 97-98). Promotion ist nicht gleich Werbung, sondern es handelt sich hierbei um den Einsatz von Musikproduktionen in den Medien. Da es sich nicht um offensichtliche Werbung handelt, ist die Glaubwürdigkeit beim Konsumenten hoch. Promotion wird der Werbung vorgereiht, da Musikkäufer dazu neigen, Produkte erst zu kaufen, wenn sie diese bereits aus den Medien kennen. Werbung wird zur Verstärkung der Promotion zeitlich später eingesetzt. Allerdings stimulieren Werbung und Promotion nicht nur legale Verkäufe (vgl. Mahlmann 2008 S. 143). Die Kernaufgabe der Musikindustrie, ihre Künstler in den Medien zu promoten, ergab sich Ende der 1940er-Jahre, als sich kleine, unabhängige Plattenlabels mit kleinen, unabhängigen Radiostationen verbanden. Das wiederholte Abspielen von Musikstücken durch die Radiostationen wurde zum wichtigsten Instrument der Verkaufsförderung von Tonträgern. Das führte zu einer neuen Machtverteilung innerhalb der Musikindustrie. Durch Musikvideos und Konzerttourneen wurde der Tonträgermarkt weiter angekurbelt und die Kosten für die Promotion weiter gesteigert (vgl. Tschmuck 2003, S. 320). Seit den 1950er Jahren spricht man von einer symbiotischen Beziehung zwischen Tonträger- und Radioindustrie. Die Radiostationen sind von der Plattenindustrie abhängig, da sie mit den Produkten die Hörer an ihre Sender binden, mit denen wiederum potentielle Werbekunden angelockt werden. Die Plattenindustrie ist vom Radio abhängig, da es die wichtigste Werbeplattform von Tonträgern darstellt (vgl. Gebesmair 2008, S. 154). Durch die hohe Kostenintensität (die Rate von Erfolgen zu Flops steht 1:10) konzentriert sich der Markt auf einige große Player, genannt Majors, die 33 wiederum nur ein Teil von internationalen Medienkonglomeraten sind, um die ganze Wertschöpfungskette zu integrieren (vgl. Steinauß; Gmelin; Günnel 2008 S. 31). Abbildung 2: Die Wertschöpfungskette der Musikindustrie Kunde Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Tschmuck 2003 S. 305-326 Die heutigen 4 Majors (Universal, Warner, EMI, SONY-BMG) teilen sich den Tonträgermarkt mit den unabhängigen, kleinen Independent-Labels. Im globalen Maßstab stehen die Majors für mehr als 70 Prozent des Weltmarktes. Noch stärker als die wertmäßige Dominanz ist die überwiegende Präsenz der Majors bei der strategisch wichtigen Airtime (Sendezeit) im Radio. Die Bedeutung dieser Kenngröße ist darin begründet, dass bei mehr al 75 Prozent aller CD-Käufe die Kaufentscheidung durch das Hören von bestimmten Titeln im Radio beeinflußt ist. Der Versuch, diese Airtime für das eigene Label auszubauen, resultiert teils in der Anwendung illegaler Methoden – genannt Payola („pay for play“) (vgl. Steinkrauß; Gmelin; Günnel 2008, S. 31). Im Zeitalter der Globalisierung zielen die Strategien der Musik- und Medienkonzerne auf die weltweite Vermarktung einiger weniger, mit riesigem Aufwand produzierter und promoteter Megaacts ab. Insofern tendieren die Massenkommunikationsmittel dazu, einen relativ engen Massengeschmack, der auf Superstars und Megaacts gerichtet ist, zu „produzieren“. Das Geschäft ist Hitgetrieben und dominiert von Personen-Marken. Die Musikindustrie und die Medien konzentrieren sich auf kurzfristige Erfolge, wenige Superstars und Vermarktungsformate wie „Starmania“ in Österreich oder „Deutschland sucht den Superstar“ in Deutschland. Dabei wird aber die Symbiose zwischen Radio- und Tonträgerindustrie gefährdet. Die Tonträgerindustrie beklagt, dass die Sender ihre Playlisten (Listen der in jeder Woche zum Einsatz kommenden Musiktitel) zu sehr einschränken und sich 34 in ihren Formaten angleichen und daher kaum noch als Werbeplattform für neue Musikproduktionen von Nutzen sind (vgl. Gebesmair 2008, S. 153). Mittlerweile führt die aufwendige Promotiontätigkeit aber trotzdem dazu, dass ein großer Teil der Kosten eines Labels auf Marketing- und Promotionkosten (23 Prozent) zurückzuführen sind. Den kleinsten Anteil in der Kostenstruktur der Majors mit 2 Prozent macht der Bereich Artist & Repertoire, dessen Aufgabe das Entdecken und der Aufbau von Künstlern ist, aus. Diese geringen Ausgaben spiegeln die mangelnde Produktpolitik wider, aber auch die wachsende Unzufriedenheit der Kunden, welche sich in sinkenden Absatzzahlen ausdrückt (vgl. Jakob 2008 S.78). Die immer größer und komplexer werdenden Systeme der Medienkonglomerate, sind von subjektiver Einschätzung oder Intuition im Entscheidungsprozess rund um Musikproduktionen vollkommen entkoppelt und Neuerscheinungen hängen von Marktforschungsdaten ab. Werber und andere Investoren erwarten eine hohe Planungssicherheit, deren Erfolg sich in Quoten ausdrückt. Gemessen wird aber nur die Quantität und nicht die Qualität. Doch das System Quote ist ebenso bedroht wie das Geschäftsmodell der Musikwirtschaft. Die gesamte Kommunikationsindustrie befindet sich in einer Phase revolutionärer Erneuerung. Die digitale Technologie verändert sämtliche Medienformate, denn sie bietet Raum für zig neue Kanäle und vor allem die Einbeziehung des Konsumenten (vgl. Renner 2004, S. 211-215). „Das alte Modell „ein Sender – viele Empfänger“ ist aufgehoben. Der Konsument emanzipiert sich, ist in Form von Internetforen und Weblogs selbst längst der Sender. Das neue Modell „viele Sender – viele Empfänger“ inflationiert die Währung Quote.“ (Renner 2004, S. 215) 35 III. Web 2.0 Die starke Präsenz des Wortes „Web 2.0“ im derzeitigen medialen Geschehen ist kaum zu übersehen. „Web 2.0“ als populäres, mediales Schlagwort bezeichnet das Netz in seiner derzeitigen Erscheinungsform. In Anlehnung daran tauchen eine Vielzahl an Begriffen auf, wie etwa „Education 2.0“5 oder „Music 2.0“6. Durch die Verwendung Softwareherstellung üblich von Versionsnummern sind, impliziert (2.0), der Begriff welche in Web 2.0 der eine Weiterentwicklung. Es wird somit suggeriert, dass das bisherige Internet oder „Web 1.0“ nicht ganz optimal war und, dass sich etwas Gravierendes geändert hat (vgl. Alby 2007, S. 17-19). Trügerisch erweist sich der Begriff in zweierlei Hinsicht: Erstens gibt es keinen genauen Zeitpunkt der Entstehung des Web 2.0 und zweitens befindet sich das Web 2.0 in einer ständigen Erneuerung und Weiterentwicklung ohne dass man sich eine neue Version zulegen muss. 1. Vom Internet zum Web 2.0 Ermöglicht wurde diese Erweiterung vor allem durch die technischen Weiterentwicklungen des letzten Jahrzehnts. In den 1990er-Jahren des letzten Jahrhunderts war es anfangs unmöglich, große Datenmengen zu bewegen, da über Telefonleitungen nur ein gewisses Datenvolumen (z.B.: 56 KB/s Modem) transportiert werden konnte. Gleichzeitig war man telefonisch nicht erreichbar. Dargestellt wurden hauptsächlich textbasierte Inhalte, um den Ladevorgang zu minimieren. Dies veränderte sich zwar mit der Einführung von ISDN–Leitungen Musikdateien, Videos oder andere speicherintensive Inhalte anzuzeigen/abzuspielen war jedoch zeitaufwendig und daher auch wenig attraktiv bzw. noch immer relativ teuer. Erst die flächendeckende Einführung von leistbaren Breitbandanschlüssen bot die Grundvoraussetzung für eine größere Bevölkerungsbeteiligung. Pauschaltarife für 5 6 http://hubpages.com/hub/Education20 Abruf am 31.08.2008 http://www.music20book.com/ Abruf am 31.08.2008 36 Internetverbindungen, sogenannten Flatrates, bieten unbegrenzten Austausch von Dateien aus und ins Internet. Auch der Aufbau von im WWW angezeigten Seiten hat sich durch Anwendungen wie „Java Skript“ grundlegend geändert: Seiten werden nicht jedes Mal neu aufgebaut, sondern nur Teilinhalte neu geladen. Durch die nun günstige Möglichkeit der Übertragung von datenintensiven Inhalten, wie Musikstücke, und einer neuen Generation von Internetnutzern, welche schon mit Computern aufgewachsen ist, steigt die Anzahl der Internetnutzer (vgl. Berge; Bueschnig 2008, S. 24). Begriffsentstehung Der Begriff Web 2.0 wird Dale Dougherty (O’Reilly Media) und Craig Cline (MediaLive) zugeschrieben, die 2004 eine Konferenz namens „Web 2.0 Conference“7 abhielten (vgl. Szugat 2006, S. 14-15). Es ging darum, die Prinzipien zu identifizieren, welche die Firmen teilen, die den Crash der New Economy überlebt haben und heute erfolgreich sind. O´Reilly formulierte in seinem Initialbeitrag zum Web 2.0 diese 7 Prinzipien (Für das Folgende vgl. O´Reilly 2005): 1. The Web as Platform – das Web ist definiert als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform, die das Erzeugen von Anwendungen und Inhalten ermöglicht, die auf Basis offener Standards und Protokolle untereinander integrierbar und miteinander vernetzbar sind. 2. Harnessing Collective Intellegence – Darunter versteht O´Reilly, dass die Kumulation von Information in Gruppen oft zu besseren Aussagen und Entscheidungen führen kann als die, die ein Einzelner treffen kann. Dies wird auch als „Wisdom oft the Crowds“ (Gruppen- und kollektive Intelligenz) bezeichnet. 3. Data ist the next Intel Inside – Die Kumulation, Aggregation und Vernetzung von Informationen bzw. Daten ist wesentlicher als die Funktionalitäten einer Anwendung. Daraus können im Sinne des Prinzips 7 www.web2con.com 37 der Grundintelligenz marktbeherrschende Positionen aufgrund von Netzwerkeffekten entstehen. 4. End oft the Software Release Cycle – Web 2.0-Anwendungen bzw. webbasierte Dienste stellen keine kommerzielle Standardsoftware dar. Dienstleistungen (Integration von „Mashups“ in andere Internetanwendungen) sind von größerer Wichtigkeit als Softwareprodukte nach definierten Release-Zyklen. Die Softwareentwicklung bezieht nun auch die Nutzer mit ein. 5. Lightweight-Programming-Models – Einfache und flexibel änderbare ITArchitekturen und Entwicklungsframeworks sind aufgrund des zuvor beschriebenen Prinzips im Zuge laufender Veränderungsprozesse unabdingbar. 6. Software Above the Level of Single Device – Resultierend aus der Konvergenz von Kommunikationsmedien sollten nicht nur PCs sondern auch mobile Endgeräte Web 2.0 Anwendungen unterstützen. Die Software soll die Grenzen einzelner Geräte überschreiten. 7. Rich User Experience – Anwendungen sollten benutzerfreundlich ähnlich Desktop-Anwendungen sein und zusätzlich ergonomische Merkmale (Drag & Drop) beinhalten. Eineinhalb Jahre später hat sich der Begriff Web 2.0 durchgesetzt, Google findet hierzu inzwischen 75,5 Millionen Treffer (Stand: 8.11.2008). Aber es existiert immer noch große Uneinigkeit darüber, was Web 2.0 nun genau bedeutet. Einige halten es für ein bedeutungsloses Schlagwort aus dem Marketing, andere akzeptieren es als neue allgemeingültige Beschreibung eines Phänomens. Die Mindmap von Markus Angermeier auf der Hompage http://nerdweb.com visualisiert die vielschichtigen Verstrickungen und Prinzipien des Web 2.0. 38 Abbildung 3: Der Begriff Web 2.0 Quelle: http://nerdwideweb.com/web20/index.html#web20en, 12.06.2008 Begriffsdefinition und Kritik Die Dehnbarkeit des Begriffs Web 2.0 führt zu heftigen Diskussionen und die Definition von Tim O’Reilly ist weitgehend umstritten (vgl. Niedermaier 2008, S. 60). Kritik am Begriff Web 2.0 kommt unter anderem auch vom „Begründer des World Wide Web“, Tim Berners–Lee: „Web 1.0 was all about connecting people. It was an interactive space, and I think Web 2.0 is of course a piece of jargon, nobody even knows what it means. If Web 2.0 for you is blogs and wikis, then that is people to people. But that was what the Web was supposed to be all along“8. Berners-Lee zufolge war das WWW von Beginn an als Kommunikationsmittel zwischen Menschen gedacht – dies bedeutet für ihn keine besondere Erneuerung. Anwendungen, die durch den Begriff Web 2.0 zusammengefasst sind, beruhen im Grunde nicht auf neuen Ideen, sondern auf der Möglichkeit höherer Datenübertragung für eine immer größer werdende Teilnehmeranzahl (vgl. Kienitz 2007, S. 15 und vgl. Alby 2007, S. 2). 8 Berners-Lee, Tim (28.07.2006). Interview. URL: http://www-128.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206.txt Abruf am 12.09.2008 39 In dieser Arbeit wird das Web 2.0, in Anlehnung an Tim O’Reillys Definition, als eine Plattform der kollektiven Intelligenz, welche Software über Gerätgrenzen hinweg bereitstellt (Software wird nicht vom Rechner aus gestartet, sondern ist als Web-Anwendung vom Browser aus zu bedienen), verstanden. Es werden damit vor allem dynamische Webseiten, deren Inhalt benutzergeneriert ist assoziiert. Der Nutzer avanciert somit vom passiven Empfänger zum aktiven Produzenten, seine Gewohnheiten werden sich nachhaltig verändern (vgl. Kienitz 2007, S. 14). Aktivität im Web 2.0 „Das Web 2.0 umfasst Internet-Anwendungen und –Plattformen, die die Nutzer aktiv in die Wertschöpfung integrieren – sei es durch eigene Inhalte, Kommentare, Tags oder auch nur durch ihre virtuelle Präsenz. Wesentliche Dynamik. Merkmale Zugleich Konventionen die sind wird somit jedoch Interaktivität, durch Interoperabilität Dezentralität gemeinsame sichergestellt Standards und damit und und die Zusammenarbeit räumlich und zeitlich verteilter Nutzer überhaupt erst möglich.“ (Hass, Walsh, Kilian 2008, S. 7) 2. Social Software Social Software wird als Schlagwort für verschiedene Anwendungen und Entwicklungen dem Begriff Web 2.0 zugeordnet oder mit diesem sogar gleichgesetzt (vgl. Richter; Koch 2007, S. 7). Ebenso wie der Begriff Web 2.0 ist auch der Begriff Social Software nicht genau definiert. In dem viel zitierten Web 2.0-Artikel Tim O´Reillys taucht lediglich der Begriff Social Networks auf, und im amerikanischen Wikipedia-Eintrag werden Social Networks als Unterkategorie der Social Software angesehen. Der Begriff Social Software selbst wird in der Regel für Systeme genutzt, mit denen Menschen kommunizieren, zusammenarbeiten oder auf irgendeine andere Art interagieren können (vgl. Alby 2007, S. 89). 40 Das breite verschiedene Spektrum Weise von Social Software-Anwendungen strukturieren. Schmidt (2006, S. lässt 41) sich auf führt zur Strukturierung beispielsweise drei Basis- Funktionen des Einsatzes von Social Software an: • Informationsmanagement: Ermöglichung des Findens, Bewertens und Verwaltens von (online verfügbarer) Information • Identitätsmanagement: Ermöglichung der Darstellung von Aspekten seiner selbst im Internet • Beziehungsmanagement: Ermöglichung Kontakte abzubilden, zu pflegen und neu zu knüpfen Von Alby (2007, S. 90) wird der Begriff mit der Bestimmung, dass Social Software den Aufbau und das Selbstmanagement einer Community fördern und unterstützen muss, eingegrenzt. Eine solche Software sollte es der Community außerdem erlauben sich selbst zu regulieren. In der Praxis bietet Social Software ihren Nutzern eine Vielzahl von Funktionen zur Unterstützung von Zusammenarbeit. So können diese beispielsweise im Rahmen von Kontaktnetzwerken ihre Freundschaften pflegen, durch Nutzung von Foren Wissen austauschen und es bieten sich ihnen die Möglichkeiten, ihre Informationen zu ordnen und diese Ordnung anderen Nutzern zugänglich zu machen (vgl. Richter; Koch 2007, S. 8). Diese Beispiele machen deutlich, dass der Begriff Social Software in gewisser Weise irreführend ist: Nicht die Software an sich ist sozial, sondern diese Qualität entsteht erst im gemeinsamen, sinnhaft auf andere bezogenen Gebrauch einer spezifischen Anwendung (vgl. Schmidt 2006, S. 40). Social Software stellt den Menschen und sein Bedürfnis nach Beziehungen in den Vordergrund. Der Wunsch, mit anderen Menschen über eigene Meinungen, Erfahrungen und Erkenntnisse zu kommunizieren, gehört gemäß der Maslowschen Bedürfnispyramide zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen (Soziale Bedürfnisse). Social Software wird diesem Anliegen gerecht, indem sie die zwischenmenschliche Kommunikation über das Netz verbessert. Gleichermaßen kann Social Software als Instrument zur Selbstverwirklichung (Bedürfnis nach Selbstverwirklichung) dienen und zur sozialen Anerkennung 41 (Ich-Bedürfnisse) beitragen – zwei weitere Grundbedürfnisse aus der Maslowschen Bedürfnispyramide (vgl. Szugat 2006, S. 108 und Kasper 1996, S. 233). Die Wichtigkeit von Social Software-Programmen zeigt sich in der steigenden Bedeutung von Online-Angeboten, die betont interaktiv und partizipativ ausgerichtet sind, indem sie Usern erlauben kostenlos Material bereitzustellen. Beispielsweise ist Wikipedia zum Standard-Nachschlagewerk geworden und auf YouTube werden täglich über 100 Millionen Filmsequenzen angesehen (vgl. Niedermaier 2008, S. 60-61). Innovation und Integration Eine Besonderheit der Social Software-Anwendungen ist die starke Rückkopplung des Innovationsprozesses: Viele Programme befinden sich in einem Stadium des „perpetual beta“, werden also gemeinsam mit den Nutzern (weiter-)entwickelt. Innovationen in diesem Bereich werden dadurch unterstützt, dass viele Entwickler die Schnittstellen ihrer Programme offen legen, um die Kombination mit anderen Anwendungen zu ermöglichen, oder das gesamte Programm als Open-Source-Projekt entwickeln, das für Modifikationen und Weiterentwicklungen durch andere zur Verfügung steht. Kombination erfolgt im Bereich der Social Software auch durch die Integration verschiedener einzelner Anwendungstypen. So existieren beispielsweise Dienste, die Funktionalitäten von Weblogs und Kontaktplattformen miteinander verbinden: Die Nutzer von MySpace können andere Nutzer als ihre Freunde deklarieren und Weblog-Einträge verfassen, denen sie unterschiedliche Sichtbarkeitslevel zuweisen. Aufgrund dieses spezifischen Zusammenspiels von Nutzungspraktiken und technischen Innovationen ist das Feld der Social Software hoch dynamisch; seine Anwendungen befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Institutionalisierung (vgl. Schmidt 2006, S. 6). Bevor im Folgenden konkret auf die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und Nutzenpotentiale von Social Software eingegangen wird, soll hier bereits ein Überblick über die Systemgruppen vorgestellt werden. 42 Abbildung 4: Systemgruppen von Social Software Informationsmanagement Wikis Social Tagging Weblogs Social Networking Identitätsmanagement Beziehungsmanagement Quelle: Eigene Darstellung nach Schmidt 2006 2.1. Weblogs In den Anfängen des Internets konnte man sich über private Homepages oder über moderierte Foren im Internet mitteilen. Auf Foren konnte diskutiert, bewertet und geurteilt werden. Auf Homepages wurden eigene Inhalte dargestellt. Diese Publikationsmöglichkeit war aber nicht für eine schnelle Änderung ausgelegt. Abgesehen davon, dass man HTML erlernen musste, verfügten nur wenige über die Möglichkeit HTML-Dateien direkt über ein Terminalfenster auf einen Internetserver zu verändern. Erst mit den aktuellen Blog-Systemen wurde das Erstellen von Dokumenten vereinfacht. Die Barriere, selber zu publizieren, ist gefallen (vgl. Alby 2007, S. 25-26). Ein Weblog (auch kurz Blog genannt) ist eine Webseite mit rückwärts chronologisch sortierten Beiträgen (meist Texte und Bilder, in wachsenden Maße auch andere multimediale Inhalte wie Ton- oder Videodokumente), beginnend mit dem aktuellsten Beitrag auf der Startseite dem ältere Beiträge folgen. 43 Der Begriff „Weblog“ setzt sich zusammen aus dem Begriff „web“ und „log“ (Protokoll oder Logbuch). Ein Blog ähnelt in gewisser Weise einem Tagebuch oder Journal, nur, das es im WWW veröffentlicht wird. Die Gesamtheit aller Websites wird Blogosphäre genannt (vgl. Alby 2007, S. 21). Um Beiträge (Posts) zu veröffentlichen bedarf es keiner Kenntnis einer Programmier- oder Auszeichnungssprache. Stattdessen kann der Blogger seinen Artikel nach dem WYSIWYG (What you see is what you get)-Prinzip ebenso einfach publizieren, wie er einen Text in einem Textverarbeitungsprogramm schreiben kann (vgl. Richter; Koch 2007, S. 14). Ein Blog ist aber mehr als ein im Internet geführtes Tagebuch. Die meisten Blogs bieten neben den Inhalten zusätzliche Funktionen, über welche die meisten „normalen“ Webseiten nicht verfügen. So ist es in vielen Blogs möglich, dass die Leser des Blogs Beiträge kommentieren. Partizipation ist hier das Stichwort: die Leser sollen nicht einfach nur lesen, sondern sie sollen teilnehmen, den Autor auf Schwachstellen hinweisen und weitere Aspekte des Themas aufgreifen. Kritiker meinen, dass Blogs nichts anderes als Foren seien, nur dass sich die Forumsteilnehmer auf viele Blogs verteilen. Der Unterschied zu einem Forum ist aber, dass nicht jeder Besucher eine neue Diskussion starten kann, da der Originalbeitrag der Ausgangspunkt jeder Diskussion ist. Weiters ist die Persönlichkeit des Bloggers stilbestimmend (vgl. Alby 2007, S. 21). Trackback, Permalink und Blogroll Eine auf klassischen Webseiten nicht vorhandene Funktion ist der Trackback. Diese Funktion informiert eine Blog-Software, wenn auf einen Eintrag des Blogs in einem anderen Blog Bezug genommen wird. Trackbacks sind den Kommentaren nicht nur ähnlich, weil sie oft wie die Kommentare unter dem Originaltext mit einem Textauszug des Bezug nehmenden Blogs vermerkt werden. Vielmehr stellt der Trackback auch inhaltlich einen Kommentar dar, auch wenn dieser in einem anderen Blog veröffentlicht wird (vgl. Alby 2007, S. 2223). Eine weitere, neue Funktion sind Permalinks; darunter wird die Webadresse verstanden, unter der ein einzelner Eintrag permanent aufgerufen werden kann. 44 Jeder Eintrag erhält seine eigene Adresse. So können einzelne Beiträge leicht weiterempfohlen werden. Trackbacks und Permalinks haben zu einer guten Vernetzung untereinander verholfen, sodass sich neue Themen schnell ausbreiten können. Durch derartige Verlinkungen können zwischen den Blogs thematische Bezüge hergestellt werden und Themencluster entstehen. Zusätzlich kann der Blogger durch eine Blogroll (eine Liste mit Links) auf eigene Quellen und andere, seiner Meinung nach lesenswerte Blogs hinweisen und damit zusätzlich zur gegenseitigen Vernetzung beitragen. Ein Link auf der Blogroll drückt also in der Regel eine, von einem spezifischen Beitrag unabhängige, generelle Empfehlung eines Blogs aus (vgl. Schmidt 2006, S. 41). RSS-Feed Für einen interessierten Blogger bedeutet es einen nicht unerheblichen Aufwand bei der Vielzahl an angebotenen Informationen interessante Neuerscheinungen zusammenzutragen. Denn auch wenn der Nutzer die Weblogs kennt, die er verfolgen möchte, dann muss er diese immer noch regelmäßig („von Hand“) aufrufen und prüfen, ob es neue Einträge gibt. Hier greift das XML18-basierte Syndizierungsverfahren RSS ein. Dabei handelt es sich um eine Technik, die es dem Nutzer ermöglicht, die Inhalte einer Webseite – oder Teile davon – zu abonnieren oder in andere Webseiten zu integrieren. Die benötigten Informationen werden von den jeweiligen Webseiten automatisch in Form eines „RSS-Feeds“ (d.h. durch die Bereitstellung der Daten im RSS-Format) abgerufen. So kann ein User durch die Nutzung von Feedreadern (z.B. Online- RSS-Reader, Browser, Mail-Programme) auf jeweils neu erschienene Artikel eines Weblogs oder eines Newsdienstes zugreifen ohne jede Website extra aufrufen zu müssen (News-Aggregation). Zusätzlich stehen ihm stets die aktuellsten Informationen zur Verfügung. Dabei ist ein RSS-Abonnement nicht auf reine Text-Inhalte beschränkt. Auch Audio- oder Video-Inhalte (Podcasting) können via RSS abonniert werden. Somit bildet RSS eine Grundlage zur Verbesserung der „Awareness“, da die Nutzer schnell und einfach über aktuelle Ereignisse „auf dem Laufenden“ gehalten werden (vgl. Richter; Koch 2007, S. 15-16). 45 Blogs und die traditionellen Medien In Europa genießen Blogs noch nicht die Popularität wie in Amerika, dennoch nehmen sie in mehrerer Hinsicht Einfluss auf die traditionellen Medien. Zum Beispiel lesen Journalisten Blogs, um sich Neuigkeiten und Informationen für eigene Berichte zu besorgen. Blogging-Software ist zum großen Teil mit suchmaschinenfreundlichen Funktionalitäten ausgestattet, wodurch Blogs oft auf Suchergebnisseiten höher gelistet sind als die Webseiten der anderen Medien. Gleichzeitig stehen den traditionellen Medien nicht mehr Möglichkeiten zur Verfügung als den Bloggern, sie haben nicht mehr Platz im Browser-Fenster und ihre Seiten laden auch nicht schneller. Der entscheidende Vorteil ist aber die aktuelle Berichterstattung in Bezug auf lokale oder sehr spezielle Themen. Im Zusammenhang mit der Blogosphäre wird auch vom „Triumph der Amateure“ gesprochen und die Qualität der Berichterstattung kritisiert. Ein Beispiel, welches der Kritik entspricht, handelt von einem Video der Band „Grup Tekkan“, das von Matthias Oborski 2006 entdeckt und auf seinen Blog gestellt wurde. In diesem Videoclip rappen die drei Jugendlichen „in sagenhaft ungelenk nachgeahmter Hip-Hop-Pose und radebrechenden Deutsch“ ein Liebeslied. Durch eine schnelle Verlinkung des Videos in der Blogosphäre wurde das Video innerhalb von Tagen vier Millionen Mal allein auf YouTube angesehen. Fasziniert von der Faszination der Massen griffen die professionellen Medien das Musikstück und die Darsteller auf, gipfelnd in einem Auftritt bei Stefan Raabs Sendung „TV-Total“ und einer CD-Veröffentlichung wenige Tage später (vgl. Friebe; Lobo 2006, S. 188-189). Podcast oder AudioBlogs Ein Podcast ist eine Art Radiosendung, die in den meisten Fällen kostenlos im Internet veröffentlicht wird. Jeder kann einen Podcast erstellen und publizieren. Podcasts werden oft als AudioBlogs (Blogs welche Audiodateien beinhalten) bezeichnet, wobei die Abgrenzung nicht genau definiert ist. Podcasting ist eine Zusammensetzung aus dem Namen des populären MP3Players „iPod“ von Apple und dem englischen Wort „Broadcasting“ (Sendung, Übertragung). Podcasts können wie Blogbeiträge über RSS-Feeds abonniert werden, sodass Neuigkeiten automatisch aus dem Web geladen werden (vgl. Alby 2007, S. 73). 46 2.2. Wikis Wikis sind Anwendungen, die das gemeinsame und (in der Regel) gleichberechtigte Editieren von Textdokumenten im Internet unterstützen; durch ein System der Versionskontrolle können Änderungen am Text von allen Nutzern nachverfolgt und gegebenenfalls ergänzt oder rückgängig gemacht werden. Das wohl bekannteste Wiki ist die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“; darüber hinaus kommen Wikis vor allem im Bereich der Projektdokumentation und des Informationsmanagements zum Einsatz (vgl. Schmidt 2006, S. 39). Die wesentliche Stärke eines Wikis ist der geringe Editieraufwand, da die Seiten von jedem Besucher ohne besonderen Aufwand innerhalb von Sekunden veränderbar und kommentierbar sind. Daher auch der Name, denn „wiki wiki“ ist hawaiianisch für schnell. Die einzelnen Seiten und Artikel eines Wikis sind durch (interne) Links miteinander verbunden, so dass Schlagwörter gegebenenfalls schnell weiter recherchiert werden können. Die Einfachheit der Nutzung liegt darin, dass der Text einer Wiki-Seite eigentlich ohne Kenntnis von Auszeichnungssprachen wie HTML erstellt oder geändert werden kann. Grundsätzlich genügt reiner Text. Um den Text lesbarer und gegliedert zu gestalten, können zusätzlich Zeichenkombinationen verwendet werden, die dem eingeschlossenen Text eine Formatvorlage zuweisen oder Verweise definieren. Die Gesamtheit dieser Zeichenkombinationen wird als WikiSyntax bezeichnet und unterscheidet sich je nach verwendeter Wiki-Software. Allen Dialekten ist jedoch zu eigen, dass sie sehr viel einfacher aufgebaut sind als HTML. Diese Beschränkung auf das Wesentliche ermöglicht einer großen Gruppe von Menschen mit wenig Lern- und Schreibaufwand an diesem System teilzuhaben (vgl. Richter; Koch 2007, S. 19). Die Entscheidung, welche Personen zu einem Wiki beitragen können, ist von besonderer Bedeutung für die Qualitätskontrolle der Texte. Bei Wikis mit großer Nutzerbasis - exemplarisch zeigt dies Wikipedia - kann die Kontrolle der Qualität von gemeinsam erstellten Texten durch Prinzipien der Selbstorganisation erreicht werden: Bei kleineren Gruppen kann es sinnvoll sein, zusätzliche Maßnahmen der Moderation zu etablieren. Spezifische Funktionen der Software, beispielsweise die 47 Versionsgeschichte (die den Vergleich verschiedener Fassungen eines Dokuments erlaubt), unterstützen die Zusammenarbeit und machen es möglich, Fehlinformationen auch wieder zu korrigieren. Im Vergleich zu Weblogs tritt der Aspekt des Identitätsmanagements, also der Präsentation einer individuellen Persönlichkeit, bei Wikis in den Hintergrund (vgl. Schmidt 2006, S. 44-46). 2.3. Social Tagging Inhalte mit beschreibenden Wörtern, so genannten Tags, zu markieren, ist eine gängige Methode, Inhalte für zukünftige Navigation zu organisieren, zu filtern oder zu suchen. Gemeinschaftliches Indexieren ist am sinnvollsten, wenn die Menge an Inhalt zu groß ist, um zentral klassifiziert zu werden. Im Gegensatz zu hierarchischen Systemen - Begriffe ausschließende Taxonomien - schließen tagging-basierte Systeme die Gesamtheit aller Begriffe ein. Grundlegendes Ziel des Taggens ist das Management von Wissen. Der Prozess des Wissensmanagements beinhaltet grundsätzlich das Kategorisieren und Bezeichnen von Inhalten, die schließlich in Sinnbildung resultieren. Wissensgenerierung wird jedoch zusätzlich durch soziale Faktoren beeinflusst: Der Austausch von Erfahrungen mit anderen macht diese nahezu allgemeingültig in einer bestimmten Kultur oder Gruppe, wodurch sich ähnliche Methoden des Organisierens und Managen von Wissen entwickeln. Gesellschaften sind in diesem Zusammenhang in der Lage, kollektiv Wissen zu organisieren und Aktivitäten zu koordinieren. Das Social Web ist infolgedessen als „sozial“ definiert, da nicht nur der Einzelne seine Bookmarks einsehen kann, sondern die Gesamtheit der Benutzer. Sehr oft wird auf tagging basierten Seiten auf kürzlich hinzugefügte Inhalte und Tags referenziert, die zusätzlich darauf verweisen wer diese erstellt hat und wie viele weitere Personen diese gemeinsam haben. Auch Kategorien wie „most popular“ URLs bzw. Verlinkungen zu Benutzern mit ähnlichen Interessen werden angeboten (vgl. Golder; Huberman 2008, S. 1-3). User können sich somit mit Leichtigkeit zwischen Objekten, Autoren, Tags und Indizes bewegen. Wenn eine große Anzahl an Personen sich innerhalb sozialer Software beteiligen, können Möglichkeiten entstehen, die das Benutzerverhalten 48 in der Weise verändern, dass Taggen zu neuen Organisations- und Navigationssystemen führen (vgl. Morville; Rosenfeld 2006, S. 77). Während es bei den Webverzeichnissen nahe liegt, die Kategorien und Items ganz einfach etwa anhand von Eindrücken oder Hierarchiebäumen visuell darzustellen, erfordert dies bei einer scheinbar chaotischen Ansammlung von Begriffen wesentlich mehr Kreativität. Die bisher gängigste Methode sind die sogenannten „Tagclouds“. Diese sind ein typisches visuelles Merkmal von Web 2.0-Anwendungen. Man versteht darunter eine Zusammenstellung von Tags, die einem Objekt verliehen wurde. Die Logik dahinter ist ziemlich intuitiv: Je häufiger ein Tag unter sämtlichen Schlagworten vorkommt, desto höher ist sein Gewicht für den gesamten Webauftritt. Fügt man dann sämtliche Tags als Link (meist alphabetisch) in einer Liste zusammen, sieht man sofort, welche Schlagworte am häufigsten verwendet werden: Je höher die Gewichtung des Wortes, desto dichter oder farbiger erscheint es in der „Wolke“ (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 130). Abbildung 5: Tagcloud von Last.fm über den Musikers Beck Quelle: Last.fm; http://www.lastfm.de/music/Beck/+tags Ein zusätzlicher Zweck der Tagclouds ist die inhärente Drill-Down-Funktion, die es den Usern erlaubt sich weitere Interpreten anzeigen zu lassen, die ebenfalls durch Benutzer zur selben Kategorie hinzugefügt wurden (vgl. Cripe 2007, S. 7). Die Grundidee von „Social Software“ liegt in der Selbstorganisation der Benutzer. Unter Sozialer Software werden Anwendungssysteme, die aufgrund neuer Entwicklungen im Bereich der Internettechnologie und Nutzung von Netzwerkund Skaleneffekten indirekte und direkte zwischenmenschliche Interaktion auf breiter Basis ermöglichen und deren Beziehung im WWW abbilden und 49 unterstützen. Lediglich wenige Konventionen regeln das gemeinsame Handeln auf diesen Plattformen. Die Nutzung der Dienste wird für die Benutzer so einfach wie möglich gestaltet und bietet für den Einzelnen wie auch für die Gruppe möglichst großen Nutzen (vgl. Richter; Koch 2007, S. 4). 2.3.1. In den Folxonomies Anfangszeiten des WWW waren Verzeichnisse von Webseiten unverzichtbar um sich im Netz zurechtzufinden. Zum einen standen die WebSuchmaschinen zu dieser Zeit ganz am Anfang, zum anderen kannten Benutzer Verzeichnisse wie die Gelben Seiten schon aus der Offline-Welt und konnten ihr Wissen schnell auf die Online-Welt übertragen. So war „Yahoo!“ zunächst nichts anderes als eine Sammlung von Bookmarks, aus der ein Verzeichnis von Webseiten wurde (vgl. Alby 2007, S. 115). Die Einordnung von Webseiten in ein Verzeichnis geschieht anhand eines festgelegten hierarchisierten Klassifikationsschemas, einer sogenannten Taxonomie. Eine Fußballseite gehört in die Kategorie Fußball, die in der Kategorie Sport zu finden ist. Menschen kategorisieren jedoch sehr unterschiedlich aus ihrer eigenen subjektiven Perspektive (vgl. Alby 2007, S. 115-116). Das Wort „Folxonomy” ist eine Zusammensetzung der Wörter „Folk” (Englisch für Menschen, Leute) und „Taxonomy”. Im Gegensatz zu einer Taxonomie klassifizieren die Benutzer Objekte wie Bookmarks oder Fotos selbst, indem sie sie mit sogenannten Tags versehen. Ein Tag ist ein Schlagwort oder mehrere beschreibende Begriffe für ein Objekt. Der Vorgang des Annotierens bringt den Nutzern einen Mehrwert, da einerseits das Auffinden der eigenen Ressourcen erleichtert wird, andererseits es dadurch leicht möglich wird, ähnliche neue interessante Ressourcen zu finden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen funktioniert dies für Textinhalte gleichermaßen gut wie für Bilder, Videos oder andere nichttextuelle Inhalte (vgl. Jäschke 2006, S. 1) Die populärsten Web 2.0-Dienste werden von den Usern nicht nur dazu genutzt um Inhalte zu produzieren, sondern auch um den Content zu erschließen. Da 50 manche Autoren ihre Dokumente wechselseitig korrigieren bzw. fortschreiben, spricht man in diesem Zusammenhang von „kollektiver Intelligenz“. Hierzu gehört auch die freie Schlagwortvergabe durch Tags und die Indexierung durch „Tagging“ (vgl. Peters; Stock 2008, S. 77-78). Die Zusammenfassung aller, von Usern zugeordneten Tags, wird schließlich als Folxonomy bezeichnet und ermöglicht über das User-Interface die Suche bzw. Anzeige über alle Dimensionen. Dem eingeloggten Benutzer werden die von ihm upgeloadeten Daten samt zugeordneten Tags angezeigt. Ein Klick auf eine Ressource zeigt diejenigen User, die gleiche Daten eingetragen haben und deren hinzugefügte Verschlagwortung. Schließlich zeigt ein Klick auf ein Tag jene Ressourcen, die einem Tag zugeordnet sind (vgl. Priss; Polovina; Hill 2007, S. 284) Der entscheidende Unterschied zu einer Taxonomie ist, dass keine Kategorien von irgendeiner Instanz vorgegeben sind; jeder entscheidet selbst, welche Tags verwendet werden, denn primär geht es darum, dass der Benutzer selbst seine Daten findet. Gleichzeitig werden die Objekte nicht in einen Kategorienbaum eingeordnet; im Gegensatz zu einer Taxonomie entsteht bei einer Folxonomy keine Hierarchie; alles wird auf einer Ebene abgelegt (vgl. Alby 2007, S. 121). Folxonomies können als schwache Onthologien aufgefasst werden, wobei Tags durch Benutzer und Ressourcen miteinander verbundene Konzepte darstellen und Benutzer und Ressourcen als Instanzen der Konzepte betrachtet werden (vgl. Jäschke 2006, S. 2). Gerade diese spezifischen strukturellen Netzwerkeigenschaften erklären, warum Folxonomies ihre Mitglieder faszinieren. 51 Tabelle 1: Vor- und Nachteile von Folxonomies Vorteile • Spiegeln die Nachteile Sprache der Nutzer • Fehlendes kontrolliertes Vokabular authentisch wider • Erlauben verschiedene Interpretationen • Verschiedene Levels der Indexierung • Sind der • Vermischung von Sprachen Möglichkeit, • Versteckte paradigmatische Relationen eine günstige Form Inhaltserschließung • Sind die einzige Masseninformationen im Web zu bleiben ungenutzt erschließen • Sind Termquellen für die Entwicklung und Pflege von Onthologien • und bibliographischen Tags und Aboutness- kontrollierten Vokabularien • Tags Geben die Qualitätskontrolle an Nutzer • weiter • Erlauben Fehlende Trennung von formalen bzw. Spam–Tags, nutzerspezifische Tags und andere uneindeutige Schlagworte konkretes Suchen und • Browsing Verschmelzung von Ofness, Aboutness, Ikologie und Isness • Berücksichtigen Neologismen • Tragen dazu bei, Communities zu identifizieren • Geben eine Basis für RecommenderSysteme • Sensibilisieren Nutzer für die Inhaltserschließung Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Peters; Stock 2008 S. 38-39 2.3.2. Recommender-Systeme Recommender-Systeme sind Hilfsmittel für den einzelnen Nutzer, um Überblick im Chaos der Vielzahl an Produkten bzw. Objekten im Web zu schaffen. Es bezeichnet eine Software, deren Aufgabe darin besteht, dem Benutzer auf Grundlage seiner Präferenzen eine Empfehlung, z.B. für einen Artikel, ein Band oder einen Song zu geben. Recommender-Systeme sind Verfahren der Ähnlichkeitsbestimmung zwischen Interessensprofilen einzelner Nutzer. Dazu benötigt es zum einen die ungefilterten Hintergrunddaten und als weiteren Input Informationen über den Nutzer. Das Recommender-System ist ein Algorithmus, 52 der beide Daten kombiniert und als Ergebnis personalisierte Empfehlungen generiert (vgl. Mürzl; Riemenschneider 2008, S. 2-3). Empfehlungssysteme werden vor allem in Applikationen wie Webstores, OnlineCommunities oder Music-Player verwendet. Sie berechnen, ob der User ein spezielles Objekt bevorzugt; oder das System identifiziert eine Reihe von Objekten, die für den Benutzer interessant sein könnten (vgl. Mortensen 2007, S. 8). „Social resource sharing systems are web-based systems that allow users to upload their resources, and to label them with arbitrary words, so-called tags. The systems can be distinguished according to what kind of resources are supported. Flickr, for instance, allows the sharing of photos, del.icio.us the sharing of bookmarks, CiteULike and Connotea the sharing of bibliographic references, and Last.fm the sharing of music listening habits” (Jäschke 2006, S. 1) „Content-Based“ Filtering und „Collaborative“ Filtering sind zwei unterschiedliche Algorithmen, die in diesem Zusammenhang verwendet werden. Content-based Filtering Content-Based Filtering (CBF) analysiert die Ähnlichkeiten von Objekten (z.B. Dokumenten), indem das System bestimmte Parameter bzw. Eigenschaften misst und diese mit Eigenschaften weiterer Elemente vergleicht. Dem Anwender werden, z. B. wenn er ein Dokument über ein bestimmtes Thema gelesen hat, weitere Dokumente diesbezüglich angeboten (vgl. Heymann 2004, S. 3-4). In diesem Fall werden Produkte anhand ihrer unterschiedlichen objektiven Eigenschaften klassifiziert und entsprechend ihrer Eigenschaftsausprägung bewertet. Daraufhin versucht das CBF-System auf Grundlage der objektiven Eigenschaften und Ausprägung auf die Präferenz des Nutzers bezüglich dieser Objekte zu schließen. Im Anschluss daran werden die Objekte in eine Rangordnung gebracht, die der tatsächlichen Rangordnung des Nutzers möglichst nahe kommen soll. Von Bedeutung ist hierbei die relative Präferenz der Objekte 53 untereinander und nicht die Präferenz des einzelnen Objektes (vgl. Büttner 2008, S. 2-3). Vorteilhaft im Bezug auf CBF ist die einfache Erweiterung von neuen Elementen im System, wenn die zu messenden Parameter, z. B. durch Volltextsuche, direkt erfassbar sind. Neue Elemente können dementsprechend den vorhandenen Kategorien zugeordnet werden. Ein Nachteil dieser Methodik besteht darin, dass der Entscheider grundsätzlich keine neuen Elemente empfehlen kann, da sich die Struktur auf die Ähnlichkeit von Elementen bezieht und somit die Empfehlungen auf die vorhandenen Vorlieben des Nutzers bezieht. Neuentdeckungen bzw. Angaben zur Qualität von Elementen werden vom System nicht unterstützt. Zudem können Elemente trotz hoher Schlüsselwortanzahl durchaus semantisch unterschiedliche Bedeutung haben (vgl. Heymann 2004, S. 3-4). Collaborative Filtering Der Ansatz des Collaborative Filtering (CF) vergleicht die ausgewählten Elemente und schlägt dem Benutzer Elemente vor, die andere Teilnehmer in diesem Zusammenhang ausgewählt haben. Die Methode sucht nicht nach ähnlichen Elementen, Ähnlichkeiten sondern zwischen nach Benutzern Benutzern mit werden ähnlichem ermittelt, Geschmack. indem das Die System vergangene Entscheidungen aller Teilnehmer miteinander vergleicht und jene Teilnehmer auswählt, die eine große Anzahl gleichartiger Entscheidungen getroffen haben (vgl. Mortensen 2007, S. 10-12). Eine metaphorische Analogie wäre die Empfehlung eines Freundes, der den Benutzer sehr gut kennt, und ihn auf eine Neuigkeit aufmerksam macht. Vorteile des CF bestehen darin, dass dem Benutzer Elemente empfohlen werden können, die keinerlei Ähnlichkeit mit den bereits ausgewählten Elementen haben. Nachteilig ist die so genannte „Cold-Start“-Problematik, die besagt, dass (neue) Elemente schlichtweg nicht empfohlen werden können, wenn noch keine Bewertung vorliegt. Des Weiteren sollte das Benutzerprofil hinreichend bekannt sein, um eine qualitativ hochwertige Empfehlung geben zu können. Nur auf Basis von einer Vielzahl bereits ausgewählter Elemente, d.h. aktiver Beteiligung, kann 54 das Empfehlungssystem ausreichend ähnliche Teilnehmer finden (vgl. Heymann 2004, S. 3-4). Ein Problem von CF liegt in der Vertrauenswürdigkeit von Empfehlungen. Der Nutzer weiß nicht, warum ein bestimmtes Objekt empfohlen wurde. Auf Basis von geschätzten bzw. möglicherweise unvollständigen Daten werden Empfehlungen seitens Benutzer abgegeben, die vollkommen korrekt, jedoch auch vollkommen falsch sein können. Deshalb gibt es weitere Ansätze von CF, die diese Unschärfe verringern: (Für Folgendes vgl. Mortensen 2007, S. 11-12) Memory-based (user-based) CF Memory-based CF versucht aufgrund aller bereits empfohlenen Objekte von Usern Empfehlungen abzuleiten. Dabei werden die dem aktiven Empfehlungsempfänger am ähnlichsten Nutzer mittels verschiedener Methoden identifiziert („nearest-neighbour“). Dieser Ansatz erfordert hohen Aufwand an Rechenzeit und Speicher, um die Nachbarschaft zweier Empfehlungsempfänger zu bestimmen, da die Gesamtheit der Nutzer-Objekt-Matrix auf mögliche Ähnlichkeiten geprüft werden muss. Zusätzlich ist die Sicherung der Benutzerprofile mit Risiken verbunden (vgl. Büttner 2008, S. 9-10). Model-based CF Das Model-based CF erstellt aufgrund des gesamten Datenbestandes ein beschreibendes Modell von Nutzern, Objekten und Bewertungen. Das Modell wird meist offline über mehrere Stunden bzw. Tagen aufgebaut. Empfehlungen werden aufgrund von Abfragen dieses Modells errechnet. Anstatt die Ähnlichkeit von Benutzern zu bestimmen und daraus Empfehlungen zu erstellen, nutzt das Model-based CF Gleichartigkeit von Objekten (vgl. Mortensen 2007, S. 14). Hybride Ansätze Hybride Systeme versuchen durch Kombination der beiden zuvor beschriebenen Ansätze die jeweiligen Nachteile zu beseitigen. Beispielsweise wird die Methode des CF angewendet, wobei das Problem des „Cold-Start“ durch content-basierte Komponenten behoben wird. Für jeden Teilnehmer werden gegebenenfalls sowohl reale Einträge bzw. Bewertungen als auch „Pseudo-Bewertungen“ 55 gespeichert. Werte dieser Pseudo-Entscheidungen orientieren sich an Bewertungen, die der Teilnehmer tatsächlich für inhaltlich verwandte Elemente abgegeben hat. Daraufhin werden diese, aufgrund von CF-Elementen als so genannte „Nachbarn“ identifiziert und aufgrund der Ähnlichkeit zur Empfehlung herangezogen (vgl. Heymann 2004, S. 5-6). 2.4. Social Networking Bei Social Networking-Anwendungen hat der User die Möglichkeit, ein eigenes Profil zu erstellen, welches persönliche Informationen (Alter, Wohnort, Interessen, Foto, etc.) und Kontaktdaten beinhaltet. Dieses Profil ist dann für andere Nutzer (meist unter verschiedenen, selbstbestimmten Einschränkungen) zugänglich (vgl. Richter; Koch 2007, S. 27). Eine Social Networking-Software bietet dem Nutzer vielfältige Funktionen. So wird auch im Rahmen dieser Netzwerke die Tagging-Technik, angewandt auf Personen, eingesetzt und der Nutzer kann Profile mit ähnlichen Interessen finden. Verbesserte Navigation, stärkere Strukturierung und benutzerspezifische Einstellungen hinsichtlich der Freigabe persönlicher Daten fördern zusätzlich die Bereitschaft solchen Netzwerken beizutreten. Die grafische Gestaltung der jeweiligen Seite und die Veröffentlichung eigener Inhalte werden durch Standardbausteine erleichtert (vgl. Richter; Koch 2007, S. 27). Das strukturierte Abfragen der Information in Formularen hat den Vorteil, dass man im Netzwerk über eine erweiterte Suchfunktion speziell nach bestimmten Gesichtspunkten filtern kann. Das gesamte Netzwerk profitiert daher davon, wenn die Mitglieder möglichst viel von sich preisgeben. Zu den Profileingaben kann optional ein Foto hochgeladen werden. Wird kein Foto hochgeladen, erscheint ein „Dummy“, dass den User stets daran erinnert, dass sein individuelles Foto noch fehlt. Das Profilfoto spielt eine weitere wichtige Rolle. Es fungiert sehr oft als Icon, das heißt es wird symbolisch mit dem Namen zusammen gezeigt, wenn jemand eine Nachricht schickt, oder einen Beitrag im Forum liefert, so dass der Nutzer sofort sieht um wen es sich handelt (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 85-87). 56 Die Verknüpfungen zu anderen Profilen werden auf den Plattformen unterschiedlich realisiert. Meist müssen beide Seiten einwilligen, damit ein Kontakt hergestellt werden kann. Diese Kontakte sind dann für alle Mitglieder sichtbar. Wenn man ein Profil eines anderen Mitgliedes betrachtet, wird durch die Visualisierung der Kontakte angezeigt, über wie viele Kontakte das Mitglied verfügt (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 88-89). Es wird klar, dass es sich beim Social Networking um eine Art der Selbstdarstellung handelt, welche bewusst von den Usern genutzt wird um bemerkt zu werden. Selbstdarstellungen im realen Leben finden in realen, räumlichen Umgebungen statt und sind den dort geltenden Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Dies bedeutet, dass es beispielsweise nicht möglich ist, sich als anonymer Mensch durchs Leben zu bewegen. Der Körper ist immer mit physischer Präsenz verbunden, sendet Zeichen und wird zum hauptsächlichen Träger der Selbstdarstellung (vgl. Misoch 2004, S. 51-52). Virtuelle Identität kennzeichnet sich durch die vollständige mediale Vermittlung aller Zeichen. Alles was man von sich preisgeben will, muss man auch bewusst eingeben und versenden. Unbewusste Selbstdarstellungen, wie z.B. Stottern oder Erröten, fallen weg. Durch den Kontrollgewinn werden den Individuen neue Möglichkeiten gegeben das eigene Selbst selektiv in der virtuellen Welt zu präsentieren (vgl. Misoch 2004, S. 130-132). Obwohl es den Teilnehmern in sozialen Netzwerken hauptsächlich darum geht, wahrgenommen zu werden, braucht es zum Networking doch auch inhaltliche Anknüpfungspunkte. Diese zeigen sich in den großen Communities durch das Herausbilden von Gruppen. Jedes Mitglied hat generell die Möglichkeit, eine eigene Gruppe zu eröffnen. Die Gruppen sind meistens eigene kleine Plattformen, die über eine Mitgliederverwaltung, Foren, Blogs und Umfragetools verfügen (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 89). Social Networking kann in verschiedene Social Software-Programme integriert sein (z.B. last.fm), ist aber auch oft die Hauptfunktion eines Anbieters (z.B. Xing, Facebook, studivz). 57 3. Nutzung von Web 2.0-Angeboten Die Nutzung von Web 2.0-Angeboten wird hier von mehreren Seiten beleuchtet. Als erstes soll die Zuwendung zum Medium geklärt werden. Die Frage „Warum wenden sich Menschen dem Web 2.0 hin?“ steht im Mittelpunkt. Danach wird die Nutzungshäufigkeit anhand von Studien dargelegt. Dabei wird zwischen passiven und partizipierenden Nutzern unterschieden. Abschließend soll das Prinzip des „Long Tail“ erklärt werden, welches darlegt, dass auch die „unwichtigsten“ Nischenangebote im Web 2.0 genutzt werden. Medienwirkungsforschung Nur wenige Themen sind in den letzten Jahren so intensiv und kontrovers diskutiert worden, wie die immer stärkere Durchdringung des Alltags durch Medien. Die traditionelle Trennung zwischen den verschiedenen Medien wird durch ihre wachsende Multifunktionalität zunehmend obsolet (vgl. Münch 2008, S. 266). Versucht man das Internet bzw. das Web 2.0 in den Kontext von Medientheorie und Massenkommunikation einzuordnen, wird deutlich, dass mit dort vorfindbaren Begriffsbestimmungen und einer Fixierung auf Einzelmedien das sich technisch, strukturell und inhaltlich stetig verändernde Kommunikationsphänomen Internet nur bedingt erfassen lässt. Das Internet nötigt zu einer medienübergreifenden Sichtweise. Es weist durch seine Aufhebung der dichotomen Rollenfixierung auf Sender und Empfänger sowie durch seine generelle Offenheit für Nutzer und Inhalte weit über die Charakterisierung der Massenmedien als Instrumente der Einwegkommunikation hinaus. Mit den neuen medialen Technologien wie dem Internet wird die gewohnte Trennung zwischen den Produzenten und den Rezipienten im Prozess der öffentlichen Kommunikation aufgehoben. Unter Berücksichtigung seines kommunikationsverändernden Potentials ist das Internet mit seinen verschiedenen Diensten ein umfassendes Multimediasystem, das eine eigene Kultur mit eigener Sprache, eigenen Kunstformen und eigenem Regelwerk entwickelt hat. Damit scheint sich das traditionelle Medienverständnis aufzulösen, in jedem Fall ist es auszuweiten. Technische, soziale und kulturelle 58 Veränderungen im Medienbereich sind „nicht Ursache, sondern selbst schon Ausdruck einer geänderten gesellschaftlichen Bedarfslage“ (Eibl; Podehl S. 174175) Bei der Beschäftigung mit Medien lassen sich grob vier Forschungsbereiche unterscheiden (Für Folgendes vgl. Münch 2008, S. 462-463): • Kommunikationsstudien: Sie beschäftigen sich mit den Handlungsmotiven und –bedingungen von Medienproduzenten (z.B. Studien zur Programmgestaltung; Fragen der Vermarktung). • Studien zur Struktur von Medieninhalten: In inhaltsanalytischen Studien wird die Struktur von Medieninhalten offengelegt und zumeist mit der Frage nach ihrer Wirkung verbunden. • Rezipientenstudien oder Publikumsforschung: o Die Medienwirkungsforschung beschäftigt sich mit dem Einfluss von Medienbotschaften auf das Verhalten und die Einstellungen von Rezipienten. Die Diskussion um den Einfluss der Musikindustrie auf die Popularität von Musiktitel und –interpreten kann hier eingeordnet werden. o Die handlungs- und subjektorientierte Rezeptionsforschung fragt danach, wie und warum Menschen mit Medien umgehen und welcher individuelle Sinn daraus für sie erwächst. • Medienstrukturen: Die Fokussierung auf die strukturellen Bedingungen selbst und den daraus sich ergebenden Konsequenzen für die mediale Botschaft, findet sich besonders in systemtheoretischen und postmodernen Ansätzen. So hat z.B. die Einführung der Fernbedienung beim Fernsehen zu stark veränderten Rezeptionsmustern geführt („Zappen“). Das Interesse dieser Arbeit ist in den Bereich der Rezeptionsstudien und Publikumsforschung einzuordnen. Die Frage „Warum wenden sich Menschen bestimmten Medien zu?“ kann im Uses and Gratifications Approach bzw. in der Theorie des aktiven Publikums dargestellt werden. Zwar wurde z.B. durch die verschiedenen Modelle der Informationsverarbeitung (siehe dazu Kapitel I.3.1.) dem Publikum durchaus Aktivität zuerkannt, doch wurde diese nicht als unabhängige Variable eingeführt, sondern eher als mediatisierende „Störgröße“ 59 im Wirkungsprozess. Seit Beginn der 1970er-Jahre rückte das „aktive Publikum“ in den Vordergrund der Massenkommunikationsforschung: „Was machen die Menschen mit den Medien“ hieß nunmehr die neue Forschungsfrage (vgl. Schenk Medienwirkungsforschung S. 59-61). Der Uses and Gratifications Approach unterstellt, dass jeder Mensch Vorgänge in seiner Umwelt subjektiv interpretiert, so dass sie für ihn Nutzen haben, d.h. seinen Bedürfnissen entsprechen. Menschen suchen aktiv nach einem Weg ihre individuellen, für sie momentan relevanten Bedürfnisse zu befriedigen. Dies gilt auch für das Medienhandeln. Die Rezipienten erhoffen sich durch die Mediennutzung eine Art Belohnung („gratification“). Also führen Bedürfnisse und daraus entstehende Motive Rezipienten die zur Befriedigung Nutzung von Medien, wodurch sich die ihrer Bedürfnisse erhoffen (vgl. Burkart, Kommunikationswissenschaften S.219-221). Burkart (1995, S. 228-230) nennt folgende Arten der Gratifikation: • Ablenkung und Zeitvertreib: Realitätsflucht, emotionale Befreiung, Flucht vor Problemen, Stress. • Persönliche Beziehungen: zu Moderatoren als wären sie „gute alte Bekannte“, soziale Isolation. • Persönliche Identität: Selbstfindung, Selbstbestätigung, Identifikation mit Personen/Ideen/Situationen. • Kontrolle der Umwelt: Information über die Umwelt. Man unterstellt, dass der Empfänger massenmedial vermittelter Aussagen mit diesen sehr subjektiv interessengeleitet umgeht, benützt. d.h. sie Mediennutzung auf gilt ganz als eine persönliche in viele Weise andere Handlungsabläufe eingebettete Aktivität des Individuums, sie gilt als eine von mehreren Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung (vgl. Burkart 1995, S. 223). Die Idee vom aktiven Publikum lässt sich in ihren Kernthesen nun folgendermaßen darstellen: • Das Publikum der Massenkommunikation ist als aktives Element im Massenkommunikationsprozess zu begreifen, es ist weit davon entfernt, 60 „passiv“ zu rezipieren. Mediennutzung muss im Gegenteil als ein aktives und zielorientiertes Handeln gesehen werden. • Die Zielgerichtetheit des Rezipienten-Handelns resultiert nicht einfach aus bestehenden Prädispositionen (Einstellungen und normative Erwartungen), sondern erklärt sich aus dem Zustand der individuellen menschlichen Bedürfnislage: die Massenmedien und ihre Inhalte stellen eine Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung dar. • Die Massenmedien stehen als Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung allerdings in unmittelbarer Konkurrenz zu anderen Gratifikationsinstanzen, d.h. Mediennutzung stellt nur eine von mehreren Handlungsalternativen dar, die als potentiell funktional äquivalent angesehen werden müssen. Der Uses and Gratifications Ansatz legt nahe, dass sich Rezipienten zunächst einmal aus einer bestimmten Intention heraus dem Web 2.0 als Musikmedium zuwenden – sie erwarten sich die Befriedigung ihrer Bedürfnisse, etwa nach Information über Musikangebote, sowie nach Unterhaltung und Identifikation. 61 Web 2.0-Nutzer Die veränderte individuelle Nutzung des Internets hat zu einem sozialen Wandel beigetragen. Es erweitern sich die Öffentlichkeiten durch die Blogosphäre und der aktive Nutzer gewinnt an Bedeutung (vgl. Schmidt 2008, S.24-25). Durch zahlreiche Studien wurde versucht diese Nutzung von Web 2.0-Angeboten quantifizierbar zu machen. Die Studien wählen für ihre Ergebnisse immer unterschiedliche Fragestellungen wie z.B. „Nutzen Sie Videoportale?“ oder „Haben Sie schon einmal einen Beitrag auf Wikipedia verfasst?“ und Ähnliches. Dies erscheint auch sinnvoll, da sich der „normale“ Nutzer von Web 2.0 keine Gedanken machen wird, ob er sich gerade im Web 1.0 oder im Web 2.0 befindet. Die Studien sind deshalb aber nur teilweise vergleichbar. Die umfassende ARD/ZDF-Onlinestudie (2008: n=1802) ermittelt jährlich die Nutzung von Internetangeboten in Deutschland. Sie zeigt, dass 65,8 Prozent der Deutschen online sind, ein Zuwachs von 1,9 Millionen Internetnutzern gegenüber dem Vorjahr. Durchschnittlich verbringt jeder Erwachsene täglich 58 Minuten (2007: 54 Minuten) im Internet. Am meisten werden nach wie vor E-MailFunktionen und Instant-Massaging-Dienste genutzt. Aktive vs. Passive Nutzung Die Web 2.0 Tomorrow Studie von Burda Community Network (2008 / n=2881) identifiziert 50 Prozent aller Onliner als Web 2.0-Nutzer (Wikipedia und E-bay ausgeschlossen). Rund 20 Prozent davon beteiligen sich aktiv am Web 2.0, produzieren also selbst Inhalte. Die ARD/ZDF-Onlinestudie schätzt das Interesse der Onliner an der aktiven Teilnahme etwas geringer ein. Nur 13 Prozent sind sehr interessiert am aktiven Mitwirken. Für zwei Drittel ist dies „schlicht uninteressant“. Eine etwas ältere Studie (2006) des Markt- und Meinungsinstituts result in Zusammenarbeit mit der Medienforschung des Südwestrundfunks zeigt folgendes Bild (n=501): 11 Porzent der Onliner nutzen Web 2.0-Anwendungen ein- oder mehrmals pro Woche, weitere 9 Prozent der Onliner nutzen Web 2.0- Anwendungen (fast) täglich. Diese Studie zeigt eine überdurchschnittliche aktive 62 Beteiligung der Nutzer. Allerdings werden unter aktiver Beteiligung nicht nur produzierende sondern auch kommunizierende User verstanden. Abbildung 6: Passive und aktive Nutzer in Prozent Quelle: result Alle Studien zeigen, dass es sich bei der Nutzung von Web 2.0-Anwendungen nicht um eine Randerscheinung handelt, sondern vielmehr ein weiterer Anstieg zu erwarten ist, da sich vor allem Jugendliche verstärkt im Web 2.0 aufhalten. Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie „tummeln sich 49 Prozent der 14- bis 29Jährigen in privaten Netzwerken“ (dies ist dreimal so häufig wie die Gesamtheit der Onliner), 48 Prozent suchen regelmäßig Videoportale auf, und Wikipedia ist mit 40 Prozent ein fester Bestandteil der Onlinenutzung in dieser Altersgruppe. Abbildung 7: Web 2.0-Nutzung durch Erwachsene und 14- bis 29-Jährige / wöchentliche Nutzung in Prozent aller Onliner Quelle: Eigene Darstellung nach ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 (n=1186) 63 Typologie der Nutzer Auf Basis der Nutzungsmotive typologisiert das Markt- und Meinungsinstituts result die Web 2.0-Anwender in 8 Kategorien. Innerhalb dieser Grafik wurden die Typen von Web 2.0-Nutzern platziert – die Größe der Felder zeigt nicht die Größe der Gruppen, sondern die mögliche Bandbreite der gestaltenden und kommunikativen Involviertheit an. Abbildung 8: Typologie der Nutzer Quelle: result Infosucher Eine große Gruppe von Nutzern nutzt Web 2.0 nicht kommunikativ oder gestaltend, sondern rein betrachtend. Die einzigen Mitgestaltungen sind bei diesen Usern in der Regel Orientierungsfragen; öffentliche Kommunikation beschränkt sich auf sporadische Kommentare. 64 Unterhaltungssucher In Abgrenzung zu den Infosuchern stehen für Unterhaltungssucher vor allem die Unterhaltungsaspekte im Vordergrund. Ein Beispiel dafür ist jemand, der Videos auf You-Tube ansieht, ohne sie zu kommentieren. Auch diese Gruppe macht kaum von den Kommunikations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten im Internet Gebrauch. Kommunikatoren Nutzer dieser Gruppe machen Gebrauch von den öffentlichen Kommunikationsmöglichkeiten des Web 2.0, haben aber kein Interesse, etwas zu gestalten oder zu veröffentlichen. Die öffentliche Kommunikation im Web 2.0 findet eher betrachtend statt. Beispiele für diese Gruppe sind etwa Blogleser, die sich mit Kommentaren an Diskussionen beteiligen. Profilierte Profilierte nutzen die Möglichkeiten von Kommunikation und Mitgestaltung gleichermaßen. „Idealtypisches Beispiel ist ein Blogger, der in seinem Weblog Inhalte veröffentlicht, die (zumindest ähnlich) auch in anderen Medien hätten veröffentlicht werden können, sich selbst darstellt, dabei ein spezifisches inhaltliches Interesse verfolgt (das nicht selten selbstreferenziell das Bloggen beziehungsweise das Internet ist) und in der Blogosphäre öffentlich und vernetzt kommuniziert“. Netzwerker Netzwerker geht es vor allem um den kommunikativen Aspekt von Web 2.0: den öffentlichen und vernetzten Austausch mit anderen Nutzern (z.B. die Veröffentlichung von Fotos und Videos). Alle Nutzergruppen (außer den passiven Nutzern) haben Überschneidungen mit der Gruppe der Netzwerker, da Kommunikation die entscheidende Dimension einer Nutzung des Internets im Sinne von Web 2.0 darstellt. Spezifisch Interessierte Diese Gruppe von Usern nutzt die Partizipationsmöglichkeiten von Web 2.0 im Kontext eines ganz bestimmten Interesses oder Hobbys. Das Web 2.0 bietet dabei den Vorteil, Gleichgesinnte kontaktieren zu können und sich in vernetzten 65 Strukturen über ein gemeinsames Thema auszutauschen oder Angebote zum eigenen Thema überhaupt erst zu finden. Selbstdarsteller Selbstdarstellern geht es in erster Linie um die Darstellung der eigenen Person. Klassisches Beispiel für diese Nutzergruppe sind Nutzer von Profilen auf MySpace. Erreichen die Selbstdarstellungen eine über bloße Selbstdarstellung hinausgehende Qualität, überschneidet sich diese Gruppe mit den Produzenten oder den Profilierten, bei einem sehr hohen Grad an öffentlicher Kommunikation werden solche Nutzer auch der Gruppe der Netzwerker zugeordnet. Produzenten Produzenten sind Nutzer, denen es in erster Linie darum geht, Inhalte zu veröffentlichen und die dafür Web 2.0-Angebote nutzen. Die Produzenten sind an Kommunikation und Vernetzung nur insoweit interessiert, dass sie der Verbreitung ihrer Werke dient. Die Community an sich ist dabei zweitrangig. Abgesehen von Infosuchern (31 Prozent) und Unterhaltungssuchern ( 34 Prozent), die Web 2.0-Angebote nutzen, ohne Gebrauch von Mitgestaltungs- oder Kommunikationsmöglichkeiten zu machen, bilden die Kommunikatoren (34 Prozent) die größte Gruppe der aktiven Web 2.0-Nutzer. Die zweite große Gruppe ist die der „spezifisch Interessierten“. Hier zeigt sich, dass sich Web 2.0-Angebote für Nischeninteressen bzw. für „spitze Zielgruppen“ besonders gut eignen. 66 The Long Tail Der große Vorteil von Social Software ist, dass sie im Gegensatz zu zum Beispiel Radiosendungen keine Hits braucht um wirtschaftlich zu arbeiten. Im Web 2.0 stehen die unzähligen Nischen und Einzelpersonen den großen Hits gegenüber. Und das mit Erfolg. Die wenigsten Musikaufnahmen schaffen es in die Top 100, dennoch erreichen sie ein Publikum, das in die Millionen geht. Der Nischenmarkt kann zwar den traditionellen Mart der Hits nicht ersetzen, teilt sich aber mittlerweile mit ihm das Rampenlicht. Es müssen keine Regale mehr nach passenden Musikstücken durchsucht werden, das Internet übernimmt Lager-, Distributions- und Sendefunktion – und das zu einem Bruchteil der Kosten. Nach dem „Pareto Prinzip9“ verteilen sich Märkte nach der 80:20-Regel. 20 Prozent der Produkte erzielen 80 Prozent des Umsatzes und 100 Prozent des Gewinns. Doch bei digitalen Inhalten gelten andere Gesetze. Der Unternehmer Robbie Vann-Adibé, CEO von Ecast, ein Hersteller von digitalen Musikboxen erzielt erstaunliche Zahlen. Diese Musikboxen sind mit dem Internet verbunden und die Nutzer können aus Tausenden von Musikstücken wählen, die heruntergeladen und auf der Festplatte gespeichert werden können. Der Prozentsatz an verkauften Alben pro Quartal liegt bei 98. Fast jedes Musikstück findet seinen Abnehmer. Da es sich um Bits auf einer Datenbank handelt, deren Speicherungs- und Übertragungskosten sehr gering gehalten werden können, rentieren sich auch Songs die nicht in hoher Stückzahl erworben werden. Ein anderes Beispiel bietet der Musikanbieter Rhapsody. Die Nachfragekurve dieses Online-Musikanbieters erreicht nie die Null (Kurven zur Häufigkeitsverteilung werden „Long Tailed“ genannt). Selbst die unbeliebtesten Titel werden einige wenige Male gehört. Rhapsody und digitale Musikboxen sind zwar keine Social Software, zeigen aber auf, dass bei „grenzenlosen“ Konsummöglichkeiten auch tatsächlich „grenzenlos“ konsumiert wird (vgl. Anderson 2007, S. 11-12). 9 Beim Pareto Prinzip handelt es sich um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung im Gegensatz zum Pareto-Optimum. 67 Abbildung 9: The Long Tail Der Long Tail, hier orange eingefärbt, ähnelt einem langen Schwanz. Auf der Y-Achse ist die Anzahl der Verkäufe und auf der X-Achse sind die Produkte nach Reihenfolge ihrer Verkaufsstatistik aufgelistet. Quelle: Alby 2007, S. 154 und www.longtail.com Das Phänomen des sogenannten Long Tail ist für derartige Anbieter vor allem deshalb so interessant, weil Produkte, die nur in einem geringen Ausmaß nachgefragt werden, in Summe einen Marktanteil ausmachen können, der vom Umfang her mit den wenigen Bestsellern vergleichbar ist. Anderson formuliert sechs Thesen, die den Long Tail ausmachen. Zunächst geht er davon aus, dass es in fast allen Märkten mehr Nischen geben soll als Hits. Je mehr die Kosten für die Produktion sinken, desto größer soll dieser Nischenmarkt werden. Gleichzeitig, so Anderson, kostet es immer weniger, diese Nischen zu erreichen. Dass das funktioniert, liegt vor allem an den Suchtechnologien, denn ohne sie wären die Nischen nicht zu finden (vgl. Alby 2007, S. 155). Das Problem des Informationsüberflusses durch das riesige Warenangebot kann aber nicht alleine durch Suchfunktionen gefiltert werden, doch durch die unterschiedlichen Möglichkeiten des Social Taggings können die eigenen Vorlieben empfohlen werden. Ohne diese Filter wären die Nischen, die zum eigenen Geschmack passen, nicht zu finden. Personalisierte Medien, welche sich durch Social Tagging organisieren, ersetzen aber nicht die traditionellen Massenmedien. Jedoch werden die traditionellen Medien nicht mehr so stark wachsen wie in der Vergangenheit (vgl. Leonhard 2008, S. 107-110) 68 Die Anbieter von Nischenprodukten dürfen allerdings nicht vergessen, dass nicht sie an den vielen kleinen Nischen verdienen, sondern wiederum die großen Verkäufer wie z.B. Amazon.com. „Der einzelne Anbieter bleibt so klein und unbedeutend wie er ist“10. Es handelt sich beim Long Tail nicht um ein neues Geschäftsmodell, denn auch bisher konnte man im Plattenladen jede CD bestellen, sondern um die Beschreibung des Erfolgs einiger weniger Großen durch das Anbieten vieler Nischenprodukte. Kleine Anbieter, oder Künstler selbst, können von diesem „Effekt“ nicht profitieren. Nur die großen Anbieter können die Größenvorteile bzw. Skaleneffekte, die den Long Tail ausmachen, nutzen. “You can make money on the long tail but not in the long tail” (Alex Iskold, 2007) Trotzdem ist dieser Ansatz sehr interessant für User, welche sich selbst aktiv in das Web 2.0 einbringen. Sie können davon ausgehen, dass der von ihnen bereitgestellte User Generated Content oder die von ihnen hochgeladene und selbst produzierte Musik auch Interessenten findet. 10 http://blog.firstmedia.de/?p=659 Abruf am 12.12.2008 69 4. Erfolgsfaktoren von musikspezifischen Web 2.0-Angeboten Wie im Teil I gezeigt wurde, müssen die Emotionen, die mit einem Lied in Verbindung gebracht werden, zuerst erlernt werden. Zum einen kann dies über Konzerte oder über Radio geschehen: Je häufiger Musikkonsumenten ein Lied hören, desto besser erlernen sie es. Der Konsum eines Liedes stiftet also umso mehr Nutzen, je häufiger das Lied gehört wird. Typischerweise endet dieser sich selbst verstärkende Effekt damit, dass ein Lied „totgespielt“ wird. Das heißt die Sättigungsmenge, welche individuell verschieden ist, wurde erreicht und die Nachfrage nach anderen Liedern steigt (siehe dazu II.1.). Zum anderen spielt die soziale Interaktion, die mit dem Konsum von Musik verbunden ist, eine zentrale Rolle: Menschen konsumieren Musik gemeinsam und möchten darüber reden. Es ist für die Konsumenten also rational, die Musik zu hören, die auch von anderen Menschen im relevanten sozialen Umfeld gehört wird. Das Produkt Musik ruft bei zunehmender Nutzerzahl eine Nutzensteigerung hervor; es handelt sich um einen sogenannten Netzeffekt. Netzeffekte treten beim Gut Musik bei der Distribution oder beim Konsum von Musik (Modeeffekte) auf. Entscheidend, ob ein Netzeffekt eintritt, ist immer die kritische Masse. Zum Beispiel wurde die Peer-to-Peer-Plattform Napster erst zur Gefahr, als die kritische Masse erreicht und innerhalb des Netzwerks ein sehr breites Sortiment an Inhalten angeboten wurde (vgl. Clement; Papies; Albers 2008, S. 45-46). Wenn ein System oder Netz eine bestimmte Teilnehmerzahl überschreitet und der Nutzen eines Netzes damit ein bestimmtes Niveau erreicht hat, ist zu erwarten, dass die Teilnehmer das Netz auch in Zukunft nutzen werden und dass die Anzahl der Neukunden zunehmen wird (vgl. Kollmann; Stöckmann 2008 S. 40). „Die Mindestzahl an Teilnehmern, die erforderlich ist, damit Systeme einen ausreichenden Nutzen für eine langfristige Verwendung bei einem Anwenderkreis entwickeln können, wird als kritische Masse bezeichnet.“ (Kollmann; Stöckmann 2008 S. 40) 70 Musik als klassisches hedonistisches Gut verstärkt die Macht der kritischen Masse, durch das hohe Konsumrisiko. Die Ursache liegt darin, dass einerseits die Qualität als zentrale Produkteigenschaft vor dem Konsum nicht einzuschätzen ist. Andererseits kommt Musik eine hohe gesellschaftliche Symbolfunktion zu, was das Risiko erhöht, das falsche Produkt zu kaufen und auf soziale Ablehnung zu stossen (vgl. Clement; Papies; Albers 2008, S. 50-50). Besonders bei jungen Unternehmen im Internet kommt es zu einem intensiven Wettlauf um das Erreichen der kritischen Masse. Wird diese schnell erreicht, können kleinere Anbieter oder Nachahmer aus dem Markt verdrängt werden. Verstärkt wird diese Auffassung im Web 2.0, „dass eine Abkehr von der Sichtweise des Kunden als passiven Informationskonsument hin zu einem Informationsanbieter und –editor einläutet und somit von der aktiven Teilnehmerzahl abhängig ist.“ Das Wachstum der Teilnehmerzahl avanciert zum kritischen Erfolgsfaktor. „Gewinner können – basierend auf den Größenvorteilen der Netzwerke – sogar monopolartige Marktpositionen erreichen. Denn wenn jeder andere an dem Netzwerk teilnimmt, ist dies aus Kundensicht umso mehr Grund, sich auch anzuschließen.“ (vgl. Kollmann; Stöckmann 2008 S. 40-41) 71 IV. Typologie von Web 2.0-Angeboten In dieser Arbeit hat sich der Aktivitätsbegriff als zentrales Forschungsinteresse herausgestellt. Einerseits kann nur, wie oben schon mehrfach gezeigt, durch aktives Musikhören der persönliche Musikgeschmack erweitert oder verändert werden, andererseits ergeben sich durch die neuen Web 2.0-Applikationen unzählige Möglichkeiten von Aktivitäten in Bezug auf Musik. Im Weiteren sollen die verschiedenen Erkenntnisse über Musikrezeption und das Web 2.0 gemeinsam mit Erkenntnissen aus der Medien- und Kommunikationsforschung ein Schema der Aktivitätsmöglichkeiten bilden, in welches verschiedene Web 2.0-Angebote eingeordnet und hinsichtlich ihrer Aktivitätsmöglichkeiten klassifiziert werden können. Anschließend, in Teil V soll die Relevanz dieser Typologie für die Musikindustrie erhoben werden. Zur grafischen Darstellung der Kriterien im Vergleich werden sogenannte „Harvey Balls“ verwendet. Tabelle 2: Grafische Darstellung mittels Harvey Balls Harvey Balls Trifft nicht zu Trifft etwas zu Trifft teilweise zu Trifft ziemlich zu Trifft voll zu 0 1 2 3 4 Quelle: eigene Darstellung 1. Rezeptionsmöglichkeiten im Web 2.0 Als Kriterien zur Bewertung werden unterschiedliche Kategorien von passiver bis aktiver Rezeption unterschieden und herangezogen. Die Steigerung der Aktivität der Rezeptionsmöglichkeiten zeigt sich in unten abgebildeter Grafik. Von einer passiven bis zu einer aktiven Rezeption werden fünf Kategorien unterschieden, wobei Unterkategorien zur genaueren Betrachtung notwendig sind. 72 Abbildung 10: Kategorien von Rezeptionsmöglichkeiten Quelle: eigene Darstellung 1.1. PASSIV In der Medienforschung steht das Medium als Kommunikationsmittel im Vordergrund. Als Ausgangspunkt medienwissenschaftlicher Forschung wird häufig das von Shannon und Weaver (1976) entwickelte Modell von Kommunikationsprozessen genannt. Die Kommunikation läuft vom Sender zum Empfänger über einen Kanal. Dieser lineare Kommunikationsprozess kann (z.B. durch Rauschen) gestört werden, ausgesendetes und empfangenes Signal können sich also unterscheiden (vgl. Münch 2005, S. 462). Für den Rezipienten von Musik bedeutet das Sender-Empfänger-Modell eine rein passive Haltung in Form von „Zuhören“. Dieses Rezeptionsverhalten wird im Massenmedium Radio bestätigt. Der Hörfunk wird in dieser Arbeit als ein reines Distributionsmedium, als ein passives Medium, verstanden. Kritik zu dieser Passivität äußerte bereits Bertolt Brecht (1932) in seinem Aufsatz „Der Rundfunk als Kommunikationsapparat“. „Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu 73 machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung setzen.“ (Lindner 2007, S. 40) Sein Wunsch war Distributionsapparat es, Höreraktivitäten zu erreichen und so den in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Hörfunk sollte Austausch ermöglichen und zu Gesprächen, Debatten und Disputen genutzt werden. Auch Walter Benjamin (1930/1931) kritisierte in seinem Werk „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ die Trennung zwischen Sender und Publikum. „Der entscheidende Irrtum dieser Institution, die grundsätzlich Trennung zwischen Ausführendem und Publikum, die durch ihre technischen Grundlagen Lügen gestraft wird, in ihrem Betrieb zu verewigen. (…) Dieser Widersinn hat dazu geführt, daß noch heute, nach Jahre langer Praxis, das Publikum völlig preisgegeben, unsachverständig in seinem kritischen Reaktionen mehr oder minder auf die Sabotage angewiesen Haltung geblieben ist. (…) In der (das Abschalten) der Massen dem Rundfunkprogramm gegenüber hat diese Barbarei ihren Gipfel erreicht und scheint nunmehr bereit zu sein, umzuschlagen. Es gehört dazu nur eines: die Reflexion des Hörers wäre auf sein reales Reagieren hinzulenken, um es zu schärfen und zu rechtfertigen“ (Benjamin, 1989, S. 1506-1507). Die Aktivität des Rezipienten ist also auf das Einschalten bzw. Ausschalten des Gerätes und auf die Senderwahl beschränkt. Benjamin kritisiert wie Brecht die Trennung von Sender und Empfänger und fordert eine Aktivierung des Publikums. Er thematisiert die Hilflosigkeit der Hörer und meint, dass durch Rückbindung an das Programm Kommunikationsbarrieren durchbrochen werden könnten (vgl. Lindner 2007, S. 96-98). In der Weiterentwicklung des Radios zum Internetradio hat sich nur der Kanal geändert. Die Rezeption erfolgt weiterhin passiv und ist auf das Ein- und Ausschalten beschränkt. Teilweise werden auch in Web 2.0 Radiostationen angeboten. 74 1.2. INFORMATIV Durch die Wandlung des Internets zum WWW wurde es möglich, Informationen in Form optisch aufbereiteter und formatierter Seiten zu Verfügung zu stellen, diese Seiten durch Hyperlinks miteinander zu verbinden und mit Hilfe von Suchmaschinen in Sekunden aufzufinden. Das Internet wurde damit zu einem globalen Informationsraum, der ohne besondere Vorkenntnisse betreten werden kann (vgl. Spiegel 2006, S. 11). Im „alten“ Web 1.0 ist es eindeutig, ob man User oder Autor einer Webseite ist. In der Regel ist man als User Rezipient oder Konsument einer Seite und damit ohne Rechte zur Bearbeitung. Als Autor hingegen ist man selbst verantwortlich, dass Inhalte auf eine Seite gelangen und dass diese akkurat und aktuell sind. Im Web 2.0 verschwimmen die Grenzen: User werden zu Autoren und bringen aktuelle Inhalte ein, korrigieren Fehler und sorgen für eine „lebendige“ Webseite (vgl. Kerres 2006, S. 2). In der Kategorie informativ geht es aber um den reinen Konsum von Information, nicht um die Bereitstellung. Sich Wissen rund um Musik, eine Musikgruppe oder einen Musiker anzueignen, ist ebenso eine Form der Rezeption wie das Musikhören selbst. Durch aktive Auseinandersetzung mit Musik können die Musikerfahrungen in die eigene Welt integriert werden (siehe dazu Kapitel I.1.). Es ist also unerheblich, ob die Information vom Betreiber der Seite oder von den Usern der Seite verfasst wurde. Dieses Kriterium bewertet rein die Möglichkeit, ob weiterführende Information über Musik erhältlich ist. 1.3. INTERAKTIV: KOMMUNIKATIV und PARTIZIPATIV 1.3.1. Kommunikation KOMMUNIKATION ist Kommunikationspartner ein Prozess, impliziert. der stets Kommunikation ein ist Gegenüber, also immer einen ein doppelseitiges Geschehen, das zwischen mindestens zwei Partnern stattfindet. In 75 der Massenkommunikation werden massenmedial verbreitete Aussagen von den Rezipienten aufgenommen. Dabei können die Rezipienten nicht, auch wenn dies der Terminus Massenkommunikation vermuten lässt, mit der Masse gleichgesetzt werden. In der Kommunikationsforschung wird daher vom „dispersen Publikum“ gesprochen. Darunter sind einzelne Individuen, aber auch kleine Gruppen von Menschen zu verstehen, deren verbindendes Charakteristikum darin besteht, dass sie sich einem gemeinsamen Gegenstand – den Aussagen der Massenmedien – zuwenden. Die Rückkopplungsmöglichkeiten der Rezipienten beschränken sich allerdings auf „schmalbandiges Feedback“ per Brief, Fax oder Telefon. Durch das Internet erweitern sich jedoch die Möglichkeiten und „Interaktivität“ wird zum neuen Schlagwort (vgl. Burkart 2002, S. 168-169). Aus dem dispersen Publikum der Massenmedien entsteht ein aktiver bzw. interaktiver Rezipient, der ohne Medienbruch und Zeitverzug direkt auf die Kommunikatoren Einfluss nimmt oder selbst zum Kommunikator werden kann (vgl. Beck 2006 S.39). One-one-Kommunikation In diesem Kriterium werden die Möglichkeiten der persönlichen Kommunikation bewertet. Wie können die teilnehmenden User kommunizieren? Unterschieden wird eine private One-one-Kommunikation, welche aber von allen anderen Nutzern zu verfolgen ist, von der öffentlichen One-many-Kommunikation. Die One–one-Kommunikation, welche nur für die beteiligten Nutzer einsehbar ist und eine Kommunikation ähnlich dem E-mailen darstellt, wird nicht berücksichtigt. Anerkennung und Aufmerksamkeit sind in der realen wie auch in der Online-Welt knappe Güter, doch durch die Mechanismen der Online-Welt sind hier die Chancen größer, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen, auch als gesellschaftlicher Außenseiter in der realen Welt. Wie wichtig diese Anerkennung ist, zeigt sich in den verschiedenen Funktionen von Web 2.0-Anwendungen. Zum Beispiel sind bei MySpace die Anzahl der Kontakte beziehungsweise Freunde Indikatoren der eigenen Popularität, bei YouTube die Wertung der anderen Nutzer (vgl. Alby. 2007, S. 112). 76 One-many-Kommunikation Weiters wird eine One–many-Kommunikation, wie eine reine Kommentarfunktion zu den unterschiedlichen Themen untersucht. Nach Alby ist der Begriff „Social Software“ nur durch die Möglichkeit der Selbstregulation eingegrenzt. Diese Selbstreflexion erfolgt über Kommentarfunktionen. Einerseits entsteht in den Profilen der User ein Konstrukt des eigenen Selbst durch die Interaktion mit anderen, andererseits garantiert die Kommentarfunktion eine kritische Diskussion des User Generated Content (vgl. Alby 2007, S. 89 und S. 113). Die One-many-Kommunikation wird hier, zur genaueren Betrachtung, vom User Generated Content unterschieden. In der Literatur werden aber Kommentare oft mit User Generated Content gleichgesetzt. „Word of Mouth“ wird die Kommunikation von Konsumenten untereinander genannt, die sich auf den Besitz, die Benützung oder Eigenschaften von Produkten oder Dienstleistungen bezieht. Die Besonderheit dabei ist, dass die Konsumenten direkt miteinander kommunizieren. Gerade in der Entertainmentbranche haben Konsumenten ein Bedürfnis über ihre Erfahrungen mit dem Gut zu reden. Durch das Internet gewinnt die Mundpropaganda einen entscheidenden Aspekt: die Möglichkeit der Archivierung. Das digitale Word of Mouth ist damit in seiner Gesamtheit wirkungsvoller als die nicht-digitale Variante. Die Reichweite der digitalen Mundpropaganda ist größer, ferner wird selbige von einem an der jeweiligen Thematik interessierten und somit empfänglicheren Personenkreis abgerufen. Schlechte Kritiken über neue Musikalben können somit den langfristigen Erfolg mindern (vgl. Kilian, Walsh, Zenz 2008, S. 322-325). 1.3.2. PARTIZIPATION Geht es um die Erklärung dessen, was Web 2.0 eigentlich auszeichnet, wird häufig gesagt “Mit-Mach-Web”, d.h. die erhöhte Bereitschaft dazu, sich an Prozessen im Internet aktiv zu beteiligen. Als Voraussetzung für den Erfolg von Social Software gilt die Bereitschaft der Nutzer, 77 • ihre Anonymität im Netz teilweise oder ganz aufzugeben (Profile) und • selbst Inhalte für das Web zu schaffen (User Generated Content) (vgl. Szugat 2006, S. 14 und Alby 2007, S.90). User Generated Content - Many-Many-Kommunikation Aus einer One-many-Kommunikation, wie bei der “herkömmlichen“ Massenkommunikation, wird durch die Möglichkeit selbst Inhalte (Content) bereitzustellen, eine Many-many-Kommunikation, welche dem Ziel von Brecht „den Zuhörer nicht zu isolieren, sondern in Beziehung zu setzen“ sehr nahe kommt (vgl. Burkart 2002, S. 503). Bestes Beispiel ist die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“, aber auch musikbezogene Social Software erlaubt ihren Usern Inhalte über Bands oder Musikstile selbst zu editieren. Neben der intelligenten Kombination von Datenquellen ist es gerade der sogenannte User Generated Content, der vom Benutzer erstellte Inhalt, der das jeweilige Web 2.0-Angebot so interessant macht. Menschen investieren Zeit, Energie und Wissen, obwohl sie dafür in der Regel keinen finanziellen Ausgleich bekommen. Wer z.B. bei Wikipedia sein Wissen einbringt, der weiß auf der anderen Seite auch, dass er von den Beiträgen anderer profitieren kann. Dies kann auch zu einem Gemeinschaftsgefühl führen oder auch zu einem gewissen Stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein (vgl. Alby 2007, S. 111-112). Unter User Generated Content können alle interaktiven und produktiven Tätigkeiten der Nutzer verstanden werden. Hier, in diesem speziellem Kriterium, wird nur die Many-many-Kommunikation im Rahmen des User Generated Content, also die gemeinsame Aufbereitung eines Themas, betrachtet. Profile Eine für Social Networks typische Funktion sind die persönlichen Profile. Meist sind diese mit diversen Sichtbarkeitseinstellungen Netzgemeinschaft versehen oder generell der für Mitglieder Öffentlichkeit des der Netzes zugänglich. Manche Angebote, wie MySpace, funktionieren größtenteils über 78 diese Profile. Die User sind also bereit, Teile ihrer Identität preiszugeben; sich selbst im Web darzustellen. Anhand des beim Anmelden auszufüllenden Mitgliederprofils kann der Nutzer wählen, wie er sich den anderen präsentieren will. Die unterschiedlichen Plattformen geben aber mit dem Formular schon die jeweiligen Settings vor. Bei Xing wird zum Beispiel großer Wert auf die Ausbildung, Karriere und Expertise gelegt, bei MySpace wird eher auf private Angaben geachtet. In Zeiten der computervermittelten Kommunikation wird der Rechner als Vehikel benutzt, um Bekanntschaften zu schließen. Ein besonderer Reiz am Netz scheint es zu sein, dass es möglich ist, die wahre Identität zurückzustellen, teilweise auszublenden oder komplett zu verschleiern. Durch die eingeschränkte kommunikative Bandbreite des Netzes (grundsätzlich ist nur Kommunikation in Textform möglich) ist es nun weitaus leichter als im Face-to-Face Gespräch möglich, zu kontrollieren, welche Bestandteile der Identität an das Gegenüber weitergegeben werden. Virtuellen Identitäten im Web 2.0 kommt eine besondere Bedeutung zu. Obwohl sie nicht den Merkmalen der dahinter stehenden Personen entsprechen müssen, ist doch der Aspekt der Kontinuität (siehe dazu Kapitel I.4.) entscheidend für die in der Community so wichtige Reputation (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 179-180). Tagging Die Möglichkeit seine eigene Musik zu kategorisieren, um diese auch für andere leichter auffindbar zu machen, wurde schon unter Kapitel III.2.3 genauer beschrieben. In dieser Kategorie wird bewertet, inwieweit User die Möglichkeit haben, Wissen und Aktivitäten zu koordinieren. Die Kategorie ist um so ausgeprägter um so häufiger auf Tags und auf die Aufforderung zum Taggen hingewiesen wird. Beim Geld hört die Partizipation auf Die Benutzer im Web 2.0 sollen zwar partizipieren, damit ist aber nicht die Partizipation an den Werbeinnahmen gemeint. Die Inhalte werden von den Usern generiert, verdienen tun daran andere. Wenn man sich vor Augen führt, dass sich die Benutzer in Währungen wie Aufmerksamkeit, Bestätigung und 79 Gemeinschaftsgefühl auszahlen lassen und die Betreiber daran echtes Geld verdienen, dann bekommt dieser Aspekt des Web 2.0 einen etwas schalen Beigeschmack. Etwas anders sieht es bei den Blogs aus. Im Prinzip kann jeder mit seinem eigenen Blog Geld verdienen, mit „Google AdSense“ und ähnlichen Programmen ca. 50 Dollar im Monat. Sehr populäre Blogs verdienen durchaus höhere Summen, doch es ist bisher kein Fall bekannt, in dem ein Blogger allein durch sein eigenes privates Blog den Lebensunterhalt bestreiten konnte (vgl. Alby 2007, S. 159). 1.4. PRÄFERENZAKTIV Recommender-Systeme sind ähnlich den zuvor beschriebenen Folxonomies eine Form der Organisation von Inhalten. Recommender-Systeme versuchen aber aufgrund von schon getagten Inhalten oder aufgrund des Userverhaltens (z.B. welche Musik man hört) oder aufgrund von Angaben im Profil oder aufgrund von „Freunden“ auf Ähnlichkeiten zu anderen Inhalten oder anderen Usern zu schließen. Durch dieses System sollen passende Empfehlungen gegeben werden. Es versucht die eigenen Präferenzen herauszufiltern um weiterführende Inhalte, wie z.B. Neuerscheinungen, anbieten zu können. Deshalb wird diese Kategorie präferenzaktiv benannt. Sie bewertet in wie weit ein System mit Präferenzen arbeitet (siehe dazu Kapitel III.2.3.2.). 1.5. PRODUKTIV Prosuming Den Begriff des „Prosumenten“ prägte Alvin Toffler 1980 in seinem Buch „Die Zukunftschance – Von der Industriegesellschaft zu einer humaneren Zivilgesellschaft“. Er bedeutet die Verbindung von Konsument und Produzent zu einem Prosument. Als erstes Beispiel für die Veränderung des Konsumenten zum Produzenten nennt Toffler die Einführung eines Schwangerschaftstests zur Selbstuntersuchung in europäischen Apotheken in den frühen 1970er-Jahren. Es entsteht eine Do-it-yourself-Bewegung in der der „Outsider“ zum „Insider“ wird 80 und immer mehr Produktivität auf den Verbraucher übertragen wird (vgl. Toffler 1980, S. 272-284). „Die Bereitwilligkeit, mit der sich der Verbraucher zur Produktion verlocken läßt, hat weitreichende Konsequenzen. Zum besseren Verständnis sei daran erinnert, daß der Markt genau auf jene Trennung von Produzent und Konsument zurückgeht, die heute zunehmend an Konturen verliert. Das Marktsystem war unnötig, solange die meisten Menschen das, was sie produzieren, auch selbst verbrauchten. Erst in dem Moment, da der Verbrauch von der Herstellung geschieden wurde, wurde auch der Markt unerläßlich (…) Und wo immer sich die Kluft zwischen Konsument und Produzent verringert, werden Funktionen, Rolle und Macht des Marktes in Frage gestellt. Die Rolle die der Markt in unserem Leben spielt wird daher durch den Aufstieg des Prosums verändert“ (Toffler 1980, S. 281-282). Zwar verstand Toffler den Prosumer-Begriff damals mehr in der Hinsicht, dass Konsumenten Sach- und Dienstleistungen nicht bloß erwerben, sondern solche auch aktiv produzieren, etwa im Sinne von Hausarbeit, wie in vormodernen Zeiten der Subsidiarität. Inzwischen jedoch hat sich der Prosumer-Begriff auch für Formen der direkten Kollaboration zwischen Unternehmen und Kunden eingebürgert, die mit Konzepten von Co-Design oder Co-Produzententum gefasst werden. Digitales Arbeiten und das Internet weiten die Möglichkeiten für Prosuming immer weiter aus. Der Prototyp des Prosumenten im Webzeitalter konsumiert, produziert und kommuniziert nahtlos über mediale, soziale und technische Netze hinweg und versorgt längst nicht nur mehr sich selbst mit Produkten eigener Herstellung (vgl. Friebe/Lobo 2006, S. 215). „2015 wird jeder Mensch einen Song geschrieben, ein Buch veröffentlicht, ein Video gedreht, ein Weblog publiziert und ein Programm geschrieben haben.“ (Kevin Kelly) Prosuming mit Hilfe des Internets entspricht der Brecht`schen Radiotheorie. Musikhören wird zur Kommunikation und geht sogar darüber hinaus indem die 81 Sender auch zu Produzenten werden und ihre eigene Musik zur Verfügung stellen. Aber es muss auch Kritik am Aufstieg des Prosumenten geübt werden. Der Dresdner Professor für Industrie- und Techniksoziologie Günter Voß hat den arbeitenden Kunden als Problemfeld identifiziert. Voß spricht von einer abhängigen Konsumarbeit. Konsumenten sind immer häufiger abhängig von machtvollen und im Weltmaßstab immer häufiger monopolistisch agierenden Konzernen (vgl. Voß; Rieder 2005, S. 184). Schleichend fängt das bei IKEA mit der Selbstmontage der Möbel an, allein die verkauften Billy-Regale wurden von den Kunden in bisher 20 Millionen Arbeitsstunden zusammengebaut. Im Web 2.0 findet man diesen Mechanismus verborgen im Wort Beta, das für unfertige BetaVersion steht und bedeutet, dass ein Unternehmen seine finalen Produkttests unentgeltlich an die Kunden auslagert. Obwohl das sogenannte „Public Beta Testing“ oft zu besseren Ergebnissen führt als Testreihen im abgeschlossenen Labor, ist die Betrachtungsweise von Voß schon deshalb berechtigt, weil kostenlose Arbeit im Wirtschaftskreislauf nichts zu suchen haben sollte (vgl. Friebe; Lobo 2005, S. 216). Seit dem Jahr 2000 erscheint Managementliteratur, welche einen dramatischen Wandel bei der Kundenrolle beschreibt. Das Heraustreten des Kunden aus traditionellen verschiedenen Rollen Texten und das Aufkommen konstatiert. Dabei des spielen aktiven digitale Kunden wird Techniken in eine bedeutende Rolle für diese Entwicklung zum „Prosumenten neuen Typs“. Die Mitwirkung des Konsumenten bei der Leistungserbringung erfordert dabei nahezu professionelle Kompetenzen. Damit ist die erreichbare Dienstleistungsqualität in hohem Maße von der Kompetenz der Konsumenten abhängig. Die Tätigkeiten der Prosumenten neuen Typs ähneln in vielen informatisierter beruflicher Arbeit – der Prosument neuen Typs nähert sich deutlich der Erwerbsrolle (vgl. Voß; Rieder 2006, S. 111-112). Im Bereich der Musik bedeutet dies die Produktion eigener Musikstücke und deren kostenlose Bereitstellung auf verschiedenen Social Software-Seiten oder in Weblogs. Handelt es sich dabei um Social SharingPlattformen, wie z.B. YouTube, stellen diese Produzenten sogar die wichtigste Ressource der Plattform dar. Ihr einziger Lohn ist ihre Reputation im Netzwerk. Diese Reputation ergibt sich einerseits durch die Rezipienten, welche durch den 82 Konsum der Inhalte diese in Beliebtheitslisten aufnehmen. Andererseits können sich Bewerter aktiv an der Organisation der Inhalte beteiligen und sie kommentieren (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 107). Crowdsourcing und Beta Die Wortneuschöpfung „Crowdsourcing“ bezeichnet den Trend zur Teilauslagerung von Unternehmensaufgaben an eine Menge von Menschen, die diese Aufgaben in ihrer Freizeit lösen, meist kostenlos. Das WWW dient dabei als Medium und Plattform für alle Prozesse zwischen Unternehmen und einem Heer von Freizeitarbeitern (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 217). Bei BetaVersionen wurde die Software in der Regel schon zuvor intern getestet und wird dann erst der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt um die restlichen Programmfehler (Bugs) zu identifizieren (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 190). Crowdsourcing und das Testen von Beta-Versionen haben einige Überschneidungen mit dem User Generated Content, es geht aber meines Erachtens weiter, da die Unternehmensinteressen und keine persönlichen Interessen im Vordergrund stehen, weshalb dies der Unterkategorie produktiv und nicht der Unterkategorie Partizipation zugeteilt wird. Gemeinsam ist ihnen die „Bezahlung“; sie erfolgt durch Aufmerksamkeit, Bestätigung und Gemeinschaftsgefühl. Vieles von dem, was Internetökonomie heute praktisch ausmacht, läuft darauf hinaus, dass sich die Kunden selbst in die Vermittlungsleistung mit einbringen und damit gewissermaßen eine pro-aktive Mitarbeit leisten (müssen), wenn sie bestimmte Güter und Dienstleistungen erwerben wollen. 83 2. Bewertung verschiedener Web 2.0-Angebote Vorweg muss Angeboten angemerkt unterschiedlich werden, viel dass Literatur zu zu den verschiedenen Verfügung steht. Web 2.0Die drei untersuchten Web 2.0-Netzwerke wurden Anhand ihrer Bekanntheit (gemessen an der User- oder Profilzahl) und ihrer stark unterschiedlichen Schwerpunkten ausgewählt, analysiert und so weit wie möglich mit Literaturangaben gestützt. Weblogs als weiteres Angebot für Musikinteressierte werden als eine gemeinsame Kategorie angesehen, da sich die musikspezifischen Weblogs sehr stark ähneln. 2.1. Last.fm Last.fm ist ein Musikdienst, „der lernt was du magst“11. So beschreibt sich Last.fm selbst und weist damit gleich zu Beginn auf sein Recommender-System hin. Last.fm entstand aus dem Zusammenschluss des Online-Plattenlabels von Felix Miller und Martin Stiksel und dem Studenten Richard Jones, der Programmerfinder des Audioscrobblers, welcher aufzeichnet, was man auf seinem Computer hört. Mittlerweile speisen alle Major-Labels und viele kleine Labels ihr Repertoire in das Programm, auf das weltweit über 20 Millionen User aus 239 Ländern12 zugreifen, welche von 94 Mitarbeitern13 betreut werden. „Jedes Lied, das du spielst, wird deinem Last.fm-Profil etwas zu deinen musikalischen Vorlieben mitteilen. Es kann dich mit anderen Leuten zusammenbringen, die mögen was du magst – und dir andere Lieder aus ihrer Musiksammlung empfehlen, sowie aus deiner eigenen … und während du Last.fm verwendest machst du es immer besser, für dich und alle anderen. Wenn du ein Lied an einen Freund empfiehlst, zu 11 12 13 www.lastfm.de/about Abruf am 4.12.2008 www.lastfm.de/advertise Abruf am 4.12.2008 www.lastfm.de/team Abruf am 4.12.2008 84 deinen Lieblingsliedern hinzufügst oder etwas darüber schreibst – oder einfach nur anhörst – veränderst du die Rolle, die dieses Lied auf Last.fm spielt. Es wird an andere Leute empfohlen werden, da du es angehört hast. Es wird in unseren Musikcharts nach oben klettern, und vielleicht wird es von mehr Leuten gehört werden, weil du es gut gefunden hast“14 In den ersten beiden Absätzen der Selbstbeschreibung von Last.fm werden fast alle relevanten Aktivitätskriterien, wie sie im vorherigen Kapitel ausgearbeitet wurden, angesprochen. Passiv 3 Das Last.fm-Radio kann man auch ohne dass man ein Profil besitzt benützen. Man gibt einfach einen Künstler ein und hört Musik passend zum Künstler. Sobald man ein Profil bei Last.fm eingerichtet hat und einige Titel vom Audioscrobbler gespeichert wurden, hat man die Möglichkeit sein eigenes personalisiertes Radio zu hören, bzw. das seiner „Nachbarn“. Das Radio kann direkt auf der Last.fmSeite oder vom Audioscrobbler aus gestartet werden. Informativ 4 Zu jeder Musikgruppe oder jeden Musiker gibt es von den Usern selbst verfasste Informationen, welche auch solange die URL der jeweiligen Quelle eingegeben wird von Wikipedia oder anderen GFDL-lizensierten Quellen kopiert werden dürfen. Die Profile der Musiker werden also nicht von den Musikern selbst gestaltet. Zu jedem Künstler gibt es zusätzlich die Information wie oft dieser gespielt wurde, wie viele Hörer es auf Last.fm gibt, News und eine Kommentarfunktion. Zusätzlich verbindet Last.fm diese Informationen mit der Promotion von Konzertterminen und den Musikverkauf über den Partner 7DIGITAL als Download bzw. über amazon.com als Tonträger (vgl. Warm 2008, S. 74). 14 www.lastfm.de/about Abruf am 4.12.2008 85 Interaktiv: Kommunikation und Partizipation Um auf Last.fm kommunizieren zu können, muss ein Profil angelegt werden. Danach hat man zahlreiche Möglichkeiten sich in die Social Software einzubringen. One–one-Kommunikation 4 Die öffentliche One-one-Kommunikation wird durch sogenannte „Shoutboxen“ ermöglicht. Diese sind in jedem Profil integriert und können auch von „NichtFreunden“ zum kommentieren des Musikgeschmacks des Profilinhabers oder auch für alle anderen Nachrichten genutzt werden. One-Many-Kommunikation 4 Die zuvor erwähnten Shoutboxen befinden sich auch auf den jeweiligen Profilen der Künstler sowie auf den Informationsseiten über Events. So können sich die unterschiedlichen User durch diese Kommentarfunktion über die letzte Platte oder das letzte Konzert des jeweiligen Künstlers unterhalten. Ein zusätzliches Angebot bietet Last.fm mit einem persönlichen Blog für jeden User. Auch da Last.fm-Team selbst führt einen Blog. User Generated Content - Many-many Kommunikation 4 Die Möglichkeit, selbst User Generated Content bereit zu stellen, haben die User von Last.fm indem sie Informationen zu den Musikern ganz im Stil von Wikipedia gemeinsam verfassen. Diese Texte werden also ausschließlich von den Profilinhabern editiert. Profile 3 Die Profile von Last.fm wurden schon mehrfach erwähnt. Eine Besonderheit dabei ist, dass die User ihre Profile neben dem Uploaden eines Fotos und der Eingabe einiger weniger Daten zu Person (z.B. 26, Weiblich, Österreich) nur über ihre gehörte Musik gestalten können. Um ein User-Profil anlegen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Eine Möglichkeit besteht darin, sich durch das Last.fm-Repertoire zu hören und jeden Titel (oder ganze Alben), der einem gefällt mittels „Add to profile button“ seinem 86 Profil hinzuzufügen. Eine andere Möglichkeit sich ein Profil anzulegen kann durch den MP3-Player und dem „Audioscrobbler Plug In“ erfolgen. Hierfür werden einfach die Titel vom MP3-Player auf den Last.fm-Server übertragen. Oder man hört einfach Last.fm-Radio und fügt die ausgewählten Songs zu seinem Profil. Das User-Profil schließlich gibt Auskunft über den Inhalt und kann natürlich entsprechend editiert werden (vgl. Steindl 2007, S. 85-86). Die Profilbesitzer können nach erfolgreicher Registrierung auch andere Profilbesitzer als „Freunde“ zum eigenen Profil hinzufügen. Weiters sind auf den Profilseiten die letzten Aktivitäten, die Freunde, die persönlichen Hitlisten und vieles mehr einsehbar. Abonnementen (Kosten 2,5 EURO/Monat) unterscheiden sich von den „normalen“ Usern dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, Besucher ihres Profils zu sehen, dass sie keine Werbung erhalten, unendlich viele Playlisten erstellen können, eine weitere Radiostation „Lieblingslieder“ (diese müssen eigens dafür getaggt werden) nutzen können, eine „Top-Priorität“ zum Webserver und zum Radioserver zu den Hauptzeiten bekommen und Beta-Versionen schon vor allen anderen User testen zu können. Tagging 4 Jeder Besitzer eines Profils kann seine Musik auch ganz einfach mit eigenen Worten kategorisieren. Inhalte werden bei Last.fm ausschließlich durch die Community klassifiziert. Auf den Seiten der Musiker sind die jeweiligen Tags dann sichtbar und informieren die anderen User über Musiker, die mit denselben Worten getaggt wurden. Die Tags der User können auf den Profil-Seiten durchsucht werden. Die Tagcloud von Last.fm kommuniziert zusätzlich die Relevanz der einzelnen Objekte durch vergrößerte Darstellung der häufigsten Tags. Präferenzaktiv 4 Last.fm ist ein Online-Radiosender mit der Besonderheit der CollaborativeFiltering-Methode. Ähnlichkeiten von Eigenschaften eines Songs sind dem Recommender-System angenommen, dass von jene Last.fm Benutzer, nicht die bekannt. einen Stattdessen gewissen wird Musikinterpreten 87 favorisieren, ebenfalls jene Interpreten bevorzugen, die der gleichen Gruppe von Interpreten zugeordnet werden. Nachdem die User ein Profil erhalten und schon einige Musiktitel gehört haben, ermittelt Last.fm mittels dieser Methode Korrelationen zwischen Personen mit ähnlichen Präferenzen, so genannte „Nachbar-Verbindungen“. Dies sind User, die die gleichen Musiktitel oder Musikstile bevorzugen. Last.fm benutzt diesen Ansatz jedoch mit unterschiedlichem Fokus als andere Systeme. Anstatt den Algorithmus, der die Empfehlungen identifiziert, zu verbessern, versucht der Ansatz von Last.fm den Datenbestand zu korrigieren und zu vervollständigen (vgl. Mortensen 2007, S.20) Auf diese Weise entstehen individuelle Radiosender, welche die Empfehlungen von Last.fm an die User darstellen (vgl. Steindl 2007, S. 85-86). Produktiv Last.fm hat mittlerweile die Kataloge aller großen Majors im Programm und ermöglicht die Aufnahme auch für alle anderen kleineren Labels. Die im Repertoire erfassten Künstler erhalten ihre Tantiemen über die MCP/PRSVereinigung15, dem englischen Pendant zur AKM in Österreich oder der GEMA in Deutschland (vgl. Steindl 2007, S. 85-86). Aber auch private Personen können ihre eigenen Lieder einspeisen. Prosuming 4 Künstler, die ihre eigene Musik bei Last.fm zum anhören freigeben wollen, müssen sich zuvor als Künstler bei Last.fm registrieren lassen. Last.fm lockt mit den Vorteilen einer großen Community, welche die Künstler zu PromotionsZwecken nützen können16. Seit 1. Juli 2008 erhalten die Künstler ohne Plattenvertrag nun auch eine Zahlung im Rahmen des „Artist Royalty Programms“ von Last.fm, welches durch Werbeeinahmen finanziert wird. Jedes Mal wenn ein Künstler über die „Musik On 15 16 www.mcps-prs-alliance.co.uk Abruf am 7.01.2008 http://www.lastfm.de/uploadmusic?accountType=artist Abruf am 29.11.2009 88 Demand“-Funktion oder in einem Last.fm-Radio gespielt wird, erhält der Musiker eine Vergütung17. Crowdsourcing 3 Nur als Abonnement hat man bei Last.fm die Möglichkeit, Beta-Versionen schon vorab zu testen und diese zu kommentieren. Man wird dabei von Last.fm explizit um Mithilfe gebeten. Last.fm stellt ein interessantes Geschäftsmodell von Social Commerce innerhalb von Social-Music-Plattformen dar. Der Nutzer wird entsprechend seiner Vorlieben mit Musik versorgt. Gleichzeitig ist es möglich, mit Hilfe von Social Filtering jene Nutzer zu identifizieren, die dem eigenen Musikgeschmack am nächsten kommen um ein Netzwerk aufzubauen (Vgl. Baechle 2008, S.131). Das Geschäftsmodell von Last.fm ist auf drei Säulen aufgebaut. Durch Vermittlungsgeschäfte Abonnements für Extra-Features und klassische Werbung auf der Homepage werden Erlöse erzielt (vgl. Warm 2008, S. 74). 2.2. MySpace MySpace ist eine mehrsprachige Social Networking-Website, die es den Nutzer ermöglicht, kostenlose Benutzerprofile mit Fotos, Videos, Blogs, Gruppen usw. einzurichten. Mit über 180 Millionen Mitgliedern ist MySpace eine der größten Communities im WWW. Der Schwerpunkt von MySpace liegt seit Gründung durch Tom Anderson im Jahre 2003 auf der Musik. Anderson nutzte seine Kontakte zu Künstlern und Bands und überzeugte sie davon, sich „ihren MySpace“ einzurichten. Damit wurde es möglich, dass Bands und Fans miteinander in Kontakt treten konnten (vgl. Ebersbach; Glaser; Heigl 2008, S. 83). „MySpace has joined forces with music giants Warner Music Group, Universal, Sony BMG and EMI to create MySpace Music - the world´s richest music experience. MySpace has over 5m artists/bands worldwide 17 http://blog.last.fm/2008/07/09/calling-all-musicians Abruf am 29.11.2009 89 connecting with 120m consumers who play over 6 billion tracks per month, making it the planet´s most visited music destination. But it´s not just about streaming music. MySpace Music offers purchasable MP3 downloads, ringtones, gig tickets, merchandise and much more. This prompted David Sinclair of Word to state “for the global community of musicians and music fans, it´s (MySpace Music) turning into a music version of Google.”18 Passiv 2 User können auf MySpace-Music die Profile aller Künstler die sich bei MySpace als Musiker registrieren haben lassen - auch ohne selbst einen Account zu besitzen besuchen. Auf diesen Profilseiten können Musiker ihre eigene Musik hochladen und diese kann dann (passiv) gehört werden. Interessant ist die „Add to my profile“-Funktion19, welche jedem Profilinhaber ermöglicht hochgeladene Musikstücke dem eigenen Profil hinzuzufügen. Allerdings können Künstler nicht mehr als 4 Lieder ihrem Profil hinzufügen, somit muss danach (aktiv) wieder ein neuer Künstler gesucht werden. Das MySpace-Radio kann ebenfalls, ohne dass ein Account angelegt werden muss, genutzt werden. Es handelt sich dabei um einen Podcast, also einer speziell für MySpace zusammengestellten Radiosendung, und nicht um ein personalisiertes Radio. Informativ 4 Die Musiker gestalten ebenso wie die „normalen“ User ihre Profilseiten selbst, durch Angaben zur Person, über Videobeträge und Fotos20. Die MySpace-Seiten der Musiker sind meist gut sortiert, damit die User schnell Informationen über Neuerscheinungen und Tourdaten erhalten. Mittlerweile lassen viele berühmte Künstler ihre MySpace-Seiten von ihrem Management oder ihrem Fanclub betreuen. 18 http://creative.myspace.com/uk/trademarketing/downloads/moreopps.pdf Abruf am 22.12.2008 19 http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=userTour.yourSpace Abruf am 22.12.2008 20 http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=userTour.yourSpace Abruf am 22.12.2008 90 Interaktiv: Kommunikation und Partizipation Um am Netzwerk auch aktiv teilnehmen zu können muss ein Profil erstellen werden. Nach der Angabe einiger weniger Daten kann jedes Profil individuell gestaltet werden. Die Profile können privat oder öffentlich sein, d.h. private Profile können nur von den „friends“ angesehen werden können. One-one Kommunikation 4 Auf MySpace wird auf den einzelnen Profilseiten öffentlich kommuniziert. Dazu muss zuerst eine „Freundschaft“ zwischen den kommunizierenden hergestellt sein. Mit der Funktion „Add comment“ können auf dem befreundeten Profil Kommentare hinterlassen werden. One-many Kommunikation 4 Ähnlich der One-one-Kommunikation funktioniert auch die One-many- Kommunikation. Mittels „Bulletins“ können Informationen gleichzeitig an alle befreundeten Nutzer versendet werden. “Post a bulletin and your message will show up on all your friends' bulletin boards.”21 Besonders vorteilhaft ist diese Funktion für Musiker die ihre Fans über Neuigkeiten oder über Tourdaten informieren wollen. Eine weitere Möglichkeit der One-many-Kommunikation hat jeder User über seinen eigenen Blog. User Generated Content – Many-many Kommunikation 1 Schriftlich erstellter User Generated Content im Sinne dieser Arbeit wird auf MySpace nicht produziert. Die User partizipieren nur über die Kommentarfunktion und erstellen keine gemeinsamen Inhalte. Allerdings werden die MySpaceRadiosendungen gemeinsam mit den Usern erstellt. 21 http://bulletins.myspace.com/index.cfm?fuseaction=bulletin Abruf am 22.12.2008 91 „MySpace have created the world’s first user generated radio station. The station showcases the latest emerging talent and invites user audition for a chance to be the show's weekly co-host and, as you would expect from a user generated station, their fate is decided by the listeners.”22 Profile 4 Ein MySpace-Profil kann auf sehr unterschiedliche Weise gestaltet werden. Diese individuellen Gestaltungsmöglichkeiten mittels Fotos, Musik, Videos und Textbeiträgen lassen eine ausgeprägte virtuelle Selbstdarstellung zu. Die dem Profil hinzugefügte Musik wird automatisch beim Aufrufen der Profilseite abgespielt und trägt somit wesentlich zur Profilgestaltung bei. “One of the core reasons MySpace users love the site and keep coming back, long after they have lost interest in other sites is the creativity and self-expression the site allows. MySpace can now reveal that we have revolutionised the way our users manage their profiles making this selfexpression even more fun than before and removing the need to have any CSS/HTML knowledge or design input from third party sites.”23 Tagging 0 Die Musiker auf MySpace-Music werden zwar in Genres unterteilt, diese basieren aber nicht auf User-Tags. Es handelt sich um eine Taxonomie aufgrund des angegebenen Genres des Musikers. Präferenzaktiv 0 Auf MySpace-Music werden täglich andere Musiker präsentiert und auch die TopKünstler können schnell identifiziert werden. Jedoch basiert dies nicht auf einer persönlichen Empfehlung. Persönlich können Musikempfehlungen nur mittels Kommentarfunktion zwischen den Usern ausgetauscht werden. 22 http://www.myspace.com/ukadvertising Abruf am 22.12.2008 http://creative.myspace.com/uk/trademarketing/downloads/moreopps.pdf Abruf am 30.12.2008 23 92 Produktiv Alle registrierten Musiker können Musik bei MySpace hochladen, solange es sich um ihre eigene Musik handelt oder sie berechtigt sind diese weiter zu vertreiben.24 Prosuming 4 MySpace setzte bei der Gründung 2003 den Schwerpunkt auf die Vernetzung von unabhängigen Musikern und Bands. Mittlerweile ist der Besitz eines MySpaceProfils für jede Band zum Muss geworden, da MySpace, wie im Eingangsstatement festgehalten, versucht eine Musikversion von Google zu werden. „One big reason to get involved in MySpace is that it´s a great way to rapidly build your mailing list. […]That pays dividends down the road, as once someone is on my list I can remind them about my music on a regular basis. It also gives me more people to promote my concert events to when I go on tour.” (Nevue 2007, S. 108) Crowsourcing 1 Eine deutsche Beta-Version wurde Ende 2006 online gestellt und hat im Januar 2007 bereits mehr als 2,5 Millionen Mitglieder25.Seit Sommer 2007 gibt es auch eine Österreichische Version. Die User werden aber nicht aufgefordert an der Beta-Version mitzuarbeiten. 2.3. SellaBand Das seit 2006 bestehende Angebot SellaBand setzt sich einen sehr interessanten Schwerpunkt: Die Promotion und Produktion von Neuentdeckungen mit Unterstützung der Fans. 24 http://signups.myspace.com/index.cfm?fuseaction=signupBand Abruf am 30.12.2008 Spiegel-Online 01.08.2007, http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=50109989&top=SPIEGEL Abruf am 22.12.2008 25 93 "To unite Artists and Fans in an independent movement that aims to level the playing field in the global music industry."26 Üblicherweise schließen Musikschaffende Verträge mit Labels über eine oder mehrere Tonträgerproduktion/en ab. Der Labelvertrag, der auf dem Leistungsschutzrecht basiert, garantiert im Idealfall auf längere Sicht Einnahmen aus Tonträgern. Die Bindung ist meist exklusiv, das heißt, dass der Tonträger nur bei dem Label veröffentlicht wird, mit dem der Vertrag abgeschlossen wurde. Die Exklusivität ist für das Label wichtig, weil es nur so zum einzigen Verwerter der Leistungsschutzrechte wird. Die Exklusivität kann aber Nachteile für Musikschaffende mit sich bringen, vor allem wenn sich der Vertrag über mehrere Tonträgerproduktionen (und damit über Jahre) an das eine Label bindet. Musiklabels schießen die Kosten für Produktion, Tournee und Marketing vor, wodurch Musikschaffende oder Bands häufig gezwungen sind lange Zeit Schulden abzuzahlen (vgl. Sperlich 2005, S. 91f). Alternativen bilden Angebote wie www.sellaband.com, welche Musikschaffenden ermöglichen ohne Verträge und ohne Kosten, sondern durch Fanpartizipation, einen Tonträger zu produzieren. Jede CD-Produktion wird in 5000 Parts unterteilt wobei jeder Nutzer einen oder mehrere Parts zum Preis von je 10$ kaufen kann. Ist die gesamte Summe von 50.000$ erreicht, wird der Band ein A&R-Manager, ein Produzent und ein Studio zur Verfügung gestellt. Zwei große Vorteile ergeben sich aus dem Konzept SellaBand: Erstens sind die Künstler zu keiner Zeit an SellaBand gebunden und können jederzeit einen Labelvertrag ihrer Wahl unterschreiben. Zweitens steht ein großes Netzwerk an Musikbegeisterten auf der Plattform SellaBand zur Verfügung, welches dem Bekanntwerden und der Promotion der Band hilft. Als Nutzer dieser Plattform wird man interessanterweise als „Believer" bezeichnet, was zum Ausdruck bringen soll, dass man an seine jeweiligen LieblingskünstlerInnen glaubt und sie deshalb unterstützt. Typisch für Social 26 http://www2.sellaband.com/aboutus.html Abruf am 4.01.2009 94 Software sind die jeweiligen Profile der „Believers" und deren Informationsaustausch untereinander, welcher der Künstlerpromotion dient. Ist die CD produziert, sind 3 Lieder des neuen Albums auf der Webseite von SellaBand gratis verfügbar, die anderen können gegen eine Gebühr heruntergeladen werden. Die CD selbst kann über die Webseite, über die einzelnen Believer-Profile und über den Künstler bezogen werden. Jeder Believer erhält für seine Teilnahme eine CD. Die Einnahmen aus den Downloads und CD Verkäufen werden zwischen SellaBand, Musiker und auch Believer geteilt. Somit soll die aktive Promotion durch die Believer gefördert werden. Derzeit (Stand Juli 2008) haben 23 Musiker durch die seit 2006 bestehende Plattform eine CD-Produktion erreicht. Neben den Gründern Johan Vosmeijer (ehemals bei Sony/BMG), Pim Betist und Dagmar Heijmans (ehemals Sony/BMG), hat die Plattform mittlerweile 7 weitere Mitarbeiter27. Passiv 2 Um Musik auf SellaBand hören zu können muss man noch kein Profil angelegt haben. SellaBand bietet ein Radio (auch als „Stand Alone Player“) welches spezielle Playlisten (z.B. New Uploaded Tracks) zusammenstellt. Man hat aber auch die Möglichkeit direkt einen Künstler auszuwählen und nur die Musik des jeweiligen Künstlers zu hören. Dabei entscheidet der Künstler welche Musik upgeloadet wird. Ist von diesem Künstler schon ein Album über SellaBand produziert worden, stehen von diesem Album 3 Lieder zur Verfügung. Sobald man ein Profil erstellt hat, kann der Believer seine eigenen Playlisten zusammenstellen und seinem Profil anhängen28. Informativ 2 Um weiterführende Informationen zu den jeweiligen Musikern und Bands zu finden, müssen deren selbst erstellten Profile besucht werden. Die Musiker haben die Möglichkeit Informationen in Form von Text-, Bild- und Videoeinträgen 27 http://www2.sellaband.com/aboutus.html Abruf am 30.12.2008 http://www.sellaband.com/player und http://www.sellaband.com/search/?search=1 Abruf am 30.12.2008 28 95 bereitzustellen. Zusätzlich sieht man den Status (Anzahl der verkauften Parts) der Band oder des Musikers und die Netzwerkbewegungen rund um die Profilseite. Interaktiv: Kommunikation und Partizipation Die Web 2.0-Plattform SellaBand bietet unterschiedliche Möglichkeiten der Kommunikation und Partizipation. Besonders an SellaBand ist, dass auch die User für ihre Bemühungen auf der Plattform entlohnt werden. One-one Kommunikation 3 Die Kommunikation zwischen den Usern ist auf den jeweiligen Profilseiten einsehbar und findet mittels Kommentarfunktion statt. Hauptsächlich wird diese Kommunikation aber nicht von den Usern untereinander genützt, sondern von Musikern und Bands um User gezielt auf ihre Musik aufmerksam zu machen. One-many Kommunikation 2 Den Profil-Seiten der Musiker kann jeder User Kommentare anfügen. Aber auch der Künstler selbst kann hier Informationen hinzufügen. Die Nutzung der Onemany-Kommunikation ist aber auf SellaBand viel häufiger genutzt User Generated Content – Many-many Kommunikation 0 Grundsätzlich erstellen die User von SellaBand nicht die Inhalte über Musiker und Bands. Die Möglichkeit der User sich für die Promotion einer oder mehrerer Bands stark zu machen, kann zwar als User Generated Content gesehen werden, aber nicht im Sinne dieser Arbeit. Im eigenen Profil erhält man einen „PromoTool-Bereich“, welcher zur freiwilligen Vermarktung der Künstler (in die der Profilinhaber investiert hat) einladet. Die Believers können z.B. einen ShopBereich einrichten und direkt über ihr Profil die Musik ihrer Lieblingskünstler verkaufen, aber auch ganz einfach Informationen über Künstler bereitstellen. Profile 4 SellaBand basiert fast ausschließlich auf Profilen. Sowohl die User als auch die Künstler erstellen ihre Profile selbst. Dabei besteht die Möglichkeit neben der Bekanntgabe von textuellen Informationen auch Fotos und Videos hochzuladen. 96 Jedem User und Künstler steht auch ein eigener Blog zur Verfügung. Die persönlichen Angaben beschränken sich auf das Herkunftsland und den Eintrittstermin in die Plattform; optional können auch Geschlecht und Alter angegeben werden. Tagging 4 Inhalte werden auch auf SellaBand mittels Tagging sortiert. Dabei werden die meistgenutzten Tags zu einem Künstler größer dargestellt in der Tagcloud. Auf den Profilseiten der Künstler können die Tags zum jeweiligen Künstler, auf den Profilseiten der User können die persönlich getaggten Inhalte eingesehen werden. Präferenzaktiv 0 SellaBand arbeitet nicht mit Präferenzen oder Empfehlungen. Neuheiten werden über Playlisten verbreitet. Diese werden aber nicht nach Ähnlichkeiten im Musikstil oder der User zusammengestellt, sondern nach z.B. neuen Künstlern oder den erfolgreichsten Künstlern der Plattform. Ein Recommender System kommt nicht zum Einsatz. Produktiv Die Vision von SellaBand ist es Künstler ohne Labelvertrag eine Plattform zur erfolgreichen Promotion zu bieten. Dabei ist es unerlässlich die Musikstücke der Künstler gratis anzubieten. Prosuming 4 Um als Künstler überhaupt bei SellaBand teilnehmen zu können, müssen eigene Musiktitel hochgeladen werden. Die Künstler tragen somit ausschließlich und direkt zum Content der Plattform bei. Die Plattform selbst unterstützt dann die Bekanntmachung der Musiktitel. Anders als bei anderen Plattformen ist jedoch die Möglichkeit, dass die Künstler, falls ihre Promotion erfolgreich ist und sie die 50.000 Parts verkauft haben, ein Produzent und ein A&R-Manager zur Seite gestellt wird. Gemeinsam wird ein Album produziert, von dem wiederum drei Titel der Plattform zur Verfügung gestellt werden. 97 2.4. Musikspezifische Weblogs Weblogs sind bekannt für ihren alternativen Journalismus in Tagebuchform (siehe dazu Kapitel III.2.1.), aber auch im Bereich der Musik und des Musikjournalismus sind unzählige Weblogs entstanden. Die Angebote ähneln sich in Hinblick auf Funktion und Aufbau sehr stark und werden daher gemeinsam untersucht – die gesamte musikspezifische Blogosphäre steht bei der Betrachtung im Mittelpunkt. Blogs werden auf einer sehr individuellen und persönlichen Ebene verfasst und sind meist auf ein bestimmtes Musikgenre oder auf eine bestimmte Musikpräferenz beschränkt. Die Betreiber promoten ihre musikalischen Neuentdeckungen mittels eigenen Textbeiträgen, Videostreams von YouTube, Distributionsverbindungen zu Amazon.com und mit Musikdownloads. „Any music file you acquire following provided links, use only for your own evaluation purpose, and delete it within 24 hours. If you like anything of the music presented here, please buy it.”29 “The MP3s on this site are only available for 6 days. My intention is not to violate copyright laws. If you are owner (copyright or creator) of an MP3 posted here and are unhappy about its use, please email me and I will delete it immediately.”30 Passiv 0 Passiv kann ein Weblog sehr schlecht genutzt werden. Da sich die hier untersuchten Weblogs hauptsächlich mit relativ unbekannter Independentmusik beschäftigen, muss zuerst das Blog nach passender Musik durchsucht werden. Erst dann können die Audiodateien ausgewählt werden. Über eigene Player oder Playlisten, welche die Musik auf dem Blog zusammenstellen könnten, verfügen die Blogs nicht. 29 30 http://indiesurfer.blogspot.com Abruf am 09.12.2008 http://mp3hugger.com/2007/05/about-mp3hugger.html Abruf am 09.12.2008 98 Für die Nutzung aller Inhalte, auch musikalischer, ist allerdings keine Anmeldung erforderlich. Erst wenn man aktiv in die Kommunikation eintreten will, muss man sich dem Netzwerk anschließen, einige Blogger lassen aber auch das anonyme Verfassen von Beiträgen zu. Informativ 4 Die große Stärke musikspezifischer von Weblogs Informationen. liegt Je in der nach Aufbereitung persönlichem alternativer, Interesse des Blogbetreibers werden Informationen zu den unterschiedlichen Musikgruppen und Genres bereitgestellt. Die Informationen tragen immer die persönliche Note des Autors und können nicht als Tatsachen angesehen werden. Im lokalen oder regionalen Musikjournalismus haben die Blogger aber die Vorteile Informationen, welche für „seriöse“ Journalisten unerheblich wären, schnell und detailiert einer großen Öffentlichkeit zu unterbreiten (siehe dazu Seite 45 Blogs und die traditionellen Medien). Um die Menge an Information filtern zu können, verfügen alle Blogs über eine Suchfunktion und über eine Art Abosystem (RSS-Feed). Mittels RSS-Feed können die Besucher des Blogs auf zuvor definierte, neu erschienene Artikel eines oder mehrerer Blogs zugreifen, ohne jeden einzelnen Blog aufrufen zu müssen. Dabei ist ein RSS-Abonnement nicht auf reine Text-Inhalte beschränkt. Auch Audiooder Video-Inhalte (Podcasting) können via RSS abonniert werden. Interaktiv: Kommunikation und Partizipation One-one-Kommunikation 0 Eine persönliche One-one-Kommunikation ist in der Blogosphäre eher unerheblich. Vielmehr steht die Diskussion des Contents, des Inhalts, im Vordergrund. One-many-Kommunikation 4 Die zuvor erwähnte Aufbereitung musikspezifischer Inhalte erfolgt in der Blogosphäre mittels One-many-Kommunikation, also mittels Kommentarfunktion. Der Content wird durch Kommentare und deren Verlinkung mittels Trackbacks 99 und Blogrolls aufgebaut. So entsteht ein Netz an Informationen zum jeweiligen Thema. User Generated Content – Many-many Kommunikation 1 Aus der One-many-Kommunikation wird in der Blogosphäre durch das Verfassen von Kommentaren, das Hinzufügen von Trackbacks und Permalinks eine Manymany-Kommunikation zu einem spezifischen Thema. Das Gesamtbild betrachtend, ergibt dies einen User-Generated-Content, der zwar jeweils ein Thema generiert, dies aber in einer sehr persönlichen und ungeordneten Weise. Der Content selbst wird nicht verändert oder aktualisiert sondern durch Kommentare erweitert. Um User-Generated-Content im Sinne des definierten Kriteriums handelt es sich dabei eher nicht. Profile 1 Ebenso wie die One-one-Kommunikation ist auch die persönliche Darstellung durch Profile unerheblich. Die Teilnehmer an einem Blog, also die Verfasser der Kommentare, sind nur registriert und erhalten kein Profil. Die meisten Partizipatoren betreiben stattdessen selbst einen Blog. Das Betreiben eines Blogs in der Blogosphäre kann aber gleich, wie die Gestaltung eines Profils in einem Netzwerk gesehen werden. Denn der Autor des Blogs ist in seinem Blog stil- und themenbestimmend. Er entscheidet über die Inhalte und deren audiovisuelle Aufbereitung. Die Person selbst steht dabei aber meist im Hintergrund. Tagging 0 Blogs sind rückwärts chronologisch sortiert. Zusätzlich bieten die Blogger unterschiedliche Orientierungshilfen, wie z.B. Archive, Recent Posts, Blogroll. Das Ordnen mittels Tags ist unüblich. Die verschiedenen Blogs selbst werden aber auf Seiten wie www.delicious.com mittels Tags geordnet. Präferenzaktiv 0 Durch das Fehlen von Profilen und Angaben zu den eigenen Präferenzen ist die Nutzung eines Recommender-Systems nicht möglich. Ein Blog selbst ist aber eine Art Empfehlung an die Themeninteressierten. 100 Produktiv 0 Der Blogger ist durch seine selbst motivierte Betreibung des Blogs einer der Produzenten des Blogs. Die meisten Blogger widmen sich der Musik aber als Journalisten und nicht als Musiker, welcher seine Musik selbst hochlädt. Auch die Erweiterung der Blogosphäre, welche ausschließlich durch die Blogger erfolgt, kann zwar als eine Art Crowdsourcing gesehen werden, im Sinne des zuvor definierten Kriteriums Crowdsourcing, ist diese Aktivität aber nicht mit einzubeziehen. 101 Tabelle 3: Gegenüberstellung der Web 2.0-Angebote Last.fm MySpace SellaBand Weblogs Passiv 3 2 2 0 Informativ 4 3 2 4 One-one 4 4 3 0 One-many 4 4 2 4 Many-many 4 1 0 1 Profil 3 4 4 1 Tagging 4 0 4 0 Präfernzaktiv 4 0 0 0 Prosuming 3 4 4 0 Crowdsourcing 3 1 0 0 Kommunikativ Partizipativ Produktiv Quelle: Eigene Angaben Bei der Gegenüberstellung der Web 2.0-Angebote fällt auf, dass das Kriterium One-many-Kommunikation am stärksten ausgeprägt ist. Die Kommunikation und Partizipation mittels Kommentaren scheint für die User als befriedigendste Methode am Web 2.0 teilzunehmen. Durch die Wichtigkeit dieses Kriteriums entstehen besonders in der Musikpromotion neue Möglichkeiten (siehe dazu Teil V.). Zum passiven Musikkonsum kann das Web 2.0 sehr schlecht genützt werden, für ein „Berieseln lassen“ ist zumindest ein zuvor eingegebenes Suchkriterium notwendig. Meisten können nur einige wenige Lieder am Stück gehört werden. An Information mangelt es dem Web 2.0 allerdings nicht. Diese ist meist sehr aktuell und detailiert, die Quellen sind aber oft nicht angegeben. Die größte Stärke liegt bisher, wie bereits erwähnt, in der Kommunikation, aber das Web 2.0 hat auch viele Angebote hinsichtlich der Partizipation. Außer in der Profilgestaltung, bieten die musikspezifischen Web 2.0-Angebote aber vorerst nur 102 wenige Möglichkeiten im Bereich des Taggings oder in der gemeinsamen Gestaltung von Inhalten. Der Einsatz von Recommender-Systemen ist bei Distributionsanbietern wie amazon.com nicht mehr wegzudenken. Musikspezifische Web 2.0-Anwendungen müssen hier ihre Potentiale erst ausschöpfen. Grundsätzlich ist im Web 2.0 jeder User produktiv, sobald er sich bei einem Netzwerk registrieren hat lassen. Für musikalisch produktive Nutzer entwickeln sich die Web 2.0-Angebote immer stärker zu einfachen, unbürokratischen und günstigen Promotionsplattformen und unterstützen somit die Selbstvermarktung. Alle hier untersuchten Partizipation und Anwendungen besonders könnten hinsichtlich ihr Angebot Präferenzaktivität hinsichtlich noch deutlich verbessern. Jedoch ist im Web 2.0 die Glaubwürdigkeit der Plattform und der Nutzen für den User im Vordergrund, und diese scheinen bisher mit einer umfassenden Kommentarfunktion am besten zufrieden gestellt zu werden. 103 V. Auswirkungen auf die Musikpromotion Die große Stärke musikspezifischer Web 2.0-Anwendungen liegt in der Interaktivität. Am meisten ausgeprägt ist dabei die Kategorie One-manyKommunikation. Die One-many-Kommunikation als Kommentarfunktion wird in allen musikspezifischen Web 2.0-Anwendungen angeboten und trägt im weiteren Sinne zum User Generated Content bei. Die Promotion von Musik als Kernaufgabe der Musikindustrie könnte sich dadurch entscheidend verändern (siehe dazu Kapitel II.2.). Bisher übernahmen die herkömmlichen Massenmedien die Funktion des Mittlers, Filters und Promotors für die Musikindustrie. Diese Funktion begründet darauf, dass Tonträgerkäufe zu 60 Prozent Zielkäufe sind und zu 40Prozent Impulskäufe. Zielkäufe werden maßgeblich durch die Medien angeregt, aber auch an Impulskäufen können Medien beteiligt sein. Zum Beispiel können Erinnerungen an ein Lied, das man im Radio gehört hat, zu einem spontanen Kauf motivieren. Die Ursachen für die Wahrnehmung eines gekauften Produktes (Source of Awareness) haben sich, wie unten stehende Tabelle zeigt, in den letzten Jahren stark verändert. Die klassischen Promotionskanäle Radio und Fernsehen haben deutlich verloren, umgekehrt hat das Internet als neuer Promotionskanal klar zugelegt (vgl. Mahlmann 2008 S. 144). Tabelle 4: Sources of Awareness in Prozent für Promotion 2001-2007 Medium 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Radiosendungen 9,8 6,5 5,0 4,9 4,4 4,5 4,9 TV-Sendungen 5,1 3,7 4,5 3,6 4,2 3,3 3,4 MTV&VIVA 15,5 13,2 13,2 9,1 5,5 4,2 3,4 Konzert 2,0 1,6 1,9 1,7 2,4 3,0 2,5 Printmedien 3,4 2,6 2,8 3,0 2,9 2,8 3,0 Internet 2,8 3,4 4,2 4,7 5,1 4,8 8,5 Quelle: Eigene Darstellung nach Clement, Schusser, Papies S. 145 (GfK) Angesichts der Tatsache, dass Musikpromotion der Absatzsteigerung von Tonträgern dient und diese in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat, ist 104 es nicht verwunderlich, dass auch die Künstler selbst auf andere Promotionswege ausweichen. Künstler konzentrieren sich angesichts unsicherer Einnahmen aus dem traditionellen Tonträgergeschäft stärker auf Konzertaktivitäten. Bekanntestes Beispiel für die Entwicklung sind Prince, der seine neueste CD im Jahr 2007 umsonst einer Zeitschrift beilegte, und Madonna, die von ihrem bisherigem Label Warner Music zu einem Unternehmen (Live Nation) wechselte, das bisher primär als Konzertveranstalter aufgetreten war (vgl. Altig, Clement, Papies 2008 S. 17). Dies ist ein Feld, in dem die Labels bisher nicht an der Wertschöpfung partizipieren. Plattenfirmen streben nun den Abschluss sogenannter 360-GradVerträge an. Denn durch die Promotion der Labels werden die Künstler aufgebaut und die Konzert- und Merchandiseagenturen profitieren davon (vgl. Altig, Clement, Papies 2008 S. 26). Die fehlende Aufmerksamkeit der Kunden gegenüber den herkömmlichen Musikpromotoren wie Radio und Fernsehen, sowie die zunehmende Unzufriedenheit der Künstler mit der Promotionstätigkeit ihrer Labels zeigt die steigende Wichtigkeit der Promotion im Internet. Das Web 2.0 zeigt in der Erreichung von Promotionsaufgaben entscheidende Vorteile gegenüber anderen Medien. Kundenkontakt und Kundenkommunikation Die Plattenlabels haben traditionell keine direkte Kommunikation mit ihren Kunden. Damit vermarktet die Musikindustrie ihre Produkte an eine relativ unbekannte Masse (vgl. Clement; Papies; Schusser 2008, S. 10). Die Entwicklung vom klassischen Sendekonzept (ein Sender – viele Empfänger) hin zur individuellen Kommunikation öffnet neue Potenziale für den Musikmarkt. Der physische Handel musste in den vergangenen Jahren die Kompetenz der Kundenberatung durch den Absatzverlust immer weiter zurückfahren. Kompetente Fachhändler gaben auf, und Megastores mit hoher Preiskompetenz nahmen ihren Platz ein. Die Rolle des wichtigen Intermediär zum Kunden können nun aber neue Technologien in Form von Netzwerken übernehmen. Durch verschiedene Analysetechniken von Kundenpräferenzen, können Kunden gezielt 105 neue Produkte empfohlen werden, die ihren Vorlieben entsprechen. Diese neue Software kann Lücken schließen. Der Kunde kann sogar seine eigenen Präferenzen einbringen und trägt damit zur Meinungsbildung anderer bei. Diese Prozesse sind im digitalen Handel geeignete Möglichkeiten, die Qualität des Kundendienstes zu erhöhen, neue Nutzwerte einzubringen und gleichzeitig die Kosten im Vergleich zum physischen Handel zu reduzieren (vgl. Dyk 2008 S. 202). „Idealerweise findet ein Kunde beim digitalen Musikhandel der Zukunft ein speziell auf ihn zugeschnittenes Angebot vor. Dazu gehören Hinweise auf zu seinem Geschmack passende Musiktitel und Gruppen sowie Zusatzinformationen über Künstler, Konzerte in der regionalen Umgebung […].“ (Buxmann 2005, S.124) Virales Marketing Die Bedeutung von Word of Mouth-Kommunikation steigt, durch die einfachen Kommentar- und Kommunikationsfunktionen und die schnelle Verbreitung dieser, stark an. Dies fordert einen neuen Umgang mit der Word of Mouth- Kommunikation von Seiten der Musikindustrie. In diesem Zusammenhang wird oft der Begriff „virales Marketing“ verwendet. Gemeint ist die Verbreitung von Botschaften im Internet durch virtuelle Mund-zuMund-Propaganda. Dazu benötigt man Inhalte, die besondere Aufmerksamkeit erzeugen und das Pioniergefühl ansprechen. Gut eignen sich Inhalte die von Fans selbst generiert werden und bewusst nicht professionell sind. Mit „viralen Tools“ können Fans zum Mitmachen ermutigt werden, deren Beiträge viel glaubwürdiger wahrgenommen werden als anonyme Werbebotschaften. Vor allem das aktive Weiterleiten von Information, über z.B. tell a friend-Funktionen zeigt sich als geeignet, Botschaften zu verbreiten. Besonders wichtig ist es dabei, sogenannte „Early Adopters“ zu erreichen und zu überzeugen. Diese können aber nur mittels einer Pull-Strategie und nicht wie bisher im Musikmarketing üblich mit einer Push-Strategie erreicht werden, d.h. die Kunden müssen direkt umworben und können nicht durch generelle Werbung gewonnen werden (vgl. Mahlmann 2008 S. 155-156). 106 Kundenbindung Die Einbeziehung von Social Networks stellte einen sehr interessanten Fortschritt in der Internetpromotion dar, allerdings hat man es mit komplexen sozialen Systemen zu tun, die eigenen Regeln und Normen folgen. Im Gegensatz zu den konventionellen Ansätzen hat Internet-Promotion die Möglichkeit, Musik-Fans in die Promotionarbeit mit einzubinden. Die Botschaft über Künstler und neue Musikprodukte kann sehr effizient über Communities verbreitet werden, so dass im optimalen Fall für den betreffenden Künstler Fan-Communities entstehen, die ihrerseits den Kommunikationsprozess fortführen (vgl. Mahlmann 2008 S. 155156). Authentizität ist dabei wichtiger als Professionalität und Kreativität ist wichtiger als technische Vollkommenheit. „Für den Erfolg von Promotion gilt als eine wichtige Größe die „Story“: […] Konsumenten können für diesen Kommunikationsprozess nur aktiviert werden, wenn es zu Künstlern/Musikprodukten eine spannende und interessante Geschichte zu erzählen gibt.“ (Mahlmann 2008 S. 145) Die Industrie muss lernen, den Kunden viel dauerhafter mit Werken seines Lieblingskünstler zu bedienen und vor allem auch, den Kunden direkt darüber zu informieren. Das muss sich nicht auf die Veröffentlichung von Titel beschränken, sondern bezieht sich auch auf das Liefern von Content und Gesprächsstoff über den Künstler (vgl. Clement, Papies, Schusser 2008 S. 6). Für die Kundenbindung ist also unerheblich, wie viele Features eine Plattform bieten kann. Entscheidend sind die sozialen und identitätsstiftenden Faktoren, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Content und „die Wahrnehmung der Bedeutsamkeit des eigenen Beitrags“. Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen einen zweiten Beitrag in derselben Community schreiben steigt um 12 Prozent, wenn sie auf den vorangegangenen Beitrag eine Reaktion erhielten (vgl. Sassenberger 2008, S. 58-59). Web 2.0 stellt die Bedürfnisse der User und nicht die reine Information in den Vordergrund und kann somit langfristige Bindungen herstellen. 107 Selbstvermarktung Eine weitere Entwicklung zeigt, dass die Promotion eines Künstlers nicht mehr abhängig ist von einem Plattenvertrag. Grundsätzlich hat das Internet die Promotion von Musik und Künstlern „demokratisiert“. Zumindest in der ersten Phase der Vermarktung braucht der Künstler nicht den großen Apparat der Musikindustrie oder ein enormes Marketingbudget. Die kostengünstige InternetPromotion kann durch individuelle Maßnahmen eingeleitet werden und digitale Verkäufe können auch ohne Vertriebsapparat stattfinden. Der Erfolg der unabhängigen Künstlerin Anja Plaschg alias Soap&Skin zeigt die mittlerweile hohe Effizient von Selbstvermarktung durch das WWW. Im Vergleich zu stark promoteten Künstlern, wie etwa der Band „Cardic Move“, Gewinner des Ö3 Soundcheck (größter Bandwettbewerb in Österreich), erhält die Künstlerin im Internet einen höheren Bekanntheitsgrad und eine viel höhere Glaubwürdigkeit. „Auf MySpace, einem der Tummelplätze der potentiellen Käuferschicht, gratulieren der hoffnungsfrohen Combo [Cardic Move] gerade mal eine Handvoll Freunde. Und „Friends“ sind mittlerweile die harte Währung im Musikgeschäft, Version 2.0.“ (Profil 2008 Nr 47 / 39 Jg. S. 131) Bisher hat die Erfahrung jedoch meist gezeigt, dass in den nachfolgenden Phasen der Verbreitung eines Musikprodukts die herkömmlichen Massenmedien unverzichtbar sind. Deshalb bleibt auch in der Literatur die Rolle von Web 2.0 noch unklar. Radio und Musikfernsehen sind nach wie vor zentrale Promotionsplattformen, die es zu bedienen gilt. Insofern spielen die Majors mit ihren Kernkompetenzen auch im digitalen Zeitalter eine zentrale Rolle. Nur sie haben das Potenzial, Künstler über längere Zeit zu unterstützen und auf großer Basis und unter Berücksichtigung aller Medien zu vermarkten. Es wird nach wie vor den Labels obliegen, aus der reichen Vielfalt lokalen musikalischen Schaffens nach bestimmten Kriterien eine Auswahl zu treffen und diese regional oder international zu vermarkten (Gebesmaier 2008 S. 175-176). „Das reichlich düstere Stück [The Sun von Soap&Skin] wollten bislang 20Mal soviel entdeckungsfreudige Fans hören wie den zukünftigen Ö3-Hit. Mit knapp einer halben Million Profilaufrufen und einer nicht enden wollenden Mitteilungsflut enthusiasmierter Adoranten („Ich brenne für 108 diese Musik“) ist Soap&Skin kein Geheimtipp mehr. […] Gerade wurde ein Vertrag mit dem weltweit operierenden Indie-Label PIAS unterzeichnet […].“ (Profil 2008 Nr 47 / 39 Jg. S. 132) Vereinzelt zeigt sich, dass Musik, die zunächst als User Generated Content den Weg in die Öffentlichkeit des Internets gefunden hatte, sich später auch im traditionellen Markt etablieren konnte. Inwieweit diese Prozesse zur Wertschöpfung in der Musikindustrie auch abseits der Majors beisteuern können, bleibt abzuwarten. Die Präsentationsmöglichkeiten für die Musikindustrie und für die Künstler selbst haben sich durch das Internet im Vergleich zu herkömmlichen Medien wesentlich erweitert: Internet-Portale sind in der Darstellung der Inhalte wesentlich flexibler, können Neuigkeiten über Künstler oder Charts kurzfristig aufnehmen. Sie sind nicht nur schneller, sondern auch interaktiv, auch wenn die Kommunikation mit den Teilnehmern nicht immer kontrollierbar ist. Die Musikindustrie sollte die neuen Möglichkeiten ausschöpfen, auf die Intensivierung von B2C-Beziehungen (Business to Consumer) bauen und sich Fan-Communities zu Nutze machen, die es allerdings nach dem Aufbau auch zu pflegen gilt (vgl. Mahlmann 2008 S. 155-156). 109 Schlusswort Die Veränderungen meiner persönlichen Musikrezeption durch das Web 2.0 führten zum Interesse an dieser Arbeit. Zunächst beschäftigte ich mich mit dem Thema Musikgeschmack und wie dieser grundsätzlich entsteht. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem das aktive Musikhören oder aktives Musizieren und die Kommunikation über Musik, jene Aktivitäten sind, die sich bei der Musikrezeption im Gehirn manifestieren und den Geschmack ausbilden. Im „Mitmach Web“, dem Web 2.0, geht es genau um jene Aktivität, die es uns erlaubt gestalterisch tätig zu werden und sich aktiv um unseren Musikgeschmack zu kümmern. Um dieses medial so stark genutzte Schlagwort „Web 2.0“ untersuchen zu können, muss dieser Begriff für musikspezifische Angebote typologisiert werden. Dabei lag es auf der Hand die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten in ein Schema von passiv bis aktiv einzuordnen. Als Kernaufgabe aller Web 2.0-Angebote stellt sich die Bereitstellung einer umfassenden Kommentarfunktion heraus. Die User benutzen die Kommentare untereinander um sich auszutauschen und sich gegenseitig Anerkennung zu zollen und lassen durch ihre Kommunikation und Partizipation am Web 2.0 einen User Generated Content entstehen, welcher unzählige Informationen für andere User und auch Erkenntnisse für die Musikindustrie bereithält. Das Web 2.0 ist den traditionellen Musikmedien einige Schritte voraus. Nicht nur das Unmengen an Informationen bezüglich des Musikgeschmacks der User gesammelt werden können, die Musik wird auch von den Usern mittels Social Tagging geordnet. Web 2.0-Angebote kennen also ihre Kunden sehr genau und haben den Vorteil, dass sie sehr preisgünstig agieren können, denn schließlich stellen die Kunden den Inhalt selbst zur Verfügung. Die größte Schwierigkeit für Web 2.0-Angebote am Markt bestehen zu bleiben, ist die kritische Masse zu überschreiten und die Konkurrenz abzuhängen. Ein erfolgreiches Musikmedium muss als Filter und Mittler in der Menge an angebotener Musik fungieren und zugleich einen entscheidenden Kundenstock anhäufen um am Markt bestehen bleiben zu können. Musikspezifische Web 2.0Angebote könnten dabei in der Wertschöpfungskette der Musikindustrie im 110 Bereich der Musikpromotion bzw. dem Musikmarketing besonderen Stellenwert erhalten. Erfolgsversprechende Plattformen wie „Pandora“ wurden vom Markt zwar wieder verdrängt. Andere Beispiele wie die Verkäufe von MySpace und Last.fm könnten aber ein Indiz für den dauerhaften Erfolg vom Web 2.0 als Musikpromotoren sein. 111 Literatur ALBY, Tom (2007): Web 2.0. Konzepte, Anwendungen, Technologien. München, 2007 ALTIG, Ulrike; CLEMENT, Michel; PAPIES, Dominik (2008): Marktübersicht und Marktentwicklung der Musikindustrie. In: CLEMENT, Michael; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008, S. 17-26 ANDERSON, Chris (2007): The Long Tail. München, 2007 BAACKE, Dieter (Hrsg.) (1998): Handbuch Jugend und Musik. Opladen, 1998 BASTIAN, Hans Günther (1991): Jugend am Instrument. Opladen, 1991 BECK, Klaus (2006): Computervermittelte Kommunikation im Internet. München, 2006 BEHNE, Klaus-Ernst (1975): Musikalische Konzepte - Zur Schicht- und Altersspezifität musikalischer Präferenzen. In: KRAUS, Egon (Hrsg.): Forschung in der Musikerziehung. Mainz, 1975, S. 35-61 BEHNE, Klaus-Ernst (2002): Musikpräferenzen und Musikgeschmack. In: BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf (Hrsg): Musikpsychologie. Ein Handbuch. 4. Auflage. Hamburg, 2002, S. 339-353 BENJAMIN, Walter (1989): Gesammelte Schriften Band II/3. Reflexionen zum Rundfunk. Frankfurt am Main, 1989, S. 818-1526 BERGE, Stefan; BUESCHNIG, Arne (2008): Strategien von Communities im Web 2.0. In: HASS, Bertold H,; WALSH, Gianfranco; KILIAN, Thomas (2008): Web 2.0: Neue Perspektiven für Marketing und Medien. Berlin, 2008, S. 23-38 BLAUKOPF, Kurt (2002): Tonträger. In: BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf (Hrsg): Musikpsychologie. Ein Handbuch. 4. Auflage. Hamburg, 2002, S. 175-180 112 BOURDIEU, Pierre (1979): La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Édition de Minuit, 1979. Deutsch: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main, 1982 BRIEGMANN,Frank; JAKOB, Hubert (2008): Management der Wertschöpfungskette. In: CLEMENT, Michael; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008, S. 87-98 BROSIUS, Hans Bernt. (2006). Massenkommunikation. In: H. W. Bierhoff & D. Frey (Hg.), Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie. Göttingen, 2006, S. 588-594 BRUHN, Herbert (2002): Tonpsychologie – Gehörpsychologie - Musikpsychologie. In: BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf (Hrsg): Musikpsychologie. Ein Handbuch. 4. Auflage. Hamburg, 2002, S.439-451 BRUHN, Herbert (2008): Musikpsychologie. Das neue Handbuch. Hamburg, 2008 BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf; RÖSING, Helmut (2002): Musikpsychologie: Ein Handbuch. 4. Auflage. Hamburg, 2002 BURKART, Roland (2002): Kommunikationswissenschaft: Grundlagen und Problemfelder. Wien, 2002 BÜTTNER, Katja (2008): Content-Based versus Collaborative Filtering. Frankfurt am Main, 2008 CHARLTON, Michael interdisziplinären (1997a): Rezeptionsforschung Medienwissenschaft. In: als Aufgabe CHARLTON, einer Michael; SCHNEIDER, Silvia (Hrsg.) (1997):Rezeptionsforschung. Opladen 1997. S. 16- 39 CHARLTON, Michael; SCHNEIDER, Silvia (Hrsg.) (1997b):Rezeptionsforschung. Opladen 1997 CLEMENT, Michel; PAPIES, Dominik; ALBERS Sönke (2008): Netzeffekte von Musik. In: CLEMENT, Michael; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008, S. 45-58 113 CLEMENT, Michel; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008 CRIPE, Billy (2007): Folksonomy, Keywords & Tags: Social & Democratic Userinteraction in Enterprise Content Management. In: Oracle Business & Technology White Paper: Abruf am 12.09.2008 http://www.oracle.com/technology/products/contentmanagement/pdf/OracleSocialTaggingWhitePaper.pdf DOLLASE, Rainer (1998): Musikpräferenzen und Musikgeschmack Jugendlicher. In: BAACKE, Dieter (Hrsg.): Handbuch Jugend und Musik. Opladen, 1998, S. 341-368 DOLLASE, Rainer (2005): Musikalische Sozialisation. In: OERTER, Rolf; STOFFER, Thomas: Spezielle Musikpsychologie. Göttingen, 2005, S.153-206 DÖRING, Nicola (2003): Sozialpsychologie des Internets: Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen, 2003 EBERSBACH, Anja, GLASER, Markus; HEIGL, Richard (2008): Social Web. Konstanz, 2008 EIBL, Thomas ; PODEHL, Bernd (2005). Internet. In: Jürgen Hüther/Bernd Schorb (Hrsg.), konzipierte Grundbegriffe Medienpädagogik. Auflage. (S. 4.,vollständig 170-178) neu München:. http://www.mediacultureonline.de/fileadmin/bibliothek/eiblpodehl_internet /eibl-podehl_internet.pdf, Abruf am 11.03.2008 ERIKSON, Erik H. (1966): Identität und Lebenszyklus, Frankfurt, 1966 ERIKSON, Erik H. (1973): Identität und Lebenszyklus, Frankfurt, 1973 FRIEBE, Holm; LOBO, Sascha (2007): Wir nennen es Arbeit: Die digitale Boheme oder: Intelligentes Leben jenseits der Festanstellung. München, 2007 GEBESMAIR, Andreas (2001): Grundzüge einer Soziologie des Musikgeschmacks. Wiesbaden, 2001 114 GEBESMAIR, Andreas (2008): Die Fabrikationen globaler Vielfalt. Struktur und Logik der transnationalen Popmusikindustrie. Bielefeld, 2008 GEMBRIS, Heiner (1998): Zum Stand der Erforschung musikalischer Begabung und Entwicklung am Ende des 20. Jahrhunderts. In: SCHOENEBECK, Mechthild (Hrsg.): Entwicklung und Sozialisation aus musikpädagogischer Perspektive. Musikpädagogische Forschung, Bd. 19. Essen, 1998, S. 9-26 GEMBRIS, Heiner (2008): Musikalische Entwicklung im Erwachsenenalter. In: BRUHN, Herbert (2008): Musikpsychologie. Das neue Handbuch. Hamburg 2008, S. 162-189 GOLDER, Scott A.; HUBERMAN, Bernardo (2008): The Structure of Collaborative Tagging Systems. http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/tags/tags.pdf, Abruf am 04.08.2008 GÖTTLICH, Udo (2008): Zur Kreativität des Handelns in der Medienaneignung: Handlungs- und praxistheoretische Aspekte als Herausforderung der Rezeptionsforschung. In: WINTER, Carsten; HEPP, Andreas; KROTZ, Friedrich Hrsg. (2008): Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Grundlegende Diskussionen, Forschungsfelder und Theorieentwicklungen. Wiesbaden, 2008, S. 383-400 HASS, Bertold H,; WALSH, Gianfranco; KILIAN, Thomas (2008): Web 2.0: Neue Perspektiven für Marketing und Medien. Berlin, 2008 HECHENBERGER, Thomas (1999): Zur Funktionalität der Musik und ihrer Rezeption. Wien, 1999 HEYMANN, Martin (2004): Recommender System in Theorie und Praxis. Frankfurt am Main, 2004 ISKOLD, Alex: Blogbeitrag vom 28.Nov.2007 auf www.readwriteweb.com; http://www.readwriteweb.com/archives/blogosphere_long_tail.php, Abruf am 3.12.2008 115 JAKOB, Hubert (2008): Wirtschaftlichkeit der Musikindustrie. In: CLEMENT, Michael; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008, S.77-84 JÄSCHKE, Robert; HOTHO, Andreas; SCHMITZ, Christoph; STUMME, Gerd (2006): Wege zur Entdeckung von Communities in Folkxonomies. http://dbs.informatik.unihalle.de/GvD2006/gvd06_jaeschke.pdf , Abruf am 08.08.2008 KASPER, Helmut; MAYERHOFER, Wolfgang (1996): Personalmanagement, Führung, Organisation. Wien, 1996 KERRES, Michael (2006): Potenziale von Web 2.0 nutzen. In: HOHENSTEIN, Andreas; WILBERS, Karl (Hrsg.): Handbuch E-Learning. 2006, München, http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/system/files/web20-a.pdf, Abruf am 28.10.2008 KIENITZ, Günter W. (2007). Web 2.0. Der ultimative Guide für die neue Generation Internet. Kempen, 2007 KILIAN, Thomas; WALSH, Gianfranco; ZENZ, René (2008):Word-of-Mouth im Web 2.0 am Beispiel von Kinofilmen. In: HASS, Bertold H,; WALSH, Gianfranco; KILIAN, Thomas (2008): Web 2.0: Neue Perspektiven für Marketing und Medien. Berlin, 2008, S. 321-338 KOLLMANN, Tobias; STÖCKMANN, Christoph (2008): Diffusion von Web 2.0Plattformen. In: HASS, Bertold H,; WALSH, Gianfranco; KILIAN, Thomas (2008): Web 2.0: Neue Perspektiven für Marketing und Medien. Berlin, 2008, S. 39-56 KUNZ, Andreas (1998): Aspekte der Entwicklung des Persönlichen Musikgeschmacks. Frankfurt am Main, 1998 LEONHARD, Gerd (2008): Music 2.0. Essays by Gerd Leonhard. www.music20book.com, Abruf am 23.09.2008 116 LINDNER, Livia (2007): Radiotheorie und Hörfunkforschung: zur Entwicklung des trialen Rundfunksystems in Deutschland, Österreich und der Schweiz; Schriften zur Medienwissenschaft 15. Hamburg, 2007 LULL, James (1985): On the Communicative Properties of Music. In: Communication Research 12/1985, S. 363-372 MAEMPEL, Hans Joachim: Medien und Klangästhetik. In: BRUHN, Herbert (2008): Musikpsychologie. Das neue Handbuch. Hamburg, 2008, S. 231-252 MAHLMANN, Carl (2008): Managing Marketing und Sales. In: CLEMENT, Michael; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008, S. 135-166 MISOCH, Sabine (2004): Identitäten im Internet. Selbstdarstellung auf privaten Homepages. Konstanz, 2004 MORTENSEN, Magnus (2007): Design and Evaluation of a Recommender System. Master´s Thesis in Computer Science. University of Tromsø, 2007 MORVILLE, Peter; ROSENFELD, Louis (2006): Information Architecture for the World Wide Web; O´Reilly, Sebastopol, 2006 MÜNCH, Thomas (2008):Musik in den Medien. In: BRUHN, Herbert (2008): Musikpsychologie. Das neue Handbuch. Hamburg, 2008, S. 266-290 MÜNCH, Thomas; EIBACH, Martin (2005): Musik und Medien. In: OERTER, Rolf; STOFFER, Thomas: Spezielle Musikpsychologie. Göttingen, 2005, S. 461524 MÜRZL, Gregor; RIEMENSCHNEIDER, Hayko (2008): Recommender System der anderen Art: Kaufempfehlungen für Supermarktartikel. http://www.muerzl.net/data/preis_empfehlung.pdf, Abruf am 01.09.2008 NEVUE, David (2007): How to promote your music on the internet. The musician´s guide to effective music promotion an the internet. 2007 NIEDERMAIER, Hubertus (2008): Können interaktive Medien Öffentlichkeit herstellen. In: STEGBAUER, Christian/ JÄCKEL, Michael (Hrsg.): Social 117 Software: Formen der Kooperation in computerbasierten Netzwerken. Wiesbaden, 2008, S.49-70 O´REILLY, Tim (2005): What is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. http://www.oreilly.de/artikel/web20.html, Abruf am 15.08.2008 OERTER, Rolf; STOFFER, Thomas (2005): Spezielle Musikpsychologie. Göttingen, 2005 OTTE, Gunnar (2008): Lebensstil und Musikgeschmack. In: GENSCH, Gerhard; Eva Maria Stöckler, Musikdistribution Peter und Tschmuck (Hrsg.): Musikproduktion. Musikrezeption, Der Wandel des Wertschöpfungsnetzwerks in der Musikwirtschaft. Wiesbaden, 2008. S. 2556 PETERS, Isabella; STOCK, Wolfgang G. (2008): Folksonomies in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. In: Wissenschaft und Praxis 59/2008, S. 77-90 PETERS, Lars (2007): Radio und Musik. In: SCHNEIDER, Beate; WEINACHT, Stefan (Hrsg.): Musikwirtschaft und Medien. München, 2007. S. 247- 266 PETSCHE, Hellmuth (2002): Zerebrale Verarbeitung. In: BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf (Hrsg): Musikpsychologie. Ein Handbuch. 4. Auflage, Hamburg, 2002, S. 630-638 PRISS, Uta; POLOVINA, Simon; HILL, Richard (2007): Conceptual Structures: Knowledge Architectures for Smart Applications: 15th International Conference on Conceptual Structures, ICCS 2007, Sheffield, UK, July 2227, Berlin PROFIL (17.11.2008): Am Elektro-Lagerfeuer. Nr.47 / 39 Jg. Wien, 2008 REJZLIK, Wolfgang (2001): Musikpräferenzen Jugendlicher. Unter besonderer Berücksichtigung der massenmedialen Verbreitung von Musik. Wien, 2001 RENNER, Tim (2004): Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm! Über die Zukunft der Musik- und Medienindustrie. Frankfurt am Main, 2004 118 RICHTER, Alexander; KOCH, Michael (2007): Social Software – Status Quo und Zukunft. Technischer Bericht Nr. 2007-01, München, 2007. http://www.kooperationssysteme.de/wordpress/uploads/RichterKoch2007. pdf, Abruf am 12.09.08 RÖSING, Helmut (1983): Rezeptionsforschung in der Musikwissenschaft. Darmstadt, 1983 RÖSING, Helmut (1995): Musikalische Sozialisation. In: HELMS, Siegmund; SCHNEIDER, Reinhard; WEBER, Rudolf (Hrsg): Kompendium der Musikpädagogik, 1995, S. 349-372 RÖSING, Helmut; PHELPS, Thomas (2002): Persönlichkeitsentwicklung. In: BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf (Hrsg): Musikpsychologie. Ein Handbuch. 4. Auflage, Hamburg, 2002, S.368-375 SASSENBERG, Kai (2008): Soziale Bindungen von Usern an Web 2.0-Angebote. In: HASS, Bertold H,; WALSH, Gianfranco; KILIAN, Thomas (2008): Web 2.0: Neue Perspektiven für Marketing und Medien. Berlin, 2008, S. 57-72 SCHENK, Michael (2007): Medienwirkungsforschung. Tübingen, 2007 SCHMIDT, Jan (2006): Social Software: Onlinegestütztes Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement. In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. Nr 2/2006, S. 37-46. SCHMIDT, Jan (2008): Was ist neu am Social Web? Soziologische und kommunikationswissenschaftliche Grundlagen. In: ZERFAß Ansgar; Welker Martin; Jan Schmidt (Hrsg.): Kommunikation, Partizipation und Wirkung im Social Web. Köln, 2008. S. 18-40 SCHNEIDER, Beate; WEINACHT, Stefan (Hrsg.) (2007): Musikwirtschaft und Medien. München, 2007 SCHULTZ VON THUN, Friedemann (1982): Miteinander reden (Bd.1). Reinbek, 1982 119 SHUTER DYSON, Rosamund (2002a):Tonalität und Harmoniegefühl. In: BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf (Hrsg): Musikpsychologie. Ein Handbuch. 4. Auflage, Hamburg, 2002, S. 299-304 SHUTER DYSON, Rosamund (2002b):Einfluss von Elternhaus, Peers, Schule und Medien. In: BRUHN, Herbert; OERTER, Rolf (Hrsg): Musikpsychologie. Ein Handbuch. 4. Auflage, Hamburg, 2002, S. 305-316 SMUDITS, Alfred (2002): Mediamorphosen des Kulturschaffens. Kunst und Kommunikationstechnologien im Wandel. Wien, 2002 SPERLICH, Regina (2005): Popularmusik in der digitalen Mediamorphose. Wien, 2005 SPIEGEL, André (2006):Die Befreiung der Information. Bonn, 2006 STEGBAUER, Christian/ JÄCKEL, Michael (Hrsg.) (2008): Social Software: Formen der Kooperation in computerbasierten Netzwerken. Wiesbaden, 2008 STEINDL, Thomas (2007): Musikpiraterie. Entstehung, Auswirkungen, Alternativen, Trends. Saarbrücken, 2007 STEINKRAUß, Niko; GEMLIN, Hannes; GÜNNEL, Stefan (2008): Wettbewerbsanalyse. In: CLEMENT, Michael; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008, S. 27-44 SZUGAT, Martin (2006): Social Software. Frankfurt am Main, 2006 TOFFLER, Alvin (1980): Die Zukunftschance: Von der Industriegesellschaft zu einer humaneren Zivilisation. München, 1980 TSCHMUCK, Peter (2003): Kreativität und Innovation in der Musikindustrie. Innsbruck, 2003 VAN DYK, Tim (2008): Einfluss neuer Technologien auf die Wertschöpfungskette in der Musikindustrie. In: CLEMENT, Michael; SCHUSSER, Oliver; PAPIES, 120 Dominik (Hrsg.) (2008): Ökonomie der Musikindustrie. Wiesbaden, 2008, S. 197-210 VOß, Günter; RIEDER, Kerstin (2006): Der arbeitende Kunde: Wenn Konsumenten zu unbezahlten Mitarbeitern werden. Frankfurt am Main, 2006 WARM, Michael (2008): Neue Geschäftsmodelle in der Musikindustrie: Erfolgspotenziale unterschiedlicher Spieler vor dem Hintergrund von Marktanforderungen und Kompetenzprofilen. München, 2008 WINTER, Carsten; HEPP, Andreas; KROTZ, Friedrich Hrsg. (2008): Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Grundlegende Diskussionen, Forschungsfelder und Theorieentwicklungen. Wiesbaden, 2008 WINTERHOFF-SPURK, Peter (2004): Medienpsychologie: Eine Einführung (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart, 2004 ZERFAß Ansgar; WELKER Martin; Jan SCHMIDT (Hrsg.): Kommunikation, Partizipation und Wirkung im Social Web. Köln, 2008 STUDIEN: SCHEINER Heinz (Hrsg.) (2008): Web 2.0 Tomorrow: Online- und OfflineVerhalten der Web 2.0 Generation; Burda Community Network GmbH, Tommorow Publishing GmbH; www.burda-community- network.de/Web_2.0_TOMORROW.pdf; Abruf am 1.12.2008) FISCH Martin; GSCHEIDLE Christoph (2008): Mitmachnetz Web 2.0: Rege Beteiligung nur in Communitys. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie. In: Media mit Perspektiven Fachzeitschrift ARD-Forschungsdienst 7/2008, zu Medienthemen http://www.media- perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/Fisch_II.pdf; Abruf am 1.12.2008) GERHARDS Maria; KLINGLER Walter; TRUMP Thilo (2006): Aktive Rezipienten und Nutzung im Social Web. In: ZERFAß Ansgar; Welker Martin; Jan 121 Schmidt (Hrsg.): Kommunikation, Partizipation und Wirkung im Social Web, Köln, 2008, S 129-148 122