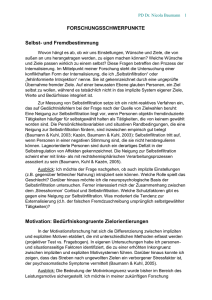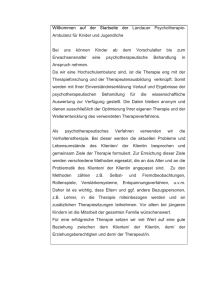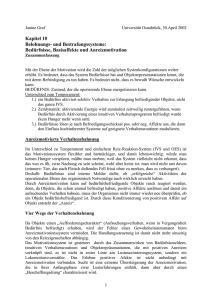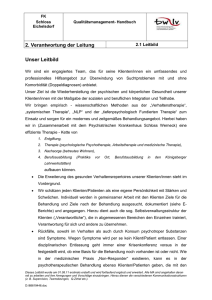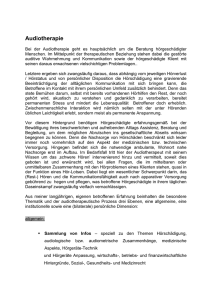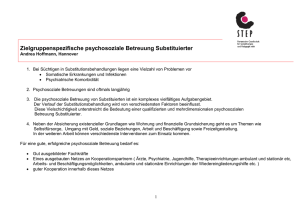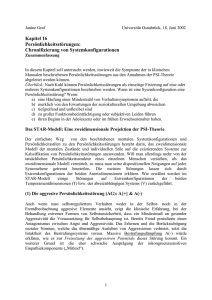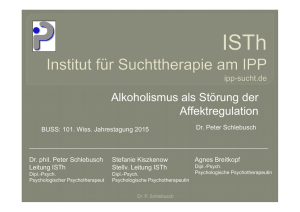Buch KOP Alkohol Endfassung\374
Werbung

Alkoholismus als Störung der Affektregulation Ein Störungsmodell auf der Basis der PSIPSI-Theorie Peter Schlebusch, Julius Kuhl, Janine Breil & Oliver Püschel (2005) ANMERKUNG: Die vorliegende Arbeit wurde möglich durch die Unterstützung der Hans-Prinzhorn-Klinik, Westfälische Klinik Hemer, insbesondere durch den ärztlichen Direktor, Prof. Dr. med. U. Trenckmann sowie den früheren Chefarzt der Suchtmedizinischen Abteilung, Dr. med. H.-D. Koritsch. Alkoholismus als Störung der Affektregulation Ein Störungsmodell auf der Basis der PSI-Theorie Peter Schlebusch, Julius Kuhl, Janine Breil & Oliver Püschel Die PSI-Theorie von Kuhl (Kuhl, 2001; Kaschel & Kuhl 2004) stellt eine umfassende Persönlichkeits- und Handlungsregulationstheorie dar, die im Gegensatz zu eigenschaftstheoretischen oder faktorenanalytischen Ansätzen Persönlichkeit nicht als ein mehr oder weniger statisches Ensemble von traits oder – allgemeiner – Dimensionen auffasst, sondern als ein dynamisches System interagierender psychischer Makrosysteme. Im Folgenden wollen wir nach einem Überblick über Probleme in der Therapie des Alkoholismus wesentliche Annahmen der PSI-Theorie darstellen und eine Anwendung auf den Störungsbereich des Alkoholismus mit dem Ziel der Entwicklung der Grundzüge einer allgemeinen Störungstheorie der Sucht versuchen. Im Anschluss werden wir die therapeutischen Implikationen des geschilderten Störungsmodells aufzeigen, und zwar als Kritik der traditionellen, regelorientierten und direktiven Suchttherapie, wie sie noch in den meisten Suchtfachkliniken anzutreffen ist, und in kritischer Ergänzung verhaltenstherapeutischer bzw. lösungsorientierter Ansätze um klärungsorientiertes Vorgehen, das wir für unverzichtbar halten. Wir verfolgen mit diesem Vorgehen zwei Ziele: Zum einen wollen wir versuchen, die Lücke zwischen klinisch-psychologischer und grundlagenwissenschaftlicher psychologischer Theoriebildung zu verkleinern. Die PSI-Theorie stellt u. E. wichtige Konstrukte zur Verfügung, die das Verständnis süchtigen Verhaltens entscheidend zu bereichern in der Lage sind. Darüber hinaus stellen motivationspsychologische Konzepte eine der wesentlichen Grundlagen der Klärungsorientierten Psychotherapie dar: Was die Lerntheorie für die Verhaltenstherapie, ist die Motivationspsychologie für die KOP. Zu den wichtigsten Zielen der KOP zählt die Schemaklärung und die Bedürfnisrepräsentation (vgl. Sachse, in diesem Band). Beide Begriffe haben im Kern motivationspsychologische Implikationen. Zum anderen beabsichtigen wir, eine Reihe von Punkten zu klären, die in bisherigen Störungsmodellen der Sucht unseres Erachtens unbefriedigend gelöst sind. So mangelt es z. B. bisherigen lerntheoretischen Modellen der Sucht an einer sinnvollen Integration mit neurobiologischen Befunden: Insbesondere sind hier Ergebnisse zur Rolle des mesolimbischen dopaminergen Belohnungssystems zu nennen, da dieses gleichermaßen für das operante Belohnungslernen, die psychotrope Wirkung der meisten suchterzeugenden Substanzen, die neurobiologischen Grundlagen der Depression und für einige Persönlichkeitsstörungen (z. B. der antisozialen PS) von Bedeutung ist. Ähnlich verhält es sich mit dem septo-hippocampalen Angst/Bestrafungssystem, das für die anxiolytische Wirkung der meisten psychotropen Substanzen, das operante Bestrafungslernen, die Angststörungen und einige weitere Persönlichkeitsstörungen (z. B. die selbstunsichere und die abhängige PS) von Bedeutung ist. Zwei weitere zentrale Probleme bisheriger Störungsmodelle bestehen a) in der mangelnden Integration des Komorbiditätsproblems und b) der mangelnden Integration und theoretischen Analyse der Motivationsprobleme bei Suchtklienten. Beide Punkte machen sie zu schwierigen Klienten. 2 1.: Komorbidität, Motivation und Störungsmodelle der Sucht Ein zentrales Problem in den bisherigen Störungsmodellen der Sucht stellt das Komorbiditätsproblem dar, also das Problem des gleichzeitigen Auftretens einer oder mehrerer Achse-I- und Achse-II-Störungen zusätzlich zur Substanzabhängigkeit. Komorbidität muß u. E. nach gegenwärtiger Literaturlage nicht als Ausnahme-, sondern als Regelfall betrachtet werden (Moggi & Donati, 2004; Moggi, 2002; Rosenthal, 2003; Rassool, 2002; Schwoon, 2001; Driessen, 1999; Morgenstern et al., 1997; Powell et al., 1982, 1987; Hesselbrock et al. 1985; Ross et al., 1988; Herz et al., 1990). Festzuhalten ist, dass verschiedene epidemiologische Studien zwar unterschiedliche, jedoch insgesamt hohe Komorbiditätsziffern ergeben, die stark von der verwendeten Methodik und den diagnostischen Systemen abhängen. Eine besondere Rolle scheint dabei die Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen zu spielen, die in verschiedenen Studien mit Prävalenzen zwischen 57 und 78% angegeben wird (Überblick u. a. bei Driessen, 1999; Becker & Quinten, 2003; Sachse, Schlebusch & Leisch 2002). Die ECA Studie (Epidemiologic Catchment Area Program, Regier et al., 1990) zeigte, dass 29% der Personen mit psychischen Störungen gleichzeitig an einer Substanzstörung litten. Die Zweiterkrankungsrate bei Alkoholabhängigen (zusätzliche Drogenstörung und/oder psychische Störung) lag bei 45%, bei Drogenstörungen lag sie bei 72%. Schließt man Substanzstörungen als Komorbiditätsdiagnose aus, so findet sich in der genannten Studie bei rund einem Drittel aller Alkoholabhängigen und der Hälfte aller Drogenabhängigen eine weitere psychische Störung über die Lebenszeit. Das Risiko ist um den Faktor 2,3 (Alkoholabhängige) bzw. 4,5 (Drogenabhängige) erhöht. Ähnliche Zahlen erbrachte die NCS-Studie (National Comorbidity Survey, Kessler et al., 1994). Lieb & Isensee (2002) fanden in einer Überblicksarbeit, dass Angststörungen den substanzbezogenen Störungen eher vorausgehen, während Affektive Störungen kein klares zeitliches Muster aufweisen. Driessen (1999) fand in einer Stichprobe von 250 Klienten in Entgiftungsbehandlung eine Komorbiditätsrate von 58,4%, wenn Persönlichkeitsstörungen eingeschlossen wurden (Methoden: CIDI und IPDE). Suizidversuche in der Vorgeschichte fanden sich bei 29,2%, 14,1% hatten ein Jahr nach Entlassung Suizidgedanken entwickelt und 8,1% einen Suizidversuch unternommen. Das Suizidversuchsrisiko war gegenüber der Allgemeinbevölkerung im Katamnesezeitraum um das 22 bis 44fache erhöht. Ca. 12% aller männlichen und 15% aller weiblichen Alkoholiker sterben an Suizid, 25% aller Suizidtoten in den USA waren Alkoholiker (Übersicht zur Mortalität bei Feuerlein, 1996). Diese und andere Zahlen sprechen insgesamt dafür, dass eine hohe Komorbidität über das gesamte Spektrum psychiatrischer Störungen vorliegt. U. E. wird die Frage der Komorbidität von Sucht und psychischen Störungen aller Wahrscheinlichkeit nach sogar noch stark unterschätzt. Dies hat mehrere Gründe: • Diagnostische Artefakte: Die hochschwelligen Regeln der diagnostischen Systeme (DSM-IV, ICD-10) führen im Falle der Sucht dazu, Komorbidität systematisch zu unterschätzen. Insbesondere die Zeitkriterien für z. B. affektive Störungen sind bei Süchtigen in der Regel nicht erfüllbar, da die meisten Personen innerhalb des fraglichen diagnostischen Zeitfensters gleichzeitig die Substanz konsumieren, so dass lege artis keine unabhängige Diagnose gestellt werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass der Zweck der operationalen Diagnostik sensu ICD-10 und DSM-IV unter anderem in der Erhöhung der Schwelle für falsch-positive Diagnosen besteht. Forschungs3 • fragen wiederum folgen oft einer umgekehrten Logik: Oft ist es sinnvoll, auch kleine Unterschiede zu fokussieren, um über die Prozesse der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Störung etwas zu lernen. Zweifelsohne erfüllt ein großer Teil der Klienten mit Substanzabhängigkeiten i. e. S. nicht die Kriterien z. B einer Major Depression, wenn man sie buchstabengetreu einschließlich der Zeitkriterien anwendet. Neben der Zeitfenster-Problematik dürfte der häufigste Grund hierfür darin liegen, dass man entsprechende Befunde schlecht von substanzinduzierten Störungen abgrenzen kann. Dies alles bedeutet jedoch keineswegs, dass z. B. affektive Prozesse bei der Genese oder Aufrechterhaltung der Störung irrelevant sind. Unabhängig von suchtspezifischen Fragen liegt ein Problem der Komorbiditätsdiagnostik auch bei anderen Störungen darin, dass beide operationalen diagnostischen Systeme von klar umschriebenen und zeitlich abgrenzbaren Syndromen ausgehen, die nur selten der Realität der Klienten entsprechen. Naive Kausalitätsmodelle: In der Komorbiditätsdiskussion wird z. T. von eher vereinfachenden Modellvorstellungen von Kausalität ausgegangen (vgl. z. B. Schwoon, 2001). Es dominiert die Idee, dass eine Störung A primär vorhanden ist und sekundär eine Störung B zur Folge hat, wobei Sucht die primäre oder sekundäre Störung darstellen kann. Kennzeichnend für diese Art der Kausalität ist die Idee der zeitlichen Abfolge: Störung A muß kriterienkonform diagnostiziert sein, um dann eine ebenfalls vollständig diagnostizierbare Störung B verursachen zu können. Dies ist jedoch nur eine denkbare Form von Kausalität (vgl. Hodapp, 1984): Es ist möglich, das sich zwei Störungen gegenseitig aufschaukeln, logisch bedingen (ohne zeitlich oder symptomatisch sauber trennbar zu sein) oder sich gemeinsam aus einem undifferenzierten Kern entwickeln. Eine Kombination aus gemeinsamer Entwicklung aus einem undifferenzierten Kern und gegenseitiger Aufrechterhaltung (Abb. 1) dürfte die angemessenste Vorstellung sein. Die Regeln der operationalen Diagnostik tendieren dazu, eine bestimmte Form von Kausalität, nämlich die der zeitlichen Abfolge von zwei voll ausgebildeten Störungen, zu bevorzugen. Andere Kausalzusammenhänge würden zu anderen Störungsdefinitionen und auch zu anderen Komorbiditätsannahmen führen. 4 • Repräsentations-Regulations-Problem: Süchtige tendieren dazu, bereits bei kleinen Verstimmungen auf die Substanz zur Gegenregulation zurückzugreifen; dies geschieht häufig schon aufgrund antizipatorischer Prozesse, also bevor die Tatsache einer gravierenderen Verstimmung von der Person überhaupt repräsentiert wird oder die Verstimmung überhaupt ein repräsentierbares Ausmaß angenommen hat (vgl. Abb. 2). Die Regulations-Schwelle, d. h. die Schwelle, ab der die Person eine Stimmungsabweichung mit der Substanz gegenreguliert, liegt somit häufig unterhalb der Repräsentations-Schwelle. Verschiedentlich wurde von Autoren auf Probleme von Süchtigen bei der Wahrnehmung von Gefühlen hingewiesen (z. B. von Lieb & Reichert, 1982), z. T. unter Rückgriff auf das psychoanalytische Konzept der Alexithymie (Burian, 1985), das im Rahmen der Theoriebildung über Psychosomatische Störungen eine Rolle spielt. Im Gegensatz zu Süchtigen ist jedoch bei Klienten mit Psychosomatischen Störungen die Regulationsschwelle deutlich über die Repräsentationsschwelle hinaus erhöht: Sie regulieren Belastungen auch dann nicht gegen, wenn sie diese repräsentieren; Süchtige regulieren Belastungen schon, wenn sie sie nur erahnen oder antizipieren. Dies lässt u. E. darauf schließen, dass Süchtige eine erhöhte Sensibilität für störende Affekte aufweisen. Hierin ist auch oft ein Grund dafür zu sehen, dass Personen angeben, ein Rückfall hätte "ohne Grund einfach so" stattgefunden. Suchttherapeuten sind gut damit vertraut, dass ihre Klienten oft in erstaunlicher Weise keine spontanen Zusammenhänge zwischen erheblichen psychosozialen Belastungsfaktoren und einem Rückfallgeschehen herstellen können. Hierin liegt u. E. ein wesentliches Problem von kognitiven Rückfallkonzepten: Suchtspezifische Überzeugungen (wie z. B. bei Beck et al., 1997) sind mit Klienten in der Regel erst post hoc zu rekonstruieren; in den seltensten Fällen geben sie spontan an, in einer Rückfallsituation bestimmte Überzeugungen aktiviert zu haben. U. Belastung E. hat dies den Alkohol Grund darin, dass emotionale Prozesse im Rückfallgeschehen die zentrale Rolle spielen. Emotionale Prozesse weisen in der Informationsverarbeitung andere Prozesscharakteristika auf als kognitive, obwohl sie natürlich eng und menhängen. Emotionale Aspekte sind im Rückfallgeschehen nicht reziprok Resultatzusameiner Top-Down-Aktivierung, sondern von Bottom-Up-Prozessen: Sie sind schnell und aktivieren semantische Aspekte bereits präkognitiv im Sinne eines Priming-Effektes. Sie müssen nicht repräsentiert werden, um verhaltensrelevant zu sein. Vermutlich verläuft der Prozess der emotionalen Aktivierung und der antizipatorischen Gegenregulation so schnell, dass es gar nicht zu einer Aktivierung kognitiver Schemaaspekte kommt. Die Bearbeitung und selbst die Identifizierung von Überzeugungen im Beck5 • schen Sinne fällt daher bei Süchtigen erheblich schwerer als bei anderen Störungen, wie z. B. der Depression. Depressive Klienten haben depressive Kognitionen in der Regel deutlich besser verfügbar. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie damit auch die zentralen impliziten Schemaannahmen besser repräsentieren. Depressive Klienten können beispielsweise durchaus Sätze spontan präsent haben, wie: „Ich habe xy nicht geschafft, also bin ich ein Versager.“ Suchtklienten hingegen haben oft selbst bei solchen Konstruktionen Schwierigkeiten. Verwechselung von Inhalts- und Bearbeitungsebene: Suchtklienten berichten auch in strukturierten Interviews häufig nicht über bestehende affektive Verstimmungen, da sie diese - ähnlich wie Personen mit Psychosomatischen Störungen - als irrelevant bewerten ("Das ist nicht so schlimm!", "Da muss man durch!", etc.) oder emotionale Informationen nicht nutzen, um den Zustand ihres psychischen Systems zu reflektieren. Sachse (2003) fasst diese Phänomene unter dem Stichwort der Bearbeitungsstörungen zusammen: Das 3-Ebenen-Modell der Psychotherapie unterscheidet eine Inhalts-, eine Bearbeitungs- und eine Beziehungsebene im therapeutischen Geschehen. Die Bearbeitungsebene umfaßt dabei nicht die Inhalte selbst, sondern den Umgang des Klienten mit Inhalten. Ein prototypisches Bearbeitungsproblem stellt z. B. die habituelle Nichtbeachtung emotionaler Informationen durch den Klienten dar. Sagt ein Klient z. B. zu einem bestimmten Inhaltsbereich, er sei nicht relevant, nicht belastend, "normal" etc., so bedeutet dies keineswegs zwingend, dass dem auch so ist. Ignoriert der Klient emotionale Informationen, ist sogar das Gegenteil möglich: Man kann davon ausgehen, dass das Ignorieren von emotionalen Informationen besonders die relevanten Informationen betrifft bzw. sich hier besonders gravierend auswirkt. In diesem Fall ist die Bearbeitungsproblematik die wesentliche Interventions- und Analyse-Ebene in der Therapie. Suchttherapeuten kennen dies – sofern sie das Phänomen richtig einordnen – genau: Die Klienten können oft Gefühle nicht konkret benennen (Th.: "Wie geht es Ihnen damit?" Kl.: "Schlecht." Th.: "Was genau heißt schlecht?" Kl.: "Nicht gut." etc.), weichen den Fragen aus ("Ich weiß nicht.") u. s. w.. Ein weiteres Bearbeitungsproblem ist das der wahrgenommenen mangelnden zeitlichen Kontingenz zwischen dem Eintritt von Belastungsfaktoren und dem Eintritt von Belastungserleben bzw. Belastungsrepräsentation. Oft finden wir bei der therapeutischen Bearbeitung von Rückfällen oder Craving, dass Klienten angeben, dass es keine vorausgehende Belastung gegeben hätte. Nähere Analysen zeigen dann oft, dass Belastungsereignisse dem Rückfall in größerem zeitlichen Abstand (Belastung am Morgen, Craving am Abend) vorausging. Die mangelnde Repräsentation belastender emotionaler Zustände zum Zeitpunkt des Auftretens von Belastungsereignissen führt dazu, dass der Klient oft zum Zeitpunkt des Rückfalls oder des Auftretens von Craving keinen Zusammenhang mehr zwischen dem Ereignis und der Reaktion herstellen kann. Auch dieses Phänomen lässt sich als Bearbeitungsproblem identifizieren: Der Klient nimmt lediglich ein bestimmtes Zeitfenster beim Versuch der Identifikation von Belastungen ins Visier. Ein weiteres Bearbeitungsproblem ist das „Problem des hinreichenden Grundes“. In der Regel sind Klienten sich der Tatsache bewusst, dass ihr Suchtverhalten ein schwerwiegendes Problem ist. Die Heuristik des „Hinreichenden Grundes“ beschreibt das Phänomen, dass Personen für ein schwerwiegendes Problemverhalten nach Ursachen suchen, die in etwa die gleiche Intensität aufweisen, wie das zu erklärende Verhalten. Schwere Probleme können demnach nur durch schwere Ursachen adäquat erklärt werden. Die Person schließt dann alle Erklärungsfaktoren aus der Betrachtung aus, die die Intensität des Problemverhaltens nicht „treffen“. Gelegentlich werden auch Kleinigkeiten als übertrieben schwerwiegende Belastungen dargestellt. Damit versuchen Klienten, die Ursachen in ihrer Intensität an die Schwere des Problems anzupassen, was dann oft für 6 • den Therapeuten nicht nachvollziehbar ist. Nimmt der Therapeut Bearbeitungsprobleme fälschlich als Information auf der Inhaltsebene wahr, so muß er zu der Überzeugung kommen, dass die fraglichen Inhalte tatsächlich keine Rolle spielen. Es entsteht der sog. Ebenen-Fehler in der Psychotherapie: Der Therapeut verarbeitet eine Information ausschließlich auf der Inhaltsebene, das Klienten-Problem bewegt sich jedoch zunächst auf der Bearbeitungsebene. Insbesondere zu Anfang der Therapie sind Bearbeitungsprobleme häufiger, da Klienten in „dysfunktionalen Bearbeitungsschemata feststecken“ (Sachse, 2003). Anzunehmen ist ferner, dass sich die Bearbeitung im Verlaufe der Therapie verbessert bzw. sich unter therapeutischem Einfluß verbessern sollte, sofern Therapeuten über die notwendige Bearbeitungsexpertise verfügen ("Bearbeitung der Bearbeitung"). Entsprechend nimmt auch die Qualität der Modellbildung des Therapeuten auf Inhaltsebene über die Zeit zu. Generell gilt somit, dass Informationen, die der Klient zu Anfang einer Therapie gibt oder repräsentiert, häufig nicht hinreichen, um eine bestimmte Problematik sicher auszuschließen. Dies hat Einfluss auf Indikationsentscheidungen des Therapeuten und selbstverständlich auch auf Diagnosen (und besonders auf den Ausschluss von Diagnosen). Letztere sollten besonders bei Alkoholabhängigen zunächst als Arbeitshypothesen betrachtet werden; der diagnostische Prozeß stellt eine kontinuierliche Modellbildung und -anpassung dar und hängt von der im Prozess variablen Validität der Informationen ab. Verwechselung von Inhalts- und Beziehungsebene: Die objektive Einschätzung von komorbiden Problemen kann durch Beziehungsaspekte in der Therapie massiv verzerrt werden. Beziehungsaspekte in der Therapie können von Klienten- und Therapeutenseite her gestört sein. Auf Klientenseite sind hier v. a. interaktionelle Pläne (Caspar, 1995) oder Interaktionsspiele (Sachse, 2001, 2004) zu nennen. Klienten mit Persönlichkeitsstörungen oder ausgeprägten Persönlichkeitsstilen haben jeweils spezifische interaktionelle Problem- und Zielrepräsentationen, die die tatsächliche Einschätzung einer Problematik stark erschweren. Insbesondere sog. Image-Spiele (Sachse, 2001) verzerren bestehende Probleme in der Regel erheblich von der Beziehungsebene aus. Narzißtische Personen präsentieren sich z. B. selbst als problemfrei, allenfalls die "Haltungsnote" ist verbesserungsfähig. Histrionische Personen präsentieren sich hingegen eher als extrem belastet, allerdings attribuieren sie Belastung external auf mangelnde Aufmerksamkeit anderer Personen. Die Auskunftsbereitschaft und v. a. die Repräsentationsfähigkeit des Klienten auf der Inhaltsebene hängt ferner stark von der Beziehungsgestaltung durch den Therapeuten ab. Generell nimmt unter der Bedingung einer guten therapeutischen Beziehungsgestaltung die Auskunftsbereitschaft des Klienten und auch die Validität seiner Problemrepräsentation über die Zeit zu. Eine repräsentationsfördernde therapeutische Beziehung wirkt, indem der Therapeut die Dialektik von komplementärer Beziehungsgestaltung und kritischem Verstehen umsetzt (vgl. hierzu v. a. Sachse, Schlebusch & Sachse, o. J.). Therapeutisches Verstehen schließt ein, dass auch unklare und widersprüchliche Konstruktionen vom Therapeuten hinterfragt werden. Eine therapeutische Beziehungsgestaltung, die ausschließlich auf interaktioneller Freundlichkeit beruht, ist zwar möglicherweise angenehm, therapeutisch jedoch wenig wirksam. Diese Dialektik zeigt, dass die therapeutische Beziehung eine Prozessvariable darstellt und nicht von Anfang an gegeben ist, indem der Therapeut eine bloße Haltung einnimmt oder sich dazu bekennt. Sachse (2005) hat insbesondere in der Kritik der klassischen Klientenzentrierten Gesprächstherapie verschiedentlich darauf hingewiesen, dass die therapeutische Beziehung keine Haltung, sondern eine Handlung ist. Eine Einschät7 • zung komorbider Störungen ist somit zu Anfang der Therapie schon alleine aus Beziehungsgründen kaum zu sichern. Insbesondere Suchtklienten tendieren dazu, nicht von Anfang an eine vertrauensvolle Beziehung einzugehen. Warum sollte ein Klient, der zu Anfang der Therapie sogar sein Alkoholproblem leugnet oder verzerrt repräsentiert, ausgerechnet ein komorbides Problem korrekt repräsentieren? Wie bereits oben geschildert, sind sich Alkoholiker fast immer der Tatsache bewußt, dass ihre Störung einen Verstoß gegen soziale Normen darstellt. Neben der Heuristik des „Hinreichenden Grundes“ hat diese Tatsache eine weitere Konsequenz auf der Beziehungsebene. Die Klienten antizipieren, dass andere Personen (auch die Therapeuten) sie mit einem "Alkoholiker-Image" identifizieren, demzufolge Alkoholiker willensschwach und asozial sind, nicht gut riechen, nachts auf der Straße herumpöbeln, ihre Partner und Kinder schlagen und einen schlechten Charakter haben. Alkoholiker teilen darüber hinaus zumeist selbst diese Sicht über (andere) Alkoholiker; unter anderem deshalb versuchen sie, ihren Interaktionspartnern (auch Ärzten und Therapeuten) klar zu machen, dass sie nicht zu dieser Gruppe gehören oder zumindest nicht so schlimm sind, wie die anderen („Ich trinke nicht täglich, nur Bier, werde nicht aggressiv, etc..“). Besonders direktive und inquisitorische Therapeuten verursachen Reaktanzphänomene bei Klienten, wenn sie darauf bestehen, dass sich Klienten in diese Gruppe einordnen lassen, bevor sie überhaupt eine Behandlung bekommen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine therapeutisch induzierte Beziehungsstörung, die ein negatives Selbst-Labeling des Klienten zur Voraussetzung der Beziehungsaufnahme macht. Klienten lernen dabei schnell, was man besser sagen und was man besser nicht sagen sollte. U. a. lernen sie, dass Therapeuten keine Ausreden hören wollen: "Ich trinke, weil ich depressiv bin!" ist in den Augen von rigiden Suchttherapeuten eine Ausrede und wird von ihnen oft sanktioniert. Klienten passen sich aufgrund dieser Sanktionen nicht nur Sprachregularien an, sondern sie übernehmen auch die Störungsmodelle ihrer Therapeuten (zumindest verbal). Dies hat – wie wir weiter unten sehen werden – seinen Grund u. a. in dem Alienationsphänomen: Da der Zugang zum Selbstsystem den Klienten nicht möglich ist, übernehmen sie auch unkorrekte Problemdefinitionen durch andere Personen (Selbstinfiltrationseffekt; Kuhl & Kaschel, 2004; Kuhl, 2001; Baumann, 1998). Eine objektive Anamnese und Diagnosestellung bezüglich komorbider Probleme setzt somit voraus, dass der Klient auf der Ebene der therapeutischen Beziehung überhaupt in die Lage versetzt wird, Probleme zu repräsentieren. Externalität: Suchtklienten zeigen auch unabhängig von Interaktionsspielen in der Regel ein hohes Maß an Externalität; diese ist definitionsgemäß mit einer Abwendung der Aufmerksamkeit von internalen Prozessen verbunden, so dass die Person häufig nur sehr eingeschränkt ihre inneren Zustände valide repräsentiert. Der Begriff der Externalität ist u. E. inhaltlich zu präzisieren. Grob vereinfachend wird unter Externalität häufig verstanden, dass die Person Ursachen für ihr Verhalten außerhalb ihrer Person verortet. Präziser ist Externalität zu bestimmen, wenn Internalität als Gegenpol definiert wird: Internalität ist nämlich nicht schon dann gegeben, wenn die Person sich selbst als Ursache des Problemverhaltens begreift, sondern vor allem dann, wenn sie versteht, dass ihre eigenen Konstruktionen, Bewertungen, Emotionen, Verarbeitungen und Schemata konstitutiv für das in Frage stehende Problem sind und dass sie insofern einen Handlungsspielraum hat: Sie kann durch eine Veränderung dieser internalen Problemdeterminanten ihre Sicht und ihr Verhalten ändern. Es gibt folgende Varianten von Externalität: Externale Opfertheorie: Die Person reklamiert für sich einen Opferstatus, d. h. sie betrachtet sich als Opfer anderer Personen, falscher Freunde, unerträglicher Part8 - ner, intrusiver Vorgesetzter oder der allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnisse (Trinken als Reaktion auf die schwankenden Aktienkurse oder die Globalisierung). Entscheidendes Merkmal einer Opfertheorie ist nicht, ob die Person Opfer ist oder nicht. Selbstverständlich können Personen Opfer anderer Personen oder der gesellschaftlichen Verhältnisse sein. Eine Opfertheorie ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass die Person ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Opferstatus instrumentell einsetzt, um ein Problemverhalten zu entschuldigen, mildernde Umstände zu reklamieren oder dessen mangelnde Veränderbarkeit zu begründen. Änderungen im Verhalten wären demzufolge nur dann möglich, wenn sich die externalen Bedingungen ändern. Eine beliebte Variante ist folgende: Die Person trinkt, weil die Partnerin co-abhängig ist. Zumindest hätte sie sonst schon viel früher aufgehört. Schließlich hätte die Partnerin die Person ja entschiedener darauf aufmerksam machen können, dass sie ein Alkoholproblem hat. Wahrscheinlich hat sie das nicht getan, weil ihr im Grunde ein trinkender Partner lieber ist, weil man den in aller Ruhe manipulieren kann. Um trocken zu bleiben, muß sich demzufolge nicht die Person selbst ändern, sondern die Partnerin. Sie war ja schließlich co-abhängig und hat somit die Verantwortung dafür, dem Süchtigen jetzt Bedingungen zu schaffen, die Abstinenz ermöglichen. Dieses Phänomen nennen wir „Co-Abstinenz“: Kl.: "Meine Frau soll mich darauf aufmerksam machen, wenn ich rückfallgefährdet bin.", "Alkoholiker sind sehr sensible Menschen, wir brauchen eigentlich besonderes Verständnis von anderen." Die Klienten reklamieren für sich eine Sonderbehandlung i. S. eines Schonraums und einer Verantwortungsübernahme durch andere. Ein Klient sagte einem anderen in der Gruppentherapie: "Wenn du übergewichtig bist, nimmst du nicht ab sondern verlangst, dass sich die Schwerkraft ändert." In Anlehnung an eine andere Klientenäußerung bezeichnen wir dieses Verhalten auch als das "Panda-BärSyndrom": Die Person tut so, als gehöre sie zu den bedrohten Tierarten, benötige Schutz und ein Reservat zum Überleben, das frei von Belastungen der restlichen Welt ist; ideal wäre ein persönlicher "Ranger", der einem die passenden Bambussorten bringt, da nur diese das Überleben ermöglichen. Internale Opfertheorie: Die Person sieht nicht die Verhältnisse oder andere Personen als Ursache an, sondern ist sich durchaus im Klaren darüber, dass sie selbst das Problem verursacht oder zumindest mitbestimmt. Sie greift hierbei jedoch auf internale Determinanten zurück, die sie leider nicht kontrollieren kann; sie ist somit zwar scheinbar internal, jedoch ohne wesentliche Konsequenz für die eigenen Verhaltensspielräume. Diese Art von Konstruktion kann man auch als "Pseudo-Internalität" bezeichnen. Die effektivsten pseudo-internalen Konstruktionen sind: a) die genetische Ausstattung/Alkoholismus als Krankheit: "Mein Vater war Alkoholiker, mein Großvater war Alkoholiker, wir sind Alkoholiker über mehrere Generationen. Das liegt in den Genen, da kann man nichts machen!"; b) das Unbewußte: Die Person handelt zwar selbst, ist jedoch nicht "Herr im eigenen Haus", da ihre Handlungen durch tiefe, nicht zugängliche und unbewußte Vorgänge gesteuert werden: "Ich trinke nicht, es trinkt in mir!"; c) Defizitäre psychische Zentralfunktionen wie z. B. "der eiserne Wille": "Ich kämpfe jeden Tag mit mir, aber jedes mal verliere ich.", "Ich kann einfach nicht wollen."; "Ich muß es einfach in den Kopf kriegen, dass ich nicht trinken will."; 9 • • d) Partialpersönlichkeiten mit eigener Handlungsplanung, die die "echte" Persönlichkeit sabotieren: "Da war dann wieder dieser innere Schweinehund, und schwupp ..."; e) Opfer der eigenen Biographie: Die Person räumt ein, selbst zu trinken, und zur Not auch, dass eigene Entscheidungsprozesse daran beteiligt waren. Diese sind jedoch in der Vergangenheit entstanden, und da die Vergangenheit per definitionem vorbei ist, ist eine Beeinflussung leider nicht mehr möglich. f) Das „Rührei-Problem“: Die Person räumt ein, dass sie in der Vergangenheit durchaus eigene Entscheidungen gefällt hat, dass es auch Alternativen zum Alkoholismus als Bewältigungsstrategie gegeben haben mag. Nun hat sie sich aber anders entschieden, und die Bewertungen, Entscheidungen und Handlungsweisen sind so „in Fleisch und Blut übergegangen“, dass eine Trennung der Komponenten heute nicht mehr möglich ist. Eigelb und Eiweiß waren einmal getrennt, wenn sie einmal verrührt sind, bekommt man sie nie wieder auseinander. Intoxikationseffekte: Schließlich überlagern die unmittelbaren Wirkungen der Substanzintoxikation die Symptome einer Depression (mit anderen Worten: Die Person ist betrunken); dies schließt auch mittelfristige Nachwirkungen der Substanz ein. Fehlattribution auf die Substanz: Personen, die alkoholabhängig sind, attribuieren häufig Veränderungen im Erleben und Verhalten auf den Substanzkonsum und werden dabei von Therapeuten oft voreilig unterstützt; davon unabhängige Störungen im Erleben und Verhalten werden häufig nicht als psychische Störungen definiert. Die oben aufgeführten Punkte sind nicht nur dafür verantwortlich, dass das Komorbiditätsproblem systematisch unterschätzt wird. Sie sind auch der Grund, dass Suchtklienten in der Therapie als schwierig gelten; eine Reihe von Phänomenen, die unter dem Einfluß psychoanalytischer Theoriebildung unter dem Stichwort der Abwehrmechanismen zusammengefasst werden, finden sich ebenfalls in unserer obigen Liste von Schwierigkeiten. Suchtklienten zeigen darüber hinaus bestimmte Auffälligkeiten, die so häufig sind, dass auch sie in einem Störungsmodell der Sucht systematisch berücksichtigt werden sollten. Diese ließen sich am besten unter dem Stichwort der Motivation zusammenfassen. Suchtklienten gelten als schwierig aus folgenden Gründen: • • • • • • Sie generieren Absichten und ändern ihre Pläne permanent, bilden oft oberflächliche, "mit der heißen Nadel gestrickte" Pläne, die nicht richtig durchdacht erscheinen; Sie kündigen Handlungen oft an, sind jedoch häufig "nicht motiviert", Verhaltensänderungen tatsächlich einzuleiten; Wenn es ihnen doch gelingt, ins Handeln zu kommen, hören sie schnell wieder auf, sobald es Schwierigkeiten gibt, zeigen eine „niedrige Frustrationstoleranz“; Handlungspläne, die langfristige, hierarchisch gegliederte Umsetzungen erfordern, werden nicht initiiert; Wenn Sie handeln, dann v. a., um negative Konsequenzen kurzfristig abzuwenden; Sie gelten als undiszipliniert, nicht bereit, sich Regeln zu unterwerfen. Lange Zeit wurde das Problem der Komorbidität durch das Suchthilfesystem komplett ignoriert oder zur bloßen Folge des sozialen Abstieges bei fortgeschrittener Sucht redu10 ziert. Mittlerweile scheint sich zumindest in der wissenschaftlichen Diskussion diese Haltung zu ändern. Angesichts dessen verwundert es, dass in den derzeit gängigen Manualen zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit nur wenige (z. B. Moggi, 2002; Moggi & Donati, 2004) der Behandlung komorbider Störungen die nötige Aufmerksamkeit schenken. Unter dem Einfluss störungsspezifischen Vorgehens in der Psychotherapie wird die Einbeziehung von Achse-I-Komorbidität jedoch nicht integrativ, sondern additiv durch die Hinzunahme eines zusätzlichen Störungsmodells (z. B. der Angst) gelöst: Anstatt ein Manual durchzuführen, macht man als Therapeut eben zwei oder man gibt sich der Hoffnung hin, dass die eine Störung automatisch verschwindet, wenn die andere behandelt wird. Auch die Diskussion um die Rolle von Persönlichkeitsstörungen bei Süchtigen (also die Komorbidität mit Achse-II-Störungen) hat bisher zu keiner befriedigenden Integration entsprechender Theorien oder Behandlungskonzepte in die Suchttherapie geführt (Sachse, Schlebusch & Leisch, 2002). Miller & Rollnick (1991) haben in ihrem einflußreichen Buch zwar zeigen können, dass eine Reihe der Schwierigkeiten, die in der Therapie mit Suchtklienten auftreten, Artefakte der Einstellungen und Erwartungen von Therapeuten darstellen und haben unter dem Stichwort des motivational interviewing angepaßte therapeutische Strategien für den Umgang mit diesen oft selbst gemachten Problemen entwickelt. Dennoch ist festzuhalten, dass die beschriebenen Phänomene in der Motivation ein Problem auch jenseits von Artefakten durch Therapeuten darstellen und dass ihre Rolle im Rahmen einer Störungstheorie auch bei Miller & Rollnick nicht geklärt ist. Hier verhält es sich ähnlich, wie mit dem Komorbiditätsproblem: Die Motivationsprobleme, die Suchtklienten "schwierig" machen, werden external zur Störung konzipiert. In psychoanalytischen Konzepten wird das Phänomen der Abwehr dazu herangezogen, das ein nicht-störungsspezifisches Generalkonzept der Psychoanalyse darstellt. In verhaltenstherapeutischen Ansätzen werden Motivationsprobleme zumeist als Probleme auf der Inhaltsebene behandelt, die durch Interventionen wie die Diskussion der Vor- und Nachteile des Trinkens, die Vermittlung von Informationen oder durch Hilfen bei der Zielbildung angegangen werden. Gelingt die Verbesserung der Motivation auf Inhaltsebene nicht, werden darüber hinaus bestehende Probleme als mangelnde Veränderungsbereitschaft, Kooperation oder „Compliance“ des Klienten aufgefasst und außerhalb der Störungstheorien als eigenständiger Sachverhalt und als Merkmal der Person behandelt (z. B. bei Schulte, 1997, als „Basisverhalten“). Diese Auffassung weisen wir zumindest für die bisher in der KOP behandelten Störungen klar zurück: In der KOP ist im Gegensatz zu den genannten Auffassungen eine Integration von sog. „Therapiehindernissen“ in die Störungstheorie selber kennzeichnend, wie z. B. in Sachses Theorie der doppelten Handlungsregulation (Sachse, 2001), in der Kooperationsprobleme des Klienten als Ergebnis einer Diskrepanz zwischen verschiedenen Ebenen der Regulation interaktionellen Handelns aufgefasst wird. Dies ist insofern einer externalen Konzeption vorzuziehen, als dass die Faktoren, die die Kooperation mit dem Therapeuten oder die Therapiemotivation erschweren, die gleichen sind, die die Störung als solche, also außerhalb des therapeutischen Settings, wesentlich definieren. In der Praxis der Suchttherapie wird der Begriff der Motivation oft sehr nahe am Alltagssprachgebrauch verwendet. Oft wird unter Motivation verstanden, dass der Patient nachdrücklich bekundet, eine Veränderung zu wünschen. Dies ist jedoch als Grundlage für die Einschätzung von Änderungsmotivation absolut unzureichend. Wissenschaftlich gesehen ist Motivation ein höchst komplexes Konstrukt und keineswegs auf die Bekundung und Umsetzung von Intentionen zu beschränken. Intentionsbildung ist sogar eine ausgesprochene Stärke von Alkoholabhängigen. Dies hält sie jedoch nicht vom Trinken ab; am Anfang unserer Beschäftigung mit motivationspsychologischen Fragen bei Süchtigen stand sogar der Eindruck, dass diese Intentionsbildung wesentlich zum Problem beiträgt. In der Therapie mit Alkoholabhängigen fällt jedenfalls eher auf, dass die Inten11 tionen, die die Klienten bilden, ihnen nicht wirklich bei der Bewältigung ihrer Sucht helfen. Es entsteht sogar eher der Eindruck, dass die Klienten durch ihre Absichten regelrecht in der Zielerreichung behindert werden. Zumeist meinen es die Klienten mit ihren Absichten durchaus ernst: Sie sind ernsthaft enttäuscht und ratlos bei einem Rückfall; nicht – wie oft unterstellt - die Entscheidung, doch zu trinken, sondern eher Scham über die eigene „Willensschwäche“ ist der häufigste Grund für einen Behandlungsabbruch. Die Motivationsprobleme von Süchtigen bestehen u. E. nicht in der mangelnden, son- dern in der übermäßigen Bildung von Intentionen, die nicht hinreichend durch „authentische“ Bedürfnisse der Person unterstützt werden. Für die Alkoholabhängigkeit beabsichtigen wir daher, die oben genannten Probleme in eine Störungstheorie zu integrieren: • • • • • • • • • • • Wir führen Sucht auf Schwierigkeiten der Klienten zurück, positive und negative Affekte internal zu regulieren; operante Wirkungsmechanismen der Substanz werden von Klienten eingesetzt, um die mangelnde internale Regulation von Affekten zu substituieren. Die Probleme in der Affektregulation führen dazu, dass die Betroffenen keinen Zugang zu impliziten Bedürfnissen, Motiven und Präferenzen haben; die Personen können sich dann nicht an internalen Standards orientieren. Die Betroffenen neigen dann zur Bildung von Absichten (expliziten Handlungsplänen), die nicht „selbstgewollt“ sind; dabei orientieren sie sich an externalen Standards. Die Personen neigen dann zu Schwierigkeiten, die nicht selbstgewollten Absichten in Handlungen umzusetzen. Die neurobiologischen Systeme der Affektregulation (Belohnungssystem, Angst- oder Bestrafungssystem) sind sowohl Wirkorte der Substanz als auch zentrale Mechanismen des operanten Lernens. Defizite in der Affektregulation können erlernt und/oder genetisch bedingt sein. Defizite in der Affektregulation können sekundär als Folge von Substanzabhängigkeit auftreten oder maximiert werden. Neurologische Folgeschäden können die Fähigkeit, Affekte zu regulieren und Impulshandlungen zu hemmen, progredient beeinträchtigen. Die häufigsten komorbiden Achse-I-Störungen bei Alkoholabhängigen (Affektive Störungen und Angststörungen) sind Resultat einer prämorbide bestehenden Affektregulationsstörung in Kombination mit aufgrund von Toleranzentwicklung der Affektsysteme schrittweise entstehenden Unfähigkeit, aus niedrigen positiven und hohen negativen Affekten herauszukommen. Persönlichkeitsstörungen werden in der PSI-Theorie mit jeweils typischen Affektkonfigurationen in Verbindung gebracht; insofern stellen sie einen Risikofaktor für das Entstehen süchtigen Verhaltens dar, als dass betroffene Personen versuchen, zugrunde liegenden chronischen Affektkonfigurationen entgegen zu wirken. Die typischen schwierigen Charakteristika von Suchtklienten (Externalisierung, Probleme der Motivation und weitere) werden nicht als Abwehrmechanismus oder mangelndes Basisverhalten aufgefasst, sondern als Funktionsprofil einer störungsspezifischen Konfiguration der von Kuhl (2001) definierten vier kognitiven Makrosysteme. Dies beinhaltet: Mangelnden Zugriff auf implizite Inhalte (Bedürfnisse, Motive, Präferenzen) Erhöhtes Bewußtsein für Diskrepanzen Übermäßige Bildung von expliziten Absichten Hemmung der Umsetzung expliziter Absichten 12 2.: Grundzüge der PSI PSISI-Theorie 2.1.: Funktionsanalyse: Die Konfiguration psychischer Systeme Kuhl (2001) definiert im Rahmen der PSI-Theorie vier kognitive Makrosysteme, die in sich jeweils eine Reihe spezifischer psychischer Funktionen vereinen. Diese weiter unten beschriebenen 4 Makrosysteme konfigurieren sich in Abhängigkeit von Affekten im Idealfall jeweils aufgabenadäquat, wobei interindividuelle Unterschiede in der Affektdisposition („bevorzugte Affektlagen“) und der daraus resultierenden Systemkonfiguration („bevorzugte Systemkonfigurationen“) für die jeweilige Person typische dominierende Funktionsprofile der Selbstregulation, Externalität, Intentionsbildung und Handlungsumsetzung bedingen. Der Schwerpunkt der PSI-Theorie liegt somit auf der variablen Konfiguration von Persönlichkeits-Subsystemen. Kuhl bezeichnet diese Betrachtungsweise als funktionsanalytisch: Während in der klinischen Psychologie in der Regel Inhalte im Vordergrund stehen (Personen handeln in bestimmter Weise, weil sie erworbenen Überzeugungen, Schemata oder Verhaltensprogrammen folgen), konzentriert sich die PSI-Theorie auf die Frage, dass diese Inhalte und Funktionsprofile variabel verfügbar sind und nur unter Bedingungen der „Bahnung“ des jeweiligen Makrosystems Einfluss auf das Verhalten der Person nehmen können. Die Inhalte sind natürlich nicht unwichtig; das Ausmaß, in dem sie im System überhaupt repräsentierbar und verhaltensrelevant werden können, ist jedoch nicht immer gleich und hängt sowohl von situativ bedingten als auch von aktuellen und überdauernden Affekten ab, also letztlich davon, dass die Person die jeweils für die Aufgabe adäquaten psychischen Systeme „ans Laufen bringt.“ Im klinischen Zusammenhang sehen wir z. B. häufig, daß Personen recht unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen, zentrale Bedürfnisse und Motive zu repräsentieren und ihr Handeln an diesen auszurichten. Besonders schwierig scheint dies für Klienten mit substanzbezogenen, psychosomatischen und Persönlichkeitsstörungen zu sein. Diese drei Klientengruppen gelten dementsprechend als schwierig, d. h. entweder als wenig kooperativ, hochgradig externalisierend oder als eingeschränkt fähig, innere Zustände (v. a. emotionale Informationen) zu „lesen“. Die PSI-Theorie postuliert, dass dieser Zugriff und die damit verbundene Möglichkeit, Motive und Bedürfnisse zu repräsentieren, in Zuständen mit starkem negativen Affekt (erhöhter Ängstlichkeit) außerordentlich erschwert ist, während er in Zuständen niedriger Ängstlichkeit erleichtert ist. Ängstliche Zustände sind gleichzeitig mit einem erhöhten Bewußtsein für Diskrepanzen und mit erhöhter Externalität verbunden. Ängstliche Personen zeigen eine habituell erhöhte Aufmerksamkeit für potentiell angstauslösende Faktoren in ihrer Umwelt, z. B. phobische Objekte, Situationen, die risikobehaftet sind oder Personen, die sie für gefährlich und bedrohlich halten; Die Personen befinden sich in einem „externalen Modus“, sie „scannen“ ihre Umwelt permanent im Hinblick auf Diskrepanzen hin ab, sie befinden sich im Zustand erhöhter Alarmbereitschaft. Positive affektive Zustände begünstigen hingegen das Handeln: Unter dieser Affektbedingung fällt es Personen leicht, Absichten in die Tat umzusetzen. Personen mit übermäßigen positiven Affekt sind solche, die spontan (evtl. übermäßig spontan) handeln, ohne sich die Zeit zu nehmen, ihr Handeln durch die Bildung expliziter Intentionen zu unterfüttern. Dieser zunächst wünschenswerte Zustand der Bahnung der Exekutive kann jedoch auch zum Problem werden, nämlich dann, wenn die Person nicht in der Lage ist, 13 konkrete Ziele zu bilden. Ist die Person im „Handlungsmodus“, fällt es ihr schwer, Absichten zu bilden, weil es hierfür erforderlich ist, die Exekutive durch Hemmung des positiven Affektes so lange zu unterbrechen. Die Bildung expliziter Intentionen wird somit durch einen Zustand niedrigen positiven Affektes begünstigt. Dies beinhaltet eine Hemmung der Exekutive zugunsten des logischen, planenden Denkens. Personen können jedoch dazu neigen, sich übermäßig mit der Bildung von Intentionen zu beschäftigen und Schwierigkeiten beim Wechsel in die Exekutive zu haben. Sie neigen zu „chronischer Absichtsbildung“ bzw. im Extremfall zum „prospektiven Grübeln“. Sie beschäftigen sich mit Plänen, haben Schwierigkeiten, sich bei konkurrierenden Handlungszielen zu entscheiden und initiieren die zur Zielerreichung nötigen Handlungen nicht. Es ist wichtig, sich in diesem Zusammenhang über das Verhältnis externaler Belohnungen oder Bestrafungen und internal generierter Affekte klar zu werden. Die Theorien des operanten Lernens beschreiben Verhalten als Funktion seiner Konsequenzen. Positive Konsequenzen werden als formal als C+, negative als C- dargestellt. In der PSITheorie wird die internale Seite des Vorganges in das Zentrum der Betrachtung gestellt. Das Verhalten der Person wird als Funktion internal generierter Affekte (A+ und A-) aufgefasst. Affekte können sowohl durch äußere Stimulierung als auch durch internale Prozesse (Selbststeuerung) reguliert werden. 2.2.: Definition und funktionale Charakteristik der kognitiven Makrosyst Makrosystekrosysteme Die Beispiele des vorangegangenen Abschnittes mögen illustrieren, was in der PSITheorie mit der Vorstellung der Bahnung psychischer Makrosysteme und mit Funktionsanalyse gemeint ist. Zusammengefasst lassen sich aus den oben geschilderten Beispielen vier Funktionen bzw. Makrosysteme ableiten: 1. Eine Funktion des Zugangs zu eigenen impliziten Bedürfnissen, Motiven und persönlichen Bedeutungen (Extensionsgedächtnis, im weiteren EG); 2. Eine Funktion zur Erkennung diskrepanter Objekte oder Zustände (Objekterkennungssystem, im weiteren OES); 3. Eine Funktion zur Bildung expliziter Handlungsabsichten bzw. zur Aufrechterhaltung unerledigter Absichten (Intentionsgedächtnis, im weiteren IG); 4. Eine Funktion zur Umsetzung von Absichten in Handlungen (Intuitive Verhaltenssteuerung, Exeku14 tive, im weiteren IVS). Die erste und dritte Funktion (Extensions- bzw. Intentionsgedächtnis) stellen die beiden Hauptsysteme der willentlichen Handlungssteuerung dar. Die PSI-Theorie postuliert, dass diese vier kognitiven Makrosysteme paarweise miteinander verbunden sind und durch positiven und negativen Affekt gebahnt werden (Abb. 3). Übertragen in die Terminologie der PSI-Theorie stellt die Schaffung von Zugang zum Extensionsgedächtnis eine wesentliche Zielgröße der KOP dar. Wir gehen davon aus, dass die Klärung impliziter Motive (Zugang zum Motivsystem) eine Voraussetzung zur Umsetzung bedürfniskongruenter Absichtsbildung darstellt. Ferner will KOP nicht nur die Inhalte des EG verfügbar machen, sondern auch die funktionellen Besonderheiten des Systems („ganzheitliche, hochinferente Repräsentation“) verfügbar machen. Die im Rahmen der KOP entwickelten therapeutischen Strategien dienen also im Prinzip dem Ziel, Inhalte des Extensionsgedächtnisses für die Person verfügbar zu machen bzw. das System als ganzes "ans Netz zu bringen". 2.2.1.: Extensionsgedächtnis (EG) Das Extensionsgedächtnis ist definiert als ein ausgedehntes (rechtshemisphärisches) semantisches Netzwerk, das der Person implizite und simultan verfügbare Repräsentationen verschiedener möglicher semantischer und emotionaler Bedeutungen sowie Handlungsoptionen zur Verfügung stellt. Begünstigt bzw. gebahnt wird das EG durch niedrigen negativen Affekt, dargestellt durch A(-). Das EG stellt implizite Repräsentationen persönlicher Motive, Bedürfnisse und Präferenzen zur Verfügung (Selbst-Aspekte), die – wenn abrufbar – der Person die Bedürfnisoder Motivkongruenz von Ereignissen, Handlungen etc. anzeigen und dadurch letztlich bedürfniskongruentes Handels ermöglicht. Implizite Repräsentation bedeutet, dass der Inhalt des EG der Person nicht vollständig bewusst sein bzw. in kognitivierter oder expliziter Form vorliegen muss: Er hat eher den Charakter einer gefühlten Bedeutung (etwa im Sinne Gendlins „felt sense“). Motivationspsychologisch ist hier somit von unbewussten Motiven zu sprechen (vgl. Heckhausen, 1989; Kuhl, 2001). Explizite Motive sind eher dem Intentionsgedächtnis (s. u.) zuzuordnen. Dies schließt ein, dass Personen mehr oder weniger große Diskrepanzen zwischen impliziten und expliziten Motiven aufweisen können. Diese Diskrepanzen entsprechen somit auch unterschiedlichen Makrosystemen und deren Repräsentationscharakteristika. Aufgrund des Repräsentationsmodus des EG (Kuhl spricht von einem „Fühlsystem“) spielen Emotionen mehr als Kognitionen eine wichtige Rolle als Indikatoren der Bedürfniskongruenz. Personen, die einen guten Zugang zum EG haben (deren EG durch niedrigen negativen Affekt gebahnt ist), können, ohne bewusst nachdenken zu müssen, Handlungsalternativen aus der persönlichen Erfahrung heraus generieren, spüren, wenn etwas gegen ihre persönlichen Bedürfnisse verstößt etc.. Aufgrund des impliziten Charakters ließe sich das EG auch als eine Art supervisorisches Hintergrundsprogramm verstehen. Inhaltlich muß das EG insbesondere bezüglich der persönlichen Bedürfnisse, Präferenzen und Ausgestaltung der Motive keineswegs homogen i. S. von widerspruchsfrei sein; dies bezeichnet den Umstand, dass Selbstsysteme unterschiedlich fragmentiert oder integriert sein können. Vielmehr ist anzunehmen, dass Personen, die guten Zugang zum Selbstsystem haben, unter bestimmten Bedingungen (gute Fähigkeit zur Regulation negativen Affektes, s. u.) auch negative Erfahrungen in das Extensionsgedächtnis integrieren können und somit in der Lage sind, Bedürfniskonflikte zu spüren. Die Verfügbarkeit impliziter Repräsentationen von Inhalten des EG (insbesondere des Selbstsystems) ist jedenfalls – so ein zentrales Postulat der PSI-Theorie – eine Voraussetzung für deren Umsetzung und somit für psychische Gesundheit; die Person ist selbstregulativ. Verhalten, das durch das Selbstsystem bzw. das EG „angeleitet“ wird, unterstützt z. B. die Selbstbehauptung auch in schwierigen Situationen, wird selbst wiederum durch die Person 15 emotional gestützt (ist „selbstmotiviert“) und ist durch kreatives und flexibles Problemlösen gekennzeichnet (Kaschel & Kuhl, 2004). Insbesondere in Situationen, in denen ein schneller, ganzheitlich gefühlter Überblick benötigt wird, um selbstkongruente Entscheidungen zu treffen oder in sozialen Situationen simultan eine hochintegrierte Repräsentation eigener Bedürfnisse zu sichern, ist ein ganzheitliches, paralleles und implizites Repräsentationssystem einem langsamen, logischen und seriellen überlegen (Kaschel & Kuhl, 2004). Ähnlich wird in der KOP (Sachse, 2003) davon ausgegangen, dass der mangelnde Zugang zum Motivsystem und die mangelnde Repräsentation von Bedürfnissen ein wesentlicher Faktor der Entstehung von Störungen darstellt: Dies gilt insgesamt störungsunabhängig. Auch Grawe (2004) geht davon aus, dass die Erweiterung störungsspezifischer Ansätze in Richtung auf die Umsetzung persönlicher Bedürfnisse eine wesentliche Verbesserung der Effektstärken bewirkt (z. B. bei Depression). Bei bestimmten Störungen scheint mangelnder Zugang zum Bedürfnissystem sogar eine zentrale Rolle zu spielen und den Kern der Störungstheorie zu bilden. Insbesondere Klienten mit psychosomatischen Störungen tendieren stark dazu, Bedürfnisse und deren Verletzung auszublenden und sich an Normen und externalen Standards zu orientieren (vgl. Sachse, 1995 und in diesem Band). Personen mit Persönlichkeitsstörungen (Sachse, 2001) repräsentieren v. a. zentrale Beziehungsmotive (einschließlich deren Verletzung) nicht. Die von Sachse in diesem Zusammenhang angenommenen authentischen Beziehungsmotive lassen sich ebenfalls als Teil des EG auffassen. Hier wird davon ausgegangen, dass Personen wesentliche Teile ihres Bedürfnissystems nicht repräsentieren und nicht über „authentisches Handeln“ umsetzen: Personen mit Persönlichkeitsstörungen setzen beispielsweise ihre Beziehungsmotive nicht über das EG (ganzheitlicher „gefühlter“ Überblick, Bedürfniskongruenz), sondern über eines der anderen Makrosysteme (bewusst planend=IG, ängstlich meidend=OE oder spontan anreizabhängig=IV) um. Anzunehmen wäre dementsprechend z. B., dass die Umsetzung von Beziehungsmotiven über das EG negativ mit Persönlichkeitsstörungen korreliert, d. h. wesentliche Systemvoraussetzung für eine authentische Bedürfnisregulation ist, so dass manipulative „Ersatzstrategien“ weitestgehend entfallen können. Obwohl Selbstregulation als grundsätzlich notwendig angesehen wird, gibt es auch klinische Fälle einer dysfunktionalen Selbstregulation: Personen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung sind in höchstem Maße ausschließlich ihrem eigenen Bedürfnissystem verpflichtet. Sie haben niedrige negative Affekte (d. h. eine Unfähigkeit zur Angst); diese pathologische Angstfreiheit führt dazu, dass antisoziale Personen (subjektiv) keine negativen Erfahrungen machen, selbst in für andere Personen gefährlichen Situationen. Personen, die keine negativen Erfahrungen machen, integrieren sie entsprechend auch nicht in ihr Selbstsystem, d. h., daß antisoziale Personen relativ "einfach gestrickte" Selbstsysteme aufweisen. Sie handeln z. B. in Beziehungen egoistisch, weil es für sie keine Gründe gibt, die Perspektive anderer Personen einzunehmen. Es ist nicht wichtig, wie z. B. die Partnerin sich fühlt, weil das für das eigene Befinden nicht wesentlich ist. Verläßt die Partnerin die Person, leidet sie nicht, sie sucht sich eine neue Partnerin. Somit muß die Person keine Erfahrung des Verlassenwerdens verarbeiten, sie muß sich auch nicht ändern etc.. 2.2.2.: Objekterkennungssystem (OES) Das Objekterkennungssystem ist ein System, das auf die Erkennung von Diskrepanzen spezialisiert ist, d. h. z. B.: das Auftreten unerwarteter oder bedrohlicher Objekte in der Umwelt oder auch von Diskrepanzen zwischen intendierten und tatsächlich erreichten Handlungsergebnissen. Gebahnt wird das OES durch hohen negativen Affekt, bezeichnet als A-. 16 In gewissem Sinne ist die Aktivierung des OES mit einem Zustand der Externalität verbunden, wenn man annimmt, dass auch internale Zustände wie externale Zustände behandelt werden können (s. o.). Personen, die z. B. auf diskrepante Wahrnehmungen somatischer Zustände fixiert sind (somatoforme Störungen), befinden sich im Zustand der Aktivierung der Objekterkennung gegenüber introzeptiven Stimuli. Neben der Wahrnehmungskomponente beinhaltet die Bahnung der Objekterkennung auch einen spezifischen Handlungsmodus, nämlich eine Anreizorientierung i. S. der Vermeidung unangenehmer Anreize. Personen mit hoher OES-Aktivierung sind bestrafungssensibel, sie meiden Situationen mit negativen Affekten oder handeln, um unangenehme Affekte zu meiden. Personen mit hoher OES-Aktivierung nehmen Diskrepanzen in ihrer Umwelt mit erhöhter Sensibilität wahr. Sie sind Spezialisten für Unstimmigkeiten. Klinisch tendieren sie häufig zu einer Art Opfermentalität oder zu Unterwerfungsgesten: Da sie Diskrepanzen verstärkt wahrnehmen, neigen sie dazu, sich als bloß reagierend zu definieren. Ihre Handlungen sind zumeist nicht durch internale sondern durch externale Standards bestimmt. Dies kann sowohl affirmativ als auch negativistisch ausgeformt sein. Affirmative Externalität richtet sich an Standards anderer Personen (abhängiger Persönlichkeitsstil) oder an überpersönlichen Normen aus (zwanghafter Persönlichkeitsstil). Diese Standards werden nicht auf Passung zu persönlichen Normen und Standards überprüft. Negativistische Externalität erlebt sich als Opfer (unberechtigter) Anforderungen anderer Personen, das eigene Verhalten ist durch einen ständigen Abwehrkampf gegen diese Anforderungen gekennzeichnet (z. B. bei paranoidem und negativistischem Persönlichkeitsstil). Der Chef, Partner, Freunde, alle werden permanent auf Unstimmigkeiten „abgescannt“, die kleinste Inkonsistenz drängt sich in den Vordergrund und nimmt die Aufmerksamkeit der Person ein. Personen mit chronischer Bahnung des OE-Systems neigen zu mißerfolgsbezogenem Grübeln, d. h. dass z. B. Fehlschläge nicht ausgeblendet werden können: Die Person führt einen Dialog, den sie „verloren“ hat, innerlich über Tage weiter, kann sich von der Idee eigenen Versagens nicht lösen; die Person verliert ihren Schlüssel und ärgert sich tagelang darüber, sie kann sich anderen Aufgaben nicht effektiv zuwenden. Klinisch gesehen begegnen uns chronische Bahnungen des OES in einer Reihe von Achse-I und Achse-II Störungen. Alle Störungen, die mit erhöhter Ängstlichkeit verbunden sind, beinhalten OES-Bahnung. Personen mit spezifischen Phobien zeigen eine erhöhte Aufmerksamkeitsausrichtung auf das Auftauchen des phobischen Objektes im Wahrnehmungsfeld. Soziale Phobie ist mit erhöhter Sensibilität für Signale von Ablehnung durch Interaktionspartner verbunden. Eine Reihe von Persönlichkeitsstörungen zeigen erhöhte chronische Bahnung des OES, so z. B. die abhängige, selbstunsichere, zwanghafte, paranoide, und die negativistische PS. Die histrionische PS kann zumindest in Phasen erhöhten negativen Affektes (z. B. durch Krisen in der Beziehung) auch erhebliche Schwierigkeiten in der Herabregulation negativen Affektes haben, obwohl sie in der "Baseline" eine mittlere Aktivität des negativen Affektes aufweist. Histrionische Personen würden demzufolge eine Starke OES-Aktivierung v. a. in Krisen zeigen, die dann nicht durch intrapsychische Regulation aufhebbar wäre. Die OES-Aktivierung würde in diesem Falle auf der sog. Zweitreaktion (Regulationsfähigkeit) beruhen, die von der Erstreaktion (Basisaktivierung der Affekte) abzugrenzen wäre. 2.2.3:. Intentionsgedächtnis (IG) Das Intentionsgedächtnis wird als ein System definiert, das bewußte und explizite Absichten bildet. Sein Funktionsmodus ist der des bewussten Denkens und Planens. Gebahnt wird das IG durch niedrigen positiven Affekt, dargestellt durch A(+). 17 Angenommen wird, dass das IG wesentlich ein linksfrontales System ist; unter anderem wird die Funktion des Arbeitsgedächtnisses dem IG zugeordnet. Das IG bildet spezifische Absichten und Ziele, es hält diese Ziele auf einem bewussten und analytischen Level aufrecht, bis die Umsetzung erfolgt. Ziele können dabei triviale Alltagshandlungen (vgl. die handlungstheoretische Analyse des Spaghettikochens bei Stadler & Seeger, 1981) oder auch komplexe, explizite interaktionelle Ziele sein (z. B. i. S. der Plananalyse, Caspar, 1995). Absichten, die im IG gebildet werden, müssen nicht zwingend kongruent zu Bedürfnissen oder Motiven sein, die das EG zur Verfügung stellt. Absichten und Motive, wie sie im IG repräsentiert werden, sind expliziter Natur, d. h. es handelt sich hier um bewusste oder zumindest auf Befragen explizierbare Absichten. Dies schließt ein, dass eine Diskrepanz zwischen impliziten und expliziten Zielen oder Motiven bestehen kann. Starke Diskrepanzen tragen dabei zur Entstehung psychischer Störungen bei (vgl. z. B. Michalak, Püschel, Joormann & Schulte, im Druck). Die PSI-Theorie nimmt zwei Mechanismen an, die zu einer "Inkongruenz" zwischen IG und EG führen können: a) chronisch erhöhter negativer Affekt, der zu einer mangelnden Bahnung des EG führt; b) chronisch niedriger positiver Affekt, der zu einer übermäßigen Bahnung des IG führt, wodurch das EG gehemmt wird. Während Selbstregulation (Bedürfnisumsetzung aus dem EG) die Umsetzung persönlicher Präferenzen stärkt, wehrt Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin (Bedürfnisumsetzung aus dem IG) Störungen durch Hemmung personaler Subsysteme (Beckmann, in diesem Band) ab, z. B. durch die Unterdrückung emotionaler Präferenzen, die eine Umsetzung expliziter Ziele behindern könnten. Das IG und Selbstkontrolle sind dementsprechend gefragt, wenn schwierige Situationen auftreten, bewusste Ziele und bewusste Umsetzungspläne und Handlungsschritte generiert werden müssen, eine Reduktion von Information (auf das Wesentliche) erforderlich ist, und die Person für eine bestimmte Zeit gezwungen ist, sich mit unangenehmen Aufgaben zu befassen. Nutzt die Person hauptsächlich das IG zur Umsetzung von Bedürfnissen, kann es zu einer chronischen Hemmung des EG kommen, was zu einer Abkopplung des intentionalen Handelns vom Bedürfnissystem führen muss. Dies würde dann (insbesondere, wenn die Person aus anderen Gründen, wie z. B. Problemen in der Regulation negativen Affekts, einen reduzierten Zugang zum EG hat) zu einer chronisch fehlenden Umsetzung persönlicher Bedürfnisse führen. Der von Rogers betonte Begriff der Inkongruenz, der in seiner Theorie eine eher metaphorisch und wissenschaftlich wenig fassbare Definition erfährt, ließe sich somit im Rahmen der PSI-Theorie sehr spezifisch der Diskrepanz zwischen IG und EG, deren jeweiligen Funktionscharakteristika und deren Interaktion zuordnen. Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung halten sich z. B. häufig für stark leistungsmotiviert (explizite Ziele); implizit folgen sie jedoch häufiger einem starken Motiv nach Anerkennung oder Autonomie (Bindungs- oder Machtmotiv). Wir vermuten, dass z. B. narzißtische Personen einem Phänomen unterliegen, das wir vorläufig als Motivkonfundierung bezeichnen: Sie realisieren ihr Anschlussmotiv über Leistung („Ich bin gut, deshalb mögen mich die anderen.“) und/oder über das Machtmotiv (wie in dem Caligula zugeschriebenen Satz: "Mögen sie mich hassen, wenn sie nur Angst vor mir Im klinischen Kontext zeigt sich eine starke Betonung des Intentionsgedächtnisses v. a. haben.“). bei depressiven und zwanghaften Klienten. Diese Klienten zeigen entsprechend einen niedrigen oder gehemmten positiven Affekt. Depressive Klienten tendieren stark zu „chronischer Absichtsbildung“ ("prospektives" Grübeln über Ziele, die Zukunft, etc.). Die Exekutive ist chronisch gehemmt, d. h. dass die Klienten nicht in der Lage sind, die Umsetzung der Absichten zu energetisieren und sich somit in einer „Endlosschleife“ der Intentionsbildung befinden (prospektive Lageorientierung). Kuhl (2001) spricht in diesem Zusammenhang von Willenshemmung bzw. manifester Alienation: Personen können die 18 Umsetzung der Absichten nicht durch positiven Affekt energetisieren, die Exekutive (IVS, s. u.) ist blockiert. Dies hemmt gleichzeitig die Repräsentation von Inhalten des EG, so dass das Grübeln als ergebnislos empfunden wird, da es zu keinen zufriedenstellenden Resultaten im Sinne von Bedürfnisrepräsentation und -befriedigung führt. Anzunehmen ist, dass eine kurzfristige Hemmung des EG durchaus sinnvoll ist, da sie der Person ein Erfüllen von Aufgaben ermöglicht, die nicht „persönlich gewollt“ sind (Pflichten erfüllen). Eine chronische Hemmung des EG durch hohen negativen oder niedrigen positiven Affekt führt darüber hinaus zur Gefahr der latenten Alienation: Dieses Phänomen bezeichnet die Beeinträchtigung der Bildung und Aktivierung valider kognitiver Repräsentationen von Gefühlen und emotionalen Präferenzen (mangelnde Nutzung des EG). Bei Nichtverfügbarkeit des Bedürfnissystems tendiert die Person ferner dazu, fremde Intentionen in das IG zu übernehmen, ohne zu bemerken, dass es sich um fremde Intentionen handelt. Zu spüren, dass es sich um fremde Intentionen handelt, wäre schließlich nur möglich, wenn das EG verfügbar wäre und Inkongruenz zu Bedürfnissen anzeigen würde. Im Ergebnis wird das IG „infiltriert“, die Person verwechselt fremde Bedürfnisse mit eigenen. Häufig finden sich Alienationseffekte dieser Art bei Klienten mit psychosomatischen Störungen (vgl. Sachse, 1995; Beckmann, in diesem Band), sind jedoch auch bei anderen Störungen häufig (Kuhl & Kaschel, 2004). 2.2.4.: Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS) Intuitive Verhaltenssteuerung kann als Exekutiv-System angesehen werden, das intuitive Verhaltensroutinen für die Umsetzung von expliziten Absichten zur Verfügung stellt. Die IVS wird gebahnt durch hohen positiven Affekt, dargestellt als A+. Angenommen wird, dass die IVS über eine Vielzahl erlernter und auch angeborener automatisierter Routinen verfügt, z. B. solche für soziale Interaktion, emotionalen Ausdruck, Elternverhalten bis hin zu komplexen motorischen Programmen wie das „rechts abbiegen“ eines Autofahrers (vgl. Kuhl, 2001). Insbesondere die Umsetzung komplexer Handlungen (wie des Autofahrens) erfolgt im Normalfall in hohem Maße automatisiert (d. h. intuitiv), da eine bewusste Übersetzung einzelner Aspekte einer beabsichtigten Handlung zu viel Zeit beanspruchen würde. Die IVS ist mit einem Wahrnehmungssystem verbunden, das im Gegensatz zum OES nicht einzelne Objekte aus dem Kontext herauslöst, sondern es verwendet Sinnesdaten simultan zur Steuerung der intuitiven Verhaltensprogramme. Wenn unerwartete Ereignisse auftreten oder die Handlungsroutinen nicht zum gewünschten Ergebnis führen, wird normalerweise das OES aktiviert, da eine diskrepanzsensitive Verarbeitung erforderlich ist. Intuitive Verhaltenssteuerung wird durch positiven Affekt gebahnt, der entweder situativ (Anreize, Belohnungen) oder internal generiert wird. Absichten, die im IG unter Bedingung des niedrigen (gehemmten) positiven Affektes gebildet werden, benötigen demzufolge eine Energetisierung (einen „switch“) in Richtung der Exekutive. Kuhl spricht in diesem Zusammenhang von Willensbahnung. Personen, die chronisch erhöhten positiven Affekt aufweisen, sind (prospektiv) handlungsorientiert. Handlungsorientierung muss nicht immer von Vorteil sein, z. B. wenn die Person die Exekutive weiter ausführt, obwohl es angebracht wäre, bewusst und planend vorzugehen. Chronische Aktivierung der IVS ist besonders dann von Nachteil, wenn es um die Umsetzung schwieriger Absichten geht, bei der Routinen nicht ausreichen, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Personen mit chronisch aktivierter IVS neigen demzufolge zu einer unter schwierigen Bedingungen dysfunktionalen Spontaneität und Oberflächlichkeit. Je nach Motivbereich kann dies unterschiedlich dysfunktional sein: Oben wurde bereits das Beispiel histrionischer Personen genannt, die insbesondere im Beziehungsbereich zum Einsatz von IVS-Routinen neigen. Dies macht sie charmant und attraktiv, solange die Beziehungen nicht schwierig werden und andere Arten der Regu19 lation erfordern. In Beziehungskrisen sind sie dann häufig überfordert und ignorieren oder beschönigen negative Aspekte. Im Leistungsbereich sind Personen mit hoher IVSAktivität oft oberflächlich und lösen Aufgaben solange gut, wie keine besonderen Schwierigkeiten auftauchen. Personen mit der Tendenz zur übermäßigen Bahnung der IVS fühlen sich oft wohl, solange ihre Lebensumstände ihnen ein Ausweichen vor Schwierigkeiten erlauben. Ist dies jedoch nicht möglich oder häufen sich Schwierigkeiten aufgrund der Meidungsstrategien der Person an, sind die Betroffenen häufig überlastet, erschöpft, verlieren den Überblick. 2.3.: Affekte In Übereinstimmung mit aktuellen Befunden der Neurowissenschaften unterscheidet die PSI-Theorie zwei getrennte, neurophysiologisch separierbare Affekt-Systeme: Das Belohnungssystem (Nucleus Accumbens, ventrales Tegmentum, mediales Vorderhirnbündel; vgl. u. a. Olds & Milner, 1954) und das Bestrafungssystem (das Septo-Hippocampale System, vgl. Gray & McNaughton, 2003). Die Darstellung in der formalen Sprache der PSI-Theorie bezeichnet positiven Affekt mit A+, gedämpften positiven Affekt mit A(+), negativen Affekt mit A- und gedämpften negativen Affekt mit A(-). Hervorzuheben ist, dass demzufolge Zustände von gleichzeitig hohem positiven Affekt und hohem negativen Affekt möglich werden. Positiver und negativer Affekt sind somit nicht zwei antagonistische Pole einer Dimension; vielmehr stellen sie zwei im Prinzip unabhängige Affektachsen dar. Abzugrenzen sind Affekte ferner vom Begriff der Emotion. Emotionen (vgl. LeDoux, 1996) sind hochkomplexe Zustände, die neben Affekten noch semantische, episodische und biographische Gedächtnisbestände umfassen. Affekte im Sinne der PSI-Theorie sind definiert als die jeweilige Aktivität des Belohnungs- und Bestrafungssystems. Es bereitet gewisse Schwierigkeiten, Affekte mit Begriffen zu beschreiben, die Emotionen beinhalten. Am ehesten ließe sich hoher negativer Affekt als Ängstlichkeit im Sinne einer erhöhten Vigilanz bis hin zur Lähmung angesichts der Gefahr (vgl. Gray & McNaughton, 2003) beschreiben. Gedämpfter positiver Affekt ließe sich als Zustand der Kontemplation bis hin zur Unlust, Langeweile und Depressivität begreifen. In der Beschreibung der Makrosysteme (Abb. 3) wurde bereits deutlich, dass die Affekte für die dynamischen Komponenten des Modells verantwortlich zeichnen. OES und EG auf der einen, IVS und IG auf der anderen Seite des Modells sind antagonistisch verschaltet, wobei negativer Affekt den OES/EG-Zusammenhang und positiver Affekt den IVS/IG-Zusammenhang moduliert. Die Höhe des negativen Affektes bestimmt, in welchem Ausmaß das EG und/oder das OES Einfluss auf das Verhalten des Systems, seine Wahrnehmung, das Ausmaß seiner Bedürfnisrepräsentation etc. nimmt. Entsprechendes gilt für den Zusammenhang IVS/IG. • • • • A-: Hoher negativer Affekt bahnt das OES. Dominierende Diskrepanzsensibilität, Hemmung des EG: kein Zugang zum Selbstsystem, zur ganzheitlichen Repräsentation A(-): Niedriger negativer Affekt bahnt das EG. Dominierende ganzheitlichholistische Bedürfnisrepräsentation, Hemmung der diskrepanzsensitiven Wahrnehmung A+: Hoher positiver Affekt bahnt die IVS. Dominanz der Exekutive, Hemmung des IG A(+): Niedriger positiver Affekt bahnt das IG. Dominierende Bildung expliziter Intentionen/Absichten, Hemmung der Exekutive 20 Die Konfiguration und somit die Bahnung der jeweiligen Makrosysteme ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen ist festzuhalten, dass sich Personen aufgrund biologischer und erlernter Faktoren in der „Grundkonfiguration“ von Affekten unterscheiden, sie haben „im Ruhezustand“ unterschiedliche „bevorzugte Affektkonfigurationen“. Diese Grundkonfigurationen in der Kombination positiven und negativen Affektes werden als "Erstreaktion" bezeichnet beschreiben somit eine personentypischen Grundbahnung der Makrosyteme. Kuhl (2001) definiert hiermit die funktionsanalytischen Grundkonfigurationen der Persönlichkeitstypen, wie wir sie im Extremfall als Persönlichkeitsstörungen in extremer Vereinseitigung kennen. So wäre etwa die abhängige PS durch eine Kombination von niedrigem positiven Affekt und hohem negativen Affekt gekennzeichnet (Abb. 4). Entsprechend ist eine hohe Aktivierung des OES mit hoher Aktivierung des IG das dominierende Funktionsprofil. Abhängige Personen spüren demzufolge Diskrepanzen (besonders bei anderen Personen) stark, tendieren zu Externalität bei gleichzeitig mangelnder Verfügbarkeit eigener Motive und Bedürfnisse. Sie sind bestrafungssensibel und suchen die Nähe und Führung durch andere Personen. Gleichzeitig neigen sie zu chronischer Absichtsbildung ohne Tendenz zur eigenen Umsetzung: Es geling ihnen nicht, „aus eigener Kraft“ ins Handeln (IVS) zu kommen, sie benötigen die Ermutigung durch andere Personen. Sind sie 21 auf sich alleine gestellt, handeln sie eher nicht. Antisoziale Personen zeigen hingegen eine durch A(-) bewirkte extreme Aktivierung des EG bei gleichzeitiger Hemmung des OES (Abb. 5). Sie sind hochgradig durch eigene Bedürfnisse gesteuert, negative Affekte kommen so gut wie nicht vor, entsprechend machen sie keine negativen Erfahrungen, werden in ihren Handlungen auch nicht durch Ängste, Skrupel und Normen „gestört“. Sie haben keine Schwierigkeiten, in die Exekutive zu gelangen, handeln planmäßig, jedoch ohne zu zögern. Weitere Beispiele finden sich aus Platzgründen bei Kuhl (2001). Angenommen wird, dass sowohl genetische als auch erlernte Faktoren zu der Ausbildung der bevorzugten Affektkonfigurationen beitragen. Insbesondere Bindungsaspekte scheinen die Affektregulationsfähigkeit zu beeinflussen ("Systemkonditionierung", Kuhl & Völker, 1998). Angenommen wird, dass Affektregulation durch eine Internalisierung externer Regulation durch primäre Bezugspersonen erworben wird. 3.: Anwendung der PSIPSI-Theorie auf Alkoholismus Wesentlich für eine Störungstheorie der Sucht ist der Umstand, dass beide Affektsysteme physiologisch auf Alkohol reagieren. Aktuelle neurobiologische Theorien der Sucht schreiben die euphorisierende Wirkung von psychotropen Substanzen und das Phänomen des "Belohnungs"-Cravings dem Belohnungssystem zu; die angstlösende Wirkung und ein "Entspannungs"-Craving kann dem Bestrafungssystem zugeschrieben werden (Verheul, van den Brink & Geerlings, 1999; Volkow & Fowler, 2000; Volkow, Fowler & Wang, 2003). Alkohol und nahezu alle anderen Drogen aktivieren das Belohungssystem physiologisch, d. h. A(+) wird zu A+. Alkohol ist gleichzeitig über eine Aufhebung der Hemmung im Angstsystem (Behavioral Inhibition System, Gray & McNaughton, 2003) anxiolytisch wirksam, reduziert somit A- zu A(-). Personen regulieren im Normalfall (d. h. wenn keine Defizite der Affektregulation vorliegen) sowohl ihren positiven als auch ihren negativen Affekt situations- und aufgabenadäquat in Richtung auf die optimale Konfiguration der Makrosysteme ein. Nicht alle Personen beherrschen jedoch diese Affektregulation gleichermaßen. Unsere Hauptthese ist, daß alkoholabhängige Personen v. a. deswegen Trinken, weil sie Schwierigkeiten in der intrapsychischen aufgabenadäquaten Regulation der Affekte haben und weil Alkohol in der Lage ist, sowohl negativen als auch positiven Affekt in der gewünschten Richtung zu regulieren. Im folgenden wollen wir dies für beide Affekte getrennt und die ihnen jeweils zugeordneten Makrosysteme systematisch ausführen. 3.1. Negativer Affekt, Extensionsgedächtnis und Objekterkennungssystem 3.1.1. Phase 1: Der Problemeinstieg über negativen Affekt Affekt Ausgangslage für die Entwicklung süchtigen Verhaltens im Bereich negativer Affekte ist u. E. der Umstand, dass die Person einen über längere Zeit erhöhten negativen Affekt erlebt, weil sie • • • eine Disposition zu negativem Affekt aufweist (Erstreaktion), längere Zeit Situationen ausgesetzt ist, die erhöhten negativen Affekt produzieren, und/oder diesen nicht intrapsychisch, d. h. durch eigene Regulation reduzieren kann (Zweitreaktion). 22 Erstreaktionen beschreiben überdauernde, zeitlich relativ stabile Affektdispositionen, die mit Persönlichkeitsstilen und –störungen (kognitive bzw. kognitiv-emotionale Beziehungs- und Selbstschemata) verbunden sind. Ferner sind auch zeitlich relativ stabile Motive (Anschluß, Leistung und Macht in verschiedenen Varianten, z. B. ein starkes MachtMeidungsmotiv) zu den Erstreaktionen zu rechnen (vgl. Kuhl & Kaschel, 2004). Zweitreaktionen sind im wesentlichen Fähigkeiten zur Gegenregulation von Dispositionen der oben genannten Art. Personen können bestehende problematische affektive Erstreaktionen durch funktionale Gegenregulationsstrategien ausgleichen, z. B. durch Selbstberuhigung, positive Selbstmotivierung, Planung, Selbstkontrolle etc.. Chronisch erhöhter negativer Affekt findet sich v. a. bei bestimmten Persönlichkeitsstörungen oder den damit verbundenen nichtpathologischen Persönlichkeitsstilen, z. B. der selbstunsicheren PS, der abhängigen PS, der paranoiden PS, der zwanghaften PS und der Borderline PS. Im Rahmen der Theorie der Doppelten Handlungsregulation (Sachse, 2001) wird angenommen, daß diese Persönlichkeitsstörungen auf der Verletzung zentraler authentischer Beziehungsmotive beruhen. Insbesondere Verletzungen der Autonomie durch Machtanwendung scheinen bei Alkoholabhängigen eine große Rolle zu spielen. Die Verletzung zentraler Beziehungsmotive ist jedoch nicht nur eine Traumatisierung auf der Ebene der Motive, sondern nicht zuletzt eine auf der Ebene der Affekte. Häufig ist bei Alkoholabhängigen in der KOP zu beobachten, dass die Aktivierung zentraler Schemata in der Therapie mit einem Gefühl der Lähmung und Ohnmacht einher geht. Viele Klienten haben z. B. Erfahrungen mit Gewalt oder Vernachlässigung. Entsprechend dem Modell der Systemkonditionierung ist davon auszugehen, dass die Klienten aufgrund dieser Traumatisierungen entweder schon früh chronisch erhöhte negative Affekte aufweisen (z. B.: "Ich hatte den ganzen Tag Angst, was passiert, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kommt.") oder durch mangelnde Fremdberuhigung (das Kind wird mit seinen negativen Affekten alleingelassen, "nie auf den Arm genommen", etc.) die Fähigkeit zur Selbstberuhigung früh nicht Häufig finden erlernen. wir z. B. in Familien mit Alkoholismus eine Lerngeschichte von Ohnmachtserfahrungen: Erwachsene Alkoholabhängige berichten oft in der Therapie, wie traumatisierend sie den Alkoholismus ihres Vaters in der Kindheit erlebt haben. Sie können es sich nicht verzeihen und nicht erklären, wie sie selbst trotz dieser Erfahrungen den gleichen Weg beschreiten konnten. Dieser Vorgang geht zumeist weder auf genetische Faktoren noch auf Modell-Lernen zurück. Vielmehr wird „Das Prinzip Ohnmacht“ weitergegeben: Das Kind wird Opfer des trinkenden Vaters, kann nichts dagegen tun und wird emotional vernachlässigt; die Familieninteraktionen werden durch den Einfluss des Alkoholismus des Vaters so verändert, dass das Kind nur eine periphere Rolle spielt. Trotz seines Abscheus gegen Alkoholismus lernt es Ohnmacht, d. h. es kann negativen Affekt nicht reduzieren. Dies geht als Risikofaktor der Affektregulation in die eigene Persönlichkeit ein, was unter gegebenen Umständen zu einem Einstieg in den Alkoholmissbrauch führt. Nicht reduzierbare negative Affekte können auch Ergebnis kritischer Lebensereignisse, chronisch erhöhter Belastungen oder Traumatisierungen i. S. von interpersoneller Gewalt oder Katastrophen sein. So sind Klienten mit PTB entweder starkem oder über längere Zeit bestehendem negativen Affekt ausgesetzt, ohne daß eine Regulationsmöglichkeit besteht. Andere Störungen mit erhöhtem negativen Affekt sind sämtliche Angststörungen und deren Vorläufersymptome in der Lebensgeschichte. Eine "subklinische Ängstlichkeit" oder eine bestehende Affektregulationsstörung ist für die Entwicklung von Substanzstörungen u. E. völlig hinreichend. Die Höhe des negativen Affektes ist dabei vermutlich gar nicht entscheidend, sondern eher die Tatsache, dass die Person den Affekt nicht regulieren kann. Eine "kleine Angst", die nicht reduzierbar ist, dürfte sogar der häufigere Fall 23 für den Problemeinstieg sein. Affektstörungen im Sinne einer „echten“ Komorbidität sind daher nicht unbedingt erforderlich. Affektregulationsstörungen wiederum können über lange Zeit hinweg relativ wenig auffällig sein. Bewegt sich die Person z. B. in einer Lebenssituation, die entweder keine Regulation erfordert oder in der Regulation durch andere Personen „substituiert“ wird (einen Partner, der die Person tröstet, ihr Schwierigkeiten „vom Hals hält“), kann eine latente Regulationsstörung relativ lange ohne negative Konsequenzen sein. Häufig sind Personen, die in der Erstreaktion auf negativen Affekt durchaus problematische Persönlichkeitsstile oder Motivtraumatisierungen zeigen, mit guten Zweitreaktionen ausgestattet: Hat die Person in ihrer (meist frühen) Lebensgeschichte gute Fähigkeiten der Affektregulation erlernt, kann sie möglicherweise problematische Erstreaktionen später durch den Einsatz dieser Strategien abfangen. Häufig sehen wir z. B. Personen mit hoch ausgeprägten Borderline-Stilen im PSSI-Fragebogen (Persönlichkeits-Stil-undStörungsfragebogen, Kuhl & Kazen, 1997), die aufgrund guter Selbstregulation nur niedrige Symptomausprägungen zeigen. Versagen die Zweitreaktionen, so ist die Person einer dauerhaften Erhöhung negativen Affektes ausgesetzt. Dies kann selbst dann der Fall sein, wenn die Erstreaktionen nicht übermäßig pathologisch ausgeprägt sind. Lernt die Person nun, daß Alkohol eine Substanz ist, die negativen Affekt effektiv reduziert, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines Alkoholmißbrauchs in dem Umfang, in dem die Person über keine oder keine vergleichbar effektive Methode der Reduktion negativen Affektes verfügt. Dieser Lerneffekt ist wahrscheinlich sogar unverzichtbar für eine Abhängigkeitsentwicklung, da die Differenz zwischen erhöhtem negativen Affekt und seiner anschließenden Reduktion erfahren werden muß. Im Normalfall (also einer durch intrapsychische Prozesse, und nicht durch Substanzen erzielten Reduktion negativen Affektes) wäre die Person in der Lage, wieder auf ihr EG zuzugreifen. Wir postulieren jedoch, dass im Falle einer substanzinduzierten Affektreduktion (zumindest bei höheren Dosierungen) eben dieser Zugriff auf das EG trotz Affekt- reduktion bleibt: blockiert Die Person hat "keinen Zugang" zum EG (Abb. 6). Dies hat den Grund darin, dass der Konsum von Alkohol zentrale kognitive Prozesse, darunter Gedächtnisprozesse und emotionale Verarbeitung, u. a. durch die erhöhte Ausschüttung von GABA beeinträchtigt; der Rausch führt insgesamt zu einer mangelnden Verarbeitungstiefe, so 24 dass sich eine Beeinträchtigung in der Informationsverarbeitung ergibt. Die Integration negativer Erfahrungen ins EG fällt aufgrund der Alterierung der beteiligten Informationsverarbeitungsprozesse schwer. Dies widerspricht nicht der Beobachtung, dass Personen unter Alkoholeinwirkung „sentimental“ werden. Sie spüren negative Emotionen möglicherweise stärker (über das OES), der Informationsgehalt, die „Intelligenz“ der Emotionen geht jedoch verloren. Bei nicht abhängigen Personen ist der Konsum niedriger Alkoholmengen möglicherweise sogar tatsächlich mit verbessertem Selbstzugang (erhöhtem Bedeutungserleben) verbunden. Dies dürfte jedoch nur dann der Fall sein, wenn die Person nicht konsumiert, um hohe negative Affekte zu regulieren: Hierfür wären höhere Dosierungen erforderlich, als etwa einem Gespräch mit einem guten Freund am Kamin über Fragen des Lebens zuträglich wäre. Alkohol reduziert somit zwar den negativen Affekt, der adaptive psychologische Sinn dieser Reduktion, die Bahnung des EG, ist damit jedoch gescheitert. Die Person bekommt nur „den halben Kuchen“: Der störende Affekt ist weg, sie kann jedoch die Informationen aus dem EG nicht nutzen, um das Problem einer Verarbeitung vor dem Hintergrund persönlicher Bedürfnisse und Präferenzen und damit einer bedürfnisadäquatere Lösung zuzuführen. 3.1.2. Phase 2: Toleranzentwicklung und "Deckeneffekt" Man kann davon ausgehen, daß eine einmalige oder seltene Nutzung der affektreduzierenden Wirkung von Alkohol keine dramatischen Wirkungen für die Person hat. Greift die Person jedoch öfters und schließlich fast ausschließlich auf die Substanz zurück, um negative Affekte zu regulieren, besteht ein Einstieg in psychische Abhängigkeit. Dies dürfte besonders dann der Fall sein, wenn die Person längere Zeit Situationen mit negativem Affekt ausgesetzt ist oder eine hoch generalisierte Regulationsstörung aufweist. Z. B. gibt es Personen, die nur bestimmte, an kritische Schemata gebundene Affekte (z. B. Verlassenwerden) nicht regulieren können; andere können fast jede Art negativen Affektes nicht beantworten. Hinzu kommt bei häufigem durch negativen Affekt motivierten Alkoholkonsum ein Teufelskreis des Kompetenzverlustes und der Problemaufschaukelung. Der Kompetenzverlust betrifft hier die Seite des EG: Die Person greift bei hohem negativen Affekt nicht auf die Inhalte und funktionalen Eigenschaften dieses Systems zurück. Jeder nicht gelungene Zugriff auf das EG führt zu einer nicht gelungenen Problemlösung, zumindest aber zu einer Problemlösung, die persönliche Motive nicht einbezieht. Dies führt auf die Dauer auch zu einem Verlust an Bewältigungskompetenz oder zumindest zu einer Nichtentwicklung adäquater Regulationsmechanismen, da bedürfniskongruente Bewältigung einen ganzheitlichen Überblick voraussetzt. Zeigt die Person diesen Überblick nicht, bleibt sie oft in einfachen Lösungen stecken, sie entwickelt keine „advanced strategies“ der Problembewältigung. Häufig sehen wir in der Therapie, dass die Klienten über mangelnde Kompetenzen bei der Bewältigung von Problemen verfügen; viele zeigen z. B. in Beziehungen Lösungsmuster, die nicht ihrer Altersgruppe entsprechen, sie wirken oft wie festgefroren in den Lösungsparadigmen der Altersgruppe, in der sie sich befanden, als sie den Einstieg in die Sucht begonnen haben. Die Person handelt bei Belastung dann entweder unzureichend, gar nicht oder in einer Weise, die mit der Umsetzung ihrer persönlichen Bedürfnisse nicht kompatibel ist. Sie wiederholt hierbei eine oft schon früher in der Biographie gemachte Erfahrung, nämlich die der Insuffizienz und der mangelnden Selbstwirksamkeit. Entsprechend weisen die Klienten eine hohe Lageorientierung nach Misserfolg auf. Der Umstand, dass die Person negativen Affekt durch die Substanz und nicht durch internale Affektregulation reduziert, führt auch dazu, dass sich suchtbezogene Verhaltensweisen gegenüber anderen, konstruktiveren ausweiten. Die Person lernt dabei, dass 25 Konsum kompetent ist, da die Belastung ja absinkt. Bei häufigem Konsum wird das instrumentelle Verhalten zunehmend anreizunabhängig, d. h. dass die Person auch dann trinkt, wenn sie keine unmittelbare Affektregulation beabsichtigt. Bei häufigem Konsum erlebt die Person im weiteren Verlauf eine schrittweise sich erhöhende Toleranz gegenüber der affektregulatorischen Wirkung der Substanz. Wir gehen also davon aus, daß das System für negativen Affekt selbst einer Toleranz unterliegt. Kann die Substanz den negativen Affekt nicht mehr herunterregulieren, erhöht die Person im nächsten Schritt (und späteren) die Dosierung. Schließlich tritt trotz erhöhten Konsums keine affektregulatorische Wirkung der Substanz mehr ein (Abb. 7). Hiermit ist die Person an einem Punkt angekommen, an dem sie einen "Deckeneffekt" erlebt. Sie kann durch das Trinken von Alkohol keine Reduktion des negativen Affektes mehr erreichen. Sie "hängt im negativen Affekt fest." Dieser Deckeneffekt ist verbunden mit: • • • • erhöhter und chronisch nicht reduzierbarer Ängstlichkeit dauerhafter, "chronischer" Aktivierung des OE-Systems chronischer Abkoppelung des EG vom System zunehmender Anreizunabhängigkeit des Suchtverhaltens, da die Reduktion des negativen Affektes ausbleibt Einige der typischen Probleme von Alkoholabhängigen und von Therapeuten in der Arbeit mit dieser Klientengruppe sind somit zu erklären: Die Affektlage der Klienten ist dauerhaft durch hohen A- gekennzeichnet; dies zeigt sich u. E. in der erhöhten Inzidenz von Angstsymptomen und Angststörungen bei Abhängigen. Die Klienten neigen ferner zu misserfolgsbezogenem Grübeln (Lageorientierung nach Mißerfolg). Scheitert die Person in einem Bereich (selbst in trivialen Alltagsaktivitäten), kann sie sich von Grübeln darüber nicht mehr lösen. Sie verfängt sich in Mikrodetails und 26 kann aufgrund der Nichtreduzierbarkeit des negativen Affektes auch die Funktionen des EG (ganzheitlicher Überblick über bedürfniskongruente Handlungsalternativen) nicht nutzen. Da die Person durch diese Art des Grübelns und die mangelnde Verfügbarkeit von EG-Funktionen keine kompetenten Lösungen initiieren kann, verliert sie bestehende Kompetenzen (durch Misserfolg) und entwickelt keine neuen bzw. entwickelteren Varianten. Die Klienten haben ein chronisch aktiviertes OES, sind hoch sensibel für Diskrepanzen und Unstimmigkeiten (auf der Station, bei Partnern, Freunden, sie finden "das Haar in der Suppe"); sie sind demzufolge external, machen andere Personen für ihr scheitern verantwortlich, und fordern Hilfe und Unterstützung durch andere ein. Erfüllen andere diese Erwartungen nicht, resultieren Enttäuschung bis hin zu dem Gefühl, von anderen einfach fallengelassen oder bewusst geschädigt zu werden. Ein internal ausgerichtete Analyse des Scheiterns erfolgt nicht. Dies alles wird schließlich zum Anlaß für erneutes Trinken. Sobald jedoch die unmittelbare Substanzwirkung aufhört, ist die Person wieder in hohem negativen Affekt gefangen. Viele Klienten suchen sogar erst dann um professionelle Hilfe nach, wenn sie auch unter akuter Alkoholwirkung keine Affektreduktion mehr erleben. Dann wird oft bis zur Bewußtlosigkeit getrunken. Gleichzeitig sind die Schwierigkeiten der Klienten, emotionale "Spuren" aufzunehmen und diese als Zugangsschlüssel für die Repräsentation persönlicher Bedürfnisse und Absichten zu nutzen, durch die mit dem Deckeneffekt verbundenen Blockierung des Extensionsgedächtnisse zu erklären. Diese Abkoppelung von Informationen, die das EG zur Verfügung stellt, hat gravierende Konsequenzen für die Person. Da sie implizite persönliche Motive nicht verfügbar hat, gerät sie in eine Art "Blindflug" bezüglich der Realisierung ihrer Lebensziele und ihrer authentischen Bedürfnisse. Der Begriff der "mangelnden Frustrationstoleranz" ist hier nicht ganz verkehrt, bleibt jedoch in seinem suchttherapeutischen Gebrauch an der Oberfläche stecken, wenn die funktionsanalytischen Implikationen nicht mitbedacht werden. Es ist sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, dass therapeutische "Durchhalteparolen" (die Aufforderung an den Klienten, "dran zu bleiben", Mißerfolge wegzustecken) ebenso wie Aufforderungen aus dem Umfeld, sich "zusammenzureißen", den Klienten nicht weiterhelfen. Zum einen sind Aufforderungen dieser Art eigentlich an das Intentionsgedächtnis gerichtet: Die Fähigkeit, bei der Erreichung eines schwierigen Zieles trotz bestehender Schwierigkeiten "durchzuhalten" (also Frustrationen zu tolerieren), ist jedoch erst dann gegeben, wenn die Intentionen an persönliche Bedürfnisse geknüpft sind, d. h. wenn die Person eine langfristige und persönlich relevante implizite Bedürfnisrepräsentation hat. Sie ist also nicht nur von der Willensbahnung (Übergang vom IG in die Exekutive), sondern auch vom Zugriff auf das EG abhängig. Das Problem steckt daher weniger (zumindest nicht nur) in einem so verstandenen mangelnden Durchhaltevermögen. Im Gegenteil: Alkoholiker tendieren schon ohne diesbezügliche Aufforderungen von Therapeuten dazu, ihr Intentionsgedächtnis zu überlasten (z. B. durch Vorsätze: "Morgen höre ich auf!") und damit die Repräsentation impliziter Aspekte sogar chronisch zu hemmen (s. o.). Das Durchhalten bei persönlich nicht relevanten Zielen ist eher mit dem Erleben von Sinnlosigkeit verbunden. In einigen klassischen suchttherapeutischen Kliniken wird es für wichtig gehalten wird, den Klienten das Durchhalten bei sinnentlehrten Tätigkeiten beizubringen. Z. B. werden den Patienten in der Arbeitstherapie halbfertige Werkstücke weggenommen, damit sie sich an Frustrationen "gewöhnen". Die "mangelnde Frustrationstoleranz" wird, da sie mit einem alltagspsychologischen Willensbegriff unterlegt wird, durch systematische Frustration zu behandeln versucht. Der hiermit von therapeutischer Seite offenbarte alltagspsychologische Willensbegriff ist leider nur weniger naiv, als der der Klienten: Im Grunde ist die Konzeption des "Eisernen Willens" (in der Variante, alle negativen Affekte zu "überrennen") hier wiederzuerkennen. Psychologisch gesehen sind Frustrationen 27 bei der Durchführung einer Tätigkeit jedoch nur dann überwindbar, wenn entweder eine intrinsische Motivation vorliegt, die Tätigkeit zum Erfolg zu bringen (ich bin bereit, eigene Fehler zu akzeptieren und zu korrigieren, weil ich unbedingt ein bestimmtes persönlich relevantes Ziel erreichen möchte), oder wenn die Person bereit ist, eine sinnlose Tätigkeit auszuführen, weil sie persönliche Bedürfnisse für den Augenblick zurückstellen muß. Beides setzt jedoch implizite Bedürfnis-, Motiv- oder Präferenz-Repräsentation voraus, also den Zugang zum EG. Es ist stark zu vermuten, dass Alkoholiker extrem stark auf negativen Affekt reagieren, also eine niedrige Affekttoleranz aufweisen. Dies wird bereits durch die oben geschilderte Regulations-Repräsentations-Problematik nahe gelegt. Personen mit starker Bestrafungssenisbilität sind auch erhöht vulnerabel für Substanzen, die stärker anxiolytisch sind, wie z. B. die Benzodiazepine. Die Frage der Wahl der Substanz hängt - neben der Verfügbarkeit - somit von dem am ehesten betroffenen Affektsystem ab. Jedenfalls existiert eine große Zahl von Personen, die über A- in eine Benzodiazepinabhängigkeit eingestiegen sind. Andere Drogen wie z. B. Kokain werden von ängstlichen Personen hingegen nur selten genutzt, da sie eher das Belohnungssystem aktivieren und Ängstlichkeit sogar eher fördern. Wichtig ist, dass sich der Deckeneffekt nach Absetzen der Substanz in der Regel erhält. Dies liegt daran, dass der negative Affekt schon vorher hoch war und die Kompetenzen zur Regulation durch Trinken verlorengehen oder sich zumindest nicht entwickeln. Somit wird der weiterbestehende Deckeneffekt zu einem Hauptgrund für Rückfälle nach Entgiftungen oder Behandlungen, die diesen Umstand nicht explizit berücksichtigen. 3.2. Positiver Affekt, Intentionsgedächtnis und Intuitive VerhaltenssteueVerhaltenssteuerung 3.2.1. Phase 1: Der Problemeinstieg über positiven Affekt Ausgangslage für die Entwicklung süchtigen Verhaltens im Bereich positiven Affektes ist u. E. der Umstand, dass die Person einen über längere Zeit gehemmten positiven Affekt erlebt, weil sie • • • eine Disposition zu niedrigem positiven Affekt aufweist (Erstreaktion), längere Zeit Situationen ausgesetzt ist, die niedrigen positiven Affekt produzieren, und/oder diesen nicht intrapsychisch, d. h. durch eigene Regulation anheben kann (Zweitreaktion). Chronisch niedriger positiver Affekt findet sich v. a. bei bestimmten Persönlichkeitsstörungen oder den damit verbundenen nichtpathologischen Persönlichkeitsstilen, z. B. der antisozialen PS, der abhängigen PS, der paranoiden PS, der schizoiden PS, der selbstunsicheren PS und der negativistischen PS. Alle diese Störungen und Stile zeichnen sich durch die Schwierigkeit aus, Handlungsabsichten i. S. expliziter Intentionen zu energetisieren, d. h. „in die Tat umzusetzen“, in dem sie durch Anhebung positiven Affektes in die Intuitives Verhaltenssteuerung (IV) gelangen (Willensbahnung). Personen mit Problemen in der Willensbahnung sind demzufolge prospektiv lageorientiert. Die damit verbundene Bahnung des IG bewirkt eine übermäßige Bildung von Intentionen und eine einseitige Betonung des bewußten, planerischen Denkens. 28 Häufig finden sich bei Personen mit Problemen in der Willensbahnung biographische Erfahrungen von mangelnder Ermutigung (das Kind wird nicht gelobt, ignoriert, seine Interessen und Fähigkeiten werden nicht gefördert) oder Ohnmachtserfahrungen im Sinne von Versagen mit anschließender Resignation. In der Beziehungsgestaltung durch die Eltern findet sich dabei häufig der sogenannte „Null-Resonanz-Fall“: Die Bemühungen des Kindes, sich bemerkbar zu machen, seine besonderen Fähigkeiten und Ressourcen werden nicht negativ traumatisiert (Schläge, Gewalt), sondern das Kind wird komplett ignoriert. Oft geht dies mit anderen Beziehungstraumatisierungen einher: Das Kind wird nicht verteidigt, wenn es in der Schule ungerecht behandelt wird, es wird direkt aufgefordert oder durch mangelnde Solidarität genötigt, mit Schwierigkeiten alleine klar zu kommen. Eine spezielle Variante der Autonomierverletzung besteht darin, dem Kind eine gemessen an seinen Fähigkeiten zu hohe Autonomie zu verordnen und das Scheitern daran anschließend seiner Unfähigkeit zuzuschreiben. Beispiele hierfür sind: Das Kind wird im zu jungen Alter mit der Haushaltsführung betraut, es wird bei jeder Gelegenheit an seine Selbständigkeit appelliert, es muß seinen Platz in der Familie "selber verdienen". Handlungshemmungen sind in der Biographie häufig mit Traumatisierungen des Fähigkeitskonzeptes verbunden. Viele Suchtklienten haben ausgeprägte Versagens- bzw. Versagerschemata, die alle Basismotive (Anschluss, Leistung und Macht) betreffen können. Im Anschlussbereich werden Probleme von Kindern häufig nicht auf die Eltern, sondern auf mangelnde eigene Fähigkeiten attribuiert: Das Kind glaubt, dass die Eltern sich nicht um es kümmern, weil es selbst in der Beziehungsgestaltung versagt hat. Besonders „effektiv“ ist dies, wenn der Vorwurf, ein Versager zu sein, mit dem Vorwurf, andere Personen dadurch zu schädigen, verknüpft wird (es reicht nicht, in der Schule zu versagen, die Mutter weint auch deswegen). Im Leistungsbereich wird in ähnlicher Weise ein Versagen auf die eigene Person und nicht auf überzogene Anforderungen oder mangelnde Unterstützung in der Entwicklung von Kompetenzen bezogen. Im Machtbereich wird Unterlegenheit in ähnlicher Weise mit mangelnden eigenen Kompetenzen in der Durchsetzung verbunden. Die Anstrengungen vieler erwachsener Klienten mit Suchtproblemen richten sich demzufolge darauf, Versagen in verschiedenen Motivbereichen zu vermeiden. Oft fehlen positive Strategien, d. h. die Person kann Versagensgefühle nicht durch besondere Kompetenzen ausgleichen. Der Grund für das Fehlen von positiven Strategien liegt darin, dass die Person oft aufgrund von mangelnder Belohnung keine weiteren Versuche unternimmt, ein Problem zu lösen, das sie beim ersten Versuch nicht bewältigt hat. Viele folgen daher einer Strategie der Schwierigkeitsvermeidung: Man sucht sich einfache Aufgaben, versucht, nicht aufzufallen, keine Fehler zu machen oder handelt nur dann, wenn man sich bei anderen Personen der Richtigkeit des Handelns versichert hat. Hieraus resultiert eine niedrige Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Der Mangel an external gegebener Belohnung in frühen Entwicklungsphasen führt u. a. dazu, dass das Kind die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, indem es Fremdbelohnung "internalisiert", nicht erlernt. Erwachsene Personen mit dieser Lerngeschichte bleiben dann häufig von externalen Belohnungen abhängig, sie können sich aus eigener Kraft zu "nichts aufraffen", sind nicht intrinsisch motiviert. Bleiben externale Belohnungen aus, stellt sich ein Belohnungs-Mangel-Problem ein: Die Person wird depressiv (Lewinsohn, 1974). Dieses Beispiel zeigt die Interaktion von operanten Lernprinzipien und Selbstregulation. In früheren Phasen der Entwicklung werden Kinder in der Regel mehr durch operante Belohnungen bestärkt (C+). Die Internalisierung dieses Vorganges ("Selbstbelohnung") führt zur Fähigkeit, selbstmotiviert zu handeln und gegenüber gewünschten Handlungszielen bzw. Tätigkeiten einen "Annäherungsaffekt" (A+) zu generieren. Intrinsisch motivierte Personen sind demzufolge weniger abhängig von externalen operanten Verstär29 kern. Hieraus ließe sich die Schlussfolgerung ableiten, dass intrinsische Motivation in den drei Basismotiven einer der wirksamsten protektiven Faktoren gegen die Entwicklung süchtigen Verhaltens darstellen müsste. Tatsächlich zeigt sich in entsprechenden Untersuchungen zu impliziten Motiven, dass intrinsische Motivvarianten bei süchtigen Personen extrem selten vorkommen. Hingegen sind Meidungsvarianten in einer Weiterentwicklung des TAT (OMT; Kuhl, 2005) bei allen Basismotiven am häufigsten (Schlebusch et al., i. V.). Oft finden sich in der Biographie von Suchtklienten auch Erfahrungen, die Seligmans (1975) Paradigma der Erlernten Hilflosigkeit entsprechen. Insbesondere massiv traumatisierte Personen oder Personen, die hochgeneralisierte "Null-Resonanz"-Erfahrungen aufweisen, verarbeiten diese in Richtung vollständiger Resignation. Auch diese Personen generieren keinen positiven Affekt zur Initiierung von Handlungen. Ein spezielles Problem in der Gruppe der Personen, die den Problemeinstieg über niedrigen positiven Affekt finden, stellt das Konzept der Belohnungs-Unteraktivierung dar. Angenommen wird, dass eine bestimmte Gruppe von Personen eine chronische, möglicherweise genetische Unteraktivierung des Belohnungssystems zeigt. Diese Personen zeigen eine erhöhte Extraversion (Eysenck, 1967), da sie versuchen, durch erhöhte Aktivitäten in einen subjektiv angenehmen Bereich der psychophysischen Aktivierung zu kommen. Dieses Erklärungsmodell des Ausgleichs einer Minderaktivierung durch Aktivität wurde in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Kontexten diskutiert, so z. B. als Grundlage für ADHS im Kindesalter, für die antisoziale PS, für Störungen der Impulskontrolle und unter dem Stichwort des Sensation-Seeking. Blum et al. (2000) konnten tatsächlich anhand genetischer Studien eine Beziehung zwischen Typ-B-Alkoholismus und einer von ihnen als Reward-Deficiency-Syndrome bezeichneten genetischen Variante aufzeigen. Demzufolge besteht bei Personen mit einer genetisch bedingten Minderaktivierung des Belohungssystems ein erhöhtes Risiko, diesen Mangel durch alle Arten von risikoreichen Aktivitäten auszugleichen, darunter Straftaten, gefährliche Sportarten und der Gebrauch von (dopaminerg) aktivierenden Substanzen. Gegenwärtig wird das Thema der ADHS im Erwachsenenalter und Sucht stark inflationär in den Vordergrund gerückt. Jedenfalls sind bei kritischer Betrachtung der Befunde tatsächlich eine Reihe von Personen zu finden, für die dieses Modell Sinn ergibt. Die Zahl dieser Personen ist jedoch bei enger Definition eher gering. Es dürfte sich um eine Untergruppe des sog. TypB-Alkoholismus (Clonin30 ger, 1981) handeln. Häufiger als ein genetisches Syndrom dürften leichter ausgeprägte A+-Defizite oder Probleme in der Regulation von A+ sein. So weisen sozial unsichere Personen und Personen mit Depressionen deutliche Schwierigkeiten auf, Handlungen zu initiieren: Sie bilden eher Absichten, bringen jedoch die nötige Energetisierung für die Umsetzung nicht auf. Insbesondere affektive Störungen (v. a. Dys–thymien) und deren subklinische Vorläufersyndrome dürften für die Entwicklung süchtigen Verhaltens über A(+) disponieren. Auch hier ist zu betonen, dass nicht das Ausmaß des niedrigen positiven Affektes entscheidend sein muss, sondern eher der Umstand, dass die Person ihn nicht aus eigener Kraft heraus heraufregulieren kann. Insofern ist es nicht erforderlich, dass eine ausgeprägte kriterienkonform diagnostizierbare Affektive Störung vorliegt, um einen Einstieg in ein Alkoholproblem zu erklären. Auch im Bereich des positiven Affektes ist es trotz defizitärer Erstreaktion möglich, dass die Person bestehende A+-Defizite durch eine kompensatorische Zweitreaktion auszugleichen vermag. Das Risiko für den Problemeinstieg dürfte jedoch in dem Ausmaß steigen, indem solche Selbststeuerungs-Fähigkeiten nicht verfügbar sind. Personen können ferner im Falle kompensatorischer äußerer Bedingungen durchaus auch durch fremdinduzierten A+ (z. B. über C+) bestehende Selbstregulationsprobleme über lange Jahre ausgleichen. Ein Partner, der die Person ermutigt, lobt, Arbeitskollegen oder ein Chef, der betont, wie wichtig die Person für die Firma ist, dass sie persönlich gemocht und geschätzt wird, und andere Arten von externalen Anreizen können internale Regulation positiven Affektes möglicherweise lange „substituieren“. Versagen jedoch internale Regulationsmechanismen und bleiben äußere Anreize aus, so kann die Person einen dauerhaft niedrigen positiven Affekt erleben. Zum Einstieg in eine Alkoholproblematik ist es nun erforderlich, dass die Person lernt (die Erfahrung macht), dass der Konsum der Substanz tatsächlich zu einer Anhebung positiven Affektes führt. Zwei Varianten sind hier denkbar: • • Man kann zunächst davon ausgehen, dass Alkohol bei Personen, die keine schwerwiegenden oder generalisierten Regulationsprobleme aufweisen, tatsächlich zu einer Initiierung von Handlungen führen kann, besonders wenn sie über die nötigen Kompetenzen verfügen. Die Person steht auf einer Party herum, sieht eine begehrenswerte Person und bildet die Intention, sie anzusprechen. Nach einem Glas Sekt gelingt es ihr, in die Exekutive zu kommen und die nötigen Handlungen zu initiieren: Die Person bewegt sich vom IG in die IVS. Neurobiologisch sind hier zwei Mechanismen denkbar und wahrscheinlich auch beide wirksam: Ein Erhöhung des verfügbaren positiven Affektes über die Aktivierung des Nucleus Accumbens sowie eine Aufhebung von Handlungshemmung über eine Verminderung der hemmenden Aktivitäten des orbitofrontalen Cortex (Volkow & Fowler, 2000; Volkow, Fowler & Wang, 2003; Uekermann, Daum, Schlebusch, Wiebel, & Trenckmann, 2003; Uekermann, Daum, Schlebusch & Trenckmann, 2005). Personen, die schwerwiegendere Regulationsprobleme aufweisen, und/oder über entsprechende soziale Verhaltensprogramme nicht verfügen, werden möglicherweise auch mit einem Glas Sekt keine Handlungen initiieren. Diese Personen nutzen Alkohol nicht zu Handlungsinitiierung sondern zur Handlungssubstitution (Abb. 8). Da Alkohol unmittelbar physiologisch auf das Belohnungssystem wirkt, ist eine Ausführung des Verhaltens, das zur Belohnung führen würde, gar nicht erforderlich. Insbesondere bei höheren Dosierungen dürfte die Initiierung der Exekutive auch intoxikationsbedingt gehemmt werden. 31 Insbesondere die letzte Variante dürfte erheblich für den Einstieg in eine Suchtproblematik prädisponieren. Die Person erhöht zwar den positiven Affekt, der adaptive Sinn dieser Maßnahme, nämlich die Bahnung der IVS, tritt jedoch nicht ein. 3.2.2. Phase 2: Toleranzentwicklung und "Bodeneffekt" Man kann auch hier davon ausgehen, daß eine einmalige oder seltene Nutzung der affektanhebenden oder handlungsinitiierenden Wirkung von Alkohol keine dramatischen Wirkungen für die Person hat. Greift die Person jedoch öfters und schließlich fast ausschließlich auf die Substanz zurück, um positive Affekte zu regulieren, besteht ein Einstieg in psychische Abhängigkeit. Dies dürfte besonders dann der Fall sein, wenn die Person längere Zeit Situationen mit niedrigem positiven Affekt ausgesetzt ist oder eine hoch generalisierte Regulationsstörung aufweist. Auch hier gibt es Personen, die nur bestimmte, an kritische Schemata gebundene Affekte (z. B. bei Situationen, die Schemata von Wertlosigkeit aktualisieren) nicht regulieren können; andere können fast jede Art niedrigen positiven Affektes nicht beantworten. Besonders gravierend wirkt sich bei häufigem Gebrauch der Substanz zur Handlungssubstitution ein Mechanismus des Kompetenzverlustes aus. Belohnt wird üblicherweise nur erfolgreiches – also kompetentes – Handeln, also ein Handeln, das tatsächlich zur Umsetzung einer Absicht geeignet ist. Verschafft sich die Person die Belohnung jedoch durch Trinken, wird ihr eine Belohnung unabhängig von der Kompetenz des Verhaltens bzw. unabhängig von problembezogenem Verhalten überhaupt zuteil. Demzufolge muß die Person ihre Kompetenzen auch nicht bis an das Kriterium der Eignung für die Problemlösung heran entwickeln: Sie "kassiert" die Belohnung für inkompetentes Handeln. Das physiologische System reagiert auf Alkohol, generiert ein Belohnungsgefühl und signalisiert der Person fälschlicherweise, dass das gerade ausgeführte Verhalten kompetent war: Aus der Tatsache, dass sie belohnt wurde, schließt die Person, dass sie wohl kompetent gehandelt haben muß. Zusätzlich lernt die Person, dass der Konsum von Alkohol kompetent sein muß, da die Belohnung zeitlich kontingent zum Trinken erfolgt. Konsumbezogene Verhaltensweisen verdrängen über diesen Mechanismus zunehmend problembezogene oder andere belohnende Verhaltensweisen, so dass schließlich Alkoholkonsum zur wesentlichen oder sogar einzigen Belohnungsquelle wird. Die instrumentellen Verhaltensweisen (Beschaffung, Konsum) werden immer weiter zu Routinen, die dann kaum noch im engeren Sinne durch Anreize motiviert werden müssen. Für Routinen muss die Person dann kaum noch große Mengen an Handlungsenergie aufbringen. Deshalb wird Konsumverhalten später automatisiert fortgeführt, auch wenn die Substanz physiologisch keine Belohnungseffekte mehr auslöst. Bei häufigem Konsum erlebt die Person im weiteren Verlauf eine schrittweise sich erhöhende Toleranz gegenüber der affektregulatorischen Wirkung der Substanz. Wir gehen also davon aus daß das System für positiven Affekt selbst einer Toleranz unterliegt. Kann die Substanz den positiven Affekt nicht mehr hochregulieren, erhöht die Person im nächsten Schritt (und späteren) die Dosierung. Schließlich tritt trotz erhöhten Konsums keine affektregulatorische Wirkung der Substanz mehr ein. Hiermit ist die Person an einem Punkt angekommen, an dem sie einen "Bodeneffekt" erlebt (Abb. 9). Sie kann durch das Trinken von Alkohol keine Anhebung des positiven Affektes mehr erreichen. 32 Sie "hängt im niedrigen positiven Affekt fest." Dieser Bodeneffekt ist verbunden mit: • • • • • Niedriger Aktivierung und chronische Tendenz zu nicht aufhebbarer Depressivität dauerhafter, "chronischer" Aktivierung des IG chronischer Abkoppelung des IVS vom System zunehmender Anreizunabhängigkeit des Suchtverhaltens, da Belohnung ausbleibt Handlungshemmung Die Klienten sind in einem Zustand dauerhaften niedrigen positiven Affekts gefangen. Sie empfinden Langeweile und innere Unruhe. Sie haben eine Tendenz zur "chronischen Absichtsbildung", d. h.: Die Betroffenen beschäftigen sich mit Plänen, Absichten, Grübeln über mögliche Schwierigkeiten nach, kommen aber nicht in die Exekutive. Die mangelnde Energetisierung der Exekutive und der zunehmende Kompetenzverlust, der sich immer weiter generalisiert, da immer mehr Aktivitäten zugunsten der Sucht eingestellt werden, führen auch dazu, dass die Klienten auch dann, wenn sie zu handeln versuchen, schnell in der Exekutive "versanden": Man mobilisiert in einem Gewaltakt die letzten Reserven und dann versiegt die Handlungsenergie wieder. In Kliniken dient dies oft als Begründung für therapeutische Vorgaben, Auflagen und Aufträge. Klienten werden oft regelrecht in die Exekutive gezwungen und mit Sanktionen belegt, wenn sie dem nicht nachkommen. Hierbei bleibt die Frage, ob die verfolgten Ziele selbstgewollt sind, oft bedeutungslos. Eine besondere Klasse von Vorsätzen betrifft die, die sich mit der Veränderung des Suchtverhaltens befassen: Die Klienten bemühen Konstrukte wie "den eisernen Willen", den "inneren Schweinehund" und ähnliches, sie beten sich die Vorsätze, "nie wieder trinken" zu wollen, regelrecht vor. Dies geschieht mit so bemerkenswert geringem Erfolg, dass es sich lohnt, die Dysfunktionalität dieser "Vorsatzbeschwörung" näher zu beleuchten: Der "Eiserne Wille" ist bei näherer Betrachtung nicht nur eine reine Intention (und als solcher nicht unbedingt durch das Selbst abgedeckt); er ist eigentlich sogar eine Intention "zweiter Ordnung", 33 nämlich die, eine andere Intention (zu trinken) nicht auszuführen. Psychologisch gesehen ist es jedoch außerordentlich schwierig, eine beabsichtigte (gewünschte, positivbelohnende) Handlung auf Dauer nicht auszuführen. Dies ist im Prinzip nur möglich, wenn die Stärke der Hemmung permanent in ausreichendem Umfange aufrecht erhalten wird. Läßt die Kraftanstrengung nur einen Augenblick nach und fällt unter die Stärke der gehemmten Handlungsoption, bricht der Damm und die Person wird rückfällig. Oft schaffen es Personen auch nicht, diese Handlungshemmung auf Dauer alleine und aus eigener Kraft aufrecht zu erhalten. Einige Selbsthilfegruppen (natürlich nicht alle, viele beruhen auf anderen Konzepten) fallen dadurch auf, dass die Personen sich oft durch gegenseitiges hochfrequentes "vorbeten" ihrer Intentionsgedächtnisinhalte abstinent halten. Bei Personen, die sich auf das Konzept des "Eisernen Willens" verlassen, folgt entsprechend oft der Rückfall, wenn sie nicht zur Gruppe gehen. Ein weiterer Grund der mangelnden Effektivität des Vorbetens von Vorsätzen besteht darin, dass die Umsetzung einer Absicht wie der, nicht mehr zu trinken, noch nicht bedeutet, zufrieden abstinent zu sein. Personen, die das Trinken aufgeben, sind nicht automatisch zufriedener, da Zufriedenheit an bedürfniskongruentes Handeln geknüpft ist. Dies ist jedoch von der Verfügbarkeit von Daten aus dem EG abhängig. Oft spüren Personen, die abstinent werden, dann auch sehr deutlich, dass sie von einem zufriedenen Leben meilenweit entfernt sind. Durch die übermäßige Nutzung des Absichtsgedächtnisses werden nun aber die personalen Subsysteme, die Bedürfnisse repräsentieren, gehemmt (Kuhl, 2001), so dass sich die Diskrepanz zwischen Bedürfnissen und ihrer Realisierung noch weiter verschlimmert. Eine weitere Schwierigkeit beim Versuch der Hemmung eines Verhaltensimpulses wie des Wunsches, zu trinken, ist in den langfristigen neuronalen Folgeschäden des Alkoholismus zu sehen. Bei längerem Alkoholkonsum scheinen insbesondere Frontalhirnfunktionen geschädigt zu werden, die mit der Hemmung von Impulsen verbunden sind (Volkow & Fowler, 2000; Uekermann et al., 2003). Zumindest in späten Suchtverläufen mit chronifizierten Folgeschäden scheinen anreizunabhängige instrumentelle Verhaltensroutinen zunehmend nicht mehr durch Absichten aufhaltbar zu sein. Wichtig ist, dass sich der Bodeneffekt nach Absetzen der Substanz in der Regel erhält. Dies liegt daran, dass der positive Affekt schon vorher hoch war und die Kompetenzen zur Regulation durch Trinken verlorengehen oder sich zumindest nicht entwickeln. Somit wird der weiterbestehende Bodeneffekt zu einem Hauptgrund für Rückfälle nach Entgiftungen oder Behandlungen, die diesen Umstand nicht explizit berücksichtigen. 4.: Zusammenfassung: Zusammenfassung: Vom Problemeinstieg zur Endkonfiguration des Sy Systems Zusammengefaßt läßt sich folgendes feststellen: 1.: Es existieren mehrere Einstiegsbedingungen in die Alkoholproblematik: • Erhöhter nicht regulierbarer negativer bzw. erniedrigter positiver Affekt (Erst– reaktion: Persönlichkeitstypen, bevorzugte Affektkonfiguration), • Nicht regulierbarer negativer bzw. nicht regulierbarer positiver Affekt (Zweitreaktion) • Oder eine Kombination. 34 2.: Entscheidend ist somit nicht die Höhe des jeweiligen Affektes allein, sondern deren Nichtreduzierbar- bzw. Nichtanhebbarkeit, also die mangelnde Regulierbarkeit. 3.: Zweck des Suchtmittelkonsums ist die Herabregulation negativen und/oder die Heraufregulation positiven Affektes. 4.: Lernt die Person, Affektregulation überwiegend über die Substanz zu erzielen, besteht der Einstieg in die psychische Abhängigkeit. 5.: Die Potenz der Substanz zur Affektregulation nimmt aufgrund von Toleranz ab; die Person reagiert mit Dosissteigerung. 6.: Die Toleranz entsteht sowohl für positiven als auch für negativen Affekt, da beide Systeme physiologisch auf Alkohol reagieren. 7.: Im Laufe der Zeit entsteht eine körperliche Abhängigkeit. 8.: Die Person erlebt nun (vgl. Abb. 10) • einen permanent hohen, nicht reduzierbaren negativen Affekt (Deckeneffekt) und gleichzeitig, • einen permanent niedrigen, nicht heraufregulierbaren positiven Affekt (Bodeneffekt). Die Systemkonfiguration ist somit durch eine gleichzeitige Dominanz der Objekterkennung und der Intentionsbildung gekennzeichnet (Abb. 10). Die jeweils korrespondierenden Systeme (Extensionsgedächtnis und Intuitive Verhaltenssteuerung) bleiben weitestgehend deaktiviert. Dies hat zur Folge, dass das Intentionsgedächtnis nicht durch Inhalte des Extensionsgedächtnisses geladen wird. Durch die Deaktivierung des EG ist in der Folge auch die Verbindung, die Informationen zwischen EG und IG austauscht, inaktiv. Persönliche Motive, Wünsche und Präferenzen spielen somit bei der konkreten expliziten Zielbildung der Person keine Rolle mehr. Sie setzt in ihrem Leben persönliche Motive nicht in Handlungen um und gerät dadurch zunehmend in eine Diskrepanz zwischen ihren Wünschen/Bedürfnissen und der Umsetzungsrealität. Das System wird dadurch anfällig gegen Infiltrationen fremder Motive und Intentionen. Die Person übernimmt fremde Normen, Bedürfnisse und Präferenzen. Um zu bemerken, dass es sich um fremde Normen handelt, wäre es jedoch erforderlich, Inhalte des EG verfügbar zu haben. Da dies jedoch nicht der Fall ist, bemerkt die Person nicht einmal, dass das System infiltriert wird. Hierdurch entsteht ein doppeltes Alienationsphänomen (latente und manifeste Alienation): Mangelnder Zugang zum Selbst (EG), die Verwechslung fremder Intentionen mit eigenen und die mangelnde Umsetzung selbstgewollter Intentionen. Das psychologische Hauptproblem alkoholabhängiger Personen ist somit die mangelnde Bildung selbstkongruenter Intentionen. Damit einher gehen • eine erhöhte Externalität und Diskrepanzsensitivität aufgrund der chronischen Bahnung des OES; 35 • • eine übermäßige Bildung selbstinkongruenter Intentionen; eine Hemmung der Exekutive. Die Endkonfiguration des Systems, wie sie in Abb. 10 dargestellt ist, entspricht der von Kuhl angenommenen Systemkonfiguration für abhängigen, zwanghaften und paranoiden Persönlichkeitsstil. Tatsächlich zeigen erste Auswertungen einer umfangreichen Studie zur Affektregulation bei Alkoholabhängigen, dass diese Persönlichkeitsstile in einer Stichprobe von stationär behandelten Alkoholabhängigen die höchsten Mittelwerte erzielen (gemessen mit dem PSSI-9, Kuhl & Kazen, 1997). Weitere Belege für das Störungsmodell werden in künftigen Publikationen berichtet. Therapeutisch gesehen stellt u. E. die mangelnde Bildung selbstkongruenter Intentionen den Hauptansatzpunkt dar. In der Praxis der Suchttherapie finden sich jedoch überwiegend stark regel- und lösungsorientierte Therapiekonzepte. Insbesondere die rigiden regelorientierten Systeme nutzen jedoch u. E. das Alienationsphänomen, das in unserem Störungsmodell ein Hauptproblem der Patienten darstellt, dysfunktional aus. Die mangelnde Selbstregulation der Klienten wird nicht durch Bemühungen, Selbstzugang zu fördern, sondern durch die Vorgabe von Normen, Regeln und Präferenzen beantwortet. Dieses Phänomen könnte man als therapeutische Willenssubstitution bezeichnen. Es ist zum Teil erstaunlich, dass Suchtpatienten selbst die absurdesten Stationsregeln widerspruchslos akzeptieren oder sogar übernehmen. Bei näherem Hinsehen tut das auch nur etwa die Hälfte der Patienten in Kliniken: Die andere Hälfte bricht die Thera- 36 pien ab oder umgeht die Regeln heimlich. Wir vermuten, dass die Patienten mit den höchsten Alienationseffekten auch am besten mit regelorientierten Behandlungssettings zurecht kommen. Vielleicht sind ja gerade die widerständigen Klienten diejenigen, die noch über die bessere Selbstregulation verfügen. Ein großer Teil der Klienten, die Rehabilitationsbehandlungen regulär abschließen, ist innerhalb eines Jahres rückfällig (geschätzt zwischen 40 und 60%). Dies spricht dafür, dass Willenssubstitution nur so lange funktioniert, wie sie angewendet wird. Sobald die Klienten den Klinikrahmen verlassen und die „freiwerdende Fremdregulation“ nicht schnell durch eine Selbsthilfegruppe ersetzen, sind sie wieder auf sich selbst (oder auf ihr Selbst) angewiesen und die alte Systemkonfiguration schlägt wieder zu. Die einseitige Lösungsorientierung der Suchttherapie ist aus unserer Sicht stark zu kritisieren, da sie nicht ohne Anknüpfung an persönlich bedeutsame Ziele und Bedürfnisse zu bewerkstelligen ist: Das Prinzip "Lösen vor Klären", das im Rahmen der KOP als Bearbeitungsstörung angesehen wird, scheint in der praktischen Suchttherapie Leitlinie des therapeutischen Handelns zu sein. Man muß Therapeuten allerdings zugute halten, dass die Klienten ihnen keinen wirklichen Anlaß geben, die eigenen Strategien zu hinterfragen. Suchtklienten übernehmen aufgrund des Alienationseffektes recht schnell die Präferenzen ihrer Therapeuten, ebenso wie abhängige Persönlichkeiten die Präferenzen ihrer Partner übernehmen. Daher vermuten wir, dass rein lösungsorientierte Suchttherapien aufgrund des Alienationsphänomens besonders schlecht laufen, wenn man das Gefühl hat, dass sie besonders gut laufen. Klienten, die sich besonders gut anpassen, sind möglicherweise genau diejenigen, die ausgeprägte Alienation zeigen. Diese sind auch nur dann dauerhaft abstinent, wenn sie sich fremdbestimmten Regel- und (Selbst-) kontrollmechanismen unterwerfen. So entsteht dann der Eindruck, dass die regelorientierten Therapiesysteme funktionieren und die hohen Rückfallraten ein zu akzeptierendes notwendiges Übel darstellen. Oft werden Rückfälle sogar darauf zurückgeführt, dass die Klienten sich nicht konsequent genug einer Fremdsteuerung überantwortet haben. In der Diskussion mit Suchttherapeuten über die Wichtigkeit der Verankerung von Therapiezielen in den persönlichen Präferenzen der Klienten erntet man auf der anderen Seite kaum Widerspruch. Selbst die regelorientiertesten Therapeuten sind subjektiv der Meinung, dass sie die persönlichen Ziele ihrer Klienten in den Vordergrund stellen. Eine Person ohne Zugang zum EG kann jedoch auf die Aufforderung, persönliche Ziele für die Therapie zu benennen, nur mit Basistrivialitäten ("Ich will nicht mehr trinken.") oder mit alienierten Bekundungen aus dem Intentionsgedächtnis mit minimaler Selbstrelevanz antworten. Die Lösungsorientierung in der Suchttherapie bedarf somit eigentlich keiner klärungsorientierten Ergänzung im Sinne der Erweiterung um einen zusätzlichen Baustein. Sie bedarf einer organischen Integration von klärungs- und lösungsorientierten Therapieelementen, in der zunächst Selbstzugang hergestellt werden muß, dann selbstkongruente Bedürfnisse und Präferenzen erarbeitet, selbstkongruente Intentionen gebildet und erst anschließend durch lösungsorientierte Interventionen umgesetzt werden müssen. Dieses Prinzip des "Klären vor Lösen" (Sachse, 2003) ist hier ebenso Leitlinie wie Grawes Adaption des Rubicon-Modells (Grawe, 2000) als Heuristik des Therapieprozesses. Es ist hier noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Rubicon-Modell nicht ein Klassifikations- schema therapeutischer Verfahren, sondern ein Modell einer integrativen psychologischen Psychotherapie darstellt, d. h.: Klärungs- und Lösungsprinzipien sind in der Regel (indikationsgeleitet) in jeder Therapie zu realisieren, der Verzicht auf eines der beiden Prinzipen ist individuell für die Person oder im Rahmen eines Störungsmodells zu begründen. In jedem Falle wirkt sich nach unseren Erfahrungen die Lockerung therapeutischer Regeln in Kombination mit einer stärkeren Individualisierung der Therapie (d. h.: psycho37 therapeutische Orientierung, nichtdirektive Beziehungsgestaltung, Betonung Klärungsorientierter Elemente) günstig auf die Abbruchrate in stationären Entwöhnungsbehandlungen aus. Es gelang, diese in unserer Einrichtung auf 8% in einem Jahr (Juni 2004-Juni 2005) zu senken. Es muss sich zeigen, ob dieses Ergebnis tatsächlich auf die genannten Änderungen zurückzuführen ist und ob die Integration der KOP zu einer Verbesserung der Therapieerfolge führt. Empirische Belege für das hier geschilderte Störungsmodell werden derzeit in einem größeren Forschungsprojekt untersucht. Hierbei wird unter anderem die Therapiebegleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik (Kuhl, 2005) eingesetzt. Berichte über Ergebnisse und therapeutische Implikationen werden folgen. 38