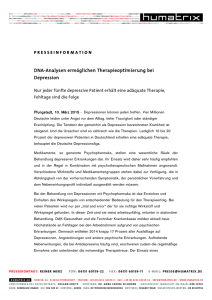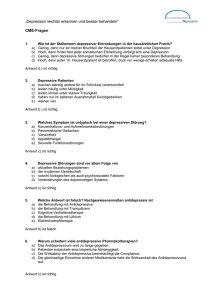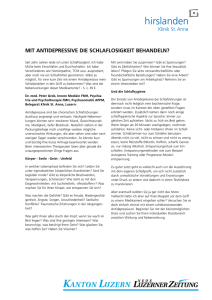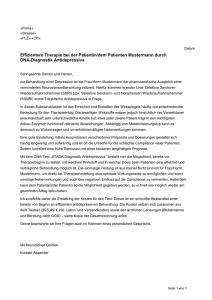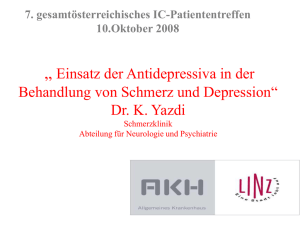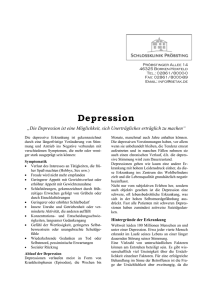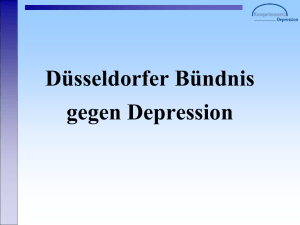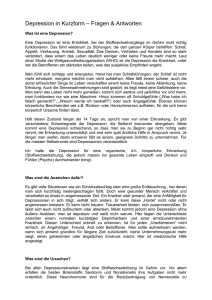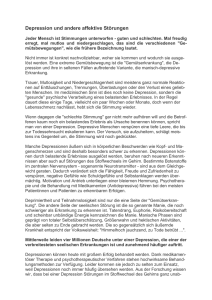Depression - Westermayer Verlags-GmbH
Werbung
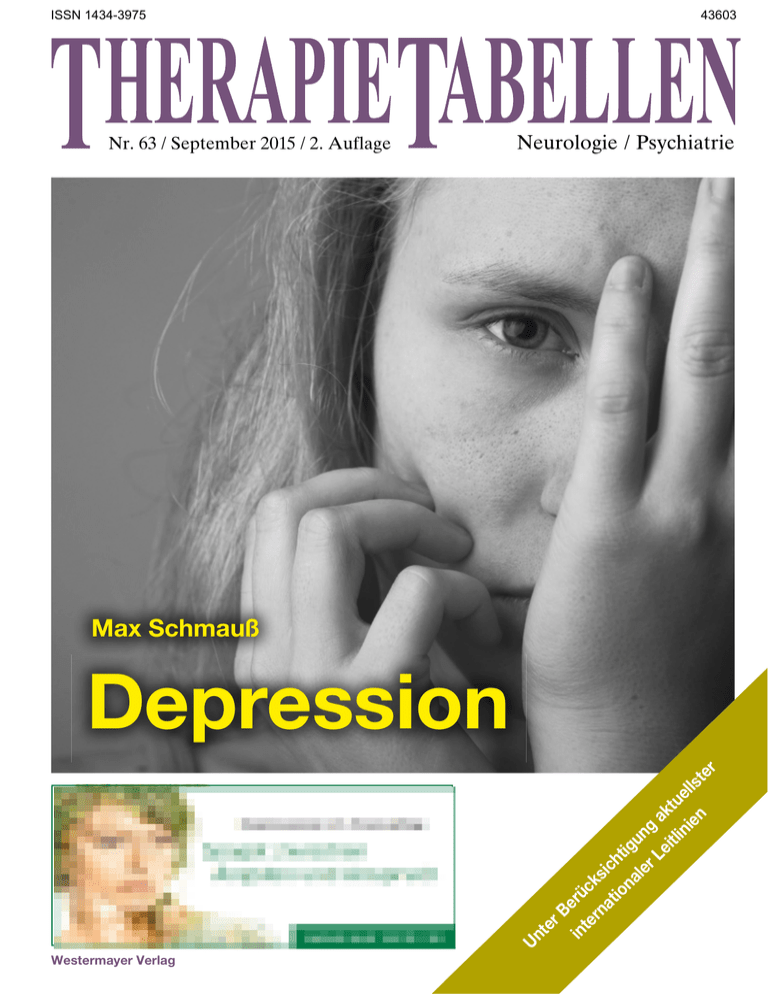
ISSN 1434-3975 43603 Nr. 63 / September 2015 / 2. Auflage Neurologie / Psychiatrie Max Schmauß Ihre Patienten wollen Verträglichkeit. Westermayer Verlag in Un MEHR AUF SEITE 36 te r Be Sie wollen Wirksamkeit. r te ück rn at sich io na tigu le r L ng ei akt tli ni uell en st e r Depression Depression Inhalt Hinweise zur Benutzung der Tabellen Vorwort 7 8 Epidemiologie, Ätiopathogenese und Diagnostik affektiver Erkrankungen Epidemiologie affektiver Störungen Einteilung affektiver Störungen Krankheitsverlauf affektiver Störungen Modellvorstellungen zur Ätiopathogenese von Depressionen Häufigkeit typischer Depressionssymptome Beispiele für pharmakogene Depressionen Beispiele für somatogene Depressionen Grundsätze der Arzt-Patienten-Beziehung Screening bei Depressionsverdacht Diagnose der depressiven Episode nach ICD-10 Fragebogen „depressive Episode“ nach ICD-10 Diagnose Depression – Checkliste Überweisung zum Facharzt – Kriterien Abgrenzung depressive Pseudodemenz – senile Demenz Depression im Alter Diagnose „manischen Episode“ nach ICD-10 Häufigkeit typischer Manie-Symptome Manie-Screening Bipolare Depression vs. Unipolare Depression 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 17 18 18 19 19 20 20 Suizidalität Suizidalität – ein Spektrum Checkliste Suizidalität – Risikofaktoren Stadien bei Suizidalität Fragenkatalog zur Abschätzung der Suizidalität Gruppen mit erhöhtem Risiko für suizidales Verhalten Abschätzung der Suizidalität Therapie bei Verdacht auf Suizidalität 21 21 22 22 23 23 24 Depression September 2015 Depression und Komorbidität TT Die häufigsten komorbiden Erkrankungen bei Depression Verteilung von depressiver Symptomatik und Angst-Symptomatik in der Allgemeinbevölkerung Lebenszeitkomorbidität der Major Depression mit Angsterkrankungen Gemeinsame Symptome Major Depression / Angst Ausgewählte Prädiktoren Angst / Depression Beziehung zwischen Depression und Angst Einfluss der Komorbidität auf die Symptomatik depressiver Erkrankungen Komorbidität erhöht Wahrscheinlichkeit von Suizidversuchen Konsequenzen einer Komorbidität Angst / Depression 24 24 25 25 25 26 26 26 27 Allgemeines zur Therapie depressiver Störungen Therapieempfehlungen nach S3-Leitlinie „Unipolare Depression“ 27 Definition von Symptomveränderungen 27 Depressionstherapie – Übersicht 28 Depressionstherapie – Checkliste 28 Grundprinzipien antidepressiver Therapie 29 S3-Leitlinie „Unipolare Depression“: Kriterien für die Auswahl eines Antidepressivums 29 Antidepressiva: Wichtige Faktoren bei Auswahl und Therapie 30 Einflussfaktoren auf die Compliance / Adhärenz 30 / 31 Spezielle Patientengruppen 31 Kriterien für die Auswahl eines Antidepressivums Pharmakologische Einteilung von Antidepressiva Auswahlkriterien für Antidepressiva: 5 STEPS Klinische Auswahl des Antidepressivums Checkliste vor Beginn einer Behandlung mit Antidepressiva Schematische Darstellung des Behandlungsverlaufs Empfehlung eines pharmakologischen Stufenmodells Depressive Störung – Behandlungsalgorithmus – Akuttherapie 33 33 34 34 35 35 37 Pharmakologie und Klinik der Antidepressiva Mögliche klinische Bedeutung der NA-, 5-HTund DA-Wiederaufnahmehemmung Neurochemisches Profil der Antidepressiva Profil wissenschaftlich-methodisch abgesicherter Johanniskraut-Extrakte Biochemische Wirkungscharakteristika ausgewählter Antidepressiva Unerwünschte Nebenwirkungen von Antidepressiva Modifiziertes „Kielholz-Schema“ Argumente für den Einsatz von TZA, SSRI und SSNRI Dosierungen und pharmakokinetische Parameter der SSRI Dosierungen und pharmakokinetische Parameter der SSNRI, NaSSA, SNRI, NDRI, Agomelatin und Vortioxetin Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) der Antidepressiva und Blutspiegel Cytochrom-P450-Isoenzyme: Substrate, Inhibitoren, Induktoren Nebenwirkungsspektrum und Interaktionspotenzial der SSRI Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen durch neue Antidepressiva Erforderliche Untersuchungen vor Therapiebeginn Empfehlungen für Routineuntersuchungen während Antidepressiva-Therapie 37 38 39 39 40 41 41 42 42 43 44 45 46 46 47 3 Inhalt Pharmakokinetische Interaktionen neuerer Antidepressiva über Cytochrom-P450-Isoenzyme Nebenwirkungen und Risiken von Tetrazyklika, SSRI, RIMA, SSNRI, SNRI, NDRI, NaSSA, Trazodon, Tianeptin, Agomelatin und Vortioxetin „Duale“ Antidepressiva, Agomelatin und Vortioxetin Monoaminoxidasehemmer (MAOH) Monoaminoxidasen mit Substraten und Hemmern Irreversible MAO-Hemmer und Zusatzmedikation Interaktionsprofil von Moclobemid Nebenwirkungsprofile trizyklischer Antidepressiva Sedierende trizyklische Antidepressiva und Trazodon Nicht sedierende trizyklische Antidepressiva Empfohlene Dosierungen bei trizyklischen Antidepressiva Tetrazyklische Antidepressiva Therapie der sogenannten AntidepressivaAbsetzsymptome Klinische Symptomatik eines zentralen Serotonin-Syndroms Arzneimittel mit serotonergem Wirkprofil Gewichtszunahme unter Therapie mit Psychopharmaka Synopsis bedeutsamer zentralnervöser und peripherer Nebenwirkungen von Antidepressiva Anticholinerg wirksame Pharmaka Infusionstherapie mit Antidepressiva Anwendung der Antidepressiva zur Infusionstherapie Nebenwirkungen der infundierbaren Antidepressiva 48 49 49 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 55 55 Faktoren, die mit einem erhöhten Rezidivrisiko der „Major Depression“ einhergehen 63 64 64 65 66 67 68 68 69 70 70 71 71 71 72 73 73 Rezidivprophylaxe bipolar-affektiver Störungen 59 59 59 60 60 61 61 Rezidivprophylaxe depressiver Störungen 4 „Mittel der 1. Wahl“ in der Akutbehandlung der Manie nach WFSBP- und CANMAT-Leitlinien Akuttherapie von bipolaren Psychosen – Aripiprazol / Risperidon Asenapin / Olanzapin / Quetiapin Indikationen für eine Lithiumbehandlung Kontraindikationen für eine Lithiumbehandlung und besondere Risikosituationen Empfohlene Bereiche für den 12 h-LithiumSerumspiegel Kontrolluntersuchungen Lithiumpräparate Unerwünschte Wirkungen von Lithium, Carbamazepin, Valproinsäure und Lamotrigin Wirkungsverstärkung von Lithiumsalzen Differenzialtherapie mit Lithium, Valproinsäure und Carbamazepin 58 62 63 Therapie bipolar-affektiver Störungen – Substanzen zur Akutbehandlung der Manie 56 56 57 57 57 Therapieresistenz depressiver Erkrankungen Stadien der Therapieresistenz bei depressiven Erkrankungen Ursachen für Pseudo-Therapieresistenz und Non-Response auf Antidepressiva Diagnostische Maßnahmen zum Ausschluss organischer Ursachen der Therapieresistenz einer Depression Typische Behandlungsziele bei Therapieresistenz Häufige Augmentationsstrategien bei Therapieresistenz Vor- und Nachteile einer Lithium-Augmentationstherapie Empfehlungen bei unzureichendem Ansprechen auf die initiale Antidepressiva-Therapie Risikoeinschätzung von Psychopharmaka im Alter Therapie mit Antidepressiva im höheren Lebensalter Dosierung von Antidepressiva bei älteren Patienten Depressive Syndrome bei Hirnerkrankungen Antidepressiva bei Morbus Parkinson Pharmakologie und Klinik der Stimmungsstabilisierer 58 62 Antidepressiva im höheren Lebensalter 55 Neue psychopharmakologische Behandlungsstrategien Vortioxetin in der Depressionsbehandlung Neue psychopharmakologische Substanzen in der Depressionsbehandlung Indikationen für eine medikamentöse prophylaktische Therapie bei „Unipolarer Depression“ Die Notwendigkeit einer prophylaktisch antidepressiven Langzeittherapie Regeln der Langzeitbehandlung affektiver Störungen Metaanalyse zum Rückfallrisiko unter verschiedenen Antidepressiva vs. Plazebo 62 Hinweise zur Auswahl des Medikaments bei der Rezidivprophylaxe bipolar-affektiver Störungen nach den CANMAT-ISBD-Leitlinien Aktueller Stand der Wirkschwerpunkte stimmungsstabilisierender Medikamente Mögliche Substanzen zur Rezidivprophylaxe „Medikamente der 1. Wahl“ zur Rezidivprophylaxe bipolar-affektiver Störungen Kontraindikationen für Phasenprophylaktika Indikationen für Therapeutisches Drug Monitoring bei affektiven Erkrankungen Kurative und rezidivprophylaktische Therapieziele bei bipolaren Störungen Möglichkeiten der Behandlungsoptimierung affektiver Episoden 74 74 75 75 76 76 77 77 Inhalt Notizen Psychopharmaka während der Schwangerschaft und Stillzeit Merksätze für Psychopharmaka in der Schwangerschaft Veränderungen der Arzneimittelkinetik in der Schwangerschaft Allgemeine Richtlinien für die Behandlung mit Psychopharmaka Psychopharmaka während der Schwangerschaft und Stillzeit 78 78 78 79 Psychopharmaka und Fahrtauglichkeit Psychopharmaka und Fahrtauglichkeit TÜV-Empfehlung zur Fahrtauglichkeit unter Antidepressiva Kognitive / psychomotorische Beeinträchtigungen durch Antidepressiva Fahrtauglichkeit bei Klinikentlassung 80 80 80 81 Psychotherapeutische Verfahren bei depressiven Störungen Voraussetzungen und Grundelemente der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) Behandlungsschema der KVT Häufige Fehler im Umgang mit depressiven Patienten KVT-Therapiemodell für chronische Depressionen Ablauf der CBASP-Therapie Interpersonelle Psychotherapie (IPT) 82 82 82 83 83 84 Internet-basierte Programme depressiver Störungen Internet-basierte Programme zur Therapieunterstützung von Patienten mit Depression 85 Schlafentzugsbehandlung und Stimulationsverfahren Praktisches Vorgehen bei der Schlafentzugsbehandlung 86 Aktuelle Stimulationsverfahren in der Depressionsbehandlung 86 Depression September 2015 Burnout TT Wichtigste Aussagen zum Thema „Burnout“ Gesellschaftliche und organisatorische Risikofaktoren für Burnout-Erleben Personenbezogene Risikofaktoren für Burnout-Erleben Burnout-Diagnose Quellenangaben / Literatur 87 87 87 87 88 5 Impressum TherapieTabellen Neurologie / Psychiatrie Nr. 63 / 2. Auflage / September 2015 Depression Verlag Westermayer Verlags-GmbH 82349 Pentenried Telefon 0 89 / 2 72 20 28 Telefax 0 89 / 2 73 00 58 [email protected] www.westermayer-verlag.de Herausgeber und Supervisor Prof. Dr. med. Max Schmauß Bezirkskrankenhaus Augsburg Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Dr.-Mack-Straße 1 86156 Augsburg E-Mail: [email protected] Projektleitung Reinhilde Bossema-Collien Verlagsadresse E-Mail: [email protected] Produktion Birgit von Rhein, Babette Evers, Christian Hehensteiner Gesamtherstellung G. Peschke Druckerei GmbH Taxetstraße 4 85599 Parsdorf b. München Quelle Titelbild: fotolia.de © 2015 Westermayer Verlags-GmbH Stand Juli 2015. Die in dieser Publikation veröffentlichten Tabellen und Texte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und andere Arten der Vervielfältigung sind untersagt. Ausnahmen nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. 6 Notizen Vorwort Depression Mit einer Lebenszeitprävalenz von 16 bis 20 % zählen depressive Erkrankungen zu den häufigsten psychischen Störungen und stellen eine Herausforderung für jedes Gesundheitssystem dar. Angesichts dieser hohen Prävalenzzahlen haben sich in den letzten 20 Jahren die diagnostischen und therapeutischen Perspektiven depressiver Erkrankungen erfreulicherweise verbessert. Nach wie vor besteht jedoch ein Optimierungsbedarf in der Diagnostik und Therapie depressiver Störungen. Die erste Auflage dieser THERAPIETABELLEN hat erfreulicherweise eine weite Verbreitung und hohe Akzeptanz gefunden. Ziel der THERAPIETABELLEN ist es ja, den interessierten Kollegen eine schnelle und umfassende Orientierung zu den wichtigsten ätiopathogenetischen Modellvorstellungen, zu Diagnostik, Verlauf und Therapie depressiver Störungen in ihrem Praxisalltag zu ermöglichen. Das vorliegende Heft enthält zunächst Tabellen zur Epidemiologie, Ätiopathogenese und Diagnostik depressiver Syndrome. Ein weiteres Kapitel ist der Diagnostik und Abschätzung der Suizidalität gewidmet. Checklisten bzw. Fragenkataloge zur Suizidalität sollen den interessierten Kollegen Hilfestellung bei der Abschätzung suizidalen Verhaltens geben. 8 Nachdem depressive Erkrankungen häufig in Komorbidität mit anderen psychischen Störungen auftreten, wird in einem weiteren Kapitel die Komorbidität der Depression intensiv beleuchtet. Nach allgemeinen Hinweisen zur Therapie depressiver Störungen wird ein Überblick zur Definition von Symptomveränderungen und den Grundprinzipien antidepressiver Therapie gegeben, im Folgenden werden Kriterien für die Auswahl eines Antidepressivums und Einflussfaktoren auf die Compliance bzw. Adhärenz der Patienten dargestellt. Die ins Auge gefassten Behandlungsstrategien sollten mit dem Patienten ausführlich besprochen und diskutiert werden. Grundlage für eine Compliance bzw. Adhärenz des Patienten sind gerade zu Beginn einer Behandlung die Schaffung einer stabilen Arzt-Patient-Beziehung sowie gezielte und verständliche Informationen über die intendierten Behandlungsalternativen. Die Therapie depressiver Störungen sollte nur im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes erfolgen. Psychotherapeutische Verfahren und soziotherapeutische Maßnahmen stellen neben der Pharmakotherapie weitere wichtige Bausteine eines entsprechenden Gesamtbehandlungsplanes dar. Vorwort Bipolar-affektive Erkrankungen Auch der Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen werden einige Kapitel gewidmet. Die aktuell verfügbaren Psychopharmaka (Antidepressiva, Phasenprophylaktika und Antipsychotika) ermöglichen unter Kenntnis von Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und des Arzneimittelinteraktionspotenzials der jeweiligen Substanzen eine differenzierte Pharmakotherapie unipolarer wie auch bipolarer affektiver Erkrankungen. Unerwünschte Wirkungen / Nebenwirkungen Unerwünschte Wirkungen und Nebenwirkungen können bei jedem genannten Pharmakon auftreten. Dabei ist zu bedenken, dass ein Teil dieser unerwünschten Wirkungen vorübergehend ist und die Belastung des Patienten durch eine schrittweise Aufdosierung reduziert werden kann. In Bezug auf spezifische Behandlungen mit Antidepressiva ist z. B. zu bedenken, dass Nebenwirkungen nach Verordnung einer Substanz nicht notwendigerweise auch Nebenwirkungen bzw. unerwünschte Wirkung bei der Verordnung eines anderen Antidepressivums der gleichen Substanzklasse bedeuten. Arzneimittelinteraktionen Werden mehrere Arzneimittel gleichzeitig oder nacheinander verabreicht, kann dies Arzneimittelinteraktionen (Wechselwirkungen) nach sich ziehen, da Arzneimittelwirkungen oder -nebenwirkungen durch Zugabe eines zweiten Pharmakons qualitativ oder quantitativ verändert werden können. Arzneimittelinteraktionen können sowohl unbeabsichtigt und dann meist unerwünscht als auch – im Rahmen einer Therapieoptimierung – beabsichtigt und erwünscht sein. Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln sind sowohl auf pharmakokinetischer als auch auf pharmakodynamischer Ebene möglich, häufig stellen sie auch ein Wechselspiel zwischen pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Effekten dar. Für pharmakokinetische Interaktionen ist kennzeichnend, dass die Konzentration eines Interaktionspartners im Plasma – und damit am Wirkort – verändert wird, pharmakodynamische Interaktionen finden dagegen z. B. auf Rezeptorebene statt. Nicht alle Interaktionen sind jedoch klinisch relevant und der Kliniker bekommt nur „die Spitze eines Eisbergs“ zu Gesicht. Wichtig für die tägliche Praxis ist insbesondere, ob das entsprechende Arzneimittel einen therapeutischen Bereich aufweist oder den Metabolismus anderer Pharmaka beeinflusst wie z. B. Lithium, Carbamazepin oder Kalziumantagonisten. In der klinischen Praxis ist anzuraten, auf klinische Symptome unerwünschter Arzneimittelwirkung vor allem dann zu achten, wenn an der Medikation Veränderungen vorgenommen werden. Wichtig erscheint zudem der Hinweis, dass die Häufigkeit von Medikamenteninteraktionen mit dem Alter des Patienten, seiner Morbidität, der Anzahl der verordneten Medikamente und der Anzahl an der Behandlung beteiligten Ärzte zunimmt. Psychopharmaka im Alter In den vergangenen Jahrzehnten haben in Europa, den USA und anderen westlichen Industrienationen vor allem altersassoziierte psychische Erkrankungen zugenommen, da der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung nicht nur kontinuierlich, sondern sogar exponenziell ansteigt. Ein besonderes Augenmerk muss auf depressive Störungen im Alter gerichtet werden. Psychopharmakotherapie im Alter orientiert sich an den gleichen Grundprinzipien wie die allgemeine Pharmakotherapie älterer Patienten. Aufgrund der im Alter geänderten Nierenfunktion, der veränderten Kapazität von Leberenzymen und des im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen anderen Verteilungsvolumens sollte generell mit niedrigen Dosierungen begonnen werden. Für viele der symptomatischen Therapien, insbesondere neuropsychiatrischer Komplikationen, ist eine eher niedrige Dosis anzustreben. Im Weiteren werden Hinweise zur Verordnung von Psychopharmaka in Schwangerschaft und Stillzeit und zum Problem der Fahrtauglichkeit unter Psychopharmaka dargestellt. Wir hoffen, unsere Leser mit diesem kurzgefassten tabellarischen Ratgeber in ihrem Bemühen um eine differenzierte Therapie der Depression für ihre Patienten zu unterstützen. Der Leser findet hier vor allem im Gegensatz zum umfassenden und differenzierten Lehrbuch oder zu entsprechenden Diagnostik- und Therapieleitlinien einen schnellen tabellarischen Überblick über die wesentlichen differenzialdiagnostischen Erwägungen und die aktuell zur Verfügung stehenden Therapiealternativen. Die Lektüre dieser Tabellen kann natürlich das Studium umfassender psychiatrischer Lehrbücher oder aktueller Originalarbeiten in entsprechenden deutsch- oder englischsprachigen Fachzeitschriften nicht ersetzen. Die Indikationen und Dosisangaben für alle Psychopharmaka wurden sorgfältigst überprüft – eine Haftung für fälschliche Angaben kann jedoch trotzdem nicht übernommen werden. Wir würden uns freuen, wenn auch diese 2. Auflage der THERAPIETABELLEN die in Klinik und Praxis tätigen Kolleginnen und Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen könnte. Rückmeldungen und Anregungen sind für künftige Auflagen erwünscht und sehr willkommen. Augsburg, im August 2015 9 Prof. Dr. med. Max Schmauß