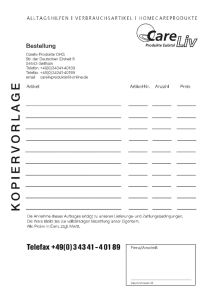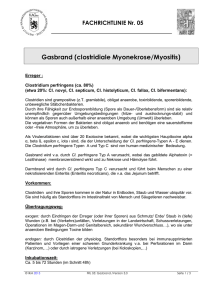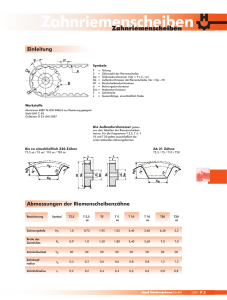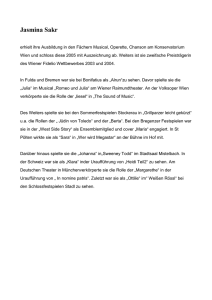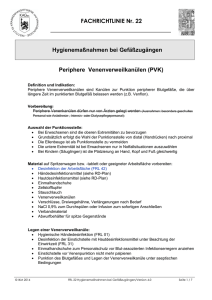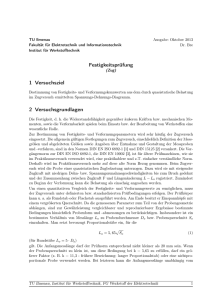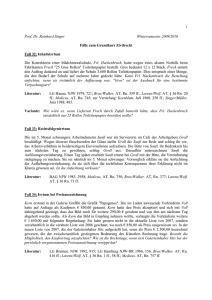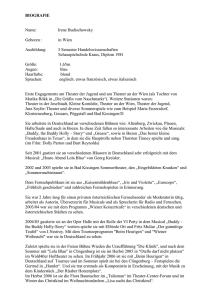30 Nachbemerkung: Bei der großen Anzahl von heute nur noch
Werbung
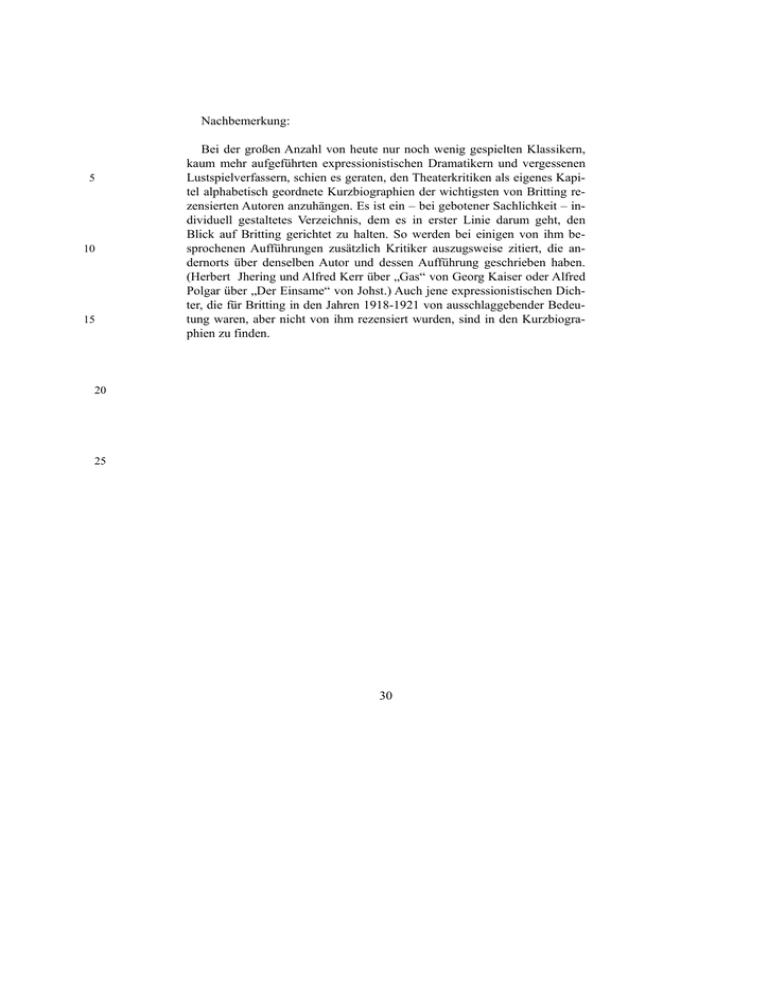
Nachbemerkung: 5 10 15 Bei der großen Anzahl von heute nur noch wenig gespielten Klassikern, kaum mehr aufgeführten expressionistischen Dramatikern und vergessenen Lustspielverfassern, schien es geraten, den Theaterkritiken als eigenes Kapitel alphabetisch geordnete Kurzbiographien der wichtigsten von Britting rezensierten Autoren anzuhängen. Es ist ein – bei gebotener Sachlichkeit – individuell gestaltetes Verzeichnis, dem es in erster Linie darum geht, den Blick auf Britting gerichtet zu halten. So werden bei einigen von ihm besprochenen Aufführungen zusätzlich Kritiker auszugsweise zitiert, die andernorts über denselben Autor und dessen Aufführung geschrieben haben. (Herbert Jhering und Alfred Kerr über „Gas“ von Georg Kaiser oder Alfred Polgar über „Der Einsame“ von Johst.) Auch jene expressionistischen Dichter, die für Britting in den Jahren 1918-1921 von ausschlaggebender Bedeutung waren, aber nicht von ihm rezensiert wurden, sind in den Kurzbiographien zu finden. 20 25 30 5 Regensburger Neueste Nachrichten 1.0.1912 bis 14.3.1914 10 15 20 25 30 35 Ein Sommernachtstraum Lustspiel in 3 Akten von William Shakespeare. Übersetzt von A.W. Schlegel. Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy. 5 10 15 20 25 30 35 Man sah sich ordentlich neugierig im Hause um, als man am Sonntag Abend zum erstenmale wieder das Theater betrat. Zwar war am Zuschauerraum nichts geändert worden, in gleicher Langeweile wie früher blickten die verschnörkelten Goldverzierungen der Decke auf den Saal hernieder und das dunkle Rot der Wandverkleidungen der Logen war während des Sommers auch nicht leuchtender geworden. Trotzdem – die fünfmonatliche Trennungszeit hatte einem die gewohnte Umgebung etwas entfremdet, nur allmählich gewann wieder das Gefühl die Oberhand, daß man sich in einem lang vertrauten Raum befinde. Aber richtig heimlich wurde man doch erst, als sich langsam Logen und Ränge mit plaudernden Menschen füllten und vom Orchester herauf das mannigfach verworrene Tönen klang, das beim Stimmen verschiedener Instrumente entsteht. – Leise, unruhvolle Spannung liegt auf allen Gemütern! Das macht: es soll die erste Aufführung der Saison mit einem neuen Ensemble unter einem neuen Direktor stattfinden. Und da weiß man im voraus nie, wie es werden wird! Die Theaterhabitues, die in Gruppen zusammenstehen, tauschen alte Erinnerungen aus, sprechen von früheren Aufführungen des graziösen Shakespear´schen Lustspiels auf unserer Bühne und erörtern die Chancen der diesmaligen. Da schrillt ein Klingelzeichen durch den Raum, das Stimmengewirr schwillt langsam ab und verstummt, das Licht verlischt. Dann rauscht der Vorhang empor. Puck, der übermütig kecke Kobold, springt vor die Rampen und sagt sein launig Sprüchlein her. Sein Prolog, von Hofrat Dr. Hutter verfaßt, bildete den Auftakt zum nun folgenden Spiel, dem Traum einer Sommernacht. Die graziösen Einfälle der heiteren Phantasie Shakespeares nahmen die Sinne gefangen, Puck ergötzte durch seine kapriziösen Tollheiten, Liebesleid und Liebesfreud rührte an das Herz und das Märchen, das auf leisen Sohlen durch den mondbeschienenen Zauberhain schritt, und Elfen und Waldgeister im Gefolge hatte, rief selige Kindheitserinnerungen wach. Man weiß ja aus den Geschichten die Großmutter erzählte, daß Zauberkräutlein Liebe erwecken und zerstören, daß übermütige Geister den Menschen Tiergestalten verleihen können. Und die Menschen, denen da im dunklen Wald so Seltsames geschieht, trotz ihrer griechischen Kleidung sind sie durchaus keine Hellenen, in ihnen fließt das schwere Blut des Nordländers, ihre Gefühlswelt umschließt einen Kreis, der dem unsern an Inhalt gleich ist. 33 5 10 15 20 25 30 Die biederen Handwerker gar, die brave Bürger aber miserable Komödianten sind, könnten sie nicht aus Schilda gebürtig sein? Der drastische Humor, mit dem sie gezeichnet sind, erinnert an manche mittelalterliche deutsche Schwänke, die derb und ungekünstelt sind. Die Aufführung des Lustspiels am Sonntag vermittelte uns als wertvollstes Geschenk die Regiekunst des neuen Oberspielleiters unseres Schauspiels, des Herrn Benthien. Es ist immer ein Wagnis, auf einer Provinzbühne ein Ausstattungsstück wie es „Sommernachtstraum“ ist, in Szene zu setzen. Diesmal muß das Wagnis als geglückt bezeichnet werden. Trotz der verhältnismäßig geringen technischen Hilfsmittel unseres Theaters ist es gelungen, vor allem durch Benützung der Vorderbühne, viele Verwandlungen zu vermeiden und das Spiel nur durch eine einzige größere Pause unterbrochen, glatt und rasch zu Ende zu führen. Die Bühnenbilder voll strenger Einfachheit und Geschlossenheit erzielten prächtige Wirkungen, die durch die vortrefflich verwendeten Beleuchtungskünste zu größerer Eindringlichkeit gesteigert wurden. – So war der äußere Rahmen zu dem Werk würdig und bei weiser Beschränkung auf einfache Mittel, großlinig und zügig durchgeführt. – Die Darstellung, die bemerkenswerte Einzelleistungen nicht bot, zeigte, daß das junge Ensemble schon recht wacker zusammen gespielt ist. Nini Hauser, als fröhlichkecker Puck, war von quecksilberner Beweglichkeit und zeigte Ansätze zu einer tieferen Durchdringung der Rolle. Max Linnbrunner gab seinen Zettel in kräftiger Holzschnittmanier, mit guter Komik. Er war der beste der Rüpel, die durch Ihre Theateraufführung am Hofe des Theseus die Lachlustigen im Hause für sich einnahmen. Karl von Pidoll führte seinen kleinen Part als Egeus gut durch. Willibald Mohr als Theseus war ganz ansprechend, während Georg Kalkum an seinen Lysander ein Übermaß von Stimmenaufwand und großen Gebärden verschwendete. – Die musikalische Illustration zu dem Lustspiel, die traumzarte Musik Mendelssohn-Bartholdys, die dem verschollenen Märchenzauber der Dichtung angepaßt ist, fand unter Leitung von Kapellmeister Hofmann eine gute Wiedergabe. Das stark besetzte Haus zeigte sich sehr beifallslustig und rief Darsteller, Regisseur und Direktor wiederholt vor den Vorhang. RNN 23/267 1.10.1912 35 34 Die Journalisten Lustspiel in vier Akten von Gustav Freytag 5 10 15 20 25 30 Nach einem Satz, der sich in jeder Literaturgeschichte findet, haben die Deutschen nur drei gute Lustspiele: Lessings »Minna von Barnhelm«, Kleists »Zerbrochenen Krug« und Freytags »Journalisten«. Und wer all das platte Zeug kennt, das unter der Flagge »Lustspiel« segelt, wer die pikant gewürzten Possen und öden Schwänke zum Überdruß genossen hat, die unter dem Titel »Lustspiel« sich in die Literatur schmuggeln zu können glauben, wer die vergeblichen Versuche der Modernen miterlebt, einen neuartigen, unseren veränderten Daseinsformen entsprechenden Lustspielton zu finden, der muß dem strengen Urteil beipflichten. Es scheint unseren Dichtern die Fähigkeit abhanden gekommen zu sein, das rauschend pulsierende Leben der Gegenwart mit dem überlegenen Lächeln des Zuschauers zu betrachten und aus den wechselvoll durcheinander schießenden Fäden am »Webstuhl der Zeit« die buntesten und farbenfreudigsten zu entnehmen und zu einem frohen Kranz zu vereinen. – Die Alten haben das, scheint es, besser verstanden, und so ist das leuchtende Dreigestirn am deutschen Lustspielhimmel noch durch keinen weiteren Stern vermehrt worden, in unvermindertem Glanze strahlt es und wärmt und bezaubert. Die »Journalisten« kamen gestern abend zur Aufführung. Man merkt nicht, daß das Stück schon sechs Jahrzehnte überdauert hat, noch zeigt sich keine Spur von Altersschwäche. In lebendiger Frische wirken die Gestalten des Werks auf uns, sie sind lebende Menschen von Fleisch und Blut wie wir, keine Marionetten. Und darum werden sie auch immer Anteilnahme erwekken. – Georg Kalkum, der die Regie führte, gab den impulsiven, heißblütigen Redakteur Bolz. Er stattete die dankbare Rolle mit vielen charakteristischen Einzelzügen aus und gestaltete eine kraftsprühende Persönlichkeit, die die ganze Aufführung beherrschte. Als Oberst Berg war Willibald Mohr auf dem richtigen Platz, sein Gegner Oldendorf wurde durch Hans Strien ansprechend vertreten. Den Schmock stellte Karl von Pidoll dar. Er arbeitete das gedrückte, scheue unstäte Wesen des getretenen Juden scharf heraus und fand Töne und Gesten, die von Talent zeugten. Die übrigen, größeren und kleineren Rollen des Stückes waren gut besetzt. – Das Publikum, leider gering an der Zahl, unterhielt sich gut und applaudierte lebhaft. 35 RNN 23/267 1.10.1912 35 So lange wir irren Schauspiel in 4 Aufzügen von Karl Schüler 5 10 15 20 25 30 35 Auf dem Juristenkongreß, der unlängst in Wien tagte, wurden des Langen und Breiten Gründe für und gegen die Abschaffung der Todesstrafe erörtert, wurde hitzig darüber debattiert, ob es noch dem modernen Rechtsempfinden entspräche, einem Menschen als Sühne für begangene Missetat den Kopf abzuschlagen. Eine Eingung konnte unter den gelahrten Herren nicht erzielt werden und auch die Ansichten der Allgemeinheit über diese Frage gehen beträchtlich auseinander. Von denjenigen, die keine Freunde des Einenkopfkürzermachens von Rechtswegen sind, wird als ein gewichtiges Moment gegen die Verhängung der Todesstrafe vor allem auch der Umstand angeführt, daß die Möglichkeit besteht, daß einmal ein Unschuldiger hingerichtet werden kann. Um einem solchen fürchterlichen, nicht mehr gut zu machenden Justizirrtum vorzubeugen, solle man die Todesstrafe als solche überhaupt abschaffen. Eine Broschüre über dieses Thema wäre sicherlich ganz interessant, ob es aber angebracht ist, solche Frage von der Bühne herab zu erörtern, steht auf einem anderen Blatt. Karl Schüler tat es. An einem Beispiel zeigt er, daß es vorkommen kann, daß Unschuldige zum Tod verurteilt werden. Daß da ein Tendenzdrama im schlimmsten Sinne des Wortes entstehen mußte, ist klar. Irgend einen literarischen Wert besitzt das Stück nicht. Der Verfasser versteht es – nach einer etwas langweiligen Exposition – ganz geschickt, die Spannung der Zuschauer rege zu halten. Die Charaktere der handelnden Personen sind durchweg oberflächlich angelegt, nur selten zeigt sich ein Ansatz eine Figur feiner und lebenswahrer herauszuarbeiten. Dafür gibt es Szenen, die voll nervenkitzelnder Sensation sind. Man bedenke: der unschuldig Verurteilte in der Nacht vor der Hinrichtung in seiner Zelle, draußen hört man das Schafott aufschlagen, während man noch in Ungewißheit schwebt, ob der Deliquent begnadigt werden wird. Hat man ähnliches nicht schon in den dünnen Heften gelesen, die buntscheckige Titelbilder tragen und in jeder Kolportagebuchhandlung ausgestellt sind? Gespielt wurde recht gut. Herr Benthien führte die Regie und gab zum erstenmal auch Gelegenheit ihn als Schauspieler kennen zu lernen. Sein Herzog bewies, daß er ein Künstler ist, der Intellegenz und Feingefühl besitzt. Sein Engagement bedeutet einen Gewinn für unser Theater. Den Minister Hassenpflug spielte Herr von Pidoll mit der nötigen kühlen Reserve und Überlegenheit des eleganten, kalten Hofmanns, Herr Linnbrunner als Bollen-Nannte charakterisierte gut und hatte eine vortreffliche Maske. Herr 36 5 Strien besitzt Temperament und wußte die Gefühlsausbrüche des Lehrers Kleinfritz ohne Übertreibung zu geben. Herr Rothmeyer bot als Schuldirektor eine ansprechende Leistung. Das Stück gefiel selbstverständlich. Das Publikum hatte viel mit Rührung zu kämpfen und begeisterte sich am guten Ausgang. Begreiflich: Das Schauspiel ist beinah so schön wie ein Kinodrama. RNN 23/280 14.10.1912 37 Durchs Ohr Lustspiel in 3 Akten von Wilhelm Jordan 5 10 15 20 25 30 Wenn die Verse nicht so hübsch und zierlich wären und in ihrer bestechenden Glätte nicht eine gar sorgfältige Feile verrieten, wären die drei Akte wohl kaum erträglich. Die Idee des Lustspiels ist von ehrwürdigem Alter. Schon nach dem ersten Auftritt der ersten Szene des ersten Aktes weiß man ganz genau, welchen Verlauf die Dinge nehmen werden. Denn wenn ein spleeniger, alter Onkel in seinem Testamente seinen Neffen nur unter der Bedingung sein großes Besitztum vererbt, daß besagter Neffe eine bestimmte junge Dame zum Traualtar führen muß, wenn ferner der pietätlose Neffe diese abscheuliche Klausel verwünscht, weil er sein Herz bereits an eine ihm nicht bekannte Holde verloren hat, so hat es doch in einem richtig gehenden Lustspiel nichts Überraschendes – es ist viel mehr eine Selbstverständlichkeit – daß der Seelenkampf des unglücklichen Neffen dadurch beendet wird, daß sich nach langen Wirrsalen herausstellt, daß die junge Dame, die der Neveu heiraten soll, identisch ist mit der Angebeteten, die sein Herz im Sturme erobert hat. – Das ist auch die Fabel des Jordan‘schen Stückes, die dadurch nicht an Geist gewinnt, daß diesmal sich der Neffe in die – Stimme einer Maske, die natürlich sein durch das Testament bestimmtes Bräutchen ist verliebt, bei ihm also die Liebe nicht wie so oft durch den Magen, sondern „durch’s Ohr“ geht, Die Darstellung des Lustspiels entsprach billigen Anforderungen. Herr Kalkum als Heinrich sprach seine Verse gut, doch wäre ihm etwas Mäßigung in der Entfaltung seiner Stilmittel anzuraten. Herr Strien und die Damen Heuser und Falkow genügten den ihnen gestellten Aufgaben. Der Beifall des wenig zahlreichen Publikums war nur schwach und wäre vermutlich noch spärlicher ausgefallen, wenn nicht die Damen und Herren der Künstlerlogen es für nötig gefunden hätten, ihren Kollegen auf der Bühne dadurch einen Liebesdienst zu erweisen, daß sie stets das Signal zum Applaus gaben und sich beinahe die Hände wund klatschten.- Den Schluß des Abends bildete das nachfolgende einaktige Lustspiel. RNN 23/281 15.10.1912 35 38 Zum Einsiedler Von Benno Jacobson 5 10 15 Ein still versonnener Humor verklärt das graziöse Werkchen, in dem ein glücklicher Gedanke glücklich durchgeführt wird. Es steckt echter Lustspielgeist in dem kleinen Stück. Die süßwehmütige Resignation des alten Ehepaares, das fünfundzwanzig Jahre verheiratet ist, und am Jubiläumstag wieder die Stätte aufsucht, wo es den ersten Tag seiner Hochzeitsreise verbrachte, ist mit lächelnder Güte geschildert. In dem eben getrauten Pärchen, das nun das Hotel-Zimmer gemietet hat, in dem die jetzt grau Gewordenen damals Logis genommen hatten, ersteht ihnen das Bild ihrer eigenen Jugend. Die Darsteller fanden den Ton, den das Stück verlangt. Frl. Bille und Herr Pötsch als das Silberhochzeitspaar, Frl. Butze und Herr Gemeier als die Neuvermählten spielten mit natürlicher Empfindung und vieler Diskretion. - - Um die Regie des Abends hatte sich Herr Benthien verdient gemacht. RNN 23/281 15.10.1912 39 Der Kaufmann von Venedig Lustspiel in fünf Aufzügen von W. Shakespeare 5 10 15 20 25 30 35 Ein geistreicher Kopf hat einmal gesagt: Wenn die Engländer alle ihre Kolonien verlieren würden, so hätten sie immer noch Shakespeare. Das ist ein Ausspruch, der mehr bedeutet, als ein verblüffendes Paradoxon, ist kein Aphorismus, der flüchtig kaum die Oberfläche der Dinge streift. Die Zusammenfassung der Faktoren, die dem Britenreiche und jeder Nation als Wesensbedingung zum Aufstieg und zur einheitlichen Größe gesetzt sind, wird in dem Satze gegeben. Eine hohe Kultur, die in Männern und Werken der Kunst und Wissenschaft ihren Ausdruck findet, muß ein Volk sich schaffen, denn durch rohe ursprüngliche Kraft allein ist eine Nation vielleicht im Stande, durch Kriegstaten sich vorwärts zu bringen, niemals aber genügt das, um ein Volk auf der einmal erreichten Höhe auch fest zu halten. Äußere kriegerische Macht und innere Kulturarbeit müssen verbunden werden. Englands Macht liegt in seinen Kolonien, seine Kultur besitzt in Shakespeare ihren leuchtendsten, genialsten Geist. Shakespeare ist der Meister eines großen und edlen Realismus, der himmelweit über dem überwundenen Naturalismus unserer verflossenen Hypermodernen steht. Das universelle Genie des Dichters findet für alle Zeiten, alle Länder, alle Geschlechter, alle Altersstufen die richtige Ausdrucksweise. Er kann gütig und verzeihend lächeln wie ein verstehender Menschenfreund, er zürnt und droht wie ein ergrimmter Titane, nichts Menschliches ist ihm fremd. Und ein göttlicher Humor ist ihm eigen, der Humor, der unter Tränen lacht, den Wilhelm Busch so definierte: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Im Kaufmann von Venedig ist dem Dichter eine Figur unter der Arbeit gewaltig überragend geworden, so mächtig hervortretend und sich in den Mittelpunkt schiebend, wie es der Schöpfer ursprünglich gar nicht gewollt hat. Der Jude Shylok wurde die Hauptperson des Dramas, dessen Ökonomie dadurch gesprengt wird. Die Gestalt dieses Juden, der das Schicksal seiner ganzen Rasse verkörpert, flößt Abscheu und Mitleid zugleich ein. Der Haß gegen seine Unterdrücker macht Shylok zu einem blutdürstigen, eklen Tier. Aber so erfreut man ist, daß Shylok, der mit Verbissenheit auf seinem Schein besteht, am Schluß doch geprellt wird das Gefühl läßt sich nicht verdrängen, daß ihm doch eigentlich Unrecht geschieht. Ernst von Possart spielte den Shylok, er ist der Shylok. Wer den gefeierten Künstler einmal in dieser seiner Glanzrolle gesehen hat, dem wird sie 40 5 10 15 unauslöschlich ins Gedächtnis eingeprägt bleiben, für den wird die Gestalt des Juden Shylok immer die Züge Possarts tragen. Er stattete die Figur mit so viel charakteristischen Einzelzügen aus, bis auf das kleinste Detail arbeitet er die Gestalt plastisch heraus, jede Geste, jeder Ton ist so wohl abgemessen, daß ein Shylok vor uns ersteht, der in der Gerichtsszene zu erschütternder Tragik und echter Menschlichkeit empor wächst. Daß sich neben Possart die übrigen Darsteller mit ihren Aufgaben verhältnismäßig gut abfanden, ist nur erfreulich. Herr Mohr war ein ansprechender Antonio, Frl. Hoheneck gab die Porzia mit gutem Gelingen. Als Bassanio war Herr Kalkum etwas zu korpulent, sonst aber ganz nett. Herr von Pidoll spielte den Prinzen von Marocco wenig temperamentvoll, sein Organ vermochte auch den Anforderungen seiner Rolle nicht gerecht zu werden. Herr Benthien, der die Regie in mustergültiger Weise führte, war als Arragon zierlich und gelenk, wie ihm vorgeschrieben war. Das Haus war bis auf den letzten Platz besetzt, sogar im Orchester hatte man Sitze aufschlagen müssen. Der Beifall, der hauptsächlich dem illustren Gast galt, war rauschend und wohlverdient. RNN 23/288 22.10.1912 20 41 Der gutsitzende Frack Komödie in vier Akten von Gabriel Dregely 5 10 15 20 25 30 35 Das ist ein in das moderne Leben übertragenes Märchen. – Wir alle kennen die Geschichten, die Großmutter erzählte, wenn an rauhen Winterabenden der Sturm an den Fensterläden rüttelte, bei denen es einem so wohlig gruselte, wenn man die Taten und Abenteuer miterlebte, die die Helden und Ritter und schönen Prinzessinnen in den wundersamen Mären zu bestehen hatten. Und die Geschichte vom „tapferen Schneiderlein“, das durch seine Schlauheit und Keckheit es weit im Leben brachte und gar ein Königstöchterlein zur Braut bekam, gefiel uns immer besonders. – Märchen, nun, sie können sich auch in unserer Zeit ereignen, die als trocken und poesielos verschrien ist. Aber durch kühnes Reckentum, Mut und Tapferkeit allein werden keine Prinzessinnen mehr erstritten, und durch Heldensinn und Kraft wird kein Schneiderlein mehr Landesfürst. So hoch hinaus geht es jetzt nicht mehr. Daß aber ein armer Schneidergeselle im Verlaufe eines Jahres zur Ministerwürde emporsteigt, ist immerhin auch eine ganz ansehnliche Leistung. Und dabei ist dieser Abkömmling des Märchenschneiderleins nicht durch besondere Gaben ausgestattet, keine gütige Fee verhilft ihm zum raschen Aufstieg. Das tut einzig und allein eine tüchtige Portion Frechheit und - - ein gutsitzender Frack. Gar ergötzlich schildert Dregely die rasche und ungeahnte Karriere des kecken Nadelhelden, der mit einem gestohlenen Frack am Leibe frech und voll Gottvertrauen eine Soiree bei einem Parvenu besucht, seinem Namen eigenmächtig das vielbedeutende Wörtchen „von“ vorsetzt, sich bei einem Minister gut einzuführen weiß und - - als er die Gesellschaft verläßt, nicht nur verschiedene Frauen – und Mädchenherzen gebrochen, sondern auch schon halb und halb festen Fuß in den besten Kreisen der Stadt gefaßt hat. Der ehemalige Schneidergeselle wirft sich auf die Politik, wird Abgeordneter, gibt ein bedeutendes sozialpolitisches Werk heraus, daß aus der Feder seines – Privatsekretärs stammt (dessen Frau nebenbei auch noch seine Geliebte ist), und erhält – nachdem seine Entlarvung durch einen guten Freund hintertrieben wird – die Ministerwürde. - - Und das alles hat ein gutsitzender Frack zuwege gebracht. Herr Gemeier trug gestern dieses Kleinod von einem Kleidungsstück. Er trug es mit Grazie und sah elegant aus, aber – rote Socken zum Frack darf ein Mann nicht tragen, der durch die ausgesuchte Vornehmheit seines Exterieurs Erfolge erringen will. Im übrigen fand der brauchbare Darsteller den 42 5 richtigen Ton für diesen Günstling des Glücks, versagte aber in der Szene des dritten Aktes, wo dem so Hochgestiegenen Gefahr droht, von dem erklommenen Gipfel schmählich gestürzt zu werden. – Den jüdischen Parvenu Reiner gab Herr von Pidoll in guter Maske und diskretem Spiel. Gut war Herr Strien als Silberberg, während Herr Zeischke als Gabl nicht entsprach. Das mäßig besetzte Haus amüsierte sich gut und applaudierte heftig. RNN 23/297 31.10.1912 10 43 Liebelei Schauspiel in drei Akten von Arthur Schnitzler 5 10 15 20 25 30 35 Wesen und Eigenart Schnitzlers und der Dichterschule „Jung Wien“, deren bedeutendster Könner er ist, lassen sich am besten mit den Worten charakterisieren, mit denen er einmal ein Mädchen schildert: „lch kann dir nun einmal nicht helfen – sie erinnert mich so an einen getragenen Wiener Walzer – sentimentale Heiterkeit – lächelnde, schalkhafte Wehmut – das ist so ihr Wesen.“ – Das ist so das Wesen dieser feinen nervösen Literaten, die auf den differenziertesten Reiz reagieren, die mit dem sensibelsten Empfinden nuancierte Stimmungen auskosten, sich in sie hineinversenken, die leise, stille Worte haben auch für die große Tragik des Lebens, die allem Lauten und Rohen, und auch allem Urwüchsigen und Derben und Kräftigen fremd, mit dekadentem Unverständnis gegenüberstehen. Sie zeigen keine kraftstrotzenden Reckengestalten, keine verwegenen Drauflosgänger: ihre Lieblingsfiguren sind Menschen, die, der materiellen, gemeinen Not des Lebens enthoben, träumend, beschaulich versonnen, mit lächelndem Pessimismus, wie ein untätig Außenstehender dem Wirbeltanz alles Seins zusehen, die die Ereignisse mit müder Resignation an sich herankommen lassen. Daher sind Ihre Gestalten oft so unirdisch wie Darstellungen auf verblaßtem Seidenbrokat. Aber aus ironisch schalkhafter, heimlicher Lebensweisheit, die melancholisch zwischen den Scherzen hervorlächelt, aus schwermütiger Grazie blickt uns plötzlich manchmal doch groß und ewig das Leben an. Arthur Schnitzler ist heuer fünfzig Jahre alt geworden. Der Repräsentant „Jung -Wiens“ hat also seine Jugendtage schon hinter sicht, der Herbst des Lebens steht vor ihm. Wenn man die Lebensarbeit des Fünfzigjährigen überblickt, so ist eine bestimmte ausgesprochene Entwicklung, eine Entwicklung nach einem bestimmten Ziele hin, ein Übergang von der „Sturm-und Drangperiode“ zur Schaffensperiode des reifen Dichters („Sturm und Drang“ haben die Jungwiener ja nie gekannt) nicht zu konstatieren. Der Schnitzler der „Liebelei“, des „Anatol“, des „Reigen“ ist auch der wenn auch verkappte – Schnitzler des „Schleier der Beatrice“, und des „jungen Medardus“. „Liebelei“ hat den Ruhm Schnitzlers begründet. In drei Akten wird da die Liebestragödie eines jungen Mädchens erzählt, eines Mädchens der Vorstadt, das einen jungen Mann der guten Gesellschaft abgöttisch liebt und das an dieser Liebe zugrunde geht, als es erfährt, daß der Geliebte im Duell für eine andere Frau gefallen ist. – Anmut und Charme und süße Melancholie 44 5 verklärt das Stück, dessen beide männlichen Hauptpersonen identisch sind mit Anatol und Max aus „Anatol“. Schnitzler zu spielen ist nicht gerade leicht. Die gestrige Vorstellung bot einige gute Leistungen. Fräulein Hoheneck als Christine zeichnete eine Gestalt, die in ihrer Schlichtheit und stillen Größe rührte. Herr Strien gab seinen Fritz mit gutem Gelingen und auch Herr Pötsch als Musiker Weiringer war recht ansprechend, während Fräulein E. als Mizzi schlecht abschnitt. Man hätte diese Rolle besser anders besetzt. Das Haus war leider schlecht besucht, kargte jedoch nicht mit seinem Beifall. 10 RNN 23/303 7.11.1912 45 Die Jungfrau von Orleans Eine romantische Tragödie in 5 Akten von Fr. Schiller 5 10 15 20 25 30 35 Auf langmähnigem Roß ein gepanzertes junges Weib, das edle Antlitz, rückwärts geneigt, hebt sich gen Himmel, frei entquillt eine Lockenflut dem Nackensturz, dessen gereckte Rechte aber senkt das Schwert, demütig ... (unleserlich) Das ist das Denkmal, daß man der Jeanne d‘Arc in Orleans errichtet hat. So mag die Gestalt der Jungfrau auch Schiller vorgeschwebt haben, als er das Geschick des seltsamen Mädchens als Vorwurf zu einem Thema verwendete. Schon im „Wallenstein“ hatte Schiller gegenüber seinem bisherigen Schaffen insofern neue Wege beschritten, als sich hier schon die Ereignisse nicht allein aus des Helden Brust entwickelten, daß vielmehr schon die äußeren Verhältnisse ihre unheilbringende Rolle spielten. In noch stärkerem Maß tritt diese Auffassung in der „Jungfrau von Orleans“ hervor. Mit dieser romantischen Tragödie, die die Darstellung des Wunders in das Bereich der Bühne zog, näherte sich Schiller den Romantikern, die ihn persönlich so heftig befehdet und geschmäht hatten. Bewundernswert ist es, wie er, der geborene Protestant und Anhänger einer konfessionslosen Humanitätsreligion sich in die katholische Anschauungswelt hinein versetzt, die der Stoff erheischt. Aber auch die rein menschlichen Seiten der Charakteristik wirken überzeugend. Die farbenreiche Sprache, das gewaltige Pathos, der geheimnisvolle Duft des Überirdischen, das Johanna umgibt, die unwiderstehliche Kraft in der Entwicklung des Stoffes, die bis zur Katastrophe in gewaltiger Steigerung mitfortreißt – all das sind Vorzüge, die Schiller als den Meister des Dramas zeigen. Die Darstellung der Lebensbahn der „gottgesendeten“ Jungfrau, wie Schiller sie gibt, weicht stark ab von der geschichtlichen Wirklichkeit. Doch hat Schillers Werk der Jungfrau auch in der Dichtung wieder zu ihrem Rechte verholfen, nachdem sie Voltaire in seiner „Pucelle“ aufs Schändlichste mit Schmutz beworfen hatte. Für uns Deutsche wird Jeanne d’Arc ewig die Züge tragen, mit denen Schiller sie ausgestattet hat, ähnlich wie „Maria Stuart“ ist die vom Dichter genial geschaute Heldin unserem Herzen und Gefühl näher stehend, als ihre geschichtliche Person. Am Samstag - Abend brachte man an unserem Stadttheater das Werk heraus. Ein Wagnis, wenn man bedenkt, daß unser Schauspielpersonal heuer nicht den Anforderungen genügt, die man zu stellen bisher gewohnt war. Daß man trotzdem eine verhältnismäßig ganz anständige Aufführung zu 46 5 10 15 20 25 Wege brachte, ist wohl vor allem der Verkörperung der Titelrolle durch Frl. Anna Glenk vom Münchner Hoftheater zu danken. Frl. Glenk gab die Jungfrau mit viel Natürlichkeit, vermied naheliegendes, leeres Pathos und erzielte so starke Wirkungen. Die Sprechtechnik der Dame ist sehr gut ausgebildet und allen Anforderungen gewachsen. Wenn ihre Leistung auch nicht überragend genannt werden kann, so bewegte sie sich doch auf einer respektablen Höhe. – Herr Benthien spielte den König Karl. Obwohl sein Organ manchen Schwierigkeiten der Rolle nicht gewachsen ist, hatte er so viel natürliche Empfindung, echtes Gefühl und verständnisvolle Auffassung zu geben, daß er sich neben der Gastin würdig zeigen konnte. Der Talbot des Herrn von Pidoll hatte düstere Entschlossenheit und finstere Strenge. – Mitleid erregte Herr Zeischke als Raoul, der seine Erzählung erbarmenswürdig schlecht brachte. Diese Qual hätte man dem Publikum ersparen können. Herr Kalkum vergeudete als Graf Dunois wieder seine schönen Stimmittel, die er ohne jede Ökonomie verwendete. Innerliches, lebendiges Gefühl nützt mehr als der größte Stimmaufwand und seelenloses Deklamieren! – Vollkommen unfähig war Karl Kaiser als Raimond. Man tut am besten, seine Leistung mit dem Mantel christlicher Nächstenliebe zu bedecken. – Der Erzbischof von Reims des Herrn Kestler glich wenig einem so hohen geistlichen Würdenträger und den drei Ratsherren glaubte man gern, daß es um Orleans schlecht stehe, so herabgekommen sahen sie aus. Die Regie des Herrn Benthien schuf eine rasche Aufeinanderfolge der Szenen und gute Bühnenbilder. Leider mußte die Ansprache des Königs an sein „gutes Volk“ sich an die Adresse von kaum zwanzig Männlein und Weiblein richten. Das Haus war mäßig besetzt und sehr beifallsfreudig. RNN 23/307 11.11.1912 47 Gesinnung Ein heiteres Quartett von Hans Müller 5 10 15 20 25 30 35 Am Samstag Abend gab es an unserem Stadttheater so etwas wie eine Premiere: Die 1. Reichsdeutsche Aufführung des Einakterzyklus‘ „Gesinnung“ von Hans Müller. – Hans Müller gehört nach seiner ganzen Art zu dem Kreis der Wiener Literaten um Schnitzler und Hofmannsthal, die mit besonderer Vorliebe die für sie charakteristische Form der dialogischen Novelette , die zwischen Drama und Novelle steht, pflegen. Diese Form konnte nur an einer Stätte reifer, alter Kultur, nur in Wien erblühen. Die Kunst der eleganten Plauderei, geistreich pointierter Unterhaltungen liegt diesen feinen und stillen Poeten, die zwar keine kraftgenialischen, titanischen Gipfelstürmer, Erneuerer und Wegweiser sind, die aber mit ihrem liebenswürdigen Talent, mit ihrer leisen und reifen Art Werke schaffen, die in ihrer Zierlichkeit und ihrem Duft starke Wirkungen hervorbringen. Die Stimmung ist für sie alles, ihr Mangel an Pathos und Feierlichkeit wirkt wohltuend und die weltferne Resignation ihrer Kunst ist von seltsamsüßen Reiz. Hans Müller ist nicht gerade das stärkste Talent „Jungwiens“, immerhin aber ein Schriftsteller, der die Form sicher beherrscht, etwas zu sagen hat und es auch zu sagen weiß. Er ist frisch und natürlich und nicht so sehr Künder melancholischen Entsagens und wehmütigen Verzichtens, wie der Kreis, dem er literarisch angehört. Die vier Lustspielchen, die Müller unter dem Gesamttitel „Gesinnung“ zusammengefaßt hat, sind ganz reizend. Ohne Anspruch auf höhere Wertung erheben zu können, verhelfen sie ein paar Abendstunden auf amüsante Weise zu verbringen. – Bei der Uraufführung im Wiener Deutschen Volkstheater bildete die „Romantik“ das erste Stück des Zyklus‘. Hier gab man als Einleitung „Die Gewissenssache“. Der junge Graf Gismondi-Oehringen glaubt seinen Vater in die Netze der Hofschauspielerin Marius verstrickt. Um ihn zu retten, knüpft er selbst zarte Beziehungen zu der Schauspielerin an. Da stellt sich heraus, daß der alte Graf nicht die Marius, sondern ihr Gesellschaftsfräulein heiraten wird, weil diese seine Lieblingsspeise so trefflich zu bereiten versteht. – „Der Mittwoch“ schildert, wie ein berühmter Frauenmaler von der Dienstagsredoute in Begleitung einer Maske in seine Wohnung zurückkehrt. Gerade als es ihm zu gelingen scheint, die Tugend der Dame zu Fall zu bringen, schlägt es Mitternacht. Da erklärt sie plötzlich, am Mittwoch nie ein Verhältnis zu beginnen, weil das immer noch ein Ende mit Schrecken genommen habe. Vier Mittwochliebhaber seien ihr 48 5 10 15 20 25 30 schon elendiglich gestorben. Der Don Juan, der gern noch länger leben möchte, gibt sie frei. Und erfährt erst, als das Auto mit der Dame schon abgefahren ist, von seiner Haushälterin, daß diese die Uhr vorgerückt habe. – „Das Höchste“ ist der Titel des vierten Stückes. Die Novelle, die den gleichen Stoff behandelt und die er jetzt dramatisiert hat, hat der Autor schon vor mehreren Jahren hier im „Kaufmännischen Verein“ vorgelesen. Ein junger Philosoph, ein Menschenfreund, der jedem helfen will ist ein großer Pechvogel. Mit all seinen Wohltaten stiftet er nur Unheil an. Da er sich in selbstmörderischer Absicht in die Donau stürzen will, bemerkt er im Wasser einen treibenden Menschenleib. Er rettet mit Lebensgefahr die sich verzweifelnd wehrende Selbstmörderin und trägt sie in seine Villa. Hier stellt sich heraus, daß die vermeintliche Selbstmörderin die Vizepräsidentin eines Schwimmklubs ist und gerade im Begriffe war ein Dauerschwimmen zu absolvieren. Der Pechvogel hat schließlich doch noch Glück: er verlobt sich mit der Dauerschwimmerin. – „Die Garage“ ist eine unbedeutende Sache, die gegen die ersten drei Stücke stark abfällt. Müller weiß in den vier Komödien allerlei Unanständiges mit Anstand und Grazie zu sagen. Hofschauspieler Gustav Waldau von München, der in sämtlichen Stücken der Träger der Hauptrolle war, verblüffte durch seine brillanten Leistungen. Frack, Smoking und Cutaway trug er mit gleicher Eleganz, er spielte mit einer Verve, die bewundernswürdig war. Als Fabian Hübner zeichnete er eine Figur, die in ihrer rührenden Güte eindringlich wirkte. – Neben Waldau konnte nur Frl. Hoheneck gut bestehen, alle anderen Spieler versagten mehr oder minder. Die Herren Strien und Gemeiner waren in ihren Rollen nichts weniger als vorbildlich. Frl. Bille als Marius entsprach nicht. Frau Oesterreicher als Frau Fröbius übertrieb zu sehr und Frl. Butze als Nina spielte durchaus nicht so gut, daß sie es nötig gehabt hätte, den Applaus des Hauses in so auffallender Weise für sich in Anspruch zu nehmen. Die Ausstattung der vier Stücke ließ leider viel zu wünschen übrig. Daß ein berühmter Maler die Wände seines Zimmers mit Kitschbildern behängt, ist wohl nicht wahrscheinlich. - - Das ausverkaufte Haus war beifallsfreudig und rief den Dichter und Herrn Waldau (beide wurden mit riesigen Lorbeerkränzen ausgezeichnet) wiederholt und stürmisch vor die Rampen. 35 RNN 23/314 18.11.1912 49 Einsame Menschen Drama von Gerhart Hauptmann 5 10 15 20 25 30 35 Als Nachfeier zu Gerhart Hauptmanns fünfzigstem Geburtstag gab man gestern Abend an unserem Stadttheater „Einsame Menschen“. Es ist in diesen Tagen sehr viel über den Dichter geschrieben worden; an den meisten Theatern kamen Werke von ihm zur Aufführung; die bedeutendsten Zeitschriften brachten ausführliche Jubiläumsartikel über Hauptmann: fast so viel wurde er gefeiert, als gälte es nicht seinen fünfzigsten Geburtstag sondern seinen fünfzigsten Todestag würdig zu begehen. Bei dem deutschen Volke, das im allgemeinen Geistesgrößen erst dann nach ihrem vollen Werte einzuschätzen versteht, wenn sie längst gestorben sind, könnte diese Ehrung des lebenden Gerhart Hauptmann fast beängstigend wirken, fast den Eindruck hervorrufen, als wäre der Dichter mit seinem Schaffen zu Ende, habe uns das Reifste seiner Kunst schon geboten, sei geistig schon tot. Und er ist doch nicht viel weniger als das! Erst in der letzten Zeit hat er uns wieder die Romane „Emanuel Quint“ und „Atlantis“ und das schon früher entstandene Drama „Gabriel Schillings Flucht“ geschenkt, die uns den Dichter auf der vollen Höhe seines Schaffens zeigen. Für Hauptmann gilt sein eigenes Wort: „Fragmentarisch ist alle Kunst. Was da ist, ist schön. Ergreifend und schön“. Es ist richtig: Hauptmann hat auch Schwaches, Unfertiges, gar Wertloses gegeben. Aber bei der überquellenden Fülle seiner Herrlichkeiten, bei seinem gewaltigen, den Stempel des Ewigen tragenden Gesamtwerks erträgt man gerne diese öden Strecken, die inmitten eines gesegneten Wunderlandes liegen, die Schönheit und den Reichtum dieses Märchenreiches umso mehr hervortreten lassen. Gerhart Hauptmann ist der Dichter des Leidens, der Sehnsucht nach Erlösung, nach Befreiung. Sein Glaubensbekenntnis lautet: „Warum bluten die Herzen und schlagen zugleich? Das kommt, weil sie lieben müssen“. – Der Dichter gibt nicht psychopathische Studien, sondern rein Menschliches, erfaßt von einem verstehend Mitfühlenden; ewig Menschliches, eingebaut in eines Dichters blutendes Herz. „Einsame Menschen“ gehören zu den frühesten Werken Hauptmanns. Der Gegensatz zwischen der alten, gläubigen Generation und der jungen, naturwissenschaftlich gebildeten und nervösen ist fein und sicher durchgeführt. Der ewig schwankende, willensschwache Johannes Vockerat kann unser Mitgefühl nicht in dem Maße erregen, wie es zur tieferen Wirkung des Dramas notwendig wäre. Der Einfluß Ibsens auf Hauptmann läßt sich nicht 50 5 10 15 verkennen, auch daß der Dichter sich mit naturwissenschaftlichen Problemen beschäftigte (er studierte in Berlin und Jena Naturwissenschaften) ist klar ersichtlich. Herr Strien spielte den Johannes Vockerat. Er sah etwas zu jugendlich frisch aus für den übernervösen, energielosen Menschen, fand sich auch im ersten Teil des Abends nicht recht mit seiner Rolle ab. Später hatte er echte Töne und wirkte etwas überzeugender. Frl. Falkow als Frau Käthe Vockerat konnte ihre Aufgabe nicht bewältigen. Das gedrückte, zage Wesen der jungen Frau gelang ihr zwar gut, doch versagte sie im Affekt vollkommen. Das alte Ehepaar Vockerat wurde durch Frl. Bille und Herrn Pötsch trefflich dargestellt. Dagegen entsprach Frl. Hoheneck nicht so, wie man es hätte von Ihr erwarten sollen. Ihre Anna Mahr war verschwommen gezeichnet, man gewann kein richtiges Verhältnis zu dieser Gestalt. Das Haus war gut besetzt. Sollte das nicht ein Fingerzeig für die Direktion sein, daß ernste, moderne, literarisch wertvolle Stücke besser ziehen, als Antiquitäten wie „Durchs Ohr“, und „Die zärtlichen Verwandten“? RNN 23/323 27.11.1912 51 Magdalena Ein Volksstück in drei Aufzügen von Ludwig Thoma (Buchausgabe bei Albert Langen in München) gibt Archivare, Bibliothekare und Registratoren der Literatur, langweilige Tröpfe, die am liebsten jede dichterische Begabung ein für allemal klassifizieren möchten, nach denen ein Lyriker unmöglich ein passables Drama schreiben kann, nach denen ein Humorist nie und nimmer ernste Stoffe zu behandeln im Stande ist. Da wird ein Talent nach Schema F eingeschachtelt. Und wenn irgend ein neues Erzeugnis nicht mehr in das Aktenfach paßt, dann muß es eben auch nichts wert sein, denn zwei Fächer werden nicht zugestanden. Dafür langen die verstaubten Begriffe der Herren Archivare nicht. Ludwig Thema, der Simplicissimusmann, ist nach diesen Literaturbureaukraten ein Humorist und Witzbold, der mitunter auch derbe Zoten reißt – mehr nicht. Daß er schon zwei ernste Romane voll Wucht und psychologischer Vertiefung geschrieben hat, die zu den besten Werken dieser Art gehören, läßt diese Herren kalt. In der Schilderung des Bauernlebens steht Thoma unerreicht da. Wer seinen »Agricola« kennt, weiß, daß es nicht möglich ist, dieses Buch in der eindringlichen Schärfe der Charakteristik zu übertreffen. Diese Bauern sind bodenständige Figuren, rauh, verschlagen, auf ihren Vorteil bedacht, ohne falsche Sentimentalität, die am Samstag Kammerfensterln, am Sonntagvormittag beichten und am Nachmittag raufen. Nichts ist ihrer Art ferner, als die gefühlvolle Weichheit, in der sie z.B. Ganghofer in seinen Romanen schildert. Thoma, ein Oberammergauer, der selber Bauernblut in den Adern hat, behandelt auch in seinem neuesten Bühnenwerk einen Vorwurf aus dem bäuerlichen Leben. Es ist die Tragödie des gefallenen Mädchens, das aus Leichtsinn, Dummheit und Trieb auf die schiefe Bahn gerät. – Der Paulimann, ein bescheidener Häusler, lebt mit seinem Weib in glücklicher Ehe. Ein Gram zehrt an den alten Leuten, die Tochter, die Leni, ist in der Stadt herabgekommen, zur Dirne geworden. Auf dem Schub wird sie ins Elternhaus geliefert. Nach der Mutter Tod führt die Geächtete dem Vater die Wirtschaft. Sie sehnt sich nach der Stadt zurück und – um das Geld dazu zu erlangen, verlangt sie von einem Burschen, dem sie ihre Gunst schenkte, Geld. Darüber empört sich das ganze Dorf und in einem Anfall von Zorn und Verzweiflung ersticht der Vater sein entartetes Kind. Eine Fülle seeli- Es 5 10 15 20 25 30 35 52 5 10 15 20 25 30 scher Vertiefung und echter Charakterschilderung liegt in den einzelnen Szenen. Fein gezeichnet sind die bäuerlichen Vertreter der sittlichen Forderung, in deren Liebeskodex die Prostitution keinen Raum hat, die einem Mädel ein oder zwei ledige Kinder verzeihen, aber sich mit Abscheu von der wenden, die sich für ihre Liebe bezahlen läßt. – Der eigentliche Höhepunkt des Dramas ist wohl die Szene des zweiten Aktes, in der das vergebliche Liebeswerben des verachteten, ausgestoßenen Weibes geschildert wird. Es ist ergreifend, wie in dem apathischen, im Sumpf untergegangenen, verlotterten Mädel eine edlere Empfindung noch einmal aufflammt, in der naiven Liebessehnsucht zu dem strammen Knecht. Die Aufführung an unserem Theater hätte man eine ganz anständige nennen können, wenn – ja wenn es nicht bei den meisten Darstellern mit dem Dialekt gehapert hätte. – Die beste Leistung des Abends bot Herr Kalkum als Aushilfsknecht Lorenz Kaltner. Das war eine Figur, die mit Naturtreue und feinem Humor gezeichnet war, fest und scharf umrissen. Ganz köstlich war seine Maske. Man hätte glauben mögen, eine Zeichnung von Spiegel aus dem »Simplizissimus« sei lebendig geworden, als er im zweiten Akt ins Zimmer trat, mit den Militärhosen angetan, das Haar sorgfältig gescheitelt und an den Kopf geklebt, den Schnurrbart keck aufgezwirbelt. Besser und mit größerer Virtuosität hätte man die Rolle nicht darstellen können, als es Kalkum in diesem prächtigen Kabinettstückchen tat. Frau Lauschek fand für ihre Mariann warme Herzenstöne und wirkte ergreifend in ihrer rührenden Schlichtheit. Der Bürgermeister des Herrn Linnprunner war in Maske und Spiel ganz vortrefflich. – Die Trägerin der Titelrolle, Frl. Hoheneck, sah als herabgekommene Dirne viel zu proper aus. Warum sich die Dame keine Maske machte, ist unerklärlich. Schließlich sieht doch die Jungfrau von Orleans anders aus, als eine verlotterte Bauerntrude! Gespielt hat Frl. Hoheneck ganz gut, wenn ihr auch der Dialekt viele Schwierigkeiten machte. Das gleiche gilt von Herrn Loebell, der österreichisch statt oberbayerisch sprach, im übrigen aber ganz gut spielte. Herr Pötsch sächselte als Bauer Plank vergnügt darauf los. Das mäßig besetzte Haus applaudierte lebhaft. RNN 23/352 29.11.1912 35 53 Gyges und sein Ring Eine Tragödie in 5 Akten von Friedrich Hebbel 5 10 15 20 25 30 35 Hebbel selbst berichtet über die Entstehungsgeschichte des Gyges. „Mich reizte“, schrieb er, „nur die Anekdote, die mir, etwas modifiziert, außerordentlich für die tragische Form geeignet schien, und nun das Stück fertig ist, steigt plötzlich zu meiner eigenen Überraschung, wie eine Insel aus dem Ozean die Idee der Sitte als die alles bedingende und bindende daraus hervor. Ich gestehe, daß ich dies kaum begreifen kann, es bestärkt mich aber nur um so mehr in meiner freilich längst gehegten Überzeugung, daß der Künstler, wenn er von einem Gegenstand mächtig ergriffen wird, sich um den Gehalt desselben gar nicht ängstlich zu kümmern braucht, sondern daß dieser ganz von selbst hinzutritt, wie der Saft in die Bäume, vorausgesetzt allerdings, daß er ihn in der Brust trägt.“ „Gyges und sein Ring“ ist wohl die neuestete und köstlichste Gabe unter allen Gaben Hebbels. Kein Wunder also, daß es vieler Jahrzehnte bedurfte, bis man das Genie begriff, dem dieser kolossale Wurf gelungen, voll des reinsten menschlichen und künstlerischen Gehalts. Als man Grillparzer das Drama zum erstenmal vorgelesen hatte, sagte er sinnend vor sich hin: “Wie ist das filtriert! wie ist das filtriert!“ Schärfer könnte man das Wesen dieser Tragödie nicht erfassen. Die Handlung spielt sich in zweimal vierundzwanzig Stunden ab. Der erste Akt führt vom Morgen vor den Festspielen bis in die schwüle Abendstunde, in die die festliche Erregung des Volkes hereinklingt und die das frevelhafte Vorhaben gebiert. Der nächste Morgen findet Gyges in Unruhe und Fieber, und der junge Tag ist gerade recht, um hinaus zu ziehen in die Welt. Aber als der Tag vergangen ist, und Gyges vor Rhodopen gestanden hat, treten sich in der Dämmerung die Freunde mit dem Schwert gegenüber und der Abend sieht von düsteren Fackeln erhellt Vermählung und Tod in einem. In dieser raschen Aufeinanderfolge der Tatsachen hat Hebbel eine Geschlossenheit, eine künstlerische Harmonie und Schönheit erreicht, wie in keinem anderen seiner anderen Werke. Und bei dieser klaren Gliederung des schlanken Baues der Handlung, gibt es in der Tragödie seelische Verkettungen, Windungen, Zwischenstufen, und Lichtbrechungen, gegen die alle späteren Objekte und Subjekte einer dramatischen Analyse grob anmuten. Kandaules, ein königlicher Mann, in Glanz und Fülle seiner Lebenskraft, der nur in der Berührung mit einer höheren Kultur in ein leises Schwanken gerät, Rhodope, ein blumenhaftes Wesen, „wie aus lauter Schleiern gewebt“ 54 5 10 15 20 – und zwischen Mann und Weib tritt der Jüngling, Gyges, von feuriger Anmut, in dessen geistigen und körperlichen Adel der ganze Reichtum griechischer Kultur zusammen geschmolzen ist. Reifste Kunst spinnt die Fäden des Schicksals aus den Seelen dieser drei Menschen hervor. In seinem Motto sagt Hebbel selbst: Einen Regenbogen, der minder grell, als die Sonne, strahlt in gedämpftem Licht, spannte ich über das Bild. Aber er sollte nur funkeln und nimmer als Brücke dem Schicksal Dienen, denn dieses entsteigt einzig der menschlichen Brust. Herr Kalkum stellte einen vorbildlichen Gyges hin. Er zeichnete ihn mit seiner Kunst, die Gestalt des Griechen wuchs unter seiner Darstellung von Szene zu Szene zu immer erschüttenderer Wucht adligen Menschentums. Der Kandaules des Herrn Mohr war manchmal zu wenig der ragende, helläugige König, mit dem Lächeln der Güte um die Lippen, hatte aber Momente, in denen er durch natürliche Menschlichkeit wirkte. Frl. Hoheneck als Rhodope war provinzmäßig gut, Frl. Braun, die die Hero mimte, hatte in Spiel und Ton etwas operettenhaftes, das für den Stil Hebbels am allerwenigsten paßt. Das schlecht besetzte Haus hielt mit seinem ehrlichem Beifall nicht zurück. RNN 23 / 345 19.12.1912 25 55 Die Jungfrau von Orleans Eine romantische Tragödie in 5 Akten von Fr. Schiller 5 10 15 Vor erschreckend leerem Haus ging am Samstag-Abend die Wiederholung von Schillers romantischer Tragödie in Szene. Der Aufführung mangelte es an Schwung und innerer Geschlossenheit. Frl. Hoheneck gab diesmal die gottgesendete Jungfrau. Ihr Organ konnte den Ansprüchen der Rolle nicht gerecht werden, das Spiel war zwar verhältnismäßig frisch und natürlich, doch fehlte der ganzen Auffassung die große Linie. Eine Operettenrüstung, wie Frl. Hoheneck sie trug, wird die Jeanne d’Arc sicher nie an den Leib gebracht haben. – Mißliche Zufälle und Nachlässigkeiten, die die ganze Aufführung beeinträchtigten, erregten die geziemende Heiterkeit des Publikums. Der grimme Talbot mußte sein sterbendes Haupt auf den zu Boden gefallenen Helmbusch von König Karl betten. Und als er tot war, fehlte es dem französischen Heer an Soldaten, die seine Leiche fortgeschafft hätten. So mußten ihn denn Frankreichs Heerführer von der Bühne schleppen, was den toten Talbot noch so entsetzte, daß er seine – Perrücke – verlor. Und solcher Dinge passierten mehr. RNN 23/321 25.12.1912 20 56 Der Retter in der Not Lustspiel in 3 Akten von Franz v. Schönthan und Rudolf Presber. 5 10 15 20 25 30 35 Wenn man nicht wüßte, daß das Lustspiel neusten Datums ist, könnte man glauben, es stamme aus den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, so antiquiert und verstaubt wirkt das Stück, das mit den urältesten Posserequisiten arbeitet. Lauter wohlbekannte Typen begegnen uns: Der gestrenge Schulrat, der devote, katzbuckelnde Direktor, die philiströsen, vertrockneten Professoren, der hyperelegante Weinreisende, der joviale Kammerherr und ein Fräulein Mama aus Wien. Mit wenig Witz und viel Behagen agieren die Verfasser mit ihren Puppen auf der Bühne. Nachdem es anfangs den Anschein hat, als wollten sie etwas tiefer schürfen – Ansätze zu einer Satire auf das humanistische Gymnasium im Stile Otto Ernst’s sind vorhanden – verfallen sie bald in die alten Lustspielplattheiten und erreichen nach den langatmigen ersten zwei Akten mit einer ebenso kühn als unmotiviert herbeigeführten Wendung der Dinge den unbedingt notwendigen „guten Ausgang“. Das Ganze wäre noch unerfreulicher, wenn nicht, leider allzu selten, manchmal der Presberische Witz zu spüren wäre, scharf glossierend, beißend zuweilen, stets fest zupackend. Eins kann man mit Sicherheit voraussagen: Für unser Stadttheater wird das Lustspielchen auf keinen Fall den Retter in der Not bilden, es wird kein Schlager werden, der längere Zeit das Repertoire beherrschen und gefüllte Kassen bringen wird. Die beste Leistung des Abends bot Frl. Hoheneck als Baronin Lindenhain. Sie charakterisierte das oberflächliche, kecke, leichtsinnig-dumme und dabei gutmütige, geadelte Vorstadtmädel ausgezeichnet. Ihrer abgerundeten Leistung kam auch zu gute, daß die Dame den „weanerischen“ Dialekt vollkommen beherrscht. Hr. Benthien als Kammerherr Wallböck war elegant und sicher. Enttäuscht hat der Koppelmann des Herrn v. Pidoll, der sich sichtlich keine Mühe gab, diese „Wurz‘n“ (die gar keine so ausgesprochene ist) annehmbar hinzulegen. Herr Oesterreicher als Martius hatte eine sehr gelungene Maske, aber als einziges Charakterisierungsmittel ist das doch zu wenig. Das mäßig besetzte Haus applaudierte lebhaft. RNN 23/352 28.12.1912 57 Clavigo Trauerspiel von Wolfgang von Goethe 5 10 15 20 25 Goethe schrieb den „Clavigo“ im Mai 1774 Im Verlauf einer einzigen Woche. Er selbst bezeichnete das Stück als „moderne Anekdote dramatisiert – mein Held ein unbestimmter, halb groß halb kleiner Mensch, der Pendant zu Weißlingen“. Der strenge Merck urteilte: „Solchen Quark mußt du künftig nicht mehr schreiben, das können die anderen auch“. Goethe verteidigte sich später gegen diesen Vorwurf: „Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen“. Er meinte damit, daß er auch einmal einfach ein Theaterstück habe schreiben wollen, an das man nicht den allerhöchsten Maßstab ansetzen dürfe. Herr Strien spielte den Clavigo, brachte aber außer Temperament nicht viel für ihn mit. Die Figur, vom Dichter schon verschwommen gezeichnet, gewann in seiner Darstellung kein Leben. Den Carlos gab Ernst von Possart. Mit genialer Charakterisierungskunst arbeitete er eine Gestalt heraus, die bis in die feinsten Einzelzüge wohl durchdacht war. Da war kein Virtuosentum, keine Effekthascherei: einfach, großzügig und eben darum wirkungsvoll war diese Leistung. Ganz ausgezeichnet war Herr Kalkum als Beaumarchais, der seine Erzählung im 2. Akt mit eindrucksvoller Steigerung brachte. Neben Possart verzeichnete der Theaterzettel noch einen Gast: ein Frl. Herting. Die Dame spielte als Marie auf Engagement. Ihre Leistung war ein Attentat auf den guten Geschmack in künstlerischen Dingen, der bei der Gastin offenbar sehr wenig ausgeprägt ist. Ich glaube nicht, daß es möglich ist, die Marie Beaumarchais schlechter zu spielen als Frl. Herting es tat. Den zweiten Teil des Abends bildete eine Aufführung des Mollier´schen Lustspiels »Gelehrte Frauen«. RNN 24/2 3.1.1913 58 Gelehrte Frauen Komödie von J.P. Molière 5 10 15 20 Die Tragik in Molières dichterischer Tätigkeit war, daß er nie die volle Wahrheit sagen durfte. Das umgibt seine größten Komödien mit einem Hauche tiefer Schwermut und erinnert mehr an das ernste Drama als an das Lustspiel. Er, dem die Wahrheit über alles ging, der in seinen Stücken die Lüge in jeder Verkleidung, in jedem Alter, jedem Stand bekämpfte und lächerlich machte, er mußte immer höfische Rücksichten nehmen, möglichst Anstoß vermeiden. Das ließ sich natürlich nur schwer vereinen und dieser Zwiespalt machte den scheinbar lustigsten zu dem im Grunde seines Herzens trübsinnigsten Franzosen seiner Zeit. Molière, der Ibsen (mit seinem Kampf gegen die „Lebenslüge“) für das Frankreich des 17. Jahrhunderts, konnte in seinen Werken nie das letzte Wort sagen. So endigen alle seine Stücke mit einer unerklärlichen großen Freude und entlassen uns mit dem Eindruck: In Molières Seele lebte ein ganz anderer letzter Akt. In den "Gelehrten Frauen" setzt Molière den Blaustrümpfen arg zu und manches seiner Worte hat heute noch Kurswert. Ganz köstlich war Ernst von Possart als Chrysale. Mit seinem Humor, nie übertreibend, stellte er diesen herzensguten, etwas phlegmatischen Pantoffelhelden hin. Man hatte seine helle Freude an dieser liebenswürdigen Gestalt. Neben Possart hielt sich nur Herr von Pidoll als Trissotin, die übrigen Darsteller fielen alle mehr oder minder stark ab. RNN 24/2 3.1.1913 25 59 Das Glück im Winkel Schauspiel in 3 Akten von Sudermann 5 10 15 In der gestrigen Wiederholung von „Glück im Winkel“ spielte Herr Kalkum den Röcknitz. Hatte der Gast, der bei der ersten Aufführung diese Rolle gab, den kraftstrotzenden Herrenmenschen mehr als brutale Stallknechtsnatur gezeichnet und auch in der Maske so ausgestattet, so spielte ihn Kalkum mehr als eleganten Gesellschafter, der eine rücksichtslose, vor nichts zurückschreckende Energie hinter einer jovialen Außenseite verbirgt. Diese Auffassung ist die zweifellos richtigere. Der Leistung des tüchtigen Darstellers, der in Ton und Geberden lebensecht wirkte, schadete nur eine manchmal überhastende Sprechweise, durch die manches feine Wort nicht zur Geltung kam. - - Die ganze Aufführung hatte gegenüber der ersten an Plastik und Eindringlichkeit gewonnen, die einzelnen Spieler boten fast durchwegs Gutes, waren sicherer im Zusammenspiel. Das schlecht besetzte Haus dankte mit reichem Beifall RNN 24/13 15.1.1913 60 Die Liebe wacht Lustspiel in 4 Akten von G.A. Cailaret und Robert de Flers. 5 10 15 20 25 Es steckt eine tiefe Lebensweisheit in dem Satz, dessen Richtigkeit die Autoren in einem gar liebenswürdigen Exempel dartun. L’amour veille: eine wahre, große Neigung bewahrt junges, heißes, unerfahrenes Blut vor Ausflügen in das Gebiet der allzu irdischen Liebe, die gewöhnlich mit einer grausamen Ernüchterung enden. Drum kann man dem Erziehungsprinzip des alten, leichtsinnigen Lebenmanns Carteret nur beipflichten, wenn man sich auch der Meinung nicht entschlagen kann, daß bei seiner Pädagogig – Faulheit mit die Hauptrolle spielt. Die zwei geistreichen Franzosen wissen in ihrem Lustspiel viele Schlüpfrigkeiten und Unanständigkeiten mit Anstand und Grazie zu sagen. Manch feine Lebensbeobachtung, manch treffender Aphorismus erfreut. Die Figur des tolpatschigen, aber herzensguten Vernet ist mit feinen Strichen gezeichnet. Den Verfassern ist da eine Gestalt gelungen, die in all ihrer Lächerlichkeit rührend und ergreifend wirkt. Die Aufführung, die das Stück gestern Abend fand, besaß nicht den feinen Lustspielton, der erforderlich ist, um die leise Grazie des Lustspiels zur vollen Wirkung kommen zu lassen. Das Ganze wurde zu schwankmäßig, zu possenhaft heruntergespielt. Man hatte den Eindruck, daß da die Spielleitung (Herr Benthien) mildernd, dämpfend hätte eingreifen sollen. Herr Gemeier gab den unglücklichen August Vernet. Die Leistung hatte gute Momente, war aber im ganzen zu derb hingestellt. Die Jacqueline spielte Frl. Braun, ansprechend und nett. Aber auch sie tat manchmal des Guten zuviel. Das schlecht besetzte Haus applaudierte lebhaft. RNN 24/15 17.1.1913 61 Othello Trauerspiel in fünf Aufzügen von W. Shakespeare 5 10 15 20 25 30 Aus einem an und für sich mehr als dürftigen Stoff hat Shakespeare in seinem „Othello“ ein Drama voll erschütternder Wucht gestaltet, ein Seelengemälde, das die ergreifendsten, die tiefsten und geheimsten Regungen des Menschenherzens offenbart. Eine ursprünglich edle Natur wird durch die kalt berechnende Bosheit eines von Neid erfüllten Schurken jammervoll zerstört und zu Grunde gerichtet: mit so lebendiger Kraft ist das geschildert, so unsäglich traurig, und niederdrückend wirkt das, daß die Tragik zur grausamen Marter wird. Wie der kraftvolle und hochgemute Mohr, dem Jago mit systematischer Berechnung Gifttropfen um Gifttropfen in die Seele träufelt, der Eifersucht, dem „grüngeäugten Scheusal“ immer mehr Raum in seinem offenen und ehrlichen Herzen gewährt, wie er sich anfänglich in aussichtslosem Kampf wehrt gegen den unheimlichen Gegner, wie er unterliegt, und die gräßliche Tat, den Mord an Desdemona, begeht: in erschütternder Steigerung arbeitete Herr Kalkum das heraus. Er zeichnete eine Gestalt, die in der Schlußszene zu monumentaler Größe emporwuchs. Es war eine Leistung, die nicht überboten werden kann, die man an Provinztheatern nur selten zu sehen bekommt. – Herr von Pidoll als Jago war brav, aber in keiner Weise hervorragend. – Als Desdemona gastierte ein Fräulein Margarete Tarau auf Engagement. „Ännchen von Tharau ists, die mir gefällt“, heißt es im Liede. Ihre Namensschwester Margarete gefällt mir weniger. Die Dame war unerträglich süß. – Herr Pötsch als Doge von Venedig war von einer gemütlichen Behäbigkeit, die auf seine Rolle paßte, wie die Faust aufs Auge. Die Regie des Herrn Benthien schuf gute und stimmungsvolle Bühnenbilder. Nur der Sitzungssaal der Senatoren war von bemerkenswerter Nüchternheit, die erkältend wirkte. Die Herren Senatoren selbst sahen wie Grünzeughändler und nicht wie reiche Kaufherren aus. Dafür spielten sie schlecht. Das ziemlich gut besetzte Haus bereitete Herrn Kalkum stürmische Ovation RNN 14/25 27.1.1913 62 Robert und Bertram Posse mit Gesängen und Tänzen von Gustav Räder. 5 10 15 20 25 „Die lustigen Vagabunden“ heißt der Untertitel des Stückes, das trotz seiner mehr als fünfzig Jahre – ein ganz respektables Alter für eine Posse – nur wenig an Frische und Durchschlagskraft verloren hat. Spitzbuben – und Landstreicherhumor (ein naher Verwandter des Galgenhumors), der auch Lumpacivagabundus so unverwüstlich macht, entfaltet in dem Werkchen seine schönsten Blüten. Tolle Übertreibungen und eine Häufung von Unmöglichkeiten kommen in dem Stück vor: Dafür gehört es bestimmungsgemäß nur im Fasching aufgeführt. Faschingsdienstag 1856 erlebte es im Hoftheater zu Dresden seine Uraufführung und seitdem ist es über die meisten Bühnen gezogen. Das Stück steht und fällt mit der Darstellung des sauberen Lumpenpaares Robert und Bertram. Die beiden frechen Vagabunden, denen man trotz ihres bedenklich getrübten Leumundes nicht gram sein kann, wurden gestern von den Herren Loebell und Gemeier gespielt. Mit wahrhaft erschütternder Komik. Besonders Herr Loebell, der sich diesmal mit Glück von allzugroben Übertreibungen fern hielt, bot ein wahres Kabinettstückchen und schwelgte in den unglaublichsten Kalauern. Von den übrigen zahlreichen Mitspielenden seien erwähnt Herr von Pidoll, der als Spelmeier fein charakterisierte, und Herr Mack, der als Diener Jack gut jüdelte und schlechte Knittelverse vortrug. Herr Linbrunner als Strambach und Herr Hesse als Michel waren ganz wacker. In den Konzerteinlagen in der dritten Abteilung erfreuten Frl. Ney und die Herren Voß und Schaum durch Wiedergabe von einigen Liedern, die großen Beifall fanden. Das Haus war sehr gut besetzt und befand sich in übermütiger Karnevalslaune. RNN 24/34 5.2.1913 30 63 Die Zarin Schauspiel in 3 Akten von Melchior Lengyel und Ludwig Biro. 5 10 15 20 25 30 35 Das Stück ist mit einer ganz raffinierten Ausnützung aller Theaterwirkungen geschrieben, die Autoren wissen – wie alle modernen ungarischen Dramatiker – ganz genau, wie man „arbeiten“ muß, um packende Bühneneffekte zu erzielen. Was sie bieten ist reines, ausschließliches „Theater“ – aber gutes Theater. Mit einem, ein ganz kleinwenig boshaften, Lächeln, nennen sie das Motiv, das sie behandeln, „ein spezifisch russisches Problem“. Es ist das Problem, gewisse rein persönliche und menschliche Gefühle des Monarchen oder der Monarchin auf geeignete Weise zu ihrem Rechte kommen zu lassen, damit dann diese hohe Persönlichkeit, wenn ihre Unterströmungen Ableitung gefunden haben, sich mit ganzer Kraft den Staatsaufgaben widmen kann. Katharina II. von Rußland (ihre Büste thront in der Walhalla), war eine Frau von hervorragenden, ja genialen staatsmännischen Fähigkeiten. Aber ebenso bekannt wie wegen ihrer vorzüglichen Herrschereigenschaften ist sie wegen ihrer mehr als zahlreichen Liaisons und flüchtigen Amouren. Wie sie als Regentin auf schwierigem Posten tapfer wie ein Mann aushielt und kaltblütig viele und viele Anschläge mit einem Gleichmut, wie ihn selten Männer zeigen, aufdeckte und unschädlich machte – so zeigte sie auch im Verkehr mit dem anderen Geschlecht mehr männliche Eigenschaften: sie war nicht das zärtliche, anschmiegende, nachgiebige Weib sondern der stürmische, erobernde, ja heftige Mann. Einen Ausschnitt aus dem Leben dieser merkwürdigen Frau, eine kurze, schnell vorübergehende Episode, ist das Stück, in dem „bloß“ von vier Liebhabern der Kaiserin die Rede ist. Die Zarin spielte Frl. Hoheneck. Wenn ihr auch manchmal der metallene Ton, die eherne Art der Katharina fehlte, so hatte sie doch viele gute Momente und wußte besonders in den Liebesszenen zu überzeugen. Die beste Leistung des Abends bot Herr von Pidoll als Kanzler, der den feinen und liebenswürdigen, dabei energischen und gescheiten Diplomaten ganz köstlich hinstellte. Herr Strien als Alexei war gut, Frl. Braun als Amme verdient die gleiche Wertung. Den französischen Gesandten spielte Herr Kalkum mit Eleganz und sicherer Ruhe. 64 Die Aufführung, die zu den wenigen guten des Jahres gehört, war von Herrn Benthien einstudiert. Das Haus war gut besetzt und sehr beifallsfreudig. RNN 24/37 8.2.1913 5 65 Des Meeres und der Liebe Wellen Trauerspiel in fünf Aufzügen von Franz Grillparzer 5 10 15 20 25 30 Es ist für die reife und abgeklärte Kunst Grillparzers bezeichnend, daß er weder für sich noch in seinen Werken eine Sturm- und Drang Periode kennt. Er scheute den Kampf im Leben wie im Dichten. Er ist der Dichter der Ruhe, der beharrenden Gewalten, nie der treibenden Kräfte. Das höchste ist ihm die Wahrung aller Gesetze. Trotz dieser Scheu vor allen starken Umwälzungen fehlt es Grillparzer nicht an Leidenschaft. Aber ebenso groß wie seine Leidenschaft war seine Kraft der Selbstbeherrschung, die bis zur Selbstverleugnung ging. Er weiß: über die Leidenschaftlichen siegen die Klugen und Verständigen. Die Liebe, die sich über alle Schranken hinwegsetzt, um zu ihrem Ziel zu gelangen, muß auch an der Nichtachtung alles außer ihr Liegenden zu Grunde gehen. Hier hat Grillparzer uns sein Schönstes gegeben. In »Des Meeres und der Liebe Wellen« schenkte er der Deutschen Literatur ihre herrlichste Liebestragödie. Die Hero und Leander-Sage ist wohl nie mehr so stimmungsvoll gestaltet worden, wie in diesem Werke, in dem deutlich zum Ausdruck kommt, wie innerlich die Dramatik Grillparzers ist. Sie beruht viel mehr in der Entwicklung des Empfindens als des Geschehens. Vor leerem Hause gab man am Samstag die Tragödie. Frl. Hoheneck spielte die Hero. Sie war brav, recht brav, aber auch nicht im geringsten mehr. Es fehlte der Leistung an Innerlichkeit und stolzer Keuschheit. Gut war Herr Strien als Leander und ausgezeichnet Herr Kalkum als Naukleros. Er sprach seine Verse wunderbar flüssig und spielte ruhig und überlegen. Dem Oberpriester des Herrn Mohr hätte man mehr Natürlichkeit und ruhige Wucht gewünscht. Die wenigen Besucher gaben ihrem Beifall durch kräftiges Applausieren Ausdruck. RNN 24/53 24.2.1913 66 Hinter Mauern Schauspiel in 4 Akten von Henry Nathansen 5 10 15 20 25 30 35 Von dem feinsten dänischen Poeten, Jacobsen, hat Theodor Wolff einmal gesagt, er hätte Duft und Klang der seltsamen Natur seines Landes mit allen Nerven seines Körpers erfaßt. Von dieser reizbaren, feinfühligen dänischen Poetennatur hat Nathansen nur sehr wenig in sich. Er ist in seinem Stück weniger Däne, als vielmehr in erster Linie Jude. Bewußt oder unbewußt hütet er sich dabei, das eigentlich jüdische Problem, das Rasseproblem (das in letzter Zeit von den führenden Geistern Europas wieder besonders eindringlich erörtert wird), den Unterschied zwischen arischem und semitischem Volkstum, zu behandeln. Nathansen schiebt das Konfessionelle in den Vordergrund. Wenn die aufgeklärte Esther, die dem Glauben ihrer Väter nicht mehr anhängt, Kulturvorlesungen besucht, und sich mit dem Kulturbringer verlobt, völlig aus dem Gleichgewicht gerät, als ihr christliche Trauung und eine Taufe ihrer zukünftigen Kinder in der christlichen Kirche zugemutet wird – so heißt das das Problem entschieden schief anpacken. Man agiert nicht tragisch um Äußerlichkeiten! (Denn für die aufgeklärte Esther sind das doch Äußerlichkeiten.) Was kann die Form einer Esther bedeuten, die das jüdische Familienleben muffig findet und sich schroff auf ihren „Kulturstandpunkt“ stellt. Wenn ihr Vater, der intolerante, orthodoxe Jude, über die Christengemeinschaft seiner Tochter und die „Schurkerei“ der Christen zetert, so liegt darin etwas Natürliches, Begreifliches. Bei Esther wirkt dies Festhalten an Gebräuchen, die sich doch für sie überlebt haben, sonderbar unkonsequent, fast ärgerlich. Es müßte denn sein, daß Nathansen sagen wollte, daß am Ende selbst im „befreiten“ Juden etwas „hinter Mauern“ bleibt! Dann müßte aber das ganze Stück anders angelegt, dürfte nicht einseitig auf das konfessionelle Gebiet verschoben sein. „Hinter Mauern“ ist ein Tendenzstück, das als solches keine ernsten künstlerischen Qualitäten besitzt. Gestalter wird Nathansen erst, wenn er über der Illustration des religiösen Konflikts die Rassenkonflikte behandelt und in guter Milieustudie sich mit dem Charakteristischen der Judennatur befaßt. Er bietet dann eine Art Heimatkunst. Etwas in die Breite gehend zwar, aber in der feinen Beobachtung des Details und Erfassen ..serer Züge von künstlerischem Blick und Ehrlichkeit. Herr von Pidoll spielte den alten Levin mit patriarchalischer Würde und überaus warmherziger, pathetischer Menschlichkeit. Frl. Bille als seine Frau hatte Güte und Milde. Das etatsrätliche Ehepaar wurde durch Frau Lau67 5 schek und Herrn Mohr gut dargestellt. Erwähnung verdient auch Herr Strien, der sich eine vortreffliche Maske gemacht hatte. Die von Herrn Benthien geleitete Inszenierung ging den Absichten des Dichters liebevoll nach und stellte die warme Gemütlichkeit des jüdischen Heims in auffälligen Kontrast zur steifen Nüchternheit des christlichen Hauses. Das schlecht besetzte Haus kargte nicht mit Beifall. RNN 24/61 4.3.1913 10 68 Judith Eine Tragödie in fünf Aufzügen von Friedrich Hebbel 5 10 15 20 25 30 35 Hundert Jahre sind es in diesen Tagen, daß in Wesselburen im Dithmarschen einem armen Teufel von Maurer, und seiner Frau Antje, ein Sohn geboren wurde, der auf den Namen Friedrich Hebbel getauft wurde. Und der dann eben das Leben eines Proletarierkindes lebte: in einer ärmlichen Küche wohnte und spielte, in einer feuchten und dunklen Schlafkammer mit den Eltern zusammen schlief und früh hinaus mußte, um dem Vater auf dem Bau beim Ziegelfahren und Kalkrühren zu helfen. Und aus diesem armen Jungen wurde ein großer Dichter, trotz der Entbehrungen, die sein Leben begleiteten und verbitterten, die er so lange nicht abschütteln konnte. Die Versuchung liegt nahe, im Eifer einer Jahrhundertfeier einem Dichter mehr zu geben als des Dichters ist. Bei Hebbel braucht man diese Gefahr kaum zu befürchten. Viel zu wenig Freunde haben nicht nur seine einzelnen Werke gefunden: viel zu wenig weiß man bei uns auch, ein wie glühender, allumfassender Geist, ein wie tiefgründiger unerschrockener Denker er war. Und noch etwas: er war einer von den letzten, die mit beiden Armen noch die ganze Welt umspannen wollten, einer von den letzten universalen Geistern in einer Zeit, die auch die Dichter zur Spezialisierung und Arbeitsteilung treibt. Unser Stadttheater brachte gestern als Hebbelfeier eine »Judith«-Vorstellung heraus, die gut und abgerundet war. Wie der Dichter selbst »Judith«, sein geniales Jugendwerk aufgefaßt haben will, zeigt sein Brief an Madame Stich: “Judith und Holofernes sind, obgleich, wenn ich meine Aufgabe löste, wahre Individualitäten, dennoch zugleich die Repräsentanten ihrer Völker. Judith ist der schwindelnde Gipfelpunkt des Judentums, jenes Volkes, welches mit der Gottheit selbst in persönlicher Beziehung zu stehen glaubte; Holofernes ist das sich überstürzende Heidentum, er faßt in seiner Kraftfülle die letzten Ideen der Geschichte, die Idee der aus dem Schoß der Menschheit zu gebärenden Gottheit, aber er legt seinen Gedanken eine demiurgische Macht bei, er glaubt zu sein, was er denkt. Judentum und Heidentum aber sind wiederum nur Repräsentanten der von Anbeginn in einem unauslösbaren Dualismus gespaltenen Menschheit, und so hat der Kampf, in dem die Elemente meiner Tragödie sich gegenseitig aneinander zerreiben, die höchste symbolische Bedeutung, obwohl er von der Leidenschaft entzündet und durch die Wallungen des Bluts und die Verirrungen der Sinne zu Ende gebracht wird.” 69 5 10 15 20 Die Aufführung des Werkes an unserer Bühne verdient vortrefflich genannt zu werden, vor allem deshalb schon, weil die zwei Hauptrollen des Stückes so ausgezeichnet besetzt waren. Frl. Magda Lena spielte die Judith. Die Künstlerin, von ihrem Engagement an unserem Stadttheater her noch in bester Erinnerung, ist sicher ein Talent, eine künstlerische Individualität, besitzt Eigenart und starkes Können. Es ist erstaunlich, was sie in den zwei Jahren, seit sie von hier fort ist, gelernt hat. Trotz ihres spröden Materials weiß sie volle und starke Wirkungen zu erzielen. Ihre Judith, die vielleicht etwas großliniger hätte angelegt sein dürfen, hatte Kraft und Temperament und vermochte zu überzeugen. Den Holofernes spielte Herr Kalkum. Er brachte für die Rolle eine imposante Figur und mächtige Stimmittel mit und stellte einen Holofernes auf die Bühne, der Wucht und Größe besaß. Seine Schlußszene im 5. Akt arbeitete er in gewaltiger Steigerung heraus, er bot da reine Kunst, die packte und erschütterte. Als Daniel bot Herr von Pidoll eine Glanzleistung von trefflicher Charakterisierung. Die vielen kleinen Rollen des Stückes waren gut besetzt. Erwähnung verdienen besonders Herr Mohr als Achiore Herr Mack als Assod und Herr Strien als Ephraim. Das sehr gut besetzte Haus war beifallsfreudig und applaudierte lebhaft. Frl. Lena wurde mit vielen Blumengaben ausgezeichnet. RNN 27/76 19.3.1913 weiter. hier klicken 70