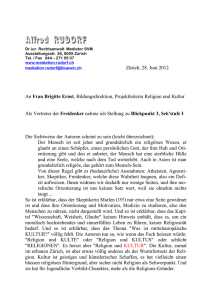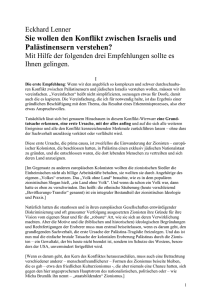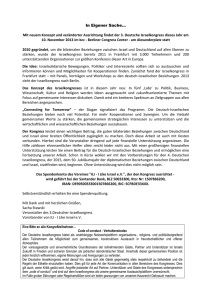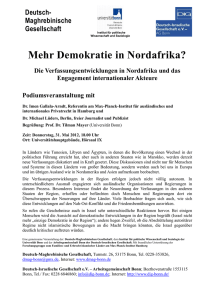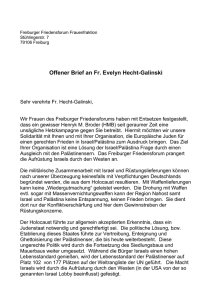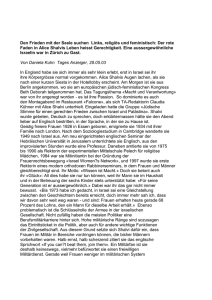Zwei Geiger aus Osteuropa – Bronislaw Huberman und Emil Hauser
Werbung
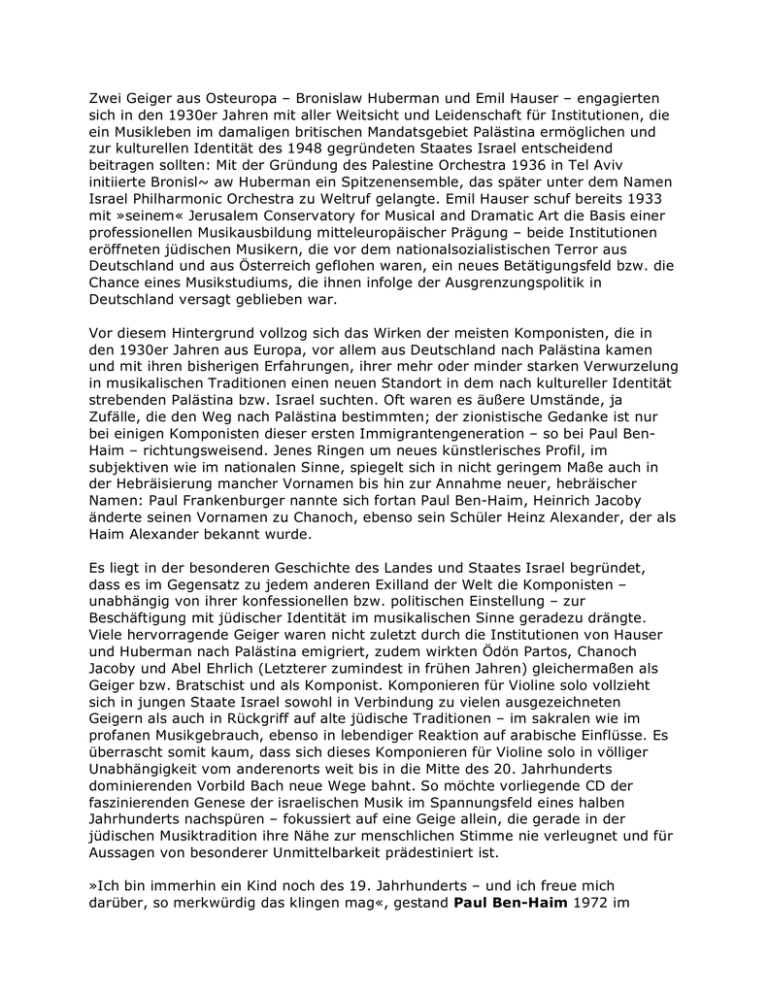
Zwei Geiger aus Osteuropa – Bronislaw Huberman und Emil Hauser – engagierten sich in den 1930er Jahren mit aller Weitsicht und Leidenschaft für Institutionen, die ein Musikleben im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina ermöglichen und zur kulturellen Identität des 1948 gegründeten Staates Israel entscheidend beitragen sollten: Mit der Gründung des Palestine Orchestra 1936 in Tel Aviv initiierte Bronisl~ aw Huberman ein Spitzenensemble, das später unter dem Namen Israel Philharmonic Orchestra zu Weltruf gelangte. Emil Hauser schuf bereits 1933 mit »seinem« Jerusalem Conservatory for Musical and Dramatic Art die Basis einer professionellen Musikausbildung mitteleuropäischer Prägung – beide Institutionen eröffneten jüdischen Musikern, die vor dem nationalsozialistischen Terror aus Deutschland und aus Österreich geflohen waren, ein neues Betätigungsfeld bzw. die Chance eines Musikstudiums, die ihnen infolge der Ausgrenzungspolitik in Deutschland versagt geblieben war. Vor diesem Hintergrund vollzog sich das Wirken der meisten Komponisten, die in den 1930er Jahren aus Europa, vor allem aus Deutschland nach Palästina kamen und mit ihren bisherigen Erfahrungen, ihrer mehr oder minder starken Verwurzelung in musikalischen Traditionen einen neuen Standort in dem nach kultureller Identität strebenden Palästina bzw. Israel suchten. Oft waren es äußere Umstände, ja Zufälle, die den Weg nach Palästina bestimmten; der zionistische Gedanke ist nur bei einigen Komponisten dieser ersten Immigrantengeneration – so bei Paul BenHaim – richtungsweisend. Jenes Ringen um neues künstlerisches Profil, im subjektiven wie im nationalen Sinne, spiegelt sich in nicht geringem Maße auch in der Hebräisierung mancher Vornamen bis hin zur Annahme neuer, hebräischer Namen: Paul Frankenburger nannte sich fortan Paul Ben-Haim, Heinrich Jacoby änderte seinen Vornamen zu Chanoch, ebenso sein Schüler Heinz Alexander, der als Haim Alexander bekannt wurde. Es liegt in der besonderen Geschichte des Landes und Staates Israel begründet, dass es im Gegensatz zu jedem anderen Exilland der Welt die Komponisten – unabhängig von ihrer konfessionellen bzw. politischen Einstellung – zur Beschäftigung mit jüdischer Identität im musikalischen Sinne geradezu drängte. Viele hervorragende Geiger waren nicht zuletzt durch die Institutionen von Hauser und Huberman nach Palästina emigriert, zudem wirkten Ödön Partos, Chanoch Jacoby und Abel Ehrlich (Letzterer zumindest in frühen Jahren) gleichermaßen als Geiger bzw. Bratschist und als Komponist. Komponieren für Violine solo vollzieht sich in jungen Staate Israel sowohl in Verbindung zu vielen ausgezeichneten Geigern als auch in Rückgriff auf alte jüdische Traditionen – im sakralen wie im profanen Musikgebrauch, ebenso in lebendiger Reaktion auf arabische Einflüsse. Es überrascht somit kaum, dass sich dieses Komponieren für Violine solo in völliger Unabhängigkeit vom anderenorts weit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts dominierenden Vorbild Bach neue Wege bahnt. So möchte vorliegende CD der faszinierenden Genese der israelischen Musik im Spannungsfeld eines halben Jahrhunderts nachspüren – fokussiert auf eine Geige allein, die gerade in der jüdischen Musiktradition ihre Nähe zur menschlichen Stimme nie verleugnet und für Aussagen von besonderer Unmittelbarkeit prädestiniert ist. »Ich bin immerhin ein Kind noch des 19. Jahrhunderts – und ich freue mich darüber, so merkwürdig das klingen mag«, gestand Paul Ben-Haim 1972 im Interview mit dem Schweizer Musikredakteur Walter Kläy; ergänzend kommentierte er: »...ich stamme noch aus prähistorischer Zeit!« Jene »prähistorische Zeit« deutet auf ein längst abgeschlossenes, durch das Jahr 1933 jäh beendetes Kapitel seiner Biographie: Geboren als Paul Frankenburger am 5. Juli 1897 in München, erhielt Paul Ben-Haim – wie er sich unmittelbar seit seiner Flucht nach Palästina im Mai 1933 eine neue Identität gab – seine kompositorische Ausbildung bei dem BrucknerSchüler Friedrich Klose und wuchs somit in spätromantischer Tradition auf. Heinrich Schalit, in den 1920er Jahren einer der bedeutendsten Reformatoren jüdischer Sakralmusik in Deutschland, überzeugte seinen jüngeren Komponisten-Kollegen bereits früh »von der Notwendigkeit, seine Begabung den Gestirnen und Inspirationen der jüdischen Welt hinzugeben «, wie es Max Brod in poetischen Worten umreißt. So fand Paul Ben-Haim unter dem Einfluss der jemenitischen Sängerin Bracha Zefira, als deren Klavierbegleiter er viele Jahre fungierte, zu einem folkloristisch geprägten Stil dem so genannten Mittelmeerstil, der Spuren von Gesängen jemenitischer, persischer, sephardischer bzw. türkischer Juden mit orientalischem Kolorit verbindet. In der 1951 für Yehudi Menuhin geschriebenen Sonate in G kontrastieren kurzgliedrige, obsessiv insistierende Bewegungsmuster, wie sie den ersten und dritten Satz bestimmen, in ihrer rauen, leidenschaftlichen Prägung den statischen, ziellos um wenige Zentraltöne kreisenden langsamen Satz. Verlorenheit und Melancholie, die aus diesem magischen Monolog – der ganze 2. Satz ist mit Dämpfer zu spielen – sprechen, lassen die Exilerfahrung, jenen unwiederbringlichen Verlust von Heimat und persönlich-kultureller Verwurzelung erahnen. In seiner unendlichen Weite schwingt gewiss auch das Erleben des in vielen Teilen um 1950 noch dünn besiedelten, wenig erschlossenen Exillandes mit der Erinnerung an seine jahrtausendealte kulturelle Vergangenheit mit. Der dritte Satz von Ben-Haims Sonate in G zeigt in vielen Details, namentlich in den allmählich vom Grundton G aufstrebenden, in kleinsten Intervallschritten geführten flirrenden 16tel-Passagen, ebenso in formaler Hinsicht erstaunliche Parallelen zum Finalsatz von Bartóks 1944 entstandener Sonata für Violine solo: Sollte es sich um eine subtile Hommage an den gleichen Widmungsträger handeln? Seit ihrer Uraufführung in New York am 4. Februar 1952 durch Yehudi Menuhin wurde die Sonate in G nicht nur zu einem der bekanntesten Werke von Paul Ben- Haim, sie gewann auch rasch den Ruf als eine jener Kompositionen, die das Streben nach musikalischer Identität des jungen Staates Israel eindringlich widerspiegeln. Ähnliches lässt sich von Bashrav sagen, dessen Berühmtheit zumindest in Israel den Blick auf das riesige Gesamtwerk von Abel Ehrlich bis heute eher behindert hat. Dabei entspringt Bashrav – 1953 in Oranim entstanden – einer Ben-Haim entgegengesetzten ästhetisch-stilistischen Position: Arabische Einflüsse, die sich u. a. im mehrfachen Gebrauch von Mikrointervallen spiegeln, verschmelzen mit unmittelbar von der deutschen Sprache und polyphonen Musiktradition geprägten Momenten zu einer beeindruckenden Einheit, die gerade in der Verbindung scheinbar widersprüchlicher Elemente eine neue Identität beschwört. Der aus der arabischen Folklore entlehnte Titel Bashrav verweist auf eine rondoartige Form, deren Ritornellteile einem ständigen Verwandlungsprozess unterworfen sind. Assoziiert das zu Beginn dreimal anhebende Rufmotiv nach Abel Ehrlichs Bekunden ein direktes Hörerlebnis in einem arabisch geprägten Umfeld, so erschließt sich die Genese des von unregelmäßigen Metren und Tonwiederholungen bestimmten Scherzo-Themas in der Mitte des Stückes über eine berührende deutschsprachige Reminiszenz. »Das 2. Thema habe ich aufgeschrieben, was meine Tochter vor sich hinsang, als sie 41/2 Jahre war, als sie die Bilder vom Grimm’schen Märchen ›Die 3 Bären‹ ansah im Rhythmus wie im Scherzo ›Vaterbär und / Mutterbär und der / Kleine – und / weg Vater und / weg Mutter und / weg Kleiner...‹« – so erinnert sich Abel Ehrlich in einer dieser Einspielung zugrunde liegenden korrigierten und kommentierten Druckausgabe von Bashrav. Bevor das Werk in einer erneut dreimal anhebenden Rufgeste – wie aus weiter Ferne am Rande des Wahrnehmbaren – erlischt, verdichten sich die zentralen Motive in einem kontrapunktisch gestalteten, elegischen Schlussteil, der in seiner archaischen Strenge einem Bekenntnis zur – 1953 längst verlorenen und zerstörten – deutschen Musiktradition gleichkommt. Immer wieder hat sich Abel Ehrlich in seinen Werken mit Aspekten jüdischer Geschichte und Identität, zugleich mit der Exilproblematik und dem Verlust seiner ostpreußischen Heimat auseinander gesetzt. Nach seinem Abitur in Königsberg studierte er von 1934 bis 1938 in Zagreb und wurde nach kurzem Exil in Albanien seit 1939 in Jerusalem, später in Tel Aviv ansässig. In ihrer subtilen Beredsamkeit am Rande des Verstummens berühren die beiden späten Monologe Jeremia und Spinoza (1997) und Die Asche, aus der das Vergessen besteht (2000) zwei existenzielle Fragestellungen, die den Komponisten zunehmend beschäftigten. Jeremia und Spinoza thematisiert zwei Exponenten des jüdischen Geisteslebens, die durch ihre kritische Haltung zu Exilierten innerhalb ihres eigenen Volkes, ja innerhalb der eigenen Gemeinde wurden. Ein verstecktes musikalisches Selbstporträt? Abel Ehrlich erklärte dazu im August 1998: »Es ist fast, als ob ich über das ähnliche Schicksal dieser beiden großen Repräsentanten meines Volkes nachdenke und mit ihnen mitleide – weniger eine Erzählung als ein Nachdenken.« Ein Gedicht von Borges, dem Glück des Vergessenwerdens am Beispiel eines unbekannten Dichters im alten Griechenland gewidmet, inspirierte Abel Ehrlich zu Beginn des Jahres 2000 zu einer musikalischen Meditation von intimster Eindringlichkeit. Jene Asche, aus der das Vergessen besteht wird Klang in dynamisch ungemein differenzierten melodischen, rhetorischen Gesten, die schattenhaft aus dem Dunkel hervortreten und gleich Erinnerungsfragmenten im Nichts verschwinden. Mordecai Seters zweisätzige Sonate für Violine solo, nur zwei Jahre nach derjenigen von Paul Ben-Haim 1953 entstanden, offenbart eine dem ›Mittelmeerstil‹ grundlegend konträre Position. Ausgangspunkt der Orientierung Seters stellt Abraham Zvi Idelsohns bedeutende Sammlung traditioneller jüdischer Melodien dar, die Mordecai Seter durch den Cellisten und Komponisten Joachim Stutschewsky kennen lernte. Anders als die meisten israelischen Komponisten der ersten Generation, die erst als Erwachsene die Sprache des Exillandes erlernten, wuchs Seter bereits als Kind mit Hebräisch auf: Als Zehnjähriger kam er mit seiner Familie 1926 aus der Sowjetunion nach Palästina und gewann somit ein besonderes Verständnis für die Intonation, mithin für die rhetorische Eigenart des Hebräischen. Im Gespräch mit Walter Kläy betonte Mordecai Seter 1972 die Bedeutung von Tonalität bzw. Modalität für sein Komponieren – in der Sonate für Violine solo spiegelt sich dieser stilistische Aspekt Seters ebenso wider wie seine Verwurzelung in der Tradition jüdischen Gesanges. Beide Sätze – sowohl der rhythmisch an eine barocke französische Ouvertüre gemahnende, harmonisch aufgeraute erste als auch der chaconneartig angelegte, äußerst sanglich gestaltete zweite Satz – sind durch zahlreiche Kadenzierungen unterteilt, die in ihrer harmonischen Trennschärfe gerade im zweiten Satz den Eindruck von Strophen erwecken. In diesem weiträumig konzipierten zweiten Satz finden sich rhetorische Gesten von sakraler Suggestivkraft, deren ausführliche Spielanweisung Seters Verbindung zu archaischen Kantillationen, mithin die Sprachlichkeit seiner Musik direkt offenbart: »as a Psalmody, recitando rubato e sotto voce« (wie eine Psalmodie, frei und mit gedämpfter Stimme rezitierend). Indem Mordecai Seter auf jede Art äußerlicher instrumentaler Effekte verzichtet, ohne jedoch die genuine Farbigkeit unterschiedlichster geigerischer Klangregister zu vernachlässigen, gelingt ihm ein höchst individuell geprägtes Werk von bewegender Ausdrucksintensität. Glück im Unglück hatte Haim Alexander (*9. August 1915 in Berlin), als er 1936 sein Klavierstudium am Sternschen Konservatorium aufgrund der nationalsozialistischen Ausgrenzungspolitik gegenüber Juden abbrechen musste. Durch einen Zufall erfuhr er von Emil Hausers unmittelbar bevorstehender Berlinreise, die der Findung besonders begabter Studenten für »sein« neu gegründetes Konservatorium in Jerusalem galt: So kam Haim Alexander nach Jerusalem, wo er noch heute lebt und sich seinem Schaffen widmet. Seine Ausbildung vollzog sich im Spannungsfeld zweier extrem gegensätzlich geprägter Komponisten – und Lehrerpersönlichkeiten, die Haim Alexander auf unterschiedliche Weise beeinflussten: »In Komposition erhielt ich zum ersten Mal Stunden nach meiner Einwanderung in Palästina 1936. Mein Lehrer war Stefan Wolpe, wie Sie sicher wissen, war er ein Zwölftönler. Was ich ihm vorzeigte, – war etwa im ›NeoMendelssohn‹ Stil – Zwölfton war für mich ›Böhmische Dörfer‹. 1938 verließ Wolpe Israel und ich lernte einige Jahre bei Chanoch Jacobi, einem Hindemith-Schüler. Dazu kommen noch mehrere Besuche in Darmstadt, um mich vollständig durcheinander zu bringen...«(Brief an den Verfasser vom 12.2.2001). In diesen Worten klingen ästhetische Aspekte an, die das Schaffen von Haim Alexander vor allem im Sinne einer engen Verbindung zu musikalischen Traditionen und Entwicklungen in Mitteleuropa bestimmen. Dabei muss ergänzt werden, dass Haim Alexander bis heute ein hinreißender Jazzpianist und Improvisator ist – Qualitäten, die einerseits ihm in den ersten schwierigen Jahren des Lebens in Palästina eine solide Existenzgrundlage sicherten, andererseits seinen Werken bei aller Akribie der Materialbehandlung einen Hauch jener improvisatorischen Spontaneität, jener unangestrengten, durchaus instrumentspezifischen Klangsinnlichkeit verleihen. Sowohl der 2001 entstandene Epilog als auch der 2002 vorangestellte Prolog ist durch einen Wechsel von monodisch-erzählenden und streng polyphon gestalteten Episoden charakterisiert, deren harmonische Ambivalenz wesentlich durch den Tritonus geprägt wird. Gerade jenes Schweben zwischen Konsonanz und Dissonanz, jenes organisch wirkende Ausbalancieren zwischen freitonaler Disposition und latenter Tonalität, verleiht beiden Miniaturen einen klanglichen Zauber von verhaltener Melancholie. Haim Alexander und Abel Ehrlich verdanke ich nicht nur wunderbare Beiträge zum Soloviolinrepertoire – in vielen Gesprächen und Briefen eröffneten sie wichtige Einblicke in ihr Schaffen und boten wertvolle Erinnerungen an das Musikleben in Palästina bzw. im jungen Staat Israel seit 1948. Walter Kläy (Radio DRS Bern) stellte mir freundlicherweise seine Porträtsendungen zur Verfügung, in denen er bereits 1972 verschiedenste Komponisten Israels in Selbstzeugnissen und ihrer Musik präsentierte: eine Pioniertat zu einer Zeit, als in Europa dem Thema Exilmusik noch keinerlei Beachtung geschenkt wurde. Drei Bücher haben meine Auseinandersetzung mit dem spannenden Forschungsgebiet ›Komponisten in Israel‹ in besonderem Maße begleitet und gefördert: Max Brod: Die Musik Israels (Tel Aviv 1951) Diesem Buch entstammt o.g. Zitat Robert Fleisher: Twenty Israeli Composers: Voices of a Culture (Detroit 1997) Barbara von der Lühe: Die Emigration deutschsprachiger Musikschaffender in das britische Mandatsgebiet Palästina (Frankfurt/Main 1999) Kolja Lessing