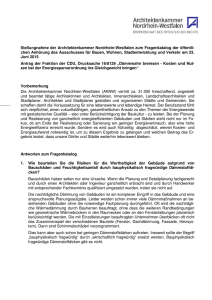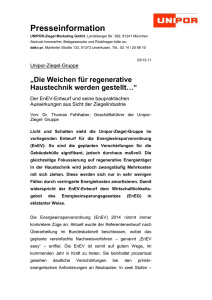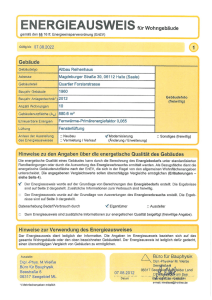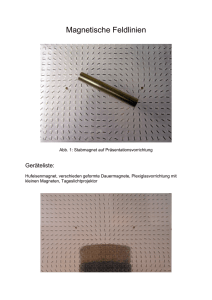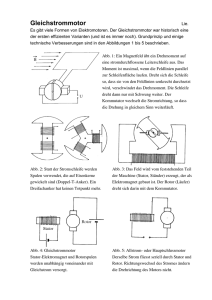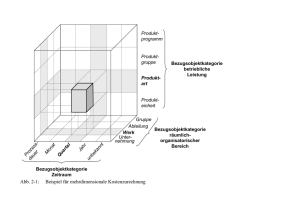3.4 System Bestandsgebäude
Werbung

3.4 System Bestandsgebäude Umgangsmöglichkeiten mit Wohnungsbeständen Mit der Energiepreisentwicklung der Umwelt- und Klimapolitik und den daraus resultierenden Förderprogrammen wurden bislang einige wesentliche Rahmenbedingungen für die energetische Bestandsentwicklung erläutert. In diesem Abschnitt werde ich mich nun dem Umgang mit Bestandsgebäuden annähern. Abb. 38: Prozentuale Verteilung der Wohnungen in Deutschland nach Baualtersstufen Bestandsgebäude lassen sich nicht pauschal betrachten, sondern sind in ihrer Ausformung äußerst vielfältig. Für sie gelten komplexere Zusammenhänge und andere Zielsetzungen als für Neubauten. Im folgenden Kapitel wird versucht den Gebäudebestand in Zahlen zu erfassen, nach verschiedenen Aspekten zu differenzieren, um danach zu klären, welche Anforderungen an dessen Entwicklung gestellt werden und mit welchen Planungsmethoden man diesen begegnen kann. Abb. 39: Prozentuale Verteilung des Wohnungsbestandes im Jahr 2000 57 System Bestandsgebäude 3.4.1 Wohngebäudebestand der Bundesrepublik Deutschland in Zahlen Die Bestandsgebäude lassen sich grob in zwei Klassen einteilen: Neubauten und Altbauten. Unter energetischen Gesichtspunkten gelten alle Gebäude, die älter als ein Jahrzehnt sind, bereits als Altbauten. Diese Gebäude weisen bereits im Vergleich zu heute einen erhöhten Energieverbrauch auf. Die Anteile dieser beiden Gruppen am Gesamtbestand unterscheiden sich deutlich. Der Wohnungsbestand in der Bundesrepublik Deutschland betrug im Jahr 2002 rund 38.689.800 Wohnungen. Während nur etwa ein Drittel dieser Wohnungen auf ein Baualter vor dem Zweiten Weltkrieg datiert wird, bilden die seit den 50er Jahren errichteten Wohnungen mit zwei Dritteln, die deutliche Mehrheit im Bestand. Dieses Verhältnis lässt sich durch die starken Zerstörungen der Bausubstanz während des Krieges begründen. Der Wohnungsmangel nach dem Krieg führte zu einer hohen Wohnbautätigkeit besonders in der direkten Nachkriegszeit. Diese Entwicklung lässt sich für ganz Deutschland beobachten. Wie in der Abbildung 38 verdeutlicht, nimmt der Bestand der Jahre 1949 – 1978 den größten Anteil ein (47%). In dieser Altersspanne sowie zwischen 1979 – 1990 (14%) dominieren im Bestand die Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (vgl. Abb. 40). Der Einfamilienhausbau nimmt erst in den 90er Jahren zu. Bestandsgebäude neueren Datums (1990 und später) Abb. 40: Altersstruktur der Wohnungen in Deutschland 58 sind lediglich mit 11% vertreten. Insgesamt gibt es in Deutschland heute über 17 Millionen Wohngebäude. 11 Millionen davon sind Gebäude mit nur einer Wohnung und entsprechen damit dem klassischen Einfamilienhaus. Über 3 Millionen Gebäude besitzen zwei Wohnungen und ziemlich genau 3 Millionen Gebäude besitzen drei oder mehr Wohnungen. Dagegen stellen Gebäude mit drei Wohnungen und mehr eine Anzahl von rund 20 Millionen Wohnungen, die Gebäude mit zwei Wohnungen eine Summe von rund sieben Millionen Wohnungen und die Gebäude mit einer Wohnung, die bereits erwähnten 11 Millionen Wohnungen. Die mit Abstand größte Anzahl der Wohnungen (ca. 55 %) ist somit klar dem Bereich der Mehrfamilienhäuser zuzuordnen, die größere Anzahl der Gebäude allerdings stellen die klassischen Einfamilienhäuser mit nur einer Wohnung. (s. Kompetzenzzentrum 2006d, 9-11) Ein- und Zweifamilienhäuser umfassen insgesamt einen Anteil von 57,6 % der Wohnfläche und stellen gleichzeitig über 82 % aller Wohngebäude dar. (vgl. Abb. 39) Wohngebäudebestand der Wohnungsunternehmen Die in etwa 3000 in den Mitgliedsverbänden des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) zusammengeschlossenen Wohnungsunternehmen, bewirtschaften ca. 6,2 Millionen Wohnungen. (s. GdW 2006, 206) Das entspricht rund einem Drittel des gesamten Mietwohnungsangebotes von 20 Millionen Wohnungen in Deutschland. Die System Bestandsgebäude Abb. 41: Prozentuale Verteilung der Wohnungen des GdW nach Baualtersstufen vom GdW repräsentierten Unternehmen bewirtschaften also knapp 30 % des gesamten vermieteten und zwei Drittel des gewerblich-professionell verwalteten Mietwohnungsbestandes in Deutschland. In den neuen Bundesländern wird sogar nahezu jede zweite Mietwohnung von Unternehmen des GdW-Bereiches bewirtschaftet (s. GdW 2006, 11). Dies zeigt die große Bedeutung der Wohnungswirtschaft bzw. der durch den GdW repräsentierten Unternehmen zum einen für die sektoralen Ziele „Haushalte“ des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung (vgl. Kapitel 3.2.3) und zum anderen für die Wohnungsversorgung. Gemessen am Anteil aller bewohnten Mietwohnungen liegen die Tätigkeitsschwerpunkte der vom GdW bundesweit vertretenen Unternehmen vor allem in Verdichtungsräumen und Stadtregionen, so dass die Unternehmen auch einen wesentlichen Beitrag zur Stadtentwicklung beitragen können. (s. GdW 2006, 11) Der Großteil der wohnungswirtschaftlichen Bestände stammt, wie der gesamte Wohnungsbestand Deutschlands, aus der Nachkriegszeit (vgl. Abb. 41) . Der Bestand der Jahre 1960 - 1970 nimmt mit 26 % den größten Anteil ein. Zusammen mit den Baualtersklassen 1949 - 1959 (20%) und 1971 - 1980 (18%) wurden somit 66 % des wohnungswirtschaftlichen Bestandes vor der ersten bzw. teilweise vor der zweiten Wärmeschutzverordnung errichtet (vgl. Kapitel 3.6). Dies verdeutlicht sich bei der Betrachtung der Wohneinheitenverteilung nach städtebaulichem Gebiet, denn 81,5 % der GdW-Wohnungen liegen in Siedlungen der 50er bis 80er Jahre. (s. GdW 2006, 212) Der wesentliche Bestand der Wohnungsunternehmen setzt sich aus Wohnungen, die mehr als zwei Wohnungen haben, zusammen. Diese Gruppe der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern macht 96,7 % des Bestandes aus. Lediglich 2,8 % der Wohnungen befinden sich in Gebäuden mit weniger als drei Wohnungen, also in Einfamilien- und Reihenhäusern. Die meisten Wohnungen (1.172.811) werden von den nordrhein - westfälischen Mitgliedsunternehmen des GdW bewirtschaftet. Insgesamt beläuft sich der Bestand an Wohneinheiten in NRW auf rund 8 Millionen Wohnungen. In diesem Zusammenhang ist vor allem der „Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen“ (VdW) von großer Bedeutung, da die 460 Mitgliedsunternehmen des Verbandes rund 1,24 Millionen Wohnungen bewirtschaften. Dies entspricht in etwa einem Achtel des Wohnungsbestandes in NRW. Nach Angaben des VdW lebt jeder vierte NRW-Bürger in einer dieser Wohnungen. (s. InWIS Forschung & Beratung GmbH 2007, 5) Instandsetzungsbedarf des deutschen Gebäudebestands Die Beurteilung des Instandsetzungsbedarfs des gesamtdeutschen Gebäudebestandes wird anhand des Endberichts „Dialog Bauqualität“ (02.09.2002) des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung ermittelt. Der langfristige Instandsetzungsbedarf ist beim Wohnungsbestandes der alten Bundesländer am höchsten. (vgl. Abb. 42 u. 43). Die Gegenüberstellung des Instandsetzungsbedarfs von 1992 und 1999 zeigt einen gleichbleibenden Instandsetzungsbedarf. Ebenfalls lässt sich erkennen, dass der Instandsetzungsbedarf für die Baualtersklasse 1949 bis 1970 besonders hoch ist. Dies hängt mit dem niedrigen Qualitätsstandard des Bauens in den Nachkriegsjahren und dem sehr hohen Anteil dieser Gebäudeklasse zusammen. Weiterhin auffällig ist, dass der Instandsetzungsbedarf von Ein- und Zweifamilienhäusern im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern bedeutend höher ist. Auf die Wohneinheit bezogen, ist der Instandsetzungsbedarf sowohl bei Ein- und Zweifamilienhäusern als auch bei Mehrfamilienhäusern der Baualtersklasse von 1919 - 1948 am höchsten (vgl. Abb. 44). Der höhere 59 System Bestandsgebäude Abb. 42: Instandsetzungsbedarf Stand 1992/1999 alte Bundesländer Instandsetzung und Modernisierung in den neuen Bundesländern. Der Schwerpunkt des Instandsetzungsbedarfs liegt bei den konventionell errichteten Mehrfamilienhäusern. Insgesamt ist der Instandsetzungsbedarf in Deutschland von 1993 (163 Mrd. DM) bis 2000 (115 Mrd. DM) deutlich um 50 Mrd. DM gesunken. Dieser Rückgang ist besonders durch die umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen in den neuen Bundesländern erreicht worden, während, wie schon erwähnt, in den alten Bundesländern von einem gleichbleibenden Instandsetzungsbedarf ausgegangen werden kann. (s. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2002, 25 - 33) 3.4.2 Planen und Bauen im Bestand Abb. 43: Instandsetzungsbedarf des Wohnungsbestandes der alten Bundesländer nach Fristigkeiten Abb. 44: Instandsetzungsbedarf des Wohnungsbestandes der alten Bundesländer in DM/Wohnung Instandsetzungsbedarf je Wohneinheit bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist auf den höheren Anteil von Außenbauteilen, die damit verbundene verstärkte Alterung und den höheren Verschleiß der Außenbauteile zurückzuführen. Ebenso sind die größeren Wohneinheiten im Ein- und Zweifamilienhausbereich für den höheren Instandsetzungsbedarf je Wohneinheit verantwortlich. Der Instandsetzungsbedarf des Wohnungsbestandes der neuen Bundesländer ist seit 1994 für alle Baualtersklassen stark zurückgegangen. Dies ist zurückzuführen auf die beträchtlichen Anstrengungen zur 60 Das Planen und Bauen im Bestand wird seit Jahren durch Architekten und Stadtplaner als das Aufgabenfeld der nächsten Jahrzehnte identifiziert. Dies lässt sich an der Bautätigkeit in Deutschland festmachen. Das Verhältnis von Neubau und Bauen im Bestand verschiebt sich in den letzten Jahren kontinuierlich Richtung Bestand. (s. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2002, 15) „Seit dem Jahr 2000 übersteigt die Modernisierungstätigkeit anteilsmäßig den Neubauanteil am Wohnungsbauvolumen.“ (Meisel 2005 , 27). Auch bezüglich des Investitionsvolumens im Hochbau übersteigt der Bestand den Neubaubereich deutlich um fast 20 %. Dagegen übertrifft die Zahl der Baugenehmigungen für Neubauten die Zahl der Baugenehmigungen im Bestand um ein Vielfaches. Für diese starke Diskrepanz lassen sich zwei Gründe aufführen. Zum einen ist eine Vielzahl der Baumaßnahmen im Bestand nicht genehmigungspflichtig und zum anderen sind Bestandsmaßnahmen im Vergleich zu Neubaumaßnahmen häufig kostenintensiver, da die Planungsunsicherheit meistens größer und die Durchführung der Maßnahmen aufwendiger ist. Auch in der Wohnungswirtschaft ist man sich darüber einig, dass „Wohnungsbau“ künftig überwiegend im Bestand stattfindet. Die aktuellen wohnungswirtschaftlichen Bestandsinvestitionen verdeutlichen dies. Auch die Investitionstätigkeit, der vom GdW bundesweit vertretenden Unternehmen, ist überwiegend auf den Bestand ausgerichtet. Im Laufe der 90er Jahre hat die relative Bedeutung der Bestandsinvestitionen - trotz rückläufiger absoluter Werte - bis zum Jahr System Bestandsgebäude 2002 kontinuierlich zugenommen. Die Investitionen für Instandhaltung und Modernisierung, erreichten eine Größenordnung von 77% der gesamten Investitionsleistungen im GdW-Bereich. Seit 2002 ist wieder ein leichter Bedeutungszugewinn der Neubauinvestitionen festzustellen. (s. GdW 2006, 11) Insgesamt ist 2005 allerdings ein Rückgang der Bauinvestitionen zu verzeichnen. Die gesamtwirtschaftlichen Bauinvestitionen und damit die Beschäftigung und Umsätze der Betriebe fielen auf einen neuen Tiefstand. Die Wohnungsbauinvestitionen sanken im Vergleich zum Vorjahr um 3,4%. Somit verringert sich nun bereits seit sechs Jahren kontinuierlich, die in den Wohnungsbau investierte Leistung. (s. GdW 2006, 8) Kategorisierung der Bestandsgebäude Bestandsgebäude lassen sich sowohl nach ihrem Baualter und ihrer Bauform, als auch den verwendeten Konstruktionen und Baustoffen differenzieren. Über die Verschiedenartigkeit dieser Merkmale lassen sie sich in unterschiedliche Gebäudetypen einteilen. Der Gebäudevielfalt sind keine Grenzen gesetzt, dennoch ist es sinnvoll, anhand einer Grobabschätzung über die Baualtersklasse sowie die Gebäudegröße, die Charakteristika der Bestandsgebäude zu bestimmen. Diese allgemeine und vereinheitlichte Typenbildung ermöglicht es, grundlegende und schnell erfassbare Aussagen über das Wesen eines Bestandsgebäudes zu gewinnen. Das Baualter bildet ein wichtiges Merkmal, weil sich in jeder Bauepoche allgemein übliche Konstruktionsweisen, aber auch typische Bauteilflächen (z.B. Fenstergrößen) finden lassen. Die Baualtersklassen orientieren sich an historischen Einschnitten, den Zeitpunkten statistischer Erhebungen und Veränderungen der wärmetechnisch relevanten Bauvorschriften (s. IWU 2003, 2). Innerhalb der Literatur existiert einer Vielzahl solcher Gebäudetypologien. Neben allgemeinen Analysen und Aussagen zu einzelnen Gebäudetypen ermöglicht z.B. die Deutsche Gebäudetypologie (vgl. Abb. 45) darüber hinaus energetische Aussagen zu den einzelnen Gebäudetypen. Neben typischen Energiekennwerten und Energieeinsparpotentialen für Einzelgebäude listet die Gebäudecharakterisierung des IWU auch typische Flächen und U-Werte auf (s. IWU 2003, 2), die für eine energetische Bewertung von Bestandsgebäuden bzw. zur Energieberatung herangezogen werden können. Weiterhin sind aus zahlreichen Projekten in der Baupraxis typische baualtersklassenspezifische Schwachstellen ermittelt und Abb. 45: Ausschnitt aus der Deutschen Gebäudetypologie in einem Ratgeber für die Praxis zusammengestellt worden (s. Meisel 1995). Hinzugefügt werden muss, dass die Gebäudetypologien (vgl. Abb. 45), im einzelnen durch regionale Besonderheiten variieren und lediglich eine grobe Verallgemeinerung für Bauten in ganz Deutschland darstellen. Auch wenn insbesondere in den 60er und 70er Jahren überregionale Gemeinsamkeiten auffällig sind, können Planungsaussagen auf Ebene der Gebäudetypologie nur erste Abschätzungen zu Vorüberlegungen bei der Bestandsentwicklung sein. Für weitere Schritte bzw. den konkreten Sanierungsfall muss das vorliegende Gebäude im Bestand analysiert werden. Umfangreiche Bestandsuntersuchungen und energetische Bewertungen sollten den Baumaßnahmen zu Grunde liegen. (s. Fachinformationszentrum Karlsruhe 2004, 45 – 46). Aufgrund dessen stellt der nächste Abschnitt das inhaltliche und methodische Vorgehen einer baulich-technischen Bestandsaufnahme vor. Die Bestandsaufnahme Grundlage eines Planungsgutachtens (Consultings) Das Grundprinzip jeder Bestandsaufnahme ist die gedankliche Zerlegung des Gebäudes in einzelne Bauelemente. Diese müssen getrennt voneinander untersucht werden. Pauschale Beurteilungen von Gebäuden ohne detaillierte Angaben zum Zustand der verschiedenen Bauelemente sind unzureichend. Die Bestandsuntersuchung lässt sich in sieben Einzelschritte unterteilen. Die Beachtung dieser Schritte gewährleistet eine zuverlässige und wirtschaftliche Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen. Von Beginn an sind alle sieben Einzelschritte parallel zu betrachten um eine zielgerichtete Verfahrensweise zu erreichen. Diese ermöglicht eine Begrenzung des Untersuchungsaufwands, weil sich die Bausubstanz 61 System Bestandsgebäude gezielt dort intensiver untersuchen lässt, wo Maßnahmen (wie zum Beispiel die Erneuerung oder der Einbau von Bädern mit entsprechenden Leitungsführungen) geplant sind. Die sieben Einzelschritte systematischer Gebäudebeurteilung sind: 1.Schritt: Maßliches Erfassen des Baugefüges in Plänen und Fotos 2.Schritt: Klären der vorhandenen Konstruktionen, Baustoffe und technischen Gebäudeausrüstung 3.Schritt: Erfassen von Schäden und Schwachstellen nach Art, Grad und Ausmaß 4.Schritt: Klären von Schadensursachen und Wirkungsmechanismen 5.Schritt: Überprüfen und Festlegen von Einzelzielen baulicher Maßnahmen 6.Schritt: Klären verschiedener, alternativer Baumaßnahmen an Bauelementen 7.Schritt: Kosten-/Nutzenvergleiche mit Kostenberechnungen nach Bauelementen Im ersten Schritt müssen eventuell vorhandene Bestandspläne beschafft und kritisch überprüft werden. Sollten keine Bestandspläne vorliegen, ist zu prüfen, inwieweit sie für die angestrebten Maßnahmen benötigt werden, denn vollständige Neuaufmaße sind sehr arbeitsaufwändig und bilden deshalb eher die Ausnahme. Praxisgerechter sind hingegen gezielte Teilaufmaße an Veränderungspunkten im Gebäude. Bezüglich der Durchführung des zweiten Schrittes ist in der Praxis häufig eine unzureichende Durchführung feststellbar. Bei diesem Schritt ist vor allem darauf zu achten, dass auch vollständig verdeckte Bauteile maßlich erfasst werden um Fehlplanungen zu vermeiden. Im heutigen Bestand ist immer mit ungewohnten Konstruktionen zu rechnen. Zur Klärung vorhandener Konstruktionen und Baustoffe stehen verschiedene zerstörungsarme Techniken zur Verfügung, wie z.B. die Untersuchung des Wandaufbaus mittels Bohrkernen. Die Entnahme von Proben zur Klärung von Konstruktionen und Baustoffen ist genau zu planen, denn durch die Auswahl einer Untersuchungsstelle kann das Untersuchungsergebnis stark beeinflusst werden. Hier ist die Erfahrung des Beurteilenden gefragt. Um den dritten Schritt zielgerichtet durchzuführen, müssen die typischen Schadensschwerpunkte und Schwachstellen von Gebäuden sowie die benötigten Verfahrenstechniken vorab bekannt sein. Aus Art, 62 Grad und Ausmaß der Schäden am Gebäude ergeben sich notwendige bauliche Instandsetzungsmaßnahmen. Auf diese Weise kann die Menge und Priorität der Instandsetzungsmaßnahmen erfasst werden. Weiterhin können so die Kosten nach BauelementVerfahren abgeschätzt werden. Die Erfassung der relevanten Daten kann in der Regel auch von nicht auf Bauschadensfragen spezialisierten Architekten und Ingenieuren geleistet werden, lediglich zur Ursachenklärung sind Sachverständige eventuell hinzuzuziehen. Die bereits angesprochene exakte Erklärung von Schadensursachen und Wirkungsmechanismen (vierter Schritt) erfordert eventuell die Kompetenz von Fachleuten, die dann gesondert mit spezifischen Aufgabenstellungen zu beauftragen sind. Als Beispiel kann hier die Gebäudedurchfeuchtung als häufiges und schwieriges Problem bei der Ermittlung von Ursachen und Wirkungsweisen genannt werden. Die Schritte fünf bis sieben stellen die Verbindung zu Planungszielen und möglichen Baumaßnahmen her. Hierbei ist es vor allem wichtig, methodisch die Ebene der Betrachtung der Bauelemente weiterzuführen, das heißt: Ziele, mögliche Baumaßnahmen und Kosten sind nach Bauelementen getrennt zu ermitteln. Um die vielfältigen zu erfassenden Kriterien der Beurteilung der verschiedenen Bauelementbereiche zu erleichtern, ist neben der ausführlichen Fotodokumentation, die Verwendung von Checklisten sinnvoll. Über die Checklisten ist es möglich, die Vollständigkeit einer Untersuchung zu dokumentieren, denn in der Praxis stellt die Unvollständigkeit der Bestandsaufnahme eine wesentliche Fehlerquelle dar. (s. Meisel 2005, 82-90) Die Dokumentation der baulich-technischen Bestandsaufnahme als eine entscheidende Grundlage für die Planung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird heute durch den Einsatz von Softwareprogrammen (z.B. epiQR) erleichtert. Planungsgutachten Eine zuverlässige Modernisierungsplanung beginnt immer mit einem Gutachten über die Ausgangslage des betreffenden Gebäudes. Hierfür müssen die Mängel, Bindungen und Chancen durch die vorhandene bauliche Struktur, die bestehende Nutzung, die voraussichtliche soziodemographische Entwicklung System Bestandsgebäude und die städtebauliche Lage analysiert werden. Ziel dieser Analyse ist, die für die Planungsentscheidungen nötigen Daten und Fakten systematisch zusammenzutragen. Vorab sind mit dem Investor mögliche Entwicklungsziele sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen einzugrenzen um eine Basis für Kosten/Nutzenvergleiche zu schaffen. Die vorgestellten sieben Schritte zur systematischen Gebäudebeurteilung bilden in diesem Zusammenhang die Grundlage für die baulich-technische Beurteilung und Entwicklung des Gebäudes. Ebenso sind Daten zur Einordnung der Immobilie in den städtebaulichen Kontext zu erheben, da die Lagequalität die Entwicklungsziele wesentlich prägt. Für Bestands-, Planungs- und Kostengutachten dieser Art ist charakteristisch, dass sie auf der Basis der Zustandsbeurteilung der Immobilie verschiedene „Maßnahmenstufen“, „Standards“ und „Entwicklungsszenarien“ erarbeiten. Diese müssen dem Auftraggeber transparent dargestellt werden, denn auf Grundlage dieser systematisch aufbereiteten Unterlagen kann der Auftraggeber eine Entscheidung treffen. (s. Meisel 2005, 90 – 91) 3.4.3 Maßnahmenstufen, Standards und Baustufen im Umgang mit Bestandsgebäuden Im Altbaubereich stehen Architekten und Planer vor komplexeren Planungsaufgaben als im Neubau. Bei Neuabauten sind die Anforderungen der Nutzer hinsichtlich heutiger Leitbilder problemlos umzusetzen. Im Gegensatz hierzu liegt der Ansatz für die Entwicklung eines Bestandsgebäudes immer in den vorhandenen Potentialen, „die Möglichkeiten finden ihre Grenzen oft nur im Budget des Bauherren“ (Kompetzenzzentrum 2007b, 4), denn die Anforderungen an den Wohnungsstandard werden im Wesentlichen von den Wohnbedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten des Bewohners bestimmt. „Mit diesem Hintergrund muss die Aufgabe für die Entwicklung von Konzepten für die künftige Nutzung von Baubeständen lauten, eine breite Palette möglicher Verbesserungsansätze für verschiedene Gebäudetypen und Baualtersstufen zu entwickeln, die verschiedene Qualitätsniveaus bieten.“ (s. Lehrstuhl für Wohnbau und Grundlagen des Entwerfens und Institut für Wohnbau 2006, S.17). Es erscheint somit sinnvoll, den Altbaubestand als ein Reservoir an verschiedensten, abgestuften, baulichen Qualitäten anzusehen, deren Erhaltung bzw. strategische Entwicklung zur Abdeckung differenzierter Woh- nungsbedürfnisse dient. Deswegen und aufgrund der bereits erläuterten Methodik eines Planungsgutachtens werden im Folgenden Standards, Maßnahmenstufen sowie „stufenweise Verbesserungskonzepte“ (s. Lehrstuhl für Wohnbau und Grundlagen des Entwerfens und Institut für Wohnbau 2006, 13) vorgestellt. Standards im Umgang mit Bestandsgebäuden Verschiedene Bauzustände lassen auf heterogene Instandsetzungssockel schließen. Darauf aufbauend können differenzierte Standards für Modernisierungsmaßnahmen gewählt werden. Man unterscheidet in der Literatur in der Regel zwischen drei Standards: einfacher Standard, mittlerer Standard sowie hoher Standard. Diese setzen auf drei Sockelzustände auf: schlechter Zustand, mittlerer Zustand, guter Zustand (vgl. Abb. 46). Für den baulichen Gesamtaufwand einer Modernisierungsmaßnahme resultiert daraus eine Vielzahl von möglichen Kombinationen, die in gesamtheitlichen Planungskonzepten ermittelt werden können. Der jeweilige Standard kann den Nutzerund Investorenwünschen entsprechend definiert und angepasst werden. Solche abgestuften Standards können ein breites Spektrum von Qualitätskategorien ergeben, die der Liquidität und Investitionsbereitschaft unterschiedlicher Nutzergruppen entspricht. (s. Finkenbusch 2006, 55) Maßnahmenstufen im Umgang mit Bestandsgebäuden Neben der bereits erläuterten Einteilung nach Standards für Modernisierungsmaßnahmen, ist im Altbaubereich weiterhin eine Einteilung in Maßnahmenstufen gängige Praxis und soll im Folgenden thematisiert werden. Inwieweit der Altbau an den modernen Wohnstandard durch entsprechende Maßnahmen angepasst wird, entscheidet letztendlich der Nutzer bzw. der Investor. Die notwendigen Maßnahmen lassen sich je nach Zielsetzung des Eigentümers in verschiedene Stufen einteilen. Diese Stufen reichen von der Instandhaltung und Instandsetzung bis hin zu Umbaumaßnahmen, Erweiterungen, Anbauten, kompletten Umnutzungen oder sogar bis zu Rückbau oder Abriss. Der Begriff Instandhaltung fasst entsprechend der Definition der DIN 31051 (Ausgabe Juni 2003) als Oberbegriff die Bereiche Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung zusammen. Instandhaltung ist demnach eine Maßnahme zur Bewahrung 63 System Bestandsgebäude und Wiederherstellung des ursprünglichen bzw. eigentlichen Gebäudezustands (Soll-Zustand) sowie zur Feststellung und Beurteilung des aktuellen bzw. tatsächlichen Gebäudezustands (Ist-Zustand). Es ist wichtig, genau zwischen den einzelnen Begriffen zu unterscheiden, da z.B. in der Wohnungswirtschaft zwischen den Begriffen Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung als Hauptunterteilungsbegriffe differenziert wird. (s. Kompetenzzentrum 2006a, 2) Die Instandhaltung bildet die wesentliche Grundlage jeder Nutzung eines Gebäudes, sie schützt das Gebäude vor Substanzverlust und trägt hierdurch zum Werterhalt der Immobilie bei. Durch regelmäßige Inspektionen lässt sich die Lebensdauer der einzelnen Bauteile und somit des gesamten Gebäudes erheblich verlängern. (s. Kompetzenzzentrum 2006d, 6) Unter dem Begriff Instandsetzung sind diejenigen baulichen Maßnahmen zu verstehen, „die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands und zur Behebung baulicher Mängel dienen.“(s. ebd. 6) Die zu behebenden Mängel können dabei durch Abnutzung, Alterung, Unterlassen der regelmäßigen Instandhaltung oder durch einmalige außergewöhnliche Ereignisse, wie z.B. Sturm- oder Wasserschäden, entstanden sein. Bei der Planung von Instandsetzungsmaßnahmen sollte stets geprüft werden, ob nicht gleichzeitig weitere in Zusammenhang stehende sinnvolle Baumaßnahmen durchgeführt werden können (wie z.B. energetische Maßnahmen). Die Kopplung der ohnehin notwendigen Baumaßnahmen mit Modernisierungsmaßnahmen führt zu einer Optimierung des Bauablaufs sowie zur Kostensenkung (vgl. Kapitel 3.4.5). Beispielsweise kann auf die Ausbesserung des Putzes verzichtet werden, wenn ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht wird. (s. Kompetenzzentrum 2006d, 6) Von Modernisierung ist die Rede, wenn die baulichen Maßnahmen über den reinen Erhalt des ursprünglichen Gebäudezustandes hinausgehen. Modernisierung bezeichnet einerseits Maßnahmen, die eine bewohnergerechte Gestaltung des Gebäudes und des Umfeldes beinhalten, andererseits bau- und haustechnische Maßnahmen, die nachhaltig zu einer Verringerung des Energie- und Wasserverbrauchs führen. Zur bewohnergerechten Gestaltung des Gebäudes gehören Verbesserungen der Wohnungszuschnitte in Form von z.B. Grundrissveränderungen, Wohnungszusammenlegungen oder -teilungen, die Erneuerung der Küchen oder Bäder sowie die barrierearmen Nutzungsmöglichkeiten der Wohnung und des Umfeldes. Des Weiteren zählen auch Verbesserungen des 64 Schallschutzes zu den Modernisierungsmaßnahmen. Die bau- und haustechnischen Maßnahmen werden auch als energetische Modernisierung bezeichnet. (s. ebd. 6-7) „Im Gegensatz zur Instandsetzung (Wiederherstellung) sind die Maßnahmen der Modernisierung nicht zwingend notwendig, sie führen jedoch zu einer Abb. 46: Modell möglicher Instandsetzungsstufen und Modernisierungsstandards in Abhängigkeit von Baunebenkosten Abb. 47: Instandhaltung / Modernisierung System Bestandsgebäude Steigerung der Wohnqualität und sichern darüber hinaus den langfristigen Werterhalt der Immobilie.“ (s. Kompetenzzentrum 2006a, 5) In Abbildung 47 sieht man die Unterschiede zwischen Instandsetzung und Modernisierung noch einmal bildlich veranschaulicht. Wenn die bisherige Raumaufteilung unbefriedigend oder eine Anpassung an moderne Wohnverhältnisse erforderlich ist, können größere Umbau- oder gegebenenfalls Erweiterungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Um die Wohnfläche zu erweitern, können im Rahmen der Umbaumaßnahmen z.B. das bisher ungenutzte Dach- oder Kellergeschoss als Wohnfläche ausgebaut werden. Reichen die vorhanden Ausbaukapazitäten des Bestandes für die beabsichtigte künftige Nutzung nicht aus, so kann oft durch einen Anbau zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Der Anbau schafft zum einen neue Wohnfläche und zum anderen können (z.B. in Form eines Wintergartens) neue Qualitäten entstehen, die den Wohnraum funktional und atmosphärisch aufwerten. (s. Kompetenzzentrum 2006d, 7) In der letzten Zeit gab es eine Reihe von Umnutzungen von Bestandsgebäuden. Hierbei wird meist ein bisher anders genutztes Gebäude zu künftigen Wohnzwecken umgebaut. Umnutzungen betreffen somit eigentlich keine Wohngebäude, sondern vor allem Gebäude der Industrie und Landwirtschaft, welche durch den Wegbruch von Produktions- und Industriezweigen leer stehen und hinsichtlich einer Wohnnutzung häufig über besonders interessante Raumqualitäten verfügen. Bei Umnutzungen sollte stets darauf geachtet werden, dass die Bausubstanz, welche nicht zu Wohnzwecken errichtet wurde, in einem vertretbaren Rahmen umgebaut werden kann. Eine besonders umfangreiche Bestandsuntersuchung ist demzufolge für Umnutzungsplanungen erforderlich. (s. ebd. 7-8) Als letzte Möglichkeit des Umgangs mit Bestandsgebäuden mittels Maßnahmenstufen existiert der Rückbau und Abriss von Gebäuden. Der Begriff Rückbau steht für den behutsamen Umgang mit vorhandener Bausubstanz, die abgebrochen werden muss. Das typische Anwendungsbeispiel für Rückbau ist der Abbruch von einzelnen Etagen eines mehrgeschossigen Wohngebäudes. Dies kann eine kostengünstige und architektonisch wertvolle Modernisierungsmaßnahme darstellen. Deshalb sollte eine Rückbaumaßnahme immer als eine mögliche Variante zum konventionellen Abbruch gesehen werden. Abrissmaßnahmen kommen im Gegensatz zum Rückbau immer dann zum Einsatz, wenn der Altbestand auf dem nachzunutzenden Grundstück nicht mehr mit vertretbarem Aufwand einer Nutzung zugeführt werden kann. (s. ebd. 8) Im Rahmen dieser Arbeit, in der der Umgang der Wohnungswirtschaft mit Energiestandards untersucht wird, steht die energetische Modernisierung, also die bau- und haustechnischen Verbesserungsmaßnahmen im Vordergrund, weshalb auf die anderen soeben erläuterten Aspekte im Umgang mit Bestandsgebäuden im weiteren Verlauf der Arbeit nicht mehr eingegangen wird. Stufenweise Verbesserungskonzepte Für die Erneuerung des Wohnungsbestandes sind differenzierte Konzepte für eingegrenzte Erneuerungsziele gefragt um bei begrenzten Mitteln Wohnungen, Wohngebäude und Wohnanlagen bedarfsgerecht, kundenorientiert und werthaltig zu erneuern.(s. Institut für Wohnen und Umwelt 2002, 1) „Für eine zukunftsweisende Modernisierungsstrategie ist entscheidend, dass die Einzelmaßnahmen aufeinander abgestimmt sind und als Bausteine in mehreren Schritten durchgeführt werden können.“ (s. Kompetzenzzentrum 2006g, 7) Die durchgreifende „Vollmodernisierung“, Leitvorstellung früherer Sanierungsprogramme, kommt allenfalls bei sehr hohem Instandhaltungsrückstand in Frage. Der Begriff kennzeichnet die Absicht einen Wohnungsbestand so aufzurüsten, dass er möglichst in allen Belangen höchsten Anforderungen gerecht wird. (s. Institut für Wohnen und Umwelt 2002, 1) Bei der „Erneuerung in einem Zug“ folgen die vorgesehenen Bauarbeiten einer Erneuerungsmaßnahme in der technisch und sachlich gebotenen Abfolge unverzüglich aufeinander und werden abschließend fertig gestellt. Aus Gründen der Vermietung oder wegen fehlender Finanzierungsmittel kann dieses Ziel unter Umständen auf einen sehr langen Zeitraum aufgeschoben werden. Auch Teilmodernisierungen gelten als Erneuerung in einem Zug, wenn darauf folgende Maßnahmen nicht geplant sind. Dagegen wird bei einer „Erneuerung in Stufen“ die Erneuerungsmaßnahme, Voll- oder Teilmodernisierung, in ihrem geplanten Umfang aus bestimmten Gründen in einzelne zeitlich und sachlich begrenzte Maßnahmenbündel (Baustufen) aufgeteilt. Dabei kann es sich bei einer Stufe um kleinere Teilmaßnahmen („Einzelstufen“) oder auch um größere Maßnahmenbündel („Hauptstufen“) handeln. Nach jeder Stufe ist das Ge- 65 System Bestandsgebäude bäude wieder uneingeschränkt funktionsfähig, wenn es auch insgesamt keine Neubauqualität hat. Für die Wohnungsunternehmen gibt es unterschiedliche Gründe ihre Bestände entweder in Stufen oder in einem Zug zu erneuern. Für die Erneuerung in einem Zug sprechen im Wesentlichen drei Punkte. Der wichtigste Punkt sind die Mieterinteressen bzw. die Vermietungsbedingungen vor dem Hintergrund, dass die Mieter bei einer Modernisierung in einem Zug nur einmal belästigt werden, denn bei durchgreifenden Modernisierungsmaßnahmen im bewohnten Zustand können die Belastungen für die Mieter erheblich sein. Was für erträglich gehalten wird, hängt stark davon ab, wie sehr die Mieter an den Maßnahmen interessiert sind. Das zweite entscheidende Kriterium sind die Kostenvorteile bei der Baudurchführung. Der dritte für die Wohnungsunternehmen bedeutende Grund ist die wirtschaftliche Vermietbarkeit. Weitere Motive, wie z.B. die Nachhaltigkeit der Maßnahmen und Mieterwechsel spielen nur eine untergeordnete Rolle. (s. ebd. 3-5) Demgegenüber steht eine Reihe von Gründen, die den Ausschlag für eine Erneuerung in Stufen geben können. Die Mieterbelange spielen hier ebenfalls die wichtigste Rolle, denn in einzelnen Wohnungen kann nicht modernisiert werden, wenn die Mieter den Modernisierungen nicht zustimmen, da Wohnungsunternehmen häufig dem Konflikt mit den Mietern aus dem Weg gehen. An zweiter Stelle steht der Kapitalmangel, das heißt, eine durchgreifende „Voll-“ Modernisierung ist nicht finanzierbar. Ebenso kann die Dringlichkeit der Maßnahmen ein entscheidendes Kriterium sein. Es kann vorkommen, dass Erneuerungsmaßnahmen wegen ihrer Dringlichkeit keinen Aufschub dulden, die erforderlichen finanziellen Mittel aber fehlen um eigentlich dazu gehörende Maßnahmen gleich mit erledigen zu können. Sonstige Gründe für eine Erneuerung in Stufen beziehen sich hauptsächlich auf den Umfang und die Größe der Gesamtmaßnahmen, die eine Stufenerneuerung notwendig machen wie z.B. sehr komplexe Maßnahmen, die den Haushaltsrahmen eines Jahres des Wohnungsunternehmens sprengen würden. (s. ebd.4-6) Bei anstehenden größeren Erneuerungsvorhaben stellt sich die Frage, wie diese in finanziell und personell bewältigbare Abschnitte aufgeteilt werden können, sofern sich nicht aus den obigen Gründen für eine Vollmodernisierung entschieden wird. Möglich ist einerseits eine Abfolge von Stufen über den gesamten Bestand oder andererseits eine Abfolge von 66 Vollsanierungen einzelner Wohngebäude. Dabei können die erforderlichen jährlichen finanziellen Aufwendungen im Prinzip gleich hoch veranschlagt werden, sich der gleiche Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter des Unternehmens ergeben und die Gesamtmaßnahme zum gleichen Zeitpunkt abgeschlossen sein. Allerdings spricht für eine Vollmodernisierung in Stufen die Auswirkung auf die Mieter in den umliegenden Wohngebäuden. Durch diese Art der Modernisierung wird zum einen die Belästigung der Mieter in einem begrenzten Rahmen gehalten, man lebt neben der Baustelle und nicht darin, und zum anderen ist zu bedenken, dass zu Beginn der Erneuerungsmaßnahmen keinesfalls immer alle Mieter mit der Modernisierung einverstanden sind. Durch den punktuellen Beginn der Erneuerungen kann das Interesse dieser Mieter geweckt werden. Die Überzeugungsarbeit, die in der ersten Erneuerungsstufe geleistet wird, zahlt sich beim Fortschreiten der Maßnahmen aus, da die Mieter dann das Ergebnis der Erneuerung des ersten Abschnittes vor Augen haben. Eine Abfolge von Stufen über den gesamten Bestand hingegen kann zur Unzufriedenheit unter den Mietern führen, da die Mieter mehrmals direkt in ihrer Wohnung bzw. an ihrem Gebäude durch Bauarbeiten belästigt werden. Es kann auf Seiten der Mieter schnell die Beschwerde entstehen: „Warum habt ihr das nicht gleich mitgemacht?“ Eine sinnvolle Stufe nach technischer und wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit kann zum Beispiel die energetische Erneuerung des Hauses sein. Die energetische Modernisierung der Gebäude wird häufig nicht mit allen Komponenten in einem Zug durchgeführt. Eine sinnvolle Aufteilung in technisch voneinander unabhängige Teilstufen kann z.B. folgendermaßen aussehen: 1. Dämmung der obersten Geschossdecken bzw. des Daches und der Kellerdecken 2. Dämmung der Außenwände mit einem Wärmedämmverbundsystem und Einbau neuer Fenster mit Wärmeschutzverglasung 3. Erneuerung der Heizungsanlagentechnik. Theoretisch sind die Maßnahmen aufgrund ihrer technischen Unabhängigkeit voneinander auch in anderer Reihenfolge auszuführen. Allerdings ist bei vorgezogenem Einbau einer neuen Heizungsanlage zu berücksichtigen, dass diese auch ohne folgende Wärmedämmmaßnahmen ausreichend leistungsfähig ist. Es ist also sinnvoll, zuerst die wärmedämmtechnischen Maßnahmen abzuschließen um anschließend die Heizungstechnik auf diese abzustimmen. System Bestandsgebäude Bei Erneuerung ihrer Wohnungsbestände richtet sich der Blick der Unternehmen auf die Nachhaltigkeit der Investitionen: Die Wohnungen sollen langfristig mit anderen Angeboten konkurrenzfähig bleiben. Eine der Optionen bei dieser Perspektive ist die an Bausubstanz und Marktgegebenheiten angepasste Erneuerung in Stufen. Die Ausrichtung der Unternehmen auf ein wirtschaftlich optimales Ergebnis ist nicht ausschließlich als Ausrichtung auf die zahlungsfähige Nachfrage am Markt zu verstehen: nach ihrem wirtschaftlichen Umfeld als kommunale, genossenschaftliche oder industrieverbundene Unternehmen orientieren sie sich durchaus auch an Zielen, die nicht allein von der allgemeinen Nachfrage bestimmt und nicht allein an der Renditemaximierung orientiert sind. So sehen es kommunale Unternehmen durchaus auch als ihre Aufgabe an, Wohnungssuchende unterer Einkommensschichten oder – in Absprache mit der Kommune – auch Haushalte mit sozialen Problemen unterzubringen. Die Erneuerung in Stufen kann daher auch ein Mittel sein um Erneuerungsmaßnahmen auf ein bestimmtes Nachfragesegment von Haushalten zuzuschneiden, die auf preiswerte Wohnungen angewiesen sind. (s. ebd. 6-8) Modelle der Baudurchführung Neben den vorgestellten Überlegungen der Maßnahmenstufen, Standards und Baustufen bei der Altbaumodernisierung spielen die unterschiedlichen Modelle der Baudurchführung eine entscheidende Rolle für die Planung der Baumaßnahmen. Es ist für die Festlegung der Art und des Umfanges von Modernisierungsmaßnahmen ein großer Unterschied, ob in leeren oder bewohnten Wohnungen gearbeitet werden kann. Deswegen haben sich in der Praxis mehrere unterschiedliche Modelle der Baudurchführung etabliert. Alle Modelle haben gemeinsam, dass die vorhandenen Mieter, sofern sie für die Modernisierung ausziehen müssen, nach der Modernisierung die Chance erhalten, in ihre Wohnung oder zumindest in ihr Gebäude zurückzukehren. Dies ist eine Grundforderung sozialverträglichen Modernisierens. Im Wesentlichen gibt es drei gängige Modelle der Baudurchführung von Modernisierungsmaßnahmen. 1. Durchführung der Modernisierung in bewohnten Wohnungen. Im Rahmen dieses Modells entstehen starke Einschränkungen im möglichen und zumutbaren Maßnahmenvolumen aufgrund der Anwesenheit der Mieter. Diese Form der Baudurchführung stellt bei umfang- reicheren Modernisierungsmaßnahmen die ungünstigste Variante gegenüber dem ungehinderten Arbeiten in leeren Wohnungen und Gebäuden dar. 2. Getaktete Modernisierung: Bei der getakteten Modernisierung werden alle übereinander liegenden Wohnungen innerhalb eines Gebäudes „freigezogen“, so dass innerhalb dieser Wohnungen eine „ungestörte“ Modernisierung stattfinden kann. Bei dieser Methodik können auch die Installationsstränge des Gebäudes erneuert werden. Entscheidend für das Vorgehen bei dieser Modernisierungsvariante ist das Vorhandensein von genügend Ersatz- bzw. Ausweichwohnraums. Nach der Modernisierung ziehen Mieter in die fertig modernisierten Wohnungen und machen so wieder den nächsten Modernisierungstrakt frei. 3. Freiziehen: Bei sehr umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen bleibt häufig nur die Möglichkeit des „Freiziehens“ des gesamten Gebäudes um die Maßnahmen durchführen zu können. Benötigt wird bei dieser Methodik ein relativ großes Potential an Ersatzwohnraum in anderen Gebäuden. Die Mieter verlassen entweder nur vorübergehend, also für die Dauer der Modernisierung, oder endgültig ihre ursprüngliche Wohnung. In der Praxis wird häufig auch eine frei werdende Wohnung im Gebäude individuell modernisiert. Dies kann zu erheblichen Problemen zukünftiger Modernisierungsplanungen führen, denn wohnungsübergreifende Maßnahmen, wie zum Beispiel Ver- und Entsorgungsleitungen der Haustechnikinstallation oder Optimierungen von Wohnungsgrößen und -zuschnitten, können nicht realisiert werden. Innerhalb des Gebäudes entstehen unterschiedlichste Zustände und es werden verschiedene Produkte zeitversetzt eingebaut. Bei einer zukunftsfähigen Entwicklung der Wohnungsbestände lassen sich die verschiedenen Bauzustände zumeist nicht in einer sinnvollen Gesamtkonzeption zusammenführen, so dass in der Regel ein Verlust der vorher getätigten Bauinvestitionen entsteht. Die Überlegungen der Durchführungsmodelle müssen bereits beim ersten Herangehen an die Gebäude in der Bestandsaufnahme-Phase eine Rolle spielen. Sie geben einen Teil der technischen Kriterien bereits bei der Prüfung der vorhandenen Bausubstanz vor, da diese Prüfung unter Einbeziehung des Modells der Baudurchführung und von deren Einzelschritten 67 System Bestandsgebäude erfolgen muss. In diesem Zusammenhang ist eine rechtzeitige und ausführliche Information der Mieter wichtig, bei der das Wohnungsunternehmen, die Architekten und Ingenieure ihre Konzepte vorstellen um so mögliche Mieterwünsche berücksichtigen zu können. (s. Meisel 2005, 104-105) 3.4.4 Heutige Anforderungen an die Entwicklung von Bestandsgebäuden Im Altbaubereich genügt ein Großteil der bestehenden Gebäude nicht mehr oder nur unzureichend den zeitgemäßen Wohnvorstellungen (vgl. Kapitel 2.4). Der Wohnungsbestand muss heute an die spezifischen Lebensumstände seiner sich differenzierenden Nutzer sowie an geltende technische Standards angepasst werden. Um diesen differenzierten Anforderungen sozialverträglich, bautechnisch, wirtschaftlich und gestalterisch qualitativ gerecht zu werden, müssen diese Komponenten zu einer strategischen Bestandsentwicklung zusammengefasst werden. Durch die strategische Modernisierung der Wohnungsbestände soll in erster Linie die Wohn- und Lebensqualität der Bewohner gesteigert werden. Die Anforderungen an den Wohnstandort sind dabei im Wesentlichen von individuellen Wohnbedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten der Bewohner bzw. der Zielgruppe der Investoren bestimmt. Als nicht mehr zeitgemäß gelten verschachtelte Grundrisse, kleine Fensteröffnungen bzw. schlecht belichtete Räume, überalterte Küchen und Sanitärausstattungen, überholte haustechnische Anlagen sowie veraltete Elektroinstallationen. Diese sind insbesondere geprägt durch zu wenige Steckdosen für die Vielzahl, der heute üblichen technischen Geräte. Die zeitgemäßen Wohnvorstellungen (vgl. Kapitel 2.4) orientieren sich in der Regel an aktuellen Neubauten. Diese qualitativen Ansprüche sind jedoch im Rahmen einer Altbaumodernisierung und aufgrund der damit verbundenen hohen Investitionskosten, nicht immer bzw. nicht in der Breite des Bestandes umzusetzen. Es bestehen bereits eine Vielzahl von gegebenen Bedingungen, welche bei der Modernisierungsplanung berücksichtigt werden müssen. Die Energieeffizienz und die Energie- und Ressourceneinsparung bilden ein wichtiges Leitthema für die energetische Modernisierung, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Großteil der Gebäude in einer Zeit errichtet wurde, in der baulicher Wärmeschutz sowie energiesparender Anlagentechnik wenig Auf68 merksamkeit entgegengebracht wurde (vgl. Kapitel 3.6). Der Bestand besitzt somit auf diesem Sektor ein enormes Potential, die Effekte der Energieeinsparung sind hier in der Summe deutlich höher als im Neubausektor. Die energetische Modernisierung des Gebäudebestandes kann einen erheblichen Beitrag für die Umwelt - im Sinne der Nachhaltigkeit - leisten. (s. Kompetzenzzentrum 2006g, 6). Zusätzlich trägt eine energetische Modernisierung neben ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch unmittelbar zur Verbesserung des Raum- und Wohnklimas bei und erhöht damit die Wohnqualität (s. Kompetzenzzentrum 2007b, 2). Neben der Weiterentwicklung des Bestandes in energetischer und wohnqualitativer Sicht gilt es zunächst den vorhandenen Gebäudebestand im Sinne der Nachhaltigkeit zu erhalten. Dabei werden Ressourcen geschont sowie die Flächeninanspruchnahme für die Ausweisung neuer Baugebiete deutlich reduziert. Dies trägt wiederum zur Erhaltung des Landschafts- und Stadtbildes, zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden, zur Verminderung des Ressourcenverbrauchs und Umweltbeeinträchtigungen sowie zu einem rationellen Einsatz von Energie bei. (s. Kompetzenzzentrum 2006d, 5) 3.4.5 Erneuerung von Bauteilen und Bauteilschichten (Lebenszyklusbetrachtung) Die Lebenszyklusbetrachtung von Bauteilen und Bauteilschichten das Kopplungsprinzip spielen für den richtigen Zeitpunkt einer Modernisierung bzw. einer energetischen Modernisierung eine entscheidende Rolle und sollen deshalb im Folgenden näher vorgestellt werden. Das Kopplungsprinzip Die Kopplung wärmetechnischer Sanierungsmaßnahmen an ohnehin anstehende Instandsetzungs-, Erneuerungs- oder Modernisierungsmaßnahmen ist von zentraler Bedeutung für den zu betreibenden Aufwand energetischer Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten. Insbesondere im Hinblick auf den hohen Instandsetzungsbedarf der größten Baualtersklassengruppe des deutschen Gebäudebestandes ist es ratsam das Kopplungsprinzip bei Instandsetzungsmaßnahmen anzuwenden. Es kommt darauf an, die günstigen Zeitpunkte, an denen ohnehin baulicher Aufwand entsteht, für die zusätzliche Anbringung eines optimalen Wärmeschutzes zu nutzen. Bisher wurden diese Modernisierungszeitpunkte nur System Bestandsgebäude selten, trotz bestehender Förderprogramme, genutzt. Dabei ermöglicht die Maßnahmenkopplung eine Kostenreduktion für die eigentliche Maßnahme, z.B. eine zusätzliche Dämmung, denn einige Positionen fallen bei der Gebäudeinstandsetzung ohnehin an und andere können sogar entfallen. Auf eine anstehende Erneuerung des Außenputzes mit Abschlagen des alten Putzes kann z.B. verzichtet werden, wenn stattdessen ein Wärmedämmverbundsystem auf den bestehenden Putz aufgebracht wird. Von den Gesamtinvestitionen ist so ein Großteil der Kosten der Instandsetzung und nicht der Dämmung zuzuordnen. (s. Ebel 2000, 39) Abbildung 48 verdeutlicht dieses Prinzip am Beispiel der Kosten der einzelnen Arbeitsschritte für ein Wärmedämmverbundsystem in Bezug zu den Instandhaltungskosten. Weiterhin verdeutlicht diese Abbildung, dass eine größere Dämmstärke gegenüber einer geringeren nur einen recht geringen Kostenmehraufwand bedeutet. In Abbildung 49 sind einige Maßnahmen zusammengestellt, die sich für die Kombination von Wärmeschutz und Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand anbieten. Abschließend bleibt festzuhalten, dass „der richtige Zeitpunkt für energiesparende Maßnahmen spätestens dann gekommen ist, wenn im Laufe der Nutzung eines Gebäudes ohnehin Baumaßnahmen erforderlich werden.“ (Kompetenzzentrum 2007b, 2) Aufgrund dieser Tatsache, soll in einem nächsten Schritt die Lebensdauer von Bauteilen näher betrachtet werden. Lebensdauer von Bauteilen und Bauteilschichten Die Lebensdauer eines Hauses ist abhängig vom Umgang (Instandhaltung, Modernisierung) der Nutzer und Eigentümer mit dem Gebäude sowie von den spezifischen Bauteileigenschaften, der Ausführungsqualität und der konkreten Beanspruchung. Die Lebensdauer kann nicht pauschal beurteilt werden, sondern bezieht sich in erster Linie auf die Lebenserwartung einzelner Konstruktionen und Bauteile eines Gebäudes, die innerhalb von bestimmten Zeitabständen erneuert werden müssen. Die zu erwartende Restlebensdauer von Bauteilen bzw. Bauteilschichten im Bestand sind im Allgemeinen nur als grobe Schätzwerte anzusetzen, denn sofern regelmäßige Inspektionen und Instandsetzungen durchgeführt wurden, kann eine Abb. 48: Kosten der einzelnen Arbeitsschritte für ein WDVS an einem Mehrfamilienhaus 69 System Bestandsgebäude Abb. 49: Kopplungszeitpunkte für Wärmeschutzmaßnahmen höhere Lebensdauer angenommen werden, als bei unkontrollierten Bauteilen. Die Lebenserwartung wird deshalb mit „Von-bis-Werten“ angegeben. Für die Bewertung kann die mittlere Lebenserwartung als Orientierung angesetzt werden. Derzeit ist eine Abschätzung der Lebensdauer, der im Bestand vorhandenen Bauprodukte nur möglich, indem von der möglichen Lebensdauer eines neu hergestellten Bauteils ausgegangen wird und die jeweiligen lebensdauermindernden Beeinflussungen, wie z.B. mechanische Beanspruchungen, bauphysikalische und chemische Prozesse sowie Beanspruchungen aus Umwelteinflüssen, abgezogen werden. Eine subjektive Bewertung, ob durch einen Laien oder einen Fachmann, kann dabei nicht vollständig vermieden werden. (s. Kompetenzzentrum 2006a, 7) „Im Normalfall verschleißen die Außenbauteile und die Bauteile des Innenausbaus zuerst, und übrig bleibt der Rohbau, wenn keine ständige Instandhaltung erfolgt.“ (Meisel 2005, 24). Folgende Erneuerungsintervalle können für bestimmte Bauteile ausgemacht werden. Eine detaillierte Auflistung findet sich im Info-Blatt Nr. 4.2 „Lebensdauer von Bauteilen und Bauteilschichten“ des Kompetenzzentrums, welches zum Download zur Verfügung steht. „Nach 5 – 15 Jahren sollten - Tapeten und Anstriche innen - textile Fußbodenbeläge - Elektro-Warmwasserbereiter - Außenanstriche an Fassaden und Fenstern - Abdichtungen von Flachdächern erneuert werden. 70 Innerhalb der Zeitspanne von 15 – 30 Jahren sollten - Dachrinnen - Dachanschlüsse aus Zinkblech - Plattenverkleidungen außen - Verglasungen außen - Kunststoff-Bodenbeläge innen - Fugenabdichtung von Außenbauteilen - Heizkessel und -thermen sowie Heizkörper - elektronische Regeleinrichtungen - und Bauteile der 1. Erneuerungsgruppe zum zweiten Mal ausgetauscht werden. Nach 30 – 50 Jahren sollten dann - Dacheindeckungen und Dachanschlüsse - Kaminköpfe über Dach - Fenster und Außentüren - Außenwandputz und -bekleidungen - Teile des Wand- und Deckenputzes innen - Sanitärleitungsnetz für Bäder und Küchen - Ausstattung von Bädern und Küchen - Elektroinstallationsnetz mit Dosen und Schaltern - Rohrnetz der Heizungsanlage - Bauteile der 1. Erneuerungsgruppe zum dritten Mal und - Bauteile der 2. Erneuerungsgruppe zum zweiten Mal erneuert werden.“ (Meisel 2005, 25) Summiert man nun die Bauteile, die nach etwa fünfzig Jahren erneuert sind, fallen damit etwa 60-70 % des finanziellen Aufwands an, der für den ehemaligen Neubau bereits aufgebracht werden musste. Ist keine regelmäßige Bauunterhaltung erfolgt und tre- System Bestandsgebäude Abb. 50: Lebenszyklus eines Gebäudes ten umfangreiche Bauschäden auf, können auch die Kosten eines vergleichbaren Neubaus anfallen. Als besonders problematisch haben sich beispielsweise auftretende Feuchteschäden, welche die konstruktiven Bauteile beeinträchtigen und deren Behebung die Kosten der Baumaßnahme deutlich in die Höhe treiben, herausgestellt. Weiterhin ist bei der Konzeptfindung für die Weiterentwicklung von Wohngebäuden verschiedener Altersstufen die Tatsache zu berücksichtigen, dass in vielen Bereichen die ursprünglichen Bauteile und Ausstattungselemente nicht mehr vorhanden, sondern in Teilen bereits ersetzt sind. Durch umfassende Modernisierungsmaßnahmen wurden die originalen Bauelemente häufig verfremdet und ohne Gesamtkonzept eingebaut und entsprechen daher den heutigen Anforderungen nicht mehr. (s. Meisel 2005, 25 - 27) Phasen (während) der Lebensdauer eines Gebäudes Abb. 51: Lebenszykluskosten eines EFH errichtet nach EnEV Abb. 52: Gesamtenergieaufwand für Wohngebäude Die Lebensdauer der Bauteile ist von entscheidender Bedeutung für eine ökonomische und ökologische Bewertung von Konstruktionsvarianten für Gebäude über ihren Lebenszyklus. Ein aussagefähiger Kostenvergleich von Lösungsvarianten ist nur möglich, wenn Baukosten und Lebensdauer zueinander in Bezug gesetzt werden. (s. Kompetzenzzentrum 2006c, 2) Der Lebenszyklus eines Gebäudes lässt sich in folgende einzelne Lebenszyklusphasen einteilen: Planungsphase, Errichtungsphase, Nutzungs- und Betriebsphase, Instandhaltungs- und Modernisierungsphase, Umnutzungs-/Weiternutzungsphase, Rückbau und Wiederverwendung sowie Recyclingphase. (vgl. Abb. 50) „Die Lebenszyklusbetrachtung bietet die Chance, die Aufwendungen über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes - seien sie ökonomischer oder ökologischer Natur - auf der Grundlage einer fundierten Planung zu minimieren und gleichzeitig die Nutzungsqualität zu sichern.“ (Kompetzenzzentrum 2006b, 2) Erforderliche höhere Planungs- und Errichtungskosten lassen sich in der Regel – insbesondere durch Einsparungen bei den Nutzungskosten – refinanzieren, so dass insgesamt eine Senkung der Lebenszykluskosten möglich wird. Die Betriebskosten bilden in der Regel den variabelsten Anteil und machen mit Abstand den größten Kostenanteil aus, wie auch die Abbildung der „Kostenverteilung eines Einfamilienhauses errichtet nach Energieeinsparverordnung“ belegt (vgl. Abb. 51). Da 71 System Bestandsgebäude die einzelnen Lebenszykluskosten stark von den zukünftigen Preisentwicklungen am Arbeits- und Rohstoffmarkt sowie der Energiepreisentwicklung (vgl. Kapitel 3.1) beeinflusst werden, sind diese sowohl bei der Lebenszyklusbetrachtung im Rahmen des Entwurfes als auch bei Modernisierungsmaßnahmen sinnvoll zu berücksichtigen. (s. ebd. 2 - 4) Innerhalb der ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung werden die drei Aspekte der Nachhaltigkeit, also ökonomische, ökologische und soziokulturelle Aspekte berücksichtigt. Die ökonomische Dimension umfasst im Groben die Minimierung der Lebenszykluskosten von Gebäuden (vgl. Abb 51), die Reduzierung von Umbau- und Erhaltungsinvestitionen im Vergleich zum Neubau sowie die Optimierung der Aufwendungen für technische und soziale Infrastruktur. Die ökologische Dimension beschäftigt sich mit der Suche nach der Antwort für die globalen Probleme der begrenzten energetischen Ressourcen, insbesondere von fossilen Energieträgern, und die daraus resultierende Steigerung der Energiekosten sowie mit dem Klimawandel, der durch Umweltbelastungen verursacht wird. Die soziokulturellen Aspekte des Lebenszyklus von Gebäuden sind selten quantifizierbar, beeinflussen aber die funktionelle Dauerhaftigkeit eines Gebäudes. Die Gesamtlebensdauer eines Gebäudes wird stark von seiner flexiblen Nutzbarkeit bestimmt. (s. ebd. 3 - 4) Mit der Verknappung der fossilen Ressourcen (vgl. Kapitel 3.1) ist ein langfristiger Preisanstieg für die derzeit wichtigsten Energieträger Gas, Öl sowie indirekt auch Strom verbunden. „Die Minimierung des Energieverbrauchs wird somit zu einem zentralen Anliegen der Gebäudeplanung, nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen.“ (s. ebd. 8) Bislang war es nicht nötig den Energieaufwand der verbauten Energie aufgrund seines geringen Anteils zu berücksichtigen. „Je weiter jedoch der Heizenergiebedarf durch zusätzliche Maßnahmen – wie z.B. einen verbesserten baulichen Wärmeschutz und eine effiziente Energieversorgung – gesenkt werden kann, umso sinnvoller wird zukünftig eine energetische Bewertung unter Einbeziehung der Erstellungsphase.“ (vgl. Abb. 52) (s. ebd.9) 72 3.5 Potentiale der Energieeinsparung im Wohngebäudebestand Hohe Energieeinsparpotentiale innerhalb der wohnungswirtschaftlichen Bestände Nachdem im vorherigen Abschnitt Umgangsmöglichkeiten mit Bestandsgebäuden erörtert wurden, sollen innerhalb dieses Kapitels die Potentiale der Energieeinsparung im Wohngebäudebestand kurz erläutert werden. Hierzu wird zunächst der Endenergieverbrauch nach Verbrauchssektoren betrachtet um danach näher auf das energetische Niveau von Gebäuden sowie die wohnungswirtschaftlichen Bestände und deren Entwicklungschancen einzugehen. Abb. 53: Aufteilung des Endenergieverbrauchs auf Verbrauchssektoren in Deutschland 1990 - 2004 3.5.1 Endenergieverbrauch der Verbrauchssektoren Die Umweltproblematik der gegenwärtigen Zeit, welche im Zusammenhang mit der Umwandlung und dem Verbrauch von Energie steht, führt zunehmend zu einer internationalen Diskussion um Maßnahmen zur Bewältigung der damit verbundenen Anforderungen. Diese Bestrebungen führten in der Vergangenheit zu internationalen Vereinbarungen wie z.B. dem „White Paper“ der Europäischen Kommission oder den Beschlüssen von Kyoto der Vereinten Nationen, welche nicht zuletzt auch für Deutschland einen zukünftigen Handlungsbedarf definieren und sich in nationalen Gesetzen wie z.B. der Energieeinsparverordnung niederschlagen (vgl. Kapitel 3.6). Zentrale Ansatzpunkte zur Bewältigung obiger Problematiken sind die Steigerung der Energieeffizienz, und allgemeiner, die Entwicklung von nachhaltigen Energie- und Gesellschaftssystemen. Einen wesentlichen Bereich für den Einsatz von innovativen, energieeffizienten Technologien, stellt in diesem Sinne der Gebäudesektor dar (vgl. Abb.53). In der Abbildung 54 wird deutlich, dass der Gebäudesektor mit 43,8 % den 73 Potentiale der Energieeinsparung im Wohngebäudebestand größten Endenergieverbrauch aller Verbrauchssektoren aufweist. Der wesentliche Anteil der Endenergie wird im Gebäudesektor für Raumheizwärme (75, 4 %) sowie Warmwassererzeugung (15,9 %) benötigt. Diese Beobachtungen unterstreichen die wesentliche Bedeutung des Gebäudesektors und des Gebäudebestandes, wenn es um das Thema „Energieeinsparung“ geht. (s. Biermayr 2001, 5) 3.5.2 Energetisches Niveau von Gebäuden Etwa drei Viertel der Wohngebäude in Deutschland wurden vor 1978 errichtet (vgl. Abb. 38) und entsprechen damit – sofern sie nicht zwischenzeitlich modernisiert wurden – bei weitem nicht mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Wohnkomfort. Unter energetischen Gesichtspunkten sind aber auch die Gebäude, die vor Einführung des gesetzlichen Energiestandards (EnEV) oder nicht nach einem freiwilligen Energiestandard (vgl. Kapitel 3.6) errichtet wurden, als „Altbauten“ zu betrachten. Diese „Altbauten“ weisen ein beträchtliches Potential zur Energieeinsparung im Gebäudebestand auf (vgl. Abb. 54). In Abbildung 54 wird die energetische Situation von Wohngebäuden mit der Darstellung des spezifischen Heizwärmebedarfs verdeutlicht. Hierbei fällt auf, dass der spezifische Heizwärmebedarf der Gebäude bis etwa 1968 Werte über 200 kWh/(m²a) erreichen kann. Diese Werte variieren je nach Gebäudetyp zwischen 150 kWh/(m²a) für große Mehrfamilienhäuser und 350 kWh/(m²a) für kleine Einfamilienhäuser. Der mittlere spezifische Heizwärmebedarf liegt bei 230 – 270 (kWh/(m²a). (s. Kompetzenzzentrum 2007b, 23) Wesentliche Grundlagen für die Entwicklung des spezifischen Heizwärmebedarfs sind dem Abschnitt 3.6.1 „Genese der Energiestandards“ zu entnehmen. Die ab 1968 für den Neubau eingeführte Wärmeschutzverordnung und deren Weiterentwicklung haben zu einem deutlich verminderten spezifischen Heizwärmebedarf geführt, von ca. 170 (kWh/(m²a) nach Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahre 1977 bis auf ca. 70 (kWh/(m²a) nach Einführung der EnEV 2002. Der sich im Neubau bereits etablierte freiwillige Standard des Passivhauses führt zu einer Heizwärmebedarfsverminderung auf unter 15 (kWh/(m²a). Das technische Einsparpotential für Heizwärme im Gebäudebestand beträgt somit 80 - 90 %, da es auch im Bestand möglich ist Niedrigenergiesowie Passivhausstandard zu erreichen (vgl. Kapitel 3.6 und 3.7). 74 Abb. 54: Heizwärmebedarf des Wohngebäudesbestandes einer Großstadt 3.5.3 Energieeinsparpotentiale innerhalb der wohnungswirtschaftlichen Bestände Wie im Abschnitt „Aufgabenfeld Planen und Bauen im Bestand“ (3.4.2) vorgestellt, haben die Wohnungsunternehmen innerhalb der letzten Jahre ihr Augenmerk auf die Bestandsentwicklung ausgerichtet. Auch in energetischer Hinsicht haben sich die Bestände verbessert. „Seit 1990 wurden bei den im GdW und seinen Mitgliedsverbänden organisierten Wohnungsunternehmen ca. 27 % der bewirtschafteten Wohnungen umfassend energetisch modernisiert, bei weiteren ca. 24 % der Wohnungen fanden partielle Maßnahmen statt. Jede zweite Wohnung der GdW-Mitgliedsunternehmen wurde somit seit 1990 in ihrer Energieeffizienz deutlich verbessert.“ (GdW 2006, 12) Der Endenergieverbrauch wurde um 14 % reduziert und somit auch der CO2-Ausstoß, so dass die vom GdW vertretenen Wohnungsunternehmen das Kyoto-Ziel (vgl. Kapitel 3.2) bereits jetzt erfüllen. Nach einer groben Schätzung, der noch zu erschließenden Energiesparpotentiale ergab sich, dass allein durch nachträgliche Wärmedämmung und verbesserte Fenster der Energieverbrauch in den nächsten 20 bis 30 Jahren um etwa 40 % reduziert werden könne. Werden bei dieser Schätzung noch die Potentiale durch Heizanlagensanierungen und Solarenergie miteinbezogen, so ist eine Reduktion von 50 % und mehr möglich. (s. Umweltbundesamt; GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V. 2003, 9) In einer Studie des IWU wird sogar von einer Heizwärmebedarfseinsparung von 65 - 80 % im Bestand der Wohnungsunternehmen ausgegangen (s. IWU 2001b, 41). Abschließend kann man also festhalten, dass bereits ein Teil der Bestände energetisch modernisiert wurde und aufgrund der Langlebigkeit bautechnischer Maß- Potentiale der Energieeinsparung im Wohngebäudebestand nahmen innerhalb der nächsten 20-30 Jahre wahrscheinlich nicht mehr energetisch modernisiert wird. Der Bestand der Wohnungsunternehmen bietet aber immer noch ein enormes Energieeinsparpotenzial. Um den Energiebedarf nachhaltig zu senken, reicht es nicht aus, energetische Modernisierungen an den derzeitig gesetzlichen Anforderungen auszurichten. Der Energiestandard ist vielmehr unter wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und nachhaltigen Gesichtspunkten abzuwägen. 3.5.4 Primärenergie- und Emissionsbilanz von Wärmeschutzmaßnahmen Im Wesentlichen kann der gesamte Primärenergieeinsatz, während der Lebensdauer eines Gebäudes, den drei Phasen „Errichtung“, „Nutzung“ und „Abriss“ zugeordnet werden (vgl. Abschnitt 3.4.5). Bislang werden für Raumheizung, Warmwasser sowie Licht und Kraft während der Nutzungsphase über 90 % des gesamten Energieeinsatzes aufgewendet. Dieser Energieeinsatz kann durch Maßnahmen des Wärmeschutzes (vgl. Kapitel 3.6 und 3.7) deutlich reduziert werden, so dass die Herstellungs- und die Abrissphase an Bedeutung gewinnen. Bisher umfasst der Energieeinsatz bei der Herstellung lediglich einen Anteil von maximal 5 % und setzt sich im Wesentlichen aus dem Energieverbrauch für die Fertigung der Baustoffe, deren Transport zur Baustelle und ihre Verarbeitung vor Ort zusammen. Der Anteil des Primärenergieeinsatzes für den Abriss eines Gebäudes beträgt etwa 4 bis 6 % des Gesamtaufwandes. Einsparpotentiale bestehen in diesem Bereich vor allem durch die Wiederverwendung des Bauschutts. Im Straßenbau können bis zu 70 % des anfallenden Abbruchmaterials wiederverwertet werden, dagegen liegt die Recyclingrate im Hochbau mit etwa 40 % wesentlich niedriger. Anzustreben ist hier ein weitgehend geschlossener Stoffkreislauf, bei dem aufgearbeitete Altbaustoffe die Primärbaustoffe ersetzen. Dies wird derzeit vor allem durch die Heterogenität des Bauschutts erschwert. Eine Trennung der Baustoffe nach Materialgruppen muss deshalb schon bei der Herstellung der Stoffe berücksichtigt werden. (s. Ebel 2000, 59) Primärenergie- und Emissionsbilanz Wandkonstruktionen von An dieser Stelle soll nun die Primärenergie- und Emissionsbilanz von Wandkonstruktionen verglichen werden, um zu prüfen, ob die Dämmung der Wände zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Bilanzen führt. Der Primärenergiebedarf zur Herstellung von Baustoffen wird über eine Prozesskette bestimmt, die im Wesentlichen drei Schritte umfasst: − den direkten Energiebedarf beim Herstellungsprozess − den Energiebedarf zur Aufbereitung der benötigten Rohstoffe − den indirekten Energiebedarf, z.B. für Gebäudeheizung oder die Herstellung der Maschinen Der so bestimmte „Primärenergiegehalt“ der Materialien darf nicht für sich allein beurteilt werden, sondern muss im Zusammenhang mit der benötigten Menge, der Lebensdauer des daraus hergestellten Bauteils, damit verbundener Heizenergieeinsparungen und weiterer Faktoren gesehen werden. In Abbildung 55 ist aus diesem Grund der kumulierte Primärenergieaufwand für verschiedene Wandkonstruktionen gegenübergestellt. Im linken Teil der Abbildung wird der gesamte Primärenergieaufwand für die Herstellung der Wand mit dem Heizenergiebedarf verglichen. Es ist zu erkennen, dass der Anteil des Primärenergieaufwands der Wandherstellung von 4 % bei der schlechtesten Dämmung (Typ G) bis auf knapp 17 % bei der besten Dämmung (Typ A) ansteigt. Selbst bei den gut gedämmten Typen A bis C ist der Heizenergieaufwand also um mehr als das Fünffache höher als der Primärenergieaufwand für die Herstellung der Wand. Im rechten Teil der Abbildung werden die einzelnen Bestandteile der Wand miteinander verglichen. Daraus wird ersichtlich, dass der Anteil der Dämmung am Energieaufwand der Herstellung der ganzen Wand maximal 21 % beträgt. Die Abbildung 56 gibt einen Überblick über die untersuchten Konstruktionen bzw. Wandaufbauten. Trotz der Unsicherheiten solcher Untersuchungen kann eindeutig festgehalten werden, dass gedämmte Wände eine entscheidende Verbesserung der Primärenergiebilanz bewirken und dass der Primärenergieaufwand für die Dämmstoffe vergleichsweise unbedeutend ist. Auf Grundlage dieser Untersuchungen wurde anhand eines Sanierungsbeispiels die optimale Dämmstoffstärke hinsichtlich des Primärenergieeinsatzes untersucht. Diese Untersuchungen ergaben, dass erst bei einer Mineralfaserdämmung von etwa 80 cm der Primärenergieaufwand für die Wand den Heizenergiebedarf übersteigt. Bei Polystyrol liegt dieser Wert bei ca. 45 cm. Analoge Überlegungen wurden für die 75 Potentiale der Energieeinsparung im Wohngebäudebestand Emissionen von Schwefeldioxid (S02) und Stickoxide (NOx) angestellt und führten zu dem Ergebnis, dass erst Dämmschichtdicken von mehr als 70 cm zu Schadstoffemissionen führen, die mit denen aus dem Betrieb der Heizungsanlage vergleichbar sind. Das ökologisch sinnvolle Optimum von Dämmstoffstärken liegt also deutlich über den heutigen Dämmstandards. (s. Ebel 2000, 59 - 61) Die energetischen Amortisationsrechnungen in Fachinformationszentrum Karlsruhe 2004 sind ein weiterer Beleg für diese Annahmen. Die Berechnungen zeigen, dass es maximal 23 Monate dauert bis die Herstellungsenergie für die Dämmstoffe wieder zurückgewonnen ist (s. Fachinformationszentrum Karlsruhe 2004, 15 - 19). Es liegen bei den unterschiedlichen Dämmstoffen hinsichtlich ihres Primärenergieeinsatzes zur Herstellung sowie ihrer Lebensdauer sehr deutliche Unterschiede vor, wodurch der Dämmstoffwahl aus ökologischer Sicht eine große Bedeutung zukommt. Abschließend lässt sich also festhalten, dass sich Dämmen aus ökologischen Gesichtspunkten immer lohnt. Um eine optimale Ökologie zu erreichen, sollte allerdings gezielt auf die unterschiedlichen Dämmstoffeigenschaften geachtet werden. 3.5.5 Denkmalschutz und optische Aspekte bei energetischen Modernisierungen Abb. 55: Gegenüberstellung des Primärenergieaufwandes verschiedener Wandkonstruktionen und dem jeweiligen Heizenergiebedarf (Wandtypen s. Abb. 56) Abb. 56: Kumulierter Primärenergieaufwand für Häuser mit verschiedenen Außenwänden 76 Sachlich-bautechnische Restriktionen betreffen in der Regel nicht die Gesamtheit der möglichen Wärmeschutzmaßnahmen an einem Gebäude und auch nicht alle Baualtersklassen. In erster Linie bestehen sie für Gebäude der älteren Baualtersklassen vor 1945, die eine erhaltenswerte Fassade aufweisen und beziehen sich deshalb überwiegend auf die Außenwand. Sonstige für die Wärmebilanz des Gebäudes entscheidende Bauteile wie Dächer, Fenster, Kellerdecken oder Fußböden sind auch in den älteren Baualtersklassen nur marginal betroffen. Sie können in der Regel durch die Wahl von Dämmstoffen mit geringerer Wärmeleitfähigkeit qualitativ gleichwertig, wie bei sonstigen Gebäudetypen, verbessert werden. Darüber hinaus betreffen Restriktionen aus dem Bereich der Landes-Denkmalschutzgesetze nur rund 15 % der gesamten deutschen Gebäudesubstanz (einschließlich Nichtwohngebäude). In dem Fall, dass an der Außenwand von Gebäuden keine Dämmmaßnahmen durchgeführt werden können, sei es aus Gründen des Denkmalschutzes oder aus optischen Gründen, sollte geprüft werden, ob eine Innenwanddämmung erfolgen kann. (s. Ebel 2000, 40-41) Die Wohnungswirtschaft sollte durch Restriktionen im Bereich der Denkmalpflege bei der Gebäudemodernisierung nur in wenigen Fällen eingeschränkt werden, da lediglich 16 % des Gebäudebestandes der Unternehmen vor 1948 errichtet wurden. 3.6 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung Eine rasante Entwicklung innerhalb der letzten 30 Jahre In diesem Kapitel wird der gesetzliche Rahmen zum Thema Energie mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) detaillierter betrachtet. Die EnEV stellt eine wichtige rechtliche Basis jeder aktuell geplanten Baumaßnahme dar. Neben der Erläuterung der Genese der Energiestandards werden vor allem die Anforderungen der EnEV an Bestandsgebäude und den Energiepass herausgestellt. Die historische Entwicklung der Energiestandards zeigt, wie oft die Standards angepasst werden, wo die Rechtsetzungskompetenzen liegen und wie weit die Standards auf europäischer Ebene bereits vereinheitlicht sind. Die Entstehungsgeschichte ist wichtig zum Verständnis der heutigen Situation. Insbesondere die Direktive der EU ist für die zukünftige Entwicklung von zentraler Bedeutung. Zusätzlich zu den heute geltenden gesetzlichen Standards werden die immer häufiger auftretenden aktuellen „freiwilligen“ Standards betrachtet, die die gesetzlichen Standards in ihren Anforderungen übertreffen und den zukünftigen Entwicklungen vorauseilen. 3.6.1 Genese der Energiestandards Das folgende Kapitel beleuchtet die Genese der Energiestandards. Die Energiestandards sind als Vorschriften definiert, welche der Gesetzgeber als verbindlich erklärt hat. Diese lassen sich mittels dreier Dimensionen beschreiben: Es sind die Entwicklungsgeschichte (Genese), die technische Ausgestaltung sowie der Vollzug und die Kontrolle. Die heutige Ausgestaltung der Standards ist das Resultat einer langjährigen Entwicklungsgeschichte, an der verschiedene Akteure beteiligt sind. Die Entwicklungsgeschichte und die Inhalte der Standards sind prägend für den Vollzug der Vorschriften (vgl. Abb. 57). Die Bedeutung des Wärmeschutzes nimmt immer mehr zu, doch das heute aktuelle Thema „Energieeinsparung“ und „Energiestandards“ war lange Zeit kein Thema in der Gesetzgebung. Erst mit der Energiekrise der 70er Jahre gewann es an Bedeutung. Vorher konzentrierte man sich bei der Errichtung von Gebäuden in erster Linie auf Kriterien der Standsicherheit sowie den Schutz von Feuchtigkeitseinwirkungen. Die Erdölkrise 1973 bildete in vielen Ländern den Ausgangspunkt für die Etablierung von Energie- 77 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung Abb. 57: Drei Dimensionen zur Beschreibung von Wärmeschutzstandards Abb. 58: Auswirkungen der Gesetzgebung auf den Heizenergiebedarf von Wohngebäuden (Stand 2001) standards. Die heutigen Vorschriften der Energiestandards basieren alle auf dem 1976 geschaffenen Energieeinspargesetz. Dieses wurde als Reaktion auf die erste Energiekrise in den 70er Jahren geschaffen und bildet die Grundlage für die Wärmeschutzverordnung (WSVO), welche die Vorschriften im Gebäudebereich regelt. Diese Schutzverordnung ist in der ganzen Bundesrepublik Deutschland für den Neubau sowie die Renovierung und den Umbau gültig und zwar für alle Gebäudetypen. Die Länder verfügen über keine Kompetenz eigene Energiestandards zu gestalten. Hingegen übernehmen sie die Aufgaben der Exekutive: sie müssen die WSVO in ihren Bauordnungen verankern und die Verfahren zu deren Umsetzung regeln. Insbesondere regeln sie die Zuständigkeiten im Vollzug. 2002 wurde die WSVO von der EnEV, die später genauer vorgestellt wird, abgelöst. Der Wärmeschutz bei Gebäuden war früher nicht von Bedeutung. Etwa bis zum Zweiten Weltkrieg unterschieden sich die Bauarten im Wohnungsbau kaum von denen im 19. Jahrhundert. Konventionelle Bauten aus Mauerwerk oder Fachwerk stellten bewährte Bauweisen dar. Standsicherheit und Festigkeit waren die wesentlichen Kriterien. Im Fachwerksbau richtete sich die Dicke der Ausfachung nach der Dicke der tragenden Holzquerschnitte, die etwa 16 bis 20 cm betrugen. Die wärmedämmenden Eigenschaften waren im Vergleich zur Dicke und Festigkeit von untergeordneter Bedeutung. Die geringe Bedeutung 78 des Wärmeschutzes spiegelt sich auch in DIN 4110 „Technische Bestimmungen für die Zulassung neuer Bauweisen“ (Ausgabe 1934) wider. Der Wärmeschutz wird eingehalten, wenn er dem einer 1 ½ Stein dicken Vollziegelwand mit Außen- und Innenputz entspricht. 1938 kam die Norm in der 2. Ausgabe mit quantitativen Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz heraus. Danach mussten Außenwände einen Wärmedurchgangswiderstand 1/Λ von mindestens 0,47 m²K/W aufweisen. Diese ersten zahlenmäßigen Anforderungen an den Wärmeschutz waren nicht wissenschaftlich ermittelt, sondern aus den mit dem konventionellen Mauerwerksbau erlangten Erfahrungen abgeleitet. Die erste Ausgabe, der heute in mehreren Teilen vorliegenden Wärmeschutznorm DIN 4108 „Richtlinien für den Wärmeschutz im Hochbau“, erschien 1952. In ihr wurden drei Wärmedämmgebiete (I, II und III) eingeführt. Im mittleren Dämmgebiet galt der bisherige Mindestwert von 0,47 m²K/W für den Wärmedurchgangswiderstand. In den beiden anderen Gebieten wurde der Wert um etwa 0,1 erniedrigt (0,39) bzw. erhöht (0,55). In den Jahren 1960 und 1969 folgten mit geringen Änderungen überarbeitete Fassungen der DIN 4108, welcher zufolge der Wärmeschutz folgende Aufgabe hat: Der Wärmeschutz hat bei Bauten, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, Bedeutung für die Gesundheit der Bewohner, Bewirtschaftungskosten der Bauten (Kohlenersparnis) und Herstellungskosten der Bauten. „Ausreichender Wärmeschutz ist Vorraussetzung für die Schaffung gesunder und behaglicher Räume.“ (Frauenhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB 2003, 9-10) Vergleicht man die ersten Anforderungen an den Wärmeschutz nach DIN 4110 von 1934 bis hin zur DIN 4108 von 1969, zeigt sich, dass die Anforderungen in etwa gleich geblieben sind. Es galten nach wie vor die aus den früheren Baugepflogenheiten abgeleiteten üblichen Wanddicken als maßgeblich für den Wärmeschutz. Zielsetzung war vorrangig die Vermeidung von Bauschäden sowie die Schaffung hygienischer Wohnbedingungen. Der Energieverbrauch spielte keine große Rolle, da Energie in ausreichender Menge günstig zur Verfügung stand. Die Energiekrise 1973 verdeutlichte, dass Erdöl nicht unbegrenzt zur Verfügung steht (vgl. Kapitel 3.1). Aufgrund der kurzfristig verfünffachten Erdölpreise begann ein Lernprozess, der z.B. durch autofreie Sonntage jedem Bürger bewusst wurde. Als erste gesetzliche bauliche Reaktion wurden 1974 ergänzende Bestimmungen zur DIN 4108 von 1969 herausge- Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung geben. Das Wärmedämmgebiet mit den geringsten Anforderungen wurde gestrichen. Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Fenster mindestens mit doppelter Verglasung mit einem k-Wert von höchstens 3,5 W/m²K auszuführen sind. Einfachverglasungen verschwanden vom Markt. 1976 trat somit als Folge der Energiekrise das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) in Kraft. Es bildete die Rechtsgrundlage für staatliche Vorgaben hinsichtlich rationeller Energieverwendung. 1977 wurde auf Basis des Energieeinsparungsgesetzes die erste Wärmeschutzverordnung geschaffen, die 1978 in Kraft trat. Sie begrenzte den Wärmedurchgang für einzelne Bauteile und legte fest, dass Fenster mindestens mit Isolier- oder Doppelverglasung auszuführen sind. Weiterhin wurde der Fugendurchlasskoeffizient von Fenstern und Fenstertüren begrenzt, außerdem mussten alle sonstigen Fugen luftdicht sein. In der Verordnung heißt es: „Die sonstigen Fugen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche müssen dauerhaft und entsprechend dem Stand der Technik luftundurchlässig abgedichtet werden.“ (ebd. 11) 1982 wurde eine erste Novellierung vorgenommen, die ab 1984 Gültigkeit bekam. Sie bildete im Sinne des Gesetzgebers eine notwendige Anpassung an die Energiesituation (zweite große Ölkrise) und führte zu einer weiteren Herabsetzung des maximal zulässigen Heizwämebedarfs. Sie sah gegenüber der ersten Regelung eine massive Verschärfung der Standards vor (vgl. Abb. 58). Beispielsweise wurde der k-Wert von Fenstern auf 3,1 W/m²K gesenkt. Neu war auch die Begrenzung des Wärmedurchgangs bei baulichen Änderungen an bestehenden Gebäuden. Hierdurch wurde zum ersten Mal die Möglichkeit geschaffen auf das enorme Energieeinsparpotential der Gebäude im Bestand Einfluss zu nehmen. Somit mussten seit 1984 Gebäude im Bestand bei einem erstmaligen Einbau oder Ersatz bzw. Erneuerung von Außenbauteilen wärmetechnisch verbessert werden. Es wurde z.B. für Außenwände ein Wärmedurchgangswiderstand von 1,50 m²K/W vorgeschrieben, was einem maximalen k-Wert von 0,60 W/m²K entspricht. Die erforderliche Dämmstoffdicke betrug bei Außenwänden 50 mm, bei Dächern 80 mm und bei Kellerdecken 40 mm. Diese Anforderungen wurden bei Erneuerungsmaßnahmen, die mehr als 20% der Gesamtfläche der jeweiligen Bauteile ausmachten, verpflichtend. Diese 20% -Regelung gilt bis heute und hat den Hintergrund, dass sich eine ohnehin durchzuführende Sanierung ab einer gewählten Grenze von 20% der Bauteilflä- che mit energetisch wirksamen Maßnahmen verbinden lässt. Seit Ende der 80er Jahre traten neue Argumente für einen verstärkten Wärmeschutz bei Gebäuden auf. Wärmeschutz wurde nun im Sinne von Umweltschutz und somit als Klimavorsorge betrachtet. Umwelt- und Klimaschutzaspekte rückten in den Vordergrund (vgl. Kapitel 3.2). 1992 wurde auf der Klimakonferenz von Rio de Janeiro zum ersten Mal die Förderung des umweltverträglichen Bauens thematisiert. Ein übermäßiger Ressourcenverbrauch und die Schädigung empfindlicher Ökosysteme sollten in Zukunft vermieden werden. Die zweite Novellierung der WSVO fand 1995 statt. Ziel der 3. WSVO ist es, im Neubau den Niedrigenergiehaus-Standard mit einem rechnerischen Ölverbrauch von weniger als 10 l pro m² Wohnfläche und Jahr zu erreichen. Hierzu wurde eine erste Bilanzierungsmethode zur Durchdringung des Jahresheizwärmebedarfs eingeführt. Der rechnerische Heizwärmebedarf wird in Abhängigkeit des A/V-Verhältnisses (Außenfläche zu Volumen-Verhältnis) des Gebäudes bestimmt. Die Wärmegewinne und -verluste konnten durch dieses Verfahren gemeinsam bilanziert werden. Der Bundesrat knüpfte seine Zustimmung zur 3. Wärmeschutzverordnung an eine weitere Senkung des CO2 -Ausstoßes. Gegenüber der 2. WSVO werden die Anforderungen zur Begrenzung des Heizwärmebedarfs bei baulichen Änderungen bestehender Gebäude weiter verschärft. Bei erstmaligem Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Bauteilen darf z.B. der k-Wert von Außenwänden nicht größer sein als 0,40 W/m²K. Das entspricht einer Mindestdämmstoffdicke von etwa 80 mm. Bei neu einzubauenden Fenstern darf der k-Wert 1,8 W/m²K nicht überschreiten. Seit März 2001 regelt die neue Wärmeschutznorm, also die neue DIN 4108 „Wärmeschutz und EnergieEinsparung in Gebäuden“, die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. Die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz wurden erhöht, Wärmedämmsysteme als Umkehrdach und außenliegende Wärmedämmung erdberührter Gebäudeflächen berücksichtigt. Weiterhin werden konkrete Anforderungen an Wärmebrücken und den sommerlichen Wärmeschutz gestellt. Der Mindestwert für den Wärmedurchlasswiderstand von Außenwänden wurde von 0,55 auf 1,2 m²K/W angehoben. Das entspricht einer Verschärfung des k- bzw. U-Wertes von bisher 1,39 auf 0,73 W/m²K. Bereits 1993, bei der Verabschiedung der 3. WSVO, 79 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung wurde im Bundesrat eine weitere Verschärfung der Anforderungen nach 1995 verlangt um deutliche Verringerungen der CO2-Emissionen zu erreichen. Diesen Forderungen wurde im Rahmen der EnEV 1999 Rechnung getragen. Im Jahr 2002 wurde die Wärmeschutzverordnung schließlich abgelöst durch die Energieeinsparverordnung (EnEV). In jedem Schritt der gesetzlichen Anpassung der Energiestandards wurden die Anforderungen verschärft (vgl. Abb. 58). 3.6.2 Heutiger Stand der Energiestandards Die EnEV basiert in der heutigen Ausgestaltung auf verschiedenen Normen insbesondere der DIN EN 832. Sie ist sowohl für den Neubau als auch für bestehende Bauten anwendbar. Die EnEV regelt die Ausstellung der Energieausweise, gibt energetische Mindestanforderungen für Neubauten sowie für Modernisierungen, Umbauten, Ausbauten und Erweiterungen bestehender Gebäude vor. Außerdem stellt sie Mindestanforderungen für Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie Warmwasserversorgung auf und regelt die energetische Inspektion von Klimaanlagen. Sie definiert im Detail die Grenzwerte, verweist jedoch bei den Berechnungsverfahren auf entsprechende Normen (DIN 4701, EN 832). Die Grundlage jeder energetischen Modernisierung bildet der gesetzliche Rahmen. Der Gesetzgeber erteilt verbindliche Auflagen und allgemeingültige Standards, die von jedem Bürger erfüllt werden müssen. Den aktuellen Standard gibt in Deutschland die Energieeinsparverordnung vor, deren Grundlage das Energieeinspargesetz ist (vgl. Kapitel 3.7). „Was regelt die EnEV?“ Die seit dem 1. Februar 2002 in Kraft getretene Energieeinsparverordnung – Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden – stellt eine deutliche Zäsur bezüglich der Energiestandards in Deutschland dar. Sie löst sowohl die bisher geltende Wärmeschutzverordnung als auch die Heizanlagenverordnung ab. Hierdurch soll eine Vereinfachung im Regelwerk erzielt werden, indem sowohl Heizung als auch Gebäudehülle in einem einheitlichen Gesetz geregelt werden, was bisher nicht der Fall war (vgl. Abb. 59 und 60). Wichtigste Neuerung der EnEV stellt die Schaffung einer Energiekennzahl auf Basis des Primärenergieverbrauchs dar, das heißt, es findet erstmals eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes als energetisches System statt (vgl. Abb. 60). Die Regelung schließt auf dieser Basis somit Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung ein. Es wird somit die gesamte Energiekette samt Energieverlusten bei Gewinnung, Umwandlung und Transport des Energieträgers sowie benötigter Hilfsenergie miteinbezogen (vgl. Abb. 60). Der Bezug zum Primärenergiebedarf liefert die Basis für die Beurteilung des Energieverbrauchs und den damit verbundenen Schadstoffemissionen (s. Finkenbusch 2006, 69). Abb. 59: Bilanzgrenzen der Wärmeschutzverordnung und der Heizanlagenverordnung Abb. 60: Bilanzierungsgrenzen der EnEV 80 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung Inhaltlich gliedert sich die EnEV in die folgenden sechs Abschnitte: - allgemeine Vorschriften - zu errichtende Gebäude - bestehende Gebäude und Anlagen - heizungstechnische Anlagen - gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten - Schlussbestimmungen Die Anhänge der EnEV ergänzen die inhaltlichen Abschnitte. Sie enthalten Tabellen mit einzuhaltenden Richtwerten, Vorschriften zur Berechnung der Energiekennwerte sowie Hinweise zu benötigten Rechenkomponenten und -verfahren. Die aktuelle Fassung der EnEV ist die Verordnung vom 8. Dezember 2004. Sie berücksichtigt die Änderung der Normen bezüglich der zu berechnenden Nachweise und verweist auf aktuelle Normen. Zukünftig gelten wird die EnEV 2007. Bereits am 16.11.2006 wurde der Referentenentwurf veröffentlicht. Der nun vorgelegte Kabinettsentwurf ist der zweite „formelle“ Schritt im Verordnungsverfahren. Die Bundesregierung hat am 25.04.2007 die EnEV 2007 beschlossen. Mit ihr wird die Einführung von Energieausweisen für den Gebäudebestand geregelt sowie eine weitere Anpassung an die Systematik der EPBD vorgenommen. Weiterhin führt sie neue und einheitliche Energieausweise ein. Die Energieeinsparverordnung 2007 tritt nach einem weiteren Beschluss im Bundesrat und der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am Ersten des 3. Monats nach der Verkündigung in Kraft – voraussichtlich im Herbst 2007. Anforderungen der EnEV an den Gebäudebestand Die Anforderungen der EnEV an den Bestand gliedern sich in zwei Bereiche: die Nachrüstpflichten und die bedingten Anforderungen (vgl. Abb. 61). Die Nachrüstpflichten (EnEV §9) beziehen sich auf drei Aspekte. Diese Aspekte sind unabhängig davon, ob ohnehin Sanierungen geplant sind, für Hauseigentümer verpflichtend. Im Einzelnen sind dies der Austausch des Heizkessels, die nachträgliche Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen sowie die nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke. Konkret heißt das: 1. Heizkessel, mit Gas oder Öl betrieben, die vor dem 01.10.1978 eingebaut wurden, sind bis zum 31.12.2006, also bis zum Ende letzten Jahres, außer Betrieb zu nehmen und durch einen modernen Kessel zu ersetzen. Bei Einhaltung bestimmter Abgasgrenzwerte oder bei Brennern, die nach 1996 erneuert wurden, kann diese Frist bis zum 31.12.2008 verlängert werden. Darüber hinaus gilt diese Anforderung nicht für Nierdertemperatur- oder Brennwertkessel, deren Nennwärmeleistung unter 4 kW bzw. über 400 kW liegt. Bei Zentralheizungen müssen selbsttätig wirkende Regeleinrichtungen nachgerüstet werden. 2. Heizungs- und Warmwasserrohre in nicht beheizten Räumen, die zugänglich sind, aber bisher nicht gedämmt waren, mussten bis zum 31.12.2006 nach den Bestimmungen der EnEV, die im Anhang 5 formuliert sind, gedämmt werden. 3. Ebenfalls bis zum 31.12.2006 mussten nicht be- Abb. 61: Übersicht über die Anforderungen der EnEV an Bestandsgebäude 81 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung Abb. 62: Einzuhaltende U-Werte bei Bauteiländerungen oder -austausch Abb. 63: Anforderungen der EnEV an Sanierungsfälle (auszugsweise Zusammenstellung) 82 gehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken beheizter Räume gedämmt werden. Dabei müssen sie den Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,3 W/ m²K einhalten, was mit ca. 8-12 cm Dämmstärke (Wärmeleitgruppe 040) erreicht wird. Diese Nachrüstpflichten gelten vor allem für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern. Freigestellt von diesen Nachrüstpflichten sind die Eigentümer von Einund Zweifamilienhäusern, die selbst darin wohnen. Von diesen fordert die EnEV eine Nachrüstung nur im Zusammenhang mit einem Eigentümerwechsel. Die Frist der oben genannten Anforderungen verlängert sich bei einem Eigentümerwechsel um 2 Jahre. Die bedingten Anforderungen (EnEV § 8) betreffen die Verbesserung des Wärmeschutzes von Bauteilen im Rahmen einer Sanierung, Modernisierung und Erweiterung. Es gilt grundsätzlich, wie auch bisher, dass an bestehende Bauteile keine Anforderungen gestellt werden, es sei denn, man nimmt Veränderungen daran vor. Erst bei solchen geplanten Sanierungen müssen die in Anhang 3 der EnEV beschriebenen Dämmvorschriften beachtet werden (vgl. Abb. 62).Die betroffenen Bauteile sind nach EnEV die folgenden Außenbauteile: - Außenwände - Außentüren - Decken, Dächer, Dachschrägen (Steildächer, Flachdächer) - Wände und Decken gegen unbeheizte Räume und gegen Erdreich - Vorhangfassaden Die Begrenzung des Wärmedurchgangskoeffizienten für die beschriebenen Bauteile gilt nicht, wenn weniger als 20 % der jeweiligen Bauteilfläche von Erneuerungsmaßnahmen betroffen sind. Bei Fassaden und Fenstern beziehen sich die 20 % nur auf die jeweilige Gebäudeseite. Die Vorschriften der EnEV sind allerdings auch dann erfüllt, wenn das Bestandsgebäude insgesamt den jeweiligen Höchstwert für normal beheizte Gebäude (EnEV 2004, Anhang 1, Tabelle 1) oder gering beheizte Gebäude (EnEV 2004, Anhang 2, Tabelle 1) um nicht mehr als 40 % überschreitet (Altbauaufschlag). Dies ist durch eine Energiebedarfsberechung nachzuweisen. Bei Erweiterungen des Gebäudes (Anbauten), die größer als 30 m³ sind, gelten für den neuen Gebäudeteil die gleichen Anforderungen wie für Neubauten. Diese 30 m³ sind bereits mit einem Anbau von 12 m² Grundfläche und 2,50 m Höhe erreicht. Grundsätzlich gilt für Veränderungen an Bestandsgebäuden das Ver- Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung schlechterungsgebot (EnEV § 10), das besagt, dass neue Bauteile und Anlagen die energetische Qualität des Gebäudes auf keinen Fall verringern dürfen. In Abb. 63, sieht man auszugsweise eine Zusammenstellung der EnEV -Anforderungen an Sanierungsfälle. Bei der Inbetriebnahme von neuen Heizungs- oder Warmwasseranlagen gelten ebenfalls eine Reihe von Anforderungen, vor allem für die Auswahl der Geräte sowie die Regelung der zugehörigen Anlagenkomponenten (EnEV 2004, Abschnitt 4, § 11, 12). Bei dem Einbau eines neuen Kessels ist vor allem darauf zu achten, dass es sich um einen Niedertemperatur- oder Brennwertkessel handelt, der mit einer CE-Kennzeichnung (Qualitätssiegel) versehen ist. Nur wenige spezielle Kessel müssen keine CE-Kennzeichnung aufweisen, aber auch diese dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sie nach den anerkannten Regeln der Technik gegen Wärmeverluste gedämmt sind. „Werden neue Heiz- Warmwasserspeicher sowie neue Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen installiert, muss deren Wärmeabgabe, wie bereits erwähnt, nach Anhang 5 der EnEV begrenzt werden. Die gesamte Anlagentechnik in Neubauten und Bestandsgebäuden soll durch Fachleute regelmäßig gewartet werden.“ (Finkenbusch 2006, 72) Im Folgenden gehe ich näher auf den Energiepass ein. Energiepass soll dem Käufer eines Gebäudes (egal ob Alt- oder Neubau) Auskunft über dessen energetische Qualität geben. Das Ziel ist eine Steigerung der Markttransparenz. Wesentliches Element ist eine Einstufung des Gebäudes mit Hilfe von sieben Kategorien (vgl. Abb. 64). Die Grundidee hinter dem Energiepass ist, dass die Marktkräfte gestärkt und dank höherer Transparenz energieeffiziente Gebäude vermehrt nachgefragt werden. (s. Bundesministerium für Energie 2005, 41) Wolfgang Tiefensee formuliert dies so: „ Der Energieausweis soll mehr Transparenz in den Immobilienmarkt bringen. Mieter und Käufer können künftig auf einen Blick einen Eindruck bekommen, welche Nebenkosten auf sie zukommen. Die Energieeffizienz wird damit zu einem zentralen Entscheidungskriterium. Energieeffiziente Gebäude sind damit klar im Vorteil. Wer bislang sein Haus nicht gedämmt hat, verschenkt nicht nur bares Geld, sondern schadet auch dem Klima. Mit dem Energieausweis für Gebäude kommt nun der energetische Fingerabdruck für Häuser.“ 3.6.3 Der Energiepass für Gebäude Eine wesentliche Entwicklung hat die seit dem 04.01.2003 in Kraft getretene EU-Gebäuderichtlinie ausgelöst (Richtlinie 2002/91/EG). Die Richtlinie schreibt vor, dass Eigentümer ab 2006 beim Verkauf oder bei der Vermietung einen Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes vorlegen müssen. Dieser Energieausweis ist maximal 10 Jahre gültig. Da der Ausweis auch Vergleichskennwerte enthalten muss, sind energieeffiziente Gebäude zu erkennen. Für Neubauten und wesentliche Umbauten ist ein Energiebedarfsausweis heute schon Pflicht. Für Bestandsgebäude lässt der Energiepass rein rechtlich noch auf sich warten. Energieausweise werden mit der EnEV 2007 auch im Bestand eingeführt. Im Jahr 2003 und 2004 wurde der Energiepass in einem „Großversuch“, geleitet durch die „Deutsche Energie-Agentur“ (dena), getestet und evaluiert. Der Abb. 64: Musterauszug des Energiebedarfsausweises 83 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung Ein wirkliches Ausstellungserfordernis für Bestandsgebäude besteht momentan erst dann, wenn das Gebäude wesentlich verändert wird. Genauer gesagt, wenn innerhalb eines Jahres mindestens drei Änderungen an Außenbauteilen nach Anhang 3 durchgeführt sowie der Austausch des Heizkessels oder die Umstellung der Heizungsanlage auf einen anderen Energieträger vorgenommen werden. Auch wenn das beheizte Volumen um mehr als 50% erweitert wird, ist ein Energieausweis auszustellen. Befreiungen von der EnEV können bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde in Ausnahmefällen, z.B. bei Baudenkmälern oder besonders erhaltenswerter Substanz, erwirkt werden. (s. Finkenbusch 2006, 72) In der EnEV 2007 wird nun geregelt, dass bei Verkauf oder Vermietung von Wohngebäuden, die bis 1965 fertig gestellt wurden, Interessenten ab dem 01.01.2008 ein Energieausweis zugänglich zu machen ist. Die Interessenten müssen allerdings selbst aktiv werden, denn der Energieausweis ist vom Eigentümer nur auf das Verlangen des Miet- oder Kaufinteressenten vorzuzeigen. Ein halbes Jahr später – ab dem 1. Juli 2008 – gilt dies für alle Wohngebäude. Findet in einem Gebäude kein Nutzerwechsel statt und ergeben sich auch keine anderen Gründe, die zur Ausstellung verpflichten, besteht kein gesetzlicher Zwang einen Energieausweis zu erstellen. Ab Januar 2009 müssen auch für Nichtwohngebäude im Verkaufs- oder Vermietungsfall Energieausweise ausgestellt werden. Ab dann müssen in öffentlichen Gebäuden mit regelmäßigem Publikumsverkehr Energieausweise gut sichtbar ausgehängt werden. (s. Deutsche Energieagentur 2007, 2-6) In der EnEV (§13) wird der Energiepass unter der Bezeichnung Energiebedarfsausweis geführt. Dieser Ausweis soll die wesentlichen Ergebnisse der nach der EnEV durchgeführten Berechnungen enthalten. Der Aufbau und Inhalt der Energieausweise soll einheitlich sein. Der Energieausweis enthält auf vier Seiten die wesentlichen Gebäudedaten, das „Energielabel“ sowie leicht verständliche Vergleichswerte und Modernisierungsvorschläge. Er stellt die folgenden wesentlichen energiebezogenen Merkmale eines Gebäudes zusammen: den Jahresprimärenergiebedarf, den Endenergiebedarf nach einzelnen Energieträgern, die spezifischen Werte des Transmissionswärmeverlustes sowie die Anlagenaufwandszahl der Anlagen für Heizung, Warmwasser und Lüftung. Immer dann, wenn im Gebäude kostengünstige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz möglich sind, muss der Energieausweis für das Gebäude 84 individuelle Modernisierungsempfehlungen enthalten. Diese geben dem Gebäudeeigentümer erste wichtige Hinweise über Verbesserungsmöglichkeiten, ersetzen in der Regel aber keine ausführliche Energieberatung. In der zukünftig geltenden EnEV 2007 werden die Energiebedarfsausweise als Schwerpunkt behandelt. Für Bestandsgebäude können Energieausweise sowohl auf der Grundlage des ingenieurmäßig berechneten Energiebedarfs als auch auf der Grundlage des gemessenen Energieverbrauchs erstellt werden. Beide Verfahren werden durch Berechnungsvorschriften in der EnEV 2007 geregelt. Eine Ausnahme gilt lediglich für Wohngebäude mit weniger als fünf Wohnungen, für die ein Bauantrag vor dem 01.11.1977 gestellt wurde. Für diese Gebäude sollen nur Bedarfsausweise zulässig sein, es sei denn beim Bau selbst oder durch spätere Modernisierungen wird mindestens das Wärmeschutzniveau der 1. Wärmeschutzverordnung von 1977 erreicht. Für die Zeit zwischen dem Kabinettsbeschluss und dem 31.12.2007 besteht für alle Gebäude Wahlfreiheit zwischen verbrauchs- und bedarfsbasierten Energieausweisen. (s. Deutsche Energieagentur 2007a, 5) „Der Energiebedarfsausweis beruht dabei immer auf normativen Annahmen für das Klima und die Nutzung. Bei dieser Methode wird der Bestand sehr neutral bewertet. Unterschiedliche Nutzer beeinflussen die Ergebnisse nicht, womit eine Vergleichbarkeit zu anderen Gebäuden besteht. Gleichzeitig stellt die Berechnung des Gebäudes auch eine Gebäudediagnose dar, bei der vorhandene Schwachstellen erkannt werden können. Für die Datenaufnahme im Gebäudebestand können neben eigenen Beobachtungen auch vereinfachte und pauschalisierte Kennwerte hinzugezogen werden.“ (Finkenbusch 2006, 73) „Der Energieverbrauchsausweis dagegen bildet neben der tatsächlichen energetischen Qualität des Gebäudes auch das Nutzerverhalten und die Klimaeinflüsse ab. Analysiert werden die witterungsbereinigten Energieverbrauchsdaten für das gesamte Gebäude und ein konkreter Abrechnungszeitraum. Gebäudediagnosen und Modernisierungsvorschläge sind mit Verbrauchskennwerten nicht möglich.“ (Hegner 2006, 20-22 zitiert nach Finkenbusch 2006, 73) Die Kosten für den Energiebedarfsausweis werden innerhalb des Kabinettsentwurfes für die EnEV 2007 nicht geklärt. Der Entwurf enthält keinerlei staatliche Vorgaben bezüglich der Kosten von Energieausweisen. Der Preis ist also entsprechend zwischen Aussteller und Auftraggeber zu vereinbaren. Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung 3.6.4 Rechtsetzungskompetenz der Energiestandards Die Rechtsetzungskompetenz hat für die Art und Weise der Weiterentwicklung der Energiestandards eine zentrale Bedeutung. In Deutschland wurde aufgrund der zentralen Rechtsetzungskompetenz ein landesweit einheitlich gültiger Energiestandard für Gebäude etabliert, die einzelnen Länder spielen keine Rolle bei der Gestaltung der Energiestandards. Auffällig ist vor allem, dass der föderale Aufbau und der Einsatz von Subventionen für die Gestaltung der Energiestandards von großer Bedeutung und somit maßgeblich für den Entwicklungspfad verantwortlich ist. Bei der Entwicklung des deutschen Energiestandards handelt es sich um einen hierarchisch geprägten Entwicklungspfad, das heißt, der Zentralstaat bestimmt die Energiestandards. Die Entwicklung verläuft hierarchisch von oben nach unten (Top-down Ansatz). Die nationalen Behörden entwickeln die Vorschriften, welche für das ganze Land Gültigkeit haben. Regional unterschiedliche Standards können so nicht entstehen. (s. Bundesministerium für Energie 2005,113 -115) So bildet sich ein sehr homogener Energiestandard für das ganze Land. 3.6.5 Anpassungsrhythmus der Energiestandards Seit den 70er Jahren wurden die Energiestandards in Deutschland dreimal wesentlich überarbeitet. Somit nimmt der Geneseprozess für einen neuen Standard in Deutschland zwischen 6 und 11 Jahren in Anspruch, in anderen europäischen Ländern ist dies ähnlich. Im Durchschnitt liegt der Anpassungsrythmus hier in etwa bei 5 - 7 Jahren (s. ebd. 115-116). Diese Dauer scheint ein recht fixer Wert zu sein und sich nur schwer komprimieren zu lassen. Die Auslöser für die Anpassungen der Energiestandards in den 70er und 80er Jahren waren die Energiepreiskrisen (vgl. Abschnitt 3.1) und das Aufkommen der CO2-Politik in den 90er Jahren (vgl. Abschnitt 3.2). Diese externen Ereignisse wirkten gleichsam als Taktgeber für die Anpassungen der Standards. Nach 2000 führte die zentrale Einführung der Gebäuderichtlinie der EU in den EU-Staaten zu einem gemeinsamen Impuls zur Anpassung der Energiestandards. In Deutschland entstand die EnEV. 3.6.6 Europäische Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden Weltweit hat der Klimaschutz seit Ende der 80er Jahre vor dem Hintergrund des drohenden Treibhauseffektes einen hohen Stellenwert erhalten (vgl. Kapitel 3.2). In Anbetracht der formulierten Kyoto-Ziele haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union am 16. Dezember 2002 die Richtlinie 2002/91/ EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, Englisch „Energy Performance of Buildings Directive“ (EPBD), erlassen. Am 04. Januar 2006 trat sie in Kraft. Ziel dieser Richtlinie ist die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der europäischen Gemeinschaft unter Berücksichtigung der jeweiligen äußeren klimatischen und lokalen Bedingungen sowie der Anforderungen an das Innenraumklima und der Kostenwirksamkeit. Sie soll das energetische Vorgehen innerhalb der Mitgliedsstaaten vereinheitlichen. Wie alle vergleichbaren Richtlinien hat sie Gesetzescharakter und ist für die Mitgliedsländer der EU verbindlich. Somit wird die EPBD die Energiepolitik der EU-Mitgliedsländer im Gebäudebereich entscheidend beeinflussen. Diese Richtlinie zeigt, dass die EU im Gebäudebereich die höchsten Potentiale für eine Erhöhung der Energieeffizienz sieht und eine Minderung der CO2 -Emissionen für möglich hält. In Deutschland ist die Einbeziehung der Systematik der EPBD in die Berechnungsverfahren bereits in weiten Teilen über die EnEV 2004, beziehungsweise die ihr zugeordneten Normen geregelt (vgl. Abb. 65). Anhand der Tabelle ist zu erkennen, dass bisher (EnEV 2004) die Einbeziehung der Beleuchtung und der Klimaanlagen offen ist. Für Wohngebäude gilt aber, dass die EnEV bauliche Ausführungen verlangt, die Klimaanlagen entbehrlich machen (EnEV Artikel 3, Absatz 4, sowie Anhang 1, Abschnitt 2.9). Weiterhin gibt es für Wohngebäude keine Anforderungen an die Beleuchtung. Diese soll auch zukünftig nicht zum Gegenstand öffentlich-rechtlicher Anforderungen gemacht werden. (s. Bundesministerium für Energie 2005, 98-99) In der EnEV 2007 wird die nationale Gesetzgebung weiter an die EPBD angepasst. In ihr werden für Nichtwohngebäude Berechnungsvorhaben eingeführt, die neben dem Energiebedarf für Heizung, Warmwasseraufbereitung und Lüftung auch die Bereiche Kühlung und eingebaute Beleuchtung berücksichtigen. Für Wohngebäude mit fest installierten Klimaanlagen ist zukünftig auch die benötigte Kühlenergie analog 85 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung dem Verfahren bei Nichtwohngebäuden zu berücksichtigen. Der zulässige Höchstwert für den JahresPrimärenergiebedarf wird in diesem Fall gegenüber ungekühlten Gebäuden erhöht. Im Energieausweis ist der Energiebedarf für Kühlung pauschal anzugeben. Der Systematik der EPBD wird also mit Inkrafttreten der EnEV 2007 komplett entsprochen. Insgesamt findet in allen europäischen Mitgliedsstaaten eine starke Bewegung zur Umsetzung und Anpassung der Gesetzgebung an die EPBD statt. Allerdings bestehen bei der Umsetzung der Berechnungsverfahren der EPBD in den EU-Staaten noch erhebliche Unterschiede. (vgl. Abb. 66) 3.6.7 Vollzug der Energiestandards in Deutschland Abb. 65: Umsetzung der Systematik der EPBD in Deutschland Abb. 66: Gesamtübersicht der Umsetzung der Systematik der EPBD Abb. 67: Übersicht über die geltenden Regelungen zum Vollzug der EnEV in den Bundesländern bei Neubauten 86 Geltungsbereich der Energiestandards Grundsätzlich sind Energiestandards national gültig. Die entsprechenden Grundlagen sind zustimmungspflichtig durch den Bundesrat, weil sie Länderangelegenheiten tangieren. Die Länder sind verpflichtet, die Standards so umzusetzen, wie es die nationale Gesetzgebung vorsieht. „Die Länder haben die Umsetzung in Durchführungsverordnungen oder entsprechenden Erlassen konkretisiert. In einigen Fällen sind eigene Verordnungen zur EnEV erlassen worden (z.B. Bremen). In anderen Fällen wurde die Bauordnung der Länder angepasst (z.B. Mecklenburg-Vorpommern). Es wurde geregelt, wer für die Umsetzung der Standards zuständig ist. Im Falle der EnEV wird in den Ausführungserlassen vor allem festgehalten, wer die Energiebedarfsausweise ausstellen darf, wie detailliert die Einhaltung des Energiebedarfsausweises kontrolliert wird und wer die Energiebedarfsausweise kontrolliert. Zudem sind Bestimmungen enthalten, welche die Verwendung von bestimmten Bauprodukten und Anlagen regeln. Anfang 2004 (also zwei Jahre nach Inkrafttreten der EnEV am 1. Februar 2002) haben 12 von 16 Bundesländern eine Ausführungsgesetzgebung geschaffen. In drei Ländern sind die Gesetze in Vorbereitung, ein Land will auf die Schaffung einer Umsetzungsgesetzgebung verzichten. Die Bedeutung der Regelung der EnEV auf Landesebene ist allerdings beschränkt. Laut Angaben der dena (Deutsche Energieagentur) ist es so, dass die EnEV direkt anwendbares Recht darstellt. Das heißt, auch wenn ein Land keine Umsetzungsregelung geschaffen hat, ist die EnEV dennoch gültig. Allerdings muss sich der Bauherr in einem solchen Fall an die Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung zuständige Baubehörde wenden und die Einhaltung der EnEV verlangen.“ (Bundesministerium für Energie 2005, 58) Organisation des Vollzuges Auf Bundesebene ist das Ministerium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen für die Wärmeschutzverordnung zuständig. Unterstützt wird das Ministerium von der dena (Deutsche Energieagentur). Diese ist für Informationen und Beratungen rund um die Energiestandards zuständig und betreute den Test des Energiepasses. Eine Vollzugskompetenz ist auf Bundesebene aber nicht vorhanden. Die dena versorgt die Bundesländer lediglich mit Vollzugshilfen, mit Informationen rund um die EnEV sowie mit allgemeinen Informationen zum Energiesparen im Gebäudebereich. Für alle Belange des Vollzugs sind die Länder in eigener Verantwortung zuständig. (s. Bundesministerium für Energie 2005, 58) Der Vollzug wird in den Ländern jeweils verschiedenen Stellen zugeordnet. Je nach Aufteilung der Ministerien ist eine andere Behörde verantwortlich. Die entsprechenden Regelungen zum Vollzug werden in den Bauordnungen oder einer speziellen Verordnung der Länder zur EnEV festgehalten. Die dena hat den Stand der Regelungen bezüglich der EnEV auf Stufe der Bundesländer zusammengestellt. Dieser Stand wird im Folgenden präsentiert. Die Regelungen zur Umsetzungsverordnung der EnEV sind in den einzelnen Bundesländern recht einheitlich. Die Bundesländer unterstützen den Vollzug der Energiestandards teilweise mit Information, Beratung und Ausbildung. In diesem Bereich sind Hessen und Nordrhein-Westfalen als Vorreiter zu sehen, andere Länder tun vergleichsweise wenig. Eine Gesamtübersicht über die Aktivitäten der Länder ist nicht verfügbar. Die Ausführungskontrolle wird in der Regel dem Bauherren überlassen. Dieser muss dafür sorgen, dass ein Sachverständiger während des Baus die Einhaltung der Vorgaben des Energiebedarfsausweises überprüft. Nach Abschluss des Baus muss dieser Sachverständige dem Bauherren die sachgerechte Ausführung bestätigen. Der Bauherr legt die Bestätigung den Baubehörden vor. In den Bundesländern sind dies praktisch immer die Gemeinden. Einen zentralen Vollzug durch die Bundesländer, wie er in der Schweiz bei einigen Kantonen oder in der WBF in Österreich anzutreffen ist, gibt es in Deutschland nicht. Die Baubehörde (also die zuständige Instanz einer Gemeinde) überprüft lediglich, ob bei der Baueingabe die notwendigen Energienachweise vorliegen. Experten gehen davon aus, dass eine rechnerische Überprüfung der Energieausweise seitens der Behörde nicht vorgenommen wird. In zwei Bundesländern wird dies explizit sogar in den Ausführungsverordnungen zur EnEV festgehalten. In einem Bundesland ist die Bestätigung, dass die Anforderungen des Energiebedarfsausweises eingehalten worden sind, nur auf Verlangen der Baubehörde (also nicht automatisch) vorzulegen. Vier Bundesländer sehen in ihren Ausführungsbestimmungen keine Regelung bezüglich der Kontrolle vor (vgl. Abb. 67). Insgesamt ist also davon auszugehen, dass es primär Aufgabe des Bauherren respektive des von ihm beauftragten Sachverständigen ist (z.B. des beauftragten Planers), die Einhaltung der EnEV zu prüfen. Eine Regelung über eine aktive Kontrolle der Bauausführung ist selten bis nie anzutreffen. Einzig im Bereich der Förderprogramme über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Förderung) werden stichprobenartige Kontrollen vorgenommen, um zu überprüfen, ob die Praxis mit den in den Förderanträgen gemachten Angaben auch übereinstimmt. Über die Summe der Kontrollen und deren Ergebnisse liegen keine Zahlen vor. Man kann also festhalten, dass in den meisten Bundesländern die Deregulierung oberstes Ziel bei der Umsetzung der EnEV ist. Für den Vollzug der EnEV bedeutet Deregulierung vor allem, dass sich die Bauaufsichtsbehörden von der Funktion der staatlichen Kontrolle von Bauverfahren soweit wie möglich zurückziehen. Die Verantwortung zur Umsetzung der EnEV wird damit von der staatlichen Seite auf den privaten Bereich übertragen. Der Bauherr beauftragt zum Beispiel den Architekten mit der Überwachung von Planung und Ausführung und kann diesen privatrechtlich belangen, wenn Planung und Ausführung unbefriedigend sind. Diese geringe Kontrolle bei der Aufsicht der Planung führt zu einem Vollzugsdefizit bei Wärmeschutzmaßnahmen. Die Verantwortlichen von NRW halten z.B. fest, dass die staatlichen Regelungen nur verzögert und teilweise mangelhaft umgesetzt werden (s. Nordrhein – Westfalen 2001, S.47). Diese Philosophie des Vollzugs (Deregulierung) wird durch den Energiepass unterstützt werden. Der Bauherr (oder der Käufer eines bestehenden Gebäudes) bekommt mit dem Energiepass eine Bestätigung über die Qualität des Gebäudes und soll diese privat-rechtlich einklagen, wenn sie nicht erfüllt ist. Die Behörden 87 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung werden dabei nicht aktiv, sondern verlangen nur die Existenz des Nachweises. Es gibt wenig quantitative Grundlagen zur Beurteilung des Vollzuges. Die Ausführung auf dem Bau wurde wenig untersucht. Allerdings äußern sich einige Experten kritisch bezüglich der Qualität des Vollzuges. Sie gehen davon aus, dass die Bauqualität heute in etwa jener der WSVO 1994 entspricht. Die wesentlichen Fehler bei der Ausführung seien auf falsche Berechnungen, Differenzen in der bautechnischen Umsetzung sowie falsche Ausführung zurückzuführen. Punktuelle Untersuchungen bei 30 Niedrigenergiehäusern in Münster, welche zu den speziell geförderten Bauten zählen, ergaben einen um 20 % höheren spezifischen Jahresheizwärmebedarf als ursprünglich im Wärmeschutzausweis nachgewiesen. Diese Analysen zeigten, dass der Heizwärmebedarf sich vor allem aufgrund von Fehlkalkulationen und Ausführungsmängeln verschlechterte. Experten begründen dies mit fehlenden Kontrollen durch die Behörden sowie die mangelhafte Ausbildung und Sensibilität der Handwerker. Auf Grund von Einzelbeispielen, wie das oben beschriebene, gehen Experten davon aus, dass die heutige Bauweise im Durchschnitt etwa 20 % unter den Energiestandards liegt. (s. Bundesministerium für Energie 2005, 58 – 61) 3.6.8 Freiwillige Energiestandards In den vorhergehenden Abschnitten wurde der gesetzlich vorgeschriebene Mindeststandard der EnEV sowie ihre Entwicklung erläutert. In der Bauwirtschaft gibt es allerdings neben dem gesetzlichen eine Vielzahl von freiwilligen Energiestandards, die die gesetzlichen Standards in ihren Anforderungen übertreffen und den zukünftigen Entwicklungen vorauseilen. In diesen Zusammenhang sind Begriffe wie Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Nullheizenergiehaus, Nullenergiehaus, Plusenergiehaus, KfW 40-Haus, KfW 60-Haus, X-Liter Haus zu nennen. Diese sind bisher nicht durch Normen festgelegt. Es gibt aber übliche und allgemein anerkannte Standards, die sich durch Vorhandensein von Zertifizierungs- und Qualitätssicherungsangeboten auszeichnen. Die Bedeutung privater Normenorganisationen bei der Genese der Energiestandards ist relativ gering, doch zeigen die innovativen Konzepte häufig den Weg der Zukunft für die gesetzlichen Energiestandards auf. In 88 den folgenden Abschnitten sollen nun die freiwilligen Energiestandards betrachtet werden. Energiestandards sind immer im Vergleich zu anderen Techniken des energiesparenden Bauens zu sehen. Zeitgemäße und übliche Gebäudestandards im Neubaubereich sind vor allem das Niedrigenergiehaus und das Passivhaus. In den letzten Jahren hat sich vor allem die Passivhausbranche als „Innovationsmotor“ des energiesparenden Bauens gezeigt. Niedrigenergiehaus Der Begriff Niedrigenergiehaus wird seit den 70er Jahren benutzt. Die Idee dazu kam aus den USA und Kanada, wo sie als „low energy houses“ bekannt wurden. In Europa gelten die Schweden als Vorreiter des Niedrigenergiehauses mit der „Schwedischen Baunorm“ (SBN), die 1975 – 1980 in den skandinavischen Ländern eingeführt wurde. Der Begriff „schwedische Baunorm“ wurde auch in Deutschland bekannt und kam bei Experimentalbauten zur Anwendung. (s. Simon 2004,14) In der der Vergangenheit hat der Begriff des Niedrigenergiehauses (NEH) eine Fortschreibung erfahren: Vor 2002 repräsentierten die für die EnEV in Aussicht gestellten Anforderungen das NEH-Niveau. Heute werden als Niedrigenergiehäuser Gebäude erfasst, die die Anforderungen der EnEV deutlich überschreiten, sowohl im Bestand als auch im Neubau. Der bauliche Wärmeschutz ist darauf abgestimmt gegenüber der heutigen EnEV um 30% geringere TransmissionsWärmeverluste zu erreichen. Durch zusätzliche Anforderungen an die Haustechnik wird darüber hinaus der Heizwärmebedarf noch weiter verringert. Dies beinhaltet nicht nur Anforderungen an die Wärmedämmung der Regelflächen und Sonderbauteile, sondern auch an die Vermeidung oder Minimierung von Wärmebrücken, an eine mehr als nur normgerechte Luftdichtheit sowie an eine angepasste Heizung und Lüftung. Die technischen Einzelanforderungen sind in den „Güte- und Prüfbestimmungen“ auf der Internetseite der „Gütegemeinschaft Niedrigenergie-Häuser e.V.“ (http://www.guetezeichen-neh.de/) beschrieben und können unter Rubrik Downloads herunter geladen werden. Niedrigenergiehäuser wurden in Deutschland 1985 eingeführt und haben sich mittlerweile zehntausendfach bewährt. In NRW ist die NEH-Bauweise inzwischen im geförderten Mietwohnungsbau Regelbauweise. Der Einspareffekt durch Niedrigenergiebauweise ist zwar beachtlich, dennoch kann nicht auf eine Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung normale Heizanlage verzichtet werden. Der Mehraufwand für Wärmeschutz und eventuelle Lüftungsanlage muss sich daher allein aus den eingesparten Heizkosten amortisieren. Der NEH-Standard wird erreicht, wenn die technischen Einzelanforderungen eingehalten werden. Insgesamt weist ein Gebäude mit NEHStandard einen Heizwärmebedarf von 30 bis 70 kWh /m²a auf. Passivhaus Ein Passvihaus im Sinne der Gütegemeinschaft Niedrigenergie-Häuser e.V. ist ein Gebäude, dessen Heizwärmebedarf nicht höher als 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Energiebezugsfläche und pro Jahr ist. Der Nachweis ist mit dem Berechnungsprogramm „Passivhaus Projektierungspaket“ (PHPP) des Darmstädter Passivhaus-Instituts zu führen. Ein Passivhaus stellt aus Sicht der Gütegemeinschaft Niedrigenergiehäuser e.V den heutigen Stand der Technik beim energiesparenden Bauen dar und führt zu einem um 7585 % verringerten Heizenergiebedarf gegenüber einem Neubau, der nur nach EnEV-Mindestanforderungen gebaut ist (vgl. Abb. 65). Niedrige Wärmeverluste werden durch eine „supergedämmte“ Gebäudehülle, eine kompakte, wärmebrückenfreie und luftdichte Bauweise sowie durch dreifachverglaste Fenster mit speziell gedämmtem Rahmen erreicht. Ein Großteil des Wärmebedarfs wird durch die solaren Gewinne der Fenster (große Südfenster, minimale Fensterflächen nach Norden) und durch interne Wärmegewinne gedeckt. Im Ergebnis kann die Beheizung allein durch ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft (ggf. mit eingeschränkter Nachheizung) erfolgen. Die technischen Einzelanforderungen sind in den „Güte- und Prüfbestimmungen“ auf der Internetseite der Gütegemeinschaft Niedrigenergie-Häuser e.V. (http://www.guetezeichen-neh.de/) ebenso wie für den NEH-Standard beschrieben und können unter der Rubrik Downloads herunter geladen werden. Allgemein ist zu sagen, dass Passivhäuser mit großer Sorgfalt zu errichten sind. Passivhäuser haben einen ähnlich geringen Heizwärmebedarf wie Nullenergiehäuser. Sie verzichten aber auf Autarkie-Bestrebungen und akzeptieren eine Restwärmeversorgung von außerhalb. Das Wärmeschutz-Niveau und die Haustechnik von Passivhäusern sind ökonomisch definiert. Der Mehraufwand für bessere Dämmung und Lüftungstechnik gegenüber einem Niedrigenergiehaus kann durch das nicht benötigte Heizwärme- verteilsystem finanziert werden. Passivhäuser bieten somit ein vergleichbar niedriges Verbrauchsniveau wie Nullenergiehäuser (vgl. Abb. 68) zu deutlich niedrigeren Kosten. KfW 40-Häuser Ein KfW 40-Haus ist ein Gebäude mit einem höheren Energiestandard als der gesetzliche Mindeststandard. Der Primärenergieverbrauch beträgt max. 40 kWh/m² beheizter Gebäudenutzfläche. Gleichzeitig muss der Transmissionswärmeverlust den gesetzlich vorgeschriebenen Standard um 45 % unterschreiten. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert diese Form der zusätzlichen Energieeinsparung, wenn entsprechende Nachweise erbracht werden. Für die Umsetzung des KfW 40-Standards stehen eine Reihe von Methoden zur Verfügung. Der niedrige Energieverbrauch kann z.B. durch verschiedene Kombinationen folgender Energie-Konzepte erreicht werden: - Hohe Wärmedämmung bei Wänden, Dach, Fenstern und Fundament - Vermeidung von Wärmebrücken und Luftdichtheit des Gebäudes - Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Energieeffiziente Heizsysteme - Solaranlagen zur Warmwasserversorgung - Effiziente Regenwassernutzung KfW 60-Häuser KfW 60-Häuser sind ebenfalls wie die KfW 40-Häuser Gebäude mit höherem Energiestandard im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard. Der Primärenergieverbrauch beträgt maximal 60 kWh/m² beheizter Gebäudenutzfläche. Gleichzeitig muss der Transmissionswärmeverlust den gesetzlich vorgeschriebenen Standard um 30 % unterschreiten. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert diese Häuser ebenso wie die KfW 40-Häuser. Im Gegensatz zu KfW 40-Häusern kommen KfW 60-Häuser in der Regel ohne eine Lüftungsanlage aus. Der Haustyp wird also meist mit einer herkömmlichen Heizungsanlage ausgestattet. Nullheizenergiehaus, Nullenergiehaus, Plusenergiehaus Zukunftsorientierte Planungen zielen darauf ab, künftig jeglichen fossilen Energieverbrauch für Gebäude zu unterbinden. Dafür existieren derzeit drei Kategorien von Häusern: 1. Das Nullheizenergiehaus ist ein Gebäude, bei dem 89 Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung keine Heizenergie benötigt wird, also ein Gebäude, das mit „null“ kWh/m² an fossilem Heizenergiebedarf für Raumwärme auskommt, wohl aber Energie für Warmwasseraufbereitung, Beleuchtung und andere elektrische Anlagen benötigt; 2. Das Nullenergiehaus ist ein Gebäude, bei dem sowohl keine Heizenergie als auch keine Energie für Warmwasseraufbereitung, Beleuchtung u.a. benötigt werden, also ein Gebäude, welches im Jahresmittel keinen Netto-Energiebezug von außen benötigt; 3. Das energieautarke Haus (Plusenergiehaus) ist ein Gebäude, in dem aufgrund gebäudetechnischer Anlagen (meist Solarenergie) ein Überschuss an Energie erzeugt wird, der in das Stromnetz eingespeist wird. Als Plusenergiehaus bezeichnet man also ein Haus, welches im Jahresmittel eine Netto-Energielieferung nach außen erbringt. Die vorgestellten Haustypen werden kontrovers diskutiert. Einerseits werden sie als durchaus realisierbare und rentable Zukuntfsvision gesehen, andererseits werden Nullenergiehäuser bzw. energieautarke Häuser im hiesigen Klima als weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll betrachtet. Zwar funktionieren mehrere Nullenergiehäuser sowie Plusenergiehäuser seit einigen Jahren zufriedenstellend, es zeigt sich jedoch, dass der dreifache Investitionsaufwand für den sehr hohen Wärmeschutz, für die solare Wärmegewinnung und für die Saisonspeicherung unverhältnismäßig hoch ist und sich keinesfalls aus den vermiedenen Heizkosten finanzieren lässt. Anders gesagt, der Aufwand für die Effizienzsteigerung vom Passivhaus zum Nullheizenergiehaus ist hoch, eine Wirtschaftlichkeit kann derzeit noch nicht nachgewiesen werden. Umso mehr ist die Entwicklung zum Nullenergiehaus gekennzeichnet durch technische Lösungen im Bereich der Wärmedämmung und der Anlagentechnik. So könnte die Restenergie mittels Solarkollektoren und/oder Photovoltaikmodulen erzeugt werden. Ob Nullenergiehäuser bzw. Plusenergiehäuser zukünftig wirtschaftlich rentabel werden, bleibt abzuwarten. net in in der Regel den Heizöl-Bedarf. Dies stellt eine sehr konkrete und plakative, allerdings auch unpräzise Bezeichnung dar. Die Gefahr besteht darin, dass Angaben häufig nicht stimmen: Wärmebedarf, Energiebedarf, Primär- und Sekundärenergieverbräuche werden verwechselt (s. Frauenhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB 2003, 63-65). Häufig ist der Begriff des 3-Liter-Hauses verbreitet, 3 Liter Heizöl á 10 kWh/(m²a) entsprechen 30 kWh/ (m²a) Heizwärmebedarf. Dieser Kennwert stellt auch heute noch einen hohen Anspruch dar, er ist zwischen einem Niedrigenergiehaus und einem Passivhaus anzusiedeln. Oft wird für Niedrigenergiehäuser als 3Liter-Häuser geworben, dieser Wert ist aber nur mit sorgfältiger Planung und umfangreichen Maßnahmen zu erreichen. Ein Passivhaus (nach o.g. Standard) kommt im Jahr mit weniger als 1,5 l Heizöl pro m² und Jahr für die Heizung aus. Die Abbildung 65 gibt zusammenfassend einen größenordnungsmäßigen Vergleich einiger der vorgenannten energetischen Standards an. Es ist der Heizwärmebedarf bezogen auf die Nutzfläche der Gebäude abgebildet. In der ausgewiesenen Streubreite spiegelt sich die Kompaktheit der Gebäude wider (kleines A/V-Verhältnis: geringer Bedarf; großes A/V-Verhältnis: hoher Bedarf) (s. Kompetenzzentrum 2007a, 13). X – Literhaus Zur Charakterisierung der energetischen Effizienz eines Gebäudes ist der Begriff des x-Liter-Hauses („x“ kann durch jede beliebige Zahl ersetzt werden, je niedriger diese Zahl ist, desto besser ist die Energieeffizienz des Gebäudes) entstanden. Das „x“ bezeich- 90 Abb. 68: Spezifischer Heizwärmebedarf von Wohngebäuden Gesetzliche und freiwillige Vorgaben zur Energieeinsparung 3.6.9 Die zukünftige Entwicklung der Energiestandards Betrachtet man die Entwicklung der energetischen Standards in Deutschland sowie die Entwicklung innerhalb Europas (vgl. Kapitel 3.6.1), so lässt sich vermuten, dass mit der EnEV 2007 bzw. der EPBD noch lange nicht das Ende dieser bislang knapp 40 jährigen Geschichte gesetzlicher Energiestandards erreicht ist. Die EnEV entspricht in der aktuellen Fassung (EnEV 2004) für Wohnbauten bereits vollständig den Anforderungen der neuen EU-Richtlinie und mit der EnEV 2007 wird sie auch in den Bereichen der Belichtung und Klimatisierung der EPBD vor allem im Nicht-Wohnbereich angepasst. Bei den Novellierungen der EnEV wurden bislang die Energiekennzahlen nicht verschärft. Vielmehr erfolgten Anpassungen an verschiedene überarbeitete DIN-Normen beziehungsweise die EPBD. Anpassungen wurden unter anderem in den Bereichen Wärmebrücken, Luftdichtheit, Lüftung, erneuerbare Energien, Aufstellungsort des Wärmeerzeugers, Rohrleitungsverluste, Beleuchtung und Klimatisierung sowie dem Energiepass vorgenommen. Der Angleichungsprozess an die europäische Richtlinie scheint vollzogen und auch die Anpassung an verschiedene DIN-Normen scheint weitestgehend abgeschlossen zu sein. Um langfristige Klimaschutzziele der Bundesregierung, z.B. die Reduzierung der CO2-Emissionen um mindestens 80 % bis 2050, erreichen zu können, ist eine offensivere Klimaschutz-Strategie im Bereich der Weiterentwicklung der Energieeinsparverordnung nötig. Es müssen bereits heute Ziele für die weitere Zukunft formuliert werden, auch wenn eine wichtige Stellgröße (die Entwicklung der zukünftigen Energiepreise) nicht genau kalkulierbar ist. Es ist also zu erwarten, dass auch die bislang nicht verschärften Energiekennzahlen in zukünftigen Novellierungen der EnEV erhöht werden. Über kurz oder lang wird sowohl für den Neubaubereich als auch den Altbaubereich der Niedrigenergiehausstandard (NEH-Standard) festgesetzt werden, aber auch dieser wird nicht das Ende der Entwicklung darstellen. Zumindest für den Neubaubereich ist mittelfristig mit der Einführung des Passivhausstandards zu rechnen. Ebenfalls werden in zukünftigen Novellierungen der EnEV vor allem die Anforderungen an den Altbaubestand verschärft werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die heutige Ausnahme der Nachrüstpflicht bei Ein- und Zweifamilienhäusern (Eigen- tümerwechsel) gestrichen wird. Ebenso werden sich die Anforderungen an die Nachrüstpflichten bezüglich des Umfangs und der Qualität sukzessiv erhöhen. Vorstellbar ist auch, dass eine Nachrüstpflicht für die Außendämmung im Bestand verpflichtend wird. Dies sind nur einige mögliche Verschärfungen der Standards. Dass es Verschärfungen geben wird, steht bei dem politischen Ziel der Einsparung von 80% CO2 Emissionen außer Frage (vgl. Kapitel 3.2). Bei Betrachtung der Förderprogramme (vgl. Kapitel 3.3) erhärtet sich die Vermutung der weiteren Entwicklung der energetischen Standards. Daher ist anzunehmen, dass die derzeitige Förderung von Bauten in einigen Jahren zum gesetzlichen Energiestandard wird. Dieser Standard entspräche dann in etwa dem bereits oben angesprochenen NEH-Standard. Die Förderprogramme bilden demzufolge die Rolle eines „Motors“ der Energiestandards und gewähren uns Einblicke in zukünftige Standards. Unter Betrachtung des Anpassungsrhythmus der Energiestandards wird dies voraussichtlich innerhalb der nächsten 5 – 7 Jahre geschehen. Abschließend lässt sich festhalten, dass sich die gesetzlichen Energiestandards immer weiter verschärfen werden. Es ist abzuwarten, welche innovativen Techniken in den kommenden Jahren für noch bessere energetische Gebäude entwickelt werden. 91 3.7 Stand der Technik bei der energetischen Modernisierung Triggertechnologie: Wärmedämmung für energieeffiziente Gebäude Bei der Umsetzung von energetischen Standards im Bestand versucht man die geltenden Standards für Neubauten in Form der energetischen Modernisierung auch auf den Altbau zu übertragen. Die zeitgemäßen und üblichen Gebäudestandards im Neubaubereich sind vor allem das Niedrigenergie- und das Passivhaus (vgl. Kapitel 3.6). Ebenso wie beim Neubau wird energiesparendes Bauen im Wesentlichen durch Abb. 69: Trends für die energetische Wirksamkeit verschiedener Entwurfsaspekte 92 Verbesserung der Anlagentechnik und Optimierung der Wärmedämmeigenschaften der Gebäudehülle umgesetzt. In Abbildung 69 ist die energetische Wirksamkeit verschiedener Entwurfsaspekte vergleichend dargestellt. Die Grundlage dieser Darstellung liegt in einer hohen Zahl von bearbeiteten Bauvorhaben, bei denen mit diesen Parametern Optimierungsprozesse simuliert wurden. Die Modernisierung eines Bestandsgebäudes auf einen besonders energieeffizienten Gebäudestandard ist schwierig realisierbar. Die wesentlichen Prinzipien energieeffizienter Neubauten lassen sich jedoch grundsätzlich als Prinzipien und Zielstellungen für Bestandsgebäude übernehmen. Bei den Prinzipien lassen sich sowohl formale Kriterien an ein komfortables und energetisch effizientes Wohngebäude (z.B. Standort, Gebäudeausrichtung, Gebäudeform, Gebäudezonierung, Raumanordnungen) als auch funktionale Gestaltungskriterien identifizieren. Diese werden im Wesentlichen durch die Effizienz der Anlagentechnik und die Qualität der Gebäudehülle bestimmt. Da im Altbaubereich bereits die Bausubstanz vorhanden ist, sind energetische Verbesserungsmaßnahmen hier stets mit Einschränkungen verbunden und nicht so stringent plan- und durchführbar wie im Stand der Technik bei der energetischen Modernisierung Neubaubereich. (s. Finkenbusch 2006, 59) Die Erreichung eines Niedrigenergiehaus- oder Passivhausstandards ist durch die Einbeziehung der bereits gegebenen Faktoren im Altbaubereich schwieriger und komplexer als im Neubaubereich, wurde aber in mehreren Bauvorhaben schon erfolgreich umgesetzt (Demonstrationsprojekte). Neben den formalen und funktionalen Kriterien spielt die Planung eine entscheidende Rolle für die Realisierung energetisch optimierter Gebäude, das Stichwort in diesem Zusammenhang lautet „Integraler Planungsansatz“. 3.7.1 Formale Kriterien an ein komfortables und energetisch effizientes Wohngebäude im Bestand Wie bereits erwähnt, kann auf die Aspekte, die bei einem energieeffizienten Neubau beachtet werden sollten (Standort, Gebäudeausrichtung, Gebäudeform, Gebäudezonierung und Raumanordnungen) bei einer energetischen Modernisierung nur beschränkt Einfluss genommen werden. Allerdings ist auch für Bestandsgebäude immer zu prüfen, ob die eventuell unbewusst vorhandenen Potentiale ausgeschöpft bzw. genutzt werden. So ist in jedem Sanierungsfall zu klären, wie eine möglichst optimale Gebäudegeometrie mit einem Höchstmaß an passiven Solargewinnen geschaffen werden kann. Dies gilt bei der Sanierung ebenso wie beim Neubau, ist allerdings den Gegebenheiten des vorhandenen Gebäudes unterworfen. Standort Auf die Standortwahl des Objektes kann innerhalb des Bestandes selbstverständlich kein Einfluss mehr ausgeübt werden. Allerdings spielt der Standort auch noch für den Bestand eine entscheidende Rolle. Zum einen ist zu prüfen, ob die Randbedingungen des Standortes – wie z.B. die natürlichen Ressourcen (Erdwärme etc.) – im Gesamtkonzept des Gebäudeentwurfes berücksichtigt wurden oder ob sie im Rahmen einer Modernisierung noch berücksichtigt werden können. Der geschickte Umgang mit den speziellen Randbedingungen des Ortes ermöglicht eine Reduzierung des Investitions- und Nutzungsaufwands auch bei einer Modernisierung. Weiterhin ist der Standort aufgrund der Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt von entscheidender Bedeutung (vgl. Kapitel 2.3 u. 2.4). Die Standortqualität bildet neben der Gebäudequalität und weiteren Qualitätsmerkmalen einen wichtigen Anhaltspunkt zum Wert der Immobilie. Somit bestimmt die Standortqualität auch über das sinnvolle Maß der Modernisierungsinvestitionen. Ein anderer Aspekt des Standortes, der für eine energetische Modernisierung von Bedeutung ist, ist der Sonnenstand bzw. die Verschattung durch die Umgebung. „Die Anordnung des Gebäudes im Gelände sowie seine Orientierung haben entscheidenden Einfluss auf die Besonnung und Verschattung des Gebäudes insgesamt, aber auch der einzelnen Räume. Da im Sommer die Sonne mittags sehr hoch steht und somit kleine Dachüberstände oder Balkone eine Verschattung der Hauptfassade und damit ihrer Fensterflächen bewirken, ist eine Nord-Süd-Orientierung günstig. Diese wirkt sich auch im Winter bei dann tief stehender Sonne positiv auf den Wärmegewinn eines Gebäudes aus. Bei einem Ost-West ausgerichteten Gebäude ist eher mit Überhitzung und Blendwirkung zu rechnen, da die Sonne hier vormittags und nachmittags direkt auf die Fassade scheint. Konventionelle außenliegende Verschattungssysteme reichen in der Regel aus um eine Überhitzung zu vermeiden. Moderne Systeme können dabei über eine verbesserte Lichtlenkung einen hohen Tageslichtanteil in die Räume bringen.“ (Kompetenzzentrum 2007a, 7) Neben der Verschattung durch die Umgebung entstehen Verschattungen durch Vorsprünge, auskragende Bauteile, Geländer und Fensterlaibungen sowie durch die Verschmutzung der Fensterflächen. Die Fensterebene sollte also möglichst weit an die Außenseite der Konstruktion gezogen werden um verschattende Laibungen und Stürze gering zu halten. Neben der Anordnung und Orientierung des Gebäudes hat auch noch das Mikroklima (topografische Lage, Intensität der Sonneneinstrahlung, Windverhältnisse) des Standortes Einfluss auf den Energieverbrauch. Bei windexponierten Gebäuden ist verstärkt auf die Fugendichtigkeit zu achten, da sonst mit erhöhten Wärmeverlusten und Behaglichkeitseinbußen durch Zugerscheinungen zu rechnen ist. Lagebedingte Wärmeverluste können durch eine Ausrichtung des Gebäudes mit weitgehend geschlossenen und luftdichten sowie gut wärmegedämmten Außenwänden zur Hauptwindrichtung vermindert werden. Weiterhin können die Verluste durch windhemmende Hecken und Bäume in Hauptwindrichtung reduziert werden und die Aufenthaltsqualitäten auf z.B. Balkonen oder Terrassen verbessert werden. (s. ebd. 7) 93