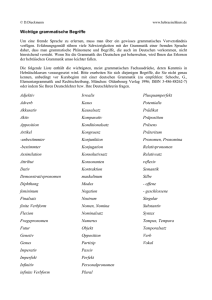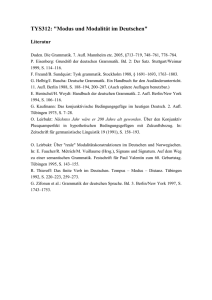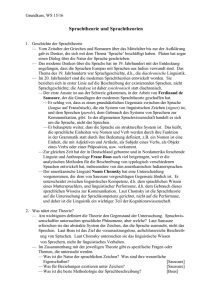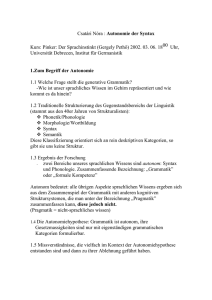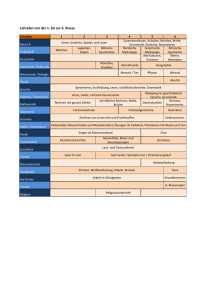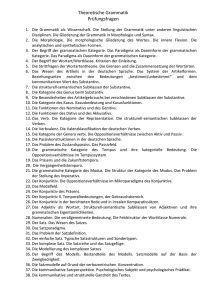Die Beziehung der Grammatik zur kommunikativen Funktion der
Werbung

Die Beziehung der Grammatik zur kommunikativen Funktion der Sprache* Gisbert Fanselow Universität Potsdam Die Frage nach der korrekten Einschätzung der "Natur der Sprache" vermag heute -anders als in den achtziger Jahren- kaum noch die Gemüter von Linguisten und Kommunikationswissenschaftlern zu erhitzen. Unter anderem mag dies daran liegen, dass auf der Basis empirischer Befunde und theoretischer Einsichten die "generative Grammatik" zumindest in einigen ihrer Schulen ihre wissenschaftliche Position modifiziert und relativiert hat, so dass sie teilweise ihren früheren Kontrahenten nunmehr mit einer kompromissfähigen Position gegenübertreten kann - zumindest tritt sie aber nicht mehr als monolithischer Block mit einer einheitlichen Meinung zum Thema Grammatik, Sprache und Kommunikation auf. Ich möchte in diesem Aufsatz in zwei Aspekten Entwicklungslinien einer veränderten Einstellung zur Relevanz der kommunikativen Funktion von Sprache für die Erklärung von Grammatik nachzeichnen. Das dabei entstehende Bild wird grammatikzentriert sein, aber erkennen lassen, warum wir Grammatik nicht verstehen können, wenn wir bei unseren wissenschaftlichen Bemühungen ausser Acht lassen, dass die Grammatikfähigkeit vom Menschen für Zwecke eingesetzt wird, und dass der Zweck Kommunikation für Sprache und Sprachfähigkeit ein wesentlicher ist. Nach einer kurzen Besprechung der "klassisch-generativen" Sicht werde ich zunächst das Verhältnis Grammatik-Kommunikation unter substantieller Perspektive betrachten, und dabei ein Beispiel (Wortstellung) genauer darstellen. Anschliessend wende ich mich architekturalen Fragen der Grammatikkonstitution zu; hier bezieht sich der Detailfokus auf das Problem der "Unaussprechbarkeit" bestimmter Inhalte und der Frage, welche Lösungen hierfür ein Grammatikkonzept voraussetzen, das von der Kommunikationssituation her abgeleitet ist. Das klassisch-generative Konzept von Sprache (und seine Grenzen) Die "klassische" Perspektive der generativen Grammatikforschung auf ihren Gegenstand –zumindest im Bereich der Syntax- geht von der These aus, man könne die Grammatik aus sich selbst heraus verstehen. Erstens heisst dies, dass bei der Formulierung syntaktischer Prinzi- pien der Bezug auf aussersyntaktische (d.h. nicht-formale) Gegebenheiten vermieden werden kann, und zweitens beinhaltet die klassische Sicht auch die These, dass solch eine syntaxinterne Sicht auch explanativ angemessen ist. Solche empirischen Ansprüche, die man unter dem Etikett "Autonomie der Syntax" vertreten hat, lassen sich als Reaktion auf die Schule der generativen Semantik verstehen, die in den sechziger Jahren die Syntax aus semantischen Gesetzen abzuleiten versuchte. Die heftige Diskussion der achtziger Jahre zwischen Vertretern der generativen Syntaxtheorie einerseits und mehr funktional orientierten Sprachwissenschaftlern andererseits über die Natur von Sprache und Grammatik löste der Anspruch der Autonomie der Syntax nun vor aus, als er zusätzlich mit einem nativistischen Anspruch verbunden wurde (vgl. Chomsky 1980, 1986a, siehe auch Fanselow & Felix 1987 für eine detaillierte Darstellung). Das Argument für eine angeborene autonome Grammatik lässt sich sehr einfach rekonstruieren: Sofern es richtig ist, dass die zugrundeliegenden Prinzipien natürlichsprachlicher Grammatiken so komplex sind, dass Kinder sie im strengen Sinne nicht lernen können, kann man kaum daran zweifeln, dass wesentliche Aspekte der menschlichen Sprachfähigkeit angeboren sind. Wahrscheinlich wird kaum jemand ernstlich bezweifeln, dass die menschliche Sprachfähigkeit genetisch in mehr oder minder abstrakter Weise vorprogrammiert ist1. Tatsächlich ging Chomsky aber einen Schritt weiter, in dem er für diese angeborenen Grundlagen der Sprachfähigkeit postulierte, dass sie aufgaben- oder besser syntaxspezifisch sind. Als Begründung hierfür liess sich anführen, dass -zumindest auf dem Erkenntnisstand der Rektions- und Bindungstheorie (Chomsky 1981)- die universellen und angeborenen grammatischen Prinzipien eben nicht auf andere kognitive Domänen reduziert werden können. Dies schien sowohl für den Objektbezug zu gelten (Grammatische Prinzipien referieren irreduzibel auf Konzepte wie "Subjekt" oder "Rektion", die nur mit Bezug auf Sprache zu verstehen sind), als auch hinsichtlich der postulierten Beziehungen zwischen diesen Objekten. Welches allgemein-kognitive Pendant könnte man sich denn auch für die syntaktischen Postulate der Rektions- und Bindungstheorie vorstellen? Die Spracherwerbsproblematik führte also in Verbindung mit der These der Autonomie der Syntax zu einer Sprachtheorie, deren wesentlicher Bestandteil die Annahme einer angeborenen Universalgrammatik war, die im Sinne von Fodor (1984) als "kognitives Modul" verstanden wurde. Offensichtlich kann es in dieser Theorie zumindest keine direkte Verbindung zwischen den Gesetzen der Universalgrammatik und der Verwendung von Sprache als Kommunikationsmittel geben. Schliesslich ist die zu erklärende Grösse Grammatikfähigkeit ja biologisch verursacht, weil angeboren, so dass sich ihre Eigenschaften im Individuum stets unabhängig von jeder Verwendung entfalten2. Einzig in phylogenetischer Hinsicht könnte man versuchen, As- pekte der Kommunikationssituation und Sprachgesetze auf einander zu beziehen, d.h. versuchen, Eigenschaften der Universalgrammatik als Ergebnis eines biologischen Anpassungsprozesses an die Erfordernisse des Kommunizierens herzuleiten (genauso wie man biologisch determinierte Eigenschaften des Auges oder des kognitiven visuellen Systems als Anpassung an die Erfordernisse des Sehens herleiten kann). Tatsächlich hat man aber eher vermieden, einen solchen Zusammenhang zu konstruieren3, und die Entstehung der Grammatikfähigkeit als exaptiv angesehen (Haider 1991, Fanselow 1991, 1992): die angeborene Universalgrammatik ist auf biologischen Strukturen fundiert, die ursprünglich für ganz andere Zwecke selegiert worden waren bzw. deren Konstitution sich aus allgemeinen biologischen Gesetzen von Wachstum und Form erklären lässt. Im evolutiven Prozess erwarben diese Strukturen die Aufgabe, den Grammatikerwerb zu steuern. Was an Grammatiken gelernt werden kann (womit wir als reife Sprecher kommunizieren können), wäre also von biologischen Grenzen bestimmt, die mit Sprache und deren Verwendung per se nichts zu tun haben. Unbefriedigend mag die nativistische Sicht der Grammatik also schon allein deswegen sein, weil sie ein ungelöstes Rätsel (die Tatsache, dass Spracherwerb überhaupt möglich ist) durch ein anderes ersetzt: wie sind die Strukturen der Universalgrammatik biologisch entstanden? Ursache für den Perspektivenwechsel in der Grammatiktheorie in den neunziger Jahren war freilich etwas ganz anderes. Grammatiksystemintern ergab sich nämlich das Problem, dass im Laufe der Erweiterung des deskriptiven Skopus der Syntaxtheorie auf immer mehr Sprachen es mehr und mehr erforderlich wurde, sehr komplex parametrisierte Prinzipien zu entwerfen. Die Rektions- und Bindungstheorie war als universalgrammatischer Ansatz ja ursprünglich auf der Basis des Englischen, von anderen germanischen und von romanischen Sprachen entworfen worden, wurde dann aber auf eine Vielzahl weiterer Sprachen angewandt. Dabei (und bei der weiteren Detailanalyse der Ausgangssprachen) bewährte sich die universalistische Perspektive zwar einigen Bereichen sehr gut, generell schien es aber erforderlich, syntaktische Prinzipien immer komplexer zu formulieren. Wenn sich aber die Komplexität der Erklärungen der Komplexität des Datenbereichs annähert, dann entgeht man dem Vorwurf, die syntaktischen Prinzipien seien nichts weiter als restatements of the facts nur dann, wenn man eine Theorie der syntaktischen Prinzipien vorlegen kann, d.h., wenn man angeben kann, warum komplexe Prinzipien genau ihre spezifische Form annehmen, und nicht etwa eine andere. Mir scheinen hier vor allem drei Reaktionen auf dieses Problem erwähnenswert. Mit Chomsky (1986b) wurde noch einmal der Versuch unternommen, eine vereinheitlichte syntaktische Theorie zu entwickeln; ein Versuch, der gemeinhin als gescheitert betrachtet wird. Koster (1988) und im Anschluss daran z.B. Fanselow (1991) versuchten, eine vereinheitlichte Gram- matik als Reflex sehr allgemeiner kognitiver Strukturierungsprinzipien zu rekonstruieren (es gibt also nach diese These keine Universalgrammatik als notwendig sprachspezifisches System). Inwieweit es gelungen ist, viele oder alle grammatischen Fakten in diesen Prinzipiensystemen befriedigend zu erfassen, kann man hier dahingestellt sein lassen; sicher richtig ist dagegen, dass der Nachweis der Gültigkeit der vorgeschlagenen abstrakten Strukturprinzipien auch ausserhalb der grammatischen Domäne (noch?) nicht erbracht wurde. Genau wie bei der aufgabenspezifischen Variante des Nativismus ist aber auch in diesen Vorschlägen ein Bezug zwischen Syntax und Kommunikation nicht erkennbar - Koster (1988) und Fanselow (1991) sehen ja gerade Grammatik als Manifestation einer nicht zweckgebundenen formalen Kompetenz des Menschen an. Chomskys zweite Reaktion auf das eben erwähnte Erklärungsproblem der generativen Grammatiktheorie -die Notwendigkeit, immer kompliziertere Grammatikprinzipien vorschlagen zu müssen, deren Erklärungskraft schwindet- lag dagegen in einer radikalen Kehrtwende bei der Konzipierung von Syntax und Grammatik. Durchaus unter Inkaufnahme erheblicher Kosten bei der deskriptiven Breite des Grammatikmodells4 sieht Chomsky (1995) den Sprachbau im wesentlichen nur durch Prinzipien erklärt, die dem Gegenstand Sprache/Grammatik praktisch mit Notwendigkeit ("virtual conceptual necessity") zukommen müssen; das grammatische System, die Sprache, sind fast perfekt konstruierte Objekte für ihren Zweck, nämlich der Konstruktion einer Beziehung zwischen dem artikulatorisch-perzeptiven System einerseits, und dem konzeptuellen System andererseits. Eigenständige Prinzipien kennen nur das artikulatorisch-perzeptive und das konzeptuelle System; die Universalgrammatik reduziert sich weitgehend auf Ökonomieerwägungen. Gleich in zwei Aspekten nimmt Chomsky also heutzutage Positionen ein, die radikal verschieden sind von den Annahmen z. B. der Rektions- und Bindungstheorie. Erstens kann die These, dass die Prinzipien des Grammatiksystems praktisch mit begrifflicher Notwendigkeit gültig sind, eigentlich kaum Anlass dafür sein, dieses System auch noch als biologisch bedingt anzusehen. Schliesslich dürften ja biologisch bedingte Fähigkeiten zwar funktional optimal angepasst sein, jedoch in ihrer Konstruktion oft 'imperfekt' erscheinen (so auch Chomsky 1995). Sie sind ja entweder aus einer Folge gradualer und nicht zielgerichteter Veränderungen entstanden, oder resultieren aus der Übernahme neuer Aufgaben durch ein für andere Zwecke selegiertes System. Für beide Fälle erwartet man nicht, dass die funktional optimalen Anpassungen auch auf eleganten und einfachen Grundprinzipien basieren. Mir scheint in diesem Widerspruch zwischen der "Eleganz und Ökonomie" des grammatischen Systems und den Imperfektionen biologischer Systeme weniger ein Rätsel und eine Herausforderung an wissenschaftliche Erklärung zu liegen, sondern er scheint mir darauf hinzudeuten, dass die Strukturgesetze der Verhaltensebene (die syntaktischen Prinzipien) eben nicht als biologische Objekte reifiziert werden dürfen (Rose 1987)5. Zweitens ist in diesem 'minimalistischen' Programm von Chomsky (1993, 1995) erstmals die Wichtigkeit der Einbettung der Grammatik in ein der Formulierung und Äusserung von Gedanken dienendes System (die Verbindung des artikulatorischen mit dem kognitiven System) anerkannt. Wesentliche Eigenschaften der Syntax sollen sich ja gerade aus den Erfordernissen der Konstruktion der Verbindung zwischen Artikulation/Perzeption einerseits und Kognition andererseits ergeben. Wir können im Rahmen des minimalistischen Programms also "Syntax" nur dann verstehen, wenn wir sie als die Abbildungsfunktion zwischen Inhalt und phonologischer Form begreifen. Aber diese Abbildung zu fokussieren, ist nur in einem kommunikationsbezogenen Sprachkonzept sinnvoll. Wäre sie nicht in den Kommunikationsprozess eingebettet, so hätte die Syntax nach dieser Sicht potenziell eine andere Form. Neben dem minimalistischen Programm hat sich die Optimalitätstheorie (Prince & Smolensky 1993, siehe Kager 1999 für eine phonologische und Müller 2000 für eine syntaktische Einführung) in der Syntax etablieren können; in der Phonologie, für die sie ursprünglich konzipiert wurde, ist sie sicher aktuell der dominante Ansatz. Sie geht -wie das Rektions- und Bindungsmodell- davon aus, dass die Grammatiken natürlicher Sprachen durch ein System universeller Prinzipien definiert sind. Diese Prinzipien sind aber verletzbar, weil sie zueinander in Konflikt stehen können, und sich bei solchen Konflikten stets das "stärkere" Prinzip durchsetzt. Unterschiede zwischen Einzelsprachen ergeben sich nicht aus Differenzen in der Formulierung der Prinzipien, sondern in der unterschiedlichen und von der Einzelsprache abhängigen Gewichtung dieser Prinzipien. Wenn man zulässt, dass Prinzipien -wegen des potentiellen Konflikts mit anderen Gesetzen der Sprache- nicht immer in jedem Satz erfüllt sein müssen, dann kann man Prinzipien weniger kompliziert formulieren - "Ausnahmen" zum Prinzip müssen nicht im grammatischen Gesetz selber kodiert werden, sondern ergeben sich aus der Interaktion zweier oder mehrerer an sich sehr einfacher grammatischer Gesetze. Das heisst, dass man das oben diskutierte explanative Problem der Rektions- und Bindungstheorie zumindest potentiell umgehen kann. Für solche einfachen und allgemeinen Prinzipien der Grammatik lässt sich dann auch viel einfacher eine Theorie des "möglichen Strukturprinzips" entwickeln. Sehr einfache Strukturprinzipien der Syntax haben aber auch das Potenzial, wie ihre phonologischen Gegenstücke grounded zu sein, d.h., sich aus der Grammatisierung von Anforderungen aus der Sprachperzeption, der Pragmatik, semantischer Gesetze, etc. zu ergeben. Dass Kommunikation für den Aufbau von Grammatik bedeutsam sein kann, ist also auch mit der Optimalitätstheorie kompatibel. Die Linkslastigkeit der Sprache Als Beleg für die These, dass sich (einige) grammatische Organisationsprinzipien nur mit Rekurs auf die Kommunikationssituation verstanden werden können, lässt sich eine überraschende Fülle von Beispielen anführen. Sieht man Sprache oder Grammatik im wesentlichen allein als Teil eines Systems zur Repräsentation und Manipulation von Gedanken an, so sollten Anpassungen der Grammatik an die Kommunikationssituation nicht zu erwarten sein. Ein erstes Beispiel für eine solche Anpassung der Syntax an "Kommunikation" folgt aus den Beschränkungen des expressiven Systems. Hat ein Verb oder ein anderes Prädikat mehr als zwei Argumente, so muss das Sprachsystem es erlauben, diese beiden Argumente voneinander zu unterscheiden, und die Optionen hierfür müssen den Möglichkeiten des expressiven Systems angepasst sein, wenn die zu repräsentierenden Sachverhalte auch kommuniziert werden sollen. In gesprochenen Sprachen werden nun die verschiedenen Aktanten eines Verbs entweder durch die lineare Stellung der Wörter (Englisch: das Subjekt steht vor dem finiten Element, das Objekt folgt dem Verb unmittelbar) oder durch Formvariation -entweder am Argument selbst (=Kasus, Latein: das Subjekt trägt den Nominativ, das direkte Objekt den Akkusativ) oder am Verb (Kongruenz, z.B. in den polysynthetischen Sprachen wie Mohawk: Kongruenzmorpheme am Verb kodieren, welche Nominalphrase Objekt ist und welche Subjekt) unterschieden. Denis Bouchard6 hat nun postuliert, dass man diese Einschränkung offenkundig darauf zurückführen kann, dass unser Artikulationssystem nicht für andere Mittel der Differenzierung grammatischer Funktionen angelegt ist (es gibt nur zeitliches Vor- und Hintereinander, wir können die Wörter nicht im dreidimensionalen Raum anordnen, aber auf der Basis des Möglichkeiten des Lexikons Formvariation vornehmen). Nicht-trivial erscheint mir an dieser Reflexion vor allem die Tatsache, dass die geringe Zahl der verfügbaren Differenzierungsmethoden m.E. dazu zwingt, eine Differenzierungsmethode für mehrere Zwecke einzusetzen. So wird im Englischen Wortstellung neben der Kodierung grammatischer Funktionen (Subjekt-Objekt) auch z. B. zur Signalisierung semantisch-pragmatischer Funktionen eingesetzt (etwa müssen Fragewörter an den Satzanfang gestellt werden), was dazu führt, dass miteinander inkompatible Forderungen an die Serialisierung der Wörter resultieren können: ein what in Objektfunktion sollte dem Verb folgen (zum Ausdruck der grammatischen Funktion) und aber auch an der Satzspitze stehen (weil Fragesätze mit Fragewörtern beginnen müssen). Bekanntlich wird dieser Konflikt im Englischen zugunsten letzterer Forderung aufgelöst (what did you say, *you said what). Aus dieser vermutlich gegebenen Unvermeidbarkeit von Konflikten zwischen Serialisierungsregeln ergeben sich nun fundamentale architekturale Konsequenzen für die Grammatikkonstitution. Transformationell orientierte Modelle nehmen etwa an, dass in der grammatischen Derivation das Objekt zunächst in der kanonischen Position erzeugt und dann an die Satzspitze bewegt wird, i.e., Transformationen und die daraus resultierende Mehrebenennatur der Syntax sind architekturale Konsequenzen der Konfliktnatur der Sprache, die selbst aus den Beschränkungen des expressiven Systems folgt. Ähnlich sind die "Vermeidungsstrategien" für Transformationen in anderen grammatischen Ansätzen auch nur erforderlich, um mit den konstruktionsbedingten Widersprüchen innerhalb der Grammatik umzugehen, und die Optimalitätstheorie erhebt die Konfliktnatur von Sprache zu ihrem obersten konstitutiven Prinzip. Wenn man so weit gehen will, kann man also sagen: die Beschränkungen des expressiven Systems prägen die Grammatik nicht nur im Detail, sondern auch im Gesamtbild und ein expressives System setzt voraus, dass Sprache zur Kommunikation verwendet wird. Gebärdensprachen nützen z.B. beim Ausdruck der Koreferenz durchaus dem gesamten, dreidimensionalen visuellen Artikulationsraum aus (Rückkehr zur Artikulationsstelle einer Nominalphrase/eines Verbarguments), und sind so auf das Kommunikationsmittel "Pronomen" nicht angewiesen. Dieser Unterschied zu den gesprochenen Sprachen belegt, dass der gewählte Artikulationskanal Konsequenzen für die Struktur der Grammatik hat. Die Berücksichtigung der Kommunikationssituation in der Form der Grammatik spiegelt sich aber z.B. auch in der "Links-Rechts-Asymmetrie" natürlicher Sprachen wieder. Am linken Rand eines Satzes oder einer Phrase gelten andere Gesetze als am rechten Rand, und diese Tatsache muss erklärt werden. Ohne Rekurs auf die Bedürfnisse der Kommunikationssituation kann so eine Erklärung aber nicht gefunden werden. Aus einer Fülle von Beispielen für die Linksorientierung der Grammatik sollen hier nur einige herausgegriffen werden. Geht man davon aus, dass Phrasen oder Wörter eine kanonische Position einnehmen, so können wir feststellen, dass Fragephrasen in einigen Sprachen (Japanisch, Chinesisch) in dieser kanonischen Position verharren, in anderen (Englisch, Deutsch) aber wie gesagt diese kanonische Position verlassen, um an die Spitze desjenigen Satzes gestellt zu werden, über den sie semantisch Skopus nehmen, wie (1) zeigt7. (1) a. he saw something b. (it does not matter) what he saw _ *he saw what Sprachen mit Subjekt-Verb-Objekt Grundstellung (wie Englisch oder die skandinavischen) tendieren dazu, solche Voranstellungen von Fragephrasen aufzuweisen, SOV-Sprachen wie Japanisch tendieren dazu, die Fragewörter im Prinzip in der kanonischen Position zu belassen. Bedeutsam ist aber vor allem, dass -von einer umstrittenen Ausnahme abgesehen (Tagale, siehe Kenstowicz 1987, aber vergleiche Haider 1994)- Fragewörter stets an den linken Satzrand wandern, wenn sie die ihrer Argumentfunktion entsprechende kanonische Funktion verlassen. Es gibt also anders formuliert kein unstrittiges Beispiel für eine Sprache, welche die Fragewörter grundsätzlich an den rechten Rand des Satzes stellen würde. Versetzungen von Phrasen sind also -zumindest bei der Fragebildung- immer nach links orientiert, und dieser Sachverhalt muss eine Erklärung finden. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens bei den anderen Regularitäten, die zum Ausdruck semantisch-pragmatischer Funktionen dienen. Weist eine Sprache die Möglichkeit auf, fokussierte Phrasen an eine spezifische Position zu versetzen, so geht auch diese Bewegung nach links. Auch Relativpronomina werden –relativ zu ihrer kanonischer Position- nach links versetzt, und nicht nach rechts (Downing 1978)8. Bewegung von Phrasen im Satz, zumindest die v.a. auf Grund syntaktischer Bedingungen ausgelöste, ist also asymmetrisch linksorientiert. Köpfe von Phrasen (also das Wort, das die syntaktische Kategorie der Phrase festlegt) können in der Phrase entweder links oder rechts angeordnet sein. So steht das japanische Verb am Ende der Verbalphrase, das englische oder französische dagegen am Beginn der Verbalphrase. Die deutsche Adjektivphrase hört mit dem Adjektiv auf, die englische beginnt mit ihm. (2) watashi-wa [VerbalPhrase kono tochi o kau] ich-top dies Land-acc kaufen John [VerbalPhrase loves Mary] (3) er ist [Adjektivphrase auf seine Tochter stolz] he is [Adjektivphrase proud of his daughter] Diese Symmetrie in den Serialisierungsmöglichkeiten für die Köpfe von Phrasen spiegelt sich nicht in einer Symmetrie der sogenannten Spezifikatorpositionen in Phrasen wieder. Auch dort ist der linke Rand bevorzugt. Unter einem Spezifikator der Phrase X versteht man einen Ausdruck, der X in gewisser (hier irrelevanter) Hinsicht vervollständigt oder abschliesst. Das einfachste Beispiel für einen Spezifikator ist das Subjekt. Subjekt stehen in der kanonischen Abfolge in Sprachen entweder direkt hinter dem Verb (4a) (=VSO-Sprachen9, hier Irisch) oder direkt an der Satzspitze (siehe (4b) für den SVO-Typ und (4c) für den SOV-Typ, hier Baskisch). (4a) D'eirigh Ciaran erhob-3sg Ciaran "Ciaran stand auf" (4b) John saw Mary (4c) Jonek hori daki John das weiss "John weiss das" Sprachen mit den kanonischen Abfolgen VOS, OVS oder OSV existieren zwar, machen aber einen verschwindend geringen Anteil der Sprachen der Welt aus. Wichtig ist auch, dass man dafür argumentieren kann (siehe etwa Kayne 1994:36), dass die Abfolgen VOS oder OVS niemals "kanonische" (zugrundeliegende) Muster sind, sondern in allen Sprachen (auch dort, wo diese Abfolgen dominieren) aus den subjektsinitialen Muster abgeleitet sind - so wie das für den deutschen OVS-Satz (5c) relativ zu den kanonischen Mustern (5a) und (5b) (SOV) zu gelten scheint. (5a) dass der Hans das Buch gelesen hat (5b) der Hans hat das Buch gelesen (5c) das Buch gelesen hat der Hans O V S Für die "kanonischen" Abfolge gibt es also anscheinend keine oder nur wenige Sprachen, die den Satzspezifikator Subjekt zwangsweise nach rechts setzen. Nimmt man an (wie in Chomsky 1995), dass (phrasale) Bewegungen immer in Spezifikatorpositionen führen, so lassen sich die beiden eben besprochenen Linkspräferenzen von Sprache aufeinander beziehen. In vielen Sprachen (so dem Deutschen, dem Bretonischen, dem Kashmiri) steht das finite, also für in Übereinstimmung mit dem Subjekt flektierte (Hilfs-) Verb in der zweiten Position des Hauptsatzes - von links her betrachtet (siehe etwa (5b)). Es gibt keine Sprache, in der das flektierte Verb in der zweiten Position von rechts erscheinen müsste. Relativ zur kanonischen Abfolge kann sich ein Pronomen nur dann auf eine quantifizierte Nominalphrase beziehen, wenn letztere links vom Pronomen steht: nur in (6a), nicht aber in (6b), kann er sich semantisch auf niemand beziehen (von niemand gebunden werden). (Bei- spiel (6c) belegt, dass die Verhältnisse bei nichtkanonischen Serialisierungen wie hier OVS komplizierter sind). (6a) Dass niemand mir die Frau zeigte, die er liebt (6b) Dass er mir die Frau zeigte, die niemand liebt (6c) mir die Frau zeigen, die er liebt, wollte niemand Aus grammatikinterner Perspektive gibt es nun keinen Grund für diese systematische Bevorzugung des linken Randes von Sätzen und Konstituenten in natürlichen Sprachen. Ein grammatisches System, das sich spiegelbildlich verhielte, wäre genauso einfach oder kompliziert wie das linksorientierte. Die Asymmetrie der Grammatik kann man bei syntaxinterner Betrachtung nicht verstehen. Auch wenn man die minimalistische Perspektive einnimmt, ergibt sich die Bevorzugung des linken Randes nicht unmittelbar. Sicherlich müssen die vermutlich hierarchisch aufgebauten Repräsentationen von Sachverhalten im kognitiven System des Menschen vom artikulatorischen System serialisiert werden, und man kann auch zugestehen, dass diese Serialisierung uniform und einfach sein muss (siehe Chomsky 1995), aber hierfür gibt es -wie auch Kayne (1994:36) einräumt- eben zwei gute Lösungen: eine, die "hierarchisch höher stehen" in zeitliche Präzedenz überträgt (wenn X höher in der Hierarchie als Y ist, geht X Y voran, siehe (7a)), und eine, die zeitliches Folgen bevorzugt (7b). (7a) [ X [ Y [ Z [ U [ V [W]]]]]] (7b) [[[[[[ W] V ] U ] Z ] Y ] X ] Durch eine Sequenz nicht unabhängig motivierter Stipulationen (so in Kayne 1994:37) kann man zwar versuchen, die Bevorzugung von Präzedenz formal zu erzwingen. Plausibler ist aber10, dass die Linkslastigkeit der Sprache sich aus der Tatsache ergibt, dass Sätze kommuniziert werden sollen, also vom Hörer verarbeitet werden müssen, und zwar inkrementell in effektiver Weise. Wir warten als Hörer nicht auf das Satzende, um erst dann mit der Satzanalyse und der semantischen Interpretation zu beginnen, sondern die Sprachverarbeitung folgt dem Inputstrom des Hörers, und zwar so, dass wir nur selten Verstehens'entscheidungen', die wir zu Beginn oder in der Mitte des Satzes getroffen haben, am Ende revidieren müssen. Nur so kann Kommunikation effektiv sein. In einer einfachen Sichtweise kann man nun sagen, dass wir bei inkrementeller Analyse natürlich nur dann ein Pronomen auf einen Quantor beziehen können, wenn wir diesen schon gehört haben, wenn er dem Pronomen vorangeht. In einer einfachen Sichtweise können wir ferner sagen, dass Hörer sobald es nur geht den Satztyp der Äusserung identifizieren können müssen - und es daher von Vorteil ist, das Fragewort an die Spitze des Satzes zu stellen, und nicht an sein Ende. Analoge einfache Erklärungen lassen sich für die anderen vorgebrachten Beispiele für Linkslastigkeit auch formulieren. In einer komplizierteren Sichtweise (Haider 1993, Kayne 1994, Chomsky 1995) würden wir dagegen sagen, dass grammatische Prinzipien stets auf Hierarchien basieren: der Quantor muss hierarchisch höher in der Satzstruktur stehen als das Pronomen, das er bindet. Das Subjekt muss das hierarchisch höchste Element im (einfachen) Satz sein. Die höchste hierarchische Position einer Ergänzungsfrage muss durch ein Fragewort gefüllt sein - und so weiter. Erst bei der Linearisierung dieser Hierarchien kommt die inkrementelle Verarbeitung von Sprache ins Spiel. Der wesentliche Unterschied zwischen "links" und "rechts" wird deutlich, wenn man z.B. berücksichtigt, dass zusammengesetzte sprachliche Ausdrücke zu unterschiedlichen Kategorien (Satz, Nominalphrase, etc.) gehören, und diese bei der OnlineSprachverarbeitung erkannt werden müssen. Es scheint nun vernünftig anzunehmen, dass das menschliche Sprachverarbeitungssystem bei der Analyse eines Ausdrucks der Kategorie K auch eine Hypothese über die Kategorie L formuliert, von der K unmittelbarer Bestandteil ist. Wenn man das Subjekt identifiziert hat, postuliert man, dass es einen Satz zu verarbeiten gilt, wenn man eine Genetiv-Nominalphrase verarbeitet hat (Peters) postuliert man, dass diese Teil einer grösseren Nominalphrase (Peters Buch) ist. Für dieses als Left-Corner-Verfahren oder "Mutterknoten-Konstruktion" (Hawkins 1994) bezeichnete Verfahren hat nun der Unterschied zwischen links- und rechtsbezogener Sprachkonstruktion natürlich grosse Bedeutung. Übertragen auf unser abstraktes Beispiel (7) sehen wir an (8), dass im Falle von (8a) bei einer inkrementellen Sprachverarbeitung mit Mutterknotenkonstruktion schon bei der Analyse des ersten relevanten Elements X in (8a) eine Hypothese über die Kategorie der Gesamtkonstruktion A formuliert werden kann: X ist unmittelbarer Bestandteil des Gesamtausdrucks. (8a) [A X [B Y [C Z [D U [E V [F W]]]]]] (8b) [A[B[C[D[E[F W] V ] U ] Z ] Y ] X ] Ganz anders ist dies aber in (8b): hier kann man auf der Basis der ersten Elements W nur die Kategorie eines kleinen Teils des Gesamtausdrucks (F) postulieren. Eine Aussage über A zu machen, hiesse, dass man A nicht wie in (8a) auf der Basis eines potentiellen unmittelbaren Bestandteils von A (nämlich X) postuliert. Die These wäre in (8b) auf der Basis eines Teils (W) eines Teils (F) eines Teils (E) eines Teils (C ) eines Teils (B) des Gesamtausdrucks zu "rechtfertigen". Wenn bei der Syntaxverarbeitung inkrementell schnell aber möglichst sicher Hypothesen über die Gesamtäusserung formuliert werden können müssen, dann hat (8a) einen unbestreitbaren Vorteil gegenüber (8b). Sowohl in der einfachen wie in der komplexen Version basiert die Herleitung der LinksRechts-Asymmetrie in der Sprache auf der Tatsache, dass Sätze vom Hörer inkrementell verarbeitet werden müssen. Dass diese Erfordernis besteht, folgt nicht aus der Repräsentationsleistung von Sprache, sondern aus ihrer kommunikativen Funktion. Die Linkslastigkeit von Grammatik ist eine ihrer zentralen substantiellen Eigenschaft. Folgt sie wie angedeutet aus der Optimierung der Verarbeitbarkeit, dann können wir Grammatik ohne Berücksichtigung der Kommunikation nicht verstehen. Auch andere grammatische Fundamentalgesetze mögen einen Bezug zur Kommunikation aufweisen. Vorschläge zur pragmatischen Ableitung bestimmter Beschränkungen über grammatische Operationen finden sich beispielsweise schon bei Erteshik-Shir (1977). Nicht alle grundlegenden Eigenschaften von Grammatik werden eine Fundierung in der Kommunikation haben – wir müssen den Faktor Lernbarkeit berücksichtigen, in unsere Erklärung mit einbeziehen, dass Grammatiken historisch entstandene Gebilde sind (siehe etwa Alexiadou & Fanselow 2000) und werden auch nicht in Abrede stellen wollen, dass allgemeine Prinzipien der Kognition und auch sprachspezifische Aspekte der Kognition Grammatiken formen – dass wir aber Kommunikation ebenso berücksichtigen müssen, kann nicht in Abrede gestellt werden. Unaussprechbarkeit Nach dieser Betrachtung einer substantiellen Eigenschaft von Grammatik will ich mich nun der Frage zuwenden, ob bestimmte architektural-begriffliche Aspekte von Grammatik ebenso nur in Bezug auf die kommunikative Situation verstanden werden können. Ein vielleicht überraschendes Resultat dieser Reflexion wird sein, dass der Begriff der "Grammatikalität" nicht ohne Berücksichtigung des kommunikativen Paars Sprecher-Hörer fixiert werden kann. "Grammatikalität" ist ein theoretischer Terminus, der in der generativen Grammatik mit Bezug auf die Frage definiert ist, ob ein Satz aus dem Regelsystem des Sprachsystems hergeleitet werden kann oder nicht. In der klassischen (nicht-transderivationellen) Sichtweise muss man nun einfach die logischen Konsequenzen eines postulierten Axiomensystems betrachten, um festzustellen, ob ein Satz oder eine andere Äusserung als grammatisch vorhergesagt wird oder nicht. Etwas deutlicher gesagt: ob S grammatisch oder ist, kann man "klassisch" dadurch determinieren, in dem man die Regeln des Axiomensystems ausschliesslich bezogen auf S anwendet. Was damit gemeint ist, erkennt man besonders deutlich an den Beispielen, die zeigen, dass Grammatiken natürlicher Sprachen nicht so einfach aufgebaut sind. In dieser Erkenntnis besteht der erste Schritt hin zur Einschätzung der Rolle der Kommunikationsfunktion von Sprache für das Konzept der Grammatikalität. Noch zwei weitere Schritte werden erforderlich sein. Erstens müssen wir berücksichtigen, dass generelle Regeln inapplikabel sein können, wenn es spezifischere Setzungen gibt. Das einfachste Beispiel ist die lexikalische Blockierung: die regelmässige Formenbildung kann nicht angewendet werden, wenn im Lexikon der Sprache eine "unregelmässige" Form vermerkt ist. So bildet man analog zu lenkte, schenkte, schwenkte, renkte eben nicht *denkte als Vergangenheitsform, weil dies regelmässige Wort durch dachte blockiert wird. Selbstverständlich könnte man die Vergangenheitsbildungsregel im Deutschen so gestalten, dass in ihrer Formulierung zum Ausdruck kommt, dass sie auf denken, wissen etc. nicht angewendet werden kann, aber damit stellte man diese Einschränkung als "Zufall" dar, der per se nichts mit der Tatsache zu tun hat, dass im Lexikon bereits unregelmässige Formen eingetragen sind. Die übliche Vorgehensweise des Grammatikers ist daher eine andere: er postuliert eine allgemeine Regel (Bilde die Vergangenheit durch Anfügen von -t), deren Applikation blockiert wird, wenn im Lexikon bereits ein Eintrag für eine Vergangenheitsform eines bestimmten Wortes vorhanden ist. Damit ist aber die Grammatikalität einer Form F nicht mehr ausschliesslich durch Betrachtungen feststellbar, die sich nur auf F beziehen. F kann nur dann grammatisch sein (z.B. eine wohlgeformte Vergangenheitsform des Deutschen sein), wenn es kein G gibt, dass in bestimmter Hinsicht (z.B. wegen lexikalischer Spezifikation) ausgezeichnet ist, und F blockiert. Das eben betrachtete Beispiel ist eine Instanz des Spezifitätsprinzips, dessen Relevanz für die Grammatikkonstitution bereits durch Panini in der altindischen Grammatiktradition erkannt wurde, und das sich etwa auch in folgenden Hinsichten manifestiert: a) Der Komparativ wird im Englischen durch Kombination mit more gebildet. Wenn das Adjektiv aber einsilbig ist (oder ein Zweisilber auf -y), dann wird der Komparativ durch Anfügen von -er gebildet (nice-nicer). Die spezifischere Regel blockiert die allgemeine (*more nice) - die Ungrammatikalität von *more nice erkennen wir nur, wenn wir errechnet haben, dass nicer wohlgeformt ist (siehe etwa di Sciullo & Williams 1987). b) Zum Ausdruck der Koreferenz verwendet man Pronomina (Hans hofft, dass Maria ihn liebt). Bei Satzgenossen (und unter weiteren Bedingungen) drückt aber ein Reflexivum Koreferenz aus (Hans betrachtet sich im Spiegel). Die Option zur Verwendung des Reflexivums verhindert, dass ein Pronomen im selben Kontext eine koreferente Deutung erfahren kann: Hans betrachtet ihn im Spiegel (Hans ≠ ihn!). Zur Berechung der Deutungsoptionen von Pronomina muss man also bestimmt haben, ob ähnliche Bedeutungen durch Reflexivpronomina ausgedrückt werden könnten (Fanselow 1991). Konkurrenz zwischen verschiedenen Ausdrucksoptionen spielt aber nicht nur dann eine Rolle, wenn das Spezifitätsprinzip einschlägig ist. Sowohl im minimalistischen Programm Chomskys als auch generell in der Optimalitätstheorie kann man oft oder immer die Wohlgeformtheit einer Struktur nur dann feststellen, wenn man errechnet hat, dass sie ihren Alternativen überlegen ist. Betrachten wir hierzu ein einfaches Beispiel. Die englische Grammatik ist z.B. von den Regeln in (9) bestimmt, wie wir schon mehrfach angesprochen haben. (9a) Subjekte gehen dem Verb voran (9b) Objekte folgen dem Verb (9c) Im Fragesatz muss genau eine wh-Phrase (who, what, etc ...) an der Satzspitze stehen. Die ersten beiden Beispiele in (10) belegen nun einfach, dass (9c) wichtiger als (9a) oder (9b) ist. Frage-Objekte können offenbar an die Satzspitze plaziert werden. Unter dieser Perspektive scheint es zunächst rätselhaft, warum man in Doppelfragen dann im Englischen das Objekt gerade, wie (10d) zeigt, nicht voranstellen darf. (10a) *you saw what (10b) what did you see (10c) who saw what (10d) *what did who see Eine genauere Reflexion führt aber zu einer einfachen Beschreibung. (9c) ist wichtiger als (9b). Dass wir das Objekt in (10b) voranstellen, liegt daran, dass wir keine alternative Form mit derselben potenziellen Bedeutung finden können, in der wir (9c) beachten, ohne (9b) zu verletzen. Das ist in (10c-d) anders: In (10d) haben wir (9c) beachtet und dabei (9b) verletzt - aber diese Verletzung von (9b) hätten wir vermeiden können, wenn wir (10c) wählen. Ob wir das Objekt unter Verletzung von (9b) voranstellen dürfen, hängt also davon ab, ob es Formen gleichen Inhalts gibt, die diese Verletzung (und die Verletzung wichtigerer Prinzipien) vermeiden können. Wenn nein, dann ist die Objektvoranstellung grammatisch, wenn ja (wie in (10c-d), ist sie keine zulässige Option. Obwohl Spezifität diesmal keine Rolle spielt, müssen wir bei der Errechnung der Grammatikalität von (10b) und (10d) auch alternative Optionen (10a, 10c) in Betracht ziehen. Zumindest sieht dies so die Optimalitätstheorie (und in eingeschränkter und etwas anders fokussierter Weise das minimalistische Programm, das wir hier ausser Betrachtung lassen wollen). Halten wir also fest: Wenn wir feststellen wollen, ob eine Struktur wohlgeformt ist, müssen wir in einem eingeschränkten Suchraum (z.B. Formen mit potentiell derselben Bedeutung) verschiedene Alternativen bewerten, und wir wählen dann als grammatisch diejenige, die in bestimmten Hinsichten (Spezifität, weniger Verletzungen grammatische Prinzipien) ausgezeichnet ist. Dies ist der erste Schritt hin zur Verbindung von Grammatikalität und Kommunikationssituation. Der zweite Schritt besteht in der Einsicht, dass dies Konzept die Vorhersage macht, dass wir im Suchraum auch immer mindestens eine ausgezeichnete und daher grammatische Form finden sollten. Grammatikalität verwandelt sich ja in ein relatives Konzept (die Struktur, die die Prinzipien am wenigsten verletzt, ist z.B. die grammatische ...). Es sollte also keine "unaussprechbaren" Inhalte geben, und diese Vorhersage ist nicht korrekt. Beispielsweise kann man weder im Deutschen noch im Englischen das quantifizierende Objekt von wiegen erfragen, wenn es selbst aus einem eingebetteten Fragesatz stammt: (11a) *wieviel fragst du dich, wer gewogen hat (11b) *how much do you wonder who weighed Analog kann man im Englischen Subjekte und how/why niemals in einer Doppelfrage kombinieren (12), man kann kein Teil eines Temporalsatzes (13) oder Relativsatzes (14) erfragen. All diese Sachverhalte sind nicht, oder wenn dann, nur sehr umständlich, formulierbar, sie sind "ineffable". (12a) *who came why (12b) *why did who come (13) *welches Buch existierte Verwirrung über Syntax, bevor Chomsky verfasst hatte? (14) *welches Buch kennst Du die Professorin, die verfasst hatte, sogar persönlich? Für das Problem, das Unaussprechbarkeit für grammatische Ansätze darstellt, die konkurrenzbasiert sind, die also aus verschiedenen alternativen Optionen immer die relativ zu bestimmten Parametern "beste" Lösung wählen, sind verschiedenen Lösungen vorgeschlagen worden, siehe etwa Müller (2000) für einen Überblick. Man kann z.B. postulieren (Pesetsky 1998), dass der Skopus der konkurrenzbasierten Syntax eingeschränkt ist, d.h., dass bestimmte Gesetze unter keinen Umständen verletzt werden dürfen (so dass KEINE der Alternativen gewählt werden kann). Unter den verschiedenen Optionen (von denen jede in ihrem Bereich ihre Berechtigung haben dürfte) ist nun die folgende für unsere Reflexion von Belang. Wie etwa Burzio (1998) beobachtet, ist die "Optimierungsrichtung" bei der Errechnung der ausgezeichneten grammatischen Form nicht immer dieselbe. Bei (10) etwa fragten wir uns: vorgegeben ein bestimmter Inhalt, was ist die optimale/ausgezeichnete Form, diesen auszudrücken? Bei der Deutung von Reflexivpronomina müssen wir aber, wie Burzio argumentiert, in die entgegengesetze Richtung überlegen: gegeben eine bestimmte Form wie (15), worauf kann sich bezogen werden? Hier bestimmen Gesetze wie bevorzugter Subjektbezug, Satzgenossenschaft, u.s.w. die Deutungsmöglichkeiten eines Reflexivums in vorgegebener Form. Bei den Personalpronomina, so Burzio, ist die Optimierungsrichtung erneut gekehrt: wir müssen relativ zu einem Inhalt (für x=Hans, x sieht x im Spiegel) fragen, ob wir ihn relativ zur Sprache besser durch Reflexiva oder durch Personalpronomina ausdrücken. (15) Hans denkt, dass Maria sich im Spiegel sieht (16) Hans sieht sich im Spiegel (17) Hans sieht ihn im Spiegel Wenn wir akzeptieren, dass beide "Optimierungsrichtungen" -von Inhalt zu bester Form, von Form zu bestem Inhalt- in der Grammatik erforderlich sind, so kann man sich fragen, was denn die Konsequenz davon ist, wenn die Optimierung in beide Richtungen nicht zum Ausgangspunkt zurückführt. Anders formuliert: was ist die Konsequenz, wenn-anders als in (18), X zwar die beste Form für A ist, aber A nicht der beste Inhalt für X? (18) Inhalt A beste Form für Inhalt A: Form X bester Inhalt für Form X: A (19) Inhalt A beste Form für Inhalt A: Form X bester Inhalt für Form X: B Nach Smolensky (2000) ist Unaussprechbarkeit für A die Folge der Situation in (19). Betrachten wir (11) unter dieser Perspektive. Der intendierte Inhalt sei (20): (20) Für welches Gewicht x gilt: du fragst dich, wer x Kilo wiegt Da nun im Deutschen fast immer das Formgesetz gilt, dass kein Teil eines Fragenebensatzes anderswo serialisiert werden darf als innerhalb dieses Fragenebensatzes, kann (11a) kein optimaler Ausdruck für (20) sein. Nehmen wir beispielsweise an, (21) sei aus der Perspektive: "Finde die optimale Form für den Inhalt" die beste Art, (20) auszudrücken. (21) du fragst dich, wer wieviel gewogen hat Für (21) müssen wir nun aber errechnen, was der beste Inhalt für diese Form ist. Im Deutschen gültige Gesetze der Form-Inhalt-Korrelation werden zum Ergebnis haben, dass (22) der beste Inhalt für (21) ist: (22) du fragst dich: für welches Paar <x,y> gilt: x hat y Kilo gewogen Anders formuliert: die beste und daher auch einzig zulässige Art, (20) zu formulieren, hat einen anderen besten und daher auch einzig zulässigen Inhalt, nämlich (22). Daher kann (20) nicht ausgesprochen werden. Ein bestimmtes Paar aus Form und Inhalt ist unter dieser Perspektive nur dann zulässig in einer Sprache, wenn die Errechnungen der "optimalen" Korrelation in beide Richtungen wie in (18) zum Ausgangspunkt zurückführt. Ist das nicht der Fall, so resultiert Ungrammatikalität und Unaussprechbarkeit. Wir haben nun die drei Vorüberlegungen zur Frage, warum die Kommunikationssituation für das Konzept "grammatisch" entscheidend ist, abgeschlossen. Wir haben erstens gesehen, dass in sehr vielen Bereichen, wenn nicht überall, Grammatikalität ein relativer Begriff ist: um festzustellen, ob eine Form F wohlgeformt ist, müssen wir nicht nur wissen, ob F nach den Formregeln der Sprache gebildet werden kann, wir müssen auch wissen, ob F unter verschiedenen Bedingungen seinen "Konkurrenten" G, H ... überlegen ist. Daraus folgt aber zweitens, dass in den konkurrenzbestimmten Teilen der Grammatik eigentlich immer mindestens eine Form zum Ausdruck eines bestimmtes Inhalts grammatisch sein müsste, und das ist nicht so. Aufbauend auf die Einsicht, dass Optimierung in beide Richtung (FormInhalt und Inhalt-Form) erforderlich scheint, sind wir drittens Smolensky (2000) in der Ansicht gefolgt, dass zumindest einige Aspekte von Unaussprechbarkeit auf die Konstellation in (19) zurückzuführen sind. Warum aber sind die beiden Optimierungsrichtungen von Relevanz, warum baut Grammatik auf beiden Richtungen gleichzeitig auf? Folgt man Vorschlägen von Blutner (2000), so entsprechen den beiden Optimierungsrichtungen den Perspektiven von Sprecher (Inhalt Form) und Hörer (Form -Inhalt). Beide Optimierungsrichtungen sind zu beachten, weil die beide Perspektiven der Kommunikationssituation berücksichtigt sind. Die allgemeine Architektur der Grammatik (Optimierung in zwei Richtungen) reflektiert die kommunikative Funktion der Sprache. Literaturverzeichnis Alexiadou, Artemis / Fanselow, Gisbert. 2000 On the Correlation Between Morphology And Syntax: The Case of V-to-I. Erscheint in den Proceedings des Germanic Syntax Workshops Groningen, Mai 2000. Blutner, Reinhard 2000 Some Aspects of Optimality in Natural Language Interpretation. ROA-38904100 Burzio, Luigi 1998 Anaphora and Soft Constraints. In: Is the Best Good Enough? Hrsg. von Pilar Barbosa, Danny Fox, Paul Hagstrom, Martha McGinnis und David Pesetsky. Cambridge, Mass.: MIT-Press. 93 – 113. Chomsky, Noam. 1980 Rules and Representations. 1981 Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris. 1986a Knowledge of Language. 1986b Barriers. Cambridge, Mass.: MIT-Press. 1995 A Minimalist Program for Linguistic Theory. Cambridge, Mass.: MIT-Press. diSciullo, Anna-Maria / Williams, Edwin 1987 On the Definition of Word. Cambridge, Mass.: MIT-Press. Downing, B. 1978 Some universals of relative clause structures. Universals of Human Language. Bd IV: Syntax. Hrsg. v. Joseph Greenberg. Stanford: Stanford University Press. 375-418. Elman, Jeffrey/ Bates, Elisabeth/ Mark Johnson/ Annette Karmiloff-Smith/ Domenico Parisi/ Kim Plunkett 1996 Rethinking Innateness: A Connectionist Perspective on Development. Cambridge, Mass.: MIT-Press. Erteshik-Shir, Nomi. 1977 On the Nature of Island Constraints. Bloomington, Indiana: IULC. Fanselow, Gisbert. 1991 Minimale Syntax. Habilitationsschrift, Universität Passau. 1992 Zur biologischen Autonomie der Grammatik. In: Biologische und soziale Grundlagen der Sprache. Hrsg. von Peter Suchsland. Tübingen: Niemeyer. 335-356. Fanselow, Gisbert & Sascha W. Felix. 1987 Sprachtheorie I: Grundlagen und Zielsetzungen. Tübingen: Francke. Fodor, Jerry. 1984 The Modularity of Mind. Cambridge, Mass.: MIT-Press. Haider, Hubert. 1991 Die menschliche Sprachfähigkeit – exaptiv und kognitiv opak. Kognitions- wissenschaft 2: 1-29. 1993 Deutsche Syntax - Generativ. Tübingen: Narr. 1994 Typological Implications of a Directionality Constraint on Projections. Ms., Univ. Stuttgart. Hawkins, John. 1994 A performance theory of order and constituency. Cambridge: Cambridge University Press. Kager, René 1999 Optimality Theory. Cambrdige: Cambridge University Press. Kayne, Richard. 1994 The Antisymmetry of Syntax. Cambridge, Mass.: MIT-Press. Kenstowicz, Michael. 1987 The phonology and syntax of wh-expressions in Tagale. Phonology Yearbook 4: 229-241. Koster, Jan. 1988 Doellose Structuren. Dordrecht, Foris. Müller, Gereon. 2000 Elemente der optimalitätstheoretischen Syntax. Tübingen: Stauffenburg (im Druck) Pesetsky, David. 1998 Some Optimality Principles of Sentence Pronunciation. In: Is the Best Good Enough? Hrsg. von Pilar Barbosa, Danny Fox, Paul Hagstrom, Martha McGinnis und David Pesetsky. Cambridge, Mass.: MIT-Press. 337-383. Prince, Alan / Smolensky, Paul. 1993 Optimality Theory. Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms., Rutgers University & University of Colorado at Boulder. Rose, Stephen. 1987 Molecules and Minds. Milton Keynes: Open University Press. Smolensky, Paul. 2000. Vortrag, gehalten auf dem Workshop zu Optimality Theoretic Semantics, Utrecht, Januar 2000. Die in diesem Aufsatz skizzierten Ideen sind von Diskussionen in den letzten Jahren mit Sascha W. Felix, Hubert Haider, Reinhold Kliegl, Gereon Müller und vielen anderen beeinflusst worden, wofür ich mich bedanken möchte. Der Aufsatz steht in Zusammenhang mit meinen Forschungen im Rahmen des Gesamtprojekt und des Projekts A3 der Forschergruppe "Konfligierende Regeln" an der Universiät Potsdam, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. * 1 Aber siehe etwa Elman et al. (1996) für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Nativismusdebatte. 2 Da ggf. Auslösereize für die Entwicklung von Gehirnstrukturen erforderlich sein mögen, impliziert diese Aussage eine -hier vernachlässigbare- Vereinfachung. 3 Für den Nachweis eines solchen Zusammenhangs müsste man zeigen können, dass die Konstruktion von Sprache mit ganz bestimmten grammatischen Prinzipien (und nicht der Besitz von Sprache schlechthin) evolutive Vorteile mit sich bringt. Solch ein Unterfangen würde wohl unweigerlich in das Reich unbegrenzter Spekulation führen. 4 Das minimalistische Programm Chomskys beschränkt sich auf die Analyse derjenigen syntaktischen Gegebenheiten, die sich mit Vorstellungen wie der Einfachheit einer grammatischen Ableitung oder der Wohlgeformtheit konzeptueller Repräsentationen erklären lassen. Es ist nicht zu erwarten, dass alle syntaktischen Phänomene sich auf diese Weise erfassen lassen. Bemerkenswerterweise werden dementsprechend auch viele Themen der Diskussion zu Zeiten der Rektions- und Bindungstheorie (Inseleigenschaften von syntaktischen Konstituenten z.B.) heute eher vernachlässigt. 5 Die Reifikationsproblematik gilt natürlich auch und vor allem für die Rektions- und Bindungstheorie selbst. Dass die optimale Formulierung syntaktischer Universalien irreduzibel syntaktisch ist, ist als solches kein hinreichender Grund, diese Eigenschaft auch dem zugrundeliegenden biologischen System zuzuschreiben, wie etwa Fanselow (1991) betont. 6 In einem Vortrag an der Universität Potsdam, Herbst 1998. 7 Daneben existieren noch Sprachen, in denen Fragewörter auch selbst dann allein an die Spitze von Teilsätzen gestellt werden können, wenn ihr semantischer Bereich mehr als diesen Teilsatz umfasst (das gilt z.B. in Malaysprachen). Weiter können sich Sprachen dahingegen unterscheiden, ob alle Fragewörter an die Satzspitze gestellt werden müssen (Bulgarisch) oder nur eines (Deutsch). Diese weiteren Unterscheidungen sind für unsere Diskussion aber nicht relevant. 8 Ob daneben noch Bewegungsprozesse existieren, die Phrasen aus anderen Gründen (z.B. phonetische Schwere, Parsebarkeit) nach rechts versetzen ("Extraposition"), ist in der syntaktischen Diskussion derzeit umstritten. 9 Hier steht V für Verb, S für Subjekt, und O für Objekt. 10 Ich verdanke diese Einsicht Hubert Haider.