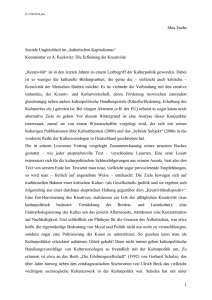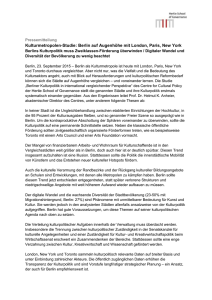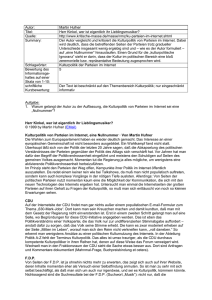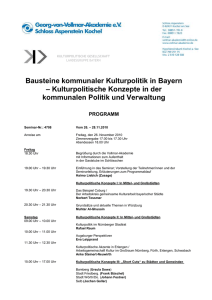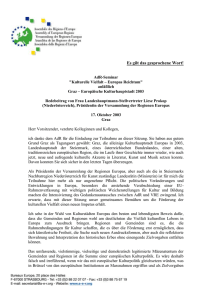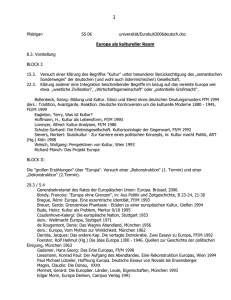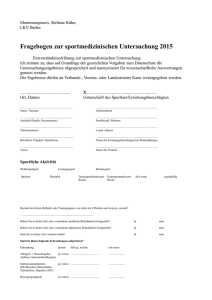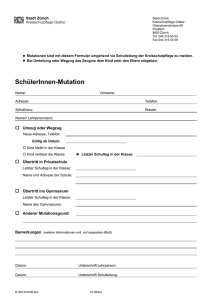Vom Auseinanderdriften der europäischen Gesellschaften
Werbung

Tagung : Zwischen Leitkultur und Laissez-faire: Der Beitrag der Kulturpolitik zur Demokratie angesichts weltweiter Migration St. Villigst 4 - 6 März 2016 Vom Auseinanderdriften der europäischen Gesellschaften und den kulturpolitischen Konsequenzen Michael Wimmer/April 2016 Die schieren Zahlen können keine deutlichere Sprache sprechen. Im Februar 2016 gab die globale Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam bekannt, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weiter gewachsen ist: 2015 hätten weltweit nur 62 Menschen über ebenso viel Vermögen verfügt wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – also 3,5 Milliarden Menschen. Ein Jahr zuvor sei das Verhältnis noch bei 80 zu 3,5 Milliarden gelegen.1 Die Tendenz des sozialen Auseinanderdriftens zeigt offensichtlich auch in Deutschland ihre Wirkung, wenn der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher zum Schluss kommt, dass sich Deutschland zu einem der ungleichsten Länder in der industrialisierten Welt entwickelt habe.2 Im globalen Zusammenhang zitierte der deutsche Kabarettist Georg Schramm bereits 2014 den USamerikanischen Großinvestor Warren Buffett,3 der in einem Interview mit der New York Times gefragt worden sei, was er für den zentralen Konflikt seiner Zeit halte. Buffett habe darauf geantwortet, es sei der Krieg zwischen Reich und Arm; seine Klasse, die Klasse der Reichen habe diesen Krieg begonnen und würde diesen auch gewinnen. Die ungleiche Geldmittelverteilung ist aber nur ein Aspekt sozialer Ungleichheit. Ein anderer ist der ungleiche Zugang zum Arbeitsmarkt. So hatte die europäische Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten Jahre verheerende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Negativ betroffen sind vor allem die südlichen Länder, wenn die Jugendarbeitslosigkeit 2015 in Spanien bei 53,5 %, in Griechenland bei 49,8 % und in Italien bei 43,9 % lag. Auch in Frankreich zählte mit 25,4 % ein ganzes Viertel der jungen Menschen dazu.4 Vom wachsenden Auseinanderdriften der Gesellschaft Dazu kommen eklatant unterschiedliche Bildungschancen. Erst in diesen Tagen wurde für Österreich bekannt gegeben, dass rund 40% der AbgängerInnen von Volksschulen nicht sinnerfassend lesen können5 und SchulleiterInnen davon ausgehen, dass rund einem Drittel ihrer AbsolventInnen auf Grund mangelnder Kompetenzen der Zugang zum Arbeitsmarkt dauerhaft versperrt bleiben werde; ihre lebenslange Perspektivlosigkeit scheint vorgezeichnet zu sein. 1 Siehe dazu: http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/soziale-ungleichheit-reichtum-welt-oxfam (letzter Zugriff: 26.04.2016) 2 http://www.sueddeutsche.de/politik/wirtschaft-selektive-wahrnehmung-1.2932294 (letzter Zugriff: 26.04.2016) 3 Georg Schramm über den Krieg zwischen Reich und Arm https://www.youtube.com/watch?v=-ZwsmVthQUs (letzter Zugriff: 26.04.2016) 4 http://www.zeit.de/2015/20/jugendarbeitslosigkeit-europa-ausbildung-finanzkrise (letzter Zugriff: 26.04.2016) 5 http://derstandard.at/2000033966724/Leseschwaeche-bei-Viertklaesslern-beunruhigt-Ministerin-kaum (letzter Zugriff: 26.04.2016) Ich stelle diese Indizien wachsender sozialer Ungleichheit an den Beginn meiner Überlegungen, um mein Erkenntnisinteresse zu präzisieren, das vorrangig in der Beantwortung der Frage besteht, ob und wenn ja in welcher Weise soziale Desintegration kulturpolitische Entscheidungsfindung beeinflusst bzw. beeinflussen sollte. Die Antwort versteht sich nicht von selbst: Wir sind alle durch eine mittlerweile mehr als 40 Jahre währende Schule einer „Kultur für alle“6 gegangen und werden jetzt zunehmend unsanft auf den Umstand gestoßen, dass es diese möglicher Weise gar nicht „für alle“ gibt. Stattdessen sind zunehmend viele, unvermittelt nebeneinander stehende Individuen und Gruppen gefordert, ihren Platz in einer ungleich verfassten Gesellschaft zu finden. Konnte der legendäre Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann noch von normativen Vorstellungen ausgehen, Kultur ließe sich zur Überwindung sozialer Differenzen nutzen, so erzählen die aktuellen Entwicklungen von einem wachsenden Auseinanderbrechen des sozialen Zusammenhalts. Gesellschaft scheint heute in viele, in ihren Eigenarten schnell variierende und kaum mehr klar fassbare Gruppen aufgespalten zu sein. Sie haben jeweils ganz unterschiedliche kulturelle Vorlieben, die unter keinen gemeinsamen Nenner mehr zu bringen sind.7 Diesen Entwicklungen entsprechen auch international akkordierte Dokumente wie die „Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt“8, die vor allem angesichts des Vormarsches einer globalen und jedwede kulturelle Unterschiede nivellierenden Kulturindustrie als Instrumente zur Stärkung des lokalen oder regionalen kulturellen Eigensinns gedacht waren und doch überkommene Vorstellungen von Kultur auf der Grundlage einer integrativen Kulturpolitik radikal in Frage stellen. Lernen aus der Geschichte Um dies besser zu begründen, möchte ich die LeserInnen zu einem kurzen historischen Rückblick einladen. Es spricht vieles für die Annahme, dass der Beginn dessen, was wir heute als Kulturbetrieblichkeit bezeichnen, an eine privilegierte soziale Klasse gebunden war, die sich die Beschäftigung mit Kultur zu leisten vermochte. Selbst befreit von den Mühen der Erwerbsarbeit verfügte sie über die dafür notwendigen Ressourcen, Zeit und Muße, ihr Leben zu verfeinern und – um ein uns verloren gegangenes Wort zu verwenden – zu veredeln. Ein zunehmend an die politische Macht drängendes Bürgertum versuchte, einen Gutteil dieser Lebensqualitäten in das eigene Selbstverständnis zu integrieren, auch wenn sie die damit verbundenen (kulturellen) Aktivitäten in dem Maße in den Bereich der Freizeit verschieben musste, wie es auf Erwerbsarbeit angewiesen war. Eine besondere Qualität kultureller Aktivitäten bestand in der Darstellung eines Distinktionsgewinns, der die Privilegierung des eigenen sozialen Status gegenüber allen anderen, als „kulturlos“ apostrophierten Teilen der Gesellschaft bestätigen sollte. In dieser Interpretation ist der Kampf des Proletariats zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts um Mitwirkung an der politischen Entscheidungsfindung auch als ein Kulturfindungsprozess zu verstehen, der der arbeitenden Bevölkerung ein eigenes, ihnen entsprechendes kulturelles Ausdrucksrepertoire im Gegensatz zum bourgeoisen Kulturbetrieb zusprechen wollte. Nach dem 6 Hoffmann, Hilmar (1981): Kultur für alle. Perspektiven und Modelle Frankfurt Davon berichten nicht nur KulturwissenschafterInnen, sondern auch BildungsexpertInnen, die vor allem im städtischen Kontext auf eine weitgehende Aufsplitterung der Schulstandorte je nach sozialer Zugehörigkeit des jeweiligen Einzugsgebietes hinweisen. Dies würde wiederum zu einer Verschärfung sozialer Trennungen und damit verbundenen Brüchen im kulturellen Verhalten führen. 88 http://www.unesco.at/kultur/basisdokumente/deklaration_kulturelle_vielfalt.pdf (letzter Zugriff: 26.04.2016) 7 Zweiten Weltkrieg wurde – jedenfalls in der österreichischen kulturpolitischen Schwerpunktsetzung – dieser Anspruch auf kulturellen Eigensinn der arbeitenden Bevölkerung zunehmend aufgegeben. Stattdessen war Kulturpolitik von der Hoffnung getragen, die Klasse der Lohnabhängigen würde in ein – weitgehend bürgerlich geprägtes – Mittelstandsmilieu aufgehen, um bei der Gelegenheit auch gleich deren kulturelle Vorlieben zu übernehmen. Dieses Motiv mag auch noch Hilmar Hoffmann angetrieben haben, der – als Insider des bourgeoisen Kulturbetriebs – in seinen kulturpolitischen Überlegungen von der Hoffnung geprägt war, früher oder später würden sich alle Menschen an der Wertschätzung des bürgerlichen Kulturbetriebs beteiligen und dafür als Mitglieder eines neuen Mittelstandes nobilitiert werden. Der Traum zur Vermittelständigung blieb unerfüllt Es sollte anders kommen. Zum einen fühlten sich Frauen strukturell unterrepräsentiert und mahnten im Zuge feministischer Bewegungen einen gleichberechtigten Zugang ein.9 Zum anderen gab es spätestens seit den 1970er Jahren alldiejenigen, die sich mit der Hegemonie eines bourgeoisen Kulturbetriebs nicht zufrieden geben wollten und stattdessen alternative kulturelle Ausdrucksformen forderten, die den jeweiligen sozialen Status besser repräsentieren würden. In Zeiten der wirtschaftlichen Prosperität der Nachkriegszeit folgte staatliche Kulturpolitik diesen Ansprüchen durch eine beträchtliche Ausdifferenzierung der Förderpraxis bei fortgesetzter Priorisierung einer traditionell gewachsenen kulturellen Infrastruktur, deren Existenz sich dem Repräsentationsbedürfnis einer vordemokratisch legitimierten Elite verdankt. Auch wenn heute Schlachtrufe aus 1968 wie jener von Pierre Boulez „Schlachtet die heiligen Kühe!“ zur Zerstörung des bourgeoisen Kulturbetriebs anachronistisch anmuten, so läuteten sie doch eine Phase der kulturpolitischen Auseinandersetzung ein, die darauf abzielte, in demokratisch verfassten Gesellschaften das Verhältnis von sozialer Stellung und kulturellem Verhalten neu zu bestimmen. In dem Maße, in dem die anhaltende wirtschaftliche Prosperität eine tendenzielle Vergrößerung des Mittelstandes als Träger des Kulturbetriebs (samt Ausweitung des staatlichen Kulturbudgets) versprach, meinte Kulturpolitik, sich in ihrer Förderpraxis über den Umstand unterschiedlicher sozialer Voraussetzungen weitgehend hinwegsetzen zu können. Ihr Hauptbemühen bestand in der Aufrechterhaltung einer Kulturbetrieblichkeit, dessen Angebot – aus welchen Motiven immer – von möglichst vielen Menschen ungeachtet ihres sozialen Status wahrgenommen werden sollte. Als die eigentliche Gewinnerin dieser kulturpolitischen Zurückhaltung sollte sich eine kommerziell ausgerichtete Kulturindustrie erweisen. Zum Unterschied zur staatlichen Kulturpolitik, die die längste Zeit in einer strikten Angebotslogik verharrte, verwandten private Kulturunternehmen viel Mühe darauf, die kulturellen Vorlieben ihrer Klientel zu analysieren und in verkaufbare Produkte zu fassen. Damit erwies sich die Kulturwirtschaft als wesentlich erfolgreicher im Bemühen um die Emanzipation des kulturellen Verhaltens breiter Bevölkerungsschichten als ihr politisches Gegenüber. Im Vergleich dazu folgte staatliche Kulturpolitik erst spät und halbherzig mit der Ermutigung öffentlich geförderter 9 Ein diesbezüglicher Anspruch scheint im Bereich der Konsumption heute weitgehend eingelöst: http://www.zeit.de/2007/42/Kulturverhalten (letzter Zugriff: 26.04.2016). Im Bereich der Produktion hingegen lassen sich bis heute strukturelle Ungleichgewichte zwischen Mann und Frau festmachen (siehe dazu z.B. die Studien des Deutschen Kulturrates zur Stellung von Frauen in Kunst und Kultur). Besonders eklatant wird diese Form der Ungleichheit im Bereich der kulturellen Bildung bzw. der Kulturvermittlung, allesamt Tätigkeiten, die mehrheitlich von Frauen ausgeführt werden. Mit diesem Genderbias geben sie eindrücklich über den (niedrigen) sozialen Status der erbrachten Leistungen Auskunft. Kultureinrichtungen, sich verstärkt um neue Zielgruppen zu bemühen und Programme nicht nur für ihre Stammklientel, sondern auch für sozial Benachteiligte zu entwickeln. Sie traf dabei ihre soziologisch weitgehend unbedarften RepräsentantInnen unvorbereitet.10 Es sind – jedenfalls meines Erachtens – zwei Entwicklungen, die es Kulturpolitik heute verunmöglichen, Vergangenheitsszenarien in gewohnter Weise fortzuschreiben. Da ist zum einen der sinkende Glaube daran, dass sich Gesellschaft noch einmal rund um einen ökonomisch erfolgreichen, dazu bildungs- und wohlstandsbasierten Mittelstand samt einem ihn als gemeinsames Anspruchsdenken repräsentierenden Kulturbetrieb organisieren ließe.11 Die oben angeführten Zahlen zur wachsenden ökonomischen Ungleichverteilung sprechen für sich. Man muss nicht den kulturpessimistischen Gedankengängen Hans Sedlmayers zum „Verlust der Mitte“12 aus dem Jahr 1948 folgen, um zu konstatieren, dass spätestens mit der seit 2008 anhaltenden europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise eine beträchtliche Verunsicherung des Mittelstandes eingesetzt hat.13 Dazu passen auch die Forschungsergebnisse des Eliteforschers Michael Hartmann, demzufolge die Wirtschaftselite Deutschlands drauf und dran ist, ihre traditionelle Affinität zum Kulturbetrieb aufzugeben und sich stattdessen anderen Formen der sozialen Distinktion zuzuwenden.14 Darüber hinaus haben die von der Krise Betroffenen schlicht andere Sorgen, wenn es darum geht, ihren privilegierten sozialen Status aufrecht zu erhalten. Der aktuelle Flüchtlingszuzug nicht ist nicht Ursache, sondern Verstärker sozialer Desintegration Zu konstatieren ist also eine – durch die aktuellen Zuwanderungswellen zusätzlich geförderte – Ausdifferenzierung der sozialen Milieus, die die europäischen Gesellschaften in ihren mittelständischen Grundfesten erschüttern. Mit ihnen zeigen sich vielfältige ethnische, religiöse und damit auch kulturelle Unterschiede, die ganz im Gegensatz zu den traditionell gewachsenen kulturpolitischen Prioritätensetzungen ganz neue kulturelle Tatsachen schaffen. Waren bisherige Formen des Zuzugs Ausgangspunkt einer vielfältigen kulturpolitischen Debatte um Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufrecht zu erhalten so zeigen sich mit dem Zuzug der aktuellen Flüchtlingsbewegungen vorrangig aus dem Nahen und Mittleren Osten die Grenzen einer solchen kulturpolitischen Strategie. Aus spezifisch österreichischer Sicht stellte die Zuwanderung von jeweils mehreren Hunderttausend Menschen aus Ungarn (1056), aus der Türkei und Jugoslawien (1970er Jahre), aus Polen (zu Beginn der 1980er Jahre) oder aus Bosnien (Mitte der 1990er Jahre) keine große gesellschaftliche und damit 10 Persönliche Gespräche des Autors mit österreichischen MuseumsdirektorInnen ließen eine weitgehende Unkenntnis der kulturpolitisch verordneten neuen Zielgruppen erkennen: „Wie soll ich sie denn erkennen?“ war eine der häufigsten Fragen, die in der Folge pragmatisch durch Zuordnung von BesucherInnen-Gruppen je nach geographischer Herkunft (Stadtzentrum oder Peripherie) beantwortet wurde 11 Siehe dazu https://www.youtube.com/watch?v=kKgFgOcQTLs (letzter Zugriff: 26.04.2016): Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen Richard David Precht und Heinz Bude mit dem Titel „Unsere ungerechte Gesellschaft“ im April 2016. Darin spricht Bude von einem gesellschaftlichen Experiment, das auf eine Zerstörung der traditionellen Mittelschichten hinauslaufen würde. Auf diese Weise würde eine kleine Gruppe von „Erfolgreichen“ eine Vielzahl von Verlierern gegenüberstehen, die kraft ihrer Leistung nicht mehr in der Lage wären, ihre sozialen Grenzen zu überschreiten in: 12 https://de.wikipedia.org/wiki/Verlust_der_Mitte (letzter Zugriff: 26.04.2016) 13 http://www.bpb.de/apuz/196707/gefuehlte-verunsicherung-in-der-mitte-der-gesellschaft?p=all (letzter Zugriff: 26.04.2016) 14 Hartmann, Michael (2012): Wodurch gehört man „dazu“? Beobachtungen zur Kultur der Deutschen Wirtschaftselite. In: Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel (2012): Kultur für alle oder Produktion der „feinen Unterschiede“ Wolfenbüttel auch kulturelle Herausforderungen dar. An den Ausläufern einer prosperierenden Nachkriegsgesellschaft gelang es – mit wenigen Ausnahmen – diese ZuwanderInnen mit ihrem unterschiedlichen sozialen, religiösen oder kulturellen Hintergrund in ein gemeinsames nationales kulturelles Selbstverständnis zu integrieren. Der aktuelle Zuzug von Flüchtlingen, vorrangig aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens trifft hingegen auf eine mittlerweile tief verunsicherte Aufnahmegesellschaft, in denen sich die Lebensverhältnisse in den letzten Jahren für eine wachsende Zahl von BürgerInnen nachhaltig verschlechtert haben. Als solche war nur ein kleiner Teil bereit, der ersten Euphorie einer von einer b reiten zivilgesellschaftlichen Bewegung getragenen Willkommenskultur zu folgen; stattdessen machten sich viele nur zu gerne rechtspopulistische Interpretationsversuche zu eigen, die darauf hinauslaufen, die Angst vor einer weiteren Verschärfung am Arbeitsmarkt bzw. vor einer weiteren Niederlage im Kampf um knappe Sozialleistungen zu schüren und diese in eine kulturelle Rhetorik zu kleiden. Ins Treffen geführt wird die Gefahr einer unkontrollierten Massenzuwanderung, der es gälte um den Preis der eigenen Abschottung Einhalt zu gebieten, aus Angst die autochthone Bevölkerung könnte um ihre kulturelle Identität gebracht werden.15 Die kollektive Zuschreibung des Fremden erspart die Arbeit am Eigenen Mit dem Wiedererstarken einer rechtspopulistischen Rhetorik zur Verteidigung des Anspruchs auf kulturelle Identität bleibt weitgehend ausgeklammert, dass es sich bei denjenigen, die zur Zeit in Europa Schutz vor existentiellen Bedrohungen suchen, um keine homogene Gruppe handelt, die deshalb auch nicht VertreterInnen einer anderen, fremden Kultur verhandelt werden können. Sie selbst kommen in ihrer großen Zahl aus ganz unterschiedlichen sozialen Kontexten und sind geprägt von kulturellen (Fremd-)Bestimmungen. Nicht zuletzt befinden sich unter ihnen eine Reihe von KünstlerInnen und Kulturschaffenden, die sich gegen eindeutige kulturelle Zuschreibungen wehren und sich mit ihren Qualifikationen stattdessen Zugang zum internationalen Kulturbetrieb erhoffen. Der politische Vorteil einer kollektiven Zuschreibung der Flüchtlinge als VertreterInnen einer „anderen Kultur“ liegt freilich darin, dass eine inhaltliche Präzisierung dessen, was als kulturelle Identität im eigenen Land noch einmal hochzustilisieren versucht wird, erst gar nicht mehr versucht werden muss; es genügt, sich negativ gegen das politische Konstrukt des Fremden abzugrenzen, um noch einmal ein kulturelles Wir-Gefühl zu erzeugen. Der Realität möglicher Weise näher kommt der Befund, dass der aktuelle Zuzug von Menschen nach Europa eine Entwicklung radikalisiert, die ihre primären Ursachen in den oben angedeuteten sozialen Veränderungen hat und bereits lange vor dem jüngsten Zuzug von Flüchtlingen gemeinsam verbindliche Kulturvorstellungen an ihr Ende haben kommen lassen. Dies betrifft vor allem kulturelle Selbstverständnisse, die auf ein statisches Set kultureller Ausdrucksformen setzen, das sich als ein verbindlicher Haltegriff in einer ansonsten sich dynamischen Gesellschaft bewähren soll. Zu Ende 15 Aus dem Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt 2016: „Deshalb wollen wir jenseits der heutigen Denkverbote die Stärkung und Pflege unserer regionalen und nationalen Identität sowie die Erziehung zu sozialer Verantwortung zur Aufgabe der Politik machen: an den Schulen, in den Kulturreinrichtungen, vor allem auf lokaler Ebene. Zur Bewahrung und Förderung unserer vielfältigen National- und Regionalkultur gehört auch, dass wir die ungezügelte Masseneinwanderung sofort stoppen und von den hier bereits ansässigen Einwanderern konsequent einfordern, dass sie unsere kulturellen Standards respektieren, die gesellschaftlichen Regeln befolgen und sich aktiv in unser historisch gewachsenes Gemeinwesen einfügen“. Siehe dazu: http://www.sachsen-anhalt-waehlt.de/wahlprogramme/afd.html (letzter Zugriff: 26.04.2016) gedacht deutet diese vielfältige kulturelle Dynamik auf ein Obsoletwerden traditioneller Kulturvorstellungen hinaus, die als selbst museal gewordene Begrifflichkeiten scheinbar immer weniger in der Lage sind, das, was gesellschaftlich der Fall ist, hinlänglich zu beschreiben oder gar zu beeinflussen. Im Gegensatz dazu erscheint es heute als eine zentrale kulturpolitische Aufgabe, das, was in perspektivischer Weise als Kultur verhandelt werden möchte, für gemeinsame Zukunftsentwicklungen mit Menschen sehr unterschiedlicher Lebenserfahrungen produktiv zu machen. Dies kann nicht nur in Bezug auf Traditionen, Sprache oder Religion passieren, sondern gilt auch für ihre Fluchterfahrungen, in die wir uns als Kinder eines 70 Jahre währenden Friedens nicht einmal andeutungsweise hinein zu denken vermögen, noch einmal produktiv zu machen. Eine bessere Unterscheidung zwischen Zivilisation und Kultur ist notwendig Zu diesen Überlegungen gehört auch eine überfällige Ausdifferenzierung dessen, was wir unter Kultur und was wir unter Zivilisation meinen. Nicht unzufällig wurde Samuel Huntingtons Klassiker Clash of Civilizations16 unter dem Titel Kampf der Kulturen17 ins Deutsche übersetzt, um so zu einer beträchtlichen Begriffsverwirrung beizutragen, die gerade angesichts des aktuellen Flüchtlingszuzugs für zusätzliche Verwirrung sorgt. Die aus der Spätphase vordemokratischer Herrschaftsformen stammende, typisch mitteleuropäische Vorstellung, in der Kultur wären die zivilisatorischen Errungenschaften wie die unantastbare Würde des Menschen und somit der Menschenrechte, darüber hinaus der Trennung von Kirche und Staat oder der Gleichwertigkeit von Mann und Frau besser aufgeboben als in der Politik, führt bis heute zu einer Überhöhung kultureller Ansprüche, die freilich kulturpolitisch immer weniger glaubhaft eingelöst werden kann. Eine Erkenntnis daraus könnte darin bestehen, zivilisatorische Errungenschaften gerade nicht auf wie immer geartete kulturelle Besonderheiten zu beziehen. In ihrem Anspruch auf globale Durchsetzung liegt ihre besondere Qualität gerade darin, dass sie vor keinen nationalen oder sonstigen Grenzen Halt machen und so ihre Durchsetzung nicht von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen oder anders definierten Gruppe abhängig gemacht werden kann. Als Ausdruck universeller, unteilbarer Werte sind sie prinzipiell allen Mitgliedern einer Gesellschaft aufzuerlegen, ganz egal ob sich diese als autochthon oder neu zugewandert erweisen. In einem solchen Selbstverständnis wäre Kultur nicht synonym zu verwenden, sondern mit kategorial anderen, zum Teil entgegengesetzten Qualitäten ausgestattet, geht es im kulturellen Kontext doch in erster Linie darum, mit vorrangig ästhetischen Mitteln symbolische Formen des Ein- bzw. des Ausschlusses und damit der Zugehörigkeit bzw. der Nichtzugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu inszenieren.18 16 Huntington, Samuel (1996): The Clash of Civilizations and the Remaking of World. Order New York Huntington, Samuel (1996): Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Europa München 18 In der immer wieder erneuerten Hoffnungsproduktion um eine „integrative Kultur“ wird gerne außer Acht gelassen, dass die Begriffsgeschichte zu „Kultur“ entscheidend geprägt ist vom Gegensatzpaar der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. Dies betrifft ethnische, klassen- oder genderspezifische Trennungsversuche, die sich allesamt um das Gegensatzpaar das „Eigene“ und das „Fremde“ ranken. „Dass diejenige fremde Kultur, deren Verstehen dem Menschen von Stund an am drängendsten erscheint, die eigene ist“, bleibt in dieser Diskussion gerne ausgeklammert. Siehe dazu u.a.: Srubar, Iljia u.a. (2005): Kulturen vergleichen Wiesbaden 17 Die wesentliche emanzipatorische kulturpolitische Leistung für eine auf Vielfalt basierende Gesellschaft bestünde darin, dass die BürgerInnen diese Formen der kulturellen Zuschreibung nicht in ihrer Natur begründet und damit schicksalhaft erleiden müssen (wie ihnen konservative VertreterInnen überkommener kultureller Identitätsvorstellungen glauben machen wollen), sondern mitentscheiden können, in welcher Form sie sich selbst kulturell verstehen und artikulieren wollen. Immer wieder neu: Gegen die Gleichsetzung von Kunst und Kultur Neben dem Klärungsbedarf im Spannungsverhältnis Zivilisation und Kultur tut sich noch eine weitere Begriffsverwirrung auf, die das aktuelle kulturpolitische Gerede gleichermaßen verunklart Es handelt sich dabei um die weithin unreflektierte Gleichsetzung von Kunst und Kultur19. Der Philosoph Rudolf Burger vermutete bereits 1983 in seinem Beitrag „Kultur ist keine Kunst“ 20, dass diese Form des wahllosen Gebrauchs grassierende Entideologisierungstendenzen einer politisch dekretierten alternativlosen spätkapitalistischen Gesellschaft repräsentieren würden. Damals meinte er, dass eine beliebige Vertauschung von Kunst und Kultur zur Produktion eines ideologischen Scheins führen würde, der darauf hinauslaufe, Gesellschaftstheorie durch kulturphilosophisches Geschwafel zu ersetzen: „Die Versöhnung von Kunst und Kultur ist die Ideologie einer Gesellschaft, die sich selbst in ihren Eigentums- und Machtverhältnissen kein Thema ist und die deshalb die Defizite der Sozialpolitik der Kulturpolitik zur symbolischen Verarbeitung überlässt“. Burger konnte bei seiner Inaugurationsrede als Rektor der Universität für Angewandte Kunst noch nichts von einer tendenziell mehrheitsfähigen Kulturideologie rechtspopulistischer Kräfte vor dem Hintergrund einer anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise gepaart mit bislang unvorstellbarer Brutalisierung an den europäischen Rändern wissen. Und doch verwies er schon damals auf die Fragwürdigkeit kulturpolitischer Maßnahmen zur Lösung sozialpolitischer Probleme (was Rechtspopulisten auf der Suche nach einer für alle verbindlichen kulturellen Identität weniger denn je davon abhält, die wachsende Benachteiligung der – oben angesprochenen – verunsicherten Mittelschichten in kulturelle Superioritätsansprüche umzudefinieren, ohne dass diese ein Theater, Konzert- oder Opernhaus betreten würden). Burger beklagte den mit der Ineinssetzung von Kunst und Kultur verbundenen Verlust eines kulturkritischen Potentials, das Kunst wie kein anderes Medium auszuzeichnen vermag. Darauf nimmt auch die Theaterregisseurin Shermin Langhoff in ihrem Beitrag für die Artikelreihe „Was ist deutsch?“ der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel „Was du in deinem Kopf und in deinem Herzen hast, kann dir keiner nehmen“21 Bezug, wenn sie für eine klare Trennung der Begrifflichkeiten von Kunst und Kultur plädiert. Sie schreibt der Kunst vorrangig einen desintegrativen und damit einen, den grassierenden vereinnahmenden bzw. gesellschaftliche Widersprüche harmonisierenden und Kulturvorstellungen entgegenwirkenden Charakter zu: „Kunst im Sinn von Kritik-Kultur war desintegrativ, in dem sie sich nicht vereinnahmen lassen wollte, sie schoss oft am Ziel vorbei, und das war gut so“. Geht es nach Langhoff, so droht heute der Kunst, die lange Zeit von Vorstellungen einer besseren – weil überkommende nationale Homogenitätsvorstellungen überwindende – Kultur getragen war, dass ihr als gefälliges Betriebsmittel des Markts der Wille zur Gegenwehr abhanden komme. Zu ihrer Wiederverlebendigung sei sie heute mehr denn je auf Einflüsse von außen angewiesen. Und dazu 19 Siehe dazu u.a.: http://educult.at/blog/blogartikel-2/ (letzter Zugriff: 26.04.2016) Burger, Rudolf (1996): Kultur ist keine Kunst. Inaugurationsrede Wien 21 http://www.sueddeutsche.de/kultur/serie-was-ist-deutsch-kultur-ist-kein-integrationskurs-1.2814539-2 (letzter Zugriff: 26.04.2016) 20 könnten ZuwanderInnen mit ihren ganz unterschiedlichen formalen ebenso wie inhaltlichen Bezügen in besonderer Weise beitragen (sofern man sie lässt). Nach ihrer Interpretation war es noch nie so wichtig, Kunst und Kultur hinlänglich voneinander zu unterscheiden. So sehr das, was im Mainstream unter „Kultur“ firmiert, heute von den ReNationalisten aller Länder erfolgreich für sich beansprucht wird, so wirkungsverdächtig erscheint es ihr, „Kunst“ noch einmal als kulturelles Desintegrationsmittel in Stellung zu bringen. Als solche kann sie den aktuellen Trend der Rekonstruktion hermetischer Kulturvorstellungen, die sich vorrangig gegen ZuwanderInnen richten, auf eine Weise stören, die eine differenzierte Auseinandersetzung um kulturelle Andersartigkeit überhaupt erst ermöglicht. Das wird dem vielfach diagnostizierten Trend der wachsenden Bedrohung zivilisatorischer Errungenschaften22 nicht Einhalt gebieten, vielleicht aber auf eine Weise kenntlich machen, dass dahinter weitere Alternativen diskutierbar werden, die über das Angebot der Rechtspopulisten hinausweisen. Die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, obliegt – entgegen allen euphorischen Selbstüberschätzungen – nicht dem Kunstinteressierten, sondern dem/der BürgerIn (citizen/citoyen), der/die bereit und fähig ist, seine/ihre Interessen gegen herrschende Widerstände nicht nur individuell, sondern auch politisch zu vertreten. Der Kunst- und Kulturbetrieb als Spiegel gesellschaftlicher Ungleichheit Die Analyse der jüngsten Wahlergebnisse auf der Suche nach einem neuen Bundespräsidenten in Österreich hat die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Cathrin Kahlweit zur Charakterisierung „Land ohne Mitte“23 finden lassen. Sie bestätigt darin einen internationalen Trend, der darauf hinausläuft, dass in den nationalen Gesellschaften die politische Vertretung von Mittelstandsinteressen vorerst an ihr Ende gekommen zu sein scheint und folglich zunehmend eine kleine Anzahl an reichen und privilegierten Menschen einer überwiegende Mehrheit an Armen und Benachteiligten unvermittelt gegenübersteht. In dem Maße, in dem das wachsende gesellschaftliche Auseinanderdriften als Ergebnis einer zentral gelenkten Globalisierungsstrategie interpretiert wird, vermehren sich Renationalisierungskräfte, die versprechen, die desintegrative Wirkungen eines freien Personen-, Güter- und Dienstleistungsaustausches noch einmal an den wieder zu errichtenden Grenzen aufhalten zu können. Verschärft werden diesbezügliche politische Ambitionen durch ein bislang unbekanntes Ausmaß an Mobilität, die sich im Fall des aktuellen Flüchtlingszuzugs allenfalls behindern, aber nicht verhindern lässt. Im Ergebnis werden die europäischen Gesellschaften auf eine dynamische Weise heterogener, ungleicher, zugleich vielfältiger und so auch kulturell immer weniger eindeutig fassbar. Die englische Kulturwissenschafterin Kate Oakley hat in ihren Untersuchungen zur Kunstproduktion und -rezeption herausgefunden, dass das Ausmaß der sozialen Ungleichheit seinen Niederschlag auch im Kunstbetrieb findet, da oder dort sogar weit über diesen hinausweist.24 Auch in diesem Sektor steht eine sehr kleine Anzahl an GroßverdienerInnen einer Mehrheit an KünstlerInnen und 22 In diesem Zusammenhang wird von autochthonen KulturpessimistInnen gerne mit pejorativen Begrifflichkeiten wie „Islamisierung Europas“ ins Treffen geführt, dass die geflüchteten ZuwanderInnen den europäischen Wertehaushalt gefährden würden. 23 Kahlweit, Cathrin: Land ohne Mitte. Analyse des Ausgangs der Bundespräsidentenwahl in Österreich. In: Süddeutsche Zeitung, 26.4. 2016 (http://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-in-oesterreich-land-ohne-mitte1.2965990?reduced=true; letzter Zugriff: 26.04.2016) 24 http://www.cusp.ac.uk/news/oakley-obrien-inequality-in-cultural-production/ (letzter Zugriff: 26.04.2016) Kulturschaffenden gegenüber, die unter prekären Bedingungen tätig sind. Die bereits seit den 1980er Jahren zu konstatierende Tendenz zur wachsenden Ökonomisierung und Eventisierung hat wesentlich zu dieser Form der sozialen Verungleichung beigetragen, ohne dass Kulturpolitik in der Lage gewesen wäre, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Alle diese Bestimmungsstücke verweisen auf eine grundsätzliche Infragestellung einer auf die traditionellen Mittelschichten bezogenen Kulturpolitik. Alle noch so gut gemeinten Maßnahmen zum Einbezug bislang vernachlässigter, in der Regel sozial benachteiligter Gruppen haben an der bestehenden sozialen Hierarchie der NutzerInnenschaft vor allem des Angebots des öffentlichen Kulturbetriebs nichts oder nur wenig zu verändern vermocht. Die Folge ist, dass Kulturpolitik im Rahmen des aktuellen sozialen Wandels ungebrochen auf eine im Verschwinden begriffene soziale Gruppe setzt, während alle anderen auf den wachsenden Markt kommerzieller Kulturgüter verwiesen werden. Kein Wunder also, dass der kulturpolitische Diskurs mittlerweile als erschöpft erscheint und bestenfalls in devianter Form als Kulturwirtschaftspolitik aufrechterhalten wird. Zur Änderung der inhaltlichen Ausrichtung des Kulturbegriffs Heute, immerhin hundert Jahre nach der Durchsetzung demokratischer Verfassungen scheint ein hegemoniales Kulturverständnis, das sich vorrangig auf eine privilegierte soziale Gruppe zu beziehen zu können vermeinte, an sein Ende gekommen zu sein. Seine heiligen Hallen scheinen weitgehend entzaubert. Es ist höchste Zeit für eine kulturpolitische Wiederbelebung entlang einer weitgehenden Neuinterpretation dessen, was künftig unter Kultur verstanden werden will – und was nicht. Für die wachsende rechtspopulistische Anhängerschaft scheint die Sache klar: Sie setzen mehr denn je auf den Popanz einer homogenen Kultur, von der zwar niemand sagen kann, was sie genau beinhaltet, die es aber um jeden Preis gegen jedwede fremde Einwirkungen zu verteidigen gilt. In ihrem totalisierenden Anspruch machen sie nochmals klar, dass Kultur immer schon als Kampfmittel zur Durchsetzung von Interessen ganz bestimmter sozialer Gruppen eingesetzt und offenbar bis heute als Waffe nicht stumpf geworden ist. (In ihrem erneuerten hegemonialen Anspruch, diesmal nicht in Bezug auf traditionelle Mittelstandsinteressen, sondern zur Anbiederung an die wachsende soziale Gruppe der KrisenverliererInnen wird deutlich, dass Vorstellungen einer allen Menschen gleichermaßen verfügbaren globalen Kultur ideologiekritisch gelesen werden müssen.) Als weit ambitionierter erweisen sich alle Versuche im Rahmen des Kampfes um die Aufrechterhaltung, einer liberalen Demokratie ein vordergründig interesseloses Neben- und Übereinander unterschiedlicher kultureller Ausdrucksformen, die alle für sich ein Existenzrecht beanspruchen ohne zur Deckung zu gelangen, zur Grundlage eines runderneuerten kulturpolitischen Konzeptes zu machen. Immerhin zeigt sich bei genauerem Hinsehen der Fortbestand oft nur unzureichend verschleierter Hierarchien im kulturellen Verhalten, die freilich nicht mehr entlang eindeutig identifizierbarer sozialer Gruppen oder Klassen, sondern weitgehend diffus, dazu temporär verlaufen und doch die Lebensverhältnisse der Menschen wesentlich mitbestimmen. Ähnlich wie im Bildungsbereich zeigen sich enorme Beharrungskräfte eines kulturbetrieblichen Institutionsgefüges, das sich mit aller Vehemenz der Antizipation der geänderten sozialen Verhältnisse verweigert. Darin ändern auch alle Bemühungen zur Implementierung neuer Bildungsund Vermittlungsinitiativen, in der Hoffnung, damit neue, bislang vernachlässigte Zielgruppen ansprechen zu können, nur sehr wenig.25 Dies zeigt sich paradigmatisch in der nachhaltigen Weigerung weiter Teile des Kulturbetriebs, die geänderten demographischen Veränderungen in die Weiterentwicklung der je eigenen strategischen Ausrichtung zu integrieren. Jüngste Forschungsprojekte wie „Brokering Migrants‘ Cultural Participation“26 haben deutlich gemacht, wie schwer sich die meisten Kunst- und Kultureinrichtungen nach wie vor im Umgang mit MigrantInnen tun und welche beträchtlichen institutionellen Stolpersteine dafür aus dem Weg geräumt werden müssen. Der aktuelle Zuzug von Flüchtlingen hat ebenso Einfluss auf die institutionellen Verhältnisse des Kulturbetriebs. Als ein bislang staatlich hoch privilegiertes Gefüge steht dieser vor der Entscheidung, im Zuge der aktuellen ökonomischen Liberalisierungstendenzen entweder verstärkt auf eine Refeudalisierung des Kulturkonsums zu setzen und damit auf eine Klientel, die es sich auf Grund ihres Erfolgs leisten kann, die immer teureren (und damit prestigeträchtigeren) Angebote wahrzunehmen, oder seine Gesamtstrategie (und nicht nur das Programmangebot im engeren Sinn) auf die geänderten sozialen Verhältnisse zu beziehen. Nur so kann es gelingen, die Relevanz seiner institutionellen Basis (und damit seine kulturpolitische Privilegierung) auch in Zukunft glaubhaft zu machen. EDUCULT hat in diesem Zusammenhang eine Recherche für die Deutsche Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Hinblick auf Maßnahmen zur kulturellen Integration von geflüchteten Menschen27 durchgeführt und war dabei mit einer Reihe von Rückmeldungen zu einer fundamentalen Neuausrichtung des Kulturbetriebs konfrontiert. Besonders wichtig erschien den meisten InterviewpartnerInnen die Notwendigkeit, der wachsenden Vielfalt künstlerisch-kultureller Ausdrucksformen auch kulturpolitisch Rechnung zu tragen. Dies könnte u.a. zu einem heftigen Umverteilungskampf führen, der bisherige pragmatisierte Subventionsempfänger in Frage stellt und stattdessen das Potential der Gegenwartskunst nutzt für die Ausgestaltung neuer, offener, ungesicherter, diskursiver und kreativer Räume nutzt, in denen auf ebenso spielerische wie ernsthafte Weise mit künstlerischen Mitteln BürgerInnen ungeachtet ihrer jeweiligen sozialen Herkunft gemeinsame Zukunftsentwürfe verhandeln können. Vieles spricht dafür, dass den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen aus ganz unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen zunehmend Bedeutung zukommen wird. Das gilt vor allem dort, wo eine Kulturpolitik von oben der wachsenden Komplexität der Kulturlandschaft immer weniger gewachsen und zu ihrer Ausgestaltung auf vielfältiges bürgerschaftliches Engagement angewiesen erscheint. Dies betrifft auch und gerade die bestmögliche Einbeziehung migranter Gruppen in die kulturpolitische Entscheidungsfindung. Diese aus diesen neuen Formen der Zusammenarbeit entstandenen Realisierungsformen könnten sich als reicher und vielfältiger erweisen als es uns gegenwärtig eine auf desintegrative Kulturpolitik 25 Es liegt in diesem Zusammenhang nahe, auf die klassisch gewordene bildungstheoretische Schrift Siegried Bernfelds „Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung“ hinzuweise. Bernstein zufolge würden sich die institutionellen Rahmenbedingungen von Schule im Versuch der Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit als wesentlich mächtiger erweisen als die inhaltlich-pädagogischen Versuche, diese zumindest zu relativieren. 26 http://educult.at/forschung/brokering-migrants-cultural-participation/ (letzter Zugriff: 26.04.2016) 27 Bei den Recherchen zur Erstellung eines von der BKM beauftragen Empfehlungskatalogs im Hinblick auf Maßnahmen zur kulturellen Integration von Flüchtlingen wurde deutlich, dass der traditionell gewachsene Kulturbetrieb für die gegenwärtigen Herausforderungen nur sehr unzureichend gerüstet ist und folglich beträchtlich an gesellschaftlicher Bedeutung verliert. Siehe dazu; EDUCULT (2016): Empfehlungen an die BKM im Hinblick auf Maßnahmen zur kulturellen Integration von geflüchteten Menschen. Wien, unveröffentlichter Bericht. zu suggerieren versucht, die auf von den kulturellen und jeweiligen sozialen Wirklichkeiten der Menschen abgehobene Bestandsinteressen fixiert bleibt. Der Rest ist Sozialpolitik.