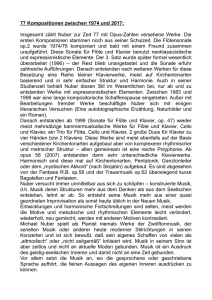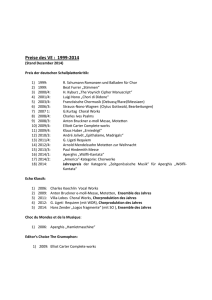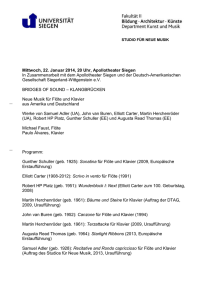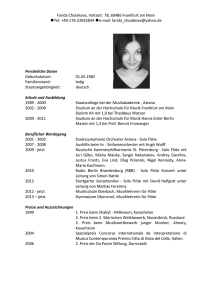93.157 Beiheft-Text als
Werbung
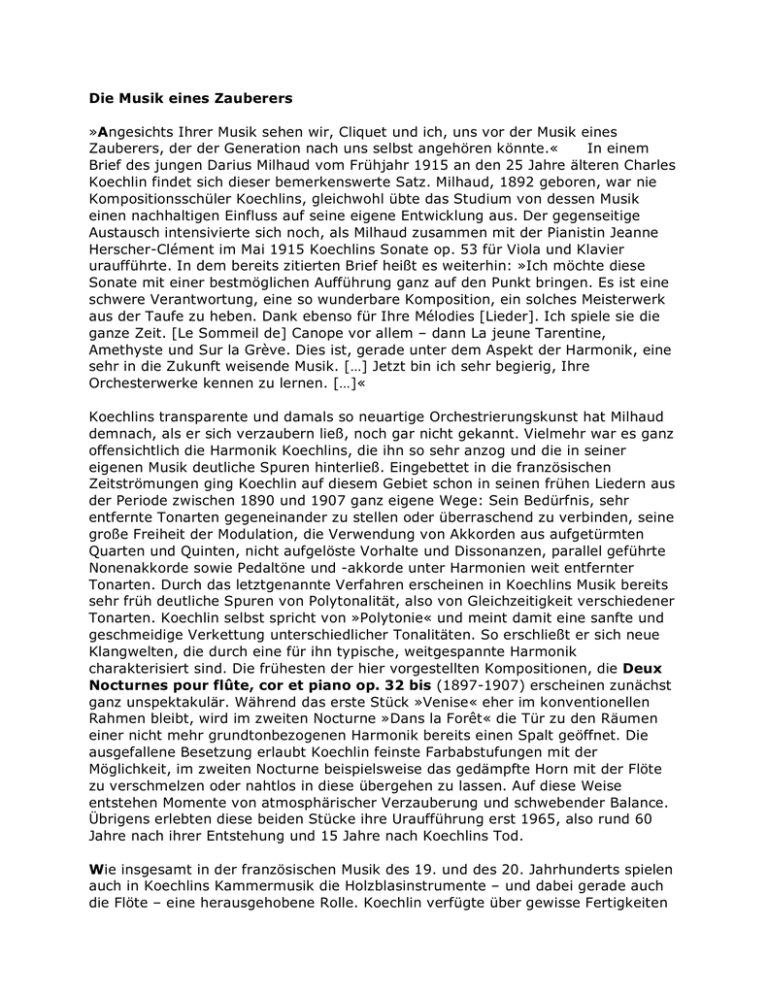
Die Musik eines Zauberers »Angesichts Ihrer Musik sehen wir, Cliquet und ich, uns vor der Musik eines Zauberers, der der Generation nach uns selbst angehören könnte.« In einem Brief des jungen Darius Milhaud vom Frühjahr 1915 an den 25 Jahre älteren Charles Koechlin findet sich dieser bemerkenswerte Satz. Milhaud, 1892 geboren, war nie Kompositionsschüler Koechlins, gleichwohl übte das Studium von dessen Musik einen nachhaltigen Einfluss auf seine eigene Entwicklung aus. Der gegenseitige Austausch intensivierte sich noch, als Milhaud zusammen mit der Pianistin Jeanne Herscher-Clément im Mai 1915 Koechlins Sonate op. 53 für Viola und Klavier uraufführte. In dem bereits zitierten Brief heißt es weiterhin: »Ich möchte diese Sonate mit einer bestmöglichen Aufführung ganz auf den Punkt bringen. Es ist eine schwere Verantwortung, eine so wunderbare Komposition, ein solches Meisterwerk aus der Taufe zu heben. Dank ebenso für Ihre Mélodies [Lieder]. Ich spiele sie die ganze Zeit. [Le Sommeil de] Canope vor allem – dann La jeune Tarentine, Amethyste und Sur la Grève. Dies ist, gerade unter dem Aspekt der Harmonik, eine sehr in die Zukunft weisende Musik. […] Jetzt bin ich sehr begierig, Ihre Orchesterwerke kennen zu lernen. […]« Koechlins transparente und damals so neuartige Orchestrierungskunst hat Milhaud demnach, als er sich verzaubern ließ, noch gar nicht gekannt. Vielmehr war es ganz offensichtlich die Harmonik Koechlins, die ihn so sehr anzog und die in seiner eigenen Musik deutliche Spuren hinterließ. Eingebettet in die französischen Zeitströmungen ging Koechlin auf diesem Gebiet schon in seinen frühen Liedern aus der Periode zwischen 1890 und 1907 ganz eigene Wege: Sein Bedürfnis, sehr entfernte Tonarten gegeneinander zu stellen oder überraschend zu verbinden, seine große Freiheit der Modulation, die Verwendung von Akkorden aus aufgetürmten Quarten und Quinten, nicht aufgelöste Vorhalte und Dissonanzen, parallel geführte Nonenakkorde sowie Pedaltöne und -akkorde unter Harmonien weit entfernter Tonarten. Durch das letztgenannte Verfahren erscheinen in Koechlins Musik bereits sehr früh deutliche Spuren von Polytonalität, also von Gleichzeitigkeit verschiedener Tonarten. Koechlin selbst spricht von »Polytonie« und meint damit eine sanfte und geschmeidige Verkettung unterschiedlicher Tonalitäten. So erschließt er sich neue Klangwelten, die durch eine für ihn typische, weitgespannte Harmonik charakterisiert sind. Die frühesten der hier vorgestellten Kompositionen, die Deux Nocturnes pour flûte, cor et piano op. 32 bis (1897-1907) erscheinen zunächst ganz unspektakulär. Während das erste Stück »Venise« eher im konventionellen Rahmen bleibt, wird im zweiten Nocturne »Dans la Forêt« die Tür zu den Räumen einer nicht mehr grundtonbezogenen Harmonik bereits einen Spalt geöffnet. Die ausgefallene Besetzung erlaubt Koechlin feinste Farbabstufungen mit der Möglichkeit, im zweiten Nocturne beispielsweise das gedämpfte Horn mit der Flöte zu verschmelzen oder nahtlos in diese übergehen zu lassen. Auf diese Weise entstehen Momente von atmosphärischer Verzauberung und schwebender Balance. Übrigens erlebten diese beiden Stücke ihre Uraufführung erst 1965, also rund 60 Jahre nach ihrer Entstehung und 15 Jahre nach Koechlins Tod. Wie insgesamt in der französischen Musik des 19. und des 20. Jahrhunderts spielen auch in Koechlins Kammermusik die Holzblasinstrumente – und dabei gerade auch die Flöte – eine herausgehobene Rolle. Koechlin verfügte über gewisse Fertigkeiten auf der Oboe, dem Horn und dem Klavier, dies jedoch unterhalb hoher professioneller Ansprüche. Hingegen besaß er schon ganz früh ein intuitives Einfühlungsvermögen in jede Art von Musikinstrument und eine traumwandlerische Sicherheit in der spezifischen Verwendung der Instrumente. Seine vierbändige Orchestrationslehre gilt als eine Art Bibel für die prägnante Instrumentationskunst des 20. Jahrhunderts. Auch zu der Zeit, als das kompositorische Lebenswerk noch weitgehend unentdeckt war, erfreute sich sein »Traité de l’orchestration« bereits einer großen Verbreitung. Zur Charakteristik der Querflöte schreibt Koechlin in dem 1948 veröffentlichten Bändchen »Les Instruments à vent«: »Die Flöte lässt uns Melodien voller Anmut hören oder auch dramatische Phrasen, die durch zurückhaltende Kühle und plötzliche Ausbrüche des Timbres noch eindrucksvoller werden; sie lebt sich aus in funkelnder Pracht oder in verzauberten Arpeggien voller Ausgelassenheit.« Ganz in diesem Sinne setzt Koechlin die Flöte in der Sonate pour deux flûtes op. 75 (1918-20) und im dreisätzigen Divertissement pour deux flûtes et clarinette op. 91 (1923-24) ein. Durch die Verwendung von Quartenfolgen als Baustein der Melodik werden im Finalsatz der Sonate op. 75 und im zweiten und dritten Satz des Divertissement die Grenzen von Tonalität immer wieder überschritten. Um 1911, mit dem Beginn der Komposition seines ersten Streichquartetts op. 51 und der Sonate für Flöte und Klavier op. 52, beginnt eine intensive Schaffensperiode, in der Koechlin über die Kammermusik die Fähigkeit zur ausgedehnten Form für sich entwickelt. Koechlin selbst spricht von »technique du développement «, seiner Technik der musikalischen Fortspinnung. Bis 1921 komponierte er insgesamt sieben Sonaten für Klavier und je ein Streichoder Blasinstrument, drei Streichquartette, ein Klavierquintett sowie, neben einigen Vokalwerken, mehrere Klavierzyklen und anderes mehr. Neben der bereits erwähnten Sonate für Viola und Klavier entstand auch die dreisätzige Suite en quatuor op. 55 (1911-15) in dieser Periode. Zunächst als Sonate für Flöte und Klavier entworfen, erkannte der Komponist schon sehr bald die Notwendigkeit, diese Besetzung durch Violine und Viola zu erweitern. In einem Kommentar schreibt Koechlin zu seiner Quartettsuite: »Es ist vor allem der dritte Satz, der durch seine Rhythmik eine tänzerische Atmosphäre beschwört. Aber man könnte auch für die ruhigere Musik des ersten und zweiten Satzes langsame Tänze finden; geschmeidige Bewegung ist angesagt, nicht ›klassischer‹ Tanz, – nichts von Gavotte oder Menuett oder so ähnlich. Vielmehr denke ich dabei an bestimmte Schulen rhythmischer Gymnastik oder an Isadora Duncan oder an die ›Ballets Russes‹.« In einer schwebenden und frei modulierenden Harmonik fließt der erste Satz der Suite, kein Grundtonanker hemmt seine ruhige und stetige Bewegung. Erst im allerletzten Takt findet die Musik in einem tiefen ›E‹ mit leerer Obertonquinte zu ihrem Ziel. Der zweite Satz verwendet ein schon im ersten Satz beiläufig aufgetauchtes Motiv aus einem absteigenden Tonleitersegment als Ostinato-Thema. Dieses gleichbleibende Thema, von den vier Instrumenten im Wechsel vorgetragen, unterliegt dabei permanenter Umfärbung, so wie wenn es jedes Mal aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet würde. Gleichzeitig wird es im Verlauf des Satzes harmonisch immer wieder neu ausgedeutet, aber auch verkürzt und vergrößert. Dieser kurze Satz zeigt, wie Koechlin aus einem simplen Grundbaustein eine extrem differenzierte Vielfalt zu zaubern versteht, ein einfaches Stück Musik und doch ein kleines Wunder. Der letzte Satz der Suite ein schneller Tanz? Man möchte sich eher ein vielleicht fünfbeiniges Tanzwesen vorstellen, das durch die dauernde Verschiebung der Betonungen nicht aus dem Tritt geraten kann. Das Stück mit seiner scheinbar einfachen, volksliedartigen Melodik zieht aus dieser rhythmischen Irritation seinen besonderen Reiz. Die in der Zeit bis 1921 gewonnenen Erfahrungen hatten Koechlin die kompositionstechnische Sicherheit gegeben, die es ihm ermöglichte, seine Vorstellungen auch in großdimensionierten Stücken zu verwirklichen. Seit der ersten Lektüre von Rudyard Kiplings zweibändigem Werk »The Jungle Book« zur Jahreswende 1898/99 hatte er davon geträumt, verschiedene Episoden des Dschungelbuch-Romans musikalisch umzusetzen. Zurückgreifend auf frühe Entwürfe, sah er sich erst jetzt in der Lage, die alten Träume zu verwirklichen. Die Komposition der symphonischen Dichtung »La Course de printemps« op. 95 nach Kipling beschäftigte Koechlin von 1923 bis 1927. Ab diesem Zeitpunkt unterscheidet er deutlich zwischen orchestraler und kammermusikalischer Konzeption. Von jetzt an – und ganz im Gegensatz zu den orchestralen Werken, deren Ausformung sich immer über Jahre hinzieht – scheint die Kammermusik nun wie zur Erholung und quasi mit leichter Hand komponiert. Als Beispiel dafür steht das Trio pour flûte, clarinette et basson op. 92 vom Oktober 1924. Inventionsartig entwickelt sich die abgeklärte und ausgewogene Dreistimmigkeit der beiden ersten Sätze. Das Gegenstück zu diesen beiden eher introvertierten Sätzen bildet das Finale. Ein Fugato- Thema, dessen Länge und Simplizität zunächst überrascht, wird dann im virtuosen Vexierspiel der drei Instrumente abwechslungsreich kombiniert und verflochten, eine Virtuosität mit ironischem Augenzwinkern. Im Juni des Jahres 1933 sah Charles Koechlin zum ersten Mal den Film »Der blaue Engel« mit Marlene Dietrich und Emil Jannings in den Hauptrollen. Nun war der »Magicien« selbst wie verzaubert und wurde zum leidenschaftlichen Kinogänger. Die Filmmusik, die er als zu oberflächlich, oft nichtssagend, banal oder vulgär kritisierte, konnte ihn allerdings, von Ausnahmen abgesehen, nicht zufrieden stellen. Sie sei im Film das schwächste Glied und spiele die Rolle der verarmten, missachteten Tante. Inspiriert durch Filme der frühen 1930er Jahre mit ihren Stars Greta Garbo, Lilian Harvey, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin sowie Fred Astaire und Ginger Rogers entstand eine Vielzahl von Werken unterschiedlichster Art: Kompositionen, nicht als Filmmusik zu einem bestimmten Film geschrieben, sondern durch Filmerlebnisse ausgelöst. Diese feurige Leidenschaft verflog allerdings im Laufe des Jahres 1939, nicht zuletzt unter dem Eindruck der bedrohlichen weltpolitischen Lage. Der frühe Tod von Jean Harlow im Frühsommer 1937 – sie starb 26jährig während der Dreharbeiten zu »Saratoga« – war für Koechlin der Anlass, der Schauspielerin die bereits im Februar 1937 skizzierte Romanze für Flöte, Altsaxophon und Klavier als Épitaphe de Jean Harlow op. 164 zu widmen. Wie schon in den beiden Nocturnes erlaubt auch hier die Besetzung ein phantasievolles Klangfarbenspiel. Ähnlich wie Alban Berg liebte Koechlin die sinnliche Geschmeidigkeit des Saxophons und hat auch in seinen Orchesterwerken die Saxophonfamilie vielfach eingesetzt. In einem Kommentar zum Épitaphe schreibt er: »Die erste Idee zu diesem kleinen Stück war nicht für Jean Harlow (die im Februar 1937 noch lebte) bestimmt, aber dann fand ich, dass diese melodische Linie sie so gut abbildete, und ich zögerte nicht, ihr das als Epitaph zu dedizieren. Der Klang des Saxophons soll hier die ganze süße Leichtigkeit des Stars in seiner kalifornischen Umgebung vermitteln.« Eine Anmerkung im Notentext der Komposition verweist auf eine Doppelzeile des Gedichts »Épiphanie« von Leconte de Lisle, das Koechlin um 1900 für Sopran und Klavier bzw. Orchester vertont hatte: « Quand un souffle furtif glisse en ses cheveux blonds, Une cendre ineffable inonde son épaule » [Wenn ein flüchtiger Hauch ihr goldenes Haar streift, legt sich unsagbare Asche auf ihre Schulter] Tatsächlich begegnet uns an dieser Stelle des Epitaphs ein notengetreues Selbstzitat aus Koechlins 37 Jahre früher entstandener Mélodie »Épiphanie«. Als Koechlin nach der durch den Ausbruch des 2. Weltkriegs bedingten Pause gegen Ende des Jahres 1941 seine Komponiertätigkeit wieder aufnehmen konnte, standen die Orchesterwerke »Offrande musicale sur le nom de BACH« op. 187, »Le Buisson ardent« op. 203/171, die 2. Symphonie op. 196 und die große symphonische Dichtung »Le Docteur Fabricius« op. 202 im Zentrum seiner Arbeit. Die ungebundene Einstimmigkeit und die modale Polyphonie gewinnen im Spätwerk Koechlins eine zunehmende Bedeutung. Bereits während der Zeit der sprühenden Filmkompositionen hatte sich diese ganz anders orientierte Entwicklung mit Stücken wie der fünfsätzigen Sonatine modale pour flûte et clarinette op. 155a (193637) angekündigt. Koechlin, dessen Reichtum im Erfinden subtiler harmonischer Verbindungen und filigraner Klänge unerschöpflich war, befriedigt nun mit der Beschränkung auf die weitgespannte melodische Linie sein Bedürfnis nach Gegensätzlichkeit. In einem Brief vom 2. August 1945 schrieb er an Darius Milhaud: »Mehr und mehr fühle ich mich von modaler Musik angezogen. Ich habe eine große Anzahl von Stücken (drei Reihen von je 32 Stücken) für Flöte solo komponiert, die in eine überwiegend modale Atmosphäre eingebettet sind. So ganz allgemein möchte man kaum glauben, welch lebendige und abwechslungsreiche Schönheit man mit modalen Monodien erreichen kann.« Gelegenheitskomposition und gleichzeitig ein kleines Juwel ganz eigener Art ist die Pièce de flûte pour lecture à vue op. 218. Als Prüfungsstück im Fach »Vom-Blatt-Spiel« am 30. Mai 1948 für das Pariser Conservatoire komponiert, bezaubert diese Komposition von nur zwei Minuten durch ihre in dichte Harmonik eingebettete Flötenmelodie und durch den ganz überraschenden Schluss: ein Aufschwung, ein »Ausbruch des Timbres« in dem Moment, als die bereits sanft zur Ruhe gekommene Musik eigentlich schon das Ende des Stücks angekündigt hatte. Ofried Nies