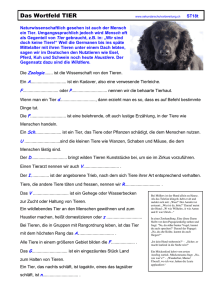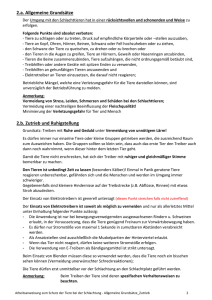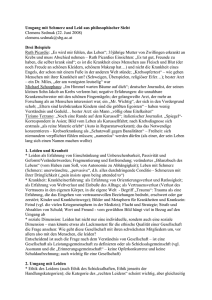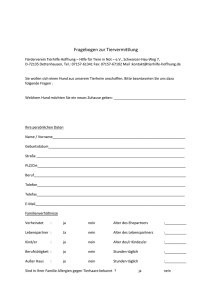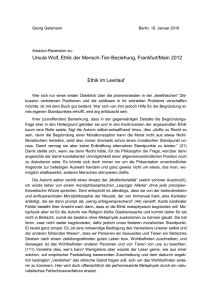Die menschliche Verantwortung für das tierische Leben in der
Werbung

Die menschliche Verantwortung für das tierische Leben in der Landwirtschaft – Landwirtschaftliche Erfordernisse und unsere Verantwortung für Tiere als Mitgeschöpfe - Moraltheologische Überlegungen Eberhard Schockenhoff∗ Übersicht Die menschliche Verantwortung für das tierische Leben in der Landwirtschaft – Landwirtschaftliche Erfordernisse und unsere Verantwortung für Tiere als Mitgeschöpfe ..................................................... 1 Die menschliche Verantwortung für das tierische Leben in der Landwirtschaft ................................. 1 I. Begriffliche Vorklärungen ................................................................................................................. 2 1. Was heißt Mitgeschöpflichkeit der Tiere?................................................................................... 2 2. Haben Tiere Rechte?.................................................................................................................. 3 II. Ethische Prinzipien der menschlichen Verantwortung für das Tier ................................................ 4 1. Rücksicht auf die Interessen der Tiere. ...................................................................................... 4 2. Die moralische Selbstachtung des Menschen............................................................................ 6 3. Die Empfindungsfähigkeit der Tiere............................................................................................ 7 III. Praktische Konfliktfelder der Tierethik ........................................................................................... 9 1. Nutztierhaltung............................................................................................................................ 9 Die menschliche Verantwortung für das tierische Leben in der Landwirtschaft Der Begriff der "Tierethik", der seit einigen Jahren im Mittelpunkt moralphilosophischer Debatten steht, ist auch für Fachleute eine Wortschöpfung jüngeren Datums. Die Tatsache, daß nur der Mensch Subjekt moralischer Verantwortung sein kann, verleitet das ethische Denken leicht zu dem Fehlschluß, er allein komme auch als ihr einziger Gegenstand in Betracht. Die mangelnde Unterscheidung zwischen dem Subjekt und dem Objekt der sittlichen Verantwortung liegt der selbstverständlichen Annahme einer langen Tradition europäischer Ethik zugrunde, wonach sittliches Handeln ein vernunftmäßiges Handeln meint, durch das der Mensch sich selbst und seinesgleichen als moralfähiges Wesen achtet, während die Tiere und erst recht die übrige nichtbewußte Natur aus der sittlichen Welt ausgeschlossen bleiben. Insofern diese stillschweigende Verbannung der Tiere aus der moralischen Gemeinschaft zur Folge hatte, daß diese auch als Gegenstand menschlicher Verantwortung kaum mehr wahrgenommen wurden, trifft für die gesamten europäischen Moralsysteme bis hinauf zu den modernen Vertragstheorien und diskursethischen Denkansätze zu, was Arthur Schopenhauer und Albert Schweitzer als erste beklagten: daß in der westlichen Ethik für die Tiere "so unverantwortlich schlecht gesorgt" sei, weil die ganze Mühe der europäischen Denker in der Vergangenheit der Sorge galt, daß "ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen". I. Begriffliche Vorklärungen Die Entdeckung der Tiere, die sich in der gegenwärtigen philosophischen Ethik ereignet, übernimmt von Schopenhauers Mitleidsmoral oder Schweitzers Ehrfurchtsethik häufig aber nicht nur das Motiv einer universalen Empathie mit allem Lebendigen, sondern zugleich ihre kritische Frontstellung gegen das Vernunftsprinzip und den Personengedanken. Diese historisch bedingte Skepsis gegenüber den beiden Grundpfeilern der tradinionellen Ethik ist mit dem sachlichen Anliegen der Tierethik jedoch nicht notwendig verbunden. Das Prinzip, auch im Verhältnis des Menschen zum Tier, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, und das Postulat "Gerechtigkeit für Tiere" lassen sich auch innerhalb einer (gemäßigt) anthropozentrischen Ethik einlösen. Bevor wir nach den Konsequenzen der neuen Tierethik für die Landwirtschaft fragen, bedarf es deshalb einer Verständigung darüber, wie weit die Grundbegriffe der klassischen Ethik auch aus dem MenschTier-Verhältnis Anwendung finden können. 1. Was heißt Mitgeschöpflichkeit der Tiere? Noch bevor die "Befreiung der Tiere" Anfang der siebziger Jahre Gegenstand philosophischer Debatten wurde und eine Phase intensiver Beschäftigung mit tierethischen Fragen begann, führte der reformierte Theologe Fritz Blanke in einem anfangs nur wenig beachteten Aufsatz das Stichwort der "Mitgeschöpflichkeit" in die theologische Ethik ein. Er griff damit eine ähnliche Formulierung des kantianischen Philosophen Wilhelm Wundt auf, der um die Jahrhundertwende das Wort "Mitgeschöpf" bereits in einem philosophischen Zusammenhang verwandte. Dieser in einem philosophischen Kontext ungewöhnliche Begriff, sollte Wundt dazu dienen, Kants radikale Dichotomie zwischen Personen und Sachen zu überwinden, nach der nur Vernunftwesen Personen und Zwecke an sich selbst, alle anderen Naturwesen dagegen Sachen und Mittel zu fremden Zwecken sind. Dadurch entging er dem durch die juristische Terminologie vorgezeichneten rechtsphilosophischen Dilemma, die Tiere nur deshalb als bloße Sachen betrachten müssen, weil sie als unvernünftige Wesen offensichtlich keine Personen sind. Der Begriff "Mitgeschöpf" vermeidet so zwar die verbale Anstößigkeit des harten Wortes "Sache"; er dient aber immer noch dazu, mehr die Differenz zwischen Tier und Mensch als die unter ihnen bestehende Ähnlichkeit zu betonen. Als Mitgeschöpfe werden die Tiere nämlich nicht um ihrer selbst willen, sondern nur als Teil der Gesamtschöpfung Gegenstand der moralischen Ordnung, während der Mensch das einzige Objekt unseres "wahren Mitgefühls" ist, das auf der Grundlage einer inneren Willenseinheit der vernünftigen Wesen entsteht. Eben diese unter den damaligen philosophischen Strömungen vom Neukantianismus bis zum dialogischen Personalismus unbestrittene Voraussetzung zog Fritz Blanke als protestantischer Theologe im Jahre 1959 erstmals in Zweifel; auf katholischer Seite folgte ihm bald darauf Josef Bernhart mit seinem Buch "Die unbeweinte Kreatur" (1961). Blanke verstand seine Ethik der Mitgeschöpflichkeit ausdrücklich als Gegenentwurf zu einer theologischen Ethik, die sich ausschließlich in den Bahnen der Ich-Du-Beziehung bewegt und forderte die Theologie dazu auf, die Pflichten, welche der Mensch als "Verwalter, Helfer und Fürsorger der Natur" gegenüber dem Tierreich hat, als "Erweiterung" des ethischen Grundgebotes der Mitmenschlichkeit anzusehen. Angestoßen durch die intensiven Bemühungen um eine philosophische Begründung der Tierethik und die Initiativen zu einer Novellierung der Tierschutzgesetze in zahlreichen europäischen Ländern hat die theologische Ethik den Begriff der "Mitgeschöpflichkeit" inzwischen mit Hilfe eines genaueren philosophischen Instrumentariums zu bestimmen versucht. Sie versteht ihn heute weithin in dem Sinn, daß auch Tiere und nichtmenschliche Wesen als Mitgefährten des Lebens zur moralischen Ordnung gehören und deshalb in einer Güterabwägung um ihrer selbst willen, d.h. unter Beachtung ihres geschöpflichen Eigenwertes, zu berücksichtigen sind. Weil sie überzweckhaft existieren und Träger eigener Sinnwerte sind, die zur Vielfalt des Lebens und zum Reichtum der Schöpfung gehören, darf sie der Mensch nur so für seine Ziele in Anspruch nehmen, daß er dabei auch ihren eigenen Zielen und ihrer Stellung innerhalb der biotischen Gemeinschaft gerecht wird. Strittig ist innerhalb der gegenwärtigen theologischen Ethik also nicht mehr die Beachtung der immanenten Theologie nichtmenschlicher Lebenwesen, sondern nur die Frage, ob dieses Postulat als Erweiterung einer (gemäßigten) anthropozentrischen Ethik einzulösen ist (A. Auer, F. Böckle, G. Mertens) oder den Übergang zu einer (gemäßigten) biozentrischen Ethik (G. Altner, F. Ricken, K. Hilpert) erfordert. 2. Haben Tiere Rechte? Die modernen Tierschutzgesetze dienen dem individuellen Wohl des einzelnen Tieres; das novellierte Tierschutzgesetz der BRD von 1986 formuliert in § 1 den Grundsatz, aus "der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen". Insofern das Tier um seiner selbst willen zu achten ist, lassen sich unsere moralischen Verpflichtungen ihm gegenüber noch weiter in einzelne gesetzlich garantierte Schutzansprüche aufgliedern. In diesem Sinn hat sich die Rede vom Recht der Tiere auf angemessene Ernährung und Pflege, auf verhaltensgerechte Unterbringung und einen artgemäßen Bewegungsraum eingebürgert. Vor allem ist es nach allgemein anerkannter Auffassung eine unmittelbare und direkte Pflicht des Menschen gegenüber dem einzelnen Tier, ihm keine schweren und unnötigen Schmerzen zuzufügen. Auch wenn das Postulat der Gegenseitigkeit, das für die Anerkennung zwischenmenschlicher Rechtsbeziehungen konstitutiv ist, durch die Asymmetrie des Mensch-Tier-Verhältnisses durchbrochen ist, kann man aus der Tatsache, daß wir Menschen Pflichten gegenüber Tieren haben, im Umkehrverschluß folgen, daß diese uns gegenüber eigene Rechte besitzen. Wir verwenden den Rechtsbegriff dann allerdings in einem abgeleiteten Sinn, der nicht mehr den moralischen Verantwortungsspielraum der Person und ihre Fähigkeit, selbst zu handeln, sondern den Anspruch schützt, etwas zu erhalten. Nach diesem erweiterten Rechtsbegriff wären nicht nur eigenverantwortliche Subjekte, sondern alle Wesen, die als Objekt zur moralischen Gemeinschaft gehören, eo ipso auch als Träger moralischer Rechte anzusehen. In einer sorgfältigen Abwägung des Für und Wider beider Positionen kommt Friedo Ricken allerdings zu dem Ergebnis, daß wir uns durch die Wendung "Tiere haben Rechte" unnötigerweise (da wir ihre moralischen Ansprüche an uns auch anders schützen können) der terminologischen Möglichkeit berauben, die Sonderstellung der Person sprachlich eindeutig auszudrücken. "Rechte gründen in der sittlichen Verantwortung der Person. Das Gesetz kann Güter von Tieren, aber nicht die Verfügungsgewalt von Tieren über Güter schützen. Bei Wesen, die zwar moralisches Objekt sind, aber aufgrund ihrer Natur niemals Subjekt moralischer Forderungen sein können, sollte nicht von Rechten gesprochen werden". Zumindest sollten wir uns bewußt bleiben, daß wir den Terminus eines moralischen Rechtes, wenn wir ihn auf Tiere beziehen, in einem abgeleiteten Sinn verwenden, weil unsere Pflichten gegenüber Tieren anders als in zwischenmenschlichen Verhältnissen nicht in der Fähigkeit zu reziprokem Handeln, sondern in unserer einseitigen Verantwortung für sie begründet sind. II. Ethische Prinzipien der menschlichen Verantwortung für das Tier Entgegen Albert Schweitzers ironischer Diagnose sind in der europäischen Ethik Tiere durchaus vorgesehen. Sie dürfen allerdings - um sein Bild aufzugreifen - nicht frei in ihr herumlaufen, sondern sich nur in den für sie vorgesehenen Reservaten des Denkens bewegen. Im Garten der europäischen Moralphilosophie sind sie als gezähmte Zootiere gehalten; sie kommen darin nicht als Mittelpunkt ihrer eigenen Umgebung, sondern nur als lebendige Staffage einer auf den Menschen hin entworfenen Welt vor, in der sie, Betrachtungsobjekt und pädagogisches Lehrstück zugleich, dem ästhetischen Genuß und der moralischen Erziehung des Menschen dienen. Für ihre Mitgliedschaft in der moralischen Welt bedeutet dies: Sie sind auch als Gegenstand der moralischen Gemeinschaft dem Menschen nicht gleichgestellt, denn dessen Sorge und moralische Verantwortung gilt den Tieren nicht direkt, sondern nur insofern das Mitgefühl mit ihnen auch die Empfindungsfähigkeit für das Leiden der Mitmenschen fördert. 1. Rücksicht auf die Interessen der Tiere. Während das Tier in der kontinentalen Ethik meist nur auf dem Umweg über das ethikbegründende Vernunftprinzip oder einen metaphysischen Lebensbegriff in moralische Erwägungen einbezogen wird, geht der angelsächsische Empirismus von Anfang an einen anderen Weg. Er nimmt eine elementare Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Tier als Ausgangspunkt für eine Begründung der Pflichten, die wir ihnen gegenüber haben: die Schmerzempfindlichkeit oder das Empfindungsvermögen überhaupt. Tiere sind wie wir schmerzempfindende Wesen und in dieser kreatürlichen Leidensfähigkeit liegt der Grund dafür, daß wir ihnen eigene Rechte zusprechen müssen. Der Begründer des klassischen Utilitarismus, Jeremy Bentham, hat den Gedanken einer Gleichbehandlung der Tiere als erster philosophisch durchdacht. In seinem im Jahr der französischen Revolution erschienen Buch "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" (1789), begründet er seine Forderung in einer Analogie zur politischen Moral damit, es gelte die Abschaffung der Sklaverei nun auch gegenüber dem Tierreich zu verwirklichen. "Vielleicht kommt es einmal dahin, daß auch das übrige Tierreich die Rechte erhält, die ihm durch die Tyrannei vorenthalten werden konnten. Die Franzosen haben bereits entdeckt, daß die Schwärze der Haut kein Grund ist, dessentwegen ein menschliches Wesen rücksichtslos den Launen eines Peinigers überlassen werden darf. Vielleicht erkennt man eines Tages auch, daß die Zahl der Beine, die Behaarung der Haut und der Auslauf des os sacrum gleichermaßen keine hinreichenden Gründe sind, um ein empfindungsfähiges Wesen (sensitive being) demselben Schicksal auszusetzen." Zur Begründung dieser Hoffnung folgt dann ein Satz, der seitdem aus der Geschichte der philosophischen Tierethik nicht mehr wegzudenken ist: Er bringt die Mitgliedschaft der Tiere in der moralischen Welt auf die griffige Formel: "Die Frage ist weder: können siedenken, noch: können sie sprechen, sondern: können sie leiden?" Daneben spielt das klassische Argument, die Einbeziehung der Tiere in die Gesetzgebung sei "ein Mittel, das allgemeine Gefühl des Wohlwollens zu bilden und die Menschen milder zu machen" nur noch eine untergeordnete Rolle. Es unterstreicht, daß Wohlwollen gegenüber Tieren auch im Interesse des Menschen liegt, daß wir also auch eigene utilitaristische Gründe dafür haben, die Interessen der Tiere zu berücksichtigen. Für Benthams utilitaristische Ethikkonzeption liegt also der entscheidende Grund dafür, ein anderes Wesen moralisch anzuerkennen, nicht in seiner Sprachfähigkeit oder in seinem Vernunftbesitz. Vielmehr erscheint ihm die Fähigkeit, zu leiden und Schmerzen zu empfinden, als das moralische Kriterium, das unsere Pflicht zur gleichen Rücksichtnahme ihm gegenüber begründet. Eine konsequente Weiterführung dieses Gedankens findet sich in der gegenwärtigen utilitaristischen Philosophie bei Peter Singer und seiner Tierbefreiungsethik. Er sieht in der Fähigkeit zur Schmerzempfindung die breiteste, allen Lebenwesen gemeinsame Basis, die seiner Ethik der allgemeinen Interessenerwägung als Grundlage dient. Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff des "Interesses", der durch die Fähigkeit, Freude und Leid empfinden zu können, definiert wird. Interessen haben zu können, meint an der Untergrenze aller möglicherweise davon betroffenen Wesen nichts anderes, als von Schmerzen frei sein zu wollen (ein Stein hat deshalb kein Interesse). Folgt man dieser Definition, dann ist die Berücksichtigung der Interessen aller schmerzempfindenden Wesen eine unmittelbare Konsequenz des Gleichheitsgrundsatzes, der jedem moralischen Urteil zugrunde liegt. Gegenüber diesem universalen Fundament der Ethik wäre ihre Gründung auf die Sprachfähigkeit oder das Vernunftvermögen eine willkürliche Eingrenzung auf die Interessen bestimmter Wesen . Das Postulat einer Befreiung der Tiere folgt aber nicht nur aus der inneren Logik des Prinzips der gegenseitigen Interessenserwägung, es steht auch in einem notwendigen geschichtsphilosophischen Horizont. Erst die Befreiung der Tiere stellt den Abschluß der bürgerlichen Freiheitsbewegung dar, die mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der französischen Revolution ihren Anfang nahm. Nachdem die Menschheit Rassismus und Sexismus überwunden hat, muß sie nun auch Abschied von dem Irrtum des Speziesismus nehmen, durch den sie ihre eigene Rasse gegenüber den nichtmenschlichen Lebewesen privilegiert. "Das Grundelement - die Rücksichtnahme auf die Interessen des Wesens, welcher Art diese Interessen auch sein mögen - muß, dem Prinzip der Gleichheit zufolge, auf alle Wesen ausgedehnt werden, farbig oder weiß, männlich oder weiblich, menschlich oder nichtmenschlich". In der Forderung nach einer neuen Tierbefreiungsethik vollendet sich also die Philosophie der Freiheit, die den bürgerlichen Gleichheitsgrundsatz auf alle Lebewesen ausdehnt. Unsere Pflichten gegenüber Tieren gründen sich dabei auf das elementare Band der Schmerzempfindlichkeit, das als der kleinste gemeinsame Nenner gewissermaßen zur Einlaßbedingung in die moralische Gemeinschaft wird. 2. Die moralische Selbstachtung des Menschen In der gegenwärtigen bioethischen Diskussion besteht unter allen Strömungen Einigkeit darüber, daß Tiere ebenso wie der Mensch schmerzempfindende Wesen sind, auf die wir um ihrer selbst willen Rücksicht nehmen müssen. Der unbestreitbare Sachverhalt, daß die Gemeinschaft der fühlenden Wesen die Artgrenzen des menschlichen Lebens übersteigt, findet auch in der Ethik Anerkennung, die auf das Vernunftprinzip und den Gedanken der Subjektivität gegründet ist. Für sie bleibt das erste Fundament der Tierethik allerdings die moralische Selbstachtung des Menschen, der gegen seine Würde als Vernunftwesen verstößt, wenn er sich gegenüber Tieren grausam und gefühllos verhält. Darauf hinzuweisen ist die unverzichtbare Funktion einer anthropologischen Begründung der Tierethik, die freilich durch die unzureichende Form verdeckt wird, in der dieses Argument bei Thomas und Kant entwickelt ist. Der Grundsatz, daß der Mensch gegen seine eigene Würde als sittliches Subjekt handelt, wenn er Tieren aus Gedankenlosigkeit oder bewußter Brutalität grausame Schmerzen zufügt, erfordert zu seiner Begründung nämlich keineswegs die Instrumentalisierung der Tiere, die diese zu bloßen Mitteln seiner moralischen Erziehung macht. Das Prinzip, auf das Leben der Tiere und ihre Empfindungswelt um ihrer selbst willen Rücksicht zu nehmen, ist mit dem Vernunftprinzip der Ethik nicht nur ohne weiteres vereinbar, sondern auch von ihm selbst gefordert. Zur besonderen Verantwortung des Menschen als des einzigen Subjektes der moralischen Gemeinschaft gehört, daß er alle Wesen gemäß ihrem immanenten Eigenwert und dem praktischen Selbstverhältnis behandeln soll, das sie ihrem Rang unter den Naturwesen entsprechend auszeichnet. Die Fähigkeit zur Schmerzempfindung setzt aber zweifellos ein zumindest anfängliches Selbstverhältnis voraus, durch das sich das Tier seiner selbst als distinktes Wesen bewußt wird. Wer Schmerz empfindet, weiß, daß es sein Schmerz ist, unter dem er leidet und erfährt sich so als von seiner Umgebung unterschieden. Unabhängig von der noch zu klärenden Frage, wie sich das tierische Schmerzempfinden vom menschlichen Leiden als einer spezifisch anthropologischen Größe unterscheidet, gilt deshalb unter allen Lebewesen: Wo Schmerz empfunden wird, da gibt es eine "Innenseite" des Lebens, die als naturgeschichtlicher Vorschein der Subjektivität interpretiert werden kann, die im Menschen zu sich selber kommt". Der Mensch hat den Grundsatz, auch den nichtmenschlichen Lebewesen keine unnötigen Schmerzen zu bereiten, deshalb um seiner moralischen Selbstachtung und um des Tieres willen als eine primäre moralische Forderung anzuerkennen. Daß ihre Mißachtung auf Dauer auch seine Fähigkeit zum Mitgefühl mit anderen Menschen untergräbt, ist dagegen eine abgeleitete moralpädagogische Konsequenz, die als empirisches Faktum keinen normativen Anspruch begründet. Der anthropologische Rückbezug der Tierethik, nach dem der Mensch, indem gegenüber dem Tier um dessen eigener Ziele willen Mitgefühl zeigt, zugleich sich selbst als Vernunftwesen achtet, deshalb darf nicht "speziesistisches" Vorurteil diskreditiert werden. Von jeder moralischen Forderung, gleich welches Objekt der moralischen Gemeinschaft sie schützt, gilt nämlich, daß der Mensch durch ihre Übertretung zugleich seine Integrität als moralisches Subjekt bedroht. Wenn es sich auch unter Menschen so verhält, daß ein sadistischer Folterer nicht nur sein Opfer erwürgt, sondern vor allem die eigene Menschenwürde zerstört, ist die Anwendung des gleichen Grundsatzes auf sein Verhalten gegenüber der nichtmenschlichen Welt vollkommen speziesneutral. Darin allein ist jedenfalls noch keine Benachteiligung der Tiere zu erkennen, wie es die "speziesistische" Kritik an einer anthropologischen Begründung der Tierethik häufig unterstellt. 3. Die Empfindungsfähigkeit der Tiere Auch der zweite Ausgangspunkt der Tierethik, die Berücksichtigung der tierischen Leidensfähigkeit um ihrer selbst willen, bedarf einer näheren philosophischen Analyse. Die moralische Forderung, Tieren keine grausamen Schmerzen zu bereiten und Mitgefühl gegenüber den Beeinträchtigungen ihres Daseins zu zeigen, erscheint dem moralischen Bewußtsein zwar unmittelbar evident, sie läßt sich aber dennoch auf verschiedene Weise begründen. Wie Friedo Ricken gezeigt hat, sind dabei grundsätzlich drei Wege denkbar, die sich in einigen Punkten berühren und hinsichtlich ihrer praktischen Konsequenzen weitgehend miteinander übereinstimmen. Das intuitionistische Argument behauptet, die Einsicht, daß der Schmerz als solcher ein Unwert und das Freisein von Schmerzen als solches ein Gut sei, stelle einen selbstevidenten Bewußtseinsinhalt dar, der von keinem Standpunkt aus sinnvoll bestritten werden kann. Aus der Forderung, Schmerzen an sich zu verhindern, folgt dann unmittelbar das Postulat, für die Schmerzfreiheit jedes Wesens einzutreten, das Schmerzen empfinden kann. Dabei muß eine solche Moral des "generalisierten Mitleids" (U. Wolf) nicht notwendig auf das Leiden als abstrakte Gesamtgröße gerichtet sein, wie es in manchen utilitaristischen Ethiken der Fall ist, die das einzelne Tier (wie auch menschliche Embryonen) nur als eine Art Behälter von Schmerz- und Unlust-Erfahrungen ansehen. Der durch den Anblick des Schmerzes hervorgerufene Affekt des Mitleids ist vielmehr als auf die individuelle Leidensfähigkeit einzelner Wesen gerichtet zu denken; ausgeschlossen wird durch das intuitionistische Argument nur, daß es für das moralische Urteil in irgendeiner Weise von Belang sein könnte, um welches Wesen es sich dabei handelt. Das zweite Argumant besteht in der Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes auf die Gemeinschaft aller Lebewesen. Dieser fordert in seiner korrekten Fassung, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln; das Gleichheitsprinzip verlangt also vom Menschen keineswegs, die Tiere in allem, sondern nur in dem gleich zu behandeln, worin sie ihm tatsächlich gleich sind. Die Frage zielt also darauf, inwiefern wir die Schmerzen von Menschen und Tieren vergleichen können und welche Rückschlüsse wir aus möglichen Unterschieden ziehen dürfen. Ein wichtiger Unterschied läßt sich trotz der offenkundigen Verwandtschaftsanalogie im Schmerzverhalten der Tiere nicht leugnen: Der tierische Schmerz ist kein Leiden im ganzheitlichen Sinn, weil dies das bewußte Selbstverhältnis eines geistigen Wesens voraussetzt. Dadurch, daß der Mensch in einem bewußten Zeithorizont lebt und sein Leiden als Teil eines größeren Lebensganzen bedeuten kann, steht er auch als Leidender in einem anderen Verhältnis zu sich selbst als das Tier. Das Tier ist immer - mit Nietzsche gesagt - angebunden an den "Pflock des Augenblicks"; es steht ganz im Zentrum seiner eigenen Welt und vermag im Schmerz nichts anderes als Schmerz zu sehen. Das Tier "leidet" deshalb nicht wie der Mensch, der auch als Leidender in seine Zukunft vorausschauen kann. Das Leiden eines krebskranken Menschen wird dadurch intensiviert, daß er um seinen schrecklichen Verlauf weiß und dieses Wissen seiner Psyche schon lange bevor die körperlichen Schmerzen einsetzen zu einer empfindlichen Lebenseinbuße führen kann. In diesem Sinn fühlt das Tier, wenn es leidet, nur Schmerz, ohne daß es diese Empfindungen interpretieren und in ihre Bedeutung für den eigenen Lebensvollzug entschlüsseln könnte. Der Philosoph Günther Patzig kommt deshalb zu dem Schluß: "Menschliche Leidensfähigkeit ist angesichts des Selbstbewußtseins und des Resonanzbodens von Erinnerung und Zukunftserwartung in ihrer Qualität von der Lebensfähigkeit der Tiere verschieden. Nur der Mensch hat ein Bewußtsein der ständigen Bedrohung seines Lebens durch den Tod, nur er hat ein kulturell vermitteltes Interesse an seinem sinnvollen Lebensganzen, einen Plan, der seine gesamte Biographie umfassen kann". Dennoch ist es fraglich, ob wir dem Schmerz des Menschen in jedem Fall ein größeres Gewicht beimessen dürfen. Der fehlende Zeitbezug und die Tatsache, daß der tierische Schmerz nicht durch ein selbstbewußtes Erleben modifiziert wird, lassen nämlich auch eine andere Deutung zu. Weil das Tier in die jeweilige Situation eingesperrt ist, hat es keine Hoffnung auf ein Ende des Leidens; es kann seinen Schmerz nicht deuten und in einen bewußten Lebenszusammenhang integrieren. Einem gefangenen Menschen kann man erklären, daß man ihn bald wieder freilassen wird; die Todesangst eines Tieres dagegen können wir auf diese Weise nicht zerstreuen. Gerade weil es im Schmerz nur Schmerz empfindet und ohne Sinnbezug leidet, ist sein Schmerz in mancher Hinsicht intensiver als der des Menschen. Deshalb ist eine rationale Entscheidung darüber, ob der Mensch oder das Tier mehr leiden, letzten Endes unmöglich. Der Vergleich des tierischen und des menschlichen Schmerzes, den wir aus den vertrauten Analogien im Umgang mit unseren Haustieren oder aus den spekulativen Rückschlüssen auf das tierische Bewußtsein ziehen können, bleibt in hohem Maße hypothetisch. Selbst wenn wir sicher annehmen dürfen, daß Tiere anders leiden als wir, kann aus dieser Erkenntnis auch die Konsequenz folgen, ihren Schmerz höher zu achten, weil ihnen die Möglichkeit der Sinngebung von seinem vorhersehbaren Ende her fehlt. Der zweite Ausgangspunkt der Tierethik, unsere Pflicht zur Rücksichtnahme auf das tierische Schmerzempfinden läßt deshalb eine generelle Ungleichbehandlung von Menschen und Tieren nicht zu. In einer konkreten Güterabwägung, in der das Übel des tierischen Schmerzes der Rechtfertigung bedarf, muß sich der Mensch, da er Größe und Intensität des tierischen Schmerzes nicht exakt bemessen kann, gemäß dem Gleichheitsprinzip deshalb von der Überlegung leiten lassen, ob er selbst in einer vergleichbaren Situation solche Schmerzen erdulden wollte; dagegen darf er sie auch dem Tier nicht zufügen, wenn er sie für sich selbst unzumutbar hält. Das dritte Argument geht von dem schon mehrfach erwähnten geschöpflichen Eigenwert der Tiere aus. Sie sind zwar nicht der letzte Zweck der moralischen Ordnung, da sie ihr Verhalten nicht rechtfertigen können und nicht zu sittlicher Verantwortung fähig sind. Dennoch sind sie in einem der Selbstzwecklichkeit des Menschen analogen Sinn Träger eigener Zwecke und eines praktischen Selbstverhältnisses, wozu neben den anderen Aspekten des tierischen Wohlbefindens vor allem das Freisein von Schmerz und Unlust gehört. Wenn der Mensch auch prinzipiell zur Verfügung über das tierische Leben berechtigt ist, so verpflichtet ihn dieses Analogieargument doch dazu, Tiere nur so für seine Ziele in Dienst zu nehmen, daß er dabei auch eigenen Zielen gerecht wird. III. Praktische Konfliktfelder der Tierethik Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen lassen sich verpflichtende Grundregeln für eine Güterabwägung in Konfliktsituationen formulieren, in denen das Wohl der Menschen dem Wohl der Tiere gegenübersteht. Gemäß der analogen Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes sind wir zwar nicht zur unterschiedslosen Gleichbehandlung, wohl aber zu Rücksichtnahme auf die Tiere in dem verpflichtet, worin sie uns gleich sind. Da Tiere ebenso wir wir schmerzempfindende Wesen sind, umfaßt das Gebot, auf Schmerz und Angst anderer Lebewesen Rücksicht zu nehmen, das entsprechend der Unterscheidung zwischen Subjekten und Objekten der moralischen Gemeinschaft allein den Menschen zu seinem Adressaten hat, in seinem Anwendungsbereich ohne Unterschied auch die Tiere. Da Tiere im Gegensatz zum Menschen als personalem Wesen jedoch keinen unbedingt zu achtenden individuellen Lebensanspruch haben, kann es prinzipiell legitim sein, menschliches und tierisches Leben als solches unterschiedlich zu berücksichtigen. Diese Möglichkeit schließt vor allem die Erlaubnis ein, zur Sicherung und Förderung der menschlichen Existenz Tiere zu töten. "Wo die Notwendigkeit besteht, tierisches Leben zu opfern, um personales, menschliches Leben zu retten, zu schützen, zu bewahren und zu fördern, ist dies erlaubt". Aus der Tatsache, daß dem Tier als Einzelwesen durch seine Tötung kein Unrecht geschieht, läßt sich jedoch kein willkürliches Vergnügungsrecht der Menschen über das Leben der Tiere ableiten. Die Erlaubnis, Tiere um des menschlichen Wohlergehens willen zu opfern, steht vielmehr unter zwei einschränkenden Bedingungen. Erstens dürfen Tieren niemals grausame und unnötige Schmerzen zugefügt werden, die der Mensch bei sich selbst als unzumutbar empfinden würde und zweitens muß die Verfügung über tierisches Leben im Dienst des Menschen einen Maßstab der Verhältnismäßigkeit entsprechen, der außer der Schmerzempfindlichkeit auch andere Aspekte des tierischen Wohlbefindens wie einen angemessenen Bewegungsraum und eine artgemäße Umgebung berücksichtigt. Welche Grenzen diese Bedingungen der menschlichen Verfügungsgewalt über das tierische Leben auflegen, soll nun für zwei konkrete Bewährungsfelder der Tierethik noch näher behandelt werden. 1. Nutztierhaltung Nach dem bisher Gesagten kann das Recht des Menschen, das Leben der Tiere für seine eigene Ernährung in Dienst zu nehmen und zu diesem Zwecke eine rationale Nutztierhaltung zu organisieren, nicht als schrankenlose Verfügungsgewalt verstanden werden, die nur nach Effizienzkriterien zu bewerten wäre. Die rationale Erwartung eines Jeremy Bentham, der Mensch werde die Tötung der Tiere schmerzfrei organisieren und ihnen ein sanfteres Los als die Natur bereiten, blieb angesichts der Entwicklung der industriellen Tierproduktion bislang jedoch ein uneingelöstes Versprechen. Die gegenwärtig in vielen Formen praktizierte Massentierhaltung stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Gebot zur Rücksichtnahme auf das tierische Wohlbefinden dar, auf das der Mensch bei der Erschließung tierischer Nahrungsquellen verpflichtet bleibt. Die Legebatterien für Hühner, die Schweinehaltung und die Mastbullenzucht mißachten das Eigenrecht der Tiere auf einen artgemäßen Bewegungsraum und fügen ihnen auch durch eine unzureichende Pflege vielfach auch unnötige Schmerzen zu. Nimmt man den Gedanken ernst, daß der Mensch den Eigenwert des Tieres achten muß und seine Schutzbedürfigkeit auch dort zu wahren hat, wo er das Leben für die eigenen Zwecke in Dienst nimmt, dann darf die Nutztierhaltung nicht einseitig am Interesse der billigen Mengenproduktion fleischlicher Nahrung für den Menschen ausgerichtet sein. Der Mensch darf zum Zwecke seiner eigenen Ernährung auf das tierische Leben zurückgreifen, aber er hat kein Recht, um einer kostengünstigen Fleischproduktion willen das Gebot einer tiergerechten Aufzucht zu mißachten. Insbesonders sind Methoden der Aufzucht, Haltung oder Mast, die den natürlichen Bewegungsraum der Tiere annähernd auf die Quadratzentimeterzahl ihrer Körpergröße reduzieren, ethisch nicht zu rechtfertigen. Ebenso müssen alle Transportmethoden als unzulässig angesehen werden, die das Tier panischen Angstzuständen und Streßreaktionen ausliefern. Auch die Tötung selbst darf nicht auf grausame Weise erfolgen. Insbesondere verstößt der Transport von Mastschweinen, bei denen viele ohne vorherige Injektionen infolge panikartiger Streßreaktionen an Herzstillstand sterben würden, gegen das Gebot, auf Schmerzund Angstzustände der Tiere Rücksicht zu nehmen. Auch die Art und Weise, wie in unseren Geflügelfabriken Suppenhühner und Brathähnchen nur unzureichend betäubt geschlachtet werden, ist mit den Grundgeboten einer tiergerechten Nahrungsgewinnung nicht zu vereinbaren. Dabei war von der Erzeugung ausgefallener Luxusnahrungsmittel wie der Gänseleberpastete oder besonders zarter Fleischspeisen durch die vorgeburtliche Schlachtung der Tiere noch gar nicht die Rede. Anders als Tierversuche unter bestimmten Konstellationen lassen sich die Formen der Tierproduktion, an die sich Herstellung und Verbraucher längst gewöhnt haben, durch kein menschliches Grundbedürfnis rechtfertigen, dem nicht auf andere Weise Rechnung getragen werden kann. In vielen Fällen wäre der Verzicht auf seiten des Menschen, den eine Abkehr von den herkömmlichen Produktionsverfahren der Tierindustrie bedeuten würde, nicht einmal sehr erheblich. Bei der Umstellung der Batteriehaltung von Hühnern auf die Bodenhaltung in geschlossenen Räumen - die natürliche Freilufthaltung als einzig zulässige Form halten auch viele Tierschutzverbände als unrealistisch - wird vom Verbraucher nur die Bereitschaft gefordert, eine bescheidene Preissteigerung mitzutragen. Angesichts der Tatsache, daß ein Ei heute kaum mehr als vor 30 Jahren kostet, wären die Mehrkosten, die auf die Bevölkerung zukommen, kaum der Rede wert. Andere Maßnahmen, die eine spürbare Verteuerung von Fleisch- und Wurstwaren mit sich bringen, haben eine weitergehende Umstellung im Konsumverhalten und in den Ernährungsgewohnheiten der Menschen zur Voraussetzung. Da in unserem Wirtschaftssystem eine wirksame Steuerung der Produktionsformen nur über den Markt erfolgen kann, ist die Änderung der Verbrauchergewohnheiten der schnellste und letztlich auch der einzig erfolgversprechende - Weg, der in den modernen Industriegesellschaften zu Formen der Nahrungsmittelproduktion führen kann, die berechtigte Belange der Tiere in angemessener Weise berücksichtigt. Dafür unter Verbrauchern, Politikern und Herstellern für Verständnis zu werben, ist vielleicht das dringlichste öffentliche Desiderat einer rationalen Tierethik, von dessen Einlösung die "zivilisierten" Gesellschaften des Westens noch weit entfernt sind. Über die Übertragung gezielter Einzelgene wie des Wachstumshormongens hinaus sind aber auch Züchtungen vorstellbar, die bisherige Artgrenzen überschreiten. Solche "transgenen Tiere" werden zwar bislang in der Agrarproduktion noch nicht eingesetzt, aber auch mit den biotechnischen Methoden, die in den letzten Jahren Eingang in die Tierzucht gefunden haben (künstliche Besamung; In-VitroFertilisation, Embryonen-Transfer), bislang bereits die Züchtung von "Mischtieren" aus Schaf und Ziege ("Schiege") oder aus Bison und Rind ("Beefalo"). Die kommerziellen Vorteile einer solchen Züchtung liegen auf der Hand: Da das Mischprodukt "Beefalo" doppelt so schnell wie ein Rind heranwächst, dabei als Futter nur Gras frißt und obendrein noch weniger fettes Fleisch auf die Waage bringt, kommt es sowohl den ökonomischen Interessen der Produzenten als auch den Geschmackserwartungen der Verbraucher entgegen. Daß Mischwesen wie der Maulesel oder Hundebastarde auch in der Natur vorkommen, kann solche Züchtungen allein jedoch ebensowenig legitimieren wie die unbestrittene Tatsache, daß die neuen biotechnischen oder gentechnologischen Methoden in sich als ethisch neutral zu betrachten sind. Sie müssen vielmehr wie jeder technische Eingriff des Menschen in die Natur von ihren Zielen her sittlich gerechtfertigt und auch angesichts der vorhersehbaren Folgen zu verantworten sein. Lassen sich diese noch nicht sicher abschätzen, weil z.B. die Expression des Transgens oder sein Integrationsort im neuen tierischen Organismus noch nicht steuerbar sind, so spricht schon der technische Sicherheitsaspekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt dagegen, den Einsatz transgener Tiere außerhalb der Grundlagenforschung ernsthaft zu erwägen. Eine ethische Bewertung der neuen gentechnischen Verfahren in der Tierwirtschaft darf sich aber nicht auf eine reine Folgenabschätzung unter Sicherheitsaspekten beschränken. Sie muß, auch wenn diese nicht mit Gewißheit vorherzusagen sind, ebenso die weitergehenden Folgen für die Gesundheit der Tiere, den Erhalt ihres Artenreichtums und das soziale Umfeld der in der Landwirtschaft tätigen Menschen in Betracht ziehen. Bei aller notwendigen Vorsicht, die angesichts der zu erwartenden revolutionären technischen Innovationsschübe im Agrarsektor angebracht ist, erlaubt es die Abwägung der damit verbundenen Güter und Übel doch schon heute, in dreifacher Hinsicht eine deutliche Warnung auszusprechen. Unter dem Gesichtspunkt des tierischen Wohlbefindens sind gegen die neuen bioethischen und gentechnologischen Tierzuchtverfahren die gleichen Bedenken anzumelden, die gegen die herkömmliche Massentierhaltung und industrielle Nutzung der Tiere sprechen. Die erstrebte größere Krankheitsresistenz und die Entwicklung von Impfstoffen gegen gefährliche Infektionskrankheiten wie die Tollwut oder die Maul- und Klauenseuche stellen zwar auch aus der Sicht des Tieres einen begrüßenswerten Fortschritt dar. Eine Güterabwägung unter dem Aspekt der tierischen Gesundheit darf jedoch nicht nur ein isoliertes Merkmal, sondern muß alle Folgen für die Gesundheit, Gesamtphysiologie und Lebensleistung des Tieres berücksichtigen. Der Bericht der Enquete-Kommission des deutschen Bundestages "Chancen und Risiken der Gentechnologie" weist darauf hin, daß einseitige Produktionssteigerungen in der Vergangenheit durch regelmäßige Gesundheitseinbußen der Tiere erkauft wurden und befürchtet, daß sich dieser Negativtrend durch die einseitige Nutzung gentechnologisch verbesserter Hochleistungsvarianten noch weiter fortsetzen könnte. Es ist aber auch möglich, daß eine umgekehrte Entwicklung zugunsten des Tieres ausschlägt, wenn es nämlich gelingt, über eine Leistungssteigerung die Bedarfszahlen so zu senken, daß die Situation des einzelnen Tieres verbessert wird. Welche der aufgezeigten Entwicklungen tatsächlich eintreten, hängt nicht zuletzt von der Bereitschaft des Menschen ab, das freiwerdende Weideland und die bisherigen Haltungskapazitäten auch tatsächlich zu einer Optimierung des Bewegungsraumes und der Lebensbedingungen seiner Nutztiere zu verwenden. Ein zweiter Aspekt, der in einer Güterabwägung zu berücksichtigen ist, betrifft den notwendigen Erhalt der Artenvielfalt unter unseren Nutztieren und des genetischen Reichtums innerhalb der einzelnen Arten. Es ist schon heute ein oft beklagtes Ergebnis der modernen Landwirtschaft, daß wir auf unseren Wiesen nur noch wenige Tierrassen antreffen. Eine weitere Verarmung, wie sie durch gezielte Zuchtanstrengungen zur einseitigen Maximierung von Produktivität und Geschmack zu befürchten ist, würde durch die theoretische Möglichkeit nicht wettgemacht, eine viel größere Zahl phänotypischer Rassenmerkmale in künftigen Genbanken zu lagern. Der Bericht der Enquete-Kommission trifft angesichts der zu erwartenden Entwicklungen in der Tierzucht leider keine triviale Feststellung, wenn er darauf hinweist, daß es "ganz allgemein wünschenswert (ist), wenn die Vielfalt der Arten uns nicht nur in Form tiefgefrorener Embryonen, sondern auch und vor allem in Form lebender Tiere erhalten bliebe". Schließlich ist als dritte Konsequenz zu bedenken, daß eine weitere Versachlichung des Mensch-Tier-Verhältnisses die kritische Schwelle überschreiten kann, die in ethischer Hinsicht akzeptabel erscheint. Dabei ist etwa an die Gefahr von Monsterbildungen zu denken, die in keiner Weise mehr an die natürliche Herkunft solcher Tiere erinnern oder auch an die Möglichkeit, daß sich die einzelnen Forschungslaboratorien ihre Züchtungen patentieren lassen. Zur Wahrnehmung der Schutzbedürftigkeit des Tieres gehört auch, daß der Mensch dessen Eigenwert respektiert und anerkennt. Bevor man deshalb darüber nachdenkt, wie sich menschliche Produktions- und Verwertungsansprüche gegenüber einzelnen Tierarten rechtlich absichern lassen, müßte sich juristischer Sachverstand wohl eher mit der Frage beschäftigen, welche garantierten Schutzansprüche diesen Tierarten gegenüber ihren Vertreiberkonzernen zukommen. Je stärker die Grundlagen unseres Zusammenlebens mit den Tieren im Haus der Welt berührt werden, desto größeres Gewicht erhält die Mahnung, die unlängst Alfons Auer ausgesprochen hat: "Die zunehmende Technisierung führt fast zwangsläufig zur Vorherrschaft oder gar zur Alleinherrschaft des Funktionalen und damit zu einer bedenklichen Versachlichung des Verhältnisses zum Tier". Daß es im Einzelfall schwer zu bestimmen bleibt, an welchem Punkt die kritische Schwelle überschritten ist, jenseits derer eine illegitime Verfügung des Menschen über die Tiere beginnt, berechtigt jedenfalls nicht dazu, solche Warnungen immer dann in den Wind zu schlagen, wenn es der technologische Fortschritt gestattet, einen weiteren Schritt in dieser Richtung zu tun. ∗ Vortrag gehalten anlässlich der Tagung "Euch sollen sie zur Nahrung dienen ...“ – Ethik des Lebens zwischen Vegetarismus und Rinderwahn, Weingarten, 7. - 9. Juni 1996.