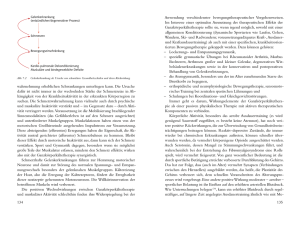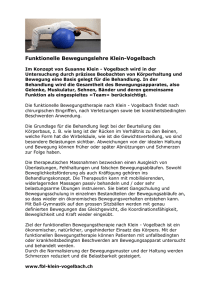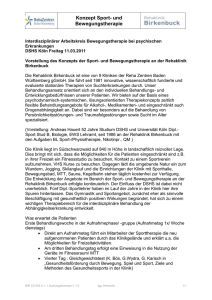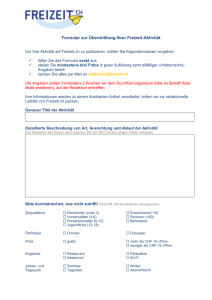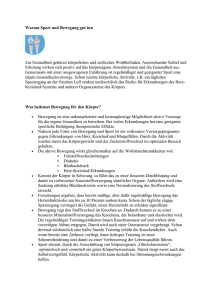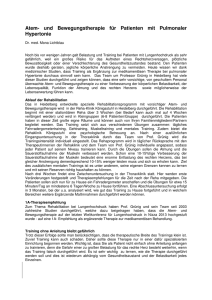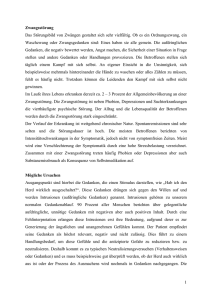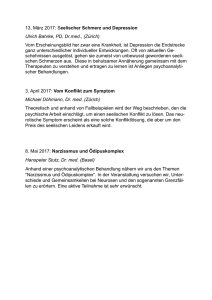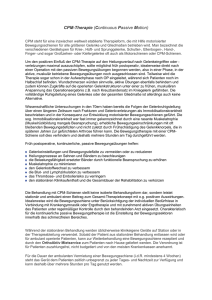Leseprobe - Weltbild
Werbung

36 4 Grundlagen der Trainingslehre Marco Herbsleb, Christian Puta 4.1 Sportwissenschaftliche Grundlagen Sportwissenschaftliche Kenntnisse bilden eine wichtige Voraussetzung, um ein regelmäßiges und sinnvolles Training bei Patienten durchführen zu können. Unter Training versteht man hierbei einen komplexen Handlungsprozess, der auf systematischer Planung, Ausführung und Evaluation von Maßnahmen basiert, um nachhaltige Ziele in den verschiedenen Anwendungsfeldern des Sports zu erreichen (Hottenrott u. Hoos 2013). Dabei werden Trainingsprinzipien und Belastungsmerkmale zur Steuerung des Trainingsprozesses genutzt. Für das Spektrum des Gesundheitssports sind nachfolgend dargestellte Trainingsprinzipien und Belastungsmerkmale bedeutsam (Hottenrott u. Hoos 2013). 4.1.1Trainingsprinzipien Prinzip des wirksamen Trainingsreizes: Ein Trainingsreiz muss eine Mindestschwelle überschreiten, um Anpassungen auszulösen. Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 4.1 Sportwissenschaftliche Grundlagen 37 Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung: Nach einer körperli- chen Belastung (z. B. Trainingseinheit) ist eine bestimmte Erholungszeit zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit notwendig, um eine erneute Belastung mit bestmöglichem Ausgangspotenzial durchführen zu können. Prinzip der individualisierten Belastung und Belastungssteuerung: Die Trainingsbelastungen und Steuerungsmaßnahmen sollten möglichst individuell auf die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit, Akzeptanz und Bedürfnislage des Trainierenden abgestimmt werden. Prinzip der alters- und geschlechtsspezifischen Belastung: Die Trainingsbelastun- gen sollen unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht geplant und umgesetzt werden. 4.1.2Belastungsmerkmale Belastungsumfang: Der Belastungsumfang charakterisiert die summierte Belas- tungseinwirkung über definierte Zeiträume. Als zugehörige Maßzahlen gelten je nach Belastungsreiz Distanzangaben, Belastungszeit oder die Anzahl an Wiederholungen. Belastungsintensität: Die Belastungsintensität kennzeichnet die Höhe bzw. Stär- ke einer Belastung. Als Maße für die Belastungsintensität können die Geschwindigkeit (wie beim Laufen, Walken oder Schwimmen), die Größe des Widerstands (wie beim Krafttraining), die mechanische Leistung (beispielsweise beim Fahrradergometer) oder auch die Intensität in Prozent der Maximalleistung verwendet werden. Vergleichbar kommen Maße für die biologische Beanspruchung (beispielsweise die Herzfrequenz) zur Anwendung. Belastungsdauer: Unter Belastungsdauer versteht man die gesamte Einwirkungsdauer einer Trainingsbelastung. Die Belastungsdauer entspricht beispielsweise der Zeitdauer einer Ausdauerbelastung oder auch der Spielzeit im Sportspiel. Beim Krafttraining entspricht die effektive Belastungsdauer der Anspannungsdauer der Muskulatur. Belastungshäufigkeit: Die Belastungshäufigkeit kennzeichnet die Anzahl der Trainingsbelastungen bzw. Wiederholungen innerhalb eines definierten Trainingszeitraums. Belastungsdichte: Die Belastungsdichte beschreibt den zeitlichen Abstand zwischen Belastungen (Pausenlänge) und kennzeichnet so das Verhältnis von Belastung und verfügbarer Erholung. Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 4 Grundlagen der Trainingslehre 38 4.1.3 Motorische Basisfähigkeiten In der Trainingslehre werden fünf motorische Basisfähigkeiten unterschieden (▶ Abb. 4-1). Für seelische Erkrankungen sind Ausdauer und Kraft die am besten untersuchten Beanspruchungsformen. Diese sollen daher – in sehr vereinfachter Form – im Zentrum der nachfolgenden Erläuterungen stehen. Ausdauer Die Ausdauer entspricht umgangssprachlich dem Durchhaltevermögen. Sie ist eine komplexe Fähigkeit mit vielfältigen Erscheinungsformen. Für die Sportund Bewegungstherapie empfiehlt sich eine grundlegende Strukturierung nach Intensitätszonen. Die Einteilung in Intensitätszonen basiert vorrangig auf der Energiebereitstellung. In Abhängigkeit von der Belastungsdauer und -intensität erfolgt die Energiebereitstellung zu unterschiedlichen Anteilen über aerobe und anaerobe Stoffwechselwege. Aus klinischer und trainingsmethodischer Sicht hat sich die Einteilung in Intensitätszonen entsprechend der Ausdauerbereiche aerob, aerob-anaerob und anaerob als sinnvoll erwiesen (▶ Abb. 4-2). Aerobe Ausdauer (Intensitätszone I): Diese ist gekennzeichnet durch Belastungsintensitäten unterhalb der aeroben Schwelle (kein nennenswerter Anstieg der Lactatkonzentration über die Ruhelactatkonzentration). Dies entspricht Belastungsintensitäten, bei denen beispielsweise Reden gut und ohne Unterbrechung möglich ist und die in der Regel als leicht bis wenig anstrengend empfunden werden. Aerob-anaerobe Ausdauer (Intensitätszone II): Hier liegen die Belastungsintensitä- ten zwischen aerober und anaerober Schwelle (Anstieg des Lactats, wobei noch ein Gleichgewicht zwischen Bildung und Abbau besteht). Die Belastung wird meist als anstrengend empfunden, Reden ist noch in kurzen Sätzen möglich. Hauptbeanspruchungsformen Koordination Flexibilität Kraft Schnelligkeit Ausdauer Abb. 4-1 Darstellung der motorischen Hauptbeanspruchungsformen Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 55 6 Sport und Bewegung in der Behandlung depressiver Erkrankungen Andreas Broocks 6.1Einleitung Depressive Erkrankungen stellen eine große Herausforderung für das gesamte Gesundheitssystem dar. Schätzungen gehen von ca. 18 Millionen Menschen in der Europäischen Gemeinschaft aus, die einmalig oder mehrfach von einer behandlungsbedürftigen depressiven Phase betroffen sind (Daten aus Eurobarometer 2006). In Deutschland sind psychische Erkrankungen auch mehr und mehr dafür verantwortlich, dass Menschen bereits in den mittleren Lebensjahren keine Alternative mehr zu einer Frühberentung sehen. Denn mehr als 20 000 Menschen werden pro Jahr wegen psychischer Erkrankungen bereits vorzeitig berentet. Damit steht diese Krankheitskategorie nach den Daten der Deutschen Rentenversicherung an erster Stelle – noch vor den Erkrankungen des Bewegungsapparats (http://www.deutsche-rentenversicherung.de; www.gbe-bund.de). In den letzten Jahren liest man in der Presse sehr häufig vom sogenannten Burn-out-Syndrom, das man in Lehrbüchern über psychische Erkrankungen noch immer vergeblich sucht. In der Regel wird unter Burn-out ein Erschöp- Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 6 Sport und Bewegung in der Behandlung depressiver Erkrankungen 56 fungssyndrom – im Zusammenhang mit einer länger andauernden beruflichen oder auch privaten Überforderungssituation – verstanden. Symptomatologisch handelt es sich um eine leichte depressive Verstimmung, aus der sich aber eine schwerere Depression entwickeln kann. 6.2 Klassifikation und Behandlung Depressive Erkrankungen unterscheiden sich deutlich von den auch bei Gesunden vorkommenden Zuständen, in denen für Stunden oder Tage Beeinträchtigungen der Stimmung oder der Leistungsfähigkeit auftreten. Typische Anzeichen sind niedergedrückte Stimmung, Konzentrationsstörungen, Neigung zum Grübeln, Freudlosigkeit, ein Gefühl von Sinnlosigkeit, innere Unruhe, Schlafstörungen – (häufig mit Früherwachen), Schuldgefühle, Suizidgedanken sowie körperliche Symptome wie dumpfe Kopfschmerzen oder ziehende Rückenschmerzen. Kleinste Verrichtungen erfordern eine große Anstrengung und hinterlassen das Gefühl einer anhaltenden Erschöpfung. Bei schweren Depressionen kann es auch zu Wahnvorstellungen kommen – beispielsweise im Sinne eines Verarmungswahns oder der Vorstellung, an einer unheilbaren körperlichen Erkrankung zu leiden. Im Rahmen der »rezidivierenden depressiven Störung« besteht meist lebenslang eine Neigung, dass nach Belastungen oder auch spontan erneut depressive Phasen auftreten. Bei der sogenannten Dysthymie fühlen sich die Betroffenen häufig matt, lustlos, gereizt und niedergeschlagen. Im Unterschied zu depressiven Episoden sind die Beschwerden aber nicht so stark, dass die Patienten arbeits­ unfähig sind. Studien haben gezeigt, dass Übergänge zwischen rezidivierenden depressiven Störungen und Dysthymie häufig sind. Bei der bipolaren affektiven Störung wechseln schwere depressive Zustände mit manischen Phasen ab, die durch Antriebssteigerung, geringes Schlafbedürfnis, Größenideen, unsinnige Geldausgaben, aber auch Aggressivität bis hin zu Erregungszuständen gekennzeichnet sind. 6.2.1ICD-10-Diagnosekriterien Leitsymptome für eine depressive Episode (seit mehr als 2 Wochen) (Punktprävalenz ca. 6 %; Lebenszeitprävalenz ca. 15 %) Depressive Stimmung yy Deutlicher Interessenverlust yy Gewichtsverlust (> 5 % des Körpergewichts/Monat) yy Insomnie oder Hypersomnie yy Agitiertheit oder starke psychomotorische Hemmung yy Erschöpfbarkeit yy Überzeugung der eigenen Wertlosigkeit und Schuld yy Starke Konzentrationsstörungen und Denkhemmung yy Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 7 Sporttherapie bei Angsterkrankungen 72 Tab. 7-1 Epidemiologie und Gesundheitskosten der Angststörungen Altersbereich der Erstmanifestation 12-MonatsPrävalenz1 Panikstörung 3.–4. Lebensjahrzehnt Agoraphobie Angst­ störung 1 2 Geschlechterverteilung1 Gesundheitskosten2 direkt indirekt 1,8 % 6,7 5,2 3.–4 . Lebensjahrzehnt 2 % 3,0 6,7 Generalisierte Angststörung Frühe Jugend Höheres Alter 1,7 % 3,4 % 8,7 2,0 Soziale Phobie Adoleszenz 2,3 % 7,3 4,8 Spezifische Phobien Kindheit 6,4 % 10,7 8,6 Frauen : Männer = 2,5 : 1 In Europa 2010 (nach Wittchen et al. 2011) In Europa 2010 in Mrd. Euro (nach Olesen et al. 2012) 7.2 Klassifikation, Klinik und Diagnostik der Angststörungen Gemäß den Klassifikationen der Weltgesundheitsorganisation und der American Psychiatric Association (ICD-10 und DSM-5) zählen zu den Angsterkrankungen die Panikstörung, die Agoraphobie, die Generalisierte Angststörung, die soziale Phobie sowie die spezifischen Phobien. Während noch im DSM-IV subsummierte Störungsbilder (Posttraumatische Belastungsstörung und Zwangsstörung) im Rahmen der letzten Revision anderen Erkrankungsgruppen zugeordnet wurden, führt das DSM-5 nun zusätzlich den selektiven Mutismus und die Trennungsangst in der Kategorie der Angststörungen des Erwachsenenalters auf. Alle Angsterkrankungen zeichnen sich neben der jeweiligen spezifischen Symptomkonstellation durch einen störungsübergreifenden psychophysischen Beschwerdekomplex aus (▶ Tab. 7-2), der unvermittelt (Panikstörung) und stimulusabhängig (phobische Störungen) auftreten oder auch einen eher chronischen, in seiner Intensität undulierenden Charakter besitzen kann (Generali­ sierte Angststörung). Im Verlauf der Erkrankungen bildet sich regelhaft ein Vermeidungsverhalten gegenüber den gefürchteten Situationen, Sorgenthemen oder den assoziierten Körpersymptomen heraus. Dies führt zu einer signifikan- Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 7.2 Klassifikation, Klinik und Diagnostik der Angststörungen 73 ten Einschränkung des sozialen Aktionsradius und mittelbar zu einem deutlichen Leidensdruck der betroffenen Patienten. Während isolierte und soziale Phobien sich oft bereits relativ früh entwickeln, liegt das Erst­manifestationsalter der Panikstörung sowie der Agoraphobie zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Die Generalisierte Angststörung zeigt hingegen eine zweigipflige Auftretenshäufigkeit und ist damit bezüglich Diagnostik und Therapie sowohl für den kinderund jugendpsychiatrischen Bereich als auch im Rahmen der Altersmedizin relevant. Frauen sind ca. doppelt so häufig wie Männer von Angsterkrankungen betroffen (▶ Tab. 7-1). Die Gründe hierfür sind noch weitgehend ungeklärt; diskutiert werden neben biologischen auch soziokulturelle Faktoren sowie ein unterschiedliches Hilfegesuchverhalten beider Geschlechter. Zur Diagnosestellung und Schweregradeinschätzung von Angsterkrankungen haben sich bereits langfristig zahlreiche standardisierte Instrumente etabliert. Die Tab. 7-2 Phänomenologie der Angststörungen nach ICD-10 Panikstörung Mehr als zwei Episoden von intensiver Angst oder Unbehagen innrerhalb eines Monats, die sich durch einen abrupten Beginn auszeichnen und innerhalb von wenigen Minuten ein Maximum erreichen (Panikattacke). Die Panikattacken sind nicht auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches Objekt bezogen, treten oft spontan auf und sind nicht mit be­sonderer Anstrengung oder mit gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen verbunden. Generalisierte Angststörung Ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten mit vorherrschender Anspannung, Besorgnis und Befürchtungen in Bezug auf alltägliche Ereignisse und Probleme (z. B. die eigene gesundheitliche, finanzielle, partnerschaftliche, sicherheitsbezogene oder allgemeine soziale Situation bzw. die naher Bezugspersonen). Die Sorgen haben kein entsprechendes objektivierbares Korrelat, sind oft exzessiv und unkontrollierbar sowie meist auf Ereignisse in der Zukunft gerichtet. Bei meist hohem Leidensdruck werden sie durch die Betroffenen oft als (teilweise) berechtigt erlebt (»Durch meine Sorgen verhindere ich Schlimmeres«). Soziale Phobie Furcht vor prüfender Betrachtung/Bewertung durch andere Menschen (z. B. im Rahmen von neuen sozialen Kontakten, Tätigkeiten in der Öffentlichkeit und/oder vor Publikum) – meist einhergehend mit niedrigem Selbstwertgefühl und Angst vor Kritik Agoraphobie Furcht vor oder in Situationen, die nicht unmittelbar verlassen werden können und/ oder die keiner unmittelbaren externen Hilfe zugänglich sind (z. B. Benutzen öffent­ licher Verkehrsmittel, Fahrstühle, Im-Stau-Stehen, Autobahnfahrten, große Plätze, breite Straßen, Wälder) Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 96 8 Aerobe Bewegung bei der Zwangsstörung Jens Plag, Sarah Schumacher, Andreas Ströhle 8.1Einleitung Die Zwangsstörung (obsessive-compulsive disorder [OCD]) ist eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die für die betroffenen Patienten regelmäßig deutliche Einschränkungen, einen hohen Leidensdruck und eine ausgeprägte Verminderung der Lebensqualität zur Folge hat (Macy et al. 2013; Wittchen et al. 2011). In diesem Zusammenhang spielen neben Einschränkungen des sozialen Funktionsniveaus und einer ausgeprägten symptomassoziierten psychischen Belastung auch eine signifikante Reduktion der Vitalgefühle und des allgemeinen Gesundheitszustands der Erkrankten eine bedeutende Rolle (z. B. Bobes et al. 2001). Wissenschaftliche Untersuchungen fanden in der Vergangenheit einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Symptomschwere einer Zwangsstörung und dem Ausmaß des Verlusts an Lebensqualität der Betroffenen. Sie zeigten darüber hinaus, dass auch durch erstrangige Behandlungsmethoden diese Defizite oft nur graduell oder erst langfristig gebessert werden können (Hollander et al. 2010; Koran et al. 2010; Maher et al. 2010). Diese Befunde reflektieren Probleme der gegenwärtigen Psycho- und Pharmakotherapie, die insbesondere hinsichtlich deren Akzeptanz bzw. Wirksamkeit bestehen. Hier- Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 8.2 Symptomatik und Epidemiologie der Zwangsstörung 97 durch wird die Wahrscheinlichkeit einer unzureichenden Besserung bzw. eines Wiederauftretens der Zwangssymptomatik deutlich erhöht. Vor diesem Hintergrund gab es in den letzten Jahren zahlreiche Studien, die Weiterentwicklungen, Alternativen und Ergänzungen der bestehenden Therapieoptionen zum Gegenstand hatten. Neben der Verbesserung und Erweiterung der kognitiv verhaltenstherapeutischen oder medikamentösen Behandlung sowie der Untersuchung psychochirurgischer Therapieansätze widmete sich die klinische Forschung auch ersten Projekten hinsichtlich der Wirkung aerober körperlicher Aktivität auf die Symptomatik einer Zwangsstörung. 8.2 Symptomatik und Epidemiologie der Zwangsstörung Die Zwangsstörung zeichnet sich durch das wiederholte Auftreten von Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen aus (Definition nach ICD-10). Bei einer Zwangsstörung bestehen über mindestens 2 Wochen Zwangsgedanken und/oder -handlungen, die für den Betroffenen belastend sind und zu einer Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens führen. Die Zwangssymptomatik zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Die Gedanken oder Handlungen sind für den Patienten als eigene erkennbar. yy Wenigstens einem Gedanken oder einer Handlung gegenüber wird Widerstand yy geleistet. Der Gedanke oder die Handlung wird nicht als angenehm erlebt. yy Die Gedanken oder Handlungen wiederholen sich in unangenehmer Weise. yy Zwangsgedanken sind meist unangenehme Gedanken oder Vorstellungen, die sich imperativ und gegen den Willen des Patienten aufdrängen und zu einer hohen inneren Anspannung führen. Regelmäßig werden diese Gedanken als unsinnig und ichdyston (d. h. sie entsprechen nicht den eigenen Vorstellungen oder Werten) erlebt und können in Abhängigkeit ihres Kontextes (z. B. sexualisierte oder blasphemische Inhalte) stark belastend und abstoßend sein. Überdauernd ist jedoch die Einsicht der Betroffenen vorhanden, dass es sich hierbei um eigene Gedanken handelt und diese nicht etwa von außen oder anderen eingegeben werden – wie es bei schizophrenen Störungen der Fall ist. Inhaltlich sind Zwangsgedanken stark individualisiert und können sich auf nahezu jeden Aspekt des sozialen und emotionalen (Er-)Lebens beziehen. Es gibt jedoch einige »klassische« Themen, die überdurchschnittlich häufig auftreten und oft auch zu korrespondierenden Zwangshandlungen führen (▶ Tab. 8-1). Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 8 Aerobe Bewegung bei der Zwangsstörung 98 Tab. 8-1 Häufige Zwangsgedanken und -handlungen Zwangsgedanken Zwangshandlungen Angst vor Kontamination (Schmutz, Körperflüssigkeiten, Umweltgifte) Exzessives Waschen und Reinigen, Vermeidung entsprechender Situationen Angst vor Schädigung der eigenen Person oder Dritter Wiederholte Kontrollen (Tür verschlossen? Herd abgestellt?) und Rückversicherungen (z. B. Anrufe) Exzessives Beschäftigen mit Symmetrie oder der Positionierung von (Alltags-) Gegenständen Wiederholtes Ordnen (z. B. nach Größe) und Ausrichten (z. B. in einem bestimmten Winkel) »Verbotene« Gedanken mit z. B. sexu­ellen, blasphemischen oder amoralischen Inhalten Wiederholte Überprüfung der eigenen Gedanken, Vermeidung entsprechender Situationen Angst, Dinge zu verlieren oder zu vergessen Exzessives Aufbewahren oder Sammeln von Alltagsgegenständen Zwangshandlungen zeichnen sich durch repetitive und meist stereotyp ausgeführte Verhaltensweisen aus. Diese können sowohl durch Dritte beobachtbar sein (z. B. Kontrolle der Tür, Ausrichten von Gegenständen) oder auch ausschließlich auf mentaler Ebene stattfinden (z. B. gedanklich einen bestimmten Satz wiederholen oder Gegenstände durchzählen). Häufig stellen sich Zwangshandlungen sekundär zu bzw. in Reaktion auf Zwangsgedanken ein. Es kommt ihnen die Funktion zu, die sich aufdrängenden Gedanken bzw. die assoziierte Anspannung kurzfristig zu »neutralisieren« oder die Verwirklichung der Gedanken zu verhindern (»Nur wenn ich dreimal auf Holz klopfe [Zwangshandlung], muss mein Mann nicht sterben [Zwangsgedanke]«). Analog zu den Zwangsgedanken werden die Verhaltensweisen meist als sinnlos erkannt. Da deren Unterdrückung jedoch zu einer weiteren Erhöhung der bereits vorhandenen Anspannung führt, wird der Widerstand gegen die Zwangshandlungen durch die Patienten oft zeitnah aufgegeben. Langfristig stellt sich bei den Patienten die Überzeugung ein, dass sie nur durch die Durchführung der Handlungsimpulse die Symptomatik kontrollieren und/oder Schlimmeres verhindern können. Dadurch wird aber eine Chronifizierung der Erkrankung begünstigt. Die Symptome einer Zwangsstörung sind meist sehr quälend und können aufgrund der Inhalte der Gedanken oder durch die eigene Einsicht in deren Sinnlosigkeit für die Betroffenen äußerst schambesetzt sein. Darüber hinaus wird durch ein sich regelhaft einstellendes Vermeidungsverhalten gegenüber Situationen oder Gegenständen, die als Auslöser individueller Zwangsgedanken oder -handlungen dienen können (z. B. potenziell verschmutzte Orte wie öffent- Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 12 Sporttherapie bei kognitiven Störungen 178 Kognitiver Abbau Geringe kognitive Veränderungen sind Teil des Alterns Präklinische Phase Leichte Kognitive Störung Die langfristige Kombination verschiedener Sportarten zeigt die höchsten Effektstärken für die Verbesserung der Kognition und einen präventiven Effekt bei Gesunden und bei Patienten mit leichter kognitiver Störung. leicht Demenz mittel Effekte sind stadienabhängig. Aktivitäten des täglichen Lebens, einige kognitive Funktionen und schwer die Belastung von Angehörigen kann durch Sport positiv beeinflusst werden (Reduktion der Sturzneigung). Es sind keine schwerwiegenden Nebenwirkungen zu befürchten. Lebenszeit Abb. 12-2 Sporttherapie bei Patienten mit kognitiven Störungen kann (Tortosa-Martinez u. Clow 2012). Bisher ist aber nicht geklärt, welche Sportarten beim Menschen in welcher Intensität und Dauer für die Initiierung dieser protektiven Mechanismen geeignet sind. Kirk-Sanchez et al. (2014) weisen zu Recht darauf hin, dass möglicherweise Trainingsinterventionen mit verschiedenen Sportarten im Gegensatz zu reinem Ausdauertraining erfolgversprechender sein könnten. So beansprucht zum Beispiel Tai-Chi sowohl kognitiv als auch physisch – im Gegensatz zu reinem Ausdauertraining. Bei aller Kritik an den durchgeführten Studien und Metaanalysen muss man aber festhalten, dass andere Strategien, wie etwa Veränderung der Ernährung (Nahrungsergänzung durch Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, Folsäure) oder Interventionen mit kognitiven Übungen deutlich geringere oder gar keine Effekte zeigen (Lovden et al. 2013). Die Verbesserung der körperlichen Fitness ist daher eine präventive und therapeutische Methode, die trotz aller Einschränkungen unbedingt angewendet werden sollte (▶ Abb. 12-2). 12.3.3 Die Rolle körperlicher Aktivität bei Patienten mit Demenz Wie oben dargestellt haben viele Studien in den letzten 10 Jahren untersucht, ob intensives körperliches Training die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, beeinflussen kann. Die Studienlage ist somit sehr umfangreich (Evidenzgrad Ia). Hamer und Chida (2009) schlossen 16 Studien in den systematischen Review ein (163 797 Teilnehmer ohne Demenz zu Beginn und 3 219, die im Verlauf eine Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 12.3 Einfluss von körperlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit 179 Demenz entwickelten). Das relative Risiko für die Gruppe mit hoher körper­ licher Aktivität, eine unspezifische Demenz oder Alzheimer-Demenz zu entwickeln, war signifikant reduziert, wenn diese mit der niedrigen Aktivitätsgruppe verglichen wurde. Für bereits erkrankte Patienten stellt sich die Frage, ob körperliche Aktivität den Fortgang der Erkrankung modulieren kann. Die Autoren sind sich bewusst, dass körperliche Aktivität ganz verschiedene Einflüsse hat. So werden soziale Interaktionen, Selbstwahrnehmung, allgemeine körperliche Beweglichkeit und Muskulatur oder kardiovaskuläre Fitness synchron verändert. Im Folgenden soll nur der Einfluss körperlicher Aktivität bei Patienten mit Demenz auf die Kognition, Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und Verhaltensauffälligkeiten – beispielsweise herausforderndes Verhalten oder Depressivität – dargestellt werden. Verschiedene randomisierte und kontrollierte Interventionsstudien deuten an, dass körperliches Training kognitive Leistungen bei älteren Personen auch mit Demenz noch verbessern oder zumindest den weiteren kognitiven Abbau verlangsamen könnte. Dies ist auch das Ergebnis einer Metaanalyse von Heyn et al. (2004). Die Autoren konnten eine hohe Effektstärke gemischter körperlicher Trainingsprogramme für die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei diesen Patienten zeigen. Moderate Effektstärken waren für eine kombinierte Auswertung von Kognition, Funktionsniveau und Verhalten nachweisbar. Kürzlich wurde ein Cochrane-Review zu diesem Thema von Forbes et al. (2013) vorgelegt. Hier wurden randomisierte kontrollierte Studien eingeschlossen, die ältere Menschen entweder in ein körperliches Aktivitätsprogramm oder in eine Kontrollgruppe eingeschlossen haben. Insgesamt wurden 16 Studien mit knapp 1 000 Patienten analysiert. Die Autoren beschreiben, dass die Sportprogramme der eingeschlossenen Studien leider extrem variabel waren und nicht nach Demenztyp unterschieden wurde. Dennoch geben die Autoren an, dass regelmäßige Sportprogramme die Aktivitäten des täglichen Lebens positiv beeinflussen und z. T. auch die kognitiven Funktionen verbessern können. So fand man moderate Effektstärken körperlicher Aktivität auf die Verbesserung kognitiver Funktionen. Die signifikante Verbesserung war jedoch nach Ausschluss einer Studie, die nur moderat bis schwer Demenzerkrankte untersuchte, nicht mehr signifikant. Hoch signifikant war dagegen die Wirkung auf Aktivitäten des täglichen Lebens mit moderaten Effektstärken. Kein Einfluss wurde hier auf Verhaltensauffälligkeiten gefunden. Diese umfangreiche Analyse verdeutlicht auch, dass die Wirkung von körperlicher Aktivität sehr stark vom Stadium der Demenz (leicht bis schwer) abhängt. Ein wesentliches Kriterium für eine erfolgreiche Demenzbehandlung kann auch an der Belastung von Angehörigen abgelesen werden. Die Metaanalyse weist darauf hin, dass hier ein positiver Effekt im Sinne einer Reduktion der Belastung von Angehörigen gemessen werden konnte. Die Ergebnisse spiegeln durchaus auch die Analysen von Potter et al. wider (2011), die aber nicht in verschiedene Demenzformen unterschieden hatten. Im Gegensatz dazu untersuchten Thune-Boyle et al. (2012) in einer Metaanalyse die Effekte von physischer Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 180 12 Sporttherapie bei kognitiven Störungen Aktivität auf Verhaltensauffälligkeiten. Es wurde von den Autoren beschrieben, dass körperliche Aktivität einen positiven Effekt auf gedrückte Stimmung und Agitation haben könnte und möglicherweise auch auf Schlaf und Umherwandern. Dennoch weisen die Autoren auf die unbefriedigende derzeitige Studienlage hin. Insbesondere sollte die Inhomogenität in Bezug auf den Diagnosetyp, die Schwere der Erkrankung und die Beachtung klinisch signifikanter Effekte in Zukunft verbessert werden. In einer neueren Studie von Lowery et al. (2014) aus England konnten die positiven Ergebnisse nicht bestätigt werden. Es wurden 131 Patienten mit Demenz in die Studie eingeschlossen und in zwei Gruppen eingeteilt (▶ Tab. 12-4). Die Sportgruppe wurde im häuslichen Umfeld angeleitet, für 12 Wochen 5-mal pro Woche 20–30 Minuten zu laufen, wobei die Intensität anstieg. Es wurde versucht, in der Kontrollgruppe für diese intensive Betreuung eine Kontrollbedingung einzuführen. Weiterhin waren keine vermehrten Stürze zu beobachten, sondern eher eine verbesserte Physis – wie dies auch in anderen Studien zu verzeichnen war (Pitkala et al. 2013). Von den Autoren konnte kein signifikanter Effekt auf die Kognition nachgewiesen werden. Eine Reduktion der Belastung von Angehörigen war aber darstellbar (Lowery et al. 2014). Andere Studien haben eine Kombination aus einer Balanceübung und neuropsychologischem Training (Dauer: 1 h) 3-mal pro Woche über 16 Wochen bei Patienten mit Alzheimer-Demenz eingesetzt (de Andrade et al. 2013). Ziel war es, eine bessere Körperwahrnehmungskontrolle und frontale Hirnfunktion zu erreichen. In dieser Studie konnten signifikante Verbesserungen in den entsprechenden neuropsychologischen Tests bei Alzheimer-Patienten gezeigt werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass körperliche Aktivität bei bereits erkrankten Patienten Aktivitäten des täglichen Lebens, einige kognitive Funktionen und die Belastung von Angehörigen positiv zu beeinflussen vermag. Unsicherheit besteht bei der Beeinflussung von Verhaltensauffälligkeiten. Zusätzlich sei noch angemerkt, dass manche Autoren wegen der veränderten Durchblutung des Gehirns bei Alzheimer-Patienten zu einem genauen Monitoring der kardiovaskulären Risikofaktoren raten (Eggermont et al. 2006). 12.4Praxisempfehlungen Die S3-Leitlinie Demenz (DGPPN 2009) spricht dem Behandler folgende Empfehlung aus: »Regelmäßige körperliche Bewegung und ein aktives geistiges und soziales Leben sollten empfohlen werden«. Es wird der Empfehlungsgrad B, die sogenannte »Sollte«-Empfehlung, ausgesprochen, da ein aktiver Lebensstil mit körperlicher Bewegung, sportlicher, sozialer und geistiger Aktivität als protektiv bezüglich des Auftretens einer Demenz eingeschätzt wird. Ebenso befürworten die aktuellen Empfehlungen des American College of Sports Medicine und der American Heart Association für ältere Menschen regelmäßige körperliche Aktivität in kleinen Einheiten von 10 Minuten, um eine bessere Lebensqualität zu Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 1 1Einleitung Valentin Z. Markser, Karl Jürgen Bär »Der ganze Körper lässt sich auffassen als ein Organ der Seele. ... Das Seelische wirkt durch seine Inhalte und Tendenzen, diese wirken krankmachend nur, wenn die Seele krank ist. Daher kann sich, wenn die Seele nicht in Ordnung ist, dies auch im Körperlichen zeigen.« (aus Jaspers 1973, S. 199) Wenn Karl Jaspers Recht haben sollte, dass sich die kranke Seele im Körperlichen zeigen kann, wäre auch die Umkehrung des Satzes möglich: Ein gesunder Körper kann sich auch im Seelischen zeigen. Das könnte gleichzeitig auch als Motto dieses Buches gelten. Die öffentliche Wahrnehmung von Sport als Teil eines gesunden Lebensstils hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So soll eine hohe körperliche Aktivität mit einer besseren Gesundheit, einer erhöhten körperlichen Attraktivität und einem längeren Leben einhergehen. Ebenso hat in vielen medizinischen Disziplinen ein Umdenken stattgefunden. Während man früher Patienten nach Herzinfarkt Schonung verordnete, weiß man heute, dass die Patienten sehr schnell wieder körperlich aktiv werden müssen. Diese Entwicklung in der soma- Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 2 1 Einleitung tischen Medizin hat auch die psychiatrische Versorgung von Patienten beeinflusst. Schon vor 20 Jahren wurden mehr als 200 unterschiedliche bewegungsund körperorientierte Therapietechniken gezählt. Auch heute fasst man unter Bewegungstherapie in den meisten Einrichtungen so unterschiedliche Verfahren wie Sporttherapie, Physiotherapie, Gymnastik, Walking, Krafttraining, verschiedene Ballsportarten, Entspannungsverfahren oder Körperpsychotherapie zusammen. Oft werden als Bewegungstherapie auch Tanztherapie, Mototherapie, Bewegungspsychotherapie, Wassergymnastik, Rückengymnastik, Lauftherapie oder allgemeine sportliche Aktivitäten angeboten. Die Ziele sind meist krankheitsunspezifisch – wie die Verbesserung der Kondition, der Körperwahrnehmung oder eine allgemeine Anregung zu erhöhter Aktivität. Nicht nur für die Patienten, sondern auch für die behandelnden Psychiater und Psychotherapeuten ist es oft schwierig, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten im Bereich der körperorientierten Therapieverfahren auseinanderzuhalten. Entsprechend problematisch ist es auch, die richtige Indikation zu stellen und das Potenzial der jeweiligen Methode auszuschöpfen. Hinzu kommt, dass neue Methoden und Ausbildungszweige entstehen und sich die Indikationen für bestehende Verfahren rasch ändern. So hält Hölter (2000, S. 1) fest: »Viele Verfahren unterscheiden sich stark in dem Versuch einer wissenschaftstheoretischen Begründung und schließen sich gegenseitig eher aus, als nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Zudem spielen auch berufspolitische Überlegungen einzelner Schulen auf dem Ausbildungs- und Therapiemarkt eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines unübersichtlichen Angebots.« Ein weiteres Problem der begrifflichen Unschärfe entsteht an der Schnittstelle zum Gesundheitssystem. Hier sind Therapieverfahren mit klarer Indikation und Kontraindikation die notwendige Voraussetzung für eine patientenorientierte Anwendung. Unschärfe entsteht aber nicht erst bei der Anwendung der Verfahren, sondern bereits bei der Definition. Wann spricht man von körperlicher Aktivität und was unterscheidet sie von exercise oder von Sport? Unter dem Begriff »körperliche Aktivität« werden heute alle Bewegungen verstanden, die durch den Einsatz größerer Muskelgruppen eine Erhöhung des Energieverbrauchs zur Folge haben (U. S. Department of Health and Human Services 1996; Fuchs u. Schlicht 2012, S. 3). Dabei wird zunächst nicht zwischen Sportarten oder Freizeitbeschäftigungen wie Gartenarbeit unterschieden. Schwieriger wird es mit dem Begriff »exercise«. In den angelsächsischen Ländern wurde damit die geplante und wiederholte Aktivität mit dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung der körperlichen Fitness beschrieben. Da körperliche Fitness nicht in jedem Fall mit Gesundheit gleichgesetzt werden kann, wurde anfänglich noch empfohlen, zwischen exercise mit dem Ziel der sportlichen Leistung auf der einen Seite und exercise zum Erhalten von Gesundheit auf der anderen zu unterscheiden. Die begrifflichen Schwierigkeiten sind im deutschen Sprachraum nicht geringer. Das Wort Sport wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus England übernommen und bedeutete eine spezifische Form der regelmäßigen körperlichen Betätigung, die sich zunehmend durch das Leistungsprinzip, Konkurrenzkampf und Re- Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH 1 Einleitung 3 kordprinzip auszeichnete (Bohus 1986, S. 126). Bis dahin kannte man vor allem das Turnen und die Gymnastik als Leibesübungen. Die Ausbreitung des Sports ging parallel mit der rasanten Entwicklung der Industrialisierung in den europäischen Ländern und erfasste schnell alle Lebensbereiche und sozialen Schichten. Die zunehmende Leistungsorientierung führte zu einer weiteren Unterscheidung – körperliche Aktivität als Gesundheitssport einerseits und leistungsorientierte körperliche Aktivität andererseits. Vor allem die neueren Entwicklungen des Breiten- und Freizeitsports machen deutlich, dass die Gleichsetzung des Sports mit der Gesundheit nicht mehr unkritisch aufrechterhalten werden kann. Dabei ist es unerheblich, ob der Leistungssport im Profi- oder im Amateurbereich betrieben wird, weil im Leistungssport nicht die Gesundheit, sondern primär die Leistung das Ziel der körperlichen Aktivitäten ist. Neben dem präventiven Ansatz zur Verbesserung der medizinischen Fitness wurden Sport und Bewegung zunehmend systematisch auch zu therapeutischen Zwecken genutzt. Sporttherapie wurde ab 1970 zuerst im Zusammenhang mit der Arbeit mit schwererziehbaren Kindern und Jugendlichen und später in der Rehabilitation von Herzinfarktpatienten angewendet. In der Folge definierte der Deutsche Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie (DVGS 2014) (http:// www.dvgs.de/verband/sport-bewegungstherapie/definition.html) die Sport- und Bewegungstherapie als eine »ärztlich indizierte und verordnete Bewegung mit verhaltensorientierten Komponenten, die vom Therapeuten geplant, dosiert, gemeinsam mit dem Arzt kontrolliert und mit dem Patienten alleine oder in der Gruppe durchgeführt wird. Sie will mit geeigneten Mitteln des Sports, der Bewegung und der Verhaltensorientierung bei vorliegenden Schädigungen gestörte physische, psychische und psychosoziale (Alltag, Freizeit und Beruf betreffende) Beeinträchtigungen rehabilitieren bzw. Schädigungen und Risikofaktoren vorbeugen«. Folgerichtig sind die Sport- und Bewegungstherapie sowie sport­ therapeutische Verfahren in die S3-Leitlinie »Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen« der Deutschen Gesellschaft für Psy­ chiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde aufgenommen worden (DGPPN; Falkai 2013). Die Definition des DVGS wird im Bereich des sportpsychologischen und sportwissenschaftlichen Gesundheitssports – vor allem in Bezug auf die Indikation und Verordnung – sehr unterschiedlich und mittlerweile auch sehr frei interpretiert. Als Aufgaben der Sport- und Bewegungstherapie werden sowohl trainingsgebundene körperliche Aktivitäten und damit einhergehende seelische Veränderungen als auch psychosoziale und pädagogische Ziele als Erweiterung der Indikation vertreten. Während einige Autoren noch systematisches körperliches Funktionstraining und Anpassungsprozesse beschreiben (Stoll u. Ziemainz 2012), formuliert Schüle (Schüle u. Huber 2012, S. 3): »Sporttherapie wird auch als ein mehrdimensionales Vorgehen betrachtet, welches sowohl funktionelle als auch psychosoziale und pädagogische Ziele verwirklicht. Die Mehrdimensionalität impliziert auch eine Abkehr von dem in der Vergangenheit dominierenden Trainingsparadigma, bei dem allein der körperlichen Aktivität, die idealtypisch Markser, Bär: Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen. ISBN: 978-3-7945-2993-3. © Schattauer GmbH