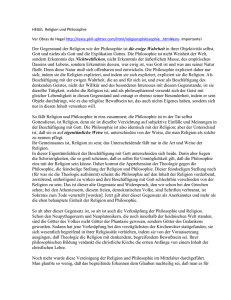Untitled - Widerspruch - Münchner Zeitschrift für Philosophie
Werbung

Widerspruch Problem Bildung „Der Mensch ist, was er sein soll, nur durch Bildung“ Hegel „We don’t need no education. We don’t need no thought control“ Pink Floyd Editorial Thema 7 Was ist - „Bildung“ heute? Oliver v. Criegern / Sibylle Weicker / Alexander v. Pechmann Drei Positionen zur bildungspolitischen Diskussion 9 Artikel Ursula Reitemeyer Bildung - ein Projekt ohne Aussicht? 24 Alexander von Pechmann Philosophie - Erzieherin der Menschheit ? 34 Bücher zum Thema 38 Hartmut von Hentig: Kreativität. Jadwiga Adamiak 4 Hartmut von Hentig: Bildung. Ein Essay. Sibylle Weicker 39 Dieter Lenzen/ Niklas Luhmann (Hg.): Bildung und Weiterbildung im Erziehungssystem. Ignaz Knips 39 Eva Ruge: Sinndimensionen ästhetischer Erfahrung. María Isabel Peña Aguado 46 Bericht Jürgen Mittelstraß: Brauchen wir einen neuen Bildungsbegriff? Ignaz Knips 51 Artikel Clemens K. Stepina Die Begriffe ‚Herrschaft‚ und ‚Knechtschaft‚ in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Karl Marx 54 Rezensionen Martin Schraven Vom Siechtum der deutschen Philosophie 70 Manuel Knoll Anmerkungen zum ‘Magister Philosophiae’ der philosophischen Institute in München 82 Aristoteles: Organon Band 1. Georgios Karageorgoudis 90 Martin Bondeli: Der Kantianismus des jungen Hegel. Alexander v. Pechmann 94 Norbert Brieskorn: Menschenrechte. Wolfgang Habermeyer 96 Manfred Faßler: Was ist Kommunikation? Matthias Groll 98 Geronimo: Glut und Asche. Jonas Dörge Weidemann 100 Thomas Lemke: Eine Kritik der politischen Vernunft. Alexander v. Pechmann 103 Hans Joas: Die Entstehung der Werte. Wolfgang Habermeyer 106 Ulrich Kohlmann: Dialektik der Moral. Manuel Knoll 110 Rainer Rotermundt: Plädoyer für eine Erneuerung der Geschichtsphilosophie. Reinhard Jellen 113 Nietzsche. Ausgewählt und vorgestellt von Rüdiger Safranski. Konrad Lotter 117 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Wolfgang Thorwart. 119 Annegret Stopczyk: Sophias Leib. Gesina Stärz 123 Berichte Anhang Trüffel, Schweine und Brainscanning Die Wirklichkeit des Konstruktivismus II. Gesina Stärz 126 To enlarge the audience - Richard Rorty in München. Alexander v. Pechmann 130 Philosoph kämpft um seine Wiedereinstellung 132 Berichtigung 133 Autoren 134 Impressum 135 Editorial Liebe Leserin, lieber Leser. Seit Beginn dieses Jahres erscheint die Zeitschrift wieder im WiderspruchVerlag. Unsere dreijährige Zusammenarbeit mit dem Attempto-Verlag ist damit beendet. Wir benutzen diese Gelegenheit, bisherige Schwächen zu beseitigen und unsere Stärken auszubauen. Noch mehr als bisher wollen wir die Philosophiezeitschrift sein, in der und mit der professionelle Philosophen, Philosophiestudenten und Philosophieinteressierte schreiben und kommunizieren. Deswegen werden einiges verändern. Die bisherige Schwerpunktsetzung des Heftes bleibt zwar erhalten, doch werden wir ihm nur noch drei Artikel und die Rezension wichtiger Bücher zum Thema widmen. Um flexibler und vielseitiger auf aktuelle Themen und interessante Veröffentlichungen und Beiträge eingehen zu können, werden wir auch Beiträge veröffentlichen, die auf aktuelle Diskussionen Bezug nehmen, oder die der Redaktion anderweitig als interessant und publikationswürdig erscheinen. Mehr als bisher wird die Redaktion auf die Straffung und die gedankliche Zuspitzung der Beiträge achten. Ein großer Mangel in der philosophischen Diskussion ist, daß die Rezensionen von Neuerscheinungen oft mehrere Jahre auf sich warten lassen. Dem wollen wir entgegenwirken, indem wir unsere Rubrik „philosophische Neuerscheinungen” wesentlich erweitern und die Rezensionen möglichst aktuell erscheinen lassen. Die besprochenen Bücher sollen längstens ein Jahr veröffentlicht sein. Im Laufe eines Jahres werden damit mindestens 40 Neuerscheinungen im Widerspruch rezensiert sein. Des weiteren wollen wir den lokalen Bezug des Widerspruch wieder mehr hervorheben. Es sollen Beiträge und Diskussionen aus der „Münchner Philosophie“ veröffentlicht werden, die von lokalem und von allgemeinem Interesse sind. Deshalb werden wir den Widerspruch in „Münchner Zeitschrift für Philosophie“ rückbenennen. Wir streben an, die Erscheinungsweise der Hefte zu ändern. Nicht nur die Bindung der Nummern an ein Schwerpunktthema, sondern auch der halbjährliche Turnus haben behindert, daß der Widerspruch zu einem lebendigen „Forum der Diskussion“ werden konnte. Die Replik auf einen Beitrag ein halbes Jahr später und in einem anderen thematischen Kontext bildet 8 Editorial keinen Diskussionszusammenhang. Wir werden uns daher bemühen, den Widerspruch dreimal im Jahr erscheinen zu lassen. Eine weitere Veränderung betrifft den Preis. 18.- DM für das Einzelheft wurde von vielen möglichen Lesern, insbesondere Studierenden, nicht akzeptiert, so daß der Absatz seit dieser Preiserhöhung rückläufig war. Wir haben wir uns daher entschlossen, den Preis pro Einzelheft auf 12.- DM (Abo: 11.- DM) herabzusetzen. Uns erscheint dieser ungewöhnliche Schritt möglich, weil wir in Zukunft zur Herstellung ein preisgünstigeres Druckverfahren wählen und den Umfang der Hefte auf ca. 120 Seiten beschränken werden. Gleichzeitig wenden wir uns an Interessierte, den Widerspruch als einen aktuellen und auflagenstarken Anzeigenträger im Bereich der Philosophie zu nutzen. Abschließend wenden wir uns mit einer Bitte an die Abonnenten und die Leser des Widerspruch. Die neuen Kommunikationsmittel machen den Austausch der Informationen leichter. Das Internet bietet uns eine weitere Möglichkeit, das Widerspruch-Projekt in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unter http://www.widerspruch.com haben wir eine - wie wir meinen, gelungene – Homepage eingerichtet, auf der wir auch die Planung der Themen der künftigen Hefte mitteilen. Das Internet bietet aber umgekehrt auch die Möglichkeit, per e-mail die Formen der Mitarbeit an der Zeitschrift zu erweitern. Wir laden daher unsere Leser ein, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Teilen Sie uns Ihre Kritik und Ihre Anregungen zu Themen und Beiträgen für die künftigen Hefte unter unserer Adresse :info@widerspruch. mit! Insbesondere sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns aus Ihrem Arbeitsgebiet auf relevante Neuerscheinungen in der Philosophie hinweisen. Darüber hinaus ist die Redaktion an der Erweiterung des Kreises der Mitarbeiter interessiert. Falls Sie die Möglichkeit sehen, durch Artikel, Rezensionen oder Berichte zur inhaltlichen Gestaltung des Widerspruchs beizutragen, teilen Sie uns bitte ihre Bereitschaft mit. In diesem Fall senden wir Ihnen gerne die Liste der Themen und der geplanten Buchbesprechungen zu. Die Redaktion Was ist „Bildung“ heute? Drei Positionen zur bildungspolitischen Diskussion Vorbemerkung Die Zeit der bundesweiten Hochschulstreiks und Studentendemonstrationen ist vorbei. Im Rückblick ist leicht zu verstehen, was diese Unruhe der Universitäten verursacht hat: die unzureichende finanziell-materielle Ausstattung der Hochschulen, die fehlenden Perspektiven für viele Studenten am Arbeitsmarkt sowie die bildungspolitischen Pläne, den Bildungsbereich dem „Wirtschaftsstandort Deutschland“ anzupassen. Die Gründe für das klanglose Ende dieses Protestes aufzufinden, ist weit schwieriger. Sicher waren dafür die mangelnde Klarheit der Forderungen auf Seiten der Protestierenden sowie die Unbeweglichkeit der Politiker und Kultusbürokraten verantwortlich. Darüber hinaus zeigte der Protest aber auch eine tiefe Verunsicherung darüber, was heute denn überhaupt unter „Bildung“ zu verstehen sei. Es mag sein, daß diese Unsicherheit, wie mancher Ex-Aktivist so beredt beklagt hat, aus der Theorielosigkeit der heutigen Studierenden herrührt. Doch warum sollten die Studenten klüger als die Gesellschaft sein? Wir meinen, daß die Verunsicherung über das, was „Bildung“ heute heißt, kein bloß bildungs- und hochschulpolitisches Phänomen ist, sondern die geistig-politische Situation in Deutschland betrifft. Das stille Scheitern der Hochschulbewegung weist auf Grundsatzprobleme hin. Von Seiten der „beobachtenden“ Sozialwissenschaften, insbesondere von Niklas Luhmann, ist seit langem darauf verwiesen worden, daß in das Bildungs- und Erziehungssystem im Grunde zwei verschiedene und verschieden begründete Zielvorstellungen eingehen: die eine manifestiere sich in einem Feld zielgerichtet qualifizierender Beeinflussungen, die andere in einem breiteren Feld der Persönlichkeitsentwicklung. Die auf Ausbildung gerichtete Erziehung, so Luhmann, sei eine Zumutung, die auf die Persönlichkeit bezogene Bildung ein Angebot. Und ebenso ist von dieser 10 Zum Thema Seite seit längerem angemahnt worden, daß diese beiden Ziele, Ausbildung und Bildung, in der Gefahr stehen, sich nicht mehr wechselseitig vermitteln zu können, sondern sich gegenseitig zu behindern, und daß dieser Zielkonflikt zur Krise und zum Stillstand des Bildungssystems führen könne.1 Im folgenden nehmen wir diese Beschreibung des Bildungssystems zwar auf, aber wir wollen dessen Krise nicht dadurch erklären, daß eine, die beiden Ziele Bildung und Ausbildung vermittelnde Konzeption fehlt, sondern daß sich in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion mehrere Bildungskonzeptionen finden, deren Begründungen und Orientierungen verschieden sind, und die ihre je eigene Tradition, Legitimität und Überzeugungskraft haben. Hierbei nehmen wir Bezug auch auf Diskussionen in unserer Redaktion, die uns gezeigt haben, daß die Frontstellungen nicht nach dem Muster „Klarheit gegen Unklarheit“ verlaufen, sondern daß die jeweilige Position durchaus auf einem Wissen dessen gründet, was „Bildung“ sei. Diese, nicht auf dem Mangel, sondern auf der Pluralität der Konzepte gegründete Situation ist es, die unseres Erachtens die bildungspolitische Unsicherheit und handlungslähmende Orientierungslosigkeit erzeugt. Die folgenden drei Beiträge stellen, gleichsam idealtypisch, drei Konzeptionen von „Bildung“ vor. Der erste ist ein Plädoyer für die Bildung als Selbstzweck; der anschließende Beitrag begreift die Bildungs- und Ausbildungsprozesse als Mittel, die der Emanzipation des Menschen dienen; und der dritte schließlich bringt Argumente, Bildung als eine pragmatische Veranstaltung zu verstehen. Da die Artikel nicht nur inhaltlich, sondern auch der argumentativen Form nach mehr oder weniger die Auffassung und Überzeugung der Autoren zum Ausdruck bringen, haben wir darauf verzichtet, sie einander methodisch „anzugleichen“. Siehe: Dieter Lenzen/Niklas Luhmann (Hg.), Bildung und Weiterbildung im Erziehungssystem, Frankfurt/Main 1997; sowie die Rezension von I. Knips in diesem Heft. 1 Oliver von Criegern Menschenbildung Die Frage nach dem Wesen des Menschen, seinem Werte und dem Sinn und Zweck seines Daseins beschäftigte die Philosophie seit der Antike. Eine jede Anthropologie, die auf solche Fragen Antworten zu geben versucht, definiert notwendig allgemeine Wesenseigenschaften des Menschen, die von der Empirie weitgehend unabhängig sind: etwa eine Würde, die jedem Menschen naturgemäß zukommt, unabhängig von seinem wie auch immer würdelosen Verhalten, den Zweck seines Strebens, mag er auch, dem Augenscheine nach, etwas ganz anderes erstreben, und das, was ihm not tut, auch wenn er selbst von dieser Not nie etwas geahnt hat. Über die Befindlichkeit des Menschen wird etwas empirisch nicht nachweisbares ausgesagt, und eben dadurch wird eine Deutung der empirisch vorfindlichen Menschen und ihres Verhältnisses zur Welt möglich. Dieses Schema, welches sich nicht nur von der „Höhle“ Platons bis zum „falschen Bewußtsein“ der Frankfurter Schule durch die Philosophiegeschichte zieht, sondern auch unserer Verfassung und all unseren Vorstellungen von Menschenwürde und Menschenrechten zu Grunde liegt, ist, bei all seiner Fragwürdigkeit, unausweichlich für jeden Versuch, das angemessene Verhalten des Menschen wie auch dem Menschen gegenüber verbindlich und im Allgemeinen zu bestimmen. Eine solche Bestimmung aber kann auch dem Staate nicht gleichgültig sein, wofern er sich nicht als Selbtzweck versteht, sondern als eine Einrichtung um des Menschen willen, die dem Menschen gerecht werden soll. Der Begriff der Bildung in seiner emphatischen, idealistisch geprägten Form versteht so den Menschen als ein vernünftiges und freies Wesen; doch diese Vernunft und diese Freiheit sind nicht eine ohne Weiteres gegebene Tatsache, sondern etwas, was günstiger Umstände zu seiner Entfaltung bedarf. Dieser Begriff des Menschen setzt sich selbst in einen Gegensatz zur vorfindlichen Wirklichkeit; doch er wird durch diesen Gegensatz nicht widerlegt, sondern gewinnt daraus die Kraft, die Wirk- 12 Zum Thema lichkeit zu verändern: eben dadurch erweist er sich als normativ. Die Veranlagung des Menschen zur Vernunft gebietet, sie herauszubilden. Wegen der Vernunft ist der Mensch Zweck seiner selbst und zur Freiheit bestimmt, und nur durch vernunftgeleitetes Handeln kann er diese Freiheit erreichen. Nicht nur muß er, um mit sich selbst als Vernunftwesen übereinzustimmen, seine verschiedenen Neigungen, Auffassungen, die disparaten Züge seines Charakters etc. zu einer organischen Ganzheit vereinigen, sondern auch um in Übereinstimmung mit sich selbst handeln zu können, die Welt als eine Einheit begreifen, in der alles Einzelne in einem Verhältnis zum Ganzen steht, und sich selbst darin wiederfinden , um sich in freier Einsicht zu seinen Handlungen zu bestimmen. Freie Selbstbestimmung kann sich weder in Ignoranz gegenüber der Wirklichkeit vollziehen, gleichsam in einem absoluten Jenseits, noch auf die Ritzen und Winkel sich beschränken, die von den Notwendigkeiten des Lebens noch nicht verstellt sind (gemäß dem Worte, frei sein heiße, nicht an der Leine zu zerren), sondern ihr Raum ist die gesamte Wirklichkeit, in der wir handeln. Diese Wirklichkeit freilich kennen wir am Anfang noch genau so wenig, als uns selbst; so muß mit der Entwicklung der Fähigkeiten, die um des Handelns willen erworben werden, die Weltund Selbsterkenntnis einhergehen und schritthalten, durch die allein die freie Entscheidung für eine Handlung möglich ist. Diese Entfaltung des menschlichen Wesens als einer organischen Einheit konnte, nach Humboldts Überzeugung, durch Zwang und Beschränkung nur behindert werden, selbst durch einen Zwang, der pädagogische Ziele verfolgt. Die Bildung sollte ganz der Spontaneität des sich bildenden Menschen überlassen bleiben, welche der Staat nicht beeinflussen, sondern ihr lediglich den Raum schaffen sollte, in dem sie möglich ist. Nicht allein konnte dieses Bildungsprojekt öffentlich die Selbstzweckhaftigkeit für sich in Anspruch nehmen, die man dem Menschen zusprach, sondern es setzte auch voraus, daß der Mensch naturgemäß in sich den Trieb zur Bildung hat, daß er danach strebt, besser, vollkommener und ganz er selbst zu werden, und daß, wer sich selbst hat bilden können, notwendig auch die Gesellschaft und die Menschheit bereichern werde. Doch bereits Nietzsche stellte fest, wie wenig sich diese hohen Ansprüche und Verheißungen erfüllt hatten. Die Bildung, auf die seine Zeit sich Bildung 13 so viel zu Gute hielt, sei zu einem bloßen Wissen um die Bildung verkommen, die „Innerlichkeit“ der Gebildeten stehe in eklatantem Gegensatz zur Barbarei ihres wirklichen Lebens. Wo das Wissen um das, was einmal war, die Geschichte, die der Mensch deutend sich aneignet, ihn fähig machen sollte, die Gegenwart zu beurteilen und in ihr zu leben, ohne sich ihr zu unterwerfen und anzugleichen, neutralisiert das in großen Mengen ohne Bedürfnis angelernte Wissen seinen Gegenstand zum toten, bedeutungslosen Faktum. An Stelle der Utopie, dessen, was sein könnte, tritt die nackte Banalität dessen, was ist, und eben weil es ist, auch so sein muß, wie es ist. Die Unfähigkeit des Verbildeten, seine Welt zu deuten führt so zur Resignation jedes Anspruches des Lebens gegenüber der Realität, oder zu deren verzweifelt optimistischer Affirmation, dem „Götzendienst des Tatsächlichen“ (Nietzsche). Bildung, nicht länger fähig, auf ein allumfassendes Ganzes zu verweisen, auf dessen Hintergrund die Wirklichkeit zu verstehen wäre, wird zum Instrumentarium, all das in die immer schon vorgegebene Wirklichkeit zu integrieren, was einmal den Blick und das Streben darüber hinaus hätte ermöglichen können, zu einem diabolischen Integrationsapparat, der allem und jedem den Anspruch und die Kraft, den Menschen, sein Leben und die Welt zu verändern, also eben Anspruch und Kraft der Bildung, vernichtet. Was einmal ihr Anliegen war, wird in die Sphäre des Unseriösen verbannt: Ein „bewußtes Leben“ beschränkt sich heute oft auf den Verzehr von Naturkost, „Selbstverwirklichung“ auf die Töpferwerkstatt im Keller. Daher vermag auch die so gescheiterte Bildung ihren Anspruch auf Selbstzweckhaftigkeit öffentlich nicht aufrecht zu erhalten, und die, dem Anspruch von Bildung im Grunde so fremde, Frage nach deren Zweckmäßigkeit behält ihr Recht. Indem aber Bildung, zur Selbsterhaltung, sich äußeren Zwecken verschreibt, besiegelt sie ihre Abschaffung. Der Begriff, dessen Unerfülltheit ihn zu einem utopischen und schließlich auch durch kein Menschenbild mehr gerechtfertigten hat werden lassen, bestimmt sich neu im Sinne des Sozialdarwinismus, als der wahren Anthropologie unserer Zeit. Die Funktion der Bildung ist danach, den Menschen fähig zu machen, sich im Kampf um das Dasein, und das heißt vor allem, im Berufsleben, zu behaupten und voranzubringen. Andere Funktionen, wie die der Ver- 14 Zum Thema mittlung von Werten, die man der Bildung oft noch zuschreibt, zur Stabilisierung des Staates und weil man einen neuen Faschismus gerne vermeiden möchte, bleiben vollkommen wirkungslos. Werte kann man nicht vermitteln, dazu sind wir heute alle zu aufgeklärt, um nicht die pädagogische Verlogenheit all solcher Wertvermittlung intuitiv zu durchschauen; doch Werte vermitteln sich selbst, wo ihnen objektive Kraft und Bedeutung zukommt. Man darf sich nicht darüber täuschen, welche Werte heute solch eine Bedeutung haben: gerade die Bildungsdebatte zeigt, daß diejenigen Unterschiede zwischen den Menschen, auf die es auch bildungspolitisch mehr und mehr ankommt, nach darwinistischen Kriterien bemessen werden, nach eben jener Lebenstüchtigkeit, die so wohl als Inbegriff dessen gilt, wozu ein Mensch sich zu bilden hat, als sie auch staatlich, als Standortsicherung, das unbedingt Notwendige ist, dem sich alles andere zu fügen hat. Wo aber das philosophische Denken sich des Abgrundes seiner faktischen Belanglosigkeit bewußt geworden ist, wird es möglich, daß der Bildungsgedanke aufhört, Bildungsgut zu sein, und zur lebendigen Hoffnung wird, es könne Vernunft doch in irgend einer Weise gerechtfertigt sein. An ihm wäre es, diese Hoffnung in einem Bildungsbegriff aufrecht zu erhalten, der sich, im vollen Bewußtsein seiner Unwirklichkeit, noch nicht den Möglichkeiten seiner Verwirklichung geopfert hat. Bildung Sibylle Weicker 15 Eine bessere Gesellschaft durch Bildung In der Zeit nach dem Faschismus dominierte in Deutschland zunächst die geisteswissenschaftliche Pädagogik (Nohl, Spranger, Flitner, Litt, Weniger), in der die Bildung zum zentralen Begriff erhoben wurde und das Problem des Erhalts und der Tradierung von Bildungsgütern, gehalten und -werten im Mittelpunkt der Erziehung stand. Hier diente Bildung vor allem der Erhaltung der Kultur und wies über das Bestehende nicht hinaus. So sah die Pädagogik ihre Hauptaufgabe darin, die Form und den Geist der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung auf zukünftige Generationen weiterzutragen. In den 60er Jahren wurde allerdings der Gegensatz zwischen den Intentionen des Grundgesetzes, den demokratischen und individuellen Rechten, und der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die noch weitgehend autoritär und hierarchisch strukturiert war, immer deutlicher und führte schließlich zur außerparlamentarischen Opposition und den Studentenprotesten, die für die grundlegende Neuorientierung der Bildungsinhalte und des Bildungssystems mitbestimmend wurden. Das zunächst von der „Frankfurter Schule“ (Adorno, Habermas) artikulierte und geschärfte Bewußtsein für die fremdbestimmenden Mechanismen einer Gesellschaft, die nur dem Namen nach als „Demokratie“ bezeichnet werden konnte, deren Strukturen jedoch mit diesem Anspruch nicht übereinstimmten, war in der deutschen Nachkriegszeit zum Auslöser einer „emanzipatorischen“ Bildungskonzeption, deren oberste Ziele mit den Begriffen „Selbstbestimmung“ bzw. „Mündigkeit“ und „Chancengleichheit“ beschrieben werden können. Hauptanliegen emanzipatorischer Bildung ist das Herausführen des Individuums aus dem Zustand der Unmündigkeit in Richtung auf mehr Freiheit. Fremdbestimmende Mechanismen, die den Einzelnen daran hindern, seine Rechte und unverfälschten Interessen wahrzunehmen, sollen transparent gemacht und durch die Änderung der sie verursa- 16 Zum Thema chenden gesellschaftlichen Verhältnisse abgebaut werden. „Ein derart emanzipatorischer Begriff von Erziehung“, schrieb der Pädagoge K. Mollenhauer 1971, „ist ... im Sinne des gegebenen sozialen Systems disfunktional. Er markiert einen gesellschaftlichen Konflikt. Der Pädagogik als Praxis wie als Theorie 'fällt' die Aufgabe zu, in der heranwachsenden Generation das Potential gesellschaftlicher Veränderungen hervorzubringen.“1 Alle gesellschaftlichen Strukturen müssen der Kritik unterzogen werden; kritisches Bewußtsein und Ich-Stärke sind wesentliche Bestandteile emanzipatorischer Bildung. Das Ziel einer derartigen Bildungskonzeption ist die permanente Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, um im Rückgriff auf das demokratische Regelsystem eine fortschreitende Demokratisierung zu erreichen, die die Widersprüche zwischen der Verfassung und der gesellschaftlichen Wirklichkeit aufzuheben bzw. zu verringern vermag. Zwar ist das Wort „Emanzipation“ im Zusammenhang mit Bildung relativ neuen Ursprungs, - die Grundgedanken dieser Konzeption reichen jedoch direkt auf die Ideen der Aufklärung und die Ideale der französischen Revolution zurück. So formulierte Kant 1784, prägnant und klar im Hinblick auf die Selbstbestimmung des Denkens: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“2 - Ebenso deutlich erkennt man die politische Dimension einer Erziehung zur Mündigkeit, die aus dem Plan zur Reorganisation der französischen Schulen hervorging, der vom Marquis de Condorcet 1792 der Nationalversammlung in Paris vorgelegt wurde: „jedem die Möglichkeit zu sichern, ... sich für gesellschaftliche Funktionen vorzubereiten, zu diesen berufen zu werden er berechtigt ist, den ganzen Umfang seiner Talente, die er von der Natur empfangen hat, zu entfalten und dadurch unter den Bürgern eine tatsächliche Gleichheit herzustellen und die politische Gleichheit, die das Gesetz als berechtigt 1 2 K. Mollenhauer, Erziehung und Emanzipation, München 1971, S. 67. I. Kant, Was ist Aufklärung? Gesammelte Werke Bd. VIII, Berlin 1968, S. 35. Bildung 17 anerkannt hat, zu einer wirklichen zu machen: dies muß das erste Ziel eines nationalen Unterrichtswesens sein.“3 So sind es denn die Forderungen der bürgerlichen Revolution von 1789 nach „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, die die Vertreter einer emanzipatorischen Bildungskonzeption antreibt, um die noch „unvollendete Moderne“ zu vollenden. Alle Mitglieder einer Gesellschaft sollen gleichermaßen an den Errungenschaften der Moderne teilhaben. Bildung wird dabei als das Hauptmittel angesehen, das die Menschen dazu befähigt, sowohl frei und selbstbestimmt zu handeln wie auch die Mechanismen zu erkennen, die dies verhindern und zu ihrer Beseitigung beizutragen. Bildung als Selbstzweck des Einzelnen zur Vervollkomnung seiner selbst wird damit aufgegeben zugunsten einer politischen Konzeption von Bildung, die im Dienste einer Verbesserung und Veränderung der Gesellschaft im Hinblick auf mehr Freiheit insbesondere für die Unterprivilegierten und Schwachen steht. Wie sehr diese Konzeption der bildungspolitische common sense in der Bundesrepublik war, zeigt der Bildungsplan der Bundesregierung 1970: „Der Verfassungsgrundsatz der Chancengleichheit muß durch eine intensive und individuelle Förderung aller Lernenden in allen Stufen des Bildungssystems verwirklicht werden. Bildung soll den Menschen befähigen, sein Leben selbst zu gestalten. Sie soll durch Lernen und Erleben demokratischer Werte eine dauerhafte Grundlage für freiheitliches Zusammenleben schaffen und Freude an selbständig-schöpferischer Arbeit wecken.“4 Die Bundesregierung reagierte mit diesen Forderungen auf statistische Untersuchungen, die gezeigt hatten, daß große Gruppen der Bevölkerung lediglich auf der untersten Stufe des Bildungssystems zu finden waren. Besonders Mädchen und Arbeiter waren in mittleren und höheren Ausbildungsgängen unterrepräsentiert. Auch das Gefälle von Stadt- und Landkindern zeigte große Unterschiede hinsichtlich ihres Marquis de Condorcet, Bericht und Entwurf einer Verordnung über die allgemeine Organisation des öffentlichen Schulwesens, Weinheim 1966, S.20. 4 Bildungsbericht '70. Bericht der Bundesregierung zur Bildungspoltik, Bonn 1970, S.9. 3 18 Zum Thema Bildungsgrades auf.5 Diese Tatsachen standen in Widerspruch zu den Grundgesetzartikeln 2 und 3, nach denen jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat und niemand wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder seines Glaubens benachteiligt werden darf. Um Demokratie und Selbstbestimmung im Sinne einer emanzipatorischen Bildung einüben zu können, sollte das Bildungssystem von überkommenen Abhängigkeiten und autoritären Strukturen befreit werden. So wurde insbesondere in den Schulen und Hochschulen ein repressionsarmer Freiraum geschaffen, in dem im „herrschaftsfreien Diskurs“ auf argumentativem Wege in Konfliktsituationen ein Konsens hergestellt werden sollte. Dennoch gelang es selbst im schulischen Bereich nicht, auf Sanktionen und Regulierungen gänzlich zu verzichten. Im Rückblick läßt sich feststellen, daß sowohl hinsichtlich des Abbaus von Ungleichheiten wie auch bei der Einführung und Einübung demokratischer und selbstbestimmter Verhaltenweisen zumindest Teilerfolge erreicht worden sind. So haben Mädchen auf allen Gebieten ihre Unterrepräsentation im Bildungssystem aufgeholt; Arbeiterkindern ist dies nicht im selben Ausmaß gelungen. Autoritäre Stukturen in den Schulen sind weitgehend verschwunden: Lehrer und Schüler haben meist einen verständnisvollen Umgang miteinander. Die Hoffnung der Initiatoren des emanzipatorischen Bildungskonzeptes, eine Veränderung der gesamten Gesellschaft durch eine Veränderung im Bildungssystem zu erreichen, hat sich jedoch bisher nicht erfüllt. Zwar forderten radikale Vertreter von Anfang an, eine emanzipatorische Erziehung müsse im aktiven Kampf gegen die spätkapitalistischen Produktionsverhältnisse und die daraus resultierenden fremdbestimmenden Mechanismen münden.6 Aus ihnen spricht das deutliche Bewußtsein über die enge Verflechtung von Wirtschaft, Politik und Bildung in der Gesellschaft. Dennoch wurde auch von ihnen nicht hinreichend klar Vgl. S. Grimm, Soziologie der Bildung und Erziehung, München 1987; bes. S.1724. 6 Vertreter dieser Richtung verwendeten bewußt den Terminus „Erziehung“ statt „Bildung“, da es ihnen nicht um die Entwicklung von Individuen zu tun war, wie in der bürgerlichen Pädagogik „Bildung“ stets verstanden worden ist, sondern um eine Veränderung der Gesellschaft. Vgl J. Beck u.a., Erziehung in der Klassengesellschaft, München 1971; bes. A. Pressel, Sozialisation, S.136-150. 5 Bildung 19 gesehen, wie bestimmend die wirtschaftlichen Entwicklungen für die anderen Bereiche sind. Bereits die erste Wirtschaftskrise am Anfang der 70er Jahre machte die meisten Hoffnungen der Bildungstheoretiker zunichte. So wurde in keinem Bundesland die Gesamtschule als einzig verbindliche Schulart durchgesetzt, obwohl alle Beteiligten sich gerade aus der Abschaffung des dreigiedrigen Schulsystems den größten Effekt im Hinblick auf mehr Gleichheit erhofft hatten. Es verwundert daher nicht, wenn diese Konzeption schon sehr bald in ihrer Radikalität eingeschränkt wurde. Zwar ist „Selbstbestimmung“ als Zweck menschlicher Lebensführung nicht aufgegeben worden, ja reüssierte zum allgemeinen Zweck menschlicher Bildung überhaupt.7 Doch Bildung wird nur auf das Individuum bezogen: „bilden ist sich bilden“8. Sie wird (wieder) lediglich als subjektive Aneignung von Mündigkeit, Kritikfähigkeit und Selbstbestimmung verstanden. Die objektive Seite der Emanzipation als politischer Kampf gegen alle unnötigen und unmenschlichen Formen von Herrschaft hingegen wird in das Belieben des Einzelnen gestellt. Heute, im Zeitalter von Globalisierung und einem Kapitalismus, der nicht mehr durch die Systemalternative in Schranken gehalten wird, sieht es so aus, als gerieten die Vorstellungen emanzipatorischer Bildung gegenüber den Argumenten der Wettbewerbs- und Standortorientierung unserer Bildungspolitiker ins Hintertreffen. Als die unmittelbar Betroffenen wissen Studenten, Schüler und Lehrer, wie der Hochschulstreik gezeigt hat, am ehesten, daß auf die Forderung nach einer emanzipatorischen Bildung nicht verzichtet werden kann, wenn das, was „Bildung“ heißt, nicht völlig unter die Räder einer ausschließlich am Wettbewerb und der Profitmaximierung orientierten kapitalistischen Ordnung geraten soll. Um dies zu verhindern, halten sie an diesen alten und neuen Forderungen fest, wenn sie Parolen wie „Recht auf Bildung“ und „Bildung für alle“ auf ihre Transparente schreiben. Vgl. W. Klafki, Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorien für ein zeitgemäßes Konzept allgemeiner Bildung, in: Zeitschrift für Pädagogik 1986/4. 8 H. Hentig, Bildung. Ein Essay, München/Wien 1996, S.39. 7 Alexander von Pechmann Bildung als Ausbildung Die dritte Konzeption hat in der bildungstheoretischen Diskussion argumentativ den schwierigsten Stand. Denn ihr fällt es schwer, der Kritik zu entgegnen, Bildung technokratisch und bloß zweckrational als Anpassungsleistung der Individuen an die bestehenden Machtverhältnisse zu verstehen. Statt das autonom handelnde Individuum und den mündigen Bürger als Bildungsziel anzunehmen, gelte hier, so die Kritik, als Ziel gelungener Ausbildung die Eingliederung in das bestehende System – und damit die Unterordnung des Subjekts unter die gegebenen Machtund Herrschaftsverhältnisse. Und in der Tat entsprechen die Worte und die Taten vieler so genannter „Bildungsreformer“ weitgehend dieser Kritik. Gräbt man jedoch tiefer, so verbirgt sich hinter dieser Praxis ein durchaus eigenständiges Bildungskonzept, das den Bereich der Ausbildung mit der Forderung nach Bildung in spezifischer Weise vereinigt. Das Anstößige dieses Konzepts scheint es jedoch zu sein, daß es an keinem transzendenten oder transzendierenden Begriff vom „Wesen des Menschen“ als dem Maßstab oder Endzweck von Bildung festhält, daß es also antimetaphysisch in dem Sinne ist, daß es sich weigert, für das Bildungssystem irgendeine Art von Letztbegründung zu geben. Die wohl größte Zumutung, die dieses Konzept speziell für die deutsche bildungstheoretische Diskussion enthält, ist, daß es nicht von einem, wie auch immer gefaßten, Ideal des Menschen als Bildungsziel ausgeht, an dem der gegenwärtige Zustand zu bemessen wäre, sondern daß es vielmehr umgekehrt das, was man die „gegenwärtigen Verhältnisse“ nennt, in seinem Kern anerkennt und gutheißt. Es nimmt daher nicht wunder, daß diese Überzeugung von der „Sittlichkeit“ des Bestehenden am meisten in der amerikanischen Demokratie - besser: im Bewußtsein des Amerikaners von seinem Land als „God’s own country“ - verwurzelt ist und Bildung 21 sie diesem Bewußtsein entspringt, - und daß dieser Überzeugung die Empörung der deutschen Bildungsseele entspricht.1 Und in der Tat läßt sich allein auf dieser Basis der Akzeptanz der gegenwärtigen Verhältnisse plausibel machen, daß der Erwerb fachlicher Kompetenz in den Ausbildungsinstitutionen nicht in die Entmündigung und Entsubjektivierung des Subjekts führt, sondern daß im Gegenteil dieser Erwerb zugleich die Ausbildung zum selbstbewußten und handlungsfähigen Ich befördert. Konkret heißt das, daß nach dieser Auffassung die Ausbildung im Rahmen der gegenwärtigen Strukturen des sozialen Wettbewerbs und der dadurch bewirkten Erfolgsorientierung nicht das Sein des Menschen behindert, sondern daß der Einzelne vielmehr durch und mittels dieser Strukturen zum handlungsfähigen Teilhaber und Teilnehmer an den Belangen der Gesellschaft wird. Ohne allzu tief in den philosophischen und soziologischen Grundlegungen dieses Bildungsmodells zu schürfen, sei nur darauf verwiesen, daß die es tragende Philosophie auf einen letztgültigen Wahrheitsbegriff zwar verzichtet, daß sie aber doch auf einen Begriff von Wahrheit rekurriert, der die Lerninhalte, die Begriffe und Theorien, der praktischen Erfolgskontrolle unterwirft, und sie daher den Erwerb von kognitiver Kompetenz im Studium als Instrument zur praktischen Lösung von Problemen versteht. Wissenschaftliche Theorien gelten nicht als gültige Einsichten in die Beschaffenheit des Gegenstandes, sondern werden instrumentalistisch als intellektuelle Werkzeuge verstanden, die künftiges Handeln ermöglichen. Im Rahmen dieses Modells steht also der Erwerb epistemischer Kompetenz nicht im Gegensatz zu einem bloß verfahrenstechnischen Wissen; Bildung ist eo ipso Ausbildung zu praktischer Kompetenz.2 Im Bereich der Philosophie hat diese Überzeugung am pointiertesten der amerikanische Philosoph Richard Rorty in seinem Aufsatz: Der Vorrang der Demokratie vor der Philosophie artikuliert (In: Forum für Philosophie (Hg), Zerstörung des moralischen Selbstbewußtseins: Chance oder Gefährdung?, Frankfurt/Main 1988, S.273-289). – Zur Kritik siehe K.O. Apel, Zurück zur Normalität? (In: ebd., S. 91-142); auch J. Habermas, Rortys pragmatische Wende. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 5/1996, S.715-741. 2 Zum Verständnis der erkenntnis- und wahrheitstheoretischen Grundlagen seien hier nur die „klassischen Schriften“ angeführt: W. James,, Was ist Pragmatismus? Mit einer Vorbemerkung von R.-P. Horstmann, Weinheim 1994; J. Dewey, Democracy and Education, 1916 (dt. Demokratie und Erziehung, 1930). 1 22 Zum Thema In soziologischer Hinsicht geht dieses Modell davon aus, daß zwischen dem Erwerb einer sozialen und damit systembedingten Rolle und der Entwicklung der Persönlichkeit kein Gegensatz besteht. Die beiden Pole, die der Soziologe G.H. Mead das objektive „me“ als Produkt der Umwelt und Erziehung und das subjektive „I“ als das handelnde und gestaltende Selbst genannt hat, werden dialogisch als die beiden Seiten der einen Medaille betrachtet, so daß das selbstbewußte „I“ sich nicht ohne das lernende „me“ bilden kann, und das aktiv-handelnde „I“ das sich auszubildende „me“ befördert.3 Wie dem im Einzelnen auch sei – argumentativ gründet das Unterlaufen des Gegensatzes von Bildung und Ausbildung in diesem Modell auf dem grundlegenden Vertrauen der Bildungssubjekte in das System. Auf der Basis dieses Vertrauens bedeutet die Eingliederung in die arbeitsteilige und kompetitive Welt der Berufe für den einzelnen keinen Verzicht auf Individualität und Subjektivität, sondern befördert umgekehrt deren Ausbildung. Wenn daher heute die Bestrebungen sich verstärken, auch in die bundesdeutschen Universitäten Muster der gegenseitigen Evaluation zu implantieren, und allgemein die gesellschaftlichen Regeln des Wettbewerbs auch hier Platz greifen sollen, so entsprechen diese Bestrebungen einem Verständnis der Bildungsinstitutionen, das diese weder als eine autonome Veranstaltung zur Bewahrung und zur Pflege des Gutes „Bildung“ noch als eine ethisch-politisch motivierte Stätte der Egalität begreift, sondern als eine Einrichtungen, die den einzelnen zur kompetenten und selbstbewußten Lösung von Problemen befähigen soll. Solche pragmatistischen Tendenzen entsprechen zweifellos einer „Amerikanisierung“ unseres Bildungssystems, die zugleich auf die Ablösung Zur soziologischen Grundlegung siehe insbesondere G.H. Mead, Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus, Frankfurt/Main 1973. - Mit Recht ist auf die Parallelität von Meads Dialogik von „I“ und „me“ und Hegels Darstellung des dialektischen Prozesses von subjektivem und objektivem Geist hingewiesen worden. Bei aller methodischen und begrifflichen Differenz liegt beiden Modellen etwas zugrunde, was Hegel die „Sittlichkeit“ nennt, und was sich – gegen den Kantischen Dualismus von moralischem Sollen und natürlichem Sein - als eine Art ursprünglichen Glaubens in die Vernünftigkeit der Verhältnisse interpretieren läßt. Vgl. dazu: E. Meinberg, Das Menschenbild in der modernen Erziehungswissenschaft, Darmstadt 1988, S.131 ff. Auch A. Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt/Main 1994. 3 Bildung 23 spezifisch „deutscher“ Bildungstraditionen drängen. Mit Grauen hätten sich damals gleichermaßen Adorno und Heidegger, der progressive wie der konservative Bildungstheoretiker, von diesem Verständnis von Bildung abgewandt. Daß dies heute nicht mehr durchgängig so ist, weist auf eine Verschiebung und auf eine starke Verunsicherung darüber hin, was heute „Bildung“ heißt. Ursula Reitemeyer Bildung - ein Projekt ohne Aussicht? Die von Adorno 1959 vorgelegte „Theorie der Halbbildung“1 markiert einen Einschnitt innerhalb der bildungstheoretischen Diskussion, weil das Projekt Bildung seitdem nicht nur in noch weitere Ferne gerückt, sondern infolge uneingelöster Geltungsansprüche gestaltlos geworden ist. Bildung, sowohl individual- als auch menschheitsgeschichtlich betrachtet, existiert nur noch anonym, ist namenlos geworden. Ihr rein plakativer Wert entspricht der warenfetischisierten Scheinexistenz des Individuums in der pluralisierten bürgerlichen Gesellschaft. Zwar konnten die Studenten- und Jugendbewegungen der sechziger und siebziger Jahre den öffentlichen Diskurs um Bildungsinhalte und die damit zusammenhängenden Erziehungsmethoden neu entfachen, was aber - trotz der sogenannten „Bildungsreform“ - grundsätzlich nichts daran änderte, daß Bildung ihres prospektiven menschheitsgeschichtlichen Charakters endgültig beraubt worden war. Gibt es Bildung nur als Ganzes, - und ist das Ganze die Menschheit, durch deren Gesamtpraxis sie sich geschichtlich manifestiert und praktisch fortschriebe, - dann zerfällt Bildung im gleichen Augenblick, in dem Menschheit als einziger Ort vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Geschichte substanzlos geworden ist. Kann die Idee der Bildung nicht mehr formuliert werden, weil das Subjekt, die Menschheit als Ganzes nicht mehr existiert, nurmehr zersetzt in Klassen, Nationen und fraktionelle Interessengruppen, hat dies unumgängliche Konsequenzen für den Prozeß, in dem die Idee sich bildungsgeschichtlich zu entfalten hätte: der Prozeß ist stillgestellt, Bildung geschieht nicht mehr. Ebenso wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem statischen Augenblick zusammenschmelzen, die Welt gewissermaßen in einer geschichtslosen, naturwüchsigen Unmittelbarkeit untertaucht, ebenso verschwindet Bildung im ungeschichtlichen Hier und Th. W. Adorno: Theorie der Halbbildung, in Gesammelte Werke, Bd. 8, Frankfurt 1972, p 93-121 1 Bildung - ein Projekt ohne Aussicht? 25 Jetzt, das ohne Geist, oder wie Hegel sagt, ohne dies „Werden seiner selbst“2 existiert. Weil der Prozeß der Bildung nicht von ihrer Idee abgelöst werden kann, bzw. weil ohne die Idee eines in der menschheitsgeschichtlichen Praxis zu sich selbst kommenden Geistes keine Bildung geschehen kann, ist der Bildungsprozeß nicht bloß vorübergehend stillgestellt, als ließe sich seine innere Dialektik durch einen äußeren aufklärenden Anstoß wieder ankurbeln. Sowie der faktische Lauf der Geschichte aufhört, von Geist durchdrungen zu sein, kein zweckmäßiger Plan der Menschheitsgeschichte mehr zugrunde liegt, der in mühevoller Arbeit der Natur abgerungen wurde, hört die Menschheitsgeschichte selbst auf und zerfällt in Zufälligkeiten und Augenblicke, die beliebig aneinandergereiht werden können. Zurückgestoßen in eine geschichtslose Naturwüchsigkeit, die mehr vom Fetisch als von der Ware selbst regiert wird, bedarf der Mensch keiner Bildung, um sich durchs Dickicht der unmittelbaren Gegenwart zu schlagen. Technisches Wissen und instrumentelle Vernunft reichen aus, die Gegenwart praktisch-existentiell zu bewältigen, sowohl als Herrschender wie auch als Beherrschter. Dem sogenannten postmodernen Bewußtsein zerläuft die Geschichte zum Immergleichen, in dem es sich aktuell zurechtfinden muß. Darin unterscheidet es sich nicht von dem allgemeinen, unaufgeklärten Bewußtsein aller vergangenen Epochen, das damals wie heute ohne Metaphysik auskommt. Bildung dagegen, begriffen als Geschichtlichwerden des objektiven Geistes, oder in Anlehnung an Kant, als Annäherungsprozeß an die Idee der Menschheit3, steht, von den Bedingungen ihrer Möglichkeit her betrachtet, auf dem Boden metaphysischer Voraussetzungen, die, wenn auch noch so offen und unbestimmt gedacht wie im Prinzip der perfectibilité bei Rousseau4, metaphysisch in dem Sinne G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, Werke in zwanzig Bänden, Bd. 3, Frankfurt 1969-71, p 365 3 I. Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), in: Kants gesammelte Schriften, hrsg. v. d. Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (1902-1923), Bd. VIII 4 J.J. Rousseau: Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (1754), in: Schriften, hrsg. v. H. Ritter, Frankfurt 1988, Band I. Vgl. in diesem Zusammenhang auch U. Reitemeyer: Perfektibilität gegen 2 26 Ursula Reitemeyer sind, als die bildungsgeschichtliche Entfaltung der menschlichen Natur zweckmäßig veranschlagt wird, so daß sie als Bildungsgeschichte des Geistes erscheint. Die nur metaphysisch zu begründende Zweckmäßigkeit der Natur leitet sich in die der Zweckmäßigkeit entsprechende Idee der Bildung weiter, welche im gleichen Augenblick zerbricht, in dem die positiven Wissenschaften das Telos der Natur außer Kraft setzen. Der postmoderne Standpunkt unterscheidet sich vom kritischen dadurch, daß er vor dem Hintergrund des unermeßlichen Tatsachenwissens alle Metaphysik von den Fakten überrollt sieht, während das kritische Denken noch in der maßlosen Anhäufung positiven Wissens einen sich selbst nicht durchschauenden metaphysischen Schwindel erkennt, der an die Stelle der zweckmäßig angeordneten Natur die zweckmäßige Anordnung des Wissens setzt. Ungeachtet der zunehmenden Wissensvermehrung und des explodierenden Fortschritts steht hinter der Negation des metaphysischen Gesamtzusammenhangs der Menschheit oder eines planvollen Laufs der Geschichte das Vertrauen auf eine das vielfältige Material ordnende Vernunft. Diese Vernunft existiert aber so wenig wie die Objektivität der Wissenschaft oder die individuelle Ausprägung der Bildung. Die hinter aller Kontingenz und Beliebigkeit des Denkens vermutete strukturelle Seinslogik baut nämlich nicht auf Zufall und Genie, sondern auf Ordnung und Sukzession. „Anything goes“5, heißt eben nicht, daß im Namen der Wissenschaft alles möglich wird, also auch die Vernichtung des Bewußtseins und der geschichtlichen Welt. „Anything goes“ heißt, der Wissenschaft die Welt anzuvertrauen und einen universalen Diskurs der Einzeldisziplinen vorauszusetzen, der deren auseinandertreibende Zwecksetzungen in einen Gesamtzweck überführt. Postmodernes Denken, so sehr es sich das Ende aller Werte, aller Geschichte, aller Metaphysik auf die Fahnen geschrieben hat, hält am Wissenschaftspositivismus fest, der nicht ohne Metaphysik ist, und steht im gleichen ökonomischen Verwertungszusammenhang wie die profitorientierte Warenproduktion kapitalistischer Systeme. Unter dem Diktat der Profitrate mag jeder erforschen, was er will, jede Methode sich ihrer Perfektion. Rousseaus Theorie gesellschaftlicher Praxis, Münster 1996, bes. Kap. VI.2. 5 vgl. P. Feyerabend: Wider den Methodenzwang, Frankfurt 1986 Bildung - ein Projekt ohne Aussicht? 27 eigenen Logik bedienen. Jede Handlung erscheint als existentieller Akt, und Lebensstile passen sich geschwind an die gesellschaftlich funktionalen Anforderungen an. Noch nie war Individualität so deckungsgleich mit dem Zwang zur Anpassung wie im Zeitalter des massenmedial organisierten Warenfetischismus6. Individualität, die jedem Menschen naturrechtlich anerkannt werden muß, erscheint als käuflicher Massenartikel. Die von Adorno und anderen Aufklärern des 20. Jahrhunderts im Nationalsozialismus festgestellte extreme Vermassung des Individuums als Resultat eines perfekten Zusammenspiels von totalitärer Politik und kapitalistischer Profitgier wurde mit veränderten Vorzeichen unter der Diktatur akkumulierenden Kapitals in allen Gesellschaftsformen fortgesetzt und propagandistisch perfektioniert. Die Massenmedien haben die Schranken zwischen privatem und öffentlichem Raum geöffnet und besetzen das individuelle Bewußtsein mit einer schablonierten Bilderwelt, deren Unmittelbarkeit es sich nirgendwo entziehen kann, so wenig wie der Zuckerrohrschneider seiner Plantage. Jede Handlung ist existentieller Akt, ja, aber nicht substantiell. Substantiell wird jede Handlung nur innerhalb eines wie auch immer strukturierten Bildungsprozesses, als Praxis in der Geschichte der Menschheit. Die Zusammenarbeit der Massenmedien mit Politik und Kapitalfraktionen hat nicht nur den privaten und öffentlichen Raum zerstört und das Individuum einer warenfetischisierten Scheinindividualität ausgeliefert dem Nährboden seiner posttraditionalen Vermassung; darüber hinaus hat sie den Prospekt einer menschheitsgeschichtlichen Zukunft vernichtet mitsamt den zugehörigen Eigenschaften wie Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Dieser zerstörte Prospekt einer geschichtlichen Zukunft, gleichzusetzen mit dem Verlust der Idee der Menschheit, bzw. eines übergeordneten Leitmotivs gesellschaftlicher Praxis, stürzt die postmoderne Gegenwart in jene „leere Geschäftigkeit“, vor der Kant schon warnte, weil sie „das ganze Spiel des Verkehrs unserer Gattung mit sich Dieser Aspekt scheint mir in Josef Früchtls sonst hervorragender Analyse einer postmodern ästhetisierten Lebenswelt etwas zu kurz zu kommen. (vgl. J. Früchtl, Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil, Frankfurt/Main 1996, bes. Kap. II: Postmodern – ästhetische Rehabilitierung der Ethik) 6 28 Ursula Reitemeyer selbst auf diesem Glob als bloßes Possenspiel“7 begreift, das ebenso zwecklos wie beliebig wäre. Gesellschaftliche Praxis, die allein durch äußere ökonomische und politische Umstände zustande kommt, ist dem Zufall ausgeliefert und nimmt der Geschichte jegliche Richtung. Ohne eine Richtung, die nur von der Vernunft vorgeschrieben werden kann, unterscheidet sich gesellschaftliche Praxis prinzipiell aber nicht vom triebdeterminierten Verhalten, weshalb sie auch in keine Geschichte der Freiheit mündet, sondern naturwüchsig bleibt. Die Posttraditionalisten negieren den von Aufklärung, Idealismus und dialektischem Materialismus formulierten Anspruch, die naturwüchsigen gesellschaftlichen Verkehrsformen in freie gesellschaftliche Praxis umzuwandeln und setzen stattdessen auf eine durch Verfahrensrationalität gestützte Reproduktionskraft sozialer Systeme.8 Solche systemische Reproduktionskraft entläßt zwar keinen geschichtlichen Prospekt, scheint aber das bestehende System zu sichern. Systeme können sich nicht geschichtlich bewahrheiten. Sie müssen funktionieren, d.h. ihren Mechanismus erhalten oder zu besser funktionierenden Systemen weiterentwickeln. Damit Systeme funktionieren, bedarf es keiner Autonomie des Subjekts, keines aufgeklärten oder gebildeten Bewußtseins und keiner frei verantworteten geschichtlichen Praxis. Nötig ist allein ein auf allen Ebenen gesellschaftlicher Praxis zu gewährleistender Ausbildungsstandard, der die Funktionstüchtigkeit erhält und verbessert. Aus der Perspektive unlebendiger funktionaler Zweckrationalität betrachtet, hat Bildung sich ebenso überflüssig gemacht wie die Idee eines subjektiv oder objektiv vernünftigen Leitfadens der Geschichte. Im Unterschied zum Standpunkt der philosophischen Kritik, die an der Idee der Bildung festhält, obgleich die vollständige Entfaltung des gebildeten Bewußtseins auf dem Boden der Halbbildung undenkbar ist, eliminiert die systemfunktionale Argumentation die Idee der Bildung von vornherein aus dem Bereich zweckmäßig organisierter Handlungszusammenhänge. Die von Adorno in der „Adenauer-Ära“ noch bitter beklagte Unmöglichkeit eines 7 I. Kant: Streit der Fakultäten (1798), in: Kants gesammelte Schriften, a.a.O., Bd. IX, A 138 8 Zum Paradigma der Verfahrensrationalität vgl. J. Habermas: Faktizität und Geltung, Frankfurt 1992 Bildung - ein Projekt ohne Aussicht? 29 aufsteigenden Bewußtseinsprozesses angesichts des Irrationalen, das sich der Vernunft und der Menschen bemächtigt, wird inzwischen nur noch festgestellt. Vor diesem Hintergrund erscheint Adornos Anklage als hoffnungslos vorgängiger, traditioneller Reflexionsstandpunkt. Leitformel einer posttraditionalen Bildung ist nämlich nicht mehr der Aufstieg oder die Arbeit des individuellen Bewußtseins zum Standpunkt des allgemeinen Wissens, in dem einzelwissenschaftliche Resultate in ein universales menschheitsgeschichtliches Licht getaucht würden. Leitformel einer posttraditionalen Bildung könnte sein, anything goes, sofern das gesellschaftliche System strukturell nicht beschädigt, und die Frage nach der moralischen Verantwortung gegenüber der zukünftigen Generation ausgeklammert wird. Begrifflich schwammig, aber um so zielorientierter verläuft die derzeitige Diskussion um Bildung. Neben beruflicher und fachlicher Qualifikation käme es zunehmend auf die Ausbildung fächerübergreifenden Denkens an. Soziale und kommunikative Kompetenz sei zu fördern in Familien, Schulen und Ausbildungsstätten. Allgemeine Bildungsinhalte müßten wieder einen festen Platz einnehmen in den Curricula der allgemeinbildenden Schulen. Die Verkabelung aller Schulen im Internet sei umgehend einzuleiten, um den „Standort Deutschland“ international attraktiv zu gestalten. Ausbildung- und Studienzeiten seien ebenso zu verkürzen, wie die gesamte Schulzeit um ein Jahr. Gefordert wird ein Zentralabitur und die verwaltungstechnische Überwachung von Regelstudienzeiten. Das Studium an Fachhochschulen ersetzt zunehmend die Ausbildung an Berufsschulen9, und die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereiche der Universitäten verkommen mehr und mehr zu schlecht ausgestatteten Verwahranstalten der Jugend in einer Mittelschichtsgesellschaft. Diese Verkürzung des Bildungsanspruchs auf blanke Berufsqualifikation ist politisch gewollt und folgt den obersten Regeln des kapitalistischen Wirtschaftssystems, Profit zu maximieren und Kapital zu akkumulieren. vgl. etwa den Forderungskatalog der StudentInnenvertretung der Katholischen Stiftungsfachhochschule München vom 4.12.97. Dort heißt es unter Punkt 12: "Wir lassen uns nicht zu Schmalspur-Fachidioten ausbilden. Kein Schnellstudium für die Masse und Vollstudium für eine kleine Elite. Diesen Demokratieabbau werden wir nicht dulden. ... Bildung ist Menschenrecht!" 9 30 Ursula Reitemeyer Es geht in der öffentlichen Diskussion schon längst nicht mehr um Bildung10. Es geht um die Besetzung von Arbeitsplätzen in einem System, das seinen eigenen Funktionsmechanismen zufolge nur eine begrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen kann, um profitabel zu sein. Bilden mag sich, wer genug Geld und Muße aufbringt, sein Denken und Fühlen vor der manipulativen Gewalt der Bewußtseinsindustrie zu schützen, die die Warenzirkulation antreibt und zum Erhalt des bestehenden Wirtschaftssystems entscheidend beiträgt. Mögen die Städte im Abfall und die Dritte Welt im Sondermüll ersticken, die Verpackung kann aufgrund zu erwartender rasanter Umsatzeinbrüche nicht auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Deshalb müssen Kinder der hochindustrialisierten Gesellschaften weiterhin minderwertige Nahrung zu sich nehmen und unter Karies leiden, wodurch sie gleichzeitig dazu beitragen, das gegenwärtige Arbeitsplatzkontingent im Versicherungsund Gesundheitswesen zu erhalten. Einmal in die irrationalen Tiefen der kapitalistischen Systemrationalität herabgestiegen, zeigt das System seine logischen Strukturen: die Teilbereiche sind miteinander unauflöslich vernetzt und funktionieren als Subsysteme der Warenproduktion. Die ökonomische Vernetzung aller gesellschaftlichen Praxisbereiche erzeugt jene, nicht einmal besonders neue Zentralperspektive, von der die Apologeten eines posttraditionalen Pluralismus behaupten, daß sie verloren gegangen sei. Der von sogenannten postmodernen Pädagogen11 als Indiz herangezogene Verzicht moderner Kunst auf perspektivische Darstellung läßt nun aber nicht darauf schlie10 Dies ist den Studierenden nicht entgangen. Vgl. dazu Oliver Schilling: Diese Studenten sind anders, in: Die Zeit Nr. 51 vom 12.12.97. In dem Beitrag des AstaVorsitzenden zur studentischen Protestbewegung heißt es: "Es gilt die Degradierung des Menschen zum reinen Objekt zu bekämpfen. Die Studierenden wehren sich gegen eine Reduktion von Menschen auf Produktion und Leistung, gegen die Aufkündigung jeglicher humanistischer Ideale und gegen ein rein funktionales Verständnis von Bildung. Das ist eine Fundamentalkritik am Menschenbild der Politik der vergangenen zwanzig Jahre, doch kaum jemand nimmt das so richtig wahr. Die einengende Beschreibung der Proteste als reine Mehr-Geld-Bewegung entspricht eher der Nachfrage der Öffentlichkeit, die sich auf komplizierte Erklärungsmuster nicht einlassen will. Wer heute etwas anderes fordert als mehr Geld, wird nicht verstanden." 11 Vgl. H. Kupffer: Pädagogik der Postmoderne, Weinheim/Basel 1990. Bildung - ein Projekt ohne Aussicht? 31 ßen, daß die vielfältigst sich aufsplitternde gesellschaftliche Wirklichkeit einer logischen Struktur sich entzieht; allenfalls ist der Rückschluß erlaubt, daß die „Tilgung der Perspektive in der neuen Malerei durch „Korrespondenz mit der vorperspektivischen“12 bestehende Wahrnehmungsschemata auflöst, die bereits von der Warenzirkulation aufgeprägt wurden. Richtet sich moderne Kunst in erster Linie gegen die Vermarktung des Wahrheitsgehalts ihrer Werke, die sie deshalb verschlüsselt und vor der Gewalt des warenfetischisierten Bewußtseins versteckt, bringt sie nichts anderes als ihre Kritik gegenüber der ökonomisch determinierten gesellschaftlichen Gesamtstruktur zum Ausdruck, deren Logik dem Wahrheitsgehalt des Kunstwerks widerspricht. Die Zentralperspektive mußte von der modernen Malerei aufgegeben werden, um den Wahrheitsgehalt der Werke dem verwertenden Zugriff zu entziehen, der seinen Spielraum desungeachtet erweitert. Die daraus entstehende A-Perspektivität des Kunstwerks deutet nun nicht auf die allseits beschworene Perspektivlosigkeit der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auf die Eröffnung einer Gegen-Perspektive. Als Gegen-Perspektive zum herrschenden Realitätsprinzip präformuliert die Moderne ebensowenig einen beliebigen ästhetischen Reflexionszugriff wie eine geschichtslose Gegenwartsanalyse. Als vollbrachte bestätigen Kunstwerke ihren Wahrheitsgehalt noch dann, wenn sie an der fetischisierten Wirklichkeit teilhaben, die sie transzendieren13. Sowenig die Moderne unter dem Anspruch der Humanität den Verlust perspektivischer Reflexion präformuliert14, den der im Dienst von Kapitalfraktionen stehende Positivismus zu verantworten hat, sowenig resultieren die postmodernen Wahrnehmungsebenen aus dem gescheiterten Projekt der Moderne. Zwar ist das Kontinuum der Geschichte noch einmal zerbrochen, vielleicht zum letzten Mal, wie Skeptiker aus allen Wissenschaftszweigen befürchten. Aber daraus folgt nicht, daß das historische Nacheinander von Moderne und postmoderner Reflexionsattitüde systematisch, d.h. begriffslogisch miteinander verknüpft wäre. Das systematisch Vorgängige des Postmodernen ist nicht die an sich selbst gescheiterte Moderne, Th.W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt 1973, p 314 ebd. p 506 14 so H. Kupffer: Pädagogik der Postmoderne, Weinheim/Basel 1990, S. 10 f. 12 13 32 Ursula Reitemeyer mit anderen Worten, die an der harten Wirklichkeit gescheiterte Idee der menschlichen Freiheit, sondern die durch alle historischen Epochen hindurchgehende Anpassungstendenz des allgemeinen Bewußtseins an den Zwang der bestehenden Verhältnisse. So steht die postmoderne Reflexion in der Tradition affirmativer Gesellschaftstheorien, denen bei aller Unterschiedlichkeit im Detail das Arrangement mit dem Bestehenden, so wie es ist, nicht wie es sein soll, gemeinsam ist. Damit rückt alle sich postmodern gebärende Reflexion in die Nähe zur politischen Macht, deren einziges Ziel 'Expansion' ist, weil sie sich anders nicht erhalten kann. Ihrer Verstrickung mit dem Positivismus kann posttraditionale Theoriebildung nicht entgehen, ebensowenig wie der methodischen Reduktion bildungstheoretischer Entwürfe auf Sozialisationstheorien. Auf deren Grundlage werden undurchführbare Bildungsprozesse in praktikable Ausbildungsprogramme umgewandelt. Strenggenommen schließen sich posttraditionaler Strukturalismus als Abgesang auf die Idee der Freiheit oder als Negation eines nicht zu verdinglichenden Restbewußtseins und klassische Bildungstheorie aus, obgleich es Hinweise darauf gibt, daß der von Hegel als vollständige Selbst-Entäußerung verstandene Prozeß bildungsgeschichtlicher Entfaltung den Umschlag von Selbst-Bildung in Anpassung ans Bestehende schon enthält. Vielleicht ist es Hegels phänomenologische Darstellung der Bewußtseins- und Wissenschaftsgeschichte, die, ihre eigene Dialektik im Prozeß der totalen Selbst-Entäus-serung stillstellend, zeigt, wie die Überantwortung des Subjekts an die objektiven Verhältnisse bildungstheoretisch gedacht werden kann: die objektiven Verhältnisse werden um so vernünftiger, je mehr das Subjekt sich an sie veräußert, oder weniger abstrakt ausgedrückt, je schneller der individuelle, leiblich konkrete Mensch sich den gesellschaftlichen Anforderungen anpaßt und in deren Strukturen verschwindet. In der zügigen Entwicklung schnell veralteter Anpassungsstrategien überrundet sich affirmative Pädagogik selbst: ein reformpädagogisches Konzept reiht sich an das andere, heute diesen, morgen jenen Schwerpunkt setzend, und wird von den Fakten überholt, sobald es in der Faktizität Fuß faßt. Pädagogen fühlen sich überall zu Hause, bei den Hirnforschern ebenso wie bei den Psychoanalytikern oder den SoftwareEntwicklern. Kein Bereich gesellschaftlicher Praxis ist so abgelegen, daß Bildung - ein Projekt ohne Aussicht? 33 nicht der Pädagoge als Sachverwalter des zukünftigen Humankapitals seine Aufgaben darin fände. Umgekehrt muß die Wissenschaft von der Erziehung des Menschen sich nicht wundern, wenn andere Ressorts ihr die Richtlinien vorschreiben. Hat sie, vielleicht infolge der unabdingbar scheiternden pädagogischen Praxis vor der Idee der Bildung, Bildung als wissenschaftlichen Reflexionsgegenstand insgesamt eliminiert, wird ihr Gebiet zwangsläufig okkupiert und in das System kapitalbildender Warenproduktion integriert. Bildung gerät unter den Maßstab der Leistung, und Leistung unter den der Profitmaximierung. Leistung muß sich wieder lohnen, heißt nichts anderes, als solche Ausbildungsgänge und Arbeitsbereiche finanziell zu fördern, die das System funktionabel erhalten und für die nächste Zukunft stabilisieren. An dieser gegenwärtig von der Politik formulierten Bildungs- oder besser Ausbildungsmaxime hat sich seit Inkrafttreten einer allgemeinen Schulpflicht prinzipiell nichts geändert, die auch nur unter dieser Maxime stehend eingeführt werden konnte. Niemals ging es der vom Staat verantworteten öffentlichen Erziehung um Bildung. Je mehr sie sich die klassischen Bildungsformeln vor die Curricula schrieb, um so effizienter paßte sich das öffentliche Erziehungssystem den gesellschaftlichen, insgesamt aber irrationalen Verhältnissen an. Vom Anpassungsdruck ausgenommen sind schon längst nicht mehr die Universitäten, deren gegenwärtige Generation aber doch wohl zu ahnen scheint, daß ihnen etwas vorenthalten wird, das es vielleicht noch nie gab, oder je geben wird, und dennoch unveräußerbares Menschenrecht ist: Bildung. Alexander von Pechmann Philosophie - Erzieherin der Menschheit ? zum 20. Weltkongreß der Philosophie, Boston, 10.-16. August 1998 Es wird gigantisch werden, richtig amerikanisch. Noch nie - hier dürfte das Wort einmal passen - werden so viele Philosophen sich zu derselben Zeit an demselben Ort versammelt haben. Mehr als fünftausend Philosophen aus aller Welt werden in diesem August ihre Hörsäle, Seminarräume und Studierstuben verlassen und, mit ihren „Contributed Papers“ und neuesten Veröffentlichungen bewaffnet, zusammenströmen, um sich hier, in Boston, zum Weltkongreß der Philosophie zu vereinen. Die großen Versammlungen der Weisen Chinas, die Konzilien der Christenheit, ja selbst alles, was man bisher so „Weltkongreß“ nannte, - sie waren nur Vorspiele und Vorübungen für das Ereignis, da jetzt, am Ende des „Jahrhunderts der Extreme“ und an der Wende der Millennien, die Schicksalsfragen der Menschheit einer philosophischen Antwort entgegenharren. Und in der Tat, welch anderer Ort wäre für eine solche Versammlung der Geister geeigneter als Boston? Ist hier doch der Ursprung, die αρχη der Neuen Freien Welt, wo sie einst sich von der Nabelschnur der Alten Welt getrennt, und wo der freie Mensch, freilich erst nach dem Verschwinden der Amerikaner, seine Freistatt gefunden hat. Und so setzt uns Boston, das „Athen Amerikas“, die Stadt der Universitäten, Bibliotheken und Institute, das Zeichen: der Geist des neuen Jahrtausends - er wird seine Heimstatt in Amerika haben, er wird amerikanisch sein. Und so hat sich denn das „Amerikanische Organisationskomitee“ (AOC) für den Andrang aus aller Welt gerüstet. Per Internet (www.bu.edu/WCP/) wird erstmals der Strom der Gelehrten, der sich vom 10.-16. August über die Stadt ergießen wird, gelenkt und geleitet, wird jedem Teilnehmer sein Ort und seine Zeit zugewiesen. 45 Sektionen hat man gebildet, die von der „Philosophy of Arts“ bis zur „Philosophy of Value“ alle nur möglichen Themenbereiche umfassen. Vier Philosophie - Erzieherin der Menschheit? 35 Plenarsitzungen zum Thema des Kongresses, fünf Symposien, sechs Spezialsitzungen, zehn interkulturelle Sitzungen, achtzig Themensitzungen und einhundertsiebzehn Rundtischgespräche werden die drohende Flut der Gedanken aus aller Welt kanalisieren und bündeln. In über siebenhundertsiebzig Veranstaltungen werden die großen und die kleinen Themen während der sechs Kongreßtage „abgearbeitet“. Ein rigider Zeitplan verlangt von den Philosophen, all die Fülle des Mitteilens- und Diskussionswerten auf den 15-Minuten-Takt zu beschränken. Selbst die Maße der Stellwände sind von den Organisatoren vorgegeben. Die Buchverleger und Sponsoren sind verständigt und bereit. Und das CyberCafé wird den Staunenden aus aller Welt den Einsatz der neuen Technologien in Philosophie und Bildung demonstrieren. Wie gesagt: die Dimensionen des 20. Weltkongreß der Philosophie werden amerikanisch sein. Doch - um alles in der Welt - wer hat es den Verwaltern des Weltgeistes eingegeben, dies Spectaculum dem Thema zu unterstellen: „Philosophie Erzieherin der Menschheit“? Genügt den Versammelten nicht das erhabene Gefühl dabei zu sein, zu hören und gehört, sehen und gesehen zu werden? Reicht es nicht hin, weiterhin solche Themen zu stellen, die Philosophen auch bearbeiten können: „Universalität des Wissens“, „Zukunft des Wissens“, „Erkenntnis und Interesse“? Muß von der Weltversammlung der Philosophen auch noch der Auftrag ausgehen, von hier und heute gleich noch die ganze Menschheit zu erziehen? Soll Boston tatsächlich der Ort der Umkehr werden, wo brave Arbeiter am Begriff und an der Sprache zu strammen Erziehern an der Menschheit werden? Können wir uns überhaupt vorstellen, Jaako Hintikka, der AOCPräsident, werde seine linguistischen Studien beenden und von nun an die Menschheit suchen, um sie mit seinen Erkenntnissen über das Wesen der Sprache und das richtige Sprechen zu beglücken? Bestehen nicht Zweifel, ob es seinem Kollegen, Robert C. Neville, dem es bislang kaum gelang, der eigenen Schar seine Beweise über „God the Creator“ recht zu vermitteln, nunmehr gelingen wird, all die anderen von dem überzeugen wird, was ihnen fehlt? Und können wir glauben, Richard Rorty werde nach dem August all die Ironie vergessen haben, mit der er bislang die Philosophie bedacht hat, um fortan sein literarisches Schaffen in den 36 Alexander v. Pechmann Dienst der Menschheit zu stellen? Noch haben wir sie ja im Ohr, die beredten Denunziationen des Universalismus, die Verabschiedung der Meisterdenker und die Erhebungen der Philosophie zur Privatsache und zum intelligenten Glasperlenspiel. Irgendetwas scheint da nicht zu stimmen. Doch nein, so entnehmen wir dem Hinweis der Veranstalter: nicht der Philosoph ist es, der die Menschheit erzieht; der Philosophie sei es, sie zu erziehen. Ist es denn nicht seit je her der Philosophie edelster Auftrag, ihr Bildungswerk an der Menschheit zu verrichten? Und, kantisch gewitzt, mag man hinzufügen: in jedem einzelnen die Menschheit zu erkennen. Nun - so wollen wir uns fragen: was ist denn die Philosophie, über die zwar der Philosoph sich genüßlich lustig macht, deren Auftrag es jedoch sei, die Menschheit zu erziehen? Ja nun, so tönen uns die Grüße über den Atlantik entgegen, diese menschheitserziehende Philosophie, das sind die „two thousend five hundred years of Western philosophy“1; das ist der nicht abreißende Strom der Tradition, der, von Ost nach West fortschreitend immer „westlicher“ wurde, der von Griechenland als Quelle ausgehend, das christliche Abendland und die europäische Aufklärung in sich aufnehmend, sich in die moderne Zeit ergießt, die heute in Amerika ihren Ort gefunden hat. Diese Philosophie hat uns zu den großartigen Denkern und Vorbildern der Menschheit gemacht, die wir heute sind. Und eben diese unsere Großartigkeit erlaubt es uns, vielmehr: verpflichtet die Philosophie, die Menschheit zu erziehen. Weil nun aber unser Apologet der „Western philosophy“ auch ein Bürger Amerikas ist, versichert er uns, daß, so wie die Vereinigten Staaten, sich vom Atlantik zum Pazifik erstreckend, unter ihren Bürgern Vertreter aller Weltkulturen umarmen (embrace), in dieser Philosophie natürlich auch die anderen Weltkulturen, weil dort auch viel über die Menschheitserziehung nachgedacht worden ist, ihren Platz haben. Und kaum vernehmlich murmelt er: natürlich - die einen mehr, die anderen weniger. Dies alles sei die Philosophie. Und ergriffen von der Bedeutung seiner Worte erscheint es ihm, daß auch die Menschheit der Erziehung durch Zitate aus: American Organizing Commitee, PAIDEIA. Twentieth World Congress of Philosophy: Philosophy Educating Humanity, Boston 1997. 1 Philosophie - Erzieherin der Menschheit? 37 die Philosophie harrt. Mögen auch Milliarden Menschen der Nahrung bedürfen; doch die Menschheit bedarf dieser Philosophie, um, wie er sagt, die Beziehungen der durch Verkehr, Wirtschaft und Information verbunden „world society“ zu zivilisieren. Und so soll denn die Weltversammlung der Philosophen ein kraftvolles („powerful“) Zeichen in das nächste Jahrtausend setzen, um die Menschheit so großartig zu machen wie die amerikanische Philosophie es heute schon ist. So stehen wir denn, in unserer Alten Welt, ungläubig, skeptisch und kleinmütig vor diesen menschheitsbeglückenden Postulaten für das kommende Jahrtausend und meinen, nur einen wohl inszenierten Theaterdonner zu vernehmen. Hat er sich verzogen, erinnern wir uns der Worte des derzeit wohl bekanntesten Philosophen: „I'm just an American, we have just to persuade the others that our way is the right one.“ Besprechungen Bücher zum Thema Hartmut von Hentig Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff München 1998 (Carl Hanser Verlag), geb., 80 S., 20.- DM. In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts haben sich Intelligenzforscher dem Begriff Kreativität zugewandt, um die schöpferischen Fähigkeiten von Menschen besser darstellen zu können, die mit einem zu eindimensional geratenen Intelligenzkonzept nicht auszuloten waren. Heute hat die Kreativität nicht zuletzt deshalb Konjunktur, weil ihr die Rolle des Hoffnungsträgers für den Standort Deutschland zugeschrieben wird. Die in diesem Sinn beschworene Kreativität meint technisch und wissenschaftlich vorn zu sein, hebt der Autor hervor. Diese Kreativität sucht nicht einen Ausweg aus dem Netz der Systemzwänge, wie etwa der Rationalisierung der Arbeitsvorgänge und der Dominanz der Wirtschaft über alle Lebensbereiche, vor allem über die Politik. Auch in der Bildung wird die Sichtweise der Wirtschaft und der Auftrag, den diese erteilt, akzeptiert. Die Bildung gibt damit ihren Anspruch auf eine Kreativität preis, die die Entfaltung eines - vernachlässigten - Teils unserer Persönlichkeit meint. Ist von Kreativitätsförderung die Rede, ist Produktivität, Ordnung und ein wenig Wohlbefinden gemeint, rundet von Hentig die Bestandsaufnahme in seinem Essay ab und setzt dagegen: Kreativität ist in erster Linie befreites Denken, nicht gehemmt von Furcht oder Routine oder einem perfekten Vorbild, es ist kein anderes Denken. Die Spontaneität, die dabei zur Geltung kommt, kann man nicht - wie von Bildungspolitikern gewünscht - in der Schule oder Uni veranstalten, methodisieren, einüben. Man könnte aber Menschen gegenüber den Sach- und Systemzwängen stärken, sie von dem lähmenden Gemisch aus Angst und Bequemlichkeit befreien, ihre Bereitschaft zu Risiko und die Kraft für das Ungewöhnliche beleben. Aber angesichts der Art, wie versucht wird, Kreativität vorwiegend zur Lösung von Wirt- Bücher zum Thema schaftsproblemen zu instrumentalisieren, outet sich von Hentig als Bedenkenträger gegenüber der Rolle des Hoffnungsträgers Kreativität als deus ex machina. Jadwiga Adamiak Hartmut von Hentig Bildung. Ein Essay München 1996 (Hanser), geb., 216 S., 34.- DM. „Bildung statt Eurofighter“ – dieser Parole im bundesweiten Streik der Studenten stimmt Hartmut von Hentig ohne Vorbehalte zu und beendet sein Essay mit den Worten: „Bildung ist nicht nur wichtiger als der Jäger 90, die Schwebebahn und der Ausbau des Autobahnnetzes, sie ist auch wichtiger als die uns gewohnte Veranstaltung Schule. Dafür, daß man dies erkenne und besser verstehe, habe ich dieses Buch geschrieben“ (209). Übersichtlich und in gewohnt klarer Sprache verfolgt Hentig zumindest zwei unterschiedliche Anliegen, die er jedoch miteinander zu verknüpfen versteht: So will er einmal den großen Stellenwert von Bildung am Ende des 20. Jahrhunderts aufzeigen und zum zweiten seine vehemente Kritik am bestehenden Schulsystem fortsetzen und über 39 eine Klärung des Bildungsbegriffes diese Kritik auch begründen. Ein Drittel des Essays widmet Hentig der notwendigen Präzisierung, was unter Bildung verstanden werden kann und was Bildung zu leisten imstande ist. Er nähert sich einer begrifflichen Klärung, indem er zunächst einmal „geläufige Fragen“ stellt: „Was bildet den Menschen? Welche Bildungsvorstellungen haben wir/wollen wir haben? ... Welche Eigenschaften und Fähigkeiten, Tugenden und Qualifikationen braucht der heutige Mensch/die heutige Welt?“ (36) Bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten, stößt Hentig zwar nicht auf eine kurze und bündige Definition von Bildung; dennoch erfahren wir, was Bildung nach Ansicht des Autors zu leisten imstande sein müßte: „Übersicht, die Wahrnehmung des historischen und systematischen Zusammenhangs, die Verfeinerung und Verfügbarkeit der Verständigungs- und Erkenntnismittel, die philosophische Prüfung des Denkens und Handelns“ (56). So muß Bildung beides leisten: „die Stärkung der Person [und zwar] durch die Klärung und Aneignung von ‚Welt‚„ (163). Mit dieser Auffassung bekennt sich Hentig zum bürgerlichen Bildungsideal Wilhelm von Humboldts, allerdings in seiner radikalen, nicht institutionalisierten Variante, die als Ziel der Bildung 40 Bücher zum Thema „die sich selbst bestimmende Individualität“ vor Augen hat – „aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie als solche die Menschheit bereichert.“(41). Einen großen Teil seiner Ausführungen widmet Hentig den Maßstäben, an denen sich Bildung beweisen und bewähren muß. Diese Maßstäbe sollen in erster Linie Plausibilität besitzen für jeden, der sich mit Bildung beschäftigt und vor allem natürlich für den Leser dieses kleinen Büchleins. An erster Stelle dieser Bewertungsgrundlagen steht für Hentig „die Abscheu und Abwehr von Unmenschlichkeit“ (76). Gleich an zweiter Stelle steht jedoch – ganz im Geiste der Verfassung der Vereinigten Staaten, in denen sich Hentig längere Zeit aufhielt – „die Wahrnehmung von Glück“ (78). Es folgen als weitere Maßstäbe: Fähigkeit und Wille zur Verständigung, ein Bewußtsein der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz, Wachheit für letzte Fragen und – last but not least – die Bereitschaft zur Selbstverantwortung und Verantwortung in der res publica. Diese Maßstäbe können nicht einfach in das Bildungssystem Schule übertragen werden, sie entziehen sich der Meß- und Operationalisierbarkeit; dennoch finden sich genügend Anlässe, Quellen und Mittel für eine Bildung, die diesen Maßstäben genügt. Bei der Darstellung dieser Anlässe wird deutlich, wie ungenügend unsere Schulen, die doch hauptsächlich gemeint sind, wenn von Bildung in den Institutionen gesprochen wird, einem Bildungsauftrag im Sinne Hentigs nachkommen. Bildung für alle wird aufgrund der Dreigleidrigkeit unseres Schulsystems unmöglich gemacht; die Vorbereitung auf das Leben nach der Schule besteht darin, die Selektionsmechanismen einer wettbewerbsorientierten Gesellschaft so früh wie möglich einzuüben und zu akzeptieren. Der eigentliche Bildungsauftrag, „nämlich den einzelnen zum Subjekt seiner Handlungen, also auch seiner Bildung“ (162) zu machen, wird zwar von allen „Schulleuten“ betont, fällt aber dem „gesellschaftlichen Auftrag ..., nämlich Ausbildungs-, Erwerbs- und soziale Aufstiegschancen zu verteilen“ (163) zum Opfer. Letztlich versucht Hentig in seinem Essay die Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite betont er die Bedeutung von Bildung, die zwar auf das Leben vorbereiten müsse, dies jedoch nicht auf Kosten der Persönlichkeitsbildung und damit der Fähigkeit zu Selbstbestimmung und Kritikfähigkeit leisten dürfe. Auf der anderen Seite kritisiert er die heutige Veranstaltung Schule, der er aber dennoch einräumt – und dies in vielen beeindruckenden Bücher zum Thema Beispielen aus seiner Praxis an der Bielefelder Laborschule deutlich macht –, daß sie für seine Vorstellung von Bildung nutzbar gemacht werden könnte. Hentig läßt hierbei außer acht, daß die Schule eben keinen gesellschaftlichen Freiraum, sondern im Gegenteil ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellt, auf die sie vorbereitet. Nähme Hentig diese Spiegelbildfunktion von Schule ebenso ernst wie die Bildung, so müßten seine Schlußfolgerungen radikaler und systemkritischer ausfallen, als sie in seinem dennoch lesenswerten Beitrag zur gegenwärtigen Bildungsdiskussion zum Ausdruck kommen. Sibylle Weicker Dieter Lenzen/ Niklas Luhmann (Hg.) Bildung und Weiterbildung im Erziehungssystem. Lebenslauf und Humanontogenese als Medium und Form Frankfurt/Main 1997 (Suhrkamp), 249 S., 19.80 DM. Paradoxien symbolisieren zunächst einmal kognitive Inkompetenz. (N. Luhmann) Der hier vorgestellte Band zu den Themen „Erziehung“ und „Bildung“ setzt die seit 1982 von Niklas 41 Luhmann und Karl-Eberhard Schorr bis zu dessen Tod 1995 herausgegebene Reihe von Kolloquienbänden zu „Fragen an die Pädagogik“ fort. Da die Einführung in die Thematik leider allzu rudimentär geblieben ist und einiges an Vorkenntnissen zu den systemtheoretischen Fragestellungen verlangt, sei hierzu der Band „Zwischen System und Umwelt“ (Frankfurt/Main 1996) besonders berücksichtigt, der es erlaubt, die neueren systemtheoretischen Grundlagen konzentriert darzustellen. Die „Fragen an die Pädagogik“ sind auf deren „Reflexionsniveau“ ausgerichtet, also auf das, was die Pädagogik als Reflexionstheorie von Erziehung reflektiert oder nicht. Eine der Leitfragen Luhmanns ist die, ob das Erziehungssystem in der Lage ist, sich auf die für es selbst konstitutiven Unterscheidungen, besser: auf die als Selbstkonstitution begriffenen Unterscheidungen, wiederum unterscheidend zu beziehen. Dies wäre eine Voraussetzung dafür, etwaige Paradoxien zwischen gesellschaftlichen Funktionen und Selbstzuweisungen überhaupt wahrzunehmen und weniger folgenreich werden zu lassen. Von einem System, so Luhmann in dem Aufsatz „Das Erziehungssystem und die Systeme seiner Umwelt“, könne man nicht sprechen, ohne daß die Umwelt des Systems 42 Bücher zum Thema mit in den Blick komme. Dies markiert eine Grundkonstruktion der „allgemeinen Theorie sozialer Systeme“: Als autopoietische, selbstreferentielle Systeme konstituieren sich soziale Systeme in Unterscheidung von ihrer Umwelt. Indem sich ein System in Operationen der Beobachtung auf etwas bezieht, bleibt etwas anderes unbeobachtet und ausgeschlossen. Beobachtungen erzeugen „Zwei-Seiten-Formen“ (vgl. D. Baecker (Hg.), Probleme der Form, Frankfurt/Main 1993). Eine allgemeine Theorie sozialer Systeme betrachtet nun gezielt eine Einheit der Differenz von System und Umwelt, beobachtet also sozusagen die in den Teilsystemen verdeckten und unverfügbaren Kehrseiten mit. Im Sinne der neuer angewendeten Konstruktion eines „Re-entry“ (G. Spencer Brown) wird ein und dieselbe Unterscheidung als andere betrachtet. Die Systemtheorie soll sich in den Unterscheidungen bewegen, ohne sich darin zu verfangen (vgl. auch: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1992, 189 ff). Paradoxerweise gehört für Luhmann der Bereich des Humanen weil der Mensch „keine durch Natur programmierte und angetriebene Trivialmaschine“ ist, „die immer zu dem gleichen richtigen Ergebnis kommt“ - zur Umwelt des Erziehungssystems. Was für den „sche- mabasierten“ Erziehungsbereich tragend ist, Lernschritte, Leistungsbeurteilung, Selektion, Qualifikationsaussagen, erfasse gerade nicht die psychischen und physischen Systeme und deren Entwicklung, die ihrerseits wiederum Gegenstand psychologischer und medizinischer Beobachtungen sein können. So müßten psychische und physische Systeme als Medien von Erziehung vorausgesetzt werden, obwohl oder auch weil sie zur Umwelt des Erziehungssystems gehörten. Auch im Blick auf das Verhältnis des Erziehungssystems zum politischen System läßt sich „die Einheit der Differenz von System und Umwelt“ nur paradox formulieren, als „Einheit von Unabhängigkeit und Abhängigkeit“. So begreife sich das Erziehungssystem in einer relativen Autonomie, müsse andererseits aber vom politischen System Entscheidungen verlangen, die etwa die Schulorganisation und die Ressourcenzuweisungen betreffen. Luhmanns Betrachtung soll darauf aufmerksam machen, „daß jede Paradoxie auch anders konstruiert werden und damit andere Möglichkeiten der Entfaltung durch Anschlußunterscheidungen freigeben kann“. Eine Leitfrage ist hierbei: „Wie wird in der modernen Gesellschaft die Ordnungsform der Hierarchie ersetzt?“, eine Ordnungsform, die dem Erziehungssystem Bücher zum Thema mit einer unterstellten Pädagogisierbarkeit sozialen Geschehens einen nur scheinbar festen Platz einräumt. Hier fragt Luhmann in Nähe zu J.F. Lyotards „Le differénd“ (Paris 1983) nach „polyzentrischen“ Gesellschaftsbeschreibungen für eine nicht mehr hierarchisch darstellbare Gesellschaft. Im Vorwort zu „Bildung und Weiterbildung im Erziehungssystem“ betonen die Herausgeber, daß Erziehung und Bildung keineswegs dasselbe seien: „Erziehung ist eine Zumutung, Bildung ein Angebot.“ Der Unterschied scheint zunächst der zwischen einem Feld zielgerichtet qualifizierender Beeinflussungen und einem breiteren Feld von Persönlichkeitsentwicklung zu sein. Auch wenn das, was „Weiterbildung“ genannt wird, Teile beruflich relevanter Qualifizierung einschließe, lasse sich nicht von einem einheitlichen System von Erziehung und Bildung sprechen. Ebenso sei im Blick auf Einrichtungen, „die eine abgeschlossene Erziehung in Schulen und Hochschulen voraussetzen und weitere Bildungsmöglichkeiten offerieren“, eine Unterscheidung von „institutioneller und praktischer Bedeutung“ Daher könne man nicht „von einem einheitlichen Funktionssystem ausgehen“. Umgekehrt ließen sich Erziehung und Bildung respektive Weiterbildung auch nicht als 43 jeweils „eigene, operativ geschlossene Systeme“ begreifen; denn die Grenzen des Erziehungssystems wiesen ständig wachsende Erweiterungen auf. In dem Aufsatz „Erziehung als Formung des Lebenslaufs“ fragt Luhmann nach Gründen für eine derartige Konzeptlosigkeit. Ein Hauptgrund liege darin, daß das Erziehungssystem zu eng mit der Differenz von „Kindern und Erwachsenen“ operiere, mit einem Konstrukt, das angesichts der zunehmenden Lebenserwartung und angesichts der Vorstellungen von einem lebenslangen Lernen suspekt werden müsse. In Anlehnung an die wahrnehmungspsychologische Unterscheidung von „Ding und Medium“ (F. Heider) wird nach dem „Medium“ gefragt, welches das Erziehungssystem benutzt, um „Formen“ zu bilden. Dabei kommt zunächst das Medium „Kind“ in den Blick, „das als Potential für sehr verschiedene Fähigkeiten vorausgesetzt werden muß“. Doch dieser Begriff sei ein Differenzbegriff zu dem des Erwachsenseins und daher „nur auf Familienerziehung und Schulerziehung anwendbar“. Mit der Medium/Form-Unterscheidung bringt Luhmann seine neuere Betrachtung von Kommunikationsmedien in einen Ansatz ein, der die Beschreibung einer Herausbildung von erwartbaren und „co- 44 Bücher zum Thema dierbaren“ Kombinationen aus einer „nicht ausschöpfbaren Menge von Kombinationsmöglichkeiten“ erlauben soll (vgl. Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1997, 190ff). So wird im Blick auf das Erziehungssystem nach einem „Transformationsbegriff“ gesucht, der besser als die Kind/ErwachsenenUnterscheidung den komplexen gesellschaftlichen Einlagerungen des Erziehungssystems und der Ausweitung seiner Grenzen Rechnung tragen soll. Vorgeschlagen wird der Begriff des „Lebenslaufs“: Der Lebenslauf als Medium und Form des Erziehungssystems. Der Lebenslauf wird definiert als „eine Beschreibung, die während des Lebens angefertigt und bei Bedarf revidiert wird“, als eine „Konjekturalbiographie“ im Sinne Jean Pauls. Deren Komponenten sind „Wendepunkte“: etwas, was auch jeweils hätte anders ausfallen können; kontingentes, das in einer „Integration von Nichtselbstverständlichkeiten“ nach Mustern über eine „rhetorische Leistung“ verarbeitet wird. Der Lebenslauf gilt hierbei einerseits als „Medium im Sinne eines Kombinationsraums von Möglichkeiten“, andererseits als „eine von Moment zu Moment fortschreitende Festlegung von Formen“. Beide Seiten seien „nur im Bezug aufeinander realisierbar“. Luhmann bringt den „Lebenslauf als Schema der Personwahrnehmung“ in einen engen Zusammenhang mit der Entwicklung der Massenmedien, mit einem „Verdrängen unmittelbarer Lebenserfahrung durch die Realitätskonstruktionen der Massenmedien“, denn ständig geschehe eine Eigenwahrnehmung vor dem Hintergrund von Mustern „formgewordener Lebensläufe“. Gerade weil es sich um ein „Produkt der Rhetorik und nicht um sachbasiertes Wissen“ handele, sei der so verstandene Lebenslauf zum „Medium für eigene Formbildungen“ des Erziehungssystems geworden. Dieses Medium erlaube dem Erziehungssystem die üblichen ‚selffulfilling-prophecy’-Operationen, weil von einer „Lebenslaufrelevanz“ bestimmter Formen und Schritte der Erziehung ausgegangen werden könne. Zu einem gesellschaftstheoretischen Problem wird derartiges für Luhmann dann, wenn diese Operationen nicht „in einer auf Erziehung zugeschnittenen Theoriesprache wiederzufinden sind“. Die Lehrerschaft und das „reflektierende Establishment“ der Pädagogik wissen dann schlechthin nicht, was sie tun, wenn sie das tun, was sie tun. So könne das Erziehungssystem also „nicht mehr teleologisch und auch nicht mehr adaptionistisch“ begriffen werden. Angenommen, Bücher zum Thema die Anregungen bewirkten ein über die Pädagogik zu vermittelndes „Reflexionsniveau“, wäre das Erziehungssystem mehr den Fragen nach der eigenen Autonomie ausgesetzt und mehr auf „Selbstorganisation“ und „Selbstbeurteilung“ verwiesen. Auch müßte sich die Pädagogik bei den Verlusten einer Plausibilität von Werten und Zielen eben mit diesen beschäftigen und mit sich selber. Dieter Lenzen wendet in seinem Aufsatz „Lebenslauf oder Humanontogenese?“ modifizierend ein, daß der Begriff „Lebenslauf“ stets auch mit teleologischen Konstrukten verbunden gewesen sei und dies auch heute noch sei. Zwar bestehe ein Bedarf an „nichtteleologischer Theorie“ im Sinne Luhmanns; aber es sei auch eine „Humanontogenese“ als andere Seite des kontingenten Lebenslaufes zu berücksichtigen, - gerade angesichts neuerer neurophysiologischer Forschungen, die ihrerseits in paradigmatischer Nähe zur Systemtheorie stehen. Lebenslauf und Humanontogenese könnten durchaus als „zwei Seiten eines Systemcodes“ im Erziehungsund Bildungsbereich gelten. Zwar komme damit eine vertraute „Binarität von Freiheit und Bestimmung“ ins Spiel, aber auch sei eine Destabilisierung geisteswissenschaftlicher Traditionslinien der Pädagogik zu erwarten, wenn es denn überhaupt 45 zu einer folgenreichen Rezeption jener Forschungen komme. In anderen Beiträgen des Bandes werden konkrete Anliegen an eine Neu- oder Umorganisation des Erziehungs- und Bildungsbereichs vorgestellt. In Jürgen Zinneckers Aufsatz „Sorgende Beziehungen zwischen Generationen im Lebenslauf“ wird eine „Novellierung des pädagogischen Codes“ gefordert, die statt des „Dualismus einer erziehenden und einer erzogenen Generation“ eine „Gesellschaft der vier zeitgleich lebenden Generationen“ berücksichtigen solle. Jürgen Wittpoth weist in dem Beitrag „Grenzfall Weiterbildung“ unter anderem darauf hin, daß die durch die Sozialgesetzgebung vorgesehene Weiterbildung von Arbeitslosen längst zu einem Instrument der Arbeitsmarktregelung und der Beschönigung von Statistiken geworden ist: Eine Planung von „Maßnahmekarrieren“ statt konkreter Hilfestellungen. Die „Lebensläufe“ müssen das dann anders erzählen. Es können hier nicht die Wirkungen von Luhmanns Anregungen eingeschätzt werden; denn die systemtheoretisch angeregten Beiträge sind eben systemtheoretisch angeregte Beiträge. Es sind Zweifel angebracht, inwieweit die Reflexionsabstufungen im pädagogischen Feld sozusagen kulminieren könnten, da ja für Luhmann die pädagogischen 46 Bücher zum Thema Reformen auch „von dem Irrtum (leben), unlösbare Probleme für lösbare zu halten“, und es zudem keine „logischen oder kosmologischen Zwänge“ gebe, von den Operationen der Systemtheorie auszugehen. Die Systemtheorie legt „Wert auf Distanz, nicht auf Nähe“: „Sie will irritieren, nicht legitimieren.“ In dem Sinne, daß „ein System tut, was es tut“ (Luhmann), gelangt die systemtheoretische Betrachtung zu den Ergebnissen, zu denen sie gelangt. Allerdings beansprucht sie, Anschlußmöglichkeiten, Möglichkeiten von Veränderungen sichtbar zu machen unter der Auflage, Paradoxien stets weiter zu bearbeiten in der Beobachtung des eigenen Beobachtens. Die hier versuchte Darstellung gelangt zu einem paradoxen Immanenzproblem der Systemtheorie Luhmanns: daß nämlich die ihr eigene Relativierung nur aus dem Theoriesystem ‚Theorie sozialer Systeme’ heraus sichtbar gemacht werden kann. Ignaz Knips Eva Ruge Sinndimensionen ästhetischer Erfahrung. Bildungsrelevante Aspekte der Ästhetik Walter Benjamins Münster / New York / München / Berlin 1997 (Waxmann-Verlag), 218 S., 49.90 DM. Es ist gar nicht so lange her (was sind fünfzehn Jahre für eine Disziplin wie die Philosophie?), daß Heinz Paetzold sich mit Recht über das Desinteresse der gegenwärtigen Philosophie für die Ästhetik beklagte.1 Als ob die Götter seine Klage gehört hätten: prompt avancierte die Ästhetik unabdingbar zu einer der wichtigsten Bereiche im philosophischen Diskurs der Gegenwart. Nicht nur deshalb, weil ihr weites Feld wichtige, immer wiederkehrende Probleme der Philosophie gut abdeckt, sondern auch, weil ihre Grenzen die Durchdringung anderer Bereiche, wie der Ethik ja sogar der politischen Theorie gut zulassen. So vermag die philosophische Ästhetik den Anforderungen, mit denen die Philosophie aktuell konfrontiert wird, am besten zu genügen.2 Nicht zuletzt, weil ein modus aestheticus viel geeigneter für den Umgang mit der Vielseitigkeit und den zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten unserer gegenwärtigen Welt ist als der modus logicus, der das philosophische Tun stark geprägt H. Paetzold, Die Ästhetik des deutschen Idealismus. Zur Idee ästhetischer Rationalität bei Baumgarten, Kant, Schelling, Hegel und Schopenhauer, Wiesbaden 1983. 2 J. Früchtl, Ästhetische Erfahrung und moralische Urteil, Frankfurt/Main 1996. 1 Bücher zum Thema und beeinflußt hat. Dieser modus aestheticus möchte allerdings auch gelernt sein und dafür gibt es keine bestimmte Regel; denn die Regeln, die wir brauchen, müssen in jeder neuen Situation, in jedem Kontext wieder neu gefunden werden. Nur durch Übung und durch Bildung können wir die dafür notwendige Sensibilität entfalten. Die Übung einerseits macht uns für diese Suche fähig. Die Bildung andererseits aber ist die Garantie, daß die dadurch getroffenen Entscheidungen sowie die entstandenen Meinungen mehr als nur vertretbar sind. Bildung und Ästhetik sind von daher untrennbar und traditionell seit je verbunden. Desto erfreulicher, daß Eva Ruge in ihrem neuen Buch den Akzent auf diese Zugehörigkeit und ihre Bedeutung vor allem für „das Projekt einer Rehabilitierung des Bildungsbegriffs“ (4) setzen möchte. Ein ehrgeiziges Projekt, das Ruge in der Einleitung eindrucksvoll und überzeugend darstellt und dessen Stoff für mehr als eine Dissertation reichen könnte. Ehrgeizig, weil Ruge die Verbindung zwischen Ästhetik und Bildung nicht in der klassischen Form behandelt. Sie wechselt die Perspektive. Statt zu fragen, wieviel Bildung oder welche Art von Bildung unsere Fähigkeit fordert, ästhetische Erfahrungen zu machen, möchte sie vielmehr wissen, wie ästhetische 47 Erfahrung und die dadurch gewonnene Erkenntnis für ein neues Verständnis von Bildung relevant sein kann. Diese Relevanz möchte Ruge hauptsächlich anhand der Ästhetik Walter Benjamins zeigen, wenn auch der Kant der dritten Kritik in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist. Vor allem, weil Eva Ruge schließlich durch die Verflechtungen zwischen Ästhetik und Bildung eine Brücke zwischen Philosophie und Pädagogik herzustellen beabsichtigt. Ästhetische Erfahrung ist zunächst eine subjektive Erfahrung, die ebenso in einem subjektiven Prozeß erlebt wird. Ruge glaubt jedoch, diesen Prozeß in sechs Momenten festlegen zu können. Was gleichzeitig diese ästhetische Erfahrung trotz Subjektivität für ein pädagogisches Programm tauglich macht. Diese sechs Momente oder Phasen ästhetischer Erfahrung ordnet Ruge wie folgt: Das erste Moment ergibt sich in der ersten Berührung mit dem, was bei uns den Prozeß der ästhetischen Erfahrung auslösen soll. Daraufhin und als zweites Moment wird eine Distanznahme erforderlich, die Ruge mit der Interesselosigkeit, die Kant auch den ästhetischen Urteilen zuspricht, verstanden wissen möchte. Hier ist eine kontemplative Haltung angesagt, die erst im dritten Moment durch Reflexion aufgehoben wird. Dieser 48 Bücher zum Thema Reflexionsprozeß ist nicht anderes als sich der möglichen zwangfreien Entsprechung zwischen Natur und Geist bewußt zu werden. Ruge spricht von Korrespondenz, ähnlich wie Kant von Übereinstimmung. Dieses dritte Moment könnte man dann mit der Erfahrung des Schönen zusammenfassen, bei der Harmonie und Lust im Mittelpunkt stehen. Bedeutend im vierten Moment ist die Sensibilisierung, die uns fähig macht, trotz der Subjektivität ästhetischer Erfahrung, offen für andere „Sinnentwürfe“ zu sein (58). Was Ruge unter Sinnentwurf versteht, ist so klar nicht. Ist man offen für die verschiedenen Möglichkeiten, individuell eine ästhetische Erfahrung zu machen, oder sind die verschiedenen ästhetischen Erfahrungen mehrerer Individuen, das was respektiert wird und für das man offen ist? Angesichts des nächsten Moments innerhalb des von Ruge konzipierten Prozesses, sollte man sich eher für die erste Variante entscheiden. Denn im fünften Moment ist der „Sinn der krisenhaften Selbstüberschreitung, ein Außersich- und Übersichhinaussein“ (61) erreicht. Anknüpfend an die Postmoderne, spricht Ruge hier ganz explizit von einer Ästhetik des Erhabenen. Sie sieht in der Erfahrung des Erhabenen die Möglichkeit der „Selbstbezogenheit und Selbstvergessenheit“ (62). Warum aller- dings diese Erfahrung so positiv sein soll, wie Ruge sie darstellt, scheint mir nicht sehr plausibel. Einerseits dient das Erhabene als Metapher vom „Erleben der heute permanenten gesellschaftlichen Krise“, so daß ein Weg gefunden wird für die Auseinandersetzung mit Erfahrungen, die unsere Wahrnehmungen, sowie unsere gewohnten Handlungsweisen zunächst überfordern. Andererseits wird ein Ausweg aus dieser Überforderung mit der Akzeptanz unserer Begrenzung und mit dem Verzicht auf ein Überlegenheitsgefühl gegenüber der Natur beschrieben - so Adornos Uminterpretation des Kantischen Gefühls vom Erhabenen -, ohne auf die Gefahren hinzuweisen, die dieses von Ruge auch sehr positiv bewertete, kathartische Moment in sich birgt. Eine „totale Selbstbezogenheit“ kann schnell in eine immer stärker werdende melancholische und passive Haltung münden, wie eine intensivere Beschäftigung mit Lyotards Begriff des Erhabenen zeigt.3 Auf die Konsequenzen einer totalen „Selbstvergessenheit“ hat bereits Kant am Beispiel des Enthusiasmus hingewiesen. Über die Irrationalität und die Fatalität, die manche terroristische Taten der Dieses Problem habe ich in „Ästhetik des Erhabenen. Burke, Kant, Adorno, Lyotard“, Wien 1994 ausführlicher behandelt; insb. S.91-116. 3 Bücher zum Thema Selbstvergessenheit begleiten, hören wir in den Nachrichten zu genüge. Das sechste und letzte Moment in dem von Ruge vorgeschlagenen Prozeß ästhetischer Erfahrung scheint mir daher besonders problematisch. Denn dieses „durch das über die 5. Stufe freigewordene produktive Potential“ soll einen „erneuten Durchgang durch die fünf Sinnebenen“ (64) ermöglichen. In diesem Zusammenhang hebt Ruge die Bedeutung der verschiedenen Übergangsphasen von einer Stufe in die andere hervor, die wiederum mehrere Einstiegswege in den Prozeß der ästhetischen Erfahrung zulassen. Daß ein wiederholter Durchgang der verschiedenen Stufen unsere „Selbst- und Weltverhältnisse“ positiv zu beeinflussen vermag, ist unbestreitbar. Auch das eigene Lernen kommt ohne ihn nicht aus. Wie aber diese ästhetische Erfahrung mitteilbar wird und für pädagogische Zwecke nutzbar gemacht werden kann, scheint mir nicht sehr überzeugend dargelegt zu sein. Außer wenn Bildung in einer sehr elitären Bedeutung gefaßt wird, was Ruges Darstellung nicht ausschließt. Auch wenn die Autorin erkennt, welche Bedeutung die ästhetische Urteilskraft im Zusammenhang mit ästhetischer Erfahrung oder ästhetischer Erkenntnis haben kann und auch wenn sie die Relevanz des Urteilsvermögens so- 49 wohl für eine an der Ästhetik angelegte Handlungstheorie (5-7) als auch für Bildung und Erziehung (S.65-68) mehrmals betont, erschwert Ruges ständiger Rekurs auf die Ästhetik des Erhabenen ein soziales Verständnis von Bildung. In diesem Punkt vermißt man bei ihr einen Blick auf die Tradition des Bildungsbegriffs, die für unser heutiges Verständnis von Bildung sehr prägend bleibt und ebenso auf die Tradition des Geschmacksbegriffs, wie z.B. bei Baltasar Gracián zu finden, an dem sich die „immanente“ - so Ruge - Verbindung zwischen Ästhetik und Bildung sehr deutlich erklären läßt. Vielleicht deswegen macht sich am Ende der Lektüre eine gewisse Enttäuschung bemerkbar. Die Ästhetik Walter Benjamins wird mit einer postmodernen Brille gelesen, was durchaus legitim ist, aber Ruges Vorhaben nicht einlöst. Die Bildungsproblematik sowie ihre Relevanz im Zusammenhang mit neuen Ansätzen in der Pädagogik kommt schließlich zu kurz und wird durch eine zum Teil interessante Sammlung von Zitaten schnell abgehandelt. Der LeserIn wäre etwas mehr geholfen, hätten beide Aspekte Eingang in die Diskussion gefunden. Vielleicht bleibt dies dem nächsten Buch von Frau Ruge vorbehalten. Sehr wünschenswert, ja fast notwendig wäre m.E., daß Ruge 50 Bücher zum Thema das nächste Mal eine etwas einfachere, ästhetische und für unsere Sinne freundlichere Sprache wählen würde. Trotz spannenden Themas erfordert die Lektüre des hier rezensierten Buches immer wieder Überwindung. Die Sätze und einige Termini sind zum Teil sehr kompliziert gebaut. Leider wird in der Philosophie sehr oft Originalität mit unnötiger Künstlichkeit verwechselt. Eine etwas literarische Ader wäre so schön!!! María Isabel Peña Aguado Bericht Jürgen Mittelstraß: Brauchen wir einen neuen Bildungsbegriff? Vortrag an der Karl Rahner-Akademie Köln, 7. Januar 1998 I. Jürgen Mittelstraß, derzeitiger Präsident der „Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie“, Professor für Philosophie an der Universität Konstanz und Mitverfasser der vom Kultusministerium der Landes Nordrhein-Westfalen betreuten Schrift „Bildung im Umbruch Schule der Zukunft“ (1997), hob hervor, mit dem Thema „Bildung“ nicht als Pädagoge oder Schulmann umzugehen, sondern von der Philosophie her. So gehe es zunächst um eine kritische Prüfung von Begriffen und Redeweisen, von Zeitsignaturen, die daraufhin zu befragen seien, ob sie denn einlösen könnten, was sie versprächen. „Bildung“ sei kein Anhängsel an ein wie auch immer lebbares Alltagsleben, kein Zusatzangebot für Erbauung und Freizeit, sondern integrierender Teil von Kultur und Orientierung, die menschliche Wesen und Gemeinwesen zu dem gemacht hätten und machten, was sie seien oder sein sollten. Kultur und Orientierung gelten hierbei als Dispositionen einer mündigen und tätigen Weltaneignung und -bearbeitung und einer Selbstformung, die Mit- telstraß mit einem „LeonardoZeitalter“ verbindet, in dem die Menschen seit nun schon geraumer Zeit lebten. Auch Kants Verständnis von „Aufklärung“, sich von einer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien zu können, gehöre in dieses Zeitalter, und vor allem, nun im Blick auf ein Verhältnis von Bildung und Ausbildung, Humboldts integratives Ideal einer Verwirklichung der jeweils „individuellen Idee“ in einer überdisziplinär angelegten Aneignung und Bearbeitung von Traditionen und von Neuerem, jeweils Zeitgenössischem: Bildung als „Erzeugung eines Universums in der Individualität“. Dem nun stehen für Mittelstraß Entwicklungen und Zeitzeichen entgegen, die nur scheinbar jenes Bildungsideal ersetzen oder ablösen könnten: „Information statt Wissen“, „Medien statt Erfahrung“ und ein „Wertewandel“ mit einer postmodernen Partikularisierung und Pluralität von Rationalitätsvorstellungen und vor allem von sozialen Lebensformen. So beklagte Mittelstraß die weiter zunehmende Zahl der 52 Bericht Ehescheidungen, die Aussichten auf eine vaterlose Gesellschaft und die mehr und mehr schwindende gesellschaftliche Funktion der Ehe, der Familie und der Kirchen. Zum Schluß des Vortrages ging es darum, was angesichts jener falschen Ablösungen eines universellen Bildungsbegriffs denn die Aufgabe der Schulen sei. Die Schulen sollten durchaus disziplinäres, also auf Ausbildung und berufliche Entwicklung ausgerichtetes Verfügungswissen vermitteln, aber auch verstärkt ein überdisziplinäres Orientierungswissen und ein integratives Lernen des Lernens. Gefordert sei so ein unzeitgemäßes Lernen in der Struktur einer unzeitgemäßen Schule. So sei die gymnasiale Oberstufe zu revidieren. Die Frage „Brauchen wir einen neuen Bildungsbegriff?“ wurde mit „Nein“ beantwortet, denn der alte sei noch nicht abgearbeitet. II. Gewiß stehen Fragen und Probleme der Verhältnisbestimmung eines Ausbildungs- und eines Bildungsauftrages der allgemeinbildenden Schulen im Mittelpunkt derzeitiger Erörterungen (vgl. hierzu den von Dieter Lenzen und Niklas Luhmann herausgegebenen Band „Bildung und Weiterbildung im Erziehungssystem“, Frankfurt/ Main 1997; s. auch die Besprechung in diesem Heft). Die Erörterungen aber verdecken mehr als sie klären können, wenn sie nicht von dem ausgehen, was der Fall ist, wozu auch die Frage gehört, welche Bildungsbegriffe und -vorstellungen genauer im Spiel sind. So müsste Mittelstraß etwa wissen, daß es seitens der Hochschulen zwar Klagen über eine mangelnde Allgemeinbildung von Studierenden gibt, andererseits aber auch stärker praxisorientierte Kurzzeitstudiengänge im Gespräch sind, die spezielle propädeutische Anforderungen an die Schulausbildung stellen. So stehen Schulen tatsächlich in einem Spannungsfeld zwischen Bildungsund Ausbildungsauftrag. Und wenn das so ist, sollten sich Bildungstheoretiker damit beschäftigen. Was Mittelstraß hervorhebt, nämlich von der Philosophie her eine Reflexion und Prüfung der verwendeten Begriffe zu leisten, geschieht gerade nicht. Sonst käme es nicht zu willkürlichen und historisch groben Epochalisierungen eines „Leonardo-Zeitalters“ und eines Zeitalters des Humboldtschen Bildungsideals. Bedenklich ist hierbei, ein humanistisches Menschenbild der Renaissance oder Humboldts Neuhumanismus als konstant und unverändert prägend zu unterstellen durch Markierungen etwa des industriellen Zeitalters und die Barbareien und Katastrophen des 20. Jahrhunderts hindurch und für ein nachindustrielles Zeitalter, von dem heute viel die Bericht Rede ist. So bleibt völlig offen, wie Mittelstraß die Wirkungen von Humboldts Bildungsideal datieren möchte. Die von Mittelstraß geführte Rede vom „Wertewandel“ ist offensichtlich von der Überzeugung getragen, daß sich bestimmte Werte nicht wandeln könnten oder gewandelt werden dürften, es sei denn um den Preis, sich von der menschlichen Gattung zu separieren. Dabei werden die Werte von Ehe, Familie und Kirchen hervorgehoben. Sie sollen denn Universalien sichern, die keiner Begründung bedürften. Mittelstraß bewegt sich so in einer wertekonservativen Dogmatik. Jener Wertewandel, eine Partikularisierung und Pluralität von Lebensformen, sei grundsätzlich inhuman und verfehle 'den Menschen'. Aber wie ist dann das von Mittelstraß sei es auch nur marginal - erwähnte Mündigkeitsideal der „Aufklärung“ unterzubringen? Bestimmt ließe es sich aus der Sicht von Mittelstraß nicht unterbringen im Sinne von Horkheimers und Adornos „Dialektik der Aufklärung“ (1947), die bekanntlich angesichts einer Geschichte der Aufklärung und der 53 Moderne die Invertierbarkeit von Prinzipien und Idealen zu bedenken gibt. Auch die späten Schriften Foucaults erheben Einwände gegen Sichtweisen, die Prinzipien und Ideale reflexionslos von ihrer Praxis und von der Geschichte ihrer Praxis abzulösen versuchen und folgenlos werden lassen in einer bloßen facon de parler (vgl. hierzu: Michel Foucault: Was ist Kritik?, Berlin 1992). In einer aktualisierenden Betrachtung von Kants „Was ist Aufklärung?“ (1784) geht es um Fragen der Befreiung aus einer „Unmündigkeit“ im Beherrschtwerden durch jene disparaten „Machtdispositive“, die hinter den vergangenen und gegenwärtigen Varianten eines dezisionistischen Prinzipiendenkens verdeckt sind. Soll eine Vorstellung von „Bildung“ die Ideale von Mündigkeit und Selbstbestimmung einschließen, muß die reflexionslose Unterstellung einer Idealität von Idealen ebenso suspekt bleiben wie die oft damit einhergehende subtile Diabolisierung des Wandels und der Veränderung überhaupt von Werten. Ignaz Knips Clemens K. Stepina Die Begriffe ‚Herrschaft’ und ‚Knechtschaft’ in den Ökonomischphilosophischen Manuskripten von Karl Marx Einleitung Gegenüber rein historischen Analysen versucht die folgende Arbeit, die Ökonomisch-philosophischen Manuskripte von Karl Marx als Synthese der Kritik bürgerlicher Ökonomie und Hegelscher Philosophie in zwei hermeneutischen Orientierungsstrukturen zu fassen: Die eine geht auf Ansätze von W. D. Hund1 zurück, der den Doppelcharakter im Marxschen Arbeitsbegriffs als Natur- und Gesellschaftskonstante faßt und so die freie Tätigkeit als stoffliche Existenznotwendigkeit, die entfremdete hingegen als aufzuhebende Form der Entäußerung begreifen kann. Die andere hat H. R. Jauß2 angedeutet; sie besteht in der Rekonstruktion der in den Philosophien von Hegel und Marx impliziten Handlungstheorien mithilfe des aristotelischen Dualismus von Poiesis und Praxis. Beide Deutungsstrukturen werden hier miteinander verknüpft und mit einer systematischen Analyse der Manuskripte verbunden. Die Ökonomisch-philosophischen Manuskripte (kurz: ÖphM)3 wurden 1844 niedergeschrieben und gelten in der Entwicklung von Marx als neuartige Synthese von Ökonomie und Philosophie. Sie entstanden aus der Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie einerseits und der Hegelschen Philosophie andererseits. Seit ihrer Veröffentlichung in der MEGA im Jahre 1932 - besonders aber in den fünfziger Jahren, als mit dieser Schrift „die bloßgelegten Ursprünge des Kommunismus als eines Humanismus ... im grellen Gegensatz zur inhumanen Gestalt der kommunistischen W. D. Hund, Geistige Arbeit und Gesellschaftsformation. Zur Kritik der strukturalistischen Ideologie, Frankfurt/Main 1973 (= Stud. z. Gesellschaftstheorie), bes. 21 ff. 2 H. R. Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt/Main 1984, 103-105 u. 114-117. 3 zitiert wird nach: MEW, Erg-Bd. l, S. 465-588. Zur Entstehungsgeschichte: S. XVII f. (Vorwort des Inst. f. Marxismus-Leninismus beim ZK der SED) 1 Herrschaft und Knechtschaft 55 Diktatur“4 standen - sind sie zum Gegenstand einer anhaltenden Kontroverse darüber geworden, welches Verhältnis Marx zum Idealismus um 1844 hatte. Diese Auseinandersetzung läßt sich in der Frage zusammenfassen, wie in seiner dialektischen Theorie die anthropologische Dimension zu beurteilen sei, nämlich daß er zum einen die gesellschaftlichen Verhältnisse des Menschen aus dessen Naturverhältnis heraus begreift, und daß er zum anderen das im Naturverhältnis erarbeitete schöpferische Potential des Menschen einem gesellschaftlichen Zusammenhang entgegenstellt, der im Begriff der entfremdeten Arbeit das sozioökonomisches Verhältnis von Herr und Knecht aufspannt. Der westliche, undogmatische Marxismus lobte die ÖphM wegen ihrer anthropologisch-humanistischen Prägung und benutzte sie als ein Kampfmittel gegen die sowjetmarxistische Sterilität, den Begriff des „Menschen“ durch den der objektivierenden „Produktivkraft“ zu ersetzen. So verschieden diese nicht orthodoxen Interpretationsansätze auch waren, so hatten sie doch als gemeinsamen Nenner, daß hier zwei zentrale Begriffe des Marxismus, Arbeit und Entfremdung, noch nicht in die eiserne Maske eines unkritisierbar wissenschaftlichen Sozialismus gegossen sind, sondern vielmehr das menschliche Antlitz eines jungen Philosophen offenbaren, der - wiewohl er diesen Begriffen eine unbestreitbar materialistische und sozialrevolutionäre Wende gibt - in fruchtbarer Weise die Auseinandersetzung mit ihrer idealistischen Herkunft sucht. I. Die Tradition der Herr/Knecht-Figur Seit dem Bestehen der abendländischen Philosophie drückt sich die Idee der menschlichen Freiheit in einem substantiellen Paradoxon aus, nämlich in der Gedankenfigur von Herrschaft und Knechtschaft, die auf der bipolaren Theorie von selbst- und fremdzwecklicher Arbeit gründet. Marx verstand es, aus dieser Struktur, von der griechischen Polis Aristoteles‚ bis zum preußischen Zensurstaat Hegels, die europäische ‚Welt‚geschichte der Freiheit des Menschen als ein in sich paradoxes J. Habermas, Literaturbericht zur philosophischen Diskussion um Marx und den Marxismus (1957). Anhang zu: ders., Theorie und Praxis, Frankfurt/Main 1989, S.389. 4 56 Clemens Stepina Gewaltverhältnis zwischen Ungleichen, also zwischen Herr und Knecht, zu deuten. Sein Versuch, diese Ungleichheit durch eine vorübergehende Verkehrung - der Arbeiter sei ‚Herr‚ und der Kapitalist ‚Knecht‚ - aufzuheben, lässt ihn als Vollender einer Tradition verstehen, die er doch zugleich überwinden wollte. 1. In seiner Politik, 1. Buch behandelt Aristoteles als erster antiker Philosoph den Begriff der menschlichen Tätigkeit im bipolaren Kontext von Herrschaft und Knechtschaft. Er nimmt im Tätigkeitsbegriff klassenideologisch eine Differenzierung in körperliche und geistige Arbeit, in fremdzweckliche Poíesis und selbstzweckliche Prâxis, vor: So wie in jedem Menschen das Selbst sich nur in der Regentschaft der herrischselbstdisziplinierenden Vernunft (Nous) über den sklavischfremdbegehrenden Trieb (Orexis) setzen könne, so bilde im Sozialgefüge das abstrahierte Selbst aller Menschen, die substantielle Polis als das Ziel des akzidentiellen Oikos, die Herrschaft des Nousträgers, des Herren, über für beide feiern: Der Herr als der Handlungsbevollmächtigte zur Zeugung des symbolischen Kulturakts5 setzt sich durch den Sklaven, der für den Herrn das poietische Werkzeug ist. In der aristotelischen Theorie ist also die Denunziationsstrategie an einem Naturrechtsverhältnis aufgehängt, die das Recht der herrschenden Klasse als ein quasi präexistentes, der körperlichen Arbeit vorgreifendes Recht legitimiert: Was der ‚minderfähige‚ Mensch als Poiesisträger, unter mehr oder minder deutlich ausgesprochener Todesandrohung6, in der Naturbezwingung an tränenreichem Werk herauswindet, wird im pathetischen Vor-Schein objektiv-naturgesetzlicher Produktionsverhältnisse zum schon fertigen, zum Werden sich stiftendes Potential des befähigten Praxisträgers, der dies Potential als Bürger oder Staat den Orexisträger, den Sklaven, ab (1254 b 2 ff.). Dieses Herrschaftsverhältnis bezeichnet Aristoteles ausdrücklich als gerecht7, weil durch die Natur vorgegeben. Dieser Kulturakt ist als soziale Praxis nichts anderes als ein Ausbeutungsverhältnis (vgl. 1280 a 13 ff.) unter dem Deckmantel der „gegenseitige(n) Freundschaft“ (1255 b 13 f.). 6 vgl. M.I. Finley, Die Sklaverei in der Antike, Frankfurt/Main 1985. 7 Mit tendenzieller Ausnahme der Sklaverei aus einem ungerechten Krieg: Pol. I, 1255 b 5 ff. 5 Herrschaft und Knechtschaft 57 Denn da Aristoteles annimmt, daß die Natur von den Ordnungsprinzipien bestimmt sei, wonach „immer Eines aus Mehrerem zusammengesetzt ist und ein Gemeinsames entsteht“, kann er sagen, daß in der Natur immer sich „ein Herrschendes und ein Beherrschtes“ (1254 a 29 ff.) zeige. Und weil er die soziale Ordnung der Naturordnung, als „zweite Natur“, nachbildet, kann er die Beherrschung des Sklaven durch den Herrn als Sieg der Vernunftdenker repräsentiert. 2. Bei Hegel, dem ‚Aristoteles‚ des Deutschen Idealismus, wird die Herr/Knecht-Figur im Paradigma des sich selbst setzenden Bewußtseins zu einer universalen und weltgeschichtlichen Kategorie weitergeführt. Im Rückgriff auf die aristotelischen Begrifflichkeit8 dient hier das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft dazu, den (welt)geschichtlichen Prozeß und die universale Konstituierungsproblematik der Arbeit als Bildungsmoment der bürgerlichen Gesellschaft auszugeben: Das Selbstbewußtsein muß sich, so Hegels naturrechtliche Ideologie der herrschenden Klasse als bourgeoisen Sinnbilds der Sittlichkeit und des Staates, um sich selbst als vernünftig einsetzen zu können, in einer selbstverwirklichenden Handlung qua Todeskampf als unterlegenes wie überlegenes Subjekt darstellen. In dieser Handlung wird jedoch der Primat nicht der Arbeit als der natürlichen materialen Gattungsäußerung (Poiesis) zugewiesen, sondern allein der bürgerlichen Geistespraxis, die die Vermittlung von Mensch und Natur immer schon voraussetzt. 9 Hegel hat die aristotelische Trennung von Praxis und Poiesis, und damit die Herr/Knecht-Figur, schon in seiner frühen rechtsphilosophischen Arbeit Über die wissenschaftliche Behandlung des Naturrechts ... (Werke, II, 434-529) übernommen und sie später, v. a. in der Phänomenologie des Geistes und den Grundlinien der Philosophie des Rechts systematisiert. 9 J. Habermas (Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie‘, Frankfurt/Main 1969) und A. Honneth (Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt/Main 1994) haben versucht, die handlungstheoretische Aporien, die der Herr-Knecht-Figur innewohnen, anhand einer Reformulierung der Jenenser Realphilosophie Hegels zu entgehen. Nicht mehr das Prinzip des Selbstbewußtseins oder der Arbeit, sondern das der Kommunikation, das bei den sprachlich agierenden Subjekten ansetzt, bzw. das der sozialen Beziehung wechselseitiger Anerkennung sei hier das Paradigma, das zugleich das der Moderne sei. Meines Erachtens läßt auch die Jenenser Realphilosophie sich nicht als Theorie intersubjektiver Beziehung interpretieren, sondern muß reflexionslogisch verstanden werden. Denn bei Hegel ist das Verhältnis des Liebenden zum Geliebten, von Verbrecher und Opfer, von Herr und 8 58 Clemens Stepina 3. Marx schließlich hat die Hegelsche Herr/Knecht-Figur des theoretisch-endlichen Selbstbewußtseins als Darstellungsverhältnis des Geistes in eine materialistische Knecht/Herr- (in ökonomischer Analyse: Arbeiter/Kapitalist-) Bewegung des praktisch-endlichen Selbstbewußtseins übersetzt und somit das idealistisch-denunziatorische Verhältnis von fremdzwecklich-instrumenteller Herstellung (Poiesis) und selbstzwecklich-emanzipatorischer Handlung (Praxis) umgekehrt. Diese Umkehrung konnte Marx gelingen, weil er in der Gegenüberstellung der materialen Arbeit des Knechts zu der Geistesarbeit des Herrn den Begriff der Entfremdung aus ihrem Ursprung, der entfremdeten Arbeit, gewonnen hat, und ihn auf alle Formen der Knechtschaft anwenden konnte. Entfremdung meint in Marx‚ ÖphM einen Zustand, in dem dem Menschen, in Verkehrung der Subjekt-Objekt-Dialektik, das Ergebnis seiner eigenen Arbeit verselbständigt gegenübertritt und als sachliche Gewalt beherrscht. Die entfremdete Arbeit ist demnach der Ursprung aller Entfremdung: Entfremdung vom Produkt der eigenen Arbeit, von sich selbst, vom Gattungswesen sowie von harmonischen Sozialverhältnissen; schließlich Entfremdung von der Natur und den eigenen fünf Sinnen (510 ff., 240). Marx nennt die so entfremdete Arbeit bei ihrem sozioökonomischen Namen: Sie ist Lohnarbeit unter der Gewalt des Privateigentums, und als solche Verkehrung der schöpferischen Gattungstätigkeit zum bloßen Mittel des rohen Selbsterhalts des Arbeiters wie verfeinerte Profitmaximierung für den Kapitalisten. Der Begriff der entfremdeten Arbeit drückt sich bei Marx also in sozioökonomischen Beziehungen aus. Diese werden im folgenden im Kontext von Herrschaft und Knechtschaft in zweifacher Weise nachvollzogen: Einmal als Ergebnis des Marxschen Studiums der Nationalökonomie seiner Zeit, das in den Kapiteln über Die entfremdete Arbeit und Privateigentum und Kommunismus enthalten ist (II); einmal als kritische Analyse des Knecht usw. kein „Kampf um Anerkennung“ zwischen wirklichen Menschen, sondern ein logisch-kategoriales Gehaltsmoment des Selbstbewußtseins, das erst dann in seinem - somit bewußt als defizitär konstruierten – ‚intersubjektiven‘ Intermezzo befriedet ist, wenn es in den absoluten Geist übergeht. Vgl. dazu J. Heinrichs, Die Logik der ‚Phänomenologie des Geistes‘, Bonn 1983, S.180 f. Herrschaft und Knechtschaft 59 Hegelschen Systems im Kapitel über die Kritik der hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt (III). II. Marx und die Nationalökonomie Marx bestimmt die Arbeit des Menschen - im Unterschied zum Tier - als bewußte und zweckgerichtete Formveränderung der Natur; sie ist allgemeine Bedingung des gesellschaftlichen Lebens. Die Stellung des Menschen zu sich selbst ist daher bestimmt durch die stoffliche Arbeit in zugleich gesellschaftlicher Form. Als solche drückt sie ein doppeltes Verhältnis aus: Die Beziehung des Menschen zur Natur wie die der Menschen zueinander - als Individuen und als Gattung. Dieses doppelte Verhältnis des Arbeitsbegriffs10 – stofflich als Verhältnis des Menschen zur Natur, der Form nach als gesellschaftliches Verhältnis – enthüllt für Marx die anthropologische Geschichtserkenntnis als ökonomische Gesellschaftstheorie; und es dient ihm, den Zustand einer Gesellschaft entweder als ein widersprüchliches – im Zustand der Nationalökonomie - oder als harmonisches Verhältnis – im Zustand des Kommunismus zu beschreiben. Der natürliche Mensch ist als Teil der Gattung im Sinne eines sich selbst erzeugenden Entäußerungsprozesses in der Arbeit das stoffliches Charakteristikum, das sich mit dem gesellschaftlichen dialektisch verschränkt: Als Naturbearbeiter ist der Mensch zugleich Gesellschaftswesen. Dieses Fürsichwerden des Menschen - die Entfaltung seines Wesens durch die „Vergegenständlichung“ in der Arbeit - vollzieht sich allein im Rahmen der historischen Formen der materiellen Produktion; dabei kommt der kapitalistischen Gesellschaft dieses fortschreitende Vergegenständlichungsmodell als „Entfremdung“, als soziale Beziehung der Ausbeutung zu. Diese soziale Beziehung der Ausbeutung ist jedoch, auf der Folie des Begriffs der entfremdeten Arbeit als Prinzip des nationalökonomischen Zustands, die spezifisch sozioökonomische Form der Arbeit als eines Herr/Knecht-Verhältnisses der Menschen zueinander: 10 zum doppelten Arbeitsbegriffs als Natur- und Gesellschaftsverhältnisse siehe: D. Hund, Geistige Arbeit und Gesellschaftsformation. Zur Kritik der strukturalistischen Ideologie, Frankfurt/Main 1973, bes. 21 ff. 60 Clemens Stepina Der Kapitalist als Herr wird zum persönlichen Repräsentanten der Macht des Kapitals als Geld - „die Eigenschaften des Geldes sind ... seines Besitzers ... Eigenschaften und Wesenskräfte“ (564); der Arbeiter als Knecht wird auf seine tierische Reproduktion - Erhaltung seiner „physischen Bedürfnisse“ (517) - reduziert. Das heißt: die Gattungsreproduktion als schöpferisch-genossenschaftlicher Arbeitsakt im Sinne der Gleichheit aller Menschen stellt sich im Kapitalismus in der Ungleichheit der Menschen als Verhältnis der ausgebeuteten Arbeit zum Geld dar. Im Geld, schreibt Marx, ist als einer fremden Macht das „entfremdete, entäußerte und sich veräußernde Gattungswesen der Menschen“ (510 f.) zu sich gekommen. Marx‚ Formulierung eines elementaren Widerspruchs des Seins als eines dynamischen Selbstverhältnisses in seiner Darstellung von Stoff und Form ist in der kapitalistischen Gesellschaftsformation ökonomisch evident geworden und deutet schon auf seine dialektische Aufhebung im Reich der kommunistischen Idee hin. Das Verhältnis des Menschen zur Natur wie zu seiner kapitalistischen Formbestimmtheit entbirgt sich als aporetisch: Auf der einen Seite sieht Marx das Reich der Freiheit, das im Kommunismus des verwirklichten Gattungswesens die Notwendigkeit der Ausbeutung der Arbeit aufhebt. Arbeit, wie es im ersten Band des Kapitals wohl im Rekurs auf die ÖphM heißt, wird hier definiert als „allgemeine Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens, vielmehr allen seinen Gesellschaftsformen gleich gemeinsam.“ (MEW 23, 198) Diesem Reich der Freiheit steht das Reich der kapitalistischen Notwendigkeit gegenüber, dem ein entsprechender Arbeitsbegriff korrespondiert: „Der Arbeiter fühlt sich ... in der Arbeit außer sich... Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen.“ (514) Nicht die Arbeit an sich, als gegenständliche Arbeit, entfremdet den Arbeiter von sich, sondern das soziale Beziehungssystem, in dem die Arbeit - als Ausdruck eines entfremdeten Naturverhältnisses – vollzogen wird. Damit entwickelt Marx die ökonomischen Kategorien seiner Kapitalismuskritik anhand der Stoff/Form-Figur für die Idee der vollkommenen Herrschaft und Knechtschaft 61 sozialen Einheit zu einer harmonischen Allseitigkeit sowohl der Gesellschaftlichkeit als auch der Selbstbestimmung weiter. Zum ersteren: Der natürlich vorhandene Widerspruch des Stoffwechselprozesses Mensch-Natur ist allen Gesellschaften als ein aufzuhebender in gleicher Weise inhärent: die menschliche Gattung muß die Natur kultivierend umformen, um die eigene, menschliche Natur gegen sie zu erhalten. Dieser Widerspruch hebt sich unter der nationalökonomischen Formation der Klassengesellschaft in der Form der Produktionsbeziehung des Arbeiters zu seinem Gegenstand auf, der sich, als Privateigentum, in der Gewalt des Kapitalisten befindet (517 ff.). Dieses Produktionsverhältnis ist als Rechtsverhältnis legitimiert und Ausdruck des kollektiven Erkenntnisinteresses der herrschenden Klasse. Hier tritt das stoffliche Element der Arbeit als Naturbearbeitung mit seinem Formelement als kapitalistische Lohnarbeit in einen unversöhnlichen Widerspruch, - bis hin zur revolutionären Krise, die als Weltrevolution zu einer weltgeschichtlichen Kategorie wird (537 ff.). – Zum zweiten: Arbeit an sich ist nicht nur allgemeingesellschaftliche Bestimmung der Gattung, sondern auch individuelle Selbstbestimmung des Menschen im Sinne von „Selbsttätigkeit, ...freier Tätigkeit“ (517), des „absoluten Herausarbeitens seiner schöpferischen Anlagen“11. Ist einmal die Einheit von Stoff und Form als Arbeit an sich in der utopia socialis wiederhergestellt, indem im Arbeitsprozeß die Gesellschaftlichkeit der Gattung und die Selbstbestimmbarkeit des Individuum einander bedingen und eins geworden sind, so wird, im dialektischen Wechselspiel, die Notwendigkeit der Arbeit zur Freiheit und die Freiheit der Betätigung wiederum zur Notwendigkeit12. 11 MEW 42, S.387. Dort heißt es weiter: „In fact aber, wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum anderes, als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen?“ 12 ÖphM, S.536: „Dieser Kommunismus ... ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen, die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbetätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung.“ Vgl. die diesbezüglichen Kritik von H. Marcuse, „Zur Kritik des Hedonismus“. In: Zeitschrift für Sozialforschung 1938, VII. S.80 ff, Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1969, S.129 ff. 62 Clemens Stepina Marx bestimmt die ökonomische Form des Kapitalismus als „zur Auflösung treibendes Verhältnis“ (533). Seine Analyse will zeigen, daß die kapitalistische Ideologie von der dialektischen Einheit von Stoff und Form nur scheinbar den Klassengegensatz aufhebt. Diese Ideologie werde als nationalökonomische Wissenschaft von den intellektuellen Stellvertretern des Staates thematisiert und produziert, die das Sittliche, das absolute Selbstverhältnis des Absoluten, unter dem Primat des endlichen Selbstbewußtseins als Herrschaft des Kapitals darstellt.13 Marx‚ kritische Analyse der Arbeit zeigt in diesem Stadium zwar, daß das Kapital sich geschichtlich als verdinglichte Gattung in der Nationalökonomie naturwüchsig als endliches Selbstbewußtsein darstellen mußte; sie entkommt aber nicht der Zirkelschlüssigkeit ihrer Argumentation: Die Strukturgleichheit des Kapitals mit der kapitalistischen Gesellschaft im Selbstdarstellungsmedium des nationalökonomischen Herrschaft/Knechtschaft-Modells ist die Selbstdarstellung des Absoluten, weil es den Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital ignoriert. Im Geld erscheint dieser auf der Ausbeutung beruhende Klassengegensatz aufgehoben. - Aber: Das Absolute teilt sich als die Stoffursache in der Form von Staat und Sitte im Herrn mit. Er allein kann das Stoffpotential des Kapitals vernünftig formieren, da er es ja – unter der Bedingung von Ausbeutung - stofflich repräsentiert; und nicht der Knecht, der es zwar in seiner Selbstentfremdung formiert, aber nicht stofflich repräsentiert. Somit wäre, zumindest rein theoretisch, eine - wie immer auch ideologisch verzerrte - Staatsform möglich, die de jure sich die gesellschaftlichen Lebensformen im Sinne von Klassen unterordnet; de facto freilich ist die kapitalistische Staatsform nichts anderes als die repraesentatio 13 ÖphM, S.531: „Nicht nur wächst der Zynismus der Nationalökonomie relativ von Smith über Say bis zu Ricardo, Mill etc., insofern die Konsequenzen der Industrie den letzteren entwickelter und widerspruchsvoller vor die Augen treten, sondern auch positiv gehn sie immer und mit Bewußtsein weiter in der Entfremdung gegen den Menschen ..., aber nur weil ihre Wissenschaft sich konsequenter und wahrer entwickelt. Indem sie das Privateigentum in seiner tätigen Gestalt zum Subjekt machen, also zugleich den Menschen zum Wesen und zugleich den Menschen als ein Unwesen zum Menschen machen, so entspricht der Widerspruch der Wirklichkeit vollständig dem widerspruchsvollen, das sie als Prinzip erkannt haben. Die zerrissene Wirklichkeit der Industrie bestätigt ihr in sich zerrissenes Prinzip, weit entfernt, es zu widerlegen. Ihr Prinzip ist ja das Prinzip dieser Zerrissenheit.“ Herrschaft und Knechtschaft 63 dominorum. Marx indes postuliert: Alle Menschen sind gleich; aber manche sind, da sie in sich das Stoffpotential der Arbeit tragen, über eine revolutionäre Periode hinweg gleicher. Dies ist im Diktum von der vorübergehenden „revolutionären Diktatur des Proletariats“ qua Knechtschaft/Herrschaft-Figur festgelegt14. Somit hat der kommende Mensch, gestiftet durch die Idee der vollkommenen sozialen Einheit, sich aus der Idee der harmonischen Menschengattung als Klassenbegriff abzuleiten. Diese sei in ihrer absoluten Verkehrung kapitalistischer Produktionsverhältnisse schon in der Arbeiterklasse (d. i. methodisch ein kollektives Subjekt des nun ökonomisch zu evozierenden Gattungsbegriffs) angelegt; sie müsse nur klassenkämpferisch hervorgebracht werden: „ ... Die Emanzipation der Gesellschaft vom Privateigentum etc., von der Knechtschaft, (spricht) in der politischen Form der Arbeiteremanzipation sich aus..., nicht als wenn es sich nur um ihre Emanzipation handelte, sondern weil in ihrer Emanzipation die allgemein menschliche enthalten ist, diese ist aber darin enthalten, weil die ganze menschliche Knechtschaft in dem Verhältnis des Arbeiters zur Produktion involviert ist und alle Knechtschaftsverhältnisse nur Modifikationen und Konsequenzen dieses Verhältnisses sind.“ (521) Das heißt, daß Marx einerseits die moralische Forderung nach einem Gattungsverhältnis einklagt, in dem sich semimythologisch eine soziale Einheit unentfremdeter Produktionsverhältnisse vorkapitalistischer Prägung vorfindet. Andererseits aber hat dieser Zustand durch eine soziale Revolution zu erfolgen, die auf die kapitalistischen Entfremdungsformen der wissenschaftlich-technischen Revolution zurückgreifen soll (dies hatte Marx eindrücklich gegen Lists utopischen Sozialismus erstritten und im Lob der Industrie besungen). Marx‚ Hypothese ist nun die, daß er erstaunlicherweise dem zutiefst entfremdeten Wesen des Kapitalismus das zu entbergende wahre Gattungswesen im Keim der Arbeiterklasse repräsentiert sieht. Wenn Marx in ökonomischen Kategorien davon 14 zur „revolutionären Diktatur des Proletariats“ siehe: Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, 28; zur „Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt“ siehe: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, MEW 7, 89 f. - Beide sind in den ÖphM schon angelegt. Siehe das folgende Zitat. 64 Clemens Stepina spricht, daß das Kapital mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, ja aufzulösen wäre, dann heißt das im Rückbezug auf die Wurzeln seiner anthropologischen Geschichtstheorie, daß er schlichtweg die Neuerschaffung des Menschen, die Aufhebung des ‚kapitalistischen Sündenfalls‚, einklagt. Weil die menschliche Arbeit bei Marx als zentrales Instrumentarium eines harmonischen Vergegenständlichungsmodells fungiert, enthält sie die Idee einer sozialen Einheit nur in einem Begriff der Arbeit, der eine harmonische Gattung in sich trägt. Vertreter dieser Gattung sind die „sozialistischen Menschen“ (542), die in ihrer poietischen Welterschließung schon das Produkt der genossenschaftlichen Gattungstätigkeit noch ausgebeutet - in sich tragen. Die wahre Sittlichkeit des Menschen ist daher nur durch seine Arbeit als das Primum gesellschaftlicher Praxis zu entbergen. Insofern deutet der Arbeiter im endlichen Selbstbewußtsein poietischer Arbeit - ist diese von kapitalistischer Entfremdung zur sozialistischen Vergegenständlichung befreit - auf den endzeitlichen Zustand sozialer Harmonie hin. Ist in ihr doch das instrumentelle Herstellen als materiale Praxis normativ verbürgt. Die geschichts- wie erkenntnisbildende Rolle der Arbeit zeitigt für Marx also das Proletariat als Richtschnur für eine kommende Menschheit.15 Der Schluß liegt nahe, daß Marx die bei Hegel vorgefundene Herr/Knecht-Figur16 des theoretisch-endlichen Selbstbewußtseins zur Knecht/Herr-Figur des praktisch-endlichen Selbstbewußtseins verkehrt hat. Steht hier der Mensch als die in gemeinschaftlicher Arbeit zu sich kommende Gattung als Desiderat kommunistischer Universalität da, so muß dort - im kapitalistischen Begriff der Gattung - der Mensch als sich 15 Vgl. Ch. Taylor, Hegel, Frankfurt/Main 1983, S.550: „Solange sich der allgemeine Mensch in Widerspruch zu seiner tatsächlichen historischen Verkörperung in der Klassengesellschaft befindet, kann der Mensch nicht deutlich erkennen, was er tut. Aber wenn dieser Widerspruch durch das Proletariat überwunden wird, wird sein Handeln selbstbewußt.“ 16 Diese Figur erscheint hier, obgleich Marx der Sache nach nur die Nationalökonomie behandeln will, zeitweise als Konglomerat nationalökonomischer Empirie und Hegelscher Theorie. Das erklärt auch, weshalb ursprünglich in die nationalökonomisch orientierten Kapiteln der Arbeit immer wieder Passagen zu Hegel eingestreut waren, die erst in den MEGA- und MEW-Redigierungen zum geschlossenen Kritikteil zusammengefügt wurden. Vgl. ÖphM, Anm. 118, 120 und 121 sowie die Anm. 99 generell. Herrschaft und Knechtschaft 65 entfremdeter, durch das Geld als Sinnbild des verkommenen Mußemenschen agieren (564). Beides zeigt an, daß die angestrebte Gesellschaftskritik nationalökonomischer Strukturen mit der Einführung des doppelten Verhältnisses der Arbeit als Stoff und Form das Defizit der Abstraktheit anthropologischer Geschichtstheorie nur in der Abstraktheit ökonomischer Theorie verdoppeln kann: Das gezeichnete Bild der kapitalistischen bzw. der kommunistischen Gesellschaftsformation besteht während dieser Phase der Marxschen Analyse erst noch als Ansatz. Es ist viel mehr durch eine spekulative Ideenlehre17 im Sinne einer materialistischen Umdeutung der Begriffe der hegelisch determinierten Nationalökonomie gekennzeichnet, als durch - so Marxens eigenes Selbstverständnis - „eine ganz empirische“ (467) Quellenforschung. III. Marx und Hegel In der Auseinandersetzung mit der „Hegelschen Dialektik“, namentlich der Phänomenologie des Geistes, lobt Marx Hegel dafür, das Wesen der Arbeit begriffen, d. h. mit den Termini Entfremdung und Vergegenständlichung erfasst zu haben (574); wiewohl er nicht an der Kritik spart, diese erfahren bei Hegel eine idealistische Gleichsetzung. Was die logische Figur der Entfremdung konkret bedeutet, lässt sich am deutlichsten in Hegels Erörterung der Arbeit im Kontext seiner Herr/Knecht-Figur ablesen. Da einer der ersten Schritte zur eigenen Arbeitswertlehre für Marx bekanntlich darin bestand, diese Figur materialistisch umzukehren, soll im folgenden dieses Umfeld des Hegelschen Arbeitsbegriffs näher untersucht werden. 17 Das ist auch der Grund, weshalb Marx in den ÖphM (510 f.) die widerspruchsvolle gesellschaftliche Entwicklung noch spekulativ als Akkumulation des Elends ausgibt, während sie in den gefestigten Ökonomiestudien als Gegensatz von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen analysiert wird. Diese Ökonomisierung ist insofern von tragender Bedeutung für den Arbeitsbegriff, da Marx dadurch das undifferenzierte, utopische Naturverhältnis einer kommenden Gesellschaft als ein differenziertes, realökonomisches Gesellschaftsverhältnis - qua Negation der kapitalistischen Gesellschaftsformation - zu deuten vermag. Damit entfällt allerdings zunehmend die Natur als Pendant der menschlichen Selbstschöpfung. Vgl. MEW 23, S.198; MEW 25, S.828. 66 Clemens Stepina Im Abschnitt Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft in der Phänomenologie (Werke III, Frankfurt 1986, S.145-155) versteht Hegel Arbeit als die Verwirklichung eines Zweckes; diese wird durch den Übergang eines Subjekts zur Selbstobjektivierung erklärt. Der Zweck als inneres Motiv entfaltet sich nur durch die Verwirklichung seines Anderen, des Objekts. Der Begriff der Entfremdung oder Entäußerung (hier wird nicht differenziert), der die zentrale erkenntnistheoretische Kategorie zur Erfassung der Subjekt-ObjektDialektik wird, ist bei Hegel als ein Prozeß bestimmt, in welchem das Subjekt durch seine objektive Außenwelt zu sich selbst kommt und wirklich wird. Auf der höchsten Stufe gegenseitiger Durchdringung von Subjekt und Objekt ist es, so idealistisch Hegel, der Geist selbst, der sich als reines Selbstbewußtsein anschaut. Am Herr/Knecht-Beispiel verdeutlicht Hegel „die Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins“ (145) im Geiste der aristotelischen Tradition: Das Selbstbewußtsein muß, um sich als vernünftig setzen zu können, sich in einer selbstverwirklichenden Handlung qua Todeskampf als unterlegenes, als Knecht, sowie als überlegenes, als Herr, manifestieren. Trotz der ‚antiken‚ Ideologie, der Staat könne sich nicht anders als durch den Primat des Geistes darstellen, hat Hegel mit seiner Rehabilitierung des Verwirklichungsvorgangs des Menschen als Poiesis, als reiner, zu sich selbst kommender Entäußerung, doch seinen eigenen Idealismus überwunden. Diese Überwindung kündigt sich dadurch an, als daß der erscheinende „Werkmeister“ Geist sich selbst nur durch seine Tätigkeit gegenständlich ist. Das Medium dafür aber ist die poietische Arbeit; in ihr durchdringen sich Subjekt und Objekt wahrhaft. Der produzierende Mensch ist in seinem Anderssein bei sich: „Die Wahrheit des selbständigen Bewußtseins ist demnach das knechtische Bewußtsein. Dieses erscheint zwar zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit des Selbstbewußtseins. Aber wie die Herrschaft zeigte, daß ihr Wesen das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegenteile dessen werden, was sie unmittelbar ist; sie wird als in sich zurückgedrängtes Be- Herrschaft und Knechtschaft 67 wußtsein in sich gehen und zur wahren Selbständigkeit sich umkehren.“ (152) Zwar schaut der Knecht sich im Medium der Arbeit selbstbewußt in seiner Entäußerung, in seinen Produkten an; jedoch ist diese Anschauung eine gegen ihn gekehrte. Zwar herrscht der Herr über den Knecht, bzw. unterwirft sich der Knecht dem Herrn; aber der Herr kann, da er wesenhaft weder Muße und Genuß von den, vom Knecht geschaffenen, Gegenständen erfahren kann, selbst kein Selbstbewußtsein erreichen. Den Schlüssel für diese Beziehung nennt Hegel hier „das Gefühl der absoluten Macht“ (153) als ontische Struktur. – Die hier erreichte Position der Dialektik von Herr und Knecht nimmt Hegel dann jedoch in den Grundlinien der Philosophie des Rechts zurück. Dort denkt er die ontologische Primatstellung des Geistes, wenn er darstellt, wie die sittliche Natur zu ihrem tatsächlichen Recht gelangt, nämlich durch die Dominanz der Vernunft (Zeichen des Herrn) über die Begierde (Zeichen des Knechts). Bei all dem bleibt Hegel jedoch die Einsicht in den nationalökonomischen Zustand, d. h. die Kapitalismusstrukturen dieser Ideologie, verwehrt. Er unterschlägt das realdialektische Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit und rechnet in naturrechtlicher Spekulation das Primum der Sittlichkeit den Herren als deren eigentlichen Inhaltsträgern zu. Die Arbeiter sowie ihre „Geschicklichkeit“ als „reine Form“ des „Wesens“ (Werke III, 155) gelten ihm, da sie ihren Zweck außer sich haben, als ehrlos. Hegel vollendet damit die Geschichte des abendländischen Denkens als einer Geschichte der Legitimation der Philosophie durch das Dogma der Trennung der geistigen von der körperlicher Arbeit (Freiheit und Notwendigkeit), das mit der logischen Figur der Entfremdung jede Möglichkeit der Synthese von Muße und Arbeit denunziert. Mit einem Wort: „Die Naturrechtslehre (ist) mit Hegel vollkommen zu Ende gedacht“ worden18. Während im Mythos der homerischen Helden körperliche und geistige Arbeit „noch nicht gänzlich [voneinander; Vf.] getrennt waren“19, etabliert die aufkommende Philosophie den ideologischen 18 N. Bobbio, Hegel und die Naturrechtslehre. In: M. Riedel, Materialien zur Hegelschen Rechtsphilosophie, Frankfurt/Main 1975, S.81. 19 E. C. Welskopf, Probleme der Muße im alten Hellas, Berlin 1962, S.120; auch: B. Snell, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1946, S.18 f. 68 Clemens Stepina Überbau des entstehenden Privateigentums als Logos: die Arbeit, mit der Formierung der Klassengesellschaft zur Zwangsarbeit geworden, wird in den idealistischen Begriffen der Philosophie als eine „Naturnotwendigkeit“, im Sinne eines objektiven Scheins ihrer Kategorien, widergespiegelt. Marx‚ zweifellose Leistung, wenn auch utopische Forderung nach der Einheit von Freiheit und Notwendigkeit wie von Praxis und Poiesis, liegt nun darin, dem idealistischen, d.h. „abstrakt geistigen“ (574), Begriff der Arbeit sein materialistisches Wesen im Sinne einer historischen Umkehrung Hegels enthüllt zu haben. Für ihn besteht die erkenntnisbildende Rolle der Arbeit in der sozialethischen Gewißheit, daß sie nicht nur als Werkzeug zum materiellen Reichtum aufgefasst werden kann, sondern vor allem als zentraler Schlüsselbegriff für das gesellschaftliche Ideal der sozialen Einheit. Sein genuiner Entwurf eröffnet sich chronologisch am fruchtbarsten dort, wo der philosophische Entfremdungsbegriff Hegels mit dem einer Kritik an der klassischen Nationalökonomie zusammengedacht wird. Denn damit wird der Begriff Entfremdung zum realdialektischen Instrumentarium der Gesellschaftskritik. Dieser übersteigt jedoch die Hegelsche formallogische Figur der Entfremdung nicht, ohne sie ‚ökonomisch‚ rezipiert zu haben. Marx kritisiert Hegel wegen des Primats des Geistes in dessen Entfremdungsbegriff; Hegel wolle überhaupt die sinnliche Gegenständlichkeit aufheben, damit die eigentliche ‚Vergegenständlichung‚ des Menschen als reines Bewußtsein – gegen die sinnlichtätige Anschauung - sich selbst darstellen könne. Mit anderen Worten: Hegel habe die Vergegenständlichung nur als Darstellungsmittel zu ihrer Aufhebung durch das synthetische Selbstbewußtsein mißbraucht, das sich als wahre Gegenständlichkeit bei ihm nur in der Abstraktion erfüllt. Das Wahre sei für Hegel die Idee, und die Natur werde für die Darstellung ihres Andersseins mißbraucht (584 f.). Entfremdung kann somit für Hegel nur ein negativ besetzter Begriff bleiben, da die wirklichen Subjekte – die bei ihm zu Funktionen der allgemeinen „mystischen Substanz“ werden - nicht zwischen sinnlichen Gegenständen überhaupt, die sich durch harmonische Vergegenständlichung qua menschliche Selbstbestimmung entbergen, und deren gesellschaftlich entfremdeten Form unterscheiden können. Gegen diese Ignoranz der Differenz, „die Lüge Herrschaft und Knechtschaft 69 seines Prinzips“ (581), die unwesenhafte Erkenntnisleistung der Herren (Kapitalisten) als ontologischen Naturzustand zu interpretieren, verwehrt Marx sich aufs Schärfste. Diese inhaltlich absolute, formal relative Differenz der Entfremdungsmodelle zieht dann in der Entwicklung des Hegelschen und Marxschen Systems ihre sich voneinander entfernenden Kreise. Um nicht sich die Blöße eines vordergründigen Zirkelschlusses zu geben, muß auf ein bestehendes Ganzes, d. h. Absolutes, der Wirklichkeit rekurriert werden. Für Hegel ist dies Absolute die Idee des Weltgeists, den er als sittlichen Mantel den Herrn, der Bourgeoisie, umwirft. Für Marx ist es in Übersetzung dieser Hegelschen Idee die materiale Idee einer Gattung20, die die Knechte, das Proletariat, wie aus der kommunistischen Pistole geschossen, stiften sollen21. Von der Marx wohlweislich als von einer „ideelle[n] Totalität“ (579) schreibt. Derart inspiriert spricht etwa Trotzki vom Menschen in der „kommunistischen Lebensweise“ als von einem Menschen „höheren gesellschaftlich-biologischen Typus“, von „einem Übermenschen“ (L. Trotzki, Literatur und Revolution, Berlin 1972, S187 ff.). 20 21 Martin Schraven Vom Siechtum der deutschen Philosophie „Ich bin der Dr. Eisenbart, kurier die Leut nach meiner Art ...“ (Deutsches Studentenlied, um 1818) Die Philosophie ist der Kritik ausgesetzt. Das ist nichts Neues, ist die Kritik doch eines ihrer Lebenselexiere. Sie selbst kritisiert fortwährend andere Positionen und kritisiert sich selbst; warum sollte sie nicht auch von anderen kritisiert werden? Ein Dummkopf also, der glaubte, die Wissenschaft der Wissenschaften, die Hüterin über These und Antithese, sei der Kritik enthoben. Warum sollte es der gegenwärtigen Philosophie anders ergehen, wenn sich schon Thales der Häme einer thrakischen Magd aussetzen mußte? Den jüngsten, aber gewiß nicht letzten Versuch, die Patientin „philosophia“ zu kurieren, unternahm nun Joachim Jung aus Wien.1 Was er vorfand, ist keine mit Lebenslust erfüllte junge Frau. Sie vermag schon längst nicht mehr, dem Manne in schwierigen Lebenslagen Trost zu spenden. Nach Jungs Diagnose ist es schon euphemistisch, die philosophia überhaupt als Patientin zu bezeichnen, die bloß zu kurieren wäre; sie befindet sich vielmehr im Zustand des Siechtums, dem Tode näher als der Genesung. Jungs Buch über den „Niedergang der Vernunft“ ist also eine Polemik. Sie ist erfrischend in ihrer Respektlosigkeit, sie ist in manchen Teilen sehr einseitig, und sie ist oft sehr ungerecht. Dies alles gehört zu einer Polemik, und wenn der Nutzen den Schaden überwiegt, sollte man ihr und ihrem Autor die kleineren und größeren Unsachlichkeiten nachsehen. Dabei zielen Jungs Pfeile nicht so sehr auf die Philosophie im allgemeinen, sondern eher auf die akademische Philosophie und vor allem den Philosophiebetrieb, wie er sich an den Universitäten in den deutschsprachigen Gegenden Europas etabliert hat. Unter „deutscher Philosophie“ will er also die akademische Philosophie in DeutschJoachim Jung, Der Niedergang der Vernunft. Kritik der deutschsprachigen Universitätsphilosophie, Frankfurt/New York 1997. 1 Vom Siechtum der deutschen Philosophie 71 land, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz verstanden wissen. Joachim Jung ist vom Fach; seine Polemik ist also ernst zu nehmen. Er hat sein Philosophiestudium mit der Promotion abgeschlossen, lebt heute als freier Journalist in Wien und ist Herausgeber der kleinen Philosophiezeitschrift „Kontroversen in der Philosophie“. Also hat er sich nach seinem erfolgreichen Studium nicht von der Universitätsphilosophie umarmen und unterkriegen lassen. Die Anamnese Jung breitet sehr viele Krankheitssymptome aus. Nur einige markante sollen hier zitiert werden: Die deutsche Philosophie ist nicht mit den brennenden Problemen dieser Welt, sondern meistens nur mit sich selbst beschäftigt; sie schaut nicht über ihren eigenen Tellerrand hinaus, ihr ist das praxisnahe Denken fremd (14). „Die Welt der Wissenschaft“ (offenbar also nicht nur die der Philosophie!) „leidet an Realitätsschwund. Man lebt scheinbar abgehoben von den Erscheinungen des Alltags auf den Bergen des Daseins, zwischen Eis und Fels, von Nebelschwaden umwabert, und nimmt die Realität im Tal nur noch wie eine winzige Spielzeuglandschaft wahr“ (172f.). Signifikant für das geistige, praxisferne Klima, das im gegenwärtigen Philosophiebetrieb herrscht, ist der Umgang deutscher Philosophieprofessoren untereinander. Die Professoren vermeiden, wenn sie auf Kongressen unter sich sind, die inhaltliche Auseinandersetzung. Statt dessen tausche man sich über Stellenbesetzungen und die Schwächen der nicht anwesenden Kollegen aus. Des weiteren nehmen die Herren Professoren nur sich selbst und ihre gleichrangigen Kollegen ernst. Die Meinungen von Studenten oder Angehörigen des akademischen Mittelbaus sind grundsätzlich nicht diskussionswürdig. Und Widerspruch und Kritik an einzelnen Lehrmeinungen werden stets als persönliche Beleidigung aufgefaßt (168f.). Darüber hinaus kann man ganz allgemein eine Abschottung der verschiedenen philosophischen Schulen untereinander feststellen, die soweit geht, daß einzelne Professoren anderen allein deswegen die Kompetenz bestreiten, weil sie sich einer anderen Denkrichtung, einer anderen philosophischen Tradition zurechnen. 72 Martin Schraven Die deutsche Gegenwartsphilosophie befaßt sich „fast ausschließlich mit der Aufarbeitung von historischem Wissensgut“ (15). Bei dieser Rezeption des tradierten Gedankenguts verstehen ihre gegenwärtigen Bearbeiter und Verwalter nicht einmal, die ohnehin komplizierten Gedankengänge der „Originaldenker“ in eine einfache und zeitgemäße Sprache zu übertragen, sondern drücken sich „noch komplizierter, noch weitschweifiger und unverständlicher“ als ihre Ideenlieferanten aus. Damit lösen sie nicht einmal jene Aufgabe, die den Philosophiehistorikern (wenn überhaupt) allein noch zugestanden werden kann: die Vermittlung der Vergangenheit an die Gegenwart. Kann man behaupten, Jung habe mit seiner Zustandsbeschreibung der deutschen Philosophie das Thema verfehlt? In diesem Falle könnte man sein Buch ohne Kommentar beiseite legen, dann wären auch diese Zeilen ein zu großer Aufwand. Jung trifft seinen Gegenstand; er legt nicht nur auf eine sehr populäre Art und Weise seine Finger in einige Wunden des gegenwärtigen Philosophiebetriebs, sondern in seiner Polemik drückt sich auch das Ohnmachtsgefühl aus, das vor allem viele Studenten befällt, wenn sie sich durch das Gestrüpp der gegenwärtigen philosophischen Institutionen (Einrichtungen und Lehren) hindurcharbeiten sollen. Auch artikuliert Jung Bedürfnisse der gegenwärtigen Studentengeneration. Wenn er etwa von den Philosophiehistorikern fordert, daß sie die komplexen Gedankengänge der großen Philosophie „in kleine handliche Teile zu zerhacken“ haben (16), damit das philosophische „Gedankengestrüpp“ (ebd.), das jene Philosophen hinterlassen haben, begehbar würde, dann äußert sich darin das Bedürfnis nach schnellen und knappen Informationen, die möglichst nicht länger als ein Werbespot sein dürfen. Das mag man bedauern und sich fragen, wie solche Leute das Philosophieren lernen sollen; aber man kann die Augen vor der Wirklichkeit dieses Bedürfnisses nicht verschließen. Daß die Sozialisation dieser Studentengeneration wenigstens zum Teil durch das Fernsehen vollzogen worden ist, und daß damit die Aufnahmefähigkeit besonders durch dieses Medium geprägt wurde, wird niemand ändern können. Die Diagnose Vom Siechtum der deutschen Philosophie 73 Auf der Suche nach den Ursachen des beschriebenen Siechtums ist unser Arzt fündig geworden. Die komplizierte Sprache, mit der die Autoren vorgeben, eine komplexe Sache adäquat und nicht vereinfachend zu erfassen und zu vermitteln, sei nicht bloß eine Unfähigkeit, sich verständlich auszudrücken. Es äußere sich darin vielmehr ein typisches Verhältnis der Philosophieprofessoren untereinander und zu ihren Studenten: Diese Sprache sei das Mittel, fachliche Unfähigkeit und Unwissenheit zu verbergen und sich vor kritischen Nachfragen zu schützen. Denn wer wagt schon eine kritische Nachfrage zu etwas vorzutragen, was er nicht so recht verstanden hat? Und wer will durch eine ungeschickt gestellte Frage direkt oder indirekt eingestehen, der Sache nicht gewachsen zu sein? Wer schon auf philosophischen Kongressen war, kennt das Geraune der Versammelten, wenn jemand eine Frage direkt zur Sache stellt. Auch in den philosophischen Zeitschriften finden wirkliche Auseinandersetzungen zur Sache eher selten statt. Es gibt in der philosophischen Sekundärliteratur viele Beispiele, auf die Jungs Kritik zutrifft. Aber warum versäumt er es, seine Kritik an treffenden Beispielen darzustellen? Einige wenige aus dem Kontext herausgerissenen Zitate können seine These nicht belegen. Es wäre informativ und für die Schwere seiner Vorwürfe sogar zwingend gewesen, die Hohlheit mancher philosophischer Abhandlung an dem einen oder anderen Beispiel aufzuzeigen. Dies allerdings hätte eine recht mühsame Textanalyse erfordert, für die Jung wohl nicht die Zeit und vielleicht auch nicht die Geduld aufbringen wollte. (Siehe oben!) Aber die bloße Behauptung z. B., daß das, was Rolf-Peter Horstmann in seinem Buch „Die Grenzen der Vernunft“2 präsentiere, „bereits in zahllosen Untersuchungen veröffentlicht worden“ (54) sei, so daß der Neuigkeitswert dieses Buches gegen Null strebe, ist dreist, solange der Nachweis nicht erbracht wird. Sicher hat Jung recht, daß viele Verfasser sich nicht der Disziplin unterwerfen wollen, ihre Ausdrucksmittel einer Kritik zu unterziehen. In der Tat gibt es viele Elaborate, die mit einer aufgeblähten Sprache nur ihre Rolf-Peter Horstmann, Die Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven des Deutschen Idealismus, Frankfurt am Main 1991 (2. Auflage, Weinheim 1995). 2 74 Martin Schraven Substanzlosigkeit verbergen. Nicht wenige Abhandlungen scheinen als ersten Zweck nicht die Mitteilung von neuem Wissen zu haben, sondern ihre Autoren scheinen sich zuerst zu bemühen, hinter geschraubten Formulierungen das Nichtwissen zu verbergen, um mögliche kritische Nachfragen von vornherein erst gar nicht aufkommen zu lassen. Aber auch hier bleibt Jung jeden Beweis schuldig; und zum andern scheint er die Erfahrung, die er selbst gemacht hat, seinen Kollegen nicht zuzutrauen. Er wird doch nicht im Ernst glauben, daß die Philosophieprofessoren, die er hier beschrieben hat, nicht allerwärts bekannt sind. Der kritische Punkt ist aber weniger der, daß es solche Leute gibt - diese gibt es immer -, sondern daß es kaum jemand gibt, der dies den betreffenden Leuten entweder öffentlich oder privat sagt. Es fehlt in diesen Fällen ein Kind, das dem Kaiser sagt, daß er nackt ist, oder: es fehlt eine Diskussionskultur. Hier trifft Jungs Kritik ins Schwarze. Im deutschsprachigen Raum ist die Diskussionskultur eine Unkultur. Offene Kritik wird auf Kongressen nicht und in Zeitschriften höchst selten geäußert. Die Ängstlichkeit, der Kritisierte könnte sich vielleicht an einer anderen Stelle des philosophischen Betriebs, sei es in einem Artikel, sei es bei einem Gutachten etc., rächen, ist sehr hoch. Aber gerade eine offene Diskussionskultur ist für die Philosophie eine conditio sine qua non. Sie würde auch dem anderen Übelstand abhelfen, dessen erste Opfer die Studenten sind. Diese können - zumindest anfangs - die Verschleierung von Inkompetenz mit den Mitteln der Sprache nicht erkennen. Ihnen wird der Eindruck vermittelt, eine unverständliche Sprache gehöre zum Wesen der Philosophie; ihnen wird damit der Zugang zu dem spannenden Abenteuer „Philosophie“ verbaut. Mag man das Verschleiern von Unwissen durch die Sprache noch unter der Rubrik „Eitelkeit“ ablegen, was in vielen Fällen auch zutrifft, so ist dies bei der Weitergabe der Philosophie an die nächste Generation nicht möglich. Entweder resignieren die Studenten und brechen das Studium ab, oder sie werden verbogen. Die geschraubte Sprache wissenschaftlicher Abhandlungen dient aber nicht nur zur Abwehr von Kritik, sie dient auch als Jargon, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schule oder Denkrichtung zu beweisen. Die Zugehörigkeit vermittelt Anerkennung und Zustimmung bei den Mit- Vom Siechtum der deutschen Philosophie 75 gliedern dieser Schule und bietet die Gelegenheit, andere auszugrenzen. Diese Zugehörigkeit zu bestimmten Traditionen prägt auch die Rekrutierung des philosophischen Nachwuchses, und diese wiederum verstärkt die Dürftigkeit der Diskussionskultur. Die Assistenten sind normalerweise völlig von ihren Professoren abhängig; ihnen werde, so Jung, nicht aufgrund ihrer Leistungen die Möglichkeit geboten, sich die höheren akademischen Weihen zu verdienen, sondern sie werden vor allem nach ihrer Fähigkeit ausgesucht, „das philosophische Glaubensbekenntnis ihres Meisters am frömmsten zu zelebrieren“ (25). Das Verhältnis der Assistenten zu „ihren“ Professoren kann man zutreffend als ein feudales Verhältnis beschreiben. Der Assistent stellt sich unter den Schutz seines Feudalherrn. Der Schutz besteht darin, daß er seinem Vasallen die Möglichkeit eröffnet, selbst nach Ableistung der Fron in den akademischen Stand höheren Grades aufzusteigen. Die Gegenleistung, der Lehnsdienst, ist die Übernahme der wissenschaftlichen Vorgaben des Meisters. Kritik kann allenfalls im höfischen Gestus einer Ergänzung, einer Marginalie etc., vorgebracht werden. (Was Prof. xy schon richtig und tiefgründig dargelegt hat, könnte man allenfalls noch durch eine kleine Bemerkung ergänzen ...). Wie sehr der Assistent von der Person des Professors und nicht von seiner Leistung abhängt, wird schlagend deutlich, wenn der Assistent in Ungnade gefallen ist. Sei es, daß er sich zu oft dem Meister gegenüber kritisch verhalten hat, sei es daß sich die maßgebliche Lehrmeinung geändert hat. Und diese Lehrmeinung kann sich sehr schnell ändern; denn einerseits gibt es auch unter den Philosophieprofessoren nicht wenige wendige, und andererseits können Emeritierungen die Verhältnisse an den philosophischen Instituten völlig umkrempeln. Der Vertrag des Assistenten wird nicht gelöst; er wird nach allen rechtlichen Kriterien erfüllt, bis zum Ende; nur wird er dann nicht mehr verlängert. Die Habilitation wird nicht angenommen oder mangels Erfolgsaussicht erst gar nicht eingereicht. Ausgebildete Philosophen von 35, 40, 45 und mehr Jahren stehen dann (unvermittelbar) dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Diese Abhängigkeit ist der Normalzustand und an ihr ändert sich auch dann nichts, wenn der Professor sie aufgrund seiner Persönlichkeit nicht ausnutzen will. Abgesehen davon, daß wohl kaum ein Professor sich das Attribut eines mittelalterlichen Lehnsherrn anhängen würde - 76 Martin Schraven die Binnensicht ist hier oft das krasse Gegenteil der Außenansicht -, diese Abhängigkeit vollzieht sich oft unter der wohlwollenden Zuwendung der Professoren. Denn es ist unter den gegebenen Umständen in der Tat der Professor, der dem Assistenten den Weg ebnet; diese „Leistung“ ist nicht fiktiv. Aber auch im mittelalterlichen Lehnsverhältnis vollzog sich unter dem Schein des gegenseitigen Nutzens ein eindeutiges Herrschaftsverhältnis. Ein weiteres Feld der Kritik Jungs richtet sich gegen ein Teilgebiet der Philosophie, gegen die Philosophiegeschichtsschreibung, wenigstens so, wie sie in der deutschen Philosophie betrieben wird. Diese befasse sich stets nur damit, zum hundertsten Mal nachzuerzählen, was Kant und Leibniz so alles gedacht haben. Dabei beruft sich Jung vor allem auf Lorenz B. Puntel, der eine ähnliche Kritik schon früher vorgetragen hatte. Nachdem Puntel Jahrzehnte hindurch zuerst Thomas von Aquin und dann Hegel traktiert und extrahiert hatte, kam ihm nach einer Gastdozentur in den USA die Einsicht, daß die Form der Philosophie, wie sie in Deutschland betrieben würde, nur „historisierendes Geschwafel“ sei, „das jedes Interesse an der Sache abtötet“ (76). Puntel verließ daraufhin das, was für ihn „der Alltagstrott“ war und wandte sich der analytischen Philosophie zu. Nicht, daß Puntel im Laufe seines Lebens entdeckt hat, daß ihn anderes als bisher interessiert, ist zu kritisieren, sondern wie er sich selbst zu seiner eigenen philosophischen Vergangenheit verhält. Puntel scheint in seiner Polemik gegen die Philosophen, die professionell Geschichte der Philosophie betreiben, vergessen zu haben, daß er selbst seine Qualifikation durch die intensive Beschäftigung mit dieser Geschichte erworben hat. Und wenn Jung sich auf Puntel beruft, dann beachtet er nicht, daß Puntel nicht im Namen der Philosophie spricht, sondern als Vertreter einer Richtung, die schon seit jeher ein besonderes schwieriges Verhältnis zu Geschichte der Philosophie hatte. Puntels Kritik gehört viel mehr in jene Abteilung, die Jung an anderer Stelle aufs Korn nimmt, daß nämlich manche Vertreter der einen Denkrichtung den Vertretern anderer Denkrichtungen die Kompetenz abstreiten. Doch was kritisiert Jung an der philosophischen Disziplin „Geschichte der Philosophie“? Auch Jung räumt ein, daß keine Wissenschaft ein engeres Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte hat als die Philosophie. Vom Siechtum der deutschen Philosophie 77 Wenn Jung der deutschen Philosophie zwei Vorhaltungen macht, daß sie sich einerseits vornehmlich mit ihrer eigenen Geschichte und damit andererseits mit sich selbst befasse, so gleicht dies jenem „Argument“, das Umberto Eco seiner Romanfigur Jorge von Burgos in „Der Name der Rose“ in den Mund legt, daß der Wesenskern der Wissenschaft das Studium und die Bewahrung des Wissens sei. „Ich sage Bewahrung und nicht Erforschung, denn es ist das Proprium des Wissens als einer göttlichen Sache, daß es abgeschlossen sei und vollständig ist seit Anbeginn in der Vollkommenheit des Wortes, das sich ausdrückt um seiner selbst willen.“3 Aber während aus Jorges Worten die Angst vor dem Verlust der Gottesfurcht infolge der Aneignung des ganzen Aristoteles und des neuen Aufbruchs in der Philosophie des frühen 14. Jahrhunderts spricht, diese Position also ein historisches, relatives Recht formuliert, unterstellt Jung sie der gegenwärtigen (deutschen) Philosophie, um sie kritisierbar zu machen. Damit aber hat Jung sich nur eine Karikatur der Philosophie zurecht gemacht, die sehr wenig über das Teilfach „Geschichte der Philosophie“ aussagt, umso mehr jedoch von Jungs mangelhaftem Philosophieverständnis erkennen läßt. Zunächst ist an die einfache Tatsache zu erinnern, daß das Wissen immer nur wirklich ist, wenn es aktuell, präsent ist. Das Wissen, das nur in Büchern oder anderen Medien gespeichert ist, nicht aber in den Köpfen wenigstens einiger Menschen, ist totes Wissen. Allein wegen des positiven, aktuellen Wissens um die philosophischen Entwürfe und Systeme der Vergangenheit hat das Fach „Geschichte der Philosophie“ seine Existenzberechtigung. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden soll, und den auch Jung als legitim einräumt. Die Philosophieausbildung wird zu einem beträchtlichen Teil in der Aneignung und Auseinandersetzung mit den verschiedenen vergangenen Philosophien geschehen. Dies ist aber bei weitem nicht alles. Man mag es bedauern; aber man kann nicht von der Tatsache absehen, daß die Rezeption der Philosophien der Vergangenheit in Teilen höchst unbefriedigend ist. Auch heute noch werden von vielen Philosophiehistoriographen Fehlinterpretationen in den Büchern reproduziert 3 Umberto Eco, Der Name der Rose. Roman, München 1986, S.509. 78 Martin Schraven und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Hier müssen die so geschmähten Philosophiehistoriker Fehlinterpretationen korrigieren. Dies kann nur geschehen, indem die verschiedenen Felder der Philosophiegeschichte von Spezialisten bearbeitet werden. Ohne diese Spezialisten gälte Giordano Bruno noch heute als Neuplatoniker und wäre der späte Schelling noch immer ein Mystiker. Solche Forschungen vollziehen sich meist in entsprechenden Fachinstituten, bei spezialisierten Lehrstühlen oder in den Redaktionen, die die Werke einzelner Philosophen historisch-kritisch herausgeben. Das sind jene, meist hochspezialisierten Fachkräfte, gegen die Jung im Anschluß an Puntel polemisiert, und auf deren Schultern sie doch stehen oder stehen sollten, wenn sie seriöse Philosophie betreiben wollen. Gerade auch in den genannten Redaktionen werden auch jene neuen Quellen der Philosophiegeschichte erarbeitet, die zum modernen Verständnis der Geschichte der Philosophie nicht bloß hilfreich, sondern auch notwendig sind. Es geht um neues Wissen über und neue Quellen der Geschichte der Philosophie. So ist unser sehr einseitiges Bild von der Philosophie des Mittelalters, das durch die theologisch ausgerichtete Rezeption geprägt ist, dem Umstand geschuldet, daß ein Großteil der Quellen immer noch in Bibliotheken und Archiven ruht. Es mag nicht jedermanns Sache sein, diese Arbeit zu leisten, aber von dieser Arbeit zu behaupten, sie würde nur Bekanntes wiederholen, zeugt von Unkenntnis und Ignoranz. Letztlich scheint Jung überhaupt nicht über jene, seit der modernen Hermeneutik selbstverständliche Reflexion zu verfügen, daß jede Generation sich die Vergangenheit auf ihre Weise aneignen muß. Es kann hier nicht der Ort sein, hermeneutische Überlegungen zu erläutern. Aber sicher ist, daß die hegelsche Philosophie, wie sie heute, am Ende des 20. Jahrhundert, von Philosophen angeeignet wird, nicht mehr diejenige ist, die in den siebziger Jahren - meist im Anschluß an oder im Sog einer Marxrezeption - vollzogen wurde. Dasselbe gilt mutatis mutandis von allen früheren Hegelaneignungen. Allein aufgrund einer sich stets verändernden gesellschaftlichen, politischen und geschichtlichen Gegenwart ist die „Wieder-holung“ der Geschichte der Philosophie, die aus dem genannten Grund auch nie eine Wiederholung sein kann, eine immer- Vom Siechtum der deutschen Philosophie 79 währende Aufgabe, in der es um sehr vieles geht, am allerwenigsten aber um die Beweihräuchern von Denkmälern. An dieser Kritik Jungs offenbart sich am meisten, daß seine Polemik manchmal weniger von Sachverstand getragen ist, als auf den öffentlichen Beifall bedacht ist. Dies zeigt sich auch und vor allem an den Maßnahmen, die zur Genesung der Patientin philosophia beitragen sollen. Die Therapie „... kann machen, daß die Blinden gehn und daß die Lahmen wieder sehn“.4 Jung scheint sich zunächst der Meinung von Michael Nerlich anzuschließen, der gegen manche dubiosen Vorgänge in philosophischen Instituten, die sich im nichtöffentlichen Raum abgespielt haben, sagt: „Die Universitäten glauben, sie müßten sich vor der Öffentlichkeit für ihre Aktivitäten nicht rechtfertigen. Ich bin für die totale Denk- und Forscherfreiheit, aber ich bin auch für die Pflicht, sagen zu müssen, was ich mache. Ich bin für die totale Transparenz.“ (171) Aber diese Stütze dient Jung nur als Einstieg zu einer ganz anderen Forderung: Statt sich für die Durchsetzung von „totaler Denk- und Forscherfreiheit“ und „totaler Transparenz“ einzusetzen, ruft Jung nach der starken Hand der Politiker. Diese soll dafür sorgen, daß sämtliche Lehrstühle, die sich überwiegend mit Philosophiegeschichte beschäftigen, nicht nachbesetzt werden. Enthaltsamkeit sollte so lange geübt werden, bis sie auf das „gesunde Maß“ von etwa 20 Prozent des jetzigen Bestandes geschrumpft seien (181). Die frei werdenden Gelder sollten dort eingesetzt werden, „wo tatsächlich noch wissenschaftliche Forschung stattfindet“, nämlich in der Astronomie, Atomphysik, Genforschung und Neurophysiologie. (ebd.) Mit dieser Therapie sei dann auch noch das andere Dilemma der deutschen Philosophie beseitigt: der Anpassungsdruck, der von seiten der OrdinaIm Unterschied zu dem Bild, das das Studentenlied von Johannes Andreas Eysenbarth (1661-1727) zeichnet, war dieser war zwar durch sein marktschreierisches Auftreten bekannt; er war aber trotzdem wegen seines gediegenen Wissens und Könnens sehr geachtet. 4 80 Martin Schraven rien auf die Assistenten ausgeübt wird. Denn wo es keine Stellen mehr gibt, entfällt auch der Anpassungsdruck (181f.). Aber auch die Philosophen, die sich nach Meinung des Autors noch um die wirklichen Probleme kümmern, kommen nicht unbehelligt davon: sie sollen auf die „Fachwissenschaften verteilt (werden), die ihrem Forschungsschwerpunkt am nächsten stehen“. Auch hier wird klar, daß Jung über keinen oder keinen zureichenden Philosophie-Begriff verfügt. Denn seine Forderung läuft auf die Auflösung des selbständigen Fachs Philosophie hinaus. Seine Polemik gegen die Philosophiehistorie, die er im Namen der Philosophie führt, dient ihm nur dazu, seinen Angriff auf die Selbständigkeit des Faches zu kaschieren. Auch sein Vorschlag, die „Institute für systematische Philosophie“ mit Historikern, Philologen, Kunstwissenschaftler, Biologen und anderen Spezialisten aufzufüllen, dient demselben Zweck. Jung weiß offenbar nicht, daß ähnliche Versuche, z.B. an der Universität Gießen, schon über fünfundzwanzig Jahren in der Erprobung sind. Über diese Versuche erfährt man in Jungs Kritik nichts. Dies ist bedauerlich, auch weil das Stillschweigen eine Schwachstelle der Analyse Jungs offenbart. Es wäre doch höchst interessant gewesen zu erfahren, in welchem Maße sein Vorschlag denn die gewünschte innovative und realitätsbezogene Philosophie hervorgebracht hat. Diskussionswürdiger ist sein Vorschlag, die Entscheidungsprozesse transparent zu machen, Verfilzungen zu entflechten. Wenn dieselbe Personengruppe entscheiden kann, welche Studenten Auslandsstipendien erhalten, wer in den Fachzeitschriften publizieren und damit seine Thesen bekannt machen darf, wer einen Forschungsauftrag erhält, wer eine Assistentenstelle besetzen, wer habilitieren kann etc., dann scheint nur eine Entflechtung und eine wirksame Kontrolle dieser geballten Macht entgegenwirken zu können (186). Aber wer soll entflechten, wer kontrollieren? Sollen Vertreter der freien Wirtschaft beurteilen, ob das „Kapital“ von Marx ein lohnenswerter Studieninhalt ist? Was würde ein Vertreter der Kirche sagen, wenn er in Studienplänen zwischen den Alternativen Thomas von Aquin, Spinoza oder Feuerbach zu entscheiden hätte? Jung ruft nach den starken Politikern. Welche Resultate es jedoch zeitigt, wenn Politikern das entschei- Vom Siechtum der deutschen Philosophie 81 dende Wort beim Einrichten, Beibehalten oder Vernichten von Lehrstühle zukommt, zeigt ein jüngeres Beispiel aus München. Kultusminister Zehetmair war maßgeblich (unter fleißiger Mithilfe der inneruniversitären Konkurrenz) an der Zerschlagung des Renaissance-Lehrstuhl an der philosophischen Fakultät der LMU München beteiligt; es war der einzige in ganz Deutschland. Über Fragen der Philosophie kann nur die Philosophie selbst befinden. Die Politiker können (und sollen auch) darauf drängen, daß die Vorgänge in den philosophischen Fakultäten transparent und die Kontrollmechanismen, unter denen eine demokratische Öffentlichkeit wohl der wichtigste ist, wirksam sind. Die Politik kann die Rahmenbedingungen setzen; jede Einmischung in inhaltliche Fragen kann der Philosophie nur schaden. Jungs Konzept bewirkt daher das Gegenteil dessen, was es vorgibt. Denn ein Eingriff der Politik in die Inhalte der Lehre und die Besetzung der Lehrstühle dürfte nur die Übertragung des jeweiligen Parteiprogramms und der Parteiideologie auf die Lehrinhalte zur Folge haben. Eines werden die Politiker auf keinen Fall bewirken: eine Erneuerung der Philosophie. Die Therapie, die Jung der siechenden philosophia verordnen will, ist eine Radikalkur, die nur ihren Exitus zur Folge haben kann. Diese Einsicht aber ist kein Grund, Jungs Buch mit dem Gestus der Entrüstung beiseite zu legen. Wenn auch die Therapie verfehlt ist, so sind doch die Krankheitssymptome, die es in der Anamnese aufzeigt, viel zu offensichtlich. Manuel Knoll Anmerkungen zum neuen Studiengang ‚Magister Philosophiae’ der philosophischen Institute in München Ein neuer Wind in München Die Münchner Institute für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik als Avantgarde der Philosophie in Deutschland? Ist das zu glauben? Weht wirklich ein neuer Wind in einer Fakultät, in der ein Professor des Seminars für christliche Weltanschauung nach dem Tod Gottes die einzige Vorlesung über französische Philosophie im 20. Jahrhundert abhält, in der ein anderer Professor seit neun Jahren versucht, seine Beschäftigung mit Nietzsche in einem Buch zu vergegenständlichen und in der ein Plotinspezialist ein Adornoseminar abhält, in dem die sachliche Diskussion von Inhalten häufig durch wütende Polemikausbrüche behindert wird? Die Frage läßt sich zweifellos mit ‚ja’ beantworten. Der neue Wind, und mit ihm die Inspiration für den neuen Magisterstudiengang mit dem Abschluß ‚Magister Philosophiae’ (M.Phil), kommt aus dem angelsächsischen Raum. Der Protagonist des geplanten Modellversuchs, Wilhelm Vossenkuhl, Ordinarius und Inhaber des Konkordatslehrstuhls für Philosophie in München, hat einige Zeit in England studiert und dabei ein anderes Ausbildungssystem kennengelernt, das er für besser als das in Deutschland vorherrschende hält und das er zu gerne importieren würde1. Der neue Studiengang, der wahrscheinlich im Sommersemester 1998 vom Senat der Universität München genehmigt wird, soll zunächst über einen Zeitraum von acht Jahren erprobt werden. Während dieser Zeit wird der traditionelle Magisterstudiengang weiterbestehen. Wenn sich der neue Studiengang bewährt, so die Hoffnung seines Protagonisten, könnte er den traditionellen ‚Magister Artium’ (M.A.) ersetzen. Wenn nicht, so die Hoffnung seiner Gegner, dann könnte der traditionelle 1 siehe Globalisierung – Hochschulreform – Philosophiestudium. Gespräch mit Wilhelm Vossenkuhl. In: Widerspruch 31, S.95 ff. Anmerkungen zum ‘Magister Philosophiae’ 83 Magisterstudiengang gestärkt aus dem friedlichen Wettstreit der Systeme hervorgehen, den man zumindest zulassen sollte. Die wichtigsten strukturellen Eigenschaften des ‚M.Phil.’ Was unterscheidet den neuen ‚M.Phil.’ vom traditionellen ‚M.A.’? Das ist gar nicht so einfach zu benennen, da es sich bei dem Studiengang sozusagen um ‚work in progress’ handelt. Solange die Hoffnung bestand, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) im Rahmen des Pilotprogramms ‚Auslandsorientierte Studiengänge’ Fördermittel zu beziehen, war Zweisprachigkeit ein wichtiges Merkmal des neuen Studiengangs. Die Möglichkeit, das Studium weitgehend auf Englisch zu absolvieren, die den Studienstandort München auch für Ausländer attraktiv hätte machen sollen, dürfte nach dem ablehnenden Bescheid des DAAD inzwischen weggefallen sein. Damit ist auch die Zukunft des obligatorischen Auslandsjahres im dritten Studienjahr an einem englischen Partnerinstitut (Birkbeck College, University of London) fraglich geworden, das sein Vorbild wahrscheinlich an dem optionalen ‚junior year abroad’ der renommierten US-Colleges hat. Die Alternative dürfte darin bestehen, entweder das Auslandsjahr zumindest als optionales beizubehalten oder ein selbständiges Konzept für das dritte Studienjahr zu erarbeiten. Soviel zu den Merkmalen des neuen Studienganges, über deren Schicksal noch nicht endgültig entschieden wurde. Die wichtigsten strukturellen Eigenschaften des ‚M.Phil’, der sich angloamerikanische Studiengänge und Abschlüsse zum Vorbild nimmt, stehen jedoch bereits weitgehend fest.2 So soll die Auswahl der Studienanfänger nach Leistungsgesichtspunkten erfolgen. Neben dem die Hochschulreife belegenden Zeugnis werden insbesondere ein Aufsatz zu einem Thema von philosophischem Interesse sowie ein persönliches Auswahlgespräch gefordert. Sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten StudienDie wichtigsten strukturellen Eigenschaften des Studienganges ‘M.Phil.’ sind in dem Antrag der Philosophischen Institute der Ludwig-Maximilians-Universität München auf Förderung im Rahmen des Pilotprogramms ‘Auslandsorientierte Studiengänge’ (DAAD) genannt, der auch bei der Podiumsdiskussion zum neuen Studiengang in München am 11.2.1998 als Diskussionsgrundlage diente. 2 84 Manuel Knoll jahr wird eine Zwischenprüfung abgehalten, die über das weitere Fortkommen entscheidet. In der Lehre sollen neben Vorlesungen und Seminaren zulassungsbeschränkte Tutorien mit einer geringen Anzahl von Teilnehmern im Vordergrund stehen, die eine bessere Betreuung gewährleisten sollen. In diesen Lehrveranstaltungen werden von den Studenten häufig kleinere schriftliche Arbeiten verlangt, die von den Dozenten korrigiert, bewertet und mit ihren Verfassern besprochen werden. Zudem erhält jeder Student seinen persönlichen Berater (adviser), mit dem er regelmäßig seine Leistungen bespricht. Statt der traditionellen Magisterarbeit von 80-120 Seiten wird am Ende des Studiums neben den schriftlichen und mündlichen Prüfungen nur eine kleinere Abschlußarbeit verlangt. Die Studienzeit soll streng auf vier Jahre begrenzt werden. Schiebefristen, d.h. die Möglichkeit Prüfungstermine zu verschieben, werden gänzlich gestrichen. Die Studieninhalte und Fächergruppen für Prüfungsleistungen sind weitgehend vorgegeben, was von den Befürwortern als Professionalisierung gelobt und von den Gegnern als Verschulung und Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit - da gezielt unerwünschte Materien ausgeschlossen werden können - getadelt wird. Logik und Wissenschaftstheorie wird - wahrscheinlich neben einem frei wählbaren zum obligatorischen zweiten Nebenfach erklärt. Soviel zu den wichtigsten strukturellen Eigenschaften des ‚M.Phil.’. Logik und Wissenschaftstheorie als obligatorisches Nebenfach Der letzte Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit. Denn die Erhebung von Logik und Wissenschaftstheorie und damit auch der analytischen Philosophie zum integralen Bestandteil des neuen Studiengangs wiegt schwer. Durch sie wird nämlich die Wahlmöglichkeit der Studieninhalte, die beim ‚M.Phil.’ im Gegensatz zum ‚M.A.’ schon weitgehend vorgegeben sind, noch weiter eingeschränkt. Vor allem aber stellt sich die Frage, ob philosophische Richtungen, die sich allzu oft durch ihre Anbetung des Formalen auszeichnen, für jeden Philosophiestudenten wirklich erstrebenswert sind. Damit soll natürlich nicht die Notwendigkeit von logischen Grundkenntnissen bestritten werden. Auch läßt sich nicht leugnen, daß eine verstärkte Ausbildung der formalen Vernunft Anmerkungen zum ‘Magister Philosophiae’ 85 durch ihre vermeintlich vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der von ihr durchdrungenen Gesellschaft gut zu einem Studiengang paßt, der sich in hohem Maße als berufsqualifizierend versteht. Aber hat diese Ausbildung noch viel mit Philosophie, mit Liebe zur Weisheit zu tun? Kommen die der Philosophie eigentümlicheren Aufgaben - etwa die Frage nach dem guten Leben oder die kritische Reflexion des Bestehenden in seinem Gesamtzusammenhang - bei so einer starken Gewichtung des Formalen nicht zwangsläufig zu kurz? Ohne die eifrigen Bemühungen einiger Mitglieder dieses Instituts wäre der Erfolg der Logiker, Wissenschaftstheoretiker und analytischen Philosophen vielleicht nicht zustandegekommen. Diese Bemühungen erklären sich nicht zuletzt dadurch, daß es seit dem Tod Wolfgang Stegmüllers, des sanften Übervaters, um das Ansehen dieses Instituts nicht zum Besten steht und daß der Nachschub an Studenten gesichert werden muß. Trotzdem: Würde es nicht genügen, es zunächst bei einem Kopierversuch der strukturellen Eigenschaften der anglo-amerikanischen Studiengänge zu belassen? Ist es überhaupt klug, die inhaltsarmen Inhalte gleich mit übernehmen zu wollen? Schließlich geht es den Befürwortern des neuen Studiengangs auch um die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit des Studienstandorts Deutschland im Zeitalter der Globalisierung. Ob eine stärkere Gewichtung der analytischen Philosophie dazu beitragen kann, ist jedoch höchst fragwürdig. Denn der gegenwärtige Trend im angelsächsischen Raum geht gerade wieder hin zu einer Suche nach Inhalten, die dem abnehmenden Interesse an der etablierten analytischen Philosophie entgegenwirken soll. Wenn also die große Zeit der analytischen Philosophie in ihren Kernländern bereits dem Ende zuzugehen scheint, was auch mit der Einsicht in die Grenzen der Formalisierbarkeit zusammenhängt, ist es dann nicht sinnvoller, andere Disziplinen in den geplanten Kanon aufzunehmen? Dabei denke ich vor allem an die an den Münchner philosophischen Instituten unter-, durch ihre Gegner oder gar nicht repräsentierten Richtungen, wie etwa Sozialphilosophie, Postmoderne-Debatte / Poststrukturalismus und Technikphilosophie / Medienphilosophie / Umweltphilosophie. Der Verwirklichung dieses Vorschlags steht natürlich das Hindernis entgegen, daß es dazu entweder zusätzlicher Mittel oder der Bereitschaft bedürfte, frei werdende Profes- 86 Manuel Knoll suren den genannten Schwerpunkten gemäß neu auszuschreiben. Fraglich bleibt jedoch auch, ob die Pluralität der in München kompetent vertretenen philosophischen Richtungen beim ‚M.Phil.’ zum Tragen kommen wird. Die drohende Ersetzung des einzigen Lehrstuhls für Renaissancephilosophie in Deutschland durch einen Lehrstuhl für Wirtschaftsethik stimmt nicht gerade hoffnungsvoll. ‚M.Phil.’ und Chancengleichheit Ein weiterer wichtiger Punkt ist die geplante strikte Begrenzung der Studienzeit auf vier Jahre. Mit ihr wollen die Befürworter des neuen Studienganges der von Wirtschaft und Politik beklagten unüberschaubaren Dauer der Studienzeiten in Deutschland entgegentreten. Schließlich besteht eines der primären Ziele des ‚M.Phil.’ darin, die Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Und tatsächlich, in England oder USA, wo Hochschulabsolventen ihren ersten Abschluß bereits nach drei bzw. vier Jahren Studium machen, haben Geisteswissenschaftler deutlich bessere Chancen auf Stellen in der „freien“ Wirtschaft als in Deutschland. Ob das alleine daran liegt, daß junge Leute um die 22 Jahre von den Personalabteilungen weder als ungebildet noch als verbildet und deshalb als erfolgreicher in die Arbeitswelt einzupassen angesehen werden, mag dahingestellt bleiben. Was auch immer noch für andere Gründe in Frage kommen mögen, die Erwartung, daß ‚Magister Light’-Absolventen bessere Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben werden als ‚M.A.’-Absolventen, erscheint nicht als unberechtigt. Dafür spricht auch die Auswahlmöglichkeit der Studenten nach Leistungsgesichtspunkten, die auch in angelsächsischen Ländern üblich ist. Die Frage ist nur, welcher Preis für diesen Vorteil zu entrichten ist. Genauer besehen, zeigt sich hier nämlich eine Dialektik am Werk. Einerseits beabsichtigen die Befürworter des ‚M.Phil.’, mit ihrem Studiengang dem Mißstand abzuhelfen, daß sich in Deutschland immer mehr rational kalkulierende Studenten nur für die Philosophie entscheiden, wenn sie sich wenig Gedanken um ihren künftigen Lebensunterhalt machen müssen. Andererseits bewirkt die strikte Begrenzung der Studienzeit bzw. die gänzliche Streichung von Schiebefristen, daß sich diejenigen, die sich um Anmerkungen zum ‘Magister Philosophiae’ 87 ihren Lebensunterhalt während des Studiums Gedanken machen müssen, nicht für den ‚M.Phil.’ entscheiden können. Denn der geplante Studiengang soll so arbeitsintensiv werden, daß keine Zeit mehr für Nebentätigkeiten bleibt, mit denen sich die finanziell schlechter Gestellten ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Beim momentanen Stand der Dinge besteht höchstens eine kleine Hoffnung auf Fördermittel aus der Wirtschaft, die es ermöglichen würden, Stipendien zu vergeben. Die momentanen BAföG-Sätze sind in den meisten Fällen nicht ausreichend, um ausschließlich davon leben zu können. Außerdem ist der Prozentsatz der Studenten, die überhaupt ein Anrecht auf BAföG haben, nicht sonderlich hoch. Daraus folgt: Gibt es weder Stipendien noch Schiebefristen, dann gibt es auch keine Chancengleichheit für die potentiellen Aspiranten des ‚M.Phil.’. Dann trifft auch der öfters vorgebrachte Vorwurf zu, daß es sich bei dem neuen Studiengang um eine elitäre Institution handle. Dieser Vorwurf läßt sich meines Erachtens primär durch die zu erwartende deutliche Chancenungleichheit begründen und weniger, wie öfters geschehen, durch den Hinweis auf die Auswahlmöglichkeit der Studenten. Denn die angestrebten Leistungskriterien versprechen nicht so streng zu werden, daß den ernsthaft interessierten Bewerbern, bei denen es wahrscheinlich erscheint, daß sie ihr Studium auch wirklich beenden, zu große Schwierigkeiten in den Weg gestellt würden. Aber selbst wenn es gelänge, Mittel für Stipendien herbeizuschaffen, hätte dies nur teilweise erfreuliche Auswirkungen. Diese Mittel würden höchstwahrscheinlich nur an die ‚M.Phil.’-Studenten verteilt werden. Denn diese haben nicht nur während ihres Kurzstudiums kaum Möglichkeiten, nebenher Geld zu verdienen, sondern müssen möglicherweise auch noch einen Auslandsaufenthalt finanzieren. Zum einen würden dadurch die ‚M.A.’-Studenten benachteiligt, zum anderen würde auf diese Weise den Studienanfängern der ‚Magister Light’ schmackhaft gemacht, was im friedlichen Wettstreit der Studiengänge unlauterem Wettbewerb gleichkäme. Die durch die gänzliche Streichung von Schiebefristen bewirkte Chancenungleichheit betrifft nicht nur für die finanziell schlechter Gestellten, sondern auch alleinerziehende Mütter sowie Frauen, die während ihres Studiums ein Kind zur Welt bringen. Denn die Betreuung eines Kindes 88 Manuel Knoll ist so zeitaufwendig, daß sie es kaum zulassen dürfte, den neuen Studiengang innerhalb der strikt auf vier Jahre begrenzten Studienzeit zu absolvieren. Philosophie und Praxisnähe Die gewichtigsten Argumente gegen die Einführung des ‚M.Phil’ sind somit zum einen die Erhebung von Logik und Wissenschaftstheorie zum obligatorischen Nebenfach, was gegenüber der freien Wahlmöglichkeit der Inhalte des ‚M.A.’ eine empfindliche Beschneidung bedeutet und in die Sackgasse des Formalismus führt. Zum anderen bewirkt ein ‚M.Phil.’ ohne Stipendien und Schiebefristen eine eklatante Chancenungleichheit. Trotz dieser Einwände scheint die Einführung des berufsqualifizierenden ‚M.Phil.’ unaufhaltsam bevorzustehen. Es dürfte kein Zufall sein, daß die Bemühungen um seine Einführung mit der Verschärfung des internationalen wirtschaftlichen Wettbewerbs im Zeitalter der Globalisierung zusammenfällt. Während an der friedlichen Koexistenz des deutschen und des anglo-amerikanischen Systems über viele Jahrzehnte hinweg nicht gerüttelt wurde, scheint es jetzt für einige an der Zeit zu sein, von der Konkurrenz zu lernen und den Studienstandort fit zu machen. Die zunehmende Ankoppelung des Ausbildungssystems an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und der vorherrschenden gesellschaftlichen Praxis macht selbst vor der Philosophie nicht halt. Eine Alternative zum ‚M.Phil.’ kann darin bestehen, unbeirrt an der Einsicht festzuhalten, daß die Philosophie nicht zunehmend im Getriebe aufgehen darf und als dessen kritische Reflexionsinstanz nicht weiter geschwächt werden sollte. Genau das zeichnet sich aber als eine Folge des neuen Studienganges in der geplanten Form ab. Damit ist aber nicht ein Plädoyer für die fragwürdige Einrichtung eines Lehrstuhls für Wirtschaftsethik gemeint. Vielmehr möchte ich den Gedanken stark machen, der mir auch in der Initiative zum ‚M.Phil.’ enthalten scheint: etwas von der geläufigen Vorstellung abrücken, daß Philosophie reiner Selbstzweck ist. Wenn Philosophie schon unaufhaltsam praxisnäher werden muß, dann sollte sie jedoch - wenn sie Liebe zur Weisheit bleiben will - versuchen, diese Nähe als verstärkte Reflexion über Praxis zu gewinnen. Dies Anmerkungen zum ‘Magister Philosophiae’ 89 könnte als positive Variante einer Ankoppelung des Ausbildungssystems an die Erfordernisse der vorherrschenden gesellschaftlichen Praxis und vielleicht sogar in gar nicht so ferner Zukunft - des Arbeitsmarktes begriffen werden. Inhaltlich realisieren ließe sich dieser Vorschlag durch die Förderung von philosophischen Richtungen wie etwa Sozialphilosophie, Postmoderne-Debatte, Technikphilosophie, Umweltphilosophie und Medienphilosophie. Als formaler Rahmen könnte ein reformierter ‚M.A.’-Studiengang dienen, in den positive Elemente der anglo-amerikanischen Studiengänge eingehen könnten: Bessere Betreuung, Tutorien (im Rahmen des bestehenden Tutorienprogramms der Münchner Universität), eine gewisse Strukturierung der Lehrinhalte, mehr schriftliche Arbeiten und moderate Auswahlverfahren. Und wer die Möglichkeiten und den Wunsch hat, der kann trotzdem in vier Jahren abschließen. Besprechungen Neuerscheinungen Aristoteles Organon Band 1. Topik, neuntes Buch oder Über die sophistischen Widerlegungsschlüsse. Herausgegeben, übersetzt, mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Hans Günter Zekl. Zweisprachige Ausgabe, Hamburg 1997 (Meiner), 682 S., 128.- DM. Während das philosophische Denken im Mittelalter und in der Renaissance der Topik des Aristoteles große Aufmerksamkeit entgegengebrachte, galt sie später und für längere Zeit als der am wenigsten brauchbare Teil des „Organon“ und wird in philosophischen Auseinandersetzungen daher auch relativ selten zitiert. Das Interesse an der Interpretation dieses Werkes und der Versuch der Weiterführung seiner Gedanken bestehen erst wieder seit den sechziger Jahren. Dieser Versuch ist mit der Entwicklung der „Argumentationstheorie“ und der sogennanten „informalen Logik“ verbunden. Speziell in der deutschsprachigen Rechtsphilosophie übt das 1953 erschienene Werk Th. Viehwegs „Topik und Jurispru- denz“ einen gewissen Einfluß auf die methodologische Diskussion aus. Das Interesse an der Topik hat in den letzten Jahren noch stärker zugenommen. Die Topik ist die Lehre von den dialektischen Schlüssen. In dialektischen Schlüssen werden einleuchtende oder plausible oder auf allgemeiner Meinung beruhende Prämissen (Endoxa) benutzt. Die Topik liefert die Regeln (Topoi) zur Bildung dieser Schlüsse. Diese Regeln scheinen eine andere Struktur zu besitzen und einen in mehrfacher Hinsicht unterschiedlichen Anwendungsbereich zu beanspruchen als die Regeln, die der später entstandenen Analytik abgewonnen werden können. Die Klassifikation und die Bildung der Topoi geht - zumindest der Intention des Aristoteles nach - von den Arten der Prädikation aus, die in den jeweiligen dialektischen Problemstellungen verwendet werden: Die Prädikationen können Prädikationen der Gattung oder des Akzidens oder des Definiens oder eines ‚idion’ (Eigenheit, Eigenschaft, Eigentümliches, Proprium) sein. Zu den dialektischen Schlüssen treten noch die eristisch Neuerscheinungen genannten hinzu, die entweder nur scheinbar schließen, oder nur aus scheinbar einleuchtenden, plausiblen oder auf allgemeiner Meinung beruhenden Prämissen schließen. Der Ausdruck „Sophistische Widerlegungschlüsse“ bedeutet genau die Abhandlung über die (inkorrekten) Widerlegungen von einleuchtenden Annahmen oder einleuchtenden Konklusionen durch eristische Schlüsse. Die Texte der acht Bücher der Topik und des neunten Buches, der Sophistischen Widerlegungsschlüsse, sind sehr gut überliefert worden. Die Interpretation der Topik wirft zahlreiche allgemeine Fragen auf: Es geht um die genaue Bestimmung ihres Anwendungsbereichs sowie um die genaue Abgrenzung zwischen dialektischer und apodeiktischer Beweisführung. Um die Unterscheidung der Topik einerseits von der Analytik, andererseits von der Rhetorik. Um die Begriffe und die Struktur der Endoxa und der Topoi sowie um ihr Verhältnis zueinander. Um den Grund und die Grenzen der „Gültigkeit“ der Topoi. Um die Möglichkeit der Gewinnung wahrer und nicht nur auf Meinung bezogener Erkenntnis durch dialektische Beweisführung. Hinzu treten viele Fragen der korrekten Interpretation einzelner Stellen. 91 Die neue Ausgabe der Topik und der Sophistischen Widerlegungsschlüsse in der „Philosophischen Bibliothek“ erscheint als erster Band einer Neuübersetzung und Kommentierung des gesamten Organon. Wie der Herausgeber Hans Günter Zekl in dem Vorwort zum Gesamtvorhaben schreibt, will er dabei vor allem die neueren Gesamtdarstellungen der aristotelischen Logik sowie die Ergebnisse der neuen Forschung (z.B. W. Jaeger) gegen die „rückwärtsgewandte systemorientierte Interpretation“ bei der Aristoteles-Interpretation berücksichtigen. Die bisher vorliegende kommentierte Übersetzung in der „Philosophischen Bibliothek“ durch E. Rolfes aus den Jahren 1918-1922 hatte die zur damaligen Zeit erst entstehende entwicklungsgeschichtliche Betrachtung nicht rezipiert. In der neuen Ausgabe erscheinen Topik und Sophistische Widerlegungsschlüsse als erster Teil des Organon, da ein zureichendes Verständnis der ersten und der zweiten Analytik den Weg über die Topik voraussetze, deren Bücher zudem früher entstanden sind als die anderen Teile des Organon. Überdies sei durch die neuere Forschung „die Distanz der aristotelischen Philosophie des Logos zu dem, was traditionelle und moderne Logik betrieben haben und betreiben, so evident geworden, daß 92 Neuerscheinungen übersetzerisch und interpretatorisch niemand mehr dahinter zurückbleiben darf“. Bereits an diesem Punkt drängen sich dem Leser gerade angesichts der neueren Arbeiten von Lukasiewitz, Patzig und J. Lear, die sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede der aristotelischen und der modernen Logik herausgearbeitet haben, Zweifel darüber auf, ob nun die durch diese Arbeiten aufgewiesenen Unterschiede eine vollständige übersetzerische und interpretatorische Abkoppelung von der logischen Terminologie und Begriffsbildung tatsächlich rechtfertigen. Die pauschalisierende Ansicht des Herausgebers zu diesem Thema wird allerdings erst dann vollständig beurteilt werden können, wenn auch die Übersetzungen und Kommentierungen der Analytiken vorliegen, worauf sich die genannten Arbeiten vorwiegend beziehen. Dennoch ist die Entscheidung, bei der Übersetzung von der Terminologie der Logik Abstand zu nehmen, im Prinzip zustimmungswürdig, da auf diese Weise in der Tat der vom aristotelischen Text eröffnete Spielraum der Interpretation so wenig wie möglich durch die Übersetzung eingeschränkt wird und die Sprache den Leser mehr herausfordert; sie wirkt auf ihn wesentlich lebendiger, ähnlich wie die Sprache des Originals. Grundsätzlich versucht der Übersetzer so nahe wie möglich an dem Text und dessen Struktur zu bleiben. Mit dieser Auffassung geht die weitere Absicht des Herausgebers einher, bei der Übersetzung - anders als bei der der Einleitung und bei der Kommentierung - keine Fremdwörter zu benutzen, da auch Aristoteles keine benutzt habe. Dies erscheint jedenfalls bis zu einem gewissen Grad zustimmungswürdig. Zwar erweckt die dafür abgegebene Begründung den Anschein eines sophistischen Widerlegungsschlusses. Aber andererseits zeigt sich, beispielsweise im Fall der Übersetzung von „epagoge“, daß das dafür gewählte Wort „Heranführung“ treffender ist als das übliche „Induktion“. Auch für die Wiedergabe der „Kategorien“ durch „Grundformen von Aussage“ und „Aussagearten“ ließen sich gute Gründe anführen, die allerdings der Übersetzer nicht nennt. Die Entscheidung, auf Fremdwörter zu verzichten, wirkt sich problematisch aus, wenn für ein mehrfach vorkommendes gleiches Wort, das im griechischen Text eine bestimmte Bedeutung als terminus technicus haben könnte, unterschiedliche Übersetzungen gebraucht werden, wie dies zum Beispiel bei dem Wort „topos“ oder dem Wort „eidos“ passiert. Zwar wird am Ende des Buches sowohl ein Verzeichnis der Neuerscheinungen deutschen Übersetzungen mit ihren Entsprechungen im griechischen als auch der Index Verborum der zugrundeliegenden Ausgabe von Ross angefügt. Diese Verzeichnisse sind aber nicht vollständig. Beispielsweise wird für „Eidos“ nur „Art“, „Form“, „Erscheinung“ angegeben, während es im Text auch durch „Anschauungsform“ übersetzt wird (zu 131 a 4-5). Letztendlich muß jeder, der feststellen möchte, ob und wo ein solcher Terminus vorliegt, sowohl die Verzeichnisse durchgehen als auch die einschlägigen Stellen des Originals vergleichen. In der Kommentierung der Ausgabe sind nur sehr wenige Verweise auf neuere Forschungsarbeiten zur aristotelischen Logik und Topik zu finden. Auch in der Einleitung wird nicht der Versuch unternommen, in den gegenwärtigen Forschungsstand einzuführen. Es fehlt auch jegliche Bemerkung zu der Streitfrage, was denn ein Topos ist oder auch zu dem Wert dieser Frage. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen und kenntnisreichen Stellenangaben aus anderen Werken von Aristoteles oder aus anderen zeitgenössischen philosophischen Quellen (Doxographie, Werke und Fragmente). Dadurch werden vor allem die Meinungsstreitigkeiten, die Thesen oder die Überlieferungsund Diskussionskontexte identifi- 93 ziert und relativ ausführlich erläutert, von denen Aristoteles ausgehen oder auf die er sich mit seinen manchmal knapp formulierten Beispielen beziehen dürfte. Die Interpretationen und Beurteilungen einzelner Stellen durch den Kommentar sind in der Regel sehr anregend: Häufig sind sie durchaus klarstellend und sachgerecht, gelegentlich aber auch zu pauschal oder oberflächlich (vgl. Anm. 97, 148, 188, 441), während sie in einigen anderen Fällen auch Anlaß zu entschiedenem Widerspruch geben: Nicht nachvollziehbar ist die Bemerkung (Anm.72), daß der Topos „ab antecedentibus et a consequentibus“ in die Rhetorik gehöre. Es handelt sich um die logisch gültigen Formen des Modus Ponens und des Modus Tollens. Auch die Anmerkung 19 zu 103 a 6, in der Zekl behauptet, daß der Einsatz des Identitätskapitels wie ein unabhängiger Neuanfang aussieht, verdient keine Zustimmung, wenn man 102 a 11-12 berücksichtigt. Die Rede von symmetrischen Relationen in Anm. 283 ist nicht korrekt: „Symmetrisch“ heißt eine zweistellige (zweigliedrige) Relation, die in beiden Richtungen gilt, wie „x ist Bruder von y“. Mit der Anm. 493 zum Marxismus überschreitet der Kommentator die Grenzen der Sachlichkeit. 94 Neuerscheinungen Der Herausgeber hat sich angesichts der fehlenden oder nicht ersichtlichen Auseinandersetzung mit zahlreichen neueren Analysen mit großer Selbständigkeit der Bearbeitung der Topik gewidmet. Die äußerst pauschalisierende Behandlung mancher Punkte läßt sich nicht rechtfertigen. Nichtdestotrotz ist diese in mehrfacher Sicht herausfordende Übersetzung vor allem denjenigen, die sich mit gewisser Kenntnis des griechischen selbständig der aristotelischen Topik und deren Interpretationsprobleme annehmen möchten, besonders zu empfehlen. Georgios Karageorgoudis Martin Bondeli Der Kantianismus des jungen Hegel. Die Kant-Aneignung und KantÜberwindung Hegels auf seinem Weg zum philosophischen System Hamburg 1997 (Meiner), Ln., 368 S., 132.- DM. In Jena, so scheint es, war Hegel plötzlich ‚da‚. Zwar wußte man, nicht zuletzt durch G. Lukács‚ „Der junge Hegel“, daß Hegel in seiner frühen Berner Zeit (1792-1795) sich vor allem als ein Vordenker der Revolution hatte profilieren wollen und etwas eigenartige „Theologische Jugendschriften“ verfaßt hatte, daß er danach in Frankfurt (17971800) - unter dem Einfluß von Hölderlin, wie Dieter Henrich annahm - intensiv die „Liebe“ und das „Leben“ verehrt hatte, um sich schließlich in Jena unter der Leitung Schellings – wie dieser eifrig kolportierte – in den mainstream der nachkantischen Systemphilosophie einzureihen und bald zu ihrem führenden Kopf zu werden. Daß Hegel mancherlei Wendungen vollzogen hatte, war bekannt, aber wie diese Steinchen sich zu einem sinnvollen Mosaik zusammenfügen lassen, ist recht unverstanden geblieben. Nun hat der Berner Philosoph Martin Bondeli, der als Dissertation schon „Hegel in Bern“ (Bonn 1990) vorgelegt hat, in seinem neuen Buch eine Darstellung dieser Entwicklung des Hegelschen Denkens gegeben. Bondeli spricht vom „Kantianismus des jungen Hegel“ und will „mittels einer eng an die Kantischen Vorgaben heranführenden Darstellung“ (2) die Genese von Hegels KantAneignung und –Kritik nachvollziehen. Anhand der zwei großen Themen der praktischen Philosophie Kants, des Sittengesetzes und der Idee der Freiheit, rekonstruiert er die Wandlung in Hegels Denken: von der frühen unkritischen Akzeptanz des Sittengesetzes als der Kritikinstanz des „christlichen Unterdrückungsgeistes“ bis zum allmähli- Neuerscheinungen chen Zweifel an diesem Revolutionsprogramm, der in dem Vorwurf gegen Kant mündet, die Verwirklichung des Sittengesetzes bringe statt Freiheit erneut „Herrschaft, Negativität, Schrecken“. In ähnlicher Weise zeichnet Bondeli Hegels Auseinandersetzung mit dem Kantischen Postulat der Existenz Gottes nach, die Hegel vom Begriff eines moralisch Gesollten zu dem absoluten Sein führt, das Freiheit und Natur, Subjektives und Objektives, vereinigt und versöhnt, vom Verständnis Gottes als oberstem Befehlshaber zu Gott als dem Sein der Liebe, sowie die damit verbundene Ausarbeitung von Hegels späterer dialektischer Methode, das Andere als das Andere seiner selbst zu fassen. Der entscheidende Gesichtspunkt von Bondelis Verfahren ist dabei, Hegels frühe Wandlung vom kantischen Sollen zum Hegelschen Sein primär nicht durch äußere Umstände – sei es die Zeitgeschichte oder seine Freunde und Kollegen - zu erklären, sondern sich in erster Linie auf die immanente Auseinandersetzung mit zentralen Theoremen der Kantischen Philosophie zu konzentrieren. Hegels Kant-Kritik, so Bondelis These, rekurriert auf Kant; er argumentiert mit Kant gegen Kant. So haben die Ideen des Schönen, des Erhabenen und insbesondere des intuitiven Verstandes in Kants „Kritik der Urteilskraft“, der Lie- 95 besbegriff in Kants „Religionsschrift“, aber auch der Begriff des „Lebens“ in der „Metaphysik der Sitten“ die Folie abgegeben, auf der Hegel Kant kritisiert und seine Alternative zur Kantischen Philosophie ausgearbeitet hat. Dies gilt auch für die Antinomienlehre, für die Kant selbst die Mittel bereitgestellt habe, sie zu überwinden. Kants Lehre habe „sich notwendig selbst untergraben und über sich hinaus in eine neue Form der Philosophie übergehen (müssen)“ (42). Bondeli ist hierbei souverän genug, zwischen dieser These Hegels und ihrem tatsächlichen Gehalt zu unterscheiden. Ohne die detaillierte und intensive Darstellung der Argumentationsverschiebungen hier nachzeichnen zu können, ist sie überzeugend. Sie revidiert das obige Bild, wonach der „junge Hegel“ aufgrund äußerer Umstände und unter Leitung anderer philosophiert habe. Ein Bild, das so gar nicht zu der selbständigen und gediegener Art zu philosophieren passen will, die wir vom „späten Hegel“ kennen. Bondeli zeigt, daß die Genese der Hegelschen Philosophie – im Gegensatz zu den Philosophien Reinholds, Fichtes und Schellings, die rasch „über Kant hinaus“ gingen - in der eindringlichen und wiederholten Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants lag. Diese bildet gleichsam 96 Neuerscheinungen den „roten Faden“, der die Tübinger, Berner und Frankfurter mit der Jenaer Zeit verbindet. Bondelis Rede vom „Kantianismus des jungen Hegel“ scheint nicht zu widersprechen, daß bei diesem wohl von vornherein „vereinigungsphilosophische Denkressourcen“ (2) vorhanden waren, die die Kant-Aneignung wie –kritik Hegels motiviert und vielleicht auch gesteuert haben. Hier verweist er auf stoische und neuplatonische Elemente. Auch hält er Hegels, fast augustinisches Ringen um die „Person Jesu“ im Hintergrund. Dies geschieht meines Erachtens zurecht. Denn Bondeli will nicht klären, ob Hegels Kantianismus „kantisch“ war, sondern zeigen, daß uns die Auseinandersetzung mit der Kantischen Philosophie die Genese der Hegelschen Philosophie erklärbar und jenes Puzzle zusammensetzbar macht. Mit dieser Arbeit dürfte Bondeli mehr als nur einen Diskussionsbeitrag zum Thema „der junge Hegel“ gegeben haben. Sie stellt ein gehaltvolles, dem Hegelschen Philosophieren angemessenes Modell vor, das in den scheinbar abrupten Wandlungen des Hegelschen Denkens die Kontinuität erkennen läßt. Alexander von Pechmann Norbert Brieskorn Menschenrechte. Eine historisch-philosophische Grundlegung Stuttgart 1997 (Kohlhammer), 208 S., 36.- DM. Brieskorn, Rechts- und Sozialphilosoph an der Münchner Hochschule für Philosophie und - nach eigener Angabe - langjähriger Mitarbeiter von „Amnesty International“, unternimmt in seinem Buch den Versuch, die Geschichte und die Begründungszusammenhänge der Menschenrechte zu systematisieren. Auf die Präambel zur „Erklärung der Menschenrechte“ vom 26. August 1789 folgt zunächst ein Interpretationsversuch anhand der darin prägnant enthaltenen Stichwörter. Im Anschluß daran gliedert Brieskorn das Thema ‚Menschenrechte‚ in sieben Kapitel, denen er jeweils eine eigene These voranstellt. Die erste These besagt, daß es allen Rechtskulturen um den Menschen ging. Seitdem es überhaupt so etwas wie das Recht gibt, geht es Brieskorn zufolge um den Schutz des Menschen. „Unter Rechtskultur ist dabei das von den Menschen einer bestimmten Sprache und Denkart erarbeitete, vielfältige Verhältnis zu verstehen, welches die Rechte und Pflichten der Menschen untereinander und das Spiel der politischen Institutionen in ihrem Rechte- Neuerscheinungen Pflichten-Verhältnis bestimmt und umfaßt“ (19). Diese Tradition reicht also weiter zurück als bis zu französischen Revolution. Wie sich der Schutz des Menschen in der Geschichte konkret gezeigt hat, erarbeitet Brieskorn an den Beispielen Sparta und Rom, an der jüdischchristlichen Ausprägung, an den Rechtskulturen des Hoch- und Spätmittelalters - darin eingeschlossen das Problem der Minderheitenrechte am Beispiel der Juden - und am neuzeitlichen Rechtsverständnis. In einem, näher an der Entwicklung der Menschenrechte bzw. deren Vorläufer orientierten, Kapitel stärkt er seine These, daß nicht einzelne Menschen, sondern Gruppen die jeweiligen Rechte erstritten haben. Die dritte These befaßt sich mit dem Problem der Definition von Menschenrechten bzw., genauer, mit der Definition von ‚Mensch‚ und ‚Recht‚ und der damit im Zusammenhang stehenden Machtverhältnisse. In der vierten und wohl interessantesten These geht Brieskorn den bisherigen Begründungsversuchen der Menschenrechte nach. Rortys Ansicht, daß Menschenrechte nicht begründet werden müssen, weil sie auf der Hand liegen und jede Begründung auf eine kontingente Definition des Wesens des Menschen hinauslaufe, wird von Brieskorn abgelehnt. Dasselbe Schicksal 97 erleiden die Begründungsversuche aus der Tradition oder aus der Gottähnlichkeit des Menschen. „Der Unterschied zwischen dem Verständnis vom Menschen innerhalb der Menschenrechtsbewegung und der Auffassung des christlichen Menschenbildes ist so erheblich, daß die Begründung entweder die Menschenrechte oder die jüdischchristliche Botschaft verstümmeln müßte“ (22). Ebenso lehnt er die Begründung der Menschenrechte durch die Diskursethik von Habermas ab. „Recht und Pflicht der Selbstentscheidung bilden ein unveräußerliches Element der Würde des Menschen. Er selbst ist und bleibt Rechts- und Freiheitsträger, der Diskurs’gemeinschaft’ kommt solche Auszeichnung als ganzer nicht zu“ (156). Die fünfte These bezieht sich auf die Ausformulierung der Menschenrechte unter Berücksichtigung der kulturellen Unterschiede der Menschen. „Das eine Anliegen ist plural zu normieren“ (22). Die sechste These fordert, daß die Menschenrechtsbewegung sich stets den Schwächsten zuwenden muß, und ein wirklicher Erfolg dieser Bewegung erst dann zu verzeichnen ist, wenn jeder einzelne seine Rechte vor der internationalen Völkergemeinschaft wirklich einklagen kann. Die siebte These schließlich besagt, daß auch der Umgang mit den Menschen- 98 Neuerscheinungen rechten einer sittlichen Vorgabe bedarf. Brieskorns fundiertes Wissen um die Geschichte der Menschenrechte und seine Erfahrungen mit dem realen Umgang mit Menschenrechten sind an vielen Stellen erhellend. Seine Offenheit für nur scheinbar nebensächliche Vorgänge, die Bereitschaft, auf Fragen einzugehen, die den eurozentrischen Gesichtskreis verlassen, würden einen tatsächlichen Diskurs über Menschenrechte mit Menschen aus anderen Kulturen ermöglichen, wäre dieses Buch nicht in zwei Punkten mangelhaft. Die inhaltlichen Ausführungen Brieskorns zu den einzelnen Themenbereichen sind teilweise entschieden zu knapp gehalten. Habermas’ Diskursethik wird zusammen mit zwei anderen Vorschlägen auf drei Seiten vorgestellt und kritisiert! Für eine wirkliche Auseinandersetzung fehlen die weiter- und tiefergehenden Argumente. Da alle anderen Begründungsversuche von Brieskorn als entweder nicht hinreichend oder falsch beurteilt werden, ist der Leser natürlich neugierig, welchen Vorschlag Brieskorn selbst lanciert. Aber er wird enttäuscht, da in diesem zentralen Kapitel des Buchs wiederum mehr Fragen als Antworten aufgeworfen werden. Brieskorn schlägt ein Verfahren in drei Schritten vor: aus Einsicht schlußfolgern, einen sozial sich vergewissernden und einen die Minderheiten befragenden Schritt. Jeder von den drei Punkten ist notwendig; ungeklärt bleibt dabei aber, inwieweit und gegenüber wem diese drei Schritte als Begründung hinreichend sind, und welchen logischen Status sie selbst untereinander einnehmen. Zur „Ehrenrettung“ Brieskorns sei aber angemerkt, daß diejenigen, die die Macht besitzen, Menschenrechte zu gewähren oder zu verweigern, einer inhaltlichen Begründung für Menschenrechte gar nicht zugänglich sind, weil diese Macht jeglicher Begründung von Menschenrechten zuwider läuft. Wolfgang Habermeyer Manfred Faßler Was ist Kommunikation? München 1997 (Fink-Verlag), 231 S., 24.80 DM. Die Tatsache, daß im Jahr weltweit etwa 80 000 Jahre telefoniert werden, zeugt zwar vom gewaltigen Ausmaß der telematischen Nutzung, zeigt aber weder, was in all den Gesprächen gesagt, noch ob etwas verstanden wurde: Die Informationsnetze funktionieren als reiner Datentransport. Die Kommunikation ertränke Neuerscheinungen im eigenen Saft, würden - in einer Art Schlagwortstatistik - auch noch Inhalte erfaßt werden. Demgegenüber ist die menschliche Kommunikation vollgestopft mit inhaltsschwerem Sinn, mit Erinnerung und Widersprüchlichkeit. Ist nun aber Kommunikation ein Austausch, der an die Verstehensleistung gebunden ist, oder gleicht sie der Übergabe eines beschriebenen Blattes Papier? Zwar ist die Kommunikation zu einem Weltverfahren geworden, ob aber eine e-mail kommuniziert, ist noch keineswegs ausgemacht. Höchste Zeit also, daß der Medienwissenschaftler Manfred Faßler die Grundsatzfrage stellt: „Was ist Kommunikation?“ Das Buch stellt verschiedene Kommunikationsmodelle vor und untersucht den Übergang der kommunikativen Gepflogenheiten vom Sprachtext hin zur medialen Interaktion. Zwar verfällt Faßler bisweilen systemtheoretischen Selbstbeschreibungen, doch gelingen ihm entscheidende Richtigstellungen in Sachen Informationsaustausch. Schon die Rede von der ‘unmittelbaren Kommunikation’ der Neuen Medien ist ihm suspekt, solange sie nicht an das gebunden bleibt, was sie vermittelt - an den Inhalt: ‘Kommunikation’ sei nicht von ‘Bedeutung’ zu lösen. Ohne Sinnabsicht würde sich Kommunikation sogar erübri- 99 gen. Wenn es aber einerlei ist, ob Menschen an Kommunikation beteiligt sind oder nicht, erweise sich Massenkommunikation als diffuse Massenbenachrichtigung, in der selbst Tote, die noch Post erhalten, kommunizieren. Faßler prüft die Dimension des Inhalts an der Frage, ob bei Kommunikation Wissen oder ob Information kommuniziert werde. Beide seien nicht zu verwechseln; denn die Information umreiße einen Zustand vor der Erkenntnis, wohingegen das Wissen der Erkenntnis erst folge. Information sei Wissen im Wartezustand. Es wartet darauf, humane Weisheitsschübe auslösen zu können. Da also die Informationsaufnahme ein allzu menschlicher Akt ist, handelt es sich noch nicht um Kommunikation, wenn Anrufbeantworter ihren Dienst tun oder Informationen auf der Festplatte erscheinen. Nichtsdestotrotz vermitteln die Apparate zwischen den Kommunikationspartnern und führen einerseits am anderen Ende der Leitung zu Erkenntnis, andererseits aber leiden die Kommunikationspartner zusehends an realen Kommunikationsschwierigkeiten. Faßler analysiert eine paradoxe Entwicklung: Die analogen Bereiche menschlichen Verhaltens und Handelns würden formalisiert, um als elektronisch eigenständige Realität 100 Neuerscheinungen zu funktionieren. Computertechnologien würden in ihren materialen und kulturellen Ausdehnungen den Bereich der menschlichen Souveränität aufheben. Gleichzeitig aber lieferten die Neuen Medien neue ‘Einsichten’, die durch ihre mediale Art der Vermittlung eine „Erweiterung in der Art unseres Denkens“ bewirkten. Das Wissens- und Weisheitsmonopol scheint nicht mehr nur der Mensch zu besitzen, vielmehr avanciere das Medium zur „eigenständigen, überzeitlichen Ordnungsrepräsentation“, das dazu einlädt, der Kommunikation als eine Simulation des Denkens zu folgen. Während die zwischenmenschliche Kommunikation den vielschichtigen Sinn einzugrenzen hat, operieren die Apparate bereits komplexitätsreduziert und zwingen den Nutzer auf eben dies Sinn-neutrale Plateau: Informationen sind schlagkräftige Waffen wider die Komplexität der Welt. Deshalb habe - dies ist die Pointe in der Analyse Faßlers “Information den Platz der Organisation von Wissen und Handlung eingenommen, den bis vor wenigen Jahrzehnten Tradition einnahm“. Das komplex Gewachsene weiche dem informativ Aktuellen und jede „Hermeneutik wird zur Hermeneutik des Programms“. Ob sich dabei noch Kommunikationsmodelle denken lassen, die auf das Soziale bezogen sind, macht Faßler davon abhängig, inwieweit es die Sozialwissenschaften verstehen, die Feldforschung upzudaten, „Theorien der Software“ zu entwickeln und durch „InteraktionsAnalysen“ den Kommunikationskompetenzen ins Epizentrum zu blicken. Erst dann würde klar werden, was zusehends suspekt erscheint: weshalb Kommunikation überhaupt erstrebenswert ist. Matthias Groll Geronimo Glut und Asche. Reflexionen zur Politik der autonomen Bewegung, Münster 1997 (UNRAST-Verlag), br., 245 S., 24.80 DM. Nachdem der wissenschaftliche und mehr schlecht als recht angewandte Sozialismus den Status eines umstrittenen historischen Ereignisses eingenommen hat, und die Vertreter der dazu gehörigen wissenschaftlichen Weltanschauung mittlerweile der roten Liste der bedrohten Arten anzugehören scheinen, und nachdem Mutanten dieser Art, die sich dissident wähnten, aber, so beansprucht, die wahrere Sozialistische Theorie praxisrelevanter Provenienz mit wissenschaftlicher Akribie zu betreiben, mangels praxisrelevanter gesellschaftspolitischer Ansätze und aus Gründen gefälliger Selbstdarstellung vollkommen im Neuerscheinungen stellung vollkommen im Himmelsschloß akademistischer Feingeisterei angekommen sind, scheint linksradikale Politik in nennenswertem Umfang nur noch in den als ‚theoriefeindlich‚ etikettierten, autonomen und anderen kleineren, militant agierenden subversiven Gruppen stattzufinden. Seit geraumer Zeit ist von dort die erfreuliche Tendenz zu vermelden, daß über Praxis und Theorie reflektiert wird. Fast wäre man geneigt zu sagen, endlich! Doch scheint es so zu sein, daß dieses Unterfangen ebenfalls Ausdruck einer, auch für diese Gruppierungen, krisenhaften Entwicklung ist. Einst lieferte Geronimo einer militärisch, quantitativ und qualitativ, weit überlegenen Streitmacht einen langen und erbitterten Kampf in den Wüsten von Texas und Mexiko. Jetzt beansprucht er, mit der Reflexion über autonome Politik eine Aufhebung im besten hegelschen Sinne zu betreiben, nämlich durch das Immer-so-weiter-machen, einer Form des Aufhörens bisheriger autonomer Politik. In seinem neuesten Buch, das sich nicht zuletzt auch durch einen beträchtlichen Unterhaltungswert auszeichnet, ist der Autor zur Erkenntnis gekommen, daß eine Bewegung, die revolutionär im konkreten und nicht in einem sich selbst kostümierenden und legitimierenden Sinne sein will, kein 101 Gedächtnis hat und sich auch nicht für das Abheften ihrer produzierten Schriften interessieren dürfte. Setzt dies ein, so sei diese Bewegung an ihr Ende gekommen. (7) Diese Grundthese versucht der Autor mit Fleisch zu füllen, indem er den kollektiven Prozeß der Selbstreflexion dieser Bewegung beschreibt und gleichzeitig an jüngeren Beispielen das Ende der bisherigen, sich revolutionär wähnenden, radikalen Linken thematisiert. Wie also ist es um ein Häuflein Abenteurer am Morgen danach bestellt, wenn sie im morgendlichen Nebel um ihr zu Glut und Asche gewordenes Lagerfeuer sitzen? Das Buch läßt drei Teile erkennen. Der erste Teil behandelt den „Autonomie-Kongress“. Der exklusive Anspruch, autonom sein zu wollen, ist natürlich ein Selbstwiderspruch, wie der Autor selbstkritisch einräumt(138), da dieser Begriff nur über die Auseinandersetzung mit anderen linksradikalen Gruppierungen politisch zu füllen ist. Gegenüber Linksradikalen, die sich selbst als ‚Stalinisten‚ bezeichnen, sei eine Position von Nöten, die sich nicht nur abgrenzt, sondern die deutlich eine andere Politik einfordert und eben gerade jenes Radikalismusverständnis zutiefst ablehnt, das sich durch die Zahl der bekämpften vermeintlichen und / oder tatsächlichen Gegner und am Grad deren 102 Neuerscheinungen Ausmerzung definiert (139). Was aber bedeutet praktizierte Autonomie heute? - In dem von mir als zweiten identifizierten Teil zeichnet Geronimo an verschiedenen Events der 90er Jahre den Verlust politischer Substanz autonomer Praxis auf. Erfolge (31ff.), Spitzel in den eigenen Reihen (61ff.) und ein Abgleiten in eine Räuber-undGendarm-Dialektik (87ff.) zeigen verschiedentlich auf schmerzhafte Weise den Verlust des Politischen: vermeintliche Politik mutiert zur inhaltslosen Aufrechterhaltung einer folkloristischen Veranstaltung - im Gegensatz zum Musikantenstadl aber mit teilweise unmittelbar blutigen Folgen. Das Hauptdilemma ist dabei, daß eine solche Politik zur unbegriffenen autistischen Selbstbefassung mit inneren Widersprüchen führt - anstatt sich als ein aus der Gesellschaft heraus Widersprüche forttreibendes Element zu begreifen. Dies ansatzweise begriffen zu haben, zeigt der durchgeführte Kongreß durch die Einsicht, mit Kongressen den Prozeß des Begreifens „langwieriger, vertüttelter sozialer Prozesse“ (191) eben nicht abkürzen zu können. In dem Buch wird immer wieder deutlich, daß der Autor auch seine eigene Rolle und seine politische Heimat einer Selbstreflexion unterzieht (köstlich: Benimmregeln, 169ff.) und das Scheitern politischer Projekte auch auf sich selbst bezieht. Der dadurch oft zu unvermittelt lancierte Szenejargon ist aber nicht die einzige Schwäche an diesem Buch: irgendwie bleibt die zentrale Kategorie des Politischen unklar, womit der dritte Teil des Buches zur Sprache kommt. - Der Autor versteht das Politische sowohl als Auseinandersetzung als auch als Meinungskampf - ohne dabei einen Feind als persönliches Gegenüber zu bestimmen. Denn, so versichert uns der Autor, „wir sind nicht gegensätzlich oder antagonistisch zueinander, wir sind nur verschieden.“ (27) Wer ist ‚Wir‚? Die autonome Bewegung? Dann ist dieses Buch eine Nabelschau derselben, die sich als kollektives Subjekt den Luxus einer Therapie leistet. Denn trotz aller Selbstreflexion kann der Konflikt einer Bewegung nicht auf eine innere Angelegenheit derselben reduziert werden. Sind mit ‚Wir‚ also alle Subjekte in dieser Gesellschaft gemeint? Dann hat diese Aussage einen bestenfalls ethischen Wert; schlimmstenfalls ist sie naiv und falsch. In einer grundlegend antagonistischen Gesellschaft gibt es kein ‚Wir‚. Es gibt Emanzipation und Unterdrückung, Freiheit und Unfreiheit, Gleichheit und Ungleichheit, Gewinnmaximierung und Bedürfnisbefriedigung. Entlang dieser Koordinaten spielen sich die gesellschaftlichen Konflikte ab: sie Neuerscheinungen sind der Motor deren Entwicklung. Und es gibt keine Oase, die davon ausgenommen wäre, daher sind „politisch maskierte, rassistische, therapeutische ... Diskurse“ (29), im Gegensatz zur Meinung des Autors, immer politisch und werden gerade deswegen als unpolitisch deklariert, um ihren gesellschaftlichen Gehalt zu eskamotieren. Der zu kritisierende Politikbegriff des Autors führt m.E. dazu, daß es dem Autor nicht ganz gelingt, die Brücke von der überzeugend dargelegten Problematik eines autonomen Politikverständnisses hin zu den Widersprüchen autonomer Politik im Klassenkampf der relevanten Zeiträume zu schlagen. Der/die geneigte Leser/in wird in dieser weitestgehend auf eine Binnensicht autonomer Politik beschränkten Schrift auf Analyseversuche des gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustandes, aus denen relevante Einsichten für Praxisprobleme radikaler Politik sichtbar werden könnten, verzichten müssen. Die immer wieder hervorgekehrte Einsicht, daß autonome Politik das Ziel in der Aktion antizipieren müsse, ist einleuchtend, aber hilft in einer Situation der Agonie linker Politikprojekte auch nicht viel weiter. Über die Selbstreflexion einiger autonomer Politikaktionen hinaus wären aber Überlegungen zu den Implikationen und Antinomien 103 linksradikaler Politik notwendig gewesen: einer Politik, die einerseits den aufklärerischen Ansatz in Anspruch nimmt, die Massen für ein emanzipatorisches Projekt zu gewinnen, und die andererseits die Massen angesichts ihres reaktionären oder semifaschistischen Bewußtseins mit Chaos, Straßenkämpfen und wortmächtigen Pamphleten oder eben mit elitärer Verachtung bestraft. Es bleibt zu hoffen, daß das Pseudonym nicht für das gleiche hoffnungslose Ende steht, das der Namensvetter erdulden mußte. Dagegen spricht, daß aus dem Bewußtsein, Verlierer zu sein, ein Ausbruch aus dem Dilemma von Macht und Gegenmacht und von Sieger und Verlierer im inklusiven bürgerlichen Staat möglich scheint. Thomas Lemke Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität. Hamburg 1997 (Argument-Verlag), 412 S., 39.80 DM. In letzter Zeit ist es um Michel Foucault ruhiger geworden. Die Debatten der 80er Jahre um seinen „heillosen Subjektivismus“ (Haber- 104 Neuerscheinungen mas) und das Begründungslose seiner Praxis, sowie die Häme über Foucaults vermeintlichen Rückzug ins Private der Selbstsorge gehören der Vergangenheit an. Im ausgehenden Kohlismus fristet er als Lebenskünstler sein geistiges Dasein in den Kompendien, die zum „guten Leben“ anleiten. Thomas Lemke hat diese Ruhe gut genutzt und aus teils noch unbekanntem Material des Pariser Foucault-Archivs die Systematik des Gesamtwerks zu rekonstruieren unternommen. Dabei geht es ihm weniger um die Inhalte, die Foucault bearbeitet hat (auch wenn diese nicht zu kurz kommen), aber auch nicht primär um die Begriffe, Konzepte und die Methodik, mit denen er gearbeitet hat, sondern um die Paradoxien, Widersprüche und Aporien, die Foucault selbst reflektiert hat, und die ihn Mitte der 70er Jahre zur Transformation, ja zum „Bruch“ (Foucault) mit seiner früheren Theorie der Macht veranlaßt haben. Lemke stellt uns Foucault nicht nur als den bekannten Analytiker und Historiker von Machtstrukturen und –diskursen vor, sondern als einen äußerst subversiven Denker, der seine eigenen Konzeptualisierungen in Frage stellt und der das zentrale Thema seiner Philosophie, Macht und Widerstand, eher umkreist als ‚auf den Begriff‚ bringt. Er kommt zum Ergebnis, daß Foucault, entgegen den Vermutungen, niemals den Widerstand zugunsten des Privaten aufgegeben hat; daß es aber für Foucault das fundamentale – theoretische wie praktische – Problem war, daß der Widerstand selbst Macht ist, und daher die Kritik der Macht auf sich selbst angewandt werden muß. Foucault entziehe sich dem gängigen Entweder-Oder und suche die Entwicklung einer „Grenzhaltung“. Er selbst hat diese Haltung als einen „‚Slalom‚ zwischen der traditionellen Philosophie und der Aufgabe jeglichen Ernstes“ (352) beschrieben. Der erste Teil von Lemkes Arbeit referiert überwiegend Bekanntes: Foucaults „Mikrophysik der Macht“, die die Technologien der Disziplinierung von Individuen anhand der psychiatrischen Klinik, des Gefängnisses und der „Wissenschaft vom Menschen“ analysiert. Der zweite Teil bildet den Kern der Arbeit. Hier stellt er jene Art der Selbstkritik Foucaults dar, die in der öffentlichen Diskussion unbeachtet blieb. Er stützt sich dabei auf teils unveröffentlichte Texte und Tondokumente, die sich auf eine Vorlesungsreihe beziehen, die Foucault 1978 und 1979 am Collège de France gehalten hat. 1977 gesteht Foucault ein, bislang einen reduzierten Begriff von Macht gebraucht zu haben: „Es ist klar, daß alles, was Neuerscheinungen ich im Laufe der letzten Jahre gemacht habe, vom Modell KriegUnterdrückung ausging.“ (127) Foucault, so versteht Lemke diese Selbstkritik, habe den Verdacht, daß sein strategisches Modell der Macht noch immer in der Tradition der juridischen Konzeption von Macht steht, die er damit überwinden wollte. Deshalb müsse das Modell Krieg-Unterdrückung überdacht, wenn nicht überhaupt aufgegeben werden; denn unter dem Gesichtspunkt der disziplinären Zurichtung müssen Widerstandspotentiale ebenso unmöglich erscheinen wie eine „Geschichte der Besiegten“, da diesen per definitionem die Sprache der Sieger aufgezwungen werde. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob „Herrschaftsprozesse nicht viel komplexer und vieldeutiger als Krieg“ (143) sind. Foucault antwortet auf diese konzeptuelle Krise mit dem Begriff „gouvernement“; Lemke übersetzt: „Regierung“, „Führung“. Diesen Begriff der „Regierung“ interpretiert Lemke als Konsequenz aus den struktur- wie subjekttheoretischen Defiziten der bisherigen Machtanalysen. Er erhält die „Scharnierfunktion“ (31), die zwischen strategischen Machtbeziehungen und Subjektivierungsprozessen, Techniken der Herrschaft und des ‚Selbst‚, Politik und Ethik, vermittelt und beide verbindet. Weil man diese 105 Neukonzeption übersehen habe, so Lemke, habe man bei Foucault fälschlich von einem „Übergang von der Politik zur Ethik“ gesprochen. Entscheidend für diesen Begriff „gouvernement“ sei, daß er die Macht über andere nicht mehr in Kategorien der Kriegführung beschreibt, sondern auf „Wahrheit“ rekurriert. „Foucault identifiziert Regierung als eine spezifische Form der Machtausübung, die weniger als repressiver Zwang oder als ideologische Verstellung funktioniert, sondern im Gegenteil über die Produktion von Wahrheit operiert. Im Gegensatz zu anderen Machtformen verlangt Regierung auf der Seite der Individuen nicht nur Unterwerfung und Gehorsam, sondern Wahrheitsakte. Foucaults zentrales Problem ist daher die Frage, ‚wie Menschen sich selbst und andere über die Produktion von Wahrheit regieren’.“ (32) Auf der Grundlage dieses Begriffs gibt Foucault eine Genealogie des modernen Staates, die Lemke recht ausführlich, von der Polizeiwissenschaft des absolutistischen Staates bis zum neoliberalen Modell der „Chicagoer Schule“, vorstellt. Der dritte Teil schließlich geht auf Foucaults Ethik ein. Diese sei keine Rückkehr zu seinem existentialistisch geprägten Frühwerk, sondern habe die Genealogie des modernen Subjekts zum Thema und müsse als 106 Neuerscheinungen Fortsetzung und Ergänzung der Genealogie des modernen Staates verstanden werden. Ging es dort um das gouvernement des autres, geht es hier um das gouvernement de soi. In Der Gebrauch der Lüste und Die Sorge um sich analysiert Foucault anhand der Sexualität und der Selbstsorge die Technologien, durch die und mittels derer das moderne Subjekt sich konstituiert. Beide Werke verfolgen die Veränderung der Selbsttechniken anhand der moralischen Reflexion der Sexualität und des Verhältnisses zu sich selbst. Foucaults früher Tod habe die Ausarbeitung dieses Konzepts des Regierens anderer und sich selbst verhindert. Wenngleich Lemkes Buch im zweiten Teil Längen hat, die man mit dem Hinweis auf die Unbekanntheit des Materials rechtfertigen kann, ist Lemkes Foucault-Interpretation äußerst überzeugend. Es wird jedenfalls der methodischen wie inhaltlichen Subtilität des Denkens Foucaults gerechter als die früheren Holzschnittdiskussionen. Vielleicht mag es darüber hinaus eine neue Diskussion über Macht und Widerstand und ihre Formen initiieren, das die alten Dualismen hinter sich läßt. Abschließend sei angemerkt, daß der umfassenden Bibliographie am Ende des Buches die Ergänzung um ein Sachregister gut getan hätte, und daß der bemühte Aktualismus des „Waschzettels“ dem Inhalt des Buches nicht gerecht wird. Alexander von Pechmann Hans Joas Die Entstehung der Werte Frankfurt/Main 1997 (Suhrkamp), 300 S., 48.- DM. Joas‚ Buch ist kein historischer Abriß über die Entstehung der Werte. Es bezieht sich auf die Theoriegeschichte: wie haben sich Philosophen und Soziologen das Entstehen und Vorhandensein von Werten und Wertbeziehungen erklärt? Auf diese „klare Frage“ als ersten Satz seiner Abhandlung folgt mit dem zweiten Satz sogleich eine klare Antwort: „Werte entstehen in Erfahrungen der Selbstbildung und Selbsttranszendenz.“ Was das genau heißt, darüber handeln die restlichen Seiten dieses Buchs, die die Erklärungsmuster von F. Nietzsche und W. James bis zu Ch. Taylor und R. Rorty umfassen. Daß dabei die Ansichten des amerikanischen Pragmatismus nicht nur im Vordergrund stehen, sondern die Basis der theoretischen Bemühung ausmachen, darf bei Joas, dem deutschen Herold des amerikanischen Pragmatismus nicht überraschen. Ihm geht es in seinem Buch explizit um die Vermittlung zweier Positionen: der Neuerscheinungen aus den USA kommende Kommunitarismus und seine dezidierte Orientierung an Werten soll mit der deutschen Lesart des Liberalismus und Universalismus in Gestalt von Jürgen Habermas verbunden werden. Joas beginnt mit Nietzsche, weil er an ihm exemplarisch aufzeigen will, wie sich im jüdischchristlichen Diskurs des Abendlands eine Umwertung der Werte vollzieht, ohne das Bezugsraster dieses Diskurses zu verlassen. Seine anti-religiöse Radikalität ist selbst noch ganz befangen im Ringen um Religiosität. Allerdings ermöglicht Nietzsches Konstruktion eines aristokratischen und totalen (totalitären?) Ichs die Öffnung zur vernünftigeren Frage des Selbst und seiner Konstitution. Bei James hingegen, dem Stammvater des amerikanischen Pragmatismus, wird Religion und Moralität strikt getrennt. Weder sei Religion eine Hyper-Moralität, noch ließen sich die Normen des rechten gesellschaftlichen Handeln aus Religion ableiten. Religion, genauer: Religiosität, sei das Resultat von Erfahrungen der Selbstaufgabe, die wiederum die „idealen Kräfte des Individuums stärken und tragen können“ (86). Mit James, so Joas, gewinnt der Begriff des Selbst als Bindeglied zwischen vorgängiger Gesellschaftlichkeit des Individuums und je individueller Erfahrung seine Kon- 107 turen. Über Dewey, Mead, Durkheim, Simmel und Scheler gelangt Joas zu Taylor und zur Bestätigung seiner Ansicht, daß sich die Frage nach den Werten des Individuums und seinen Wertbindungen, die Fragen von Moral und Ethik und, vor allem, die Frage nach dem Guten und dem Rechten ohne Rekurs auf die Bildung des Selbst und seiner Identität nicht beantworten lassen. Taylor bindet in einer Differenzierung der Wünsche auf individueller Ebene Werte, Moral und Identitätsbildung zusammen. Dies geschehe, weil der Mensch fähig sei, seine Wünsche zu reflektieren und ihnen eine hierarchische Struktur zu geben. In dieser Reflexion lassen sich Gründe für moralische Gefühle erkennen, die als Bezugspunkt eine Lebensform, ein Ideal bezeichnen und uns eine „Vorstellung geben, welche Art von Person wir nach unseren eigenen Maßstäben sein wollen“ (203). Das Subjekt, so Taylor, erfährt seine eigenen starken Wertungen nicht als Setzungen, sondern als etwas unabhängig von ihm selbst Gegebenes. Er spricht von „‚frameworks’ qualitativer Unterscheidungen, in die unsere Wahrnehmungen unserer selbst und anderer, die Situationen unseres Handelns und unsere Handlungen eingegliedert sind“ (204). Unsere Identität bezieht sich dem gemäß darauf, daß wir unterscheiden kön- 108 Neuerscheinungen nen, was uns wichtig ist und was nicht. Wichtig für Taylor ist nun, daß die Reflexion über und Artikulation der höchsten Werte/Güter eine genuine Verbindung eingehen: „Ein Gott oder das platonische Gute, der romantische Naturbegriff oder das rationale Handeln im Sinne Kants lassen sich nur als artikulierte Güter vermitteln und begreifen... ohne explizite Formulierung in irgendeiner Form ... stellen diese Güter nicht einmal Optionen dar“ (Taylor, 218). Diesen Ansatz konfrontiert Joas mit Überlegungen des von ihm so bezeichneten „postmodernen Philosophen“ Richard Rorty. Dessen Lob der Differenz und der Befreiung aus der Zwangsjacke einer starren Identität relativiert Joas mit dem Einwand, Differenzen ohne Spannung seien nicht nur langweilig, sondern belassen die jeweiligen Protagonisten einfach in ihrem dumpfen SoSein. Das schöpferische Potential der Differenz werde eliminiert, „weil keiner der Beteiligten sich mehr ans bestimmte Eigene gebunden fühlt, keiner das Andere als möglicherweise heilsame Provokation zur ernsthaften Selbstveränderung erlebt und alle Gerichtetheit auf einen möglichen Konsens - und sei es den über Differenz - verschwunden ist“ (251). Die Eingangsthese, daß Werte in Erfahrungen von Selbstbildung und Selbsttranszendenz entstehen, daß also Moralität und Identität sowohl innerhalb einer Person als auch zwischen den Personen einen spannungsreichen Zusammenhang bilden, erweitert Joas am Ende des Buches unter dem Titel „Werte und Normen: Das Gute und das Rechte“. Auf der Basis des Pragmatismus und im speziellen einer Ethik, die sich auf die Perspektive des Handelnden und seine Not, in Handlungsproblemen zu Lösungen zu kommen, einläßt, ließen sich nämlich zwei, einander eigentlich ausschließende Vorgänge zusammenbringen: die universalistische Moralkonzeption und kontingenzbezogene Wertentstehungstheorien. „Für die Rechtfertigung von Normen gibt es in dieser Sichtweise keine höhere Instanz als den Diskurs. In der Perspektive des Akteurs aber, der seine Handlungen unter kontingenten Bedingungen entwirft, steht nicht die Rechtfertigung obenan, sondern die Spezifizierung des Guten oder des Rechten in einer Handlungssituation“ (267). Diesen Ansatz konfrontiert Joas nun mit der Diskursethik von Habermas. Die rein auf Verfahrensrationalität zielende Diskursethik, zu der Habermas in den 70er Jahren ja erst durch seine Aneignung des frühen amerikanischen Pragmatismus gelangte, leite ihren Universalitätsanspruch auch daraus ab, daß nur diejenigen „Normen Neuerscheinungen Geltung beanspruchen dürfen, die die Zustimmung aller Betroffener als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden können“ (275) Joas nennt dies die diskurstheoretische Lesart des kategorischen Imperativs -, und daß sich aus dieser formalen Prozedur des ethischen Diskurses keine substantiellen Folgerungen mehr ziehen lassen. In unserer nachmetaphysichen Welt gilt daher für Habermas das Primat des Rechten vor dem Guten. Joas‚ Haupteinwand gegen dieses Diktum bezieht sich nun darauf, daß unter den Gesichtspunkten einer pragmatischen Ethik sehr wohl noch substantielle und damit partikulare und kontingente Werte, Güter oder Ideale vertretbar und verfechtbar sind - ohne deshalb sofort vom Bannstrahl des Universalismus in die reaktionäre Ecke verwiesen werden zu können. Er widerspricht Habermas, wenn dieser behauptet, die moralische Gemeinschaft konstituiere sich „allein über die negative Idee der Abschaffung von Diskriminierung und Leid sowie der Einbeziehung der - und des - Marginalisierten in eine wechselseitige Rücksichtnahme“ (290). Auch die Kommunitaristen vertreten eine Gemeinschaft, die sich das Etikett „moralisch“ an die Brust heften dürfe, weil eben Werte reproduziert werden müssen, damit die Gesellschaft sich nicht auflöst. 109 Und wo wäre dies besser möglich als in einer Gesellschaft, die sich auch als „Gemeinschaft“ (Kommune) versteht? So läßt das Buch zum Ende hin den Leser ein wenig unbefriedigt zurück, weil es so aussieht, als wäre das ganze doch nur ein kleiner und bescheidener Einwand gegen Habermas, der sich kürzer und prägnanter hätte darstellen lassen, und der gewichtige Alternativen ausblendet. Zygmunt Baumanns Versuch einer postmodernen Ethik etwa wird von Joas als „elitär“ zurückgewiesen, weil dessen These vom Ende aller Gewißheiten diejenigen vor den Kopf stoße, die für sich selbst noch eine Wertsicherheit reklamieren. Über Werteverlust klagen aber nach wie vor nur diejenigen, die sicher sind, die richtigen Werte zu besitzen, und daß es den anderen an Werten bzw. den richtigen Werten mangele. Das Problem heute jedoch ist, daß zwar Werte an sich nichts schlechtes sind, daß aber die damit verbundene Sicherheit am Ende dieses Jahrhunderts selbst zu einer Frage der Moral geworden ist. Hierfür ließen sich Beispiele aus der jüngsten Geschichte nennen. Insofern ist der Vorwurf, Bauman sei elitär, weil er verunsichere, wenig einleuchtend. Wer sich jedoch für Kommunitarismus und Pragmatismus interessiert und einen verständlichen (al- 110 Neuerscheinungen lerdings themenzentrierten) Einstieg zu Taylor und Dewey, James und Rorty sucht, wird freilich fündig werden. Dennoch hätte das Buch, das sich wiederholt auf sich selbst bezieht und den Fortgang der Argumentation als eine Entfaltung der anfangs dargelegten These und der möglichen Einwände betreibt, einer klarer strukturierten Gliederung bedurft. Eine Gliederung, die über die bloße Aneinanderreihung von zehn gleichberechtigten Punkten hinausginge, wäre schön gewesen. Oder verweist dies auf eine Schwäche des Buches - das eigentlich gar nicht geplant war (7)? Wolfgang Habermeyer Ulrich Kohlmann Dialektik der Moral. Untersuchungen zur Moralphilosophie Adornos Lüneburg 1997 (zu KlampenVerlag) , 257 S., 38.- DM. „Ethik hat Hochkonjunktur.“ (11) Kohlmanns einleitender Feststellung ließe sich hinzufügen: Veröffentlichungen zum Thema Moralphilosophie bei Adorno auch. Kohlmanns Buch ist neben einigen Aufsätzen und einem Sammelband bereits die dritte Monographie seit 1993, die sich primär mit diesem - bisher weitgehend vernachlässigten - Aspekt von Adornos Denken auseinandersetzt. Um es gleich vorwegzunehmen: eine durchweg lesenswerte Schrift von durchgängig apologetischem Charakter. In der ersten Hälfte seiner Schrift präsentiert Kohlmann die Geschichte der Moralphilosophie seit Kant überzeugend als konsequente Fortentwicklung, die - wie könnte es anders sein - in Adornos Moralphilosophie kulminiert. Kants Kritik an der Gültigkeit des ontologischen Gottesbeweises raubt sowohl der rationalistischen Metaphysik als auch der traditionellen Moral ihr Fundament. Kants Ethik, die im Bereich der Moralphilosophie einen entscheidenden Wendepunkt darstellt, kann als Antwort auf seine Kritik am ontologischen Gottesbeweis begriffen werden. Denn sie unternimmt als autonome Reflexionsmoral bzw. als Selbstgesetzgebung der Vernunft den Versuch, dem moralischen Gesetz in der praktischen Vernunft ein neues Fundament zu verschaffen. Gegen die von Kant unterstellte Einheit von Vernunft und Sittlichkeit führt Kohlmann Adornos de Sade-Interpretation aus der Dialektik der Aufklärung ins Feld, die die Allgemeingültigkeit des kategorischen Imperativs bestreitet und mit dem Aufweis der Einheit von Vernunft und Herrschaft schließt. Adorno Neuerscheinungen weist also den Autonomieanspruch der Kantschen Ethik zurück und entwickelt vornehmlich an ihr seine Kritik am repressiven Gehalt von Ethik. Auch Schopenhauer bemüht sich für Kohlmann darum, der Ethik ein neues tragfähiges Fundament zu verschaffen. Dieses findet seine Gefühlsmoral im Mitleid, das er als Quietiv des Willens verherrlicht. Adorno weist aber die Mitleidsethik als Ausweg aus den Aporien der Reflexionsmoral zurück, denn das Mitleid läßt sich prinzipiell nur als ethisches Ausnahmeprinzip begreifen. Die nachfolgenden Aufhebungsversuche der Moral durch Hegel in der verwirklichten Sittlichkeit und durch Marx im zukünftigen Gesellschaftszustand radikalisieren zwar die Kritik an Moral, bleiben für Kohlmann aber unzureichend. Während Kohlmann seine Sichtweise von Hegels wirklichkeitsverklärendem Aufhebungsversuch anhand von einigen Zitaten auch als die Adornos belegen kann, wird der Leser in der Passage zu Marx über Adornos Position im unklaren gelassen. Ein Hinweis auf Adornos Kritik an Marx’ Revolutionstheorie hätte jedoch ausgereicht, um mit Adorno behaupten zu können, daß Marx’ „Moralkritik pragmatistisch verkürzt blieb“ (100). Die bisherige Forschung hat bereits vereinzelt Nietzsches Einfluß auf 111 Adorno nachgewiesen. Kohlmann versucht nun zu zeigen, daß Adorno auch im Bereich der Moralphilosophie an Nietzsches Reflexionen anknüpft. Nietzsche zieht nicht nur aus dem Scheitern des traditionellen Begründungsdiskurses der Moral die Konsequenzen. Bei ihm findet sich auch bereits die entscheidende Frage nach der Dialektik der Moral, auf deren Entfaltung negative Moralphilosophie gerichtet ist: Ist Ethik als System der Moral selbst moralisch, genügt sie ihren eigenen Prinzipien? Die Kritik an Moral, die sich daraus ergibt und die das Unmoralische an Ethik aufzeigen will, ist bei Nietzsche und Adorno als solche wiederum moralisch motiviert. Das Unmoralische an Moral ist „ihr latentes Motiv, zu strafen und zu verfolgen, wie ihre Absicht zu zwingen“ (102). Dieser Ansatz, so Kohlmann, werde bei Nietzsche nicht weiterentwickelt und kritisiere „allein die christliche Moral“ (102). Nietzsche bleibe zudem in einer moralphilosophischen Aporie stecken, da der moralische Bezugspunkt und der Wahrheitsanspruch seiner Kritik an Moral von seiner radikalen Kritik an Moral und Wahrheit selbst erfaßt wird. Kohlmann bemüht sich auch zu zeigen, daß sich Nietzsche aus dieser Aporie nicht, wie Adorno annimmt, in neue Werte und eine positive Lehre flüchtet, sondern 112 Neuerscheinungen seine eigenen Lehren (Wille zur Macht, Übermensch, Ewige Wiederkunft, Amor fati) selbst destruiert (81ff.). Kohlmanns Nietzsche-Deutung kann nicht unwidersprochen stehenbleiben. Zum einen kritisiert Nietzsche nicht allein die christliche Moral, sondern beispielsweise auch die jüdische, die buddhistische und die Schopenhauers (vgl. Genealogie der Moral, Vorrede 5, Erste Abhandlung). Zum anderen scheint sich Kohlmann die Kritik von Habermas zu eigen zu machen, der Nietzsches Satz ‚Es gibt keine Wahrheit’ als performativen Selbstwiderspruch begreift. Dagegen ließe sich einwenden, daß ‚Es gibt keine Wahrheit’ kein einfacher, deskriptiver Satz ist, sondern das Ergebnis eines langen Diskurses mit einer Vielzahl deskriptiver Sätze. Des weiteren macht es sich Kohlmann mit Nietzsches positiver Lehre, die dieser angeblich selbst destruiere, etwas zu einfach. So ist weder vom Willen zur Macht als Hermeneutik noch von dem Zusammenhang dieser Hermeneutik mit dem Übermenschen die Rede. Und noch nebenbei bemerkt: Napoleon ist für Nietzsche kein Beispiel für eine leibhafte Personifizierung des Übermenschen (84), sondern eine „Synthesis von Unmensch und Übermensch“ (Genealogie der Moral, Erste Abhandlung, 16). Bei Adorno wird Nietzsches Ansatz dann zu einer negativen Moralphilosophie ausgebaut, die selbst keine ethischen Handlungsimperative aufrichtet und nichts weiter ist als immanente Kritik an Ethik. Diese entlarvt Ethik als Technik zur Herrschaft über die innere Natur des Menschen und als genuinen Abkömmling instrumenteller selbsterhaltender Vernunft. Adornos Bezugspunkt, der seine Kritik an Moral ermöglicht, findet sich im ‚leibhaften Moment’, das Leiden als das ‚Unmenschliche’ indiziert (147). Kohlmanns Interesse an Adornos negativer Moralphilosophie ist erfreulicherweise kein rein philosophiegeschichtliches. Denn es geht ihm nicht zuletzt darum, Nietzsches und vor allem Adornos moralisch motivierte Kritik an Moral gegen aktuelle Ethikmodelle in Stellung zu bringen und die Zweifel an deren sachlicher Relevanz zu stärken. Diese Zweifel rechtfertigen sich für ihn vor allem durch die Unbekümmertheit, mit der in der gegenwärtigen Ethikdebatte Nietzsches und Adornos stichhaltige Kritik an der Möglichkeit und Wünschbarkeit von Moral überhaupt ignoriert wird. Zu schade nur, daß Kohlmann bei der erinnernden Rekonstruktion dieser Kritik abbricht und ihre konkrete Anwendung an keinem einzigen Ethikmodell des gegenwärtigen Booms vorführt. Neuerscheinungen Manuel Knoll Rainer Rotermundt Plädoyer für eine Erneuerung der Geschichtsphilosophie Münster 1997 (Westfälisches Dampfboot), 130 S., 29.80 DM. Einem ehrgeizigen, sympathischen, notwendigen, in diesem Falle gescheiterten Projekt widmet sich R. Rotermundt, Professor für Politikwissenschaft an der FH Düsseldorf, der mit seiner neuesten Veröffentlichung den Weg zu einer Wiederherstellung der Geschichtsphilosophie die im Zuge der Postmoderne nicht nur aus dem öffentlichen Denken verschwunden scheint - ebnen will. Der Absicht des Autors nach soll dies - „bewußt knapp und sehr dicht gehalten, weil sonst der polemische Reiz dahin wäre“ - mit Rückbindung an die hegelsche Geschichtsphilosophie und in Anlehnung an die Analyse der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen von Marx geleistet werden. Er postuliert eine Rückbesinnung „auf die angeblich überwundene Metaphysik“ - im Sinne Aristoteles’ als „Denken des Denkens“-, wie sie in der Hegelschen Philosophie, nach der die Weltgeschichte als „Fortschritt im 113 Bewußtsein der Freiheit“ zu erfassen sei, anwesend ist. Um für den Entwicklungszusammenhang der Geschichte ein Kriterium zu erhalten, ist es Rotermundt zunächst um eine Analyse des Vernunftbegriffes Hegels zu tun. Dieser ist „untrennbar“ mit „Wahrheitsanspruch ... und Seinsbegriff verknüpft... Wahr ist - in Philosophie wie in der Geschichte - was als Sein begriffen werden kann, und was als Sein begriffen wird, ist vernünftig.“ (27) Die Vernunft wiederum ist in konkreter Allianz mit den Begriffen Geist und Freiheit, die in ihrer Gesamtheit den hegelschen Geschichtsbegriff konstituieren. Freiheit nach Hegel ist nicht die willkürliche Entscheidungsfreiheit, sondern die Struktur des „Beisich-Seins im andern seiner Selbst“. Diese Struktur der Freiheit ist aber in Reinform nur im Akt des Denkens (im Gedachten ist der Denkende im andern seiner selbst präsent), im Geist, im Bewußtsein vorhanden. Dies wird abermals vom hegelschen Begriff umfaßt. Der Begriff ist gedachtes Sein und seiendes Denken in einem, wobei Rotermundt zwar den Unterschied von Denken und Sein („Kein Denken ohne Sein“) herausstellt, aber die unmittelbare Einheit beider betont: „Wer jenseits allen Seins denken wollte, wäre ebenso verloren wie der, der jenseits allen Denkens sein wollte!“ 114 Neuerscheinungen (44) Im Begriff, in dem „Allgemeinheit, Einzelheit und Besonderheit ineinander vermittelt sind“, dergestalt daß der Begriff Subjekt und Prädikat eines Urteilsatzes umfaßt, in der Allgemeines und Besonderes nicht nur in einer empirischen („Diese Rose ist rot“), sondern auch logischen Beziehung („Die Rose ist eine Pflanze“) zueinander stehen, bilden Vernunft, Freiheit, Geist und Sein ein Ganzes. Dementsprechend meint Rotermundt, die eigentliche Geschichtsphilosophie Hegels in dessen ‚Logik’ gefunden zu haben. Des weiteren sind Individuum und Allgemeinheit über den Staat vermittelt; und somit beginnt die Geschichte, deren Substanz die Freiheit ist, mit der Entstehung des Staatswesens. Die Gesamtheit der Vermitteltheit der Individuen eines Volks oder einer Epoche bezeichnet Hegel als „Volksgeist“ und deren vermitteltes Ganzes nennt er „Weltgeist“. Die Struktur des Begriffs, der allseitigen Vermittlung, erscheint mithin als allgegenwärtig, und sonach erfolgt die Geschichte „durch die Bewegung des Begriffs selbst“, während „eine jede Epoche ... in eine andere“ als in ihre „bestimmte Negation“ übergeht. Nebenbei erfährt man noch, daß es sich bei Hegels Gottesbegriff um eine „hochintellektuelle Angelegenheit“ handelt, der abermals die Konstruktion der Vermitteltheit von Allgemeinen, Einzelnen und Besonderen und die Geschichte als Ganzes umschließt. Bis zum Ende der Hegel-Kapitel ist die Darstellung wahnsinnig kompliziert, aber einigermaßen stringent; ab der Hälfte des Buches wird sie weniger stringent, mehr wahnsinnig, aber nicht weniger kompliziert. Kennzeichnend für das Denken unserer Zeit ist, fährt Rotermundt fort, der Nihilismus, in welchem die Vermittlung von Besonderem und Allgemeinen nicht mehr wahrgenommen wird, und der Mensch seine gesellschaftlichen Gegenstände nicht mehr als selbst produzierte, als das Andere seiner selbst, begreift: „Der Begriff der Totalität, wie er sich dereinst in Gestalt des „Staates“, der „Gesellschaft“, der „invisible hands“, der „volonté générale“ usw. äußerte, ist aus dem Bewußtsein verdrängt. ... Der Begriff des „Politischen“ wird „in das Verhältnis Freund und Feind transformiert.“ (68) Für beide Seiten des nihilistischen Bewußtseins, die Rotermundt scharfsinnig in Kommunismus und Nationalsozialismus erblickt, „ist nicht nur Gott tot, sondern auch der Staat.“ (70) Auch bei „modernen“ Phänomenen wie Stammtischen, ethnischen Säuberungen, Selbstmordsekten, Rechtsradikalismus („Die Angst vor dem absolut Fremden ist nur die Kehr- Neuerscheinungen seite des heute geltenden Freiheitsbegriffs“; 75) und Drogenkonsum findet keine Vermittlung von Einzelnem und Allgemeinem statt. Und im Falle der NS- bzw. DDRVergangenheit oder der Nichtverantwortlichkeit des Einzelnen für das Kapital, das als rein Fremderzeugtes wahrgenommen wird, stellt Rotermundt erschreckt fest: „In beiden Fällen sind alle einzelnen vom Weltgeist abgekoppelt.“ (71) Doch damit nicht genug. Nun wird auch im „Geist“ oder „Begriff“ einer Zeit die unmittelbare Einheit von Sein und Bewußtsein postuliert: das Denken stellt „eine besondere Weise des Handelns und dieses eine besondere Weise des Denkens“ (78) dar. So wird denn Marx erst einmal eine „(kantianische) Getrenntheit von Denken und Sein“ (84) attestiert: „Marx unterstellt ... eine Trennung von Wirklichkeit und ordnendem Geist, von Weltmaterial und Weltgeist „ (83). Gleichzeitig aber sei bei Marx, dem alten Hegelianer, sozusagen hinter seinem Rücken, im „Kapital“ die „Einheit von Denken und Sein zugrundegelegt.“ (84) Als Indiz hierfür fungiert der Tatbestand, daß Marx „den Hegelschen Gedanken der List der Vernunft, welcher schließlich die Einheit von Denken und Sein voraussetzt (!), ... vehement und an entscheidender Stelle“ (84) vertritt. Beim Zusam- 115 menhang von abnehmender notwendiger Arbeitszeit und Überproduktion gelangt Rotermundt zu dem findigen Schluß, daß „Arbeit“ „immer noch ... substantiell als Reichtum aufgefaßt“ wird und „freie Zeit“ „nicht als das auftreten kann, was sie ist.“ Doch immerhin bestehe „das besondere und neue Moment der gegenwärtigen Krise“ darin, daß sie „zum erstenmal nicht als eine Überproduktion von Waren erscheint, sondern als das, was sie ist: Überproduktion von freier Zeit.“ (109) Zwar klingt in Rotermundts Plädoyer mancherorts der Bewegungscharakter der Hegelschen Begrifflichkeiten, wie Vernunft, Geist, Freiheit oder Begriff, an; für den Rezensenten ergibt sich jedoch, besonders nach der Lektüre des zweiten Teils, daß diese in ihrer Prozeßhaftigkeit nicht verstanden worden sind. Denn das gesellschaftlich Allgemeine konstituiert zwar das individuelle Bewußtsein, und die widersprüchliche Summe der menschlichen Tätigkeiten bildet dies Allgemeine; aber dieses ist nicht fähig, den Bestand des Besonderen zu garantieren. Wäre die Einheit von Denken und Sein bei Hegel (geschweige denn in der Realität) ein in sich ruhender Pol, müßte weder die Vernunft „listig“ sein, noch müßten die welthistorischen Persönlichkeiten dauernd von der 116 Neuerscheinungen Weltbühne abdanken. Im Prozeß der Selbstexplikation der absoluten Idee stellt sich die Einheit von Wirklichkeit und Begriff her, - aber zugleich so, daß sich in den allgemeinen Ablauf der Zufall, das Individuelle, das Subjektive, das Empirische, die Tatsache mischt. Es verwundert daher nicht, daß es Hegel in Fragen der Geschichte nicht bei der ‚Logik’ bewenden ließ, sondern über sie eigens Vorlesungen hielt: „Die Geschichte aber haben wir zu nehmen, wie sie ist; wir haben historisch, empirisch zu verfahren“ (Philosophie der Weltgeschichte). Davon ist Rotermundt weit entfernt: statt von der Empirie geht er von konstruierten Prinzipien aus, die aus nicht minder phantasiegesättigten Denkaxiomen abgeleitet werden. Andererseits bleibt Rotermundt ein „Hegeling“: das Bewußtsein wird als rein durchs Denken erzeugt verstanden, und da alles Handeln durchs Denken vermittelt ist, scheint auch dieses in letzter Instanz im Denken begründet. Es schadet wenig, Hegel durch eine dialektisch-materialistischen Brille zu lesen; sie verhindert, im Morast idealistisch-konstruktivistischen Unsinns verlorenzugehen, wo assoziatives Denken fröhliche Urständ’ feiert. Rotermundt will gegen den Zeitgeist Front machen; er sitzt ihm aber selber auf. Denn für unsere Zeit wie für Rotermundt ist ein naiver Begriffsrealismus bezeichnend, der beständig Begriff und Gegenstand ineinssetzt. Der Begriff steht für sich: Geist ist Geist; die Metapher wird Realität: die List der Vernunft ist die List der Vernunft; und Denken mutiert zur kalauernden Tautologie. Bei Hegel ist die Reise des Begriffs die Selbstauswicklung der Idee mitsamt ihren Entwicklungsmomenten in ihrer Totalität; bei Rotermundt ist der Begriff die reine, nicht widersprüchliche Einheit: der Staat vermittelt das Individuum mit der Allgemeinheit, - ohne durch Klassengegensätze gezeichnet zu sein; das Bewußtsein verändert sich aus sich selbst; die Weimarer Republik ist die Arbeiterbewegung, die wiederum identisch ist mit dem Geist der II. Internationale; usw. Rotermundt ersetzt die Gegenstände wie ihre Geschichte durch platte Bewußtseinsakte und vergißt somit, was er dauernd im Mund führt: ihre Dialektik. Rotermundts „Plädoyer für eine Erneuerung der Geschichtsphilosophie“ macht auf schlagende Art offenbar, wo man endet, wenn hegelsche und marxsche Kategorien aus ihrem Gesamtzusammenhang herausgebrochen werden und man es unterläßt, ihre Entwicklung nachzuvollziehen: weder beim Weltgeist noch beim Kapital, sondern im Feuilleton der Tageszeitung. Bewunderswert bleibt letztlich der Neuerscheinungen todesverachtende Wagemut des Verlages, dessen Programm mit Publikationen wie dieser schneller sinken dürfte wie die „Tirpitz“ nach der Torpedierung. Reinhard Jellen Nietzsche ausgewählt und vorgestellt von Rüdiger Safranski. München 1997 (Diederichs), Reihe „Philosophie Jetzt!“, Ln., 480 S., 48.- DM. Einerseits soll in Nietzsches Denken eingeführt werden, andererseits soll für Nietzsches Denken geworben, d.h. seine Kategorien als tauglich empfohlen werden, die Probleme des „Jetzt“ neu zu klären. Dem einen Anliegen ist die umfangreiche Auswahl der Texte gewidmet, die, in 14 Kapitel gegliedert, der Chronologie der Werke folgt und sie in ihren Kernaussagen vorführt. Von den frühen, autobiographischen und philologischen Arbeiten bis zu den nachgelassenen Aphorismen (auch Briefe, Selbstkritiken und Gedichte sind berücksichtigt) erscheint die Auswahl so als Abbreviatur des gesamten Œuvres. Dem anderen Anliegen wird in den beiden Vorworten von Peter Sloterdijk (für die gesamte Reihe) und Rüdiger Safranski (für den Nietzsche-Band spe- 117 ziell) Rechnung getragen, wobei das Anliegen der Aktualisierung dem Anliegen der bloßen Vermittlung natürlich den Stempel aufdrückt und die Auswahl der Texte mitbestimmt. Worin besteht also Nietzsches Tauglichkeit fürs „Jetzt“? Der Aspekt, unter dem er dem heutigen, „postmodernen“ Publikum interessant und schmackhaft gemacht werden soll, ist der der Bildung. Nietzsche wird als „Denker in der ersten Person“ präsentiert, d.h. als Denker, dem es vornehmlich um Selbstwahrnehmung und Selbstprüfung, um das Experiment mit dem eigenen Ich, um Selbstbehauptung und vor allem um Selbstgestaltung zu tun ist. Nur als ästhetisches Phänomen läßt sich das Dasein rechtfertigen, nur indem das Ich zum Kunstwerk gebildet und das eigene Leben als eine Art (unabgeschlossener) Bildungsroman begriffen wird, ist die Individualität vor seiner sozialen und ökonomischen Beschädigung zu retten. Modernität heißt Dynamisierung aller Lebensbereiche. Eine stabile Welt, an der sich die Individuen reiben, ihre Hörner ablaufen, mit der sie sich schließlich versöhnen können, gibt es nicht mehr. Bildung kann deshalb zu keinem Abschluß mehr kommen. Sie wird zum livelong-learning, zur ständigen, chamäleonhaften Anpassung an veränder- 118 Neuerscheinungen te Lebensbedingungen, verbunden mit der fortgesetzten Anstrengung, das patchwork und „Dividuierte“ aufs Neue zu vereinigen. Unter diesen Bedingungen soll Nietzsche nun die frohe Botschaft bringen: die Rettung des Selbst (im Wechsel der Masken) als ästhetischer Existenz. Suggeriert wird, der Wille zur Macht sei vor allem darauf gerichtet, Macht über sich selbst zu gewinnen, so wie ein Künstler im Schaffensprozeß Macht über seinen Stoff gewinnt. Suggeriert wird weiterhin, die Forderung, sich zum Übermenschen zu erheben, sei mit der Forderung identisch, seinen „Halbfabrikats“Zustand aus Elternhaus und Schule zu überschreiten, sich als IchKunstwerk zu vollenden und damit, sich zum „globalwelttauglichen Individuum“ zu erheben. Die Konzentration auf den Begriff der (Selbst-)Bildung läßt die Frage aufkommen, warum ausgerechnet die fünf Basler Vorträge „über die Zukunft unserer Bildungsanstalten“ nicht mit in die Auswahl aufgenommen sind, die sich doch explizit dem Thema widmen. Erstaunlich allerdings ist diese Auslassung nicht, zumal sich die Vorstellungen, die Nietzsche hier entwickelt, doch wesentlich von denjenigen unterscheiden, die Sloterdijk und Safranski ihm unterstellen. In erster Linie ist da nämlich (am Ende des fünften Vortrags) von Gehorsam, Dienst- barkeit und Unterordnung, von Gefolgschaft und Führertum die Rede. Kurz nach dem militärischen Sieg Deutschlands im Frühjahr 1872 geäußert, ist Nietzsches Bildungsbegriff von der Furcht inspiriert, der „Geist“ des besiegten Frankreichs, d.h. die Ideen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die gerade in der Pariser Commune wieder aufgeflackert sind, könnten auf Deutschland übergreifen. Dabei sieht Nietzsche die Vorgänge von 1870/71 in geschichtlicher Parallele zu den Perserkriegen des Altertums, die ihm keineswegs (wie etwa dem liberalen Hegel) als Geburtsstunde Europas gelten, sondern als Beginn des Niedergangs. Der militärisch besiegte Orient (so Nietzsche) hat geistig den Sieg davongetragen, nämlich mit der Ausbreitung der jüdisch-christlichen Religion, die die Herrschaft des Sklaven und Herdenmenschen eingeläutet hat. Was also im Kriege gewonnen, das wurde im Frieden wieder verspielt. Gerade infolge des Sieges und der sich daran anschließenden Erschlaffung also konnten die griechische Kultur und Bildung ihr Letztes und Höchstes nicht erreichen. Dem gilt es nun vorzubeugen. Nietzsches Bildungsprogramm ist gegen die Wiederholung einer solchen „Fehlentwicklung“ gerichtet. Und deshalb ist es ihm auch vorrangig nicht um Selbsterfahrung, Neuerscheinungen Auslotung des eigenen Ichs oder um die Integration des Individuums zu tun, sondern um die Fortsetzung des Krieges (als Konkurrenz und Daseinskampf), um die Herstellung einer natürlichen Rangordnung und die praktische Entscheidung darüber, wer Herr und wer Sklave ist. Denn das Sklaventum ist unaufhebbar und die Voraussetzung jeder höheren Bildung und Kultur - so steht es in der (ebenfalls nicht in die Auswahl mit aufgenommenen) Schrift „Der griechische Staat“, in der Nietzsche seinen Nazi-Adepten auf halbem Wege entgegengekommen ist. Safranski verschweigt die Abgründe der Nietzscheschen Philosophie nicht. Offenbar glaubt er aber, mit der Benennung und Kritik der „bösen“ Seiten sei es getan, so daß die „gute“ Seite dann, die ästhetische Selbstinszenierung und Rettung der Individualität, davon abgesondert und als Anregung und Orientierung empfohlen werden könne. Seine Interpretation schielt auf ein Publikum, das die Philosophie als Spaß entdeckt hat und nun, mit Nietzsche, zu der Überzeugung gelangen möchte, es ehre die Menschheit vor allem dadurch, daß es sich selbst zur Persönlichkeit ausbilde. Es soll nun auch philosophisch beglaubigt sein, daß es sich wieder lohnt, man selbst zu sein! 119 Safranski versäumt es nicht, Nietzsche als einen Denker zu kritisieren, der außerhalb des „demokratischen Grundkonsenses“ steht. Wenn er (wie auch Sloterdijk) trotzdem das Nietzschesche (Selbst-) Bildungsprogramm empfiehlt, dann wäre wohl doch zu klären, wie eine Demokratie undemokratisch-gebildeter Individuen aussehen könnte. Konrad Lotter John R. Searle Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer Tatsachen, Reinbek bei Hamburg 1997 (rowohlts enzyklopädie), kart., 249 S., 24.90 DM. Hatte Searle in seinen früheren Arbeiten zur Theorie der Sprechakte versucht, die Frage zu beantworten: „Wie kommen wir von der Physik der Äußerungen zu sinnvollen Sprechakten, die von Sprechern und Autoren geäußert werden?“, so galt sein 1993 erschienenes Buch „Die Wiederentdeckung des Geistes“ der Frage: „Wie paßt eine geistige Wirklichkeit, eine Welt des Bewußtseins, der Intentionalität und anderer geistiger Phänomene in eine Welt, die vollkommen aus physischen Teilchen in Kraftfeldern besteht?“ Im neuesten Buch unter- 120 Neuerscheinungen sucht Searle wiederum das Verhältnis von physikalischer und geistiger Welt und „dehnt diese Untersuchung auf die gesellschaftliche Wirklichkeit aus“. Die Frage, die er umkreist, lautet: „Wie kann es eine objektive Welt“, eine Welt der sozialen Tatsachen, „des Geldes, des Eigentums und der Ehe, von Regierungen, Wahlen, Footballspielen, Cocktailparties und Gerichtshöfen geben in einer Welt, die gänzlich aus physischen Teilchen in Kraftfeldern besteht und in der einige dieser Teilchen zu Systemen organisiert sind, die bewußte biologische Lebewesen sind wie wir selbst?“ Um diese Frage zu beantworten, baut Searle das Buch wie folgt auf: Von den insgesamt neun Kapiteln bilden die ersten fünf den Schwerpunkt der Arbeit. Sie befassen sich mit den genaueren Fragestellungen: „Wie kann es eine objektive Wirklichkeit geben, die zum Teil kraft menschlicher Übereinkunft existiert?“ und „welche Rolle spielt die Sprache bei der Konstitution derartiger Tatsachen?“, und entwerfen anschließend „eine allgemeine Theorie der Ontologie gesellschaftlicher Tatsachen und gesellschaftlicher Institutionen“. Das sechste Kapitel befaßt sich mit den „konstitutiven Regeln menschlicher Institutionen“ und der „verwirrenden Tatsache“, „daß sich die fraglichen Akteure normalerweise dieser Regeln nicht bewußt sind“, und versucht für dieses Problem ein theoretisches Werkzeug zu entwickeln. Die Kapitel 7-9 bilden zusammen den zweiten Teil des Buches. In ihm sichert Searle den erkenntnistheoretischen Unterbau seiner „allgemeiner Theorie der Ontologie gesellschaftlicher Tatsachen“ ab. Dabei knüpft er an das klassische Konzept des Realismus an, die Annahme einer bewußtseinsunabhängigen, objektiven äußeren Realität und die Möglichkeit wahrer Aussagen nach Maßgabe des aristotelischen Kriteriums der Übereinstimmung von Aussage und Sachverhalt. Die Kapitel gelten der Verteidigung „der Idee, daß es eine reale Welt gibt, die von unserem Denken und Sprechen unabhängig ist, sowie der Verteidigung der Korrespondenztheorie der Wahrheit, das heißt der Idee, daß unsere wahren Aussagen normalerweise durch die Art und Weise wahr gemacht werden, wie die Dinge in der wirklichen Welt sind, die unabhängig von den Aussagen existiert“ (8). Des weiteren ist Searle der Auffassung, „daß der Realismus und eine Korrespondenztheorie der Wahrheit wesentliche Voraussetzungen jeder vernünftigen Philosophie sind, von der Wissenschaft ganz zu schweigen“. Sie bildet auch die wesentliche Voraussetzung für die Sprechakttheorie Searles und seine „allgemei- Neuerscheinungen ne Theorie der Ontologie gesellschaftlicher Tatsachen“, die sich auf die Annahme einer bewußtseinsunabhängigen „objektiven gesellschaftlichen Wirklichkeit“ stützt. Ursprünglich nur als knappes Anfangskapitel konzipiert, sah Searle sich nach eigener Aussage zu einer ausführlicheren Darstellung durch die zwischenzeitlich einsetzende Konjunktur des philosophischen Konstruktivismus veranlaßt. Da dieser die gesamte Wirklichkeit zu einer Konstruktion des menschlichen Bewußtseins erklärt und also keine bewußtseinsunabhängige, objektive Außenwelt anerkennt, läuft er nicht nur der Alltagserfahrung zuwider, sondern bestreitet auch den theoretischen Unterbau der Theorien Searles. Damit dient Searles Buch - auf einer grundlegenden Ebene - sowohl der Absicherung der Fundamente seiner Sprachtheorien wie auch als Streitschrift gegen den Konstruktivismus und dessen Behauptung eines ausschließlichen Monismus des Bewußtseins. Für Searle bilden objektive Außenwelt und Bewußtsein ein einheitliches Kontinuum, allerdings eines, das die Organisationsformen der physikalischen Welt wie der geistigen Welt umfaßt. Gegenüber allen dualistischen Konzeptionen, die Bewußtsein und Materie als verschiedene Prinzipien voneinander 121 trennen, vertritt Searle die Position eines wissenschaftlichen Monismus. Bewußtsein wird demzufolge als eine besondere, höhere, nämlich komplexere Organisationsform der Materie beschrieben, ohne jedoch auf diese reduzierbar zu sein: „Genau wie geistige Zustände Eigenschaften höherer Stufen unseres Nervensystems sind und es infolgedessen keinen Gegensatz zwischen dem Geistigen und dem Physischen gibt, das Geistige einfach eine Menge von physischen Eigenschaften des Gehirns auf einer höheren Ebene der Beschreibung als der der Neuronen ist, so gibt es keinen Gegensatz zwischen Kultur und Biologie; Kultur ist die Form, welche die Biologie annimmt“ (235). Verbindungsglieder zwischen Kultur und Biologie sind „Bewußtsein und Intentionalität“: „Das besondere an der Kultur ist die Manifestation kollektiver Intentionalität und insbesondere die kollektive Zuweisung von Funktionen an Phänomene in Fällen, wo die Funktion nicht einzig dank der bloßen physischen Eigenschaften der Phänomene verrichtet werden kann“ (235). Während sich die klassische Korrespondenztheorie mit ihrer Unterscheidung ‚wahr – falsch‚ auf die Übereinstimmung von Aussage und physikalisch beschreibbarem Sachverhalt bezieht, bezieht Searles Sprechakttheorie die Intentionalität 122 Neuerscheinungen in die Theorie der Aussagen mit ein. Die Sprechakttheorie erklärt - womit sie über die klassische Korrespondenztheorie hinausgeht -, die Relation von Sprechakt und, nicht physikalisch beschreibbaren, sozialen Tatsachen und gesellschaftlichen Institutionen, die sich über der physischen Organisationsform einer Gesellschaft erheben. Diesen Institutionen schreibt Searle sowohl den Status eines Konstrukts als auch einer objektiven Wirklichkeit zu. Daher ist der Titel des Buches: „Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit“ durchaus mißverständlich; kennt man seinen Inhalt nicht, läßt sich der Titel auch im Sinne des Konstruktivismus verstehen. Die „gesellschaftliche Wirklichkeit“ wäre „Konstruktion“ im Sinne ihrer Unabhängigkeit von einer ontologisch gesicherten Einsichtsmöglichkeit in den Aufbau der physikalischen oder gesellschaftlichen Welt. Nach Searle jedoch ist die „gesellschaftliche Wirklichkeit“ Konstruktion, weil sie auf Übereinkunft und Bewußtsein beruht. Sie stellt eine Organisationsform höherer Ordnung dar, die sich über der physikalischen Welt erhebt und die, weil in ihr menschliche Zwecke ins Spiel kommen, relativ zu dieser ‚freier’ ist. Die Erkenntnis der objektiven physikalischen Welt wird von Searle also nicht nur als prinzipiell möglich eingeräumt, sondern sie ist für ihn auch die Bedingung der - hinsichtlich der physikalischen Gesetzmäßigkeiten - relativ freieren Gestaltungen und Übereinkünfte in der „gesellschaftlichen Wirklichkeit“. Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist also objektiv, weil sie der physikalischen Welt ‘aufliegt’, und zugleich Konstruktion, weil sie nach menschlichen Kriterien formiert ist. Nach dem von Searle selbst formulierten Anspruch soll sein neuestes Buch einen Beitrag zur „großen Erzählung“ leisten, die kontinuierlich von der physikalischen Welt zur Welt der gesellschaftlichen Tatsachen aufsteigt. Diese müssen wissenschaftlich und möglichst umfassend analysiert werden. Wenn Searle jedoch als Beispiele gesellschaftlicher Institutionen immer wieder die Institute des Geldes, der Ehe, der Gerichte usw. anführt, dann gibt er mit diesen konkreten Inhalten auch die Grenze seiner Theorie an. Denn eine Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die auch die besonderen Inhalte der Institutionen umfaßte, kann seine Sprachtheorie nicht leisten. Um die von ihm geforderte Kontinuität zu wahren, d.h. die unterschiedlichen Formen und Inhalte der gesellschaftlichen Institutionen in ihrem Vermittlungszusammenhang zu analysieren und auch zu kritisieren, benötigt man ein theoretisches Werkzeug, das nicht nur auf die Praxis der Sprache, die Neuerscheinungen Sprechakte, beschränkt ist, sondern das auch die außersprachliche Praxis der Arbeit (die aufgrund ihrer Arbeitsteiligkeit und Gesellschaftlichkeit auf sprachliche Vermittlung angewiesen ist) erfaßt. Wolfgang Thorwart Annegret Stopczyk Sophias Leib. Entfesselung der Weisheit Heidelberg 1998 (Carl-Auer-Systeme) 388 S., 49.80 DM. „Wenn es vor dreitausend Jahren möglich war, eine Vernunft zu erfinden, die eine solche Gestaltungskraft auf der Erde hatte, wie wir es erleben, mit all der Technik und den angenehmen und bedrohlichen Folgen, dann könnte doch jetzt ein neues Jahrtausend beginnen, in dem es darum geht, das Bisherige weiterzuentwickeln in Richtung Ja zu Leben und Leib.“ (219) Die Philosophin und Autorin Annegret Stopczyk denkt über die Möglichkeiten, die sich aus einer lebensbejahenden Leibphilosophie ergeben, nach und begibt sich „am Leitfaden des Leibes“ auf die Spuren einer europäischen Weisheitstradition. Ihre Philosophie ist, wie sie selbst schreibt, als ein „philosophischer Aufbruch“ zu verstehen. 123 Während so mancher ihrer Philosophen-Kollegen an deutschen und europäischen Akademien auf gut begehbaren Erkenntnispfaden oft auch fernab jeglicher Lebensrealität nach wahren Erkenntnissen sucht, begibt sich Stopczyk auf Erkenntniswege, die für unser Leben, unseren Alltag nutzbar sind. Sie geht „als pragmatische Agnostikerin davon aus, daß wir Menschen die Wirklichkeit höchstwahrscheinlich sowieso nicht ganz verstehen können. Wir sind wie Blinde, die an einem großen Elefantenkörper herumtasten und zu definieren versuchen, was ein Elefant ist. Der eine hat den Schwanz in der Hand und beschreibt etwas ganz anderes als diejenige, die ein Ohr begriffen hat. Sie können sich streiten, wie sie wollen, sie haben alle irgendwie recht, aber niemand hat insgesamt verstanden, was genau ein Elefant ist. Trotzdem sind die Details unserer Weltwahrnehmung nicht ganz falsch verstanden. Innerhalb eines bestimmten Rahmens beschreiben sie die Wirklichkeit, in der wir uns bewegen können, nur ob sie insgesamt so ist wie das Detail, das weiß ich nicht.“ (218). Unser Denken ist von der abendländischen Vernunfttradition bestimmt: Körper-Geist-Dualismus, Entweder-Oder-Logik, Denken in Begriffen und Rationalität sind nur einige Schlüsselbegriffe einer Phi- 124 Neuerscheinungen losophie, die eigentlich eher PhiloLogie genannt werden sollte. Denn wenn von Philosophie und noch dazu von akademischer Philosophie gesprochen wird, meinen wir eigentlich Freund (Philo) des Logos, der menschlichen Vernunft, des logischen Urteils oder des Begriffes. Für die Probleme des Lebens in unserer heutigen Zeit am Ende des 2. Jahrtausends bietet eine derartige Philo-Logie allein keine geeigneten Lösungen an. Annegret Stopczyk ist auf der Suche nach einem Ausgleich dieses vom Logos dominierten Denkens. Philosophie heißt „Freund der Weisheit“. Mit einer anderen Erkenntnis- und Wahrnehmungsart, nämlich über den Leibsinn, gewinnen wir neue Perspektiven und öffnen wir uns einer größeren Menge Informationen, die uns zu anderen Erkenntnisweisen über uns und unser Leben führen, als dies bisher möglich war. „Wir erkennen körperlich, leiblich, gedanklich in einer einzigen Sekunde viel mehr, als unser Sprachbewußtsein realisiert.“ (219) Eine leibphilosophische Sichtweise zu entwickeln, bedeute nicht, ein fertiges philosophisches System oder Konzept herzustellen. Philosophieren „am Leitfaden des Leibes“ gebe nur eine Richtung an. Was der Leibsinn eigentlich ist, kann nicht definiert werden. Es kann aber „eine ‚ungefähre’ Bedeutungsrichtung des Wortes ‚Leib’ erkennbar werden, ohne daß ich nach linearer naturwissenschaftlicher Methode genau definieren müßte, was damit gemeint ist.“ (49). Mit den Wahrnehmungsmöglichkeiten über den Leibsinn wird unsere rechte Gehirnhälfte, die für die räumliche Wahrnehmung und bildhafte Informationsverarbeitung verantwortlich ist, aktiver werden. Ein Ausgleich zur dominanten linken Gehirnhälfte, die für unsere Sprachleistungen und arithmetischen Leistungen relevant ist, könnte stattfinden. So schreibt Stopczyk „Ein ‚Leibsinn’ wäre so etwas wie ein ‚Transportunternehmen’ zwischen den verschiedenen Ebenen des Wahrnehmens und bewußten sprachlichen, bildlichen und verspürten Erkennens. Es wäre ein bewußt gewollter und lernbarer Sinn, der bikameral das Wissen aus den verschiedenen Erkenntnisregionen leichter koordinieren kann als unser kontrollierendes und ständig aussortierendes Sprachbewußtsein.“ (220). Mit diesem Buch wird der Grundstein für eine neue europäische Philosophie gelegt. Sicher gab es vor Annegret Stopczyk Philosophen, die sich von einer akademischen Begriffs-Philosophie abwandten, um eine lebensnähere Philosophie zu entwickeln. Die Autorin selbst setzt sich in einem Kapitel Neuerscheinungen mit dem Titel „Am Leitfaden des Leibes“ mit Philosophen auseinander, die ähnliche Absichten, wie sie verfolgten. Dem Leser werden interessante Einblicke in die Philosophie von Ludwig Feuerbach, Paracelsus, Friedrich Nietzsche und viele andere mehr gewährt. Annegret Stopczyk allerdings geht weiter als all die Philosophen vor ihr: Sie öffnet mit ihrem leibphilosophischen Ansatz ein großes und interessantes Gebiet für eine lebensnahe philosophische Forschung von 125 gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Dimension. Vor allem dürfte ihr Denken für alle diejenigen richtungsweisend sein, die weder in einer feministischen Nische noch angepaßt an akademische Denknormen philosophieren und forschen wollen. Dieses Buch hat das Potential eines philosophischen Bestsellers - bleibt zu hoffen, daß es zur rechten Zeit erschienen ist. Gesina Stärz Bericht Trüffel, Schweine und Brainscanning „Die Wirklichkeit des Konstruktivismus II“ Vom 30.4. bis 3.5. fand in Heidelberg der internationale Kongress „Weisen der Welterzeugung - Die Wirklichkeit des Konstruktivismus II“ statt. Während auf dem Kongress von 1992 - „Weisen der Welterzeugung I“ - neurobiologische Überlegungen dominierten, sind mittlerweile Konstruktivisten mit Personen anderer Disziplinen ernsthaft ins Gespräch gekommen: Wissenschaftler und Praktiker aus verschiedenen Fachbereichen wie Philosophie, Nationalökonomie, Psychiatrie, Psychologie, Management, Wirtschaftsorganisation, Pädagogik, Neurobiologie, Geschichte, Theologie, Medien und Kommunikation diskutierten die Konsequenzen konstruktivistischer Ansätze für die Praxis. Die Konsequenzen konstruktivistischer Ansätze für die Philosophie und andere, eher vom Denken als vom Handeln und empirischer Forschung dominierte Wissenschaftszweige wurden eher zögerlich verhandelt. Dabei würden Fragen wie: „Wann kommt man nicht umhin, konstruktivistische Positionen einzunehmen?“ eher eine konstruktive Möglichkeit eröffnen als ein gefährliches Para- digma darstellen, so Siegfried J. Schmidt (Professor in Münster) in seinem Einleitungsworkshop zum Thema „Konstruktivismus und Philosophie“. Leider reiste der 92jährige amerikanische Philosoph Nelson Goodman, nach dessen Buch „Ways of Worldmaking“ (1978) der Kongress benannt wurde, nicht an. Chancen und Risiken konstruktivistischer Positionen Wer unter konstruktivistischen Prämissen denkt und arbeitet, geht davon aus, daß es viele verschiedene Welten gibt, die von uns Menschen erzeugt werden. Wir ben in mehreren Welten sowohl gleichzeitig als auch im Laufe unseres Lebens. Wir konstruieren uns Wirklichkeiten nach unserer inneren Landkarte. Wie Wolf Singer (Professor in Frankfurt) in seinem Vortrag „Hirn und Kognition“ ausführte, werden die Gehirnzellen nur zu 10 % von unseren Sinnesorganen aktiviert, zu 90% beschäftigt sich das System mit sich selbst. In die Produktion oder Konstruktion von Wirklichkeit fließen unsere Erfahrungen, unser Wissen, Bericht unsere kulturellen Lebensgewohnheiten und Vieles mehr ein. Derjenige, der eine realistische Position einnimmt, geht davon aus, daß es eine wohlstrukturierte Welt, die unabhängig von unseren Beschreibungen existiert, gibt. Wer eine solche Position einnimmt, begibt sich auf eine sichere Seite. Er weiß, was wahr und falsch, richtig und gut ist. Für manche Lebenssituationen und Tätigkeiten mag dies sehr hilfreich sein. So erklärte ein Kongressreferent, daß er es vorziehe, mit einem Piloten zu fliegen, der ein realistisches Weltbild habe. Ein solches Weltbild bietet Sicherheit, solange man seine Wahrheitssetzungen akzeptiert und diese nützlich sind. Ein jedes Weltbild zu seiner Zeit. Aber auch diese Aussage wäre bei Anhängern eines einzigen realistischen Weltbildes umstritten. Sicherheit bieten die Bilder, die sich Konstruktivisten von der Welt machen, nicht. Zumindest scheint dies so zu sein, setzt man sich ausschließlich auf einer theoretischen Ebene mit dem Konstruktivismus auseinander, wie viele Einwände und Diskussionsbeiträge zeigten. Besonders bei ethischen Fragen ist es für uns Menschen doch beruhigender und vielleicht auch bequemer zu wissen, was gut und böse, richtig und falsch ist. Der Praktiker hingegen handelt das, was wahr oder falsch, gut oder böse sein soll, - insofern dies 127 - insofern dies notwendig ist - einfach immer wieder aufs Neue aus. Risiko bedeute das Wagnis des Handelns vor dem Hintergrund freier Handlungsmöglichkeiten, so Arnold Retzer (Privatdozent in Heidelberg) in einer Sektion zum Thema „Risiko-Therapie“; Gefahren hingegen seien unabhängig vom handelnden Subjekt. Ein Geisterfahrer fahre riskant, sei aber für andere eine Gefahr. Ob etwas riskant oder gefährlich sei, hänge von der Perspektive des Beobachters ab. Der Bogen in diesem Seminar wurde weiter gespannt: Menschen leben in Risikosystemen. Man könne keine sicheren Prognosen, was die Zukunft anbetrifft, stellen. Allerdings sei diese Unsicherheit ein wichtiger Faktor der Entwicklung. Für unser Erleben in einer Familie, einer Organisation oder in anderen Systemen erweise sich der Glaube, man könne alle Dinge berechnen, als unbrauchbar. In lebenden Systemen gehe es pragmatisch zu. Auf bekannt aktuelle, politische und gesellschaftliche Risiken verwies Helm Stierlin (Professor in Heidelberg) während eines Plenarvortrages zum Thema „Pluralismus und Wirklichkeitskonstruktionen“. Im Zuge der Vernetzung verschiedener kultureller Wirklichkeiten entstehe eine zunehmende Verunsicherung unter den Menschen, die wohl auch in den aktuellen Ergebnissen der 128 Bericht Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt zum Ausdruck komme. Er verglich die heutige Situation mit der Zeit der Weimarer Republik. Allerdings seien in unserer Zeit - nicht zuletzt durch die Entwicklung der Telekommunikation, durch die Menschen die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Welten vertraut zu werden - große Chancen für das Verständnis von Demokratie gegeben, wenn man sie beispielsweise im Bildungsbereich nutzt. Mulitmediale Performances, „Zur normalen und verrückten Konstruktion der Logik“ und zum Unterhaltungswert des Kongresses Mit Ergebnissen aus Bereichen wie Gehirnforschung, Neurophysiologie und Biologie (Humberto Maturana) wurde einst das Fundament für konstruktivistisches Denken gelegt. Vorträge und Beiträge aus diesen Fachrichtungen auf dem Kongress wurden allerdings des Realismus verdächtigt. Ob über Gehirnwelten im üblichen Vortragsstil referiert wurde oder eingescannte Gehirne in multimedialen Performances beobachtet werden konnten, - fraglich blieb dabei, ob die Forschungsergebnisse Konstrukte einer allgemeingültigen, von uns unabhängig existierenden Realität oder nur Möglichkeiten, Gehirnwelten zu rekonstruieren, sind. Dieses nicht näher bestimmbare Unbehagen wurde aus der Perspektive der Logik auf den Punkt gebracht: Während Hans R. Fischer seinen Vortrag zum Thema „Logik und Wirklichkeit. Zu einem konstruktivistischen Verständnis der Logik“ mit den Worten „Menschen denken nicht logisch, warum sollten es Verrückte tun.“ beendete, begann Matthias Varga von Kibed (Professor in München) anschließend seinen Vortrag mit dem Hinweis, daß es doch recht paradox sei, mit der aristotelischen Logik erklären zu wollen, daß die aristotelische Logik nicht funktioniere. Mit seinem Beitrag zum Thema „Paradoxien des Systemischen und Systeme des Paradoxen“ stiftete er reichlich Verwirrung: Mit dem Anspruch an Neutralität gegenüber konstruierten Welten seien auch Paradoxien verbunden. Nehme man nur den Begriff der Allparteilichkeit, der ein paradoxer Begriff sei, dann möge es einem so ergehen wie dem Rabbi, der erst der einen Partei recht gibt, dann der anderen und zuletzt seiner Frau, die ihn auf diese paradoxe Situation aufmerksam macht. Es gehe nicht darum eine allgemeine Paradoxientheorie zu haben - denn dann hätten wir den Konstruktivismus aufgegeben - so Matthias Varga von Kibed weiter, sondern es gehe darum, daß Paradoxien den Rahmen öffnen und eine Entwicklung Bericht von einer Theorienvielfalt zulassen. Dieser Beitrag sorgte nicht nur für allgemeine Erleichterung, da sich inzwischen der Eindruck breit gemacht hatte, so mancher bekennende radikale Konstruktivist propagiere den Konstruktivismus als absolute Wahrheit, sondern hatte auch einen enormen Unterhaltungswert, der den sonstigen (nicht in allen), eher philosophisch orientierten Vorträgen, Seminaren und Workshops fehlte. Philosophische Beiträge waren schwer verständlich und schnell verlor so mancher Hörer das Interesse: Wer anfangs eifrig mitschrieb, legte nach spätestens zehn Minuten seinen Stift beiseite; immer mehr Leute verließen im Laufe derartiger Beiträge den Saal, andere schliefen ein und wieder andere schauten sich um, um zu sehen, was die anderen machen... „Konstruktionen zum Tag“ hieß das Podium, daß diejenigen, die „auch noch was zu sagen gehabt hätten“, für kurze Statements nut- 129 zen konnten. Teilnehmer mußten resigniert feststellen, daß die Lust auf Trüffel nicht befriedigt werden konnte, da es zu wenig Schweine unter den Veranstaltern gab und die Wirklichkeitsannahmen der Mitarbeiter im Kongressbüro nicht mit der Wirklichkeit der Kongressteilnehmer übereinstimmten: Eine Sekretärin antwortete auf Anfrage einer Teilnehmerin, warum es nicht die Möglichkeit der Simultanübersetzung gebe, sie sei davon ausgegangen, daß hier auf dem Kongress nur Abiturienten anwesend wären. Eine Schlußbemerkung: Es gibt viele Gefahren und Risiken im Leben, nicht nur dann, wenn wir über die Straße gehen, mit dem Flugzeug fliegen, Kinder gebären, auf dem freien Markt freiberuflich arbeiten und unseren Lebensunterhalt verdienen; auch Denken in Philosophierstuben kann für so manchen gefährlich und für andere wiederum eher riskant sein. Gesina Stärz 130 Bericht Bericht To enlarge the audience Richard Rorty in München Auf Einladung seines Kontrahenten Jürgen Habermas nutzte der Philosoph aus Amerika seinen Deutschland-Aufenthalt, um auch in der Münchner Universität gegen die alten Aufklärer vom Schlage seines Gastgebers zu Felde zu ziehen. In seinem Vortrag unter dem Titel „Pragmatism as anti-authoritanism“ wiederholte Richard Rorty einmal mehr seine Kritik an den Priestern der Vernunft, seien sie Metaphysiker, Erkenntnistheoretiker oder Dis-kursethiker. Es gelingt uns eben nicht, die „Wahrheit“ einzufangen, und sei der Diskurs auch noch so ideal, weil wir nicht wissen können, ob wir ihr denn nun näher oder ferner sind. Da lobt Rorty sich denn doch seinen Dewey, der eben nicht, wie er ausführte, nach der Wahrheit strebte, sondern wollte, daß die Menschen glücklicher seien und ein erfüllteres Leben haben. Und so macht denn Rorty den Amerikaner Dewey zum Gewährsmann und Protagonisten der Aufklärung, die das alte Europa so sträflich verraten habe. Waren diese Philosophen es doch, wie Descartes, Locke und Kant, die den Kampf um die Mün- digkeit und Selbständigkeit des Menschen zwar begonnen haben, die ihn aber zugleich in das neue, autoritäre und inhumane Korsett einer – wie auch immer ausgelegten – Vernunft gesteckt haben. Und so will denn der Pragmatist Rorty, gestützt auf Dewey, uns nicht mehr mit der Autorität vermeintlich ewiger Prinzipien aufklären, sondern mit Argumenten und Meinungen, von denen der Sprecher überzeugt ist, daß sie uns praktisch weiterhelfen. Um überzeugt zu sein, daß auch Frauen in der Kirche reden sollen, daß Juden dieselben Rechte zustehen, oder daß die Schwarzen in Amerika wirtschaftlich und sozial besser zu stellen sind, für solche Überzeugungen, sagt Rorty, braucht man nicht die Autorität philosophischer Prinzipien; es genügt, so meint man herauszuhören, der Geist der amerikanischen Verfassung. Für eine solche „moral and democratic society“ die Zuhörerund Gefolgschaft zu gewinnen, sei die Aufgabe der Philosophie; nicht aber, ständig die Brille zu putzen, um vielleicht doch „die Wahrheit“ noch zu erblicken. Auf die bedenkliche Frage Habermas‚, warum man denn überhaupt überzeugen wolle, und wie das Überzeugen anderer funktionieren solle, antwortet Rorty: „Look at our culture, not our principles.“ Man überzeuge nicht mit der Autorität von Prinzipien, sondern durch das praktische Vorbild und die Lösungskompetenz in gemeinsamen Fragen. Und Ulrich Beck, der Organisator der Veranstaltung, stimmt Rorty zwar zu, daß die Berufung auf die „Ewigkeit“ perdu sei, daß aber gerade deshalb das Problem sich stellt, wie die Differenz zwischen der demokratischen Ordnung und anderen, etwa faschistischen, gerechtfertigt werden kann. So läßt sich Rorty letztlich doch noch herbei, ein Kriterium, ein principle (?), zu nennen: zwar lasse die moral and democratic society sich nicht dadurch rechtfertigen, daß mein „Gott“ der wahrere sei als der deine, aber doch mit dem Argument, daß meine Gesellschaft „reifer“ (more mature) sei als deine, und wir politisch fortgeschrittener seien als ihr. Und so endete denn Rortys Auftritt in München mit seinem Zeugnis der Reife. Leider ließ er offen, ob wir dies Kriterium der „Reifung“ linear oder dialektisch verstehen sollen. Werden „wir Demokraten“ immer reifer oder, wie alles, was reift, allmählich überreif? Alexander v. Pechmann Bericht Philosoph kämpft um seine Wiederanstellung Eine deutsche Geschichte. Es war einmal eine Zeit in der Bundesrepublik Deutschland, als es der Staat einem Philosophen verbot, seinen Beruf auszuüben. Es war die dunkle Zeit der „Berufsverbote“. Damals, 1975, verwehrte das Land Hessen dem Philosophen WolfDieter Gudopp-v. Behm, seine feste Anstellung an der Universität Marburg anzutreten. Er war, so meinten die, die unsere Verfassung „schützten“, zwar nicht des Teufels, aber genauso schlimm: „Marxist!“. Heute kämpft Gudopp-v. Behm vor Gericht um seine Rehabilitierung, nachdem. 1995 hatte eine Lehrerin vor dem Europäischen Gerichtshof ihre Wiedereinstellung erstritten hat. Ihr Berufsverbot, so die Richter, stehe im Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Während das Land Hessen, als die beklagte Partei, in der Vorverhandlung des Prozesses argumentierte, daß es für Gudopp-v. Behm keine Stelle gebe, ist der wahre Grund der Ablehnung des Landes vermutlich, daß die Justizminister der Länder sich nach jenem Urteil von 1995 darauf geeinigt haben, keinen Prä- zedenzfall für die Opfer des Berufsverbotes zu schaffen. Sowohl die Höhe der materiellen Entschädigungen als auch der moralische Gesichtsverlust des Staates wäre enorm. Hingegen zeigt der Richter des hessischen Arbeitsgerichts nicht nur „volles Verständnis“ für die Klage, sondern bezeichnet die Berufsverbotspraxis der 70er Jahre als ein „dunkles Kapitel unserer Geschichte“. Allerdings sei die „Gesetzeslage“ äußerst kompliziert: der Konvention der Europäischen Menschenrechtskommission stehen noch immer Gesetze und Verordnungen entgegen, die eben dier dunklen Zeit entstammen, über die jetzt geurteilt werden soll. Gudopp-v. Behm selbst ist nicht sehr optimistisch Er vermutet, daß im günstigen Fall das Land Hessen den Instanzenweg bis zum obersten Gericht gehen wird. Kein heute Lebender würde das abschließende Urteil erleben. P.S.: Trotz mitfühlenden Richters hat das Gericht die Klage auf Wiedereinstellung abgewiesen. Berichtigung Im letzten Heft, Nr.31: „Globalisierung“, ist uns auf Seite 184 ein böser Fehler unterlaufen. Die Autorin des Nachrufs auf den nigerianischen Philosophen Peter O. Bodunrin „Die Universalität der Philosophie“ ist nicht, wie angezeigt, Ronnie Peplow, sondern die Leipziger Philosophin Anke Graneß. Wir bitten insbesondere die Autorin, unseren Irrtum zu entschuldigen. AutorInnen JADWIGA ADAMIAK, Journalistin, München OLIVER VON CRIEGERN, Student der Philosophie, München MATTHIAS GROLL, Publizist (Themenschwerpunkt Neue Medien), Berlin REINHARD JELLEN, Student der Philosophie, München GEORGIOS KARAGEORGOUDIS, Jurist, wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Philosophie in München (Lehrstuhl I) ALEXANDER VON PECHMANN, Dr.phil., Lehrbeauftragter der VHS München MARÍA ISABEL PEÑA AGUADO, Dr.phil., Institut für Philosophie der Uni Leipzig URSULA REITEMEYER, Prof., Dr. phil., Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universität Münster MARTIN SCHRAVEN, Dr.phil. habil., Privatdozent für Philosophie, Universität Bremen, SchellingForschungsstelle, Ebersberg IGNAZ KNIPS, Lehrbeauftragter der Uni Köln, Abt. Internationale Beziehungen, Köln CLEMENS K. STEPINA, Dr.phil., Lehrbeauftragter am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Wien MANUEL KNOLL, M.A., Doktorand der politischen Wissenschaften, München GESINA STÄRZ, M.A., Marketing und Text-Agentur, Miesbach und München KONRAD LOTTER, Dr.phil., Lehrbauftragter am Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft der Uni München WOLFGANG THOWART, M.A., Doktorand der Germanistik, München JONAS DÖRGE WEIDEMANN, M.A., Doktorand der Politologie, Kassel Impressum Widerspruch Münchner Zeitschrift für Philosophie 18. Jahrgang (1998) Herausgeber Münchner Gesellschaft für dialektische Philosophie, Tengstr. 14, 80798 München Redaktion Jadwiga Adamiak, Oliver v. Criegern, Wolfgang Habermeyer, Manuel Knoll, Wolfgang Melchior (Internet), Konrad Lotter (verantw.), Alexander v. Pechmann, Martin Schraven, Elmar Treptow, Sibylle Weicker Verlag Widerspruch Verlag, Tengstr. 14, 80798 München. Tel & Fax: (089) 2 72 04 37 Erscheinungsweise halbjährlich / 1000 Exemplare Einband: Ute Ringwald, Frankfurt Satz: Oliver v. Criegern Druck: Drucken & Binden, Schellingstr. 23, 80799 München ISSN 0722-8104 Preis Einzelheft: 12.- DM Abonnement: 11.- DM (zzgl. Versand) Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.- Für unaufgeforderte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. – Nachdruck von Beiträgen aus Widerspruch ist nur nach Rücksprache und mit Genehmigung der Redaktion möglich.