Unser geheimnisvolles Ich • Band 1 Die Welt im
Werbung
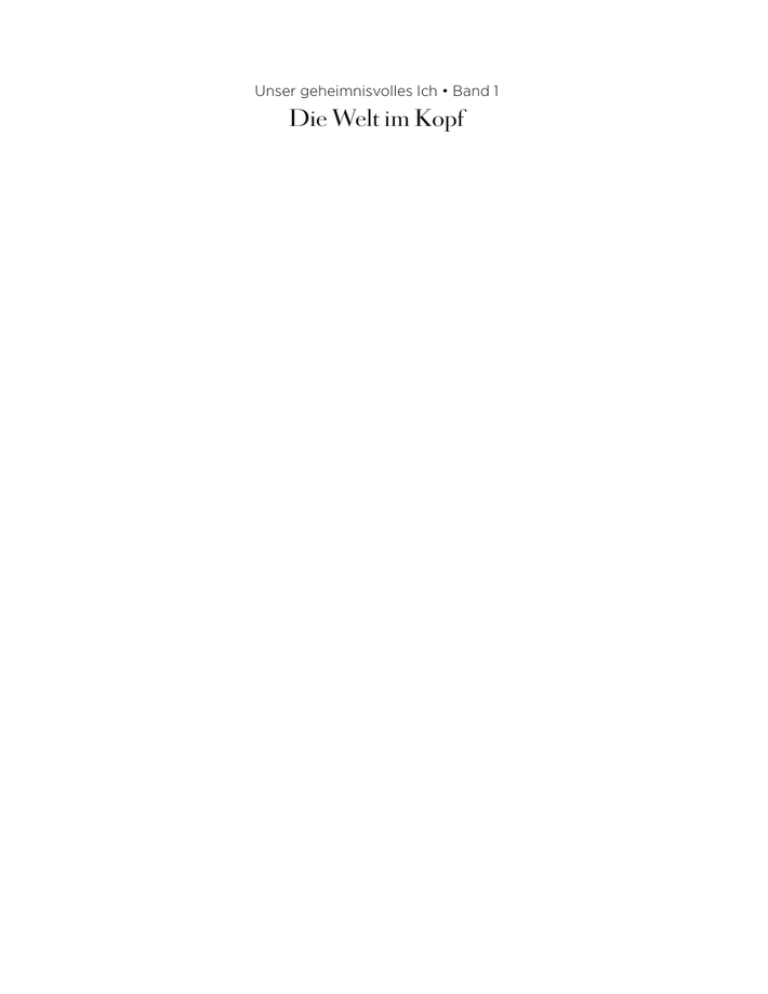
Unser geheimnisvolles Ich • Band 1 Die Welt im Kopf Unser geheimnisvolles Ich Die Welt im Kopf Was unser Gehirn kann Band 1 Herausgegeben von Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG und Springer Verlag GmbH Berlin Heidelberg Herausgeber Andreas Sentker, DIE ZEIT VERLAG Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG Pressehaus, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg Springer Verlag GmbH Berlin Heidelberg Tiergartenstraße 17, 69121 Heidelberg Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2015 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG und Springer Verlag GmbH Berlin Heidelberg. Springer Verlag GmbH Berlin Heidelberg ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Dieser Band ist ein Teil des dreibändigen Gesamtwerks »Unser geheimnisvolles Ich« (ISBN 978-3-662-46973-6) Projektleitung Sabine M. Müller Lektorat Andreas Sentker, Sabine M. Müller Lektorat Springer Spektrum Frank Wigger Einbandgestaltung und Layout Ingrid Wernitz Layout Simone Detlefsen Herstellung Torsten Bastian (verantw.), Dirk Woschei Druck und Bindung Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh Printed in Germany Die Texte der in diesem Werk verwendeten »Stichworte« sind den folgenden Bänden der bei Springer Spektrum erscheinenden Reihe »50 Schlüsselideen« (englische Originalausgabe bei Quercus, UK) entnommen: Adrian Furnham, 50 Schlüsselideen Psychologie (ISBN 978-3-8274-2378-8), Moheb Costandi, 50 Schlüsselideen Hirnforschung (978-3-662-44190-9), Richard Watson, 50 Schlüsselideen der Zukunft (978-3-642-40743-7), Ben Dupré, 50 Schlüsselideen Philosophie (978-3-8274-2394-8), Peter Stanford, 50 Schlüsselideen Religion (9783-8274-2638-3), Mark Henderson, 50 Schlüsselideen Genetik (978-3-8274-2380-1), Edmund Conway, 50 Schlüsselideen Wirtschaftswissenschaft (978-3-8274-2634-5). Vorwort Impressum Sie sind in die tiefsten Ozeangräben hinabgetaucht und haben die höchsten Berge bezwungen. Forscher haben Urwälder erobert und Wüsten durchquert. Sie haben Atome gespalten. Sie haben die Welt mit immer größeren Maschinen in immer kleinere Bausteine zerlegt. Sie haben das Erbgut des Menschen entziffert und können heute mühelos in unseren Genomen lesen – auch wenn sie noch nicht jeden Teil der Lektüre verstehen. Das vielleicht letzte große Rätsel der Wissenschaft ist das Phänomen, das wir »Ich« nennen. Über Jahrhunderte war die Frage nach diesem Ich das exklusive Terrain für philosophische Gedankengänge. Heute streiten sich Hirnforscher mit Programmierern, Psychologen mit Neuroanatomen, Physiker mit Medizinern über die Frage, was unser Bewusstsein ausmacht. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von »Bewusstsein« sprechen? Wie entsteht es? Und kann man es überhaupt erforschen? Schließlich ist das Ich naturgemäß höchst subjektiv. Aber auch höchst bedeutsam. Darum mischt bei der Ich-Suche längst die große Politik mit. US-Präsident George W. Bush hatte schon 1990 eine »decade of the brain« ausgerufen und Milliarden Dollar in die Forschung gesteckt. Die amerikanisch zweckoptimistische Hoffnung, zur Jahrtausend- Vorwort 5 wende seien alle Fragen zur Entstehung des Bewusstseins beantwortet, hat sich nicht erfüllt. Für die Forscher ein Glück: Sie haben noch genug Arbeit vor sich. Und sie planen dabei in immer größeren Dimensionen: Die EU will mit einer Milliarde Euro ein Gehirn im Computer nachbauen lassen – ein höchst umstrittenes Simulationsprojekt mit offenem Ausgang. heimer und andere Demenzerkrankungen. Doch gerade sie zeigen: Bewusstseinsforschung ist nicht nur ein intellektuelles Abenteuer, sie ist keine Spielwiese der Wissenschaft. Ihre Ergebnisse prägen unser Bild von unserem Ich und ihre Einsichten künftig vielleicht auch unseren Alltag, mit neuen Ansätzen im Kampf gegen Sucht und Depression zum Beispiel. Bewusstseinsforschung ist ein großes Abenteuer – und ein prestigeträchtiges dazu. Denn noch ist die Frage völlig offen, ob sich das Rätsel des Geistes jemals lösen lassen wird. Können wir mit der Arbeit unseres Gehirns unser Gehirn erklären? Viele Forscher haben eine eigene Theorie dazu – und manche glauben nicht, dass die Wissenschaft je eine Lösung finden wird. Neben wichtigen praktischen Antworten aber liefert moderne Hirnforschung vor allem eines – eine neue Herangehensweise an die ganz großen Fragen: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Bei ihrer Suche aber haben die Forscher Faszinierendes über unser Gehirn herausgefunden. Seine Leistung übertrifft die eines jeden Computers. Seine Architektur ist in Jahrmillionen der Evolution zu ungeheurer Komplexität herangewachsen. Dabei ist es unfassbar anpassungsfähig geblieben. Es verändert sich mit jedem Gedanken. Und bleibt sich dabei doch erstaunlich treu. Es ist aber auch ein verletzliches Organ – jedes Jahr durchlebt ein Drittel der Menschen ein psychisch bedingtes Leiden. Auf der Suche nach geeigneten Therapien wie bei der Erforschung der Grenzzustände unseres Geistes lernen die Wissenschaftler oft Überraschendes über die Funktionsweise des Zentralorgans in unserem Kopf. Bei ihrer Suche aber haben die Forscher Faszinierendes über unser Gehirn herausgefunden. Sie haben das Feuern der Neuronen entschlüsselt. Sie haben die Botenstoffe analysiert, die Furcht oder Vertrauen, Stress oder Hochgefühl auslösen. Sie haben Schaltpläne der Sinnesverarbeitung gezeichnet. Und sie sind doch noch immer voller Ehrfurcht angesichts dieses einzigartigen Organs: Seine Leistung übertrifft jeden Computer. Seine Architektur ist in Jahrmillionen der Evolution zu ungeheurer Komplexität herangewachsen. Dabei ist es unfassbar anpassungsfähig geblieben. Es verändert sich mit jedem Gedanken. Und bleibt sich dabei doch erstaunlich treu. Hamburg und Heidelberg März 2015 Andreas Sentker und Frank Wigger Sie haben die Traumdeutung der Herrschaft der Psychoanalyse entrissen und zum Feld der Hirnforschung werden lassen. Die Mediziner liefern mit ihren immer leistungsfähigeren Tomografen faszinierende Einblicke in das denkende Gehirn – im Wortsinn tief gehende Einsichten für die Grundlagenforschung. Wie sehr das Ich vom Funktionieren unseres Gehirns abhängt, merken wir, wenn dieses Ich zerfällt. Noch immer hat die Forschung keine Therapie gegen Alz- 6 Vorwort 7 Kapitel 1. Wunderwerk Gehirn 16–74 2.Grenzzustände 76-113 3. Die Sinne 114–157 4.Das erkrankte Gehirn 158–209 5.Das alternde Gehirn 210–244 Kapitel-Übersicht 9 Inhalt 1.Wunderwerk Gehirn Im Labyrinth des Denkens 17 In Lausanne suchen Forscher auf vielen Wegen nach Antworten. Stichwort: Phrenologie 25 Ich bin zwei 30 Unser Gehirn führt ein Doppelleben. Sind die Gedanken noch frei? 39 Hirnforscher erkennen unsere geheimen Absichten. Alle für einen! 49 Der Drang zum Miteinander ist tief in unserem Gehirn verankert. Bauteile für die Seele 54 Ist der Geist bloß Biologie? Die Zellen des Anstoßes 61 Stichwort: Das Nervensystem 67 Die große Neuro-Show 71 Spiegelneuronen sollen Basis sein für Mitgefühl, Kultur und Sprache. Was wurde aus den Verheißungen der Hirnforschung? 2.Grenzzustände des Gehirns Jenseits von Gut und Böse77 Sind wir für unser Verhalten im Schlaf verantwortlich? Sehnsucht nach Schlaf 83 Unser hektischer Alltag erzeugt chronischen Schlafmangel. Stichwort: Vielleicht auch träumen 88 Die Dramaturgie der Nacht 93 Im Schlaf räumt das Gehirn auf und festigt Erinnerungen. Leerlauf im Kopf 100 Stichwort: Bewusstseinsstörungen 104 Das Ringen um Worte 108 Was tut unser Gehirn, wenn wir nichts Bestimmtes tun? Ein Unfall verwandelte Erik Ramsey in eine lebende Statue. Inhalt 11 3.Die Sinne Auf den Geschmack gekommen115 Riechen und Schmecken gelten als niedere Sinne. Stichwort: Sensorische Wahrnehmung 125 Tote Nase 129 Der Mensch verlernt das Riechen. Trau den Augen nicht 132 Stichwort: Optische Täuschungen 137 Der sechste Sinn 142 Michael Bach erforscht seltene Augenleiden. Alle haben ihn, kaum jemand kennt ihn: Den Körpersinn. So klingt das Leben 147 Musik kann trösten und glücklich machen. Volle Dröhnung Mit allen möglichen Tricks wird um die Aufmerksamkeit der Hörer geworben. 154 4.Das erkrankte Gehirn Immer auf der Kippe159 Zwischen Neurose und Psychose, zwischen Angst und Wahn spielt sich das Leben von Borderlinern ab. Stichwort: Illusion und Realität: Wahn 164 Ohnmächtig im Strudel negativer Gedanken 169 Keine psychische Erkrankung ist so häufig wie die Depression. Mitten ins Leben 172 Psychisch kranke Menschen haben es schwer, Arbeit zu finden. Stichwort: Nicht neurotisch, nur anders 177 Auf der Suche nach der gesunden Mitte 182 Schau mir in die Augen 186 Menschen, die an einer Bipolaren Störung leiden, leben in den Extremen. Autisten nehmen ihre Umwelt als eine Flut von Details wahr. Wahnsinns-Typen192 Wie gestört muss man sein, um Besonderes zu leisten? 12 Inhalt 13 Coach oder Couch203 5.Das alternde Gehirn Über seelische Leiden wird so offen geredet wie nie. Ist Alzheimer angeboren?211 Eine Hypothese zur Ursache des Hirnleidens. Stichwort: Das alternde Gehirn 218 Damit die Würde bleibt222 Die Diagnose Alzheimer löst oft Horrorvorstellungen aus. Im Dorf des Vergessens229 Im niederländischen De Hogeweyk genießen Menschen mit Demenz maximale Freiheit. Stichwort: Neurodegeneration 235 Drück mich!239 In Japan ist der Kuschel-Roboter »Paro« bei alten Menschen beliebt. Anhang Autorenverzeichnis247 Bildnachweis251 14 Inhalt 15 1. Wunderwerk Gehirn Wird die Wissenschaft die Funktionsweise des menschlichen Gehirns dereinst vollständig verstanden haben, das komplexe Zusammenspiel von mehr als 100 Milliarden Nervenzellen? Forscher bauen Hirnstrukturen im Computer nach, suchen nach Aktivitätsmustern im Kopf. Sie fahnden nach der Basis von Mitmenschlichkeit und sammeln immer mehr Daten. Doch mit jeder Antwort stoßen sie auf neue Fragen. Bleibt am Ende ein großes Rätsel? 16 Die Welt im Kopf Im Labyrinth des Denkens Wie erschaffen 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Kopf Geist und Bewusstsein? In Lausanne suchen Forscher auf vielen Wegen nach Antworten. Sie bauen das Gehirn künstlich nach und lassen die Seele aus dem Körper fahren Willkommen im Heimkino des Blue Brain Project in Lausanne! Was auf der Leinwand sichtbar wird, ist der faszinierende Versuch, das Innenleben des Gehirns dreidimensional erlebbar zu machen. Denn die bunt gefärbten Nervenzellen und -fasern entstammen allesamt dem Rechner. Einer der größten Supercomputer der Welt simuliert die Neuronen und ihr Zusammenwirken mit nie da gewesener Detailtreue. Mit Hilfe einer 3-D-Brille kann man sich in das Zellgespinst hineinversetzen und staunend durch ein Gebilde schier unentwirrbarer Komplexität reisen, in dem doch alles seinen Platz hat und auf geheimnisvolle Weise zusammenwirkt. Derzeit besteht das künstliche Hirngewebe aus 10 000 Nervenzellen. Doch das ist nur der Anfang. Irgendwann sollen in der Blue-Brain-Simulation 100 Milliarden Neuronen zusammengefügt werden – zu einer vollständigen Kopie eines menschlichen Gehirns! Sind die Neurowissenschaftler am Genfer See vielleicht größenwahnsinnig? »Das hier ist kein Frankenstein-Projekt«, stellt Henry Markram als Erstes klar. Der ruhig und zurückhaltend wirkende Südafrikaner sitzt in Jeans und Pullover in seinem Universitätsbüro und ist auf Journalisten nicht allzu gut zu sprechen. Seit er im Jahre 2005 das Blue Brain Project gestartet hat, musste er immer wieder reißerische Artikel über sein Kunsthirn lesen, mit dem er angeblich das Rätsel des Bewusstseins lösen oder die menschliche Seele in eine Maschine verpflanzen wolle. Alles Quatsch, meint der Hirnforscher. »Es geht uns nicht um Künstliche Intelligenz, sondern um ein besseres Verständnis«, erklärt Markram. »Wir wollen ein realistisches Modell des Gehirns erzeugen, in das wir alle bekannten Forschungsergebnisse integrieren. Wenn das gelingt, haben wir ein fantastisches Werkzeug. Wir können zum Beispiel die Wirkung von Medikamenten im Hirn punktgenau simulieren.« In der Tat, wenn das gelänge, wäre dies eine Revolution und Markram so etwas wie der Einstein der Hirnforschung. Denn trotz eines gigantischen Wunderwerk Gehirn 17 Forschungsaufwandes – jedes Jahr werden etwa 35 000 neurowissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht – fehlt noch immer ein umfassendes Modell des Gehirns. Zwar wurde das honigmelonengroße Organ in den vergangenen Jahrzehnten immer genauer seziert; man hat bestimmte Denktätigkeiten einzelnen Hirnarealen zugeordnet, deren Morphologie studiert und die elektrische Aktivität der grauweißen Schwabbelmasse analysiert, bis hinunter zur Reizleitung einzelner Zellen. Doch all das, was unsere menschliche Einzigartigkeit ausmacht, schien sich dabei unter dem Mikroskop gleichsam in Luft aufzulösen. Und die entscheidenden Fragen sind noch immer ungeklärt: Wie bringt das Nervengeflecht in unserem Kopf Gedanken hervor, auf welche Weise führt das Neuronenfeuer zu so etwas wie Bewusstsein, kurz: Wie entsteht aus Materie Geist? Kann man das Hirn simulieren? Nicht wenige halten die Idee für spinnert Wer Antworten auf solche Fragen sucht, findet derzeit kaum einen geeigneteren Ort als die École Poly­tech­nique Fédérale de Lausanne (EPFL). Hier ist nicht nur das Blue Brain beheimatet, sondern auch das Labor für kognitive Neurowissenschaft, das mit der Erforschung seltsamer Bewusstseinsphänomene Schlagzeilen macht: Hier geht es um Spiegelhalluzinationen, Doppelgängerphänomene oder out of body-Erlebnisse, bei denen sich die Seele regelrecht vom Körper zu lösen scheint. Solche »außerkörperlichen« Erfahrungen treten manchmal in Todesnähe auf und werden gerne mit religiösen oder esoterischen Vorstellungen in Zusammenhang gebracht. Im Labor für kognitive Neurowissenschaft dagegen werden sie fast schon routinemäßig erzeugt. Wer also die hundert Meter zurücklegt, die die beiden Labors in Lausanne trennen, durchmisst das gesamte Spektrum der modernen Hirnforschung, von der Anatomie einzelner Neuronen bis zur Frage, wie aus ihrem Zusammenwirken am Ende Geist und (Selbst-)Bewusstsein entstehen. Und er lernt zwei sehr gegensätzliche Zugänge zum Gehirn kennen: zum einen die Analyse merkwürdiger Bewusstseinszustände, aus denen man sozusagen top-down auf die Funk­tions­wei­ se des Gehirns rückschließt; zum anderen den kühnen Versuch, das Denkorgan bottom-up aus seinen Einzelteilen wieder zusammenzusetzen. Dass solche ungewöhnlichen Experimente an einer kleinen, idyllisch gelegenen Schweizer Hochschule stattfinden, liegt daran, dass die EPFL nicht unter dem Ballast der Traditionen leidet. Erst vor sechs Jahren hat die École Polytechnique, die sich als »eine der innovativsten Universitäten in Europa« lobt, eine neue Fakultät für Lebenswissenschaften aus der Taufe gehoben. Und die Forscher, die hier in moderne Labors einzogen, von deren Fenstern aus man den Schnee auf den Gipfeln der französischen Alpen sieht, konnten von Anfang an visionäre Ideen in Angriff nehmen, ohne sich groß um Traditionen oder die Bedenken alteingesessener Kollegen scheren zu müssen. Henry Markram kam 2002 vom Weizmann-Institut in Israel, weil er die Chance sah, endlich seinen Traum vom Kunsthirn zu verwirklichen, den er seit 18 Die Welt im Kopf Jahren mit sich herumtrug. »Ich hatte damals auch Angebote von Eliteuniversitäten in den USA«, erzählt der 45-Jährige, »aber ich stellte fest, dass ich dort meine Zeit mit dem Schreiben von Forschungsanträgen hätte zubringen müssen.« In Lausanne dagegen war die Hochschulleitung mutig genug, das Blue Brain Project von Anfang an finanziell zu unterstützen – ohne genau zu wissen, wohin es am Ende führen würde. Die Meinungen der Fachwelt über das Experiment sind bis heute geteilt. Nicht wenige Wissenschaftler halten schon allein die Idee, das Hirn nachbauen zu wollen, für spinnert. Hat nicht die Geschichte der Hirnforschung genug Bescheidenheit gelehrt? Ist nicht mit jeder neuen Untersuchungsmethode eine Euphorie ausgebrochen, die ebenso schnell wieder verflog? Über die Phrenologen, die Ende des 18. Jahrhunderts postulierten, man könne an der Form der Schädelknochen den menschlichen Charakter ablesen, lachen wir heute nur noch. Als hundert Jahre später Camillo Golgi und Ramón y Cajal mit einer speziellen Färbetechnik erstmals die Neuronen und ihre Verbindungen (Sy­nap­sen) sichtbar machten, glaubte man, endlich den Schlüssel zum Gehirn gefunden zu haben. Auch der junge Sigmund Freud hoffte damals, in dem grauweißen Nervengeflecht den Schlüssel zum menschlichen Seelenleben zu finden – vergebens. Wiederum hundert Jahre später führte der Boom der bildgebenden Verfahren – Computer-, Kernspin- und Positronenemissionstomografie – zu neuer Euphorie. Der amerikanische Präsident rief die 1990er Jahre zur decade of the brain aus, Forscher gaben ihren Büchern großspurige Titel wie Was die Seele wirklich ist, und es schien, als sei das jahrhundertealte Leib-Seele-Problem schon so gut wie gelöst. Doch inzwischen macht sich von Neuem Ernüchterung breit. Die bunten Bilder aus dem Kernspintomografen zeigen eben doch nur den Blutfluss im Gehirn und nicht das Denken selbst. Und prominente Vertreter der Zunft wie Wolf Singer stellen selbstkritisch fest, »dass wir heute weniger wissen, wie das Gehirn funktioniert, als wir vor zwanzig, dreißig Jahren zu wissen glaubten«. Ein dreidimensionales Puzzle mit 30 Millionen Verbindungsstellen Und da will Henry Markram nun das Rätsel fast im Alleingang lösen? »Ich verstehe die Skepsis«, sagt der Neurobiologe. »Aber für mich lautet die Frage nicht: Ist es möglich, das Gehirn nachzubauen? Sondern: Was braucht man, damit es möglich wird?« Das Blue Brain Project soll genau diese Frage beantworten. Der eingangs gezeigte Film, die Reise durch den bunten Nerven-Tropenwald, ist die Frucht von fünfzehn Jahren harter Arbeit. So lange hat Markram Daten gesammelt, hat bei dem deutschen Nobelpreis­träger Bert Sakmann in Heidelberg gelernt, wie man in Rattenhirnen einzelne Nervenzellen untersucht und wie man ihre Kommunikation abhört. »Heute haben wir eine riesige Datenbank mit über 10 000 recordings von Zellen, mit Hunderttausenden Kommunikationsmustern, mit Studien zur Genexpression und so weiter«, erzählt Markram, Wunderwerk Gehirn 19 und man hat den Eindruck, er kenne jede Nervenzelle persönlich. Stundenlang kann er über ihre biologischen, elektrischen, chemischen oder magnetischen Eigenschaften reden, und es wird klar, dass Neuronen keine amorphe Masse sind, sondern höchst individuelle Gebilde, so einzigartig wie Fingerabdrücke oder Gesichter. »Und genau aus dieser Diversität und Komplexität entsteht die Macht des Gehirns«, sagt Markram. Dessen Leistungsfähigkeit illustriert der Neu­ro­bio­lo­ge anhand eines einfachen Vergleichs: »Wollte man versuchen, einen Computer mit der Rechenkapazität des Gehirns zu bauen, würde der Tausende von Gigawatt brauchen und Milliarden Dollar kosten – in unserem Kopf schafft das eine drei Pfund schwere Masse, die auf 60 Watt läuft.« Der Unterschied zwischen ­Supercomputern und Gehirn besteht in der biologi­schen Struktur. Über Trillionen von Synapsen tauschen die Neuronen permanent elektrische und chemische Informationen aus, arbeiten also zugleich analog und digital. »Wenn wir verstehen, wie das genau funk­tio­niert, wird das unsere gesamte Informationstechnik revolutionieren«, prophezeit Markram. Noch ist es nicht so weit. Aber das Blue Brain Project läuft ja auch erst seit zweieinhalb Jahren. Und immerhin hat Markram nun bewiesen, dass sein Ansatz zumindest im Prinzip funktionieren kann: Indem er alle bekannten Daten über die Funktionsweise der Neuronen seinem BlueGene/L-Computer fütterte, errechnete dieser daraus den Aufbau der kleinsten Grundeinheit eines Gehirns, einer »kortikalen Säule«. »Wir mussten dazu quasi ein dreidimensionales ­Puz­zle mit 30 Millionen Verbindungsstellen zusammensetzen«, erzählt Markram nicht ohne Stolz. Seit Ende vergangenen Jahres pulsieren die 10 000 zusammengeschalteten (Ratten-)Neuronen im Rechner. Das blinkende Nervengeflecht lässt sich nicht nur in beeindruckenden Filmen sichtbar machen; auf Knopfdruck können die Hirnforscher auch jede einzelne Zelle ansteuern, ihren Signalaustausch mit anderen Neuronen beobachten oder simulieren, was bei einer Störung des Systems geschieht. Nun müsste man nur eine Vielzahl solcher Bausteine zusammenfügen, dieselben Schritte beim Menschen nachvollziehen – voilà, fertig wäre das Gehirn. Es gibt lediglich ein Problem: Die Lausanner Forscher brauchten dazu einen Supercomputer völlig neuen Typs, der einige Hundert Millionen Dollar kosten würde. »Leider ist es extrem schwer, visionäre Investoren zu finden«, berichtet Markram. Ständig halte er Vorträge vor Milliardären, immer seien sie interessiert – »aber am Ende investieren sie dann doch lieber in Aktien oder Hedgefonds«. Mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen hat hundert Meter weiter Olaf Blanke. Der Leiter des Labors für kognitive Neurowissenschaft braucht für seine Forschungen keine Supercomputer, sondern geeignete Pa­tien­ten und Probanden. Denn er untersucht, was die 100 Milliarden Neuronen am Ende hervorbringen: (Selbst-)Bewusstsein. Täglich erlebt Blanke, der auch als Oberarzt 20 Die Welt im Kopf Den Vorwurf, er wolle eine Maschine mit Bewusstsein bauen, weist der Südafrikaner Henry Markram weit von sich. Ihm geht es um das grundlegende Verständnis des Gehirns. am Universitätsklinikum Genf tätig ist, »wie selbst kleine Störungen im Hirn einen Menschen tiefgreifend verändern«. Wenn der schlaksige Deutsche beim Mittagessen anfängt, begeistert von seinen Fallgeschichten zu erzählen, fühlt man sich an die fantastischen Storys des Neurologen Oliver Sacks erinnert. Da wäre etwa jener Patient, der durch einen Hirn­infarkt das »Gourmand-Syndrom« entwickelte: Eine Läsion im präfrontalen Kortex weckte in dem Manne eine unwiderstehliche Lust auf edles Essen und erlesene Kochkünste; am Ende kündigte der Jurist seinen Job und arbeitete als Genussexperte für Zeitschriften. Ein anderer Fall machte Blanke 2002 weltberühmt. Damals untersuchte der Neurologe eine Epilepsie-Patientin, der er zur Vorbereitung auf eine Operation winzige Elektroden ins Gehirn gepflanzt hatte. Als Blanke damit eine spezielle Hirnregion namens Angular Gyrus reizte, geschah Unerwartetes: Plötzlich, so berichtete die 43-jährige Frau, hatte sie das Gefühl, ihren Körper zu verlassen. »Ich Wunderwerk Gehirn 21 fühle mich leicht und schwebe in etwa zwei Meter Höhe. Unten sehe ich meinen Körper auf dem Bett liegen«, sagte die Pa­tien­tin. Als der Arzt die Elektrode de­ aktivierte, hörte das Phänomen schlagartig auf, als er den Stromfluss wieder einschaltete, meinte die Patien­tin prompt wieder abzuheben. Banke hatte, ohne es zu wollen, eine out of body-Erfahrung ausgelöst. Jahrhundertelang galten solche Erlebnisse als Hinweis auf die Existenz einer Seele. Zugleich schienen sie ein schlagender Beweis für den sogenannten Dualismus, demzufolge Körper und Geist getrennte Phänomene sind. Res extensa und res cogitans hieß das bei René Descartes – niemand hat die Trennung zwischen der »ausgedehnten Für den Neurowissenschaftler Olaf Blanke Körpersubstanz« und der »ausist das Selbst untrennbar mit dem Gehirn verdehnungslosen denkenden Subbunden. Er prüft diese These mit erstaunlichen stanz« deutlicher formuliert als Experimenten. der französische Philosoph. Und als er 1637 sein berühmtes »Cogito ergo sum« (»Ich denke, also bin ich«) niederschrieb, ging es ihm auch darum, »dass ich eine Sub­stanz sei, deren ganze Wesenheit oder Natur bloß im Denken bestehe und die zu ihrem Dasein weder eines Ortes bedürfe noch von einem materiellen Dinge abhänge, sodass dieses Ich, das heißt die Seele (...), auch ohne Körper nicht aufhören werde, alles zu sein, was sie ist«. Olaf Blanke sieht das heute völlig anders. Für ihn – wie für die meisten Neurowissenschaftler – ist das »Selbst« ebenso wie das Körpergefühl untrennbar mit dem Gehirn verbunden. Wer will, kann das in seinem Labor selbst erleben. »Bitte hier herein«, sagt Bigna Lenggenhager, und führt mich in einen abgedunkelten Raum, in dem ein merkwürdiger Glaskasten steht. Beim Nähertreten sieht man da­rin eine hautfarbene Gummihand liegen, deren Arm­ansatz unter einem schwarzen Vorhang verschwindet. »Und nun Ihre Hand da hinein«, kommandiert die 27-jährige Doktorandin freundlich-resolut, und mein Arm verschwindet 22 Die Welt im Kopf in dem Kasten. Lenggenhager schiebt meine Hand zur Seite unter eine Sichtblende – sodass von außen plötzlich der Eindruck entsteht, mein Arm sei nun mit der Gummihand verbunden. Dann greift die junge Forscherin zu zwei kleinen Pinseln und beginnt, gleichzeitig meine unsichtbare Hand und die sichtbaren Gummifinger zu streicheln. Ein merkwürdiger Eindruck entsteht: Während ich die Berührung an den eigenen Fingern spüre, sehe ich sie an der Attrappe. Allmählich scheint das hautfarbene Gummiding ein Teil meines Körpers zu werden. Man meint geradezu, ein Gefühl in den Gummifingern zu entwickeln – und spürt ein schmerzhaftes Erschrecken, wenn plötzlich ein Hammer darauf niedersaust. »Überrascht?«, fragt Blanke lächelnd. »Diese Sinnestäuschung ist ganz normal.« Sie belegt nichts anderes, als dass unser Körpergefühl eine Repräsentation des Gehirns ist. »Das Gehirn konstruiert aus allen Inputs, die es bekommt, ein möglichst konsistentes Bild des Körpers und des Selbst – und optische Reize haben dabei offenbar ein sehr großes Gewicht.« Wird das Gehirn also mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert – Berührungsreizen an der Hand und konkurrierende visuelle Rückmeldungen von der Gummihand –, bemüht es sich um einen diplomatischen Ausgleich und kann kurzerhand einen fremden Gegenstand in den Körper integrieren und als Selbst attribuieren. Descartes’ »Cogito ergo sum« ist passé. In Lausanne heißt es »Video ergo sum« Klingt unglaublich? Blanke hat noch mehr zu bieten. Seit Neuestem versucht er, die Gummihand-Illusion dank virtueller Realität auf den ganzen Körper auszudehnen. Wir gehen in einen Laborraum, in dem ein Stativ mit einer Vi­ deo­kame­ra steht. Blanke positioniert mich vor der Kamera und reicht mir eine spezielle Videobrille, in der ich – mich selbst von hinten sehe. Denn die Kamera filmt meinen Rücken und überträgt genau dieses Bild auf die Brille. Wieder greift Lenggenhager zu ihren Pinseln und streicht damit über meinen Rücken. Ähnlich wie im Gummihand-Experiment spüre ich die Berührung am eigenen Rücken, während ich sie im Abstand von zwei Metern vor mir sehe. Und alsbald stellt sich wiederum die Wahrnehmungsverschiebung ein: Mehr und mehr meine ich ein Gefühl in dem virtuellen Körper vor mir zu entwickeln. Bei anderen Probanden war dieser Effekt offenbar so stark, dass sie geradewegs aus ihrer Haut zu fahren meinten. Video ergo sum – so war der Bericht über dieses Experiment im Fachblatt Science betitelt. Blanke arbeitete dabei mit dem Philosophen Thomas Metzinger zusammen, der schon länger die These vertritt, das »Selbst« sei nichts anderes als eine Repräsentation des Gehirns. Es entsteht Metzinger zufolge aus all den inneren und äußeren Ein­drücken, die das Gehirn zu einem Modell der Innenund der Außenwelt zusammenfügt. Blankes Ex­pe­ri­mente zeigen beispielhaft, wie Wunderwerk Gehirn 23 fragil diese Modellbildung ist, wie sehr sich sogar unser (scheinbar so selbstverständliches) Körperempfinden manipulieren lässt – und welche Rolle dabei die Arbeitsweise des Gehirns spielt. Als Nächstes will Blanke nun mithilfe einer Kombination von virtueller Realität und bildgebenden Verfahren jene Hirnareale und -prozesse detailliert beschreiben, die solche Selbst-Repräsentationen erzeugen. Anders als die Dualisten meinten, gibt es im Gehirn eben keine übergeordnete In­stanz, die ein »Ich« oder »Selbst« hervorbringt. Stattdessen beschreiben Neurowissenschaftler das Gehirn heute gerne als »Orchester ohne Dirigent«: Niemand führt hier das Kommando, aber jede Einheit weiß, wie sie auf einen bestimmten Stimulus reagieren muss. Wird zum Beispiel die Amygdala aktiviert, eine Region, die für Furcht und Aggression zuständig ist, dann wird dieser Stimulus an den Hypothalamus weitergegeben, an den Hirnstamm und weiter bis zum Rest des Körpers. Man wird bleich, das Herz rast, die ganze Physiologie ändert sich. All diese Änderungen wiederum werden sehr genau vom Gehirn registriert – es entsteht ein »Gefühl«. Und am Ende konstruieren Tausende solcher Kreisläufe das, was wir Realität nennen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Henry Markram auf einen Erfolg seines Blue Brain Project hoffen kann. Gerade weil Gehirn, Körper und Bewusstsein sich nicht voneinander trennen lassen, kann man versuchen, dieses Wechselspiel künstlich nachzuformen. Ähnlich wie Olaf Blanke wurde dabei auch dem Blue-Brain-Chef im Laufe seiner Forschungsarbeit immer mehr klar, wie verletzlich und manipulierbar das menschliche Denkorgan ist: »Jeder äußere Reiz, jede Wahrnehmung, jeder Gedanke beeinflusst das Gehirn.« Je mehr ihm das bewusst geworden sei, umso größer sei sein Respekt davor geworden, meint Markram: »Das Gehirn verändert sich ständig – und es hängt von unserem Verhalten ab, in welcher Weise es das tut.« von Ulrich Schnabel aus der ZEIT Nr. 15/2008 24 Die Welt im Kopf Stichwort Phrenologie Die Phrenologie basiert auf einer einfachen Idee, die heute wieder aktuell ist: Das Gehirn sei das »Organ des Geistes« und so strukturiert, dass seine verschiedenen Teile für unterschiedliche Funktionen verantwortlich seien. Darum würden verschiedene Teile des Gehirns, die durch die Form des Kopfes reflektiert würden, unterschiedliche Fähigkeiten steuern. Doch die Phrenologen glaubten, dass erstens die Größe der einer bestimmten Funktion »zugeordneten« Hirnregion der »Wichtigkeit« dieser geistigen Fähigkeit entspreche; dass zweitens die Kraniometrie (Schädelvermessung) die Form des Gehirns und daher alle Fähigkeiten des Menschen erfassen könne; und dass drittens sowohl moralische als auch intellektuelle Fähigkeiten angeboren seien. »Kein Physiologe, der besonnen diese Frage [die Richtigkeit der Phrenologie] erwägt, … kann lange der Überzeugung widerstehen, dass verschiedene Teile des Gehirns unterschiedlichen Arten geistiger Aktivität dienen.« Herbert Spencer, 1896 Geschichte Die Ursprünge der Phrenologie reichen mindestens bis zu den alten Griechen, wahrscheinlich aber noch länger zurück. Viele Praktiker waren von jeher in erster Linie Physiognomiker – Deuter der Natur anhand der Gestalt der Dinge. Viele Bücher über Kunst und Wissenschaft, zumal im 17. und 18. Jahrhundert, enthielten Abbildungen, Silhouetten und Zeichnungen, die physiognomische Prinzipien veranschaulichten. Das System der Moderne wurde von Franz Gall entwickelt, der 1819 eine entsprechende Abhandlung veröffentlichte. Er glaubte, Stichwort 25 die von ihm entworfene Gehirnkarte würde Bereiche des Gehirns, die er Organe nannte, jeweils mit einer spezifischen Funktion, einer sogenannten Fakultas (aus dem Lateinischen, »Fähigkeit«, englisch faculty), verknüpfen. Im Jahre 1896 veröffentlichten Sizer und Drayton ein Handbuch der Phrenologie mit dem Titel Heads and Faces, and How to Study Them (»Köpfe und Gesichter und wie man sie untersucht«). Es zeigte anhand von Illustrationen, wie man Idioten und Dichter, aber auch Menschen mit einem verbrecherischen oder moralischen Charakter erkennt. Für den modernen Leser ist es eine irgendwo zwischen amüsant und grotesk angesiedelte Abhandlung. Die Viktorianer nahmen die Phrenologie sehr ernst. Ihre Büsten, Abgüsse, Journale, Greifzirkel und Apparaturen sind erhalten geblieben – insbesondere die feinen Büsten aus weißem Porzellan, die auch heute noch von der London Phrenology Company hergestellt werden. Bei Empfindungen und Neigungen Ferner sind die Bereiche der Kopfoberfläche in acht Empfindungen und Neigungen eingeteilt und folgendermaßen beschrieben worden: •Die »häuslichen« (domestic) Neigungen und Eigenschaften haben Mensch und Tier gemein; sie sind grundsätzlich verantwortlich für Gefühle und instinktive Reaktionen auf Objekte und Ereignisse. •Die »Selbstachtungs«- (self-regarding) Empfindungen sind zuständig für Selbstinteresse und Ausdruck der Persönlichkeit. •Die »wahrnehmenden« (perceptive) Fähigkeiten sind verantwortlich für die Wahrnehmung der Umgebung. • Aus den »künstlerischen« (artistic) Neigungen erwachsen Sensibilität und Fertigkeit in Kunst und künstlerischem Schaffen. •Die »semi-wahrnehmenden« (semi-perceptive) Fähigkeiten auf Gebieten wie Literatur, Musik und Sprache sind verantwortlich für die Wür­digung kultureller Errungenschaften. •Die »reflektiven« (reflective), »schlussfolgernden« (reasoning) und »intuitiven« (intuitive) Fähigkeiten sind zuständig für die entsprechenden Denkweisen. •Die »moralischen« (moral) Empfindungen, einschließlich religiöser Gefühle, erheben den Charakter und geben ihm ein menschliches Antlitz. •Die »eigennützigen« (selfish) Neigungen sorgen für die Bedürfnisse des Menschen und helfen ihm, sich selbst zu schützen und zu erhalten. 26 Die Welt im Kopf den Viktorianern gab es phrenologische Operationen, Schulen, Speisen und Ärzte. Voller Begeisterung vermaßen sie Köpfe: Die Kopfgröße war gleichbedeutend mit Hirngröße, was wiederum Geisteskraft und Temperament bedeutet – so glaubte man zumindest. Der durchschnittliche Mann hatte anscheinend einen Kopfumfang von 56 Zentimetern, eine Frau etwa einen bis zwei Zentimeter weniger. Die Größe des Kopfes stand in linearer Beziehung zur Größe des Gehirns und des Intellekts – es sei denn, man hatte einen Wasserkopf. Doch die Form war noch wichtiger als die Größe. Eine gute Kranioskopie konnte, so glaubte man, besondere Begabungen aufdecken. Phrenologen stellten Diagnosen und trafen Vorhersagen über Motive, Fähigkeiten und Naturell. Kurzum, der Kopf war die Manifestation des Geistes und die Seele eines Menschen. Viktorianische Phrenologen betätigten sich als Talentsucher. Einige führten länderübergreifende Vergleichsstudien durch und untersuchten die Unterschiede zwischen Engländern und Franzosen. Phrenologen examinierten Skelette, etwa den Schädel und die Knochen des Erzbischofs Thomas Beckett. Königin Victoria ließ ihre Kinder »lesen«, da Phrenologen sowohl Selbsterkenntnis als auch die Schlüssel zu geistigem, moralischem und beruflichem Erfolg versprachen. Diverse Gruppen und Einzelpersonen waren die Fackelträger der Phrenologie, darunter Nationalsozialisten und Kolonialisten, die anhand phrenologischer Erkenntnisse die Überlegenheit bestimmter Gruppen nachweisen wollten. Von dem so entstandenen Makel hat sich die Phrenologie nie wieder erholt. Lesen des Kopfes Der Phrenologe beginnt das traditionelle »Lesen des Kopfes«, indem er zunächst die allgemeine Form des Kopfes begutachtet. Ein runder Kopf zeigt ihm ein starkes, selbstsicheres, mutiges, manchmal ruheloses Wesen an. Ein eher kantiger Kopf offenbart dagegen eine solide, zuverlässige Persönlichkeit, gedankentief und zielstrebig. Ein breiterer Kopf deutet ihm einen energischen, extrovertierten Charakter an, während ein schmalerer Kopf ein eher zurückgezogenes, introvertiertes Wesen vermuten lässt. Eine ovale Form ist das Kennzeichen des Intellektuellen. Dann tastet der Phrenologe mit sanftem Druck den Schädel ab, um dessen Konturen zu erfassen. Er muss die individuelle Größe einer jeden Fakultas messen sowie deren Ausgeprägtheit im Vergleich zu anderen Partien des Kopfes. Da das Gehirn aus zwei Hemisphären besteht, kann jede Fakultas dupliziert werden, und darum untersucht der Phrenologe beide Seiten des Kopfes. Eine Fakultas, die im Vergleich zu den anderen unterentwickelt ist, zeigt eine schwache Ausprägung der jeweiligen Eigenschaft in der Persönlichkeit des Untersuchten an, während eine wohlentwickelte Fakultas Stichwort 27 Unter Neurobiologen hat mittlerweile die Phrenologie einen besseren Ruf als die Psychiatrie nach Freud, da die Phrenologie in einer gewissen, primitiven Weise ein Vorläufer der Elektroenzephalografie war. Tom Wolfe, 1997 kundtut, dass diese Eigenschaft in erheblichem Maße vorhanden sei. Folglich zeigt ein kleines Organ für »Essneigung« (alimentiveness) einen eher bescheidenen und pingeligen Esser an, eventuell einen Abstinenzler; ist diese Fakultas dagegen wohlentwickelt, deutet sie auf einen Menschen hin, der Essen und ein Glas Wein genießt; und falls sie überentwickelt ist, hat man es mit einem Vielfraß zu tun, der womöglich auch exzessiv trinkt. Der phrenologische Kopf hat über 40 Regionen, wobei es freilich darauf ankommt, welche Liste oder welches System man heranzieht. Einige davon basieren auf ziemlich altmodischen Konzepten, etwa »Veneration« (Ehrerbietung), womit Respekt für die Gesellschaft, ihre Regeln und Institutionen gemeint ist, »Mirthfulness« (Heiterkeit), also ein sonniges Gemüt und Sinn für Humor, und »Sublimity« (Erhabenheit), der Hang zu grandiosen Ideen. Außerdem gibt es Kopfbereiche für »Amativeness« (Sex-Appeal); »Philoprogenitiveness« (elterliche und kindliche Liebe); »Alimentiveness« (Appetit, Liebe zum Essen); »Eventuality« (Gedächtnis); und »Inhabitiveness« (Häuslichkeit). Kritik Trotz ihrer Popularität hat die etablierte Wissenschaft die Phrenologie stets als Mumpitz und Pseudowissenschaft abgetan. Die Idee, dass ein Zusammenhang zwischen »Höckern« auf dem Kopf eines Menschen und seiner Persönlichkeitsstruktur und moralischen Entwicklung bestehen könnte, wurde als unsinnig verworfen. Die Belege für diese Behauptung sind untersucht worden und haben sich als unzulänglich erwiesen. Der Aufstieg der Neurowissenschaft hat gezeigt, wie viele der Behauptungen der Phrenologie betrügerisch sind. Andere populäre Mythen über das Gehirn halten sich dagegen hartnäckig, etwa die Vorstellung, dass wir im Alltag nur zehn Prozent unseres Gehirns tatsächlich nutzen würden. Daneben gibt es Mythen über Gehirnenergie, Gehirn-Tuning und 28 Die Welt im Kopf Gehirn-Stärkungswässerchen, die auch nicht glaubwürdiger sind als die Phrenologie. Gleichwohl bleiben einige Aspekte der Phrenologie, die auch heute noch als relevant erscheinen. So weiß man zum Beispiel, dass die Größe des Gehirns positiv korreliert mit Ergebnissen von Tests zur geistigen Leistungsfähigkeit sowie innerhalb einer Art und über verschiedene Arten hinweg. Man weiß auch, dass die Größe des Kopfes mit derjenigen des Gehirns korreliert. Tatsächlich zeigen Psychologen seit fast 100 Jahren, dass ein schwacher Zusammenhang zwischen Kopfgröße (Länge und Breite) und IQ besteht. Gewichtet man allerdings diesen Zusammenhang entsprechend der Körpergröße, wird er noch schwächer und verschwindet womöglich ganz. Mithilfe hochentwickelter Gehirn­ scan-Verfahren haben Wissenschaftler nach Belegen für eine Beziehung zwischen Gehirngröße und IQ gesucht, aber auch hier waren die Ergebnisse nicht gerade eindeutig. Mit Sicherheit haben neue Technologien den Wissensstand über kognitive Neuropsychologie und Psychiatrie erweitert und das Interesse an diesen Disziplinen verstärkt. Man ist heute in der Lage, das Gehirn elektronisch und metabolisch zu vermessen. Aufgrund von Studien sowohl mit Unfallopfern als auch mit »normalen« Menschen wird eine detaillierte neue Karte des Gehirns aufgebaut, die zeigt, welche »Teile« für welche Funktionen hauptsächlich verantwortlich sind. Freilich beruht diese »Elektrophrenologie« auf wissenschaftlichen Experimenten und steht in keinerlei Beziehung zu den alten, vorwissenschaftlichen, moralistischen Vorstellungen der Begründer der Phrenologie. Adrian Furnham Die Vorstellung, dass Höcker auf dem Schädel mit über­ent­wickelten Bereichen des Gehirns korrespondieren, ist natürlich Unsinn, und Galls Ruf als Wissenschaftler hat durch seine Phrenologie schweren Schaden genommen. Robert Hogan und Robert Smither, 2001 Stichwort 29 Ich bin zwei Unser Gehirn führt ein Doppelleben. Seine beiden Hälften verfolgen unterschiedliche Interessen, glaubt der britische Psychiater Iain McGilchrist. Das prägt unser Denken ebenso wie unsere Kultur Wer bin ich, und wenn ja, wie viele? – Der britische Psychiater Iain McGilchrist hat auf die populärphilosophische Frage eine klare Antwort: Ich bin zwei. Zwei Persönlichkeiten leben in uns, hervorgebracht von den zwei Hälften unseres Gehirns. Diese ergänzen sich ähnlich wie Sherlock Holmes und Dr. Watson, bringen mal geniale Einsichten hervor, pflegen mal den Blick fürs unscheinbare Detail. Und wenn McGilchrist recht hat, prägt diese Doppelnatur nicht nur unser Denken, Fühlen und Wahrnehmen, sondern letztlich die ganze menschliche Kultur. Was wie abstrakte Theorie klingt, wurde für Vicki P. auf drastische Weise Wirklichkeit. Bei der Epilepsiepatientin wurde 1979 eine radikale Operation durchgeführt: Um ihre schweren Anfälle einzudämmen, durchtrennten Chirurgen die Verbindung zwischen ihren beiden Gehirnhälften, das sogenannte Corpus callosum. Die Anfälle nahmen ab. Dafür veränderte sich Vickis Alltag dramatisch. Jeder Einkauf im Supermarkt wurde für sie zu einem Kampf – gegen sich selbst. Wollte sie mit der rechten Hand etwas aus dem Regal nehmen, so schilderte sie es in einem Interview, »griff die linke Hand ein, und dann rangen sie miteinander«. Es dauerte Stunden, bis Vicki ihre Einkäufe beisammenhatte. Ähnlich war es morgens beim Anziehen: Linke und rechte Hand konnten sich partout nicht auf einen Kleidungsstil einigen. Solche Patientengeschichten sind für Iain McGilchrist der schlagende Beweis für seine ungewöhnliche These. »Man kann jeder Hirnhälfte eigene Ansichten, Absichten, Ziele, Werte und Neigungen zuschreiben«, sagt der britische Psychiater. Deshalb könne es mitunter zum Konflikt kommen – sowohl zwischen den beiden Hirnhemisphären als auch zwischen den beiden Händen, die über Kreuz mit der jeweils gegenüberliegenden Hirnhälfte verbunden sind. Am Maudsley Hospital in London, wo McGilchrist jahrelang praktizierte, hat er viele Schicksale wie das von Vicki P. kennengelernt. Zum Beispiel Menschen, denen ein Tumor oder ein Schlaganfall die rechte Hirnhemisphäre lahmlegte – und die daraufhin plötzlich ihre linke Körperhälfte nicht mehr wahrnahmen und nur noch die rechte Seite kämmten, rasierten oder bekleideten. Seither treibt Iain McGilchrist die Frage nach der Doppelnatur unseres Gehirns um. Warum besteht es aus zwei Hälften? Und warum haben diese Hemisphären so unterschiedliche Aufgaben, dass sie sich im Extremfall geradezu 30 Die Welt im Kopf bekämpfen? Der britische Psychiater betritt mit solchen Fragen heikles Terrain. Denn die Zweiteilung unseres Denkorgans war einmal ein Modethema der Hirnforschung – und wie so viele Moden wirkt diese heute etwas peinlich. So postulierten einst Forscher, unser Denkorgan lasse sich in eine »analytische« linke und eine »gefühlvolle« rechte Hälfte trennen. Prompt pries der schwedische Autokonzern Volvo in einer Anzeige ein »Auto für die rechte Hirnhälfte« an. Andere verstiegen sich zu der These, in den Hirnhemisphären spiegele sich die Dualität der Welt, Verstand und Gefühl, männlich und weiblich, Yin und Yang. Heute weiß man: Das meiste davon ist Quatsch. Es ist nicht so, dass unsere rechte Hirnhälfte ausschließlich für Impulse und Gefühle zuständig wäre und die linke für rationales Denken. Tatsächlich sind beide Hemisphären am Denken und Fühlen beteiligt; sie tauschen sich aus, und fällt eine Hirnhälfte aus, kann die andere zum Teil deren Aufgaben übernehmen. Von einer strikten Zweiteilung des Gehirns spricht deshalb heute kaum noch jemand. Doch eine schlüssige Theorie, warum das Gehirn aus zwei Hälften besteht, fehlt noch immer. Zwar ist das Gehirn nicht das einzige Doppelorgan. Auch Herz, Nieren, Lunge und Schilddrüse sind zweifach vorhanden. Beim Gehirn allerdings ist die Zweiteilung besonders rätselhaft. Denn eigentlich ist das grundlegende Bauprinzip unseres Denkorgans die Konnektivität: die Maximierung der Verbindungen zwischen rund 100 Milliarden Neuronen. Ausgerechnet die beiden Hirnhälften aber sind vergleichsweise schlecht miteinander verbunden. Die Brücke zwischen ihnen ist im Zuge der menschlichen Entwicklung sogar immer dünner geworden; das Corpus callosum ist – relativ zum Hirnvolumen – im Laufe der Evo­lu­tion nicht gewachsen, sondern geschrumpft. Und das Kurioseste: Mitunter dient der »Balken« zwischen den Hirnhälften gar nicht der Verbundenheit, sondern der Hemmung. Eine Hirnhälfte kann über das Corpus callosum die Aktivität der anderen unterdrücken. Es scheint, als hätten sich die beiden Hemisphären im Laufe der Evolution auseinandergelebt. Weil das Gehirn in vielem so rätselhaft erscheint, beschreibt man es gern in Metaphern. Die bis heute gängigste ist die Maschinenmetapher: Demnach »verarbeitet« das Gehirn die von den Sinnen einströmenden »Daten« und generiert aus ihnen mentale und physische Handlungen. In diese Metapher passt die Verdopplung wichtiger Hirnstrukturen wie etwa Hippocampus, Temporal- und Frontallappen schlecht. Sie wäre vielleicht noch als Leistungssteigerung oder Ausfallsicherung zu erklären – wenn sie denn eine einfache Verdopplung wäre. Aber das Gehirn ist bei genauer Betrachtung asymmetrisch. Von oben gesehen, erscheint es gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wobei die vorderen Strukturen der rechten Gehirnhälfte vergrößert sind und die hinteren der linken Hälfte. Zudem unterscheiden sich die Hirnhälften in ihrer zellulären Architektur und in der Konzentration der chemischen Botenstoffe, die sie steuern. Auch rein physiologisch haben sich die Hirnhälften auseinandergelebt. Wunderwerk Gehirn 31 Corpus callosum Das Corpus callosum, der Hirnbalken, verbindet die beiden Hemisphären des Großhirns. Beim Menschen besteht diese Signalbrücke aus mehr als 200 Millionen Nervenfasern. Deshalb schlägt Iain McGilchrist eine andere Metapher vor: Statt als Maschine beschreibt er unser Denkorgan als ein Team zweier individueller Charaktere, die im besten Falle zusammenarbeiten, mitunter aber auch unterschiedliche Absichten verfolgen. Für gewöhnlich merke man davon nichts, sagt McGilchrist, aber es zeige sich, wenn man eine Hirnhälfte experimentell isoliere. Dann werde klar: »Sie kann selbstständig Bewusstsein hervorbringen.« Das zeigte sich als Erstes bei »Split-Brain-Patienten«, bei denen – wie bei Vicki P. – in den 1960er und 1970er Jahren die Verbindung zwischen den Hirnhälften gekappt wurde. Diese Patienten, so stellte sich heraus, konnten Worte oft nicht erkennen, wenn sie ihnen nur in ihrem linken Gesichtsfeld präsentiert wurden. In der zugehörigen rechten Hirnhälfte (die über Kreuz mit der linken Körperseite verbunden ist) ist offenbar das Lese- und Sprachvermögen extrem schwach ausgebildet. Dafür hat sie andere Fähigkeiten. 32 Die Welt im Kopf In Experimenten legte man Split-Brain-Patienten zum Beispiel das Wort »Schlüsselring« so vor, dass sie die eine Worthälfte nur mit dem linken, die andere nur mit dem rechten Auge erkennen konnten. Wurden sie gebeten, es vorzulesen, sagten sie einfach »Ring« – denn dieses Wort auf der rechten Seite konnte die sprachbegabtere linke Hirnhälfte gut erkennen. Wurden sie dann allerdings gebeten, mit der linken Hand auf den entsprechenden Gegenstand zu zeigen, dann deuteten sie auf einen Schlüssel – die rechte Hirnhälfte konnte das Objekt zwar nicht benennen, aber erkennen. Der amerikanische Hirnforscher Michael Gazzaniga, der viele solcher Versuche durchführte, hat die Ergebnisse dieser Forschung ausführlich in seinem Buch Die Ich-Illusion beschrieben. Dabei kommt Gazzaniga zu ganz ähnlichen Schlüssen wie McGilchrist. Auch er sieht im Gehirn zwei separate Module am Werk, die einen unterschiedlichen Blick auf die Welt haben. Das Gehirn ist sehr geschickt darin, seine Zweiteilung zu verbergen. Im Normalfall arbeiten die beiden Hälften so gut zusammen, dass sie ein einheitliches Bewusstsein erzeugen. Nur in ausgeklügelten Versuchen treten die Brüche zutage. In einem Experiment etwa gaben Forscher Versuchspersonen den Befehl, ans Fenster zu gehen, präsentierten diesen Befehl aber so, dass ihn nur deren jeweils rechte Hirnhälfte wahrnehmen konnte. Prompt folgten die meisten Probanden der Aufforderung. Nach dem Grund ihres Handelns gefragt, gaben sie völlig aus der Luft gegriffene Erklärungen. Etwa: »Ich wollte aus dem Fenster schauen, weil ich Lärm gehört habe.« Offenbar versucht in solchen Situationen die sprachlich dominante linke Hirnhälfte (die den wahren Grund der Handlung nicht kennt) eine schlüssig klingende Interpretation zu liefern – auch wenn diese frei erfunden ist. In seinem Buch The Master and His Emissary vergleicht Iain McGilchrist die Beziehung zwischen den beiden Hirnhälften mit jener zwischen einem »Herrn« und seinem »Gesandten«. Demnach gibt die rechte Hemisphäre als Herr die Richtung vor, die sprachbegabtere linke Hälfte dagegen übernimmt es, dieses Tun in Worte zu fassen. Die rechte Hemisphäre sieht eher das große Ganze, die linke liefert Begründungen dafür und beherrscht die Konzentration aufs Detail. Warum diese Art der Arbeitsteilung sinnvoll ist, beschreibt McGilchrist am Beispiel eines Vogels, der ein Nest baut. Einerseits muss er sich darauf konzentrieren, akribisch Zweige ineinanderzuflechten. Gleichzeitig muss er offen bleiben für Unerwartetes – etwa einen plötzlich auftauchenden Feind. Er muss Ingenieur und Kundschafter zugleich sein. Um diese Herausforderung zu meistern, habe die Natur die Zweiteilung des Gehirns erfunden, sagt McGilchrist: »Vögel und andere Tiere benutzen ihre linke Hirnhälfte für eng fokussierte Aufmerksamkeit auf bereits bekannte Dinge, während sie ihre rechte Hirnhälfte wachsam halten für alles, was da kommen mag.« Bei Menschen sei es ganz ähnlich. Allerdings sei die Arbeitsteilung zwischen den Hirnhemisphären nicht so scharf, wie man früher vermutet habe, betont Wunderwerk Gehirn 33 McGilchrist. Es handele sich eher um Unterschiede im Herangehen an Dinge, so als ob die beiden Hirnhälften unterschiedliche Charaktere hätten. Auch die rechte Seite könne sich konzentrieren, auch die linke könne ihren Fokus weiten – nur eben jeweils weniger gut als die andere. Auch zu Vernunft und Imagination trügen beide Gehirnhälften bei. Aber ihre Beiträge unterschieden sich grundlegend: Die linke Hälfte sei der kühle Kalkulierer, die rechte gleiche einem neugierigen Kind. Der Kalkulierer denkt logisch, schematisch, prozedural. Das Kind sieht sich ständig nach Neuem um, das nicht ins Schema passt. Der Kalkulierer ist sich sicher. Das Kind staunt, fragt und zweifelt. Ihre volle Stärke gewinnen beide Weltsichten, wenn man sie kombiniert. Gemeinsam sorgen die Hirnhälften dafür, dass Menschen gegenüber der Welt die richtige Distanz behalten. Nicht zu weit weg (rechte Hälfte), nicht zu nah dran (linke Hälfte). Seine Patienten am Maudsley Hospital testete McGilchrist oft mit einer einfachen Aufgabe: Er ließ sie einen Baum zeichnen. Während Gesunde die Bäume in ihrem ganzen Formenreichtum darstellten, vom groben Umriss bis hin zum kleinsten Ast, zeigten hirngeschädigte Patienten – je nach Art des neuronalen Ausfalls – spezifische Verzerrungen. Jene, bei denen nach einem Schlaganfall nur noch die rechte Hirnhälfte richtig funktioniert, brachten zwar den Gesamteindruck eines Baumes gut zu Papier, schlampten aber bei den Details. Schlaganfallpatienten mit gesunder linker Hirnhälfte dagegen zeichneten meist eine sehr detaillierte Struktur, die allerdings einem Baum nur entfernt ähnelte. Ende der siebziger Jahre hatte McGilchrist zunächst begonnen, an der Universität Oxford Literaturwissenschaft zu studieren. Doch die Art der Literaturkritik missfiel ihm. »Ein Kunstwerk ist etwas, bei dem sein Schöpfer sich bemüht hat, es einzigartig in der Welt zu machen«, sagt er, »es kann weder verwässert noch paraphrasiert werden. Seine Bedeutung ist implizit. Dann kommt der Kritiker daher, abstrahiert und generalisiert die Bedeutung.« Das war nicht McGilchrists Sache. Er wollte wissen, wie Menschen das Konkrete, Körperliche, Unverwechselbare in Kunstwerken wahrnehmen – und beschloss mit 28 Jahren, Medizin zu studieren. In einem Vortrag des Schizophrenie-Experten John Cutting hörte er erstmals von den Fähigkeiten der rechten Hirnhälfte: »Cutting sagte, die rechte Hirnhälfte sei viel besser darin, all die Dinge zu verstehen, die ich im analytischen Denken vermisst hatte: Metaphern, Körpersprache, Humor, Tonfall, das Implizite, Einzigartige.« Für zwei Jahrzehnte vertiefte McGilchrist sich in die Erkundung der Hirnhälften, dann präsentierte er seine Überlegungen 2009 in seinem (bislang nur auf Englisch erschienenen) Buch. Dessen Titel The Master and His Emissary spielt auf eine alte Geschichte von einem Fürsten an, der seinem Gesandten die Verwaltung seines Reichs überlässt. Der Gesandte schaltet und waltet – und vergisst dabei, dass er nur im Auftrag seines Herrn regiert. Er hält sich selbst für den Herrn. Ähnlich sei es auch in 34 Die Welt im Kopf unserem Kopf, meint McGilchrist. Die linke Hemisphäre sei nur der Gesandte der rechten, habe das aber offenbar vergessen und die Herrschaft übernommen. Für diese – zugegebenermaßen gewagte – Theorie hat McGilchrist viele Belege aus der Kultur- und Sozialgeschichte zusammengetragen. »In der klassischen Antike und in der europäischen Renaissance und Aufklärung waren die Hemisphären im Gleichgewicht«, glaubt der Hirntheoretiker. Nach diesen Blütezeiten unserer Zivilisation jedoch habe jedes Mal die linke Gehirnhälfte die Oberhand gewonnen. Sogar in der Entwicklung der Porträtmalerei findet er Hinweise. »In den großen humanistischen Epochen kam plötzlich Leben in die Gemälde«, sagt er, »die Gesichter starren nicht mehr ins Leere, sie blicken direkt auf den Betrachter oder auf dessen linke Seite, also die Seite der rechten Hirnhälfte.« Sowohl in der Antike als auch in der Renaissance haben Kunsthistoriker diese Belebung verzeichnet – doch jedes Mal erstarren die Gesichter nach einer Weile wieder. Im 16. Jahrhundert habe die Dominanz der linken Gehirnhälfte die Menschheit in die Dekadenz und schließlich ins Dunkel des Mittelalters geführt. Heute, sagt McGilchrist polemisch, führe das zur Finanzkrise. »Der Kollaps der Märkte war ein perfektes Beispiel für das blinde Befolgen von Algorithmen, die im Abstrakten als tauglich ›bewiesen‹ waren, die aber völlig entkoppelt waren von der wirklichen Welt.« Dass er sich mit solchen Interpretationen auf dünnem Eis bewegt, stört McGilchrist nicht. Er denkt lieber, so darf man sagen, rechtshemisphärisch-ganzheitlich. Die linke Gehirnhälfte dagegen ist ihm weniger sympathisch. Natürlich bleibt McGilchrists Theorie nicht unangefochten. Die Erkenntnisse der Hirnforschung seien »viel zu grob, um die psychologischen und kulturellen Folgerungen zu stützen, die McGilchrist zieht«, kommentierte der englische Philosoph A. C. Grayling. Und der deutsche »Neurophilosoph« Georg Northoff hält McGilchrists Theorie zwar im Grunde für stimmig, kritisiert aber dessen Begrifflichkeit. »Das eine ist die Rede über das Gehirn, das andere ist die Rede über die Person«, sagt Northoff, »ich würde ungern beides vermischen.« Bei Hirnforschern hat es McGilchrist als Fachfremder besonders schwer. Doch er stößt durchaus auf Resonanz. »Ich glaube, dass McGilchrist auf einer tiefen Ebene recht hat«, sagt Onur Güntürkün, der an der Universität Bochum das Zusammenspiel der Hirnhälften erforscht. »In den Hemisphären mit ihren unterschiedlichen Komponenten und Fähigkeiten stecken unterschiedliche Persönlichkeitsschwerpunkte.« Die Teilung in zwei selbstständige Einheiten sei auch funktional sinnvoll, weil sie Zeit spare. »Wir können beispielsweise Gesichter innerhalb von sechs Millisekunden erkennen«, erklärt Güntürkün. »Die Verbindung zwischen den Gehirnhälften braucht aber etwa 38 Millisekunden. Die Entscheidung, ob Willi oder Walter vor mir steht, ist von einer Hirnhälfte unendlich viel schneller erledigt, als es dau­ern würde, die Gegenseite zu fragen, ob sie auch dieser Meinung ist.« »Absolut faszinierend« findet der Psychologe Peter Brugger McGilchrists Sichtweise des geteilten Gehirns. Brugger erforscht am Zentrum für Wunderwerk Gehirn 35 Den beiden Hemisphären des Großhirns werden unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben. Im Laufe der Evolution hat sich eine Art Arbeitsteilung entwickelt, die das Organ sehr effizient macht. iv iat z so as ak rib isc h log isc h sie ht D erfas s s t da sieh ze Gan e ß gro eta ils t Stru kture n rig neugie gen erfasst Stimmun atisch schem offen ran d h na Die linke Hirnhälfte steuert die rechte Hand und ist oft dominant 36 Die Welt im Kopf we it w eg Die rechte Hemisphäre steuert die linke Hand und ist eher leise Wunderwerk Gehirn 37 Neurowissenschaft in Zürich seit Jahrzehnten das Rätsel der Hemisphären. »Es gibt gute Daten dafür, dass die Hälften mit unterschied­lichen Persönlichkeitseigenschaften korreliert sind«, sagt er, »und McGilchrist hat auch recht darin, seine Theorie auf unsere Gesellschaft anzuwenden.« In seinen eigenen Versuchen hat Brugger festgestellt, dass Menschen, bei denen die rechte Hemisphäre ein Übergewicht hat, eher zu magischem oder esoterischem Denken neigen. Dabei hat die Frage nach der Arbeitsteilung im Gehirn auch praktische Bedeutung – etwa beim Lesenlernen. Seit Jahrzehnten konkurrieren zwei Lernstile: die »ganzheitliche« Methode, bei der die Schüler die Wörter im Ganzen erfassen sollen, und die synthetische Methode, bei der sie sich Buchstabe für Buchstabe vorarbeiten. Mal war die eine, mal die andere Methode angesagt – ein Streit, den Brugger für verfehlt hält. Die ganzheitliche Methode liege eher Schülern, in deren Denken die rechte Hemisphäre dominiert, während die synthetische Methode eher der linken Hemisphäre entspreche. »Man sollte im Leseunterricht beide Methoden vorstellen«, sagt Brugger, »und sie jedem Schüler individuell anpassen.« Bleibt nur die Frage: Wenn McGilchrist recht hat und jeder Mensch aus zwei selbstständig bewusstseinsbegabten Einheiten besteht – warum bemerken wir davon im Alltag nichts? Eine plausible Antwort ist, dass die Evolution ein einheitliches Bewusstsein begünstigt hat. Mehrere autonome Seelen, die in einem Körper mit­einander ringen, sind sicherlich kein Vorteil im Überlebenskampf. Wie die neuronalen Mechanismen das schaffen und wie in gesunden Gehirnen aus den Zulieferungen beider Hälften ein einheitliches Bewusstsein entsteht, ist eine Frage, an der die Gehirnforscher wohl noch lange knabbern werden. Denn die Arithmetik der Gehirne widerspricht der üblichen Logik: 1 + 1 = 1. von Tobias Hürter aus der ZEIT Nr. 25/2013 38 Die Welt im Kopf Sind die Gedanken noch frei? Hirnforscher erkennen unsere geheimen Absichten, Lügen und Vorlieben – und stellen die Privatsphäre im Kopf infrage Die Hirnforschung ist John Blumes letzte Hoffnung. Mit ihrer Hilfe will der amerikanische Anwalt »ein für alle Mal« beweisen, dass sein Mandant Ben Gower (Name geändert) irrtümlich im Gefängnis sitzt. Ein Geschworenengericht in South Carolina hatte Gower 2002 schuldig befunden, 41 Jahre zuvor einen Taxifahrer in den Kopf geschossen zu haben. Das Urteil: lebenslänglich. »Lächerlich«, erregt sich Blume noch heute. »Ein einziger Ballistiker hat behauptet, die tödliche Kugel stamme aus der Waffe meines Mandanten. Dass zuvor ein halbes Dutzend anderer Gutachter Zweifel daran hegten, interessierte die Geschworenen überhaupt nicht.« Jetzt will Blume »mit einem Beweis, den man nicht ignorieren kann«, in Berufung gehen: mit dem Protokoll eines neuartigen Lügendetektortests. Hirnforscher der Firma Cephos aus Boston (Slogan: »Unser Geschäft ist die Wahrheit«) haben Gower in einem Kernspintomografen zu dem Mord befragt und aus den Hirn­scans geschlossen, dass seine Unschuldsbeteuerungen stimmen. »Als ich las, dass die Forscher anhand der Aufnahmen mit mehr als 90-prozentiger Sicherheit zwischen wahr und falsch unterscheiden können, dachte ich: Das ist unsere Chance!«, sagt Blume. Schließlich akzeptierten Richter auch wesentlich ungenauere Methoden wie Handschriftenvergleiche oder ballistische Gutachten. »Warum sollte sie nicht auch ein Blick ins Gehirn des Angeklagten ü ­ berzeugen?« Der Fall Gower gegen den US-Bundesstaat South Carolina könnte Rechtsgeschichte schreiben. Sollte das Gericht das Testprotokoll tatsächlich als Beweis zulassen, ginge es nicht nur um Schuld und Schicksal eines Einzelnen. Dann stellten sich ganz grundsätzliche Fragen: Können Neurowissenschaftler unsere Gedanken wirklich entschlüsseln? Dürfen wir mutmaßlichen Straftätern in den Kopf schauen, müssen wir es vielleicht sogar, um andere zu schützen? Sind unsere Gedanken überhaupt noch frei? Können sie einst gar gezielt manipuliert werden? Wenige Disziplinen wecken zugleich so utopische Hoffnungen und so tief sitzende Ängste wie die Neurowissenschaft. Die einen träumen von »Gedankenlesemaschinen« oder neuen, hirnbasierten Marketingmethoden, andere fürchten eine Gedankenpolizei, wie sie die Romanautoren Philip Dick (Minority Report) oder George Orwell (1984) vor Jahrzehnten vorhergesagt haben. Tatsächlich wird Wunderwerk Gehirn 39 in den USA inzwischen laut darüber nachgedacht, ob man Terrorverdächtige nicht einfach anhand ihrer Hirnaktivität überführen könne – noch bevor sie straffällig werden. In Deutschland dagegen bestimmte in den vergangenen Jahren der Streit zwischen Philosophen und Hirnforschern die Debatte. Auf abstraktem Niveau diskutierten sie vor allem, ob der Mensch einen freien Willen habe, konkrete Anwendungen waren kaum ein Thema. Nun zeigen Beispiele wie jenes aus South Carolina, wie schnell die Erkenntnisse der Neurowissenschaft in den Alltag vordringen. Zumal Cephos (von griech. képhalon: Kopf, Schädel) nicht das einzige Unternehmen ist, das mit diesen E ­ rkenntnissen Geld verdienen will. Die Konkurrenzfirma No Lie MRI (MRI steht für Magnetresonanz- oder Kernspintomografie) aus San Diego will ihren Neuro-Lügendetektor demnächst sogar in Europa ­vermarkten. Auch die Werbeindustrie hofft auf die Hirnforschung. Statt schlichten Marketings propagiert sie nun das raffiniert klingende »Neuromarketing«. Das Schlagwort verheißt, man könne Konsumenten direkt ins Hirn blicken und ihre geheimsten Wünsche e­ rahnen. Gewaltige Hoffnungen weckt die Neuro-Technik ebenfalls in der Medizin. Rund um die Welt arbeiten Labore an Hirn-Computer-Schnittstellen, die es gelähmten Patienten ermöglichen sollen, mit der Kraft ihrer Gedanken Rollstühle, Armprothesen oder Schreibprogramme zu steuern. Beflügelt wird die Begeisterung für all diese Visionen durch immer neue Erfolgsmeldungen: Dem Hirnforscher John-Dylan Haynes in Berlin gelang es, die Absichten von Probanden zu erkennen. Sie mussten in einem Kernspintomografen entscheiden, ob sie zwei Zahlen addieren oder subtrahieren wollten. Aus ihrer Hirnaktivität konnte H ­ aynes dann die Entscheidung für plus oder minus vorhersagen – sogar noch bevor diese den Versuchspersonen selbst bewusst wurde. Er erreichte dabei eine Trefferquote von bis zu 75 Prozent. Ähnlich viel Aufsehen erregte ein Experiment von Yoichi Miyawaki von den ATR Computational Neuro­science Laboratories in Kyoto. Er zeigte seinen Testpersonen zunächst 400 Bilder, um die damit verbundenen Muster im Hirn zu kalibrieren. Als die Probanden danach verschiedene Buchstaben betrachteten, war Miyawaki in der Lage, allein aus dem neuronalen Muster zu rekonstruieren, welche Buchstaben sie gesehen hatten. Zwar standen nur die sechs Buchstaben des Wortes »Neuron« zur Auswahl. Doch eines Tages, spekulierte der Japaner, könne es auf diese Weise vielleicht gelingen, komplexere Wahrnehmungsprozesse, ja sogar Träume wie auf einer Filmleinwand sichtbar zu machen. Forscher der TU Berlin führten kürzlich vor, wie man allein mit Gedankenkraft Flipper spielen kann: Zunächst setzten sie dem Spieler eine Elektrodenhaube Nur Willenskraft steuert diesen Flipper. 40 Die Welt im Kopf Wunderwerk Gehirn 41 auf den Kopf; dann analysierten sie das EEG auf jene Hirnsignale, die der Gedanke an eine Bewegung der rechten oder linken Hand im motorischen Kortex auslöst; nun mussten sie diese Signale nur noch via Computer in einen entsprechenden Steuerimpuls umwandeln – und voilà, schon bewegten sich die beiden Flipperhebel wie von Geisterhand. Und an der Universität Tübingen zeigte der Psychologe Ahmed Karim, wie man Probanden neuronal manipuliert. Dazu bat er sie, zu zweit in einen Raum zu gehen, in dem 20 Euro versteckt waren. Jeweils einer der Teilnehmer sollte das Geld stehlen. Dann wurden sie einem »Verhör« unterzogen, bei dem die Forscher zugleich mithilfe winziger Stromimpulse die Aktivität in einem Hirnareal im präfrontalen Kortex unterdrückten. Überraschendes Ergebnis: Wurden die Stromimpulse eingeschaltet, fiel es den Dieben leichter, ihre Tat zu bestreiten. Nicht nur reagierten sie schneller auf die Fragen, sie schwitzten auch weniger und hatten geringere Schuldgefühle. Wie verändern solche Experimente unser Selbstverständnis? Sind wir bald nirgendwo mehr sicher vor dem Zugriff der »Schädelbohrer und zudringlichen Neurologen«, wie sie der Dichter Durs Grünbein einst nannte? Und muss das schöne Lied von der Gedankenfreiheit, das die Studenten des 19. Jahrhunderts zu ihrer Freiheitshymne erkoren – »Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen« –, umgeschrieben werden? Zwar nicht »mit Pulver und Blei«, aber mit EEG und MRI lassen sich die Gedanken offenbar durchaus fassen. Bevor allerdings der Ruf nach einem »Hirndatenschutzbeauftragten« laut wird, empfiehlt sich ein Blick ins Kleingedruckte der Studien. Denn beeindruckende Ergebnisse im Labor zu erzielen ist das eine, sie in die raue Praxis zu übertragen etwas ganz anderes. In dem Berliner Flipperversuch reagiert etwa die Gedankensteuerung alles andere als zuverlässig, mal kommt sie zu spät, mal bewegt sie den falschen Hebel; einem Piloten, der auf diese Weise ein Flugzeug steuerte, würde man sich jedenfalls nicht anvertrauen. Auch das Tübinger Beeinflussungsexperiment glückt nur unter ganz speziellen Laborbedingungen. Zur Beeinflussung von Menschenmassen eignet es sich nicht. Um die Kluft zwischen Hype und Realität zu erfassen, muss man sich näher mit der Technik des neurobiologischen »Gedankenlesens« befassen. Und man muss verstehen, was das eigentlich ist: ein Gedanke. Einer derjenigen, die darüber am besten Auskunft geben können, ist JohnDylan Haynes. Der deutschbritische Hirnforscher sitzt in Berlin in einer frisch renovierten Baracke, die sich etwas hochtrabend Bernstein Center for Computational Neuroscience nennt, und ist derzeit einer der erfolgreichsten »Gedankenleser«. Wenn er von seiner Arbeit erzählt, klingt es, als berichte er aus der kriminologischen Fahndung. »Unseren Erfolg verdanken wir vor allem der neuronalen Mustererkennung«, sagt der 38-Jährige und erklärt, dass er – ähnlich wie beim Vergleich von Fingerabdrücken – mithilfe mathematischer Algorithmen nach charakteristischen Merkmalen im Kopf suche. 42 Die Welt im Kopf Die verbreitete Vorstellung, es gebe für jeden Gedanken, für jede Emotion ein spezifisches Hirnareal – etwa eines für Angst, eines für Lust und eines für die Vorfreude aufs Wochenende –, ist viel zu schlicht. Denken ist Arbeitsteilung: Beim Zeitunglesen etwa verarbeiten manche Hirnareale nur Schwarz-Weiß-Kontraste, andere setzen daraus Buchstaben zusammen, wieder andere bilden daraus Wörter, entschlüsseln deren Sinn und vergleichen sie mit abgespeicherten Erfahrungen. So erzeugt jede Denktätigkeit ein neuronales Feuerwerk, das sich über das ganze Gehirn verteilt und im Kernspintomografen sichtbar gemacht werden kann. »Entscheidend ist, dass einzelne Gedanken ein Muster erzeugen, das so charakteristisch ist wie ein Fingerabdruck; das nennen wir ein neuronales Korrelat«, erklärt Haynes. Ähnlich wie eine Silvesterrakete typische Leuchtspuren an den Himmel zeichnet, hinterlässt ein Gedanke eine charakteristische Spur im neuronalen Feuerwerk. Und das kann man also entschlüsseln? »Im Prinzip ja«, sagt Haynes. »Allerdings gelingt es bislang nur in sehr einfachen Fällen – etwa bei einer Entscheidung zwischen plus und minus.« Der Arzt und Anatom Franz Joseph Gall versuchte, aus der Anatomie des Schädels Persönlichkeitsmerkmale abzuleiten. Die von ihm begründete Phrenologie erlebte Anfang des 19. Jahrhunderts in Europa einen Höhepunkt. Wunderwerk Gehirn 43 Das »neuronale Korrelat«, das die Hirnforscher beobachten, ist eben etwas anderes als das, was wir landläufig »Gedanken« nennen. Diese sind komplexe Gebilde, die viel Vorwissen und Bewertungen ent­hal­ten (»Liebt sie mich?«), das neuronale Korrelat dagegen ist das geronnene biologische Abbild einer Wahl zwischen zwei (meist sehr schlichten) Alternativen. Dass sich die Neurowissenschaftler mit so simplen Gedankenfetzen zufriedengeben müssen, liegt zum einen an der Begrenzung der Technik, zum anderen an der hyperkomplexen Struktur des Gehirns. Jede einzelne Nervenzelle ist dort mit etwa zehntausend anderen Neuronen vernetzt, jeder Impuls führt zu komplexen Kettenreaktionen und Wechselwirkungen im Hirn, die auf den Bildern aus dem Kernspintomografen vielleicht schön anzusehen sind, welche die Neurowissenschaft aber längst nicht verstanden hat. Auch deshalb dämpft Haynes allzu große Euphorie. »Die heutigen Ansätze beruhen darauf, dass man zunächst das Muster der Hirnaktivität kennen muss, das zu einem bestimmten Gedanken gehört.« Und dieses Muster unterscheide sich nun einmal von Mensch zu Mensch. Zwar Lügen entdecken, seien grundlegende Hirnaktivitäten bei geheime Sehnsüchte allen Menschen ähnlich (etwa wenn sie sichtbar machen – die Hirnscans Gesichter oder Buchstaben wahrnehmen); versprechen viel. doch sobald es um komplexere DenkproBisher offenbaren sie jedoch zesse gehe, bekomme man es mit einer wenig Verlässliches. ungeheuren individuellen Variabilität zu tun. »Wie man beliebige Gedanken einer beliebigen Person auslesen könnte, ist heute nicht geklärt«, stellt Haynes fest. Auch sei es noch niemandem gelungen, mehrere gleichzeitige Gedanken zu entschlüsseln. Das wäre, als hörte jemand aus dem großen Finale eines Silvesterfeuerwerks die einzelnen Knallkörper heraus. Einzelne Affekte, Emotionen oder Neigungen hingegen glauben manche Forscher durchaus im Hirn­scan­ner zu erkennen. Sexualmediziner der Universität Kiel zeigten zum Beispiel h ­ etero- und homosexuellen Versuchspersonen Fotos von erregten weiblichen und männlichen Genitalien. Bilder des jeweils bevorzugten Geschlechts aktivierten zwei Hirnareale besonders, eines davon lag mitten im prämotorischen Kortex, der Hand- und Mundbewegungen steuert. Für die Forscher ein klarer Hinweis auf die sexuelle Neigung. Auf zwei ganz ähnliche Studien berufen sich Firmen wie No Lie MRI oder Cephos. Daniel Langleben von der University of Pennsylvania und Andrew Kozel von der Medical University of South Carolina baten Probanden im Kernspintomografen zu lügen – in einem Fall sollten sie den Diebstahl eines Rings oder einer Uhr leugnen, im anderen bestreiten, dass sie eine bestimmte Spielkarte 44 Die Welt im Kopf besitzen. Beim Lügen fanden die Forscher charakteristische Muster auf den Hirn­ scans der Probanden, die Flunkereien im Labor konnten sie mit 90-prozentiger Sicherheit und mehr voraussagen. Dass es nicht 100 Prozent waren, wird auf der Website von No Lie MRI geflissentlich verschwiegen. Dort ist ein Gehirn mit blauen und roten Aktivitätsflecken zu sehen. Daneben steht schlicht: »Blau = Wahrheit, Rot = Lüge«. »Warum die Gehirne so reagieren, weiß niemand«, sagt Cephos-Gründer Steven Laken, »im Prinzip ist das auch egal, Hauptsache, es funktioniert.« Damit meint er wohl auch sein Geschäftsmodell. Zu seinem schillernden Kundenkreis gehören: ein Trinker, der seinen Führerschein verloren hat; ein Vater, der sich gegen den Vorwurf wehrt, er habe sich an seiner Tochter vergangen; und eben der wegen Mordes verurteilte Ben Gower. Sie alle wollen mithilfe der Hirn­scans ihre Unschuld beweisen. Wer Steven Lakens Dienste in Anspruch nimmt, muss zunächst einige Tausend Dollar überweisen und sich dann in einem flachen Betonbau an einer Landstraße bei Boston einer mehrstündigen Untersuchung unterziehen. Erst testet Laken den Urin seiner Klienten auf Drogen, dann legt er sie in den Hirn­ scan­ner und spult Hunderte Fragen ab. Der Mühe Lohn: ein dicker Report voller Abbildungen, mit dem sie nun versuchen können, Richter, Chefs oder Ehefrauen zu überzeugen. »Der Markt ist riesig«, schwärmt Laken. »In unserem Rechtssystem werden so viele unschuldig verurteilt, wir geben ihnen die Chance, sich zu ­rehabilitieren.« Die meisten von Lakens Kollegen zweifeln allerdings an der Seriosität seines Angebots. Unbehagen kommt bereits auf, wenn man nur die beiden Studien von Kozel und Langleben vergleicht: Denn sie haben ganz unterschiedliche Lügenmuster im Gehirn identifiziert. Liegt das daran, dass es einmal um Ringe, das andere Mal um Spielkarten ging? Jedenfalls zeigt sich schon hier, dass es »die Lüge« pauschal nicht gibt; erst recht kein Lügenzentrum im Hirn. Noch schwieriger ist es, die Laborergebnisse auf die Praxis zu übertragen. Was, wenn ein Verdächtiger als Kind durch einen Hundeangriff traumatisiert wurde und später im Verhör auf eine Situation angesprochen wird, in der ein Hund eine Rolle spielt? »Gut möglich, dass dann die Erregung in seinem Gehirn vom Muster einer Lüge nur schwer zu unterscheiden ist«, sagt Andreas Bauer, Neurowissenschaftler am Forschungszentrum Jülich. Und was, wenn ein Schuldiger von seiner Unschuld selbst überzeugt ist? Dann kann es gut sein, dass sein Hirn auch falsche Aussagen als wahr verarbeitet. »Das menschliche Gedächtnis verformt sich innerhalb weniger Tage«, erläutert Bauer, »wie will man da eventuell Jahre später vor Gericht feststellen, was wirklich wahr oder falsch ist?« Die Versprechungen der Lügendetektorfirmen seien daher weit überzogen. »Sie jagen einem Phantom nach.« Dennoch entfalten die bunten Bilder aus dem Kernspintomografen bereits eine Wirkung, die kaum zu unterschätzen ist. Vor allem amerikanische Wunderwerk Gehirn 45 Geschworene lassen sich leicht davon beeindrucken, wie clevere Anwälte seit den neunziger Jahren wissen. Damals wurde der Fall eines 65-Jährigen aus Manhattan verhandelt, der seine Frau erdrosselt und ihre Leiche aus dem zwölften Stock eines Wohnhauses geworfen hatte. Der Verteidiger argumentierte mithilfe eines Hirn­scans, sein Mandant sei nicht schuldfähig, da eine Zyste in seinem Hirn wuchere. Und obwohl ein Gutachter bestätigte, dass noch nicht erforscht sei, wie zuverlässig bildgebende Verfahren sind, ging die Taktik auf: Weil die Ankläger fürchteten, die Jury könne sich von den Bildern beeinflussen lassen, boten sie dem Angeklagten einen Deal an – sie verzichteten darauf, die Todesstrafe zu fordern, wenn er sich schuldig bekenne. In Deutschland hat der Bundesgerichtshof 1998 die bis dahin geltende Rechtslage zu Lügendetektortests revidiert und geurteilt: Diese verstoßen nicht gegen die Grundrechte eines Beschuldigten, sofern dieser selbst einwilligt. Zugleich stellten die Richter fest, dass herkömmliche »Polygrafen« zur Messung von Hautleitfähigkeit, Puls und Atemfrequenz als Beweismittel zu unzuverlässig seien. Damit wäre aber prinzipiell der Einsatz neuer, besserer Lügendetektoren erlaubt. Ohnehin betrifft das Urteil nur Strafprozesse, nicht aber das Sozial- oder Arbeitsrecht. Schneller, als es uns lieb ist, könnte der erste Konzern auf die Idee kommen, seine Bewerber im Hirn­scan­ner zu untersuchen, um festzustellen, wie loyal sie sind, welche Einstellungen oder auch welche sexuelle Neigung sie haben. Kann man von Arbeitgebern erwarten, dass sie darüber nachdenken, wie valide solche Ergebnisse sind? Wohl kaum. Es zählt der Glaube an die Aussagekraft der bunten Bilder. Wie groß die psychologische Wirkung von Hirn­scans ist, hat die Psychologin Deena Skolnick Weisberg eindrucksvoll belegt. An der Yale University präsentierte sie drei Gruppen von Probanden – Hirnforschern, Neurologiestudenten und Laien – wissenschaftliche Erklärungen für psychologische Phänomene, von denen manche richtig, andere falsch waren. Dabei zeigte sich: Wenn Weisberg den jeweiligen Erklärungen den Halbsatz »Hirn­scans zeigen, dass ...« voranstellte, akzeptierten die Studenten und die Laien selbst offenkundigen Unsinn. Auch das »Neuromarketing« lebt mehr vom Glauben an die Hirnforschung denn von ihrer Leistungsfähigkeit. Zu besichtigen war dies kürzlich bei einem Kongress über »Erfolgsstrategien aus Sicht des Gehirns« in München. Mehrere Hundert Werbefachleute lauschten in der BMW-Welt im Olympiapark zwischen edlen Autos, bei Häppchen und gedämpfter Musik pseudowissenschaftlichen Vorträgen über »Brain Brands« und »Emotional Boosting«. »Die Werte«, so dozierte etwa der Tagungsorganisator Hans-Georg Häusel, »sitzen im orbitopräfrontalen Kortex.« Daran lasse sich ablesen, zu welchem »Brain Type« ein Kunde gehöre und wie man ihn zum Kauf verführe. Auch Manipulationsversuche wie jener der Tübinger Forscher stoßen im Publikum auf offene Ohren. Hauptsache, das Geschäft brummt. Am Ende liefen die Ratschläge der Neuromarketing-Experten allerdings auf altbekannte verkaufspsychologische Weisheiten hinaus – garniert mit Respekt 46 Die Welt im Kopf Womit man das Denken belauscht Ein Elektroenzephalograf (EEG) misst mit Elektroden Hirnströme durch die Kopfhaut hindurch. Der Beobachter bekommt von der Neuronen-Kommunikation etwa so viel mit wie von einem Fußballspiel, das er von oben belauscht – er erfährt etwas über die Stimmung im Stadion. Der Kernspintomograf macht Veränderungen des Sauerstoffgehaltes im Blut sichtbar. Die Theorie: Wo sauerstoffreiches Blut fließt, ist das Gehirn besonders aktiv. Die Denkprozesse verfolgt man so nur indirekt – als würde man eine Anzeigetafel mit dem Spielstand betrachten. Hirnimplantate zapfen einige Dutzend oder Hundert Nervenzellen an. Sie liefern Informationen aus einem winzigen Teil des Gehirns. Das ist etwa so, als beobachte man einige Sitzreihen in der Nordkurve genauer – über all die anderen Zuschauer erfährt man hingegen nichts. heischenden Bildern aus dem Kernspintomografen: etwa dass man bei der Präsentation eines Produktes starke Emotionen erzeugen müsse (denn Emotionen prägen das Hirn stärker als rationale Argumente); oder dass man möglichst viele Sinne gleichzeitig ansprechen müsse (damit werde das Gehirn besonders aktiviert). Als wissenschaftliches Feigenblatt hatte man Christian Elger geladen, immerhin Wunderwerk Gehirn 47 Direktor der Klinik für Epileptologie am Uni-Klinikum Bonn. Doch statt, wie angekündigt, über »Einblicke ins Kundenhirn« zu referieren, las er den Neuro-Werbern die Leviten. Die Forschung liefere bislang »keinen Beleg für die Gültigkeit der Marketingkonzepte«. Elger zählte lauter Gründe auf, warum die Kernspinbilder heillos überschätzt würden, und wetterte: »Auf diesem Niveau würde keine einzige Medikamentenstudie akzeptiert werden.« So ganz wollte er allerdings die Tür doch nicht zuschlagen. Schließlich ist Elger auch Geschäftsführer einer Life & Brain GmbH und bringt selbst Bücher über Neuroleadership und Neurofinance unters Volk. So vollführte er am Ende eine irritierende Kehrtwende und prophezeite der Disziplin doch noch eine »große Zukunft« – auch wenn sie jetzt noch »ganz am Anfang« stehe. Es stimmt ja auch, die Untersuchungsmethoden werden feiner, die Geräte leistungsfähiger. Im Frühjahr wurde am Forschungszentrum Jülich einer der stärksten Kernspintomografen der Welt in Betrieb genommen, der 9komma4, der das Gehirn noch genauer abbildet. Mit solchen Apparaten wird auch die Mustererkennung Fortschritte machen – und damit die Entschlüsselung von Denkprozessen. Fürchten muss man sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings weniger vor dem Gedankenlesen oder einer gezielten Beeinflussung; gefährlich sind eher die falschen Erwartungen, welche die Hirnforschung weckt. Wenn Geschworenen­gerichte oder Arbeitgeber sich von bunten Bildern beeindrucken lassen, entstehen handfeste Gefahren für die Untersuchten – ganz ungeachtet der wissenschaftlichen Belastbarkeit. Zugleich wächst der normative Druck auf Angeklagte oder Bewerber, sich einem Hirn­scan nicht zu widersetzen. Deshalb forderte der Bonner Jurist Tade Matthias Spranger Ende Mai bei einer Sitzung des Deutschen Ethikrats dringend eine interdisziplinäre Debatte. So muss man fragen: Wie kann man Arbeitnehmer und Angeklagte vor einer missbräuchlichen Verwendung ihrer Hirn­scans schützen, etwa für Eignungs- oder Gesinnungstests? Wer erklärt Patienten und Probanden, was die bunten Bilder für ihr Leben bedeuten? Wie steht es mit dem Zugriff etwa von Versicherungen auf Untersuchungsdaten aus den Neurolaboren? Vor wenigen Wochen hat der Deutsche Bundestag das sogenannte Gendiagnostikgesetz beschlossen, das im Falle von genetischen Daten solchem Missbrauch einen Riegel vorschieben soll. Es wird Zeit, sich auch über ein entsprechendes »Hirndiagnostikgesetz« Gedanken zu machen. von Ulrich Schnabel und Jens Uehlecke aus der ZEIT Nr. 28/2009 Alle für einen! Ohne die anderen wäre der Mensch nicht, was er ist. Der Drang zum Miteinander ist tief in seinem Gehirn verankert. Ein neuronales Netz ermöglicht es ihm, sich in andere einzufühlen – es kann ihn aber auch zum willenlosen Mitläufer machen Er und sie und es sind ich. Kein Handgriff, kein Gedanke, kein Wort funktioniert ohne die anderen, ohne die Welt da draußen. Menschen lernen zu lächeln, wenn sie andere lächeln sehen. Sie lernen zu sprechen, wenn sie andere sprechen hören. Und sie lernen, was richtig und was falsch ist, wenn andere auf ihr Verhalten reagieren. Selbst der überzeugte Einzelgänger wäre ohne Eltern und Kollegen nicht derselbe Mensch. Wie sehr der Einzelne mit seinem so­zia­len Umfeld verbunden ist, überrascht immer wieder auch die, die das menschliche Miteinander untersuchen: Primatenforscher, Psychologen und Neu­ro­wis­sen­schaft­ler. Immer deutlicher wird, wie eng Körper und Geist im sozialen Netz verwoben sind. Ist es sicher gespannt, hält es Herz, Kreislauf und Immunsystem fit. Der Mensch lebt länger, sein Gedächtnis funktioniert besser, und er ist zufriedener. Das Bedürfnis nach Kontakt zu anderen sei in uns angelegt, schreibt der Psychologe Daniel Goleman in seinem Buch Soziale Intelligenz. Das haben vor allem die Studien der sozialen Neurowissenschaft gezeigt. Sie sucht nach den Grundlagen des menschlichen Gemeinsinns und fördert immer mehr über jenes System zutage, das unserer Fähigkeit zu Kooperation und Einfühlung zugrunde liegt. »Es ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen zehn Jahre, dass ein gro­ßer Teil unseres Gehirns auf die Verarbeitung sozialer Reize ausgerichtet ist«, sagt Christian Keysers, Hirnforscher am Neuro­imaging Center im niederländischen Groningen. Wie er sind viele Forscher inzwischen überzeugt: Diese neuronalen Schaltkreise bilden ein »soziales Gehirn«, das viel mächtiger ist, als man es lange für möglich hielt. An jedem Blick, den wir austauschen, an jedem Schritt, den wir machen, ist es beteiligt. Es registriert feinste Nuancen in Mimik und Tonfall des Gegenübers, sagt in­tui­tiv dessen nächste Handlung voraus und braucht nur selten die Hilfe des bewussten Denkens, um klug zu reagieren. Rücksicht und Mitgefühl sind im Hirn verdrahtet Wie wichtig diese Fähigkeit für das Leben in der Gruppe ist, zeigen Untersuchungen an Rhesusaffen, denen ein Teil dieses so­zia­len Gehirns fehlt. Die Forscher waren nicht zimperlich: Sie entfernten den Äffchen wichtige Teile des 48 Die Welt im Kopf Wunderwerk Gehirn 49 Frontalhirns, darunter die Mandelkerne, die auch bei Menschen zur emotionalen Frühwarnzentrale gehören. Die Tiere mutierten zu asozialen Rüpeln. Sie ignorierten die Regeln der Grup­pe, stopften mit gefundenem Fressen nur ihr eigenes Maul und waren sexuell enthemmt. Die Strafe blieb nicht lange aus: Die Un­ ruhe­stif­ter wurden von ihrer Gruppe verstoßen oder sogar getötet. Die verheerende Wirkung solcher Hirnverletzungen ist auch am Menschen erforscht. Patienten mit Schäden an bestimmten Arealen des Frontalhirns werden aus der Mimik ihrer Mitmenschen nicht mehr schlau. Menschen mit Verletzungen der sogenannten Insula, eines Bereichs in der Großhirnrinde, verlieren nicht nur jedes Ekelgefühl, sie verstehen auch den angewiderten Gesichtsausdruck anderer nicht mehr als Warnsignal – und greifen beherzt nach allem, was dem Gegenüber heftigen Würgereiz beschert. Und Patienten mit dem Williams-Beuren-Syndrom, einer seltenen Erbkrankheit, sind offenbar deshalb besonders vertrauensselig, weil ihre Mandelkerne nur wenig funken. Schon als Klein­k inder fremdeln sie kaum. Woher jedoch das Gespür kommt, das uns im Dickicht möglicher Reaktionen und Motive der Mitmenschen den Weg weist, Wortloses blieb lange ein Rätsel. Der Psychologe Verstehen, Empathie, Edward Lee Thorndike definierte 1920 Hilfsbereitschaft – soziale Intelligenz als die Fähigkeit, »in für viele Segnungen der Beziehungen klug zu handeln«. Viele menschlichen Kultur sollen Kollegen glaubten, diese Gabe sei im die Spiegelneuronen bewussten Denken begründet, das mitverantwortlich sein. hilfe früherer Erfahrungen die richtigen Schlüsse ziehe: Wer oft gesehen habe, dass sich unsichere Menschen am Kopf kratzen, gehe davon aus, dass ein Mensch, der sich am Kopf kratzt, unsicher ist. Anfang der neunziger Jahre kam diese Interpretation sozialer Intelligenz ins Wanken. Die italienischen Hirnforscher Giacomo Rizzolatti und Vittorio Gallese machten eine Entdeckung, die eine viel direktere Brücke zwischen dem Ich und den anderen schlägt: die Spiegelneuronen. Ganz gleich, ob die Affen in den italienischen Versuchslabors nach ihrem Futter griffen oder ob sie nur einen Artgenossen dabei beobachteten – immer waren dieselben Nervenfasern der vorderen Großhirnrinde aktiv. In den folgenden Jahren fanden die Italiener und ihre internationalen Kollegen Hinweise darauf, dass es die Spiegelneuronen auch im menschlichen Gehirn gibt. Und zwar nicht nur in den Arealen für das Erkennen von Bewegungsabläufen, sondern auch in jenen für die Verarbeitung von Seh-, Hör- und Tastreizen und in jenen für Ekel. »Das alles verändert unsere Vorstellung davon, wie unser Gehirn die so­zia­le Welt verarbeitet, natürlich grundlegend«, sagt 50 Die Welt im Kopf Christian Keysers. »Das da draußen ist eben nicht getrennt von mir, sondern etwas, das mir ähnelt, das ich direkt auf mich übertrage und nachempfinde.« Das heißt: Wer sieht, dass sich ein anderer am Kopf kratzt, weiß bereits, dass er unsicher ist – ohne überhaupt darüber nachzudenken. Auf den Schultern von Giganten Die Spiegelneuronen könnten eine Erklärung für die kleinen Wunder bieten, die sich im täglichen Miteinander ereignen: für wort­loses Verstehen, für Empathie und selbstlose Hilfsbereitschaft. Ohne derlei bio­lo­gi­sche Zusammenhänge zu kennen, beschrieb der Psychologe Theodor Lipps bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts Einfühlungsvermögen als innere Nachahmung der Gefühle anderer. Mehr als 100 Jahre später zeigt die moderne Wissenschaft, wie recht er hatte. Die Spiegelneuronen könnten so auch einen entscheidenden Beitrag zur Evo­lu­tion der menschlichen Kultur geleistet haben. Denn sie haben es den Menschen schon früh leicht gemacht, sich als einander ähnliche Wesen zu verstehen. Diese Vorstellung von dem, was im Kopf der anderen geschieht, die »Theory of Mind«, entwickeln Kinder etwa im vierten Lebensjahr. Untersucht wird sie mit der sogenannten Maxi-Aufgabe. Dazu spielen Forscher den Kindern ein Puppentheater vor. Die Figur Maxi legt ein Stück Schokolade in einen Schrank und verschwindet dann »auf den Spielplatz«. Währenddessen versteckt ihre Mutter die Schokolade in einer Schublade. Anschließend kommt Maxi zurück. Die Kinder, die all das beobachtet haben, sollen nun beantworten: Wird Maxi die Schokolade im Schrank oder in der Schublade suchen? Fast alle Kinder unter drei Jahren rufen noch falsch: »In der Schublade!« Sie können noch nicht zwischen Maxis Wissen und ihrem eigenen unterscheiden. Mit jedem weiteren Lebensmonat sinkt die Quote jedoch rapide: Schon die Hälfte der Vier- bis Fünfjährigen weiß, dass Maxi im Schrank suchen wird, sie können Maxis Denken nachvollziehen. Sechs- bis Siebenjährige sind kaum noch verwirrt. »Dieses Verständnis ermöglicht es ihnen, sich in die geistige Welt einer anderen Person hineinzuversetzen, sodass sie nicht nur vom anderen, sondern auch durch den anderen lernen können«, schreibt Michael Tomasello vom MaxPlanck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Wer durch bloßes Beobachten bereits die Hirnareale aktivieren kann, die zum Hausbau oder Fischfang nötig sind, lernt viel nebenbei. Er braucht in der Praxis nur noch ein bisschen Übung – und hat mehr Zeit für eigene Ideen und Innovationen. Erst diese Fähigkeit, kulturelles Wissen zu erschließen und aus der Erfahrung vieler Generationen zu lernen, ermöglicht dem Einzelnen Weitblick und Orientierung, als stände er, wie Isaac Newton gesagt haben soll, »auf den Schultern von Giganten«. Doch das tief verankerte Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu sein, hat auch eine dunkle Seite. Es ermöglicht nicht nur Ko­ope­ra­tion, sondern auch falsche Folgsamkeit, blinden Gehorsam und Machtmissbrauch. Die Forschung zur Wunderwerk Gehirn 51 Gruppendynamik lehrt, dem sozialen Instinkt zu misstrauen. Einige Vertreter dieser Disziplin hatten als Opfer des nationalsozialistischen Regimes erlebt, was erst durch die wechselseitigen Einflüsse zwischen Machthabern, Machern und Mitläufern möglich wurde – und aus normalen Menschen die braune Masse machte. Wie sehr sich der Einzelne durch das Er und Sie und Es beeinflussen lässt, zeigt ein Experiment des amerikanischen Sozialpsychologen Solomon Asch. Er legte einer vierköpfigen Gruppe Karten vor, auf denen unterschiedlich lange Geraden zu sehen waren. Die Teilnehmer sollten sich nun auf die längste Gerade einigen. Allerdings gab es nur einen wirklichen Probanden in der Runde – die drei übrigen Mitglieder waren Mitarbeiter von Asch. Wenn diese nun eine eindeutig falsche Lösung wählten, beobachtete Asch Erstaunliches: Der vierte, echte Proband schloss sich der Mehrheit in jedem dritten Fall an. Eine ganz ähnliche Nebenwirkung des sozialen Gehirns beobachtete Muzafer Sherif. Er forderte Versuchsteilnehmer auf, sich auf die Bewegungsrichtung eines Lichtpunkts im Versuchsraum zu einigen. Nach einem kurzen Prozess der Meinungsbildung kamen sie zu einer Entscheidung. Nur hatte Sherif sie auf die falsche Fährte gesetzt, der Punkt bewegte sich in Wirklichkeit keinen Millimeter vom Fleck – das vermeintliche Wandern war nur eine Sinnestäuschung. Die Probanden aber hatten sich in kürzester Zeit von einer »eindeutigen« Bewegungsrichtung überzeugt. Allerdings gibt es auch For­schungs­ergeb­nis­se, die zeigen, dass der Einzelne nicht nur der Gruppe ausgeliefert ist. Ihnen zufolge lohnt es sich eben doch, die eigene Meinung auf vermeintlich verlorenem Posten kundzutun. Der Sozialpsychologe Serge Moscovici, der die Schrecken des N­a zi­regimes in einem rumänischen Arbeitslager miterlebt hatte, schleuste zwei Mitarbeiter in eine Versuchsgruppe ein, deren Teilnehmer die Farbe von Karten benennen sollten. Diese beiden behaupteten von jeder grünen Karte, sie sei blau. Auf die Überzeugung der Gruppe, eine grüne Karte gesehen zu haben, hatte das zwar keinen Einfluss. Aber als Moscovici anschließend die einzelnen Probanden noch einmal befragte, stellte er fest, dass sich deren Farbwahrnehmung ein klein wenig verändert hatte: Sie ordneten Grüntöne mit Blaustich nun eher als Blau ein als zuvor. Das soziale Gehirn nutzt seine Sinne also auch, um die Stimmen derjenigen einzufangen, die außerhalb der Gruppe stehen. Sie provozieren ein Umdenken bei der Mehrheit. Und das führt, auch das haben die Forscher oft bestätigt, zu kreativeren und besser durchdachten Gruppenentscheidungen – und ist damit eine wichtige Voraussetzung für Weiterentwicklung und Innovation. Das soziale Gehirn macht Menschen zu Folterknechten Allerdings scheint der Gedanke des Einzelnen seine Wirkung zu verlieren, sobald ausgeprägte Hierarchien ins Spiel kommen. Die meisten Menschen verlieren spätestens unter der Aufsicht einer dominanten Führungsperson den Mut zum eigenen Standpunkt. Am eindrucksvollsten haben das in den sechziger und siebziger 52 Die Welt im Kopf Jahren des vorigen Jahrhunderts die Stromstoß-Studien des amerikanischen Sozialpsychologen Stanley Milgram bewiesen. Mehr als 3000 Menschen haben an dem nach ihm benannten Experiment teilgenommen, die Ergebnisse erschrecken. Milgram hatte den Probanden erklärt, er wolle untersuchen, wie sehr körperliche Bestrafung das Lernen beeinflusse. Dazu solle ein »Schüler« im Nebenraum Wortpaare richtig ergänzen, und sie selbst hätten den Part des strafenden Lehrers zu übernehmen, der jeden Fehler mit immer stärkeren Stromstößen quittiert. Und das taten sie. Zumindest, solange sie unter der Aufsicht des strengen Versuchsleiters standen. Ein mahnendes »Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen« oder »Bitte fahren Sie fort« genügte, um zwei Drittel aller Teilnehmer bis zur tödlichen Schockstufe aufdrehen zu lassen. Selbst als die »Lehrer« ihren »Schüler« (der in Wirklichkeit ein Schauspieler war) im Nebenraum schreien und schließlich verstummen hörten, blieben 62 Prozent der Probanden bis zur höchsten Stufe von 405 Volt folgsam. Verließ der Studienleiter jedoch den Raum, gehorchte augenblicklich nur noch jeder fünfte »Lehrer«. Gab es beisitzende »Lehrer«, die gegen das Prozedere protestierten, war sogar nur noch jeder Zehnte bereit, die grausamen Befehle des Versuchsleiters auszuführen. Wie sich der Führungsstil darauf auswirkt, wie gut unser sozialer Geist funktioniert, hat der Sozialpsychologe Kurt Lewin untersucht. Was er herausfand, passt zu den Milgram-Ergebnissen: Wer unter autokratischer Anleitung arbeitet, zeigt unbedingten Einsatz und Gehorsam – allerdings nur, solange sein Chef anwesend ist. Sobald dieser den Raum verlässt, verfallen die Untergebenen dem unselbstständigen Nichtstun, der Feindseligkeit und der Suche nach Sündenböcken. Weniger aggressiv, aber für einen produktiven Arbeitsablauf ähnlich unbrauchbar verhalten sich Menschen, die nach dem Motto »Laissez faire« geführt werden: Sie entwickeln sich zu unmotivierten Faulpelzen. Nur wenn Leitungspersonen ihre Leute demokratisch, das heißt unter Einbeziehung aller Interessen anleiten, laufen Gruppenmitglieder zur Höchstform auf: Sie leisten am meisten, sind einfallsreich, offen, loyal, freundlich und unterstützen sich gegenseitig. Das soziale Gehirn entfaltet seine Fähigkeiten also erst in der richtigen Umgebung. »Zwar ist die Neigung zu Zorn, Eifersucht, Egoismus und Neid im biologischen Erbe der Menschen ebenso angelegt wie ihre Bereitschaft, grob, aggressiv, gewalttätig zu sein«, sagt der amerikanische Psychologe Jerome Kagan. Doch trügen sie ein noch stärkeres Erbe für Freundlichkeit, Mitgefühl, Kooperation, Liebe und Hilfsbereitschaft in sich. »Dieser ethische Imperativ«, so Kagan, »gehört zur biologischen Ausstattung unserer Art.« von Katharina Kluin aus ZEIT Wissen Nr. 6/2007 Wunderwerk Gehirn 53 Bauteile für die Seele Mit Chips und Sonden reparieren Mediziner Psycholeiden direkt im Hirn. Ist der Geist bloß Biologie? Ein Mann in einem Klinikbett, frisch operiert. »Wie fühlen Sie sich?«, fragt eine Stimme. »Ach, erleichtert«, sagt der Mann. Dann, nach einigen Sekunden, lacht er. »Warum lachen Sie?«, fragt die Stimme. Der Patient schüttelt den Kopf. Er weiß es nicht. Er lacht, ist fröhlich. Und lacht lauter. Diesmal klingt es schrill. »Da war er schon überstimuliert«, murmelt Volker Sturm und klickt den Film vom Bildschirm. Der Patient ist unheilbar depressiv. Seit der Neurochirurg Sturm ihn operiert hat, stecken zwei Elektroden tief in seinem Hirn. Der Film zeigt den ersten Moment der Freude in seinem Leben seit vielen Jahren, die Minuten, in denen die Ärzte Strom auf die Elektroden leiteten. Fünf, höchstens zehn Volt, 130 Hertz. Das reicht, um die Seele umzukrempeln. Ein winziger Strom, und aus Tristesse wird Freude, Apathie verwandelt sich in Zuversicht. Der Elektronenfluss kann Ängste beseitigen oder Panik auslösen, Lust spenden, Ekel, Euphorie oder Zorn er­zeugen. Erprobt und entwickelt wurde die Elektrodentechnik der Tiefenhirnstimu­lation (DBS, Deep Brain Stimulation) in den neunziger Jahren, als Behandlungsverfahren für schwer kranke Parkin­son-­Patienten. Millimetergenau werden hauch­dünne Elektroden in bestimmte neuronale Kerngebiete tief unter der Großhirnrinde vorgeschoben. Das Implantat heilt die Erkrankung nicht, doch der Stromfluss kann die schweren Bewegungsstörungen der Kranken unter­drücken. Längst ist offenkundig, dass das Hirn dem Impulsmuster der Elektroden nicht nur bei der Steuerung motorischer Funktionen gehorcht. Die Neuro­ elektronik kann auch die Triebkräfte der Menschenseele gängeln: Stimmungen, Gefühle, auch übermächtige Emotionen entspringen einem speziellen Hirnareal, dem limbischen System. Je nach Platzierung lassen sich ganze Nervennetze steuern. Aber ist es erlaubt, die Psyche, selbst wenn sie krank ist, elektronisch zu lenken? Volker Sturm stellt sich diese Frage seit Jahren. Nur als Ultima Ratio seien solche Eingriffe in das Innerste des Menschen zu rechtfertigen, sagt der Direktor der Klinik für Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie am Kölner Uniklinikum. Doch in vielen Fällen sei der Eingriff sogar ethisch geboten. »Es gibt Patienten, die so leiden, dass es menschenfeindlich wäre, ihnen die Elektrode zu verweigern.« Mehr als zwei Dutzend Menschen hat Sturm Elektroden ins Hirn gepflanzt. Die Heilmacht der Psychosonde erprobt der Neurochirurg, zusammen mit Kollegen in Köln, Bonn und Magdeburg, bei Menschen mit schwe­ ren 54 Die Welt im Kopf Depressionen, Zwangsstörungen und bei Patienten mit Tourette-Syndrom. Seit Neuestem zählen auch schwe­re Alkoholiker zu seinen Patienten. Die Ergebnisse, beteuert Sturm, seien bei Angststörungen und Zwangsneurosen »erstaunlich gut«. Allerdings unterdrückt die Tiefenhirnstimulation die Symptome nur, DBS ist daher eine Dauerbehandlung. Immerhin, so zeigen die Erfahrungen, hat die Stimulation im jahrelangen Einsatz kaum Nebenwirkungen. Nur wenige Kliniken wagen sich an das heikle Verfahren. Die Neuropsychiaterin Helen Mayberg von der Emory University in Atlanta präsentierte erst vor zwei Jahren ihren Bericht über die Behandlung von sechs schwer Depressiven im Fachblatt Neuron. Bei vier der Patienten habe man »eine erstaunliche und anhaltende Remission« der Symptome erreicht. Der Neurochirurg Bart Nuttin von der Katholischen Universität Leuwen gilt als Pionier der Behandlung schwerer Zwangsneurosen. Operiert werden indessen nur Patienten, die seit Jahren krank sind und bei denen alle herkömmlichen Therapien versagten. Bedenklicher erscheint ein Experiment mit der Tiefenhirnstimulation, das New Yorker Mediziner Anfang August in Nature präsentierten. Einem 38‑Jährigen, der seit sechs Jahren im Wachkoma lag, wurden die DBS-Elektroden in den Thalamus vorgeschoben. Nach der Behandlung erlangte der Patient partiell das Bewusstsein zurück. Der Mann, berichten die Ärzte, könne mit wenigen Worten auf Fragen antworten, nach einer Tasse greifen und selbsttätig schlucken. Sturm kritisiert den Versuch heftig – auch aus eigener Erfahrung. Er selbst hatte 1979 ein ähnliches Experiment gewagt und bereut es bis heute. Man verwandle dabei einen bewusstlosen Schwerstbehinderten nur in einen Schwerstbehinderten, der sich über seine Situation klar sei: »Das ist unethisch.« Der Versuch – in Nature unter der Schlagzeile An Awakening gefeiert – demonstriert, mit welcher Macht Erkenntnisse der Neurowissenschaft bereits jetzt eingesetzt werden können. Denn der Thalamus im Mittelhirn reguliert nicht nur Schlaf und Erwachen, er dient als Eintrittspforte ins Großhirn. Er filtert alle äußeren Informationen und vermittelt sie höheren Hirnzentren, wodurch sie zu bewusstem Erleben werden. Mit Elektrodenimplantaten im Thalamus rüttelt die Neurotechnik am Tor zum Ich. Die Neurochirurgen Im neuen Gewand steht die einst schieben ihre Drähte tief ins wegen ihrer schrecklichen Folgen in Gehirn vor. Mit ihnen Misskredit geratene Psychochirurgie können sie Komapatienten vor einer Renaissance. Ein neues Zeiterwecken und alter sehen manche Beobachter heraufDepressionen lindern. dämmern: Neuro-Enhancement, das Tunen von Psyche, Gedächtnis und Intellekt, werde bald alltäglich sein. Sobald ihre Ungefährlichkeit erwiesen sei, so lautet die Vision Wunderwerk Gehirn 55 Elektrode Mittelhirn Impulsgenerator Elektronischer Impuls Batterie Bei der Tiefenstimulation wird eine Elektrode im Gehirn verankert. Die Steuerung wird unter die Haut der Brust geschoben. 56 Die Welt im Kopf der Neuro-Propheten, würden pharmakologische Lernturbos, Gedächtnispillen und mikroelektronische Neuroimplantate nicht nur für die Behandlung Kranker genutzt, sondern um Gesunden ein besseres Lebensgefühl zu verschaffen, ihnen Trauer und Liebeskummer zu ersparen oder ihre kognitiven Leistungen zu verbessern. Im Mai präsentierte die Europäische Akademie einen Bericht zum NeuroEnhancement. Längst sei »der Sitz der Seele Gegenstand therapeutischer Intervention«, sagt der Akademie-Präsident und Philosoph Carl Friedrich Gethmann. Der Report listet detailliert auf, wie sich aus gegenwärtigen Therapien künftig Techniken der Menschenverbesserung formen ließen: von Cochleaimplantaten zu Hirnchips, von neurogenetischer Forschung zum gentherapeutisch optimierten Intellekt, von der medizinischen Tiefenhirnstimulation bei Depressiven zur Bewusstseinserweiterung durch mikroelektronische Reizmuster. »Stellen Sie sich vor, ich könnte mit der Elektrode die Gedächtnisleistung steigern«, sagt der Neurochirurg Bart Nuttin, einer der Autoren. »Bei Alzheimer-Kranken wäre das medizinische Therapie.« Bei Politikern sei mehr Erinnerungsvermögen wünschenswert – »vor allem nach der Wahl«, juxt der DBS-Experte, »aber das wäre Enhancement.« Schon 2005 verfertigte die Europäische Gruppe für Ethik in den Naturwissenschaften und neuen Technologien (EGE) eine Stellungnahme, die bei ScienceFiction-Aficionados wohlige Schauer erzeugen dürfte. Wie Menschenwürde, Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit und der Schutz von Daten und der Privatsphäre zu garantieren seien, müsse nun geklärt werden, verlangten die EUEthiker, damit künftig auf futuristische Entwicklungen reagiert werden könne: • Implantierte Sinnesorgane erlauben Menschen UV- und Infrarotsehen. • Brain-Computer-Interfaces, gleichsam USB-Stecker im Hirn, ermöglichen elektronische Kommunikation zwischen Gehirn, Rechner und Datenbank. • Cerebellum-Chips dienen als zusätzliche Gedächtnisspeicher. • Kortex-Implantate sorgen für Gedankenkommunikation (Cyber-Think), für eine Gesellschaft vernetzter Individuen. All das sind Technologien, die Jahrzehnte entfernt sind, wenn sie denn verwirklicht werden. Doch sie sind längst mehr als irrlichternde Fantasie. Das Unternehmen Cyberkinetics Neurotechnology Systems in Massachusetts hat einen winzigen Chip entwickelt, bestückt mit 100 hauchdünnen Elektroden, die Nervensignale im Hirn empfangen. 2006 implantierten Mediziner dieses BrainGate Neural Interface bei einem vom Hals abwärts gelähmten Patienten in den für Bewegungen zuständigen Motorkortex. Der Mann kann nun – durch Gedankenkraft – den Cursor seines Computers bewegen, E-Mails öffnen, PC-Spiele bedienen und sogar einen Roboterarm steuern. Noch wird BrainGate nur an paralysierten Patienten getestet, doch könnten Systeme wie diese die Kommunikation Wunderwerk Gehirn 57 mit Computern, Telefonen oder anderen Menschen per Nervensignal möglich machen. An der ETH Lausanne hat das Team des Kognitionsforschers Henry Markram 2005 das Blue Brain Project gestartet. Am Ende wollen die Forscher die Funktionsweise eines Großhirns simulieren. Derzeit tüftelt das Team am mikroelektronischen Nachbau einer kortikalen Säule, eines Neuronenverbunds im Großhirn, der aus 10 000 Nervenzellen mit 100 Millionen verbindenden Synapsen besteht. Brain-Imaging-Verfahren, mit denen das arbeitende Gehirn in Echtzeit beobachtet wird, liefern bereits Skizzen von der Arbeitsteilung des Denkorgans. In den Genomzentren startet derweil die Durchleuchtung des Erbguts nach Genvarianten, die psychischen Leiden wie Schizophrenie oder Depression zugrunde liegen. Die Erkenntnisse der Genetiker sollen nicht nur die biologische Basis der Geisteskrankheiten freilegen, sie könnten auch das Fundament der gesunden Psyche erkennen lassen. Gleichwohl könnte das Menschenhirn bei dem Versuch, sich selbst zu verstehen, erneut scheitern – wie seit 2500 Jahren. Die Herausforderung ist jedenfalls formidabel. Rund 100 Milliarden Neuronen ticken im Hirn, jedes einzelne steht, direkt oder indirekt, mit 10 000 weiteren in funktioneller Verbindung. Hinzu kommt, dass die Nervennetze keineswegs fest verdrahtet sind. Wird das Gehirn mit neuen Aufgaben konfrontiert, bauen die Neuronen frische Verbindungen oder kappen andere. »Alles, was ich tue, sogar die Formulierung dieses Satzes, verändert mein Gehirn«, sagt der Münchner Psychiater Florian Holsboer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Das Denkorgan des Menschen, resümierte der US-Forscher Stuart Kauffman, sei das komplexeste Gebilde im bekannten Universum. Bislang hat die Wissenschaft bestenfalls Breschen in das Enigma des Geistes geschlagen. Wie dem Feuerwerk der Nervenzellen Bewusstsein, Planung, Glaube Prof. Dr. med. Volker Sturm ist ein Pionier der modernen Neurochirurgie. Der 1943 in Heidelberg geborene Arzt hat in Stockholm und Paris geforscht. Seit 1988 lehrt und arbeitet er an der Universität Köln. Bis heute hat er mehr als 1300 Hirnschrittmacher implantiert. 58 Die Welt im Kopf und Liebe entspringen, bleibt rätselhaft. Doch längst zeigen Debatten wie die über Manche Experten Willensfreiheit: Die Neuroforschung fürchten schon jetzt, dass steht davor, das Hochheilige des AbendTherapien für Kranke landes zu stürzen, die Idee der menschzum Lifestyle-Accessoire der lichen Seele. Gesunden werden könnten In Gefahr gerät der geistige Besitzstand einer 2500 Jahre währenden Denktradition. Schon Homer sprach von der Seele, doch durchdacht haben erst griechische Philosophen diesen »feinen immateriellen Stoff«. Dem Aufrührer Sokrates galt die Seele als Quelle der Erkenntnis und der Wahrheit. Sie konnte dem Einzelnen auferlegen, mit allen gesellschaftlichen Konventionen zu brechen. Ausgesprochen metaphysisch erscheint die Lehre seines Schülers Platon. Die Seele gehöre »zu den ersten Schöpfungen, noch vor allen Körpern«. Der Leib war für ihn das Fahrzeug der Seele, während diese – Ursprung aller Bewegung – das Gefährt in Gang setzt. Warum stellte Platon die Seele vor den Körper? Die Antwort des Philosophen: Jede Seele ist Teil der ewigen Weltseele. Daher sei auch die Seele des Einzelnen unsterblich. Aristoteles hat an Platons Seelenlehre höchst modern klingende Zweifel geäußert. Fremd war ihm die Vorstellung, neues Leben entstehe, weil Seelen aus himmlischen Höhen ins Irdische hinabstürzten. Und vor allem: Wie kann etwas Unstoffliches eine Bewegung auslösen? Auch Platons Idee der seelischen Selbstbewegung schien ihm rätselhaft. Deshalb hat Aristoteles die Psyche dem Körper zurückgegeben. Sie sei die erste Wirklichkeit eines natürlichen Körpers, und beide seien verschmolzen wie das Wachs und die ihm eingedrückte Form. Erst christliche Denker spürten in der Seele wieder den göttlichen Atem; der Schöpfer habe Adam seinen Odem eingehaucht, um ihn so zum Menschen zu machen. In der Neuzeit ist es damit vorbei. Die empirische Philosophie, etwa eines David Hume, entzaubert den Glauben an ihre überirdische Substanz. Der strenge Denker Kant sah im metaphysischen Verständnis der Seele nichts anderes als eine Ausrede der denkfaulen Vernunft. Aber es blieb von der unsterblichen Seele immerhin ein »innerer Sinn«. Heute befürchten viele Philosophen, dass die Hirnforschung auch deren letzten »Hauch« auf den Illusionshaufen der Geschichte wirft. Die Seele wäre nur eine Funktion des Körpers. Mit ihrem Tod ginge eine der kostbarsten Vorstellungen des Abendlandes verloren – die Idee, dass jeder Mensch ein ureigenes Selbstgefühl hat, das er niemandem mitteilen kann und das nur ihm allein gehört. Wie der Philosoph Gottlob Frege sagt: »Jeder ist sich selbst in einer besonderen und ursprünglichen Weise gegeben, wie er keinem anderen gegeben ist.« Könnte man dieses Selbstgefühl wirklich einer technischen Intervention unterziehen, würde Wunderwerk Gehirn 59 die immer als unverfügbar erschienene Seele zu einem manipulierbaren Objekt – nur die Dichter, diese armen Seelen, könnten noch ein Lied von ihr singen. Die nächste Generation der Philosophen wird darüber nachdenken müssen, was vom einzigartigen Selbst jedes Menschen bleibt, wenn es Elektroden gehorcht. Denn ob materiell oder immateriell – die Seele läuft oft aus dem Ruder. Zu den häufigsten psychiatrischen Leiden gehören Zwangshandlungen, und vielen Kranken helfen weder Psychotherapie noch Medikamente. Der Neurochirurg Volker Sturm aber hat knapp die Hälfte seiner 16 von Zwangsstörungen schwer betroffenen Patienten durch die Dauerstimulation mit dem Hirnschrittmacher »praktisch geheilt«, bei einigen weiteren hat sich der Zustand zumindest gebessert. Ob die DBS auch bei schweren Depressionen Erfolge zeigt, ist offen; noch ist die Beobachtungszeit bei diesen Patienten zu kurz. Offenbar schwinden die Symptome mit der Elektrodenimplantation zunächst rapide, kehren nach einiger Zeit zurück, um dann wieder abzunehmen. Schon jetzt fürchten allerdings Fachleute, dass die Hirnkrücke für Kranke zum Accessoire der Gesunden werden könnte. Manche Psychopharmaka gelten vor allem in den USA schon heute als Modedroge. Prüfungsgeplagte Studenten, gehetzte Geschäftsleute oder Kreative steigern ihre Leistungen mit Ritalin-Pillen. Der amphetaminähnliche Stoff ist nur zur Behandlung hyperaktiver und aufmerksamkeitsgestörter Kinder zugelassen. Auch Provigil, gedacht zur Behandlung plötzlicher Schlafattacken bei Narkolepsie-Patienten, erfreut sich größter Beliebtheit bei partyfreudigen Professionals. Und längst forschen Neuro-Companys an einer neuen Klasse von Psychopillen, Gedächntisboostern und Lernturbos – die in erster Linie natürlich Demenzerkrankungen abwehren sollen. Der Ulmer Psychiater Manfred Spitzer hat in einer Studie mit einem Alzheimer-Präparat das Gedächtnis von Gesunden verbessert. Er macht sich keine Illusionen: »Kognitives En­hance­ment«, sagt er, »das kommt. So oder so.« von Ulrich Bahnsen aus der ZEIT Nr. 34/2007 60 Die Welt im Kopf Die Zellen des Anstoßes Hirnforscher waren sich schon ganz sicher: Spiegelneuronen sollen die Basis sein für Mitgefühl, Kultur, Religion und Sprache. Doch die Theorie weckt Zweifel Spiegelneuronen sind Pop. Wenn der Fußballfan auf dem Sofa beim Schuss des Stürmers ebenfalls mit dem Bein ausschlägt, ruft er: »Meine Spiegelneuronen!« Steckt in einer Sitzung jemand die anderen mit seinem Gähnen oder Lachen an, können sie entschuldigend auf ihr Gehirn verweisen. Richtig, die Spiegelneuronen! Die Nervenzellen erklären angeblich, Warum ich fühle, was du fühlst und Woher wir wissen, was andere denken und fühlen, wie einschlägige Buchtitel suggerieren. Kultur, Kunst und Sprache, unsere Fähigkeit, zu helfen und Gesellschaften zu bilden – all dies beruht offenbar auf den raffinierten Schaltern im Oberstübchen. Der Hype begann bereits vor etwa fünfzehn Jahren: Damals entdeckten italienische Neurologen erstmals bei Affen, dass spezielle Zellen im Gehirn sowohl beim eigenen Handeln feuern als auch, wenn man die entsprechende Handlung bei anderen nur beobachtet. Damit schien plötzlich ein ganz einfaches neuronales Korrelat für unsere Fähigkeit zum Verstehen und Begreifen gefunden zu sein: Dank der Spiegelneuronen, jubelten die Forscher, übersetze unser Gehirn mühelos eine beobachtete Szene in etwas selbst Erlebtes (siehe Kasten unten). Heute scheinen die allmächtigen Neuronen selbst den Fortbestand der Zivilisation zu sichern: Laut dem US-Soziologen und Autor Jeremy Rifkin kommt es ganz auf die Spiegelzellen an, wenn es gelingen soll, »das empathische, das biosphärische Bewusstsein« zu entwickeln und im globalen Miteinander die haltlose Plünderung der letzten Energie- und Rohstoffreserven zu stoppen. Auch kognitive Störungen, die mit dem Sozialverhalten zusammenhängen, etwa Autis­mus, gelten als Krankheiten des »Spiegelsystems« – das behaupten jedenfalls manche Mediziner und befördern damit den Fluss von Forschungsgeldern. Der erste Platz im Wettbewerb der vollmundigsten Sprüche gebührt allerdings Vilayanur Ramachandran. Der Neurologe vom Center for Brain and Cognition an der University of California in San Diego setzte dem Hype um die Spiegelneuronen die Krone auf, indem er sie kurzerhand zur physischen Basis religiösen Empfindens erklärte. Es handele sich dabei, formulierte er, um »DalaiLama-Neuronen, welche die Grenze zwischen dir und deinem Gegenüber auflösen«. Ramachandran verglich die Wunderzellen bereits mit der Erbsubstanz. »Ich pro­gnos­ti­zie­re, dass die Spiegelneuronen für die Psychologie das sein werden, Wunderwerk Gehirn 61 Vittorio Gallese und Giacomo Rizzolatti sind die Spiegelneuronen-Erfinder. was die DNA für die Biologie war«, posaunte der PR-begabte Neurologe. Nervenzellen als das vereinigende Prinzip, ihre Entdeckung als Weltformel der Hirnforschung? Das war den Fachkollegen zu viel. Zwischen fantasie und experimentellen Beweisen klafft ein gewaltiger Abgrund »Dafür bekommt er eins auf die Mütze, wann immer ich ihn treffe«, sagt David Pöppel. Der Neurowissenschaftler und Linguist an der New York University reibt sich nicht primär an der ausufernden Erfindungsgabe mancher Kollegen. Wissenschaftler müssen kreativ sein. Doch im Fall der Spiegelneuronen klaff t ein wahrer Abgrund zwischen den öffentlichen Fantasien und dem, was 62 Die Welt im Kopf experimentell wirklich belegbar ist. Und das liegt nicht nur daran, dass die Neuronen inzwischen für alles Mögliche gut sein sollen. »Von Haarausfall bis Impotenz – es ist abenteuerlich, was ihnen alles zugewiesen wird«, erklärt der in München aufgewachsene Pöppel seine Unruhe. »Gleichzeitig ist die Befundbasis äußerst schmal.« Mehr oder weniger leise Vorbehalte gegen das Konzept der Spiegelneuronen gab es seit ihrer Entdeckung immer wieder. Doch neuerdings formiert sich vor allem in der Generation jüngerer Neurowissenschaftler eine breite Front an Kritikern. Sie haben sich nicht nur die Mühe gemacht, die Fachliteratur der vergangenen 20 Jahre auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Sie stützen sich zudem auf aktuelle Befunde, die das, was so blumig als »Spiegelneuronen« durch die Welt geistert und was den Nervenzellen allenthalben angeheftet wird, als reichlich überzogen erscheinen lassen. »Die Zellen sind da«, präzisiert David Pöppel, »aber wozu sie gut sind und was sie machen, das wissen wir überhaupt nicht.« Wer das Rätsel erkunden will, muss bis zum Anfang der 1990er Jahre zurückgehen. Damals untersuchten zwei Arbeitsgruppen um den Biologen Giacomo Rizzolatti und den Mediziner Vittorio Gallese an der Universität Parma den prämotorischen Kortex des Südlichen Schweinsaffen, eines Makaken. Dabei konzentrierten sich die Wissenschaftler auf das sogenannte Areal F5 im Hirn, das für Bewegungsmuster der Hand zuständig ist. Mittels dünner Elektroden im Hirn der Affen konnten die Forscher zeigen: Immer wenn die Tiere mit der Hand eine Nuss ergriffen und zum Mund führten, wurden die in Areal F5 liegenden Neuronen aktiv. So weit entsprach das noch der Erwartung. Spannend wurde die Sache, als Rizzolatti und Gallese feststellten, dass etwa 17 Prozent der dort gelegenen Nervenzellen auch dann feuerten, wenn die Affen nur dabei zusahen, wie ein menschlicher Experimentator eine Nuss ergriff. Der prämotorische Kortex war offenbar nicht einfach nur ein Schaltkreis, um eigene Bewegungsprogramme auszuspucken – er reagierte auch auf visuellen Input, wenn andere die entsprechende Bewegung ausführten. Das war eine gewaltige Überraschung. Denn visuell aktive Zellen sollte es im motorischen Kortex eigentlich nicht geben. Wozu sollte das gut sein? Rizzolatti und Gallese tauften die merkwürdigen Zellen Spiegelneuronen und postulierten, diese würden die zentrale Schaltstelle für das Verstehen von Handlungen darstellen. »Jedes Mal, wenn ein Individuum die Handlung eines anderen wahrnimmt, werden die Zellen im prämotorischen Kortex des Beobachters erregt, welche diese Handlung repräsentieren«, meinte Rizzolatti. Beobachten hieße also im wahrsten Sinne des Wortes Be-Greifen. Auf diese Weise, so Rizzolattis Idee, wäre die Grenze zwischen Vorbild und eigenem Tun aufgehoben und gleichsam physisch die Brücke zum Verstehen geschlagen. »Dieses automatisch ausgelöste motorische Muster der beobachteten Handlung entspricht dem, was durch eine aktive Handlung erzeugt wird und dessen Ergebnis dem handelnden Individuum bekannt ist«, schrieb der Wunderwerk Gehirn 63 italienische Forscher und triumphierte: »Das Spiegelsystem transformiert also visuelle Information in Erkenntnis.« um eine Handlung zu verstehen, reicht es nicht aus, sie zu beobachten In der Fachliteratur war bald immer häufiger von einem »Spiegelsystem« die Rede, als die fraglichen Zellen auch im menschlichen Gehirn gefunden wurden. Marco Iacoboni von der University of California in Los Angeles behauptete, mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomografie bei Versuchspersonen die neuronale Spiegelaktivität nachweisen zu können; und das nicht nur in Hirnregionen, die mit der unmittelbaren Bewegungssteuerung zusammenhingen, sondern auch in Zentren für das Sprachverständnis. Dieses Ergebnis ließ die Spekulationen so richtig ins Kraut schießen: Sprache, Kultur, Globalisierung – alles schien nun an den Spiegelneuronen zu hängen. Im Gegensatz zur öffentlichen Begeisterung, die solche Ergebnisse entfachten, sorgten sie indes unter Neurowissenschaftlern auch für einiges Unbehagen. Denn die Fachleute wissen: Kernspintomografen, wie Iacoboni sie benutzt, arbeiten zeitlich viel zu langsam und räumlich viel zu grobkörnig, um schnelle Wahrnehmungsprozesse zu erfassen. Einen Dämpfer bekam die Spiegelneuronen-Theorie dann durch die Studien von Raffaella Rumiati vom neurowissenschaftlichen Forschungszentrum in Triest. Sie untersuchte Patienten, deren Gehirn – etwa aufgrund eines Schlaganfalls – geschädigt war. Dabei stellte sich heraus: Manche Patienten können zwar bestimmte Objekte nicht mehr benutzen, sehr wohl aber die damit verbundenen Handlungen erkennen. Bei anderen ist es genau umgekehrt: Sie sind unfähig, die Objekte wahrzunehmen, können aber die Akte noch ausführen. Rumiatis Folgerung: Das Verstehen der Handlungen und ihre Wahrnehmung sind im Gehirn räumlich getrennt. Sie beruhen auf unterschiedlichen Prozessen – und sind nicht etwa in den sogenannten Spiegelneuronen vereint. Als Nächstes präsentierte eine Gruppe um Angelika Lingnau und Alfonso Caramazza vom Center for Mind/Brain Sciences der Universität Trient eine Studie, die weiter massive Zweifel schürte. Darin untersuchten sie, wie das Gehirn auf die häufige Wiederholung ein und desselben Reizes reagiert. Normalerweise kommt es dabei zu einer Anpassung (Adaptation): Sieht eine Person mehrmals hintereinander die Farbe Rot, reagieren die Rot-Zellen im Gehirn allmählich immer schwächer. Die These der Forscher war, dass auch im »Spiegelsystem« eine solche Adaptation zu beobachten sein sollte; egal, ob eine bestimmte Handlung zunächst beobachtet und dann ausgeübt wird oder umgekehrt – in jedem Fall sollten die Spiegelzellen schwächer reagieren. Doch die Vorhersage traf nur teilweise ein: Die Zellen adaptierten zwar, wenn eine Person einen Akt erst beobachtete und dann ausführte; sie reagierten jedoch anders, wenn die Reihenfolge von Handlung und Beobachtung umgekehrt wurde. Was ist der Grund für diese Asymmetrie? Nach Ansicht von Lingnau und Caramazza zeigt ihr Befund, dass die Aktivität der Spiegelzellen eben nicht 64 Die Welt im Kopf automatisch zum »Verstehen« führt. Zumindest bei der Reihenfolge »zuerst handeln/dann sehen« könne von einer automatischen Reaktion der Spiegelneuronen keine Rede sein. Stattdessen komme es in diesem Fall zu einer Neubewertung der Situation, die nicht in den Zellen selbst, sondern in anderen Gehirnregionen erfolgt. »Spiegelneuronen stellen demnach nicht die biologische Basis des Verstehens dar«, stellt Lingnau klar. Dieser Satz ist ein Frontalangriff auf die zentrale Aussage der Spiegel-Theorie von Rizzolatti. Vergegenwärtigt man sich die Komplexität eines Verstehensvorgangs, kann ein solcher Befund kaum überraschen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir sehen, wie jemand mit der Hand eine volle Flasche ergreift und deren Öffnung dem Rand eines Glases nähert. Dieser einfache motorische Vorgang kann eine Fülle von Bedeutungen haben: Es kann ums Ausgießen gehen, ums Füllen, Anstoßen, Verschütten, Teilen oder im Extremfall ums Vergiften. Um die Handlung wirklich zu verstehen, reicht es nicht, sie nur zu beobachten oder selbst auszuführen. Wir müssen zum Beispiel auch wissen: Welche verbalen Äußerungen gab es? Was war vorher passiert? Waren Beobachter anwesend? Haben die Zellen schlicht etwas mit der fähigkeit zur Imitation zu tun? Das heißt: Visuelle und motorische Aspekte sind für das Verständnis einer Handlung zwar wichtig, aber nicht hinreichend. Wir müssen diese Aspekte auch in ein größeres Beziehungsgeflecht einbetten können. Wäre dies anders, könnte man prinzipiell aus zwei Gegenständen die Zukunft vorhersagen, wie sich der amerikanische Linguist Noam Chomsky einmal belustigte. Für die sogenannten Spiegelneuronen bedeutet dies: Was reduktionistisch einzelnen Zellen zugewiesen wurde, scheint eine Leistung des gesamten Gehirns zu sein. Damit sind die vermeintlichen Spiegelneuronen als erklärendes Modell hinfällig; zumindest erscheint ihre Rolle deutlich kleiner als bisher behauptet. V. S. Ramachandran Der Neurologe Vilayanur S. Ramachandran ist bekennender Anhänger der Spiegelneuronen-These. Er wurde als Sohn einer einflussreichen Familie in Indien geboren und studierte dort Medizin. Heute lehrt und forscht Ramachandran an der University of California, San Diego. Wunderwerk Gehirn 65 Bestätigt wird dies durch eine aktuelle Arbeit, die das ohnehin vage definierte »Spiegelsystem« sehr weiträumig im Gehirn verortet, zum Beispiel auch in der Gedächtnispforte Hippocampus. »Damit sind wir bei dem alten Wie-arbeitet-das-Gehirn-Problem«, erklärte die Neurophilosophin Patricia Churchland dazu. Die komplexen und weiträumigen Verteilungsmuster der Si­gna­le erschweren den Forschern die Interpretation. Also zurück zu den Experimenten mit Schweinsaffen!, fordert Greg Hickok von der University of California in Irvine, einer der Wortführer der Skeptiker. Weg von den überzogenen Interpretationen der Spiegelzellen als Schlüssel für Ich-Entgrenzung, Globalisierung, Empathie und Kulturfähigkeit. Schließlich haben die braven Äffchen von alldem höchstens einen blassen Schimmer; dennoch besitzen sie die angeblichen Wunderzellen. Was also erklärt deren Existenz tatsächlich? Nach Hickoks Ansicht verlegte sich Rizzolatti seinerzeit voreilig auf die Erklärung des Verstehens. Er ließ dabei die naheliegende Möglichkeit außer Betracht, die Spiegelneuronen könnten lediglich etwas mit Imitation zu tun haben. Vermutlich war er der Meinung, Imitationen gehörten nicht zum Verhaltensrepertoire seiner Makaken. Tatsächlich aber imitieren diese einander durchaus, etwa bei Gesten der sozialen Kommunikation oder beim Gähnen. Umgekehrt, meint Hickok, verstünden die Affen die Bedeutung einer Handlung auch dann, wenn sie selbst dazu gar nicht in der Lage seien – etwa das Werfen von Gegenständen. Die wachsenden Einwände lassen die blühenden Fantasien mancher Neurowissenschaftler genauso dürftig dastehen wie viele andere große Theorieentwürfe. Die Entdeckung der Spiegelneuronen ist zwar ein höchst interessanter Befund. Als Basis einer neuropsychologischen Weltformel taugt sie jedoch nicht. Greg Hickok vermutet inzwischen, dass die bimodalen Neuronen lediglich daran beteiligt sind, auf den Anblick eines Aktes hin eine Reaktion aus dem eigenen Verhaltensrepertoire auszuwählen. »Auf das Verstehen können wir als Erklärung komplett verzichten«, versichert er. von Werner Siefer aus der ZEIT Nr. 51/2010 66 Die Welt im Kopf Stichwort Das Nervensystem Das menschliche Gehirn enthält viele Hundert Milliarden Zellen, die in hochgradig organisierter Weise angeordnet sind, und es heißt oft, unser Gehirn sei das komplexeste Organ im ganzen bekannten Universum – obwohl es nur rund 1,5 Kilogramm wiegt. Es besteht aus zwei Hälften oder Hemisphären, die ihre Informationen jeweils von der gegenüberliegenden Seite des Körpers erhalten. Die Großhirnrinde (Cortex cerebri), die beide Hemisphären überzieht, ist auf beiden Seiten in je vier Lappen untergliedert, die alle unterschiedliche Aufgaben erfüllen und durch tiefe Furchen, sogenannte Fissuren, voneinander getrennt sind. Der Stirn- oder Frontallappen übernimmt komplexe geistige Funktionen wie logisches Denken und Entscheidungsfindung und enthält zudem die motorischen Areale, die Willkürbewegungen planen und durchführen. Das Nervensystem besteht aus zwei Hauptkomponenten. Ein Teil, das Zentralnervensystem (ZNS), setzt sich aus Gehirn und Rückenmark zusammen; es erhält Informationen vom übrigen Körper und koordiniert dessen Aktivitäten. Der andere Teil, das periphere Nervensystem, umfasst die Nerven, die den Informationsaustausch zwischen Körper und ZNS gewährleisten. Der Scheitel- oder Parietallappen enthält die somatosensorischen Areale, die Berührungsinformationen aus dem Körper verarbeiten. Zudem verknüpft er verschiedene Typen sensorischer Informationen, um uns ein »Raumgefühl« zu vermitteln – im Grunde das Wissen darüber, wie unser Körper im Raum ausgerichtet ist. Stichwort 67 Der Schläfen- oder Temporallappen empfängt Informationen von den Ohren, und seine Außenfläche enthält Areale, die auf das Verstehen von Sprache spezialisiert sind. Die Innenfläche enthält den Hippocampus, der entscheidend für die Speicherung von Erinnerungen ist und zusammen mit den umliegenden Bereichen eine wichtige Rolle bei der räumlichen Orientierung spielt. Der Hinterhaupts- oder Okzipitallappen liegt am hinteren Hirnpol und enthält Dutzende verschiedene Bereiche, die auf die Verarbeitung und Interpretation visueller Signale spezialisiert sind. Im Inneren des Gehirns Unter dem Kortex befinden sich mehrere große Ansammlungen (Cluster) von Neuronen. Der Thalamus (gr. thalamos, »Schlafgemach, kleines Zimmer«) liegt genau im Zentrum des Gehirns und leitet wie eine Relaisstation Informationen von den Sinnesorganen an die entsprechenden Regionen im Gehirn weiter. Rund um den Thalamus liegen die Basalganglien, mehrere Ansammlungen von Nervenzellkörpern (Kerne), die hauptsächlich für die Kontrolle von Willkürbewegungen zuständig sind. Das limbische System umfasst ebenfalls eine Reihe subcorticaler Strukturen und liegt zwischen Basalganglien und Kortex. Dieses System, das manchmal als »Reptiliengehirn« bezeichnet wird, ist, evolutionär gesehen, primitiv und spielt für Emotionen, Belohnung und Motivation eine Rolle. Dazu zählen auch Hippocampus und Amygdala, die beide an der Bildung von Langzeiterinnerungen beteiligt sind. Das Mittelhirn ist ein kleiner Bereich oberhalb des Stammhirns. Es enthält mehrere Kerne, die die Augenbewegung kontrollieren, und ist die Hauptquelle für den Neurotransmitter Dopamin. Neurone, die Dopamin produzieren, erzeugen auch das Pigment Melatonin, das einem Teil des Mittelhirns ein dunkles Aussehen verleiht. Dieser Teil wird daher als Substantia nigra (»schwarze Substanz«) bezeichnet. Das Rautenhirn umfasst drei Strukturen oberhalb des Rückenmarks, die gemeinsam den Hirnstamm bilden. Der untere Teil des Hirnstamms, die Medulla oblongata, kontrolliert wichtige Vitalfunktionen wie Atmung Das menschliche Gehirn ... ist die komplexeste Anordnung von Materie, die wir kennen. und Herzschlag und ist eng mit dem Wachbewusstsein verknüpft. Über der Medulla liegt der Pons (lat. pons, »Brücke«); er verbindet den Kortex mit dem Rückenmark und ist ebenfalls für das Wachbewusstsein von Bedeutung. Die dritte Komponente des Rautenhirns, das Kleinhirn oder Cerebellum, spielt für die Gleichgewichtskontrolle und die Bewegungskoordination eine wichtige Rolle. Das Kleinhirn ist für das Erlernen motorischer Fertigkeiten wie das Fahrradfahren wesentlich, aber auch mit Emotionen und Denkprozessen v ­ erknüpft. Hochbetrieb Das Rückenmark im Zentrum des körpereigenen Transportnetzes ist ein riesiges Bündel von Millionen Nervenfasern, das den Informationsaustausch zwischen Gehirn und Körper sichert. Diese sehr empfindliche Struktur, die von der Wirbelsäule geschützt wird, kann gewisse Funktionen, wie den Patellarsehnenreflex, ohne »Befehl von oben« in Eigenregie durchführen. Dieses zentrale Nervenbündel ist zudem segmentiert; in regelmäßigen Abständen treten Nerven ins Rückenmark ein und aus ihm heraus, und zwar in hochgradig geordneter Weise. Der Querschnitt des Rückenmarks ähnelt einer Schmetterlingsfigur. Die Fasern der Motoneurone entspringen vorn im Rückenmark, ziehen zur Körpermuskulatur und übermitteln ihr die Anweisungen des Gehirns im Hinblick auf Willkürbewegungen. Die Axone der sensorischen Neurone hingegen transportieren Informationen vom Körper zum Rückenmark und nehmen Kontakt mit nachgeordneten Neuronen auf, die die Informationen hinauf zum Gehirn schicken. Die Axone der motorischen und der sensorischen Neurone sind in den peripheren Nerven gebündelt. Verschiedene Schichten der Komplexität Der Kortex (lat. cortex, »Rinde«) ist eine stark gefaltete, dünne Gewebeschicht, die die Oberfläche des Gehirns überzieht. Er weist beim Menschen eine viel größere Oberfläche auf als bei anderen Tieren – flach ausgebreitet sind es 0,2 Quadratmeter. Die starke Faltung des Kortex mit all seinen Gyri und Sulci (Windungen und Rinnen) verleiht dem Gehirn sein vertrautes Aussehen. Der Kortex ist nur wenige Millimeter dick, umfasst aber sechs Schichten, in denen die Zellen jeweils in einheitlicher Weise angeordnet sind. Trotz dieser einheitlichen Struktur enthält der Kortex eine Vielzahl eigenständiger Areale, von denen jedes auf eine bestimmte Funktion spezialisiert ist. Isaac Asimov, 1986 68 Die Welt im Kopf Stichwort 69 Der Geist, eine ­geheimnisvolle Form der Materie, abgesondert vom Gehirn. Botenstoffe Das periphere Nervensystem setzt sich aus all den Nerven zusammen, die aus dem Gehirn und dem Rückenmark austreten, und wird in zwei Komponenten unterteilt. Ein Teil, das somatische Nervensystem, besteht aus den motorischen und sensorischen Nervenfasern, die Informationen zwischen Körper und Ambrose Bierce, 1911 Rückenmark austauschen. Diese Nerven beschäftigen sich mit der bewussten Aufnahme sensorischer Empfindungen und mit Willkürbewegungen. Die zweite Komponente, das autonome oder vegetative Nervensystem, lässt sich weiter in das sympathische und das parasympathische Nervensystem unterteilen, die komplementäre Funktionen aufweisen. Das sympathische Nervensystem verwendet den Neurotransmitter Noradrenalin, um die Herz­frequenz zu erhöhen, Pupillen und Bronchien zu erweitern und die Durchblutung des Verdauungssystems zu reduzieren. All dies bereitet den Körper auf Aktivität vor; man spricht daher auch von der Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Das parasympathische Nervensystem dagegen benutzt den Neurotransmitter Acetylcholin, der die Pupillen und die Bronchien verengt, die Herzfrequenz senkt und die ­Verdauungstätigkeit steigert. Die Hirnnerven sind ebenfalls Teil des peripheren Nervensystems. Diese Nerven treten aus dem Hirnstamm aus und übermitteln Informationen zwischen dem Gehirn und den Sinnesorganen. Der Vagusnerv, der 10. Hirnnerv, ist der längste von allen und entsendet Äste bis in Herz, Brust und Bauch. Moheb Costandi 70 Die Welt im Kopf Die große Neuro-Show Was wurde aus den Verheißungen der Hirnforschung? Wissenschaftler ziehen Bilanz. Frage: Wie verschafft man sich als Forscher heute besondere Autorität? Antwort: indem man als Hirnexperte auftritt oder zumindest neurologische Studien zitiert. Egal, ob es um richtiges Lernen oder Marketing geht, um Mitgefühl, Liebe oder politische Entscheidungsfindung – kaum etwas verleiht einem Standpunkt mehr Glaubwürdigkeit als der Verweis auf bunte Hirnbilder aus dem Kernspintomografen. Diese scheinen schließlich glasklar zu belegen, was im Kopf von Lernenden, Liebenden oder Kaufenden wirklich vor sich geht. Die besondere Aura der Hirnforschung verschafft ihren Vertretern nicht nur Gehör, sie zahlt sich auch finanziell aus. Neurowissenschaftler rekrutieren derzeit enorme Forschungsmittel – wie etwa jene Milliarde Euro, mit der die EU das ­Human Brain Project fördert; und sie verstehen es, ihr Wissen auch privat zu Geld zu machen – wie der Bonner Hirnforscher Christian Elger, der Bücher über Neuroleadership schreibt und auf Werbekongressen auftritt; oder wie sein Bremer Kollege Gerhard Roth, der sich in seiner Firma Roth GmbH als Experte für »Verkaufs­training«, »Neuromarketing« und »Unternehmensführung« anbietet. Von der prognostizierten Revolution ist in der klinischen Praxis nichts zu sehen Doch wie ist es um die Aussagekraft der bunten Hirnbilder tatsächlich bestellt? Und wo steht die Neurowissenschaft heute, zehn Jahre nach jenem berühmten »Manifest« der Hirnforscher, das 2004 für Aufsehen sorgte? Damals skizzierten elf führende Vertreter – darunter Gerhard Roth, Wolf Singer und Christian Elger – den Stand und die Aussichten ihrer Disziplin; der Ton oszillierte dabei zwischen Demut und Großspurigkeit. Einerseits bekannten die deutschen Hirn­forscher bescheiden: »Nach welchen Regeln das Gehirn arbeitet (...), wie das innere Tun als ›seine‹ Tätigkeit erlebt wird und wie es künftige Aktionen plant, all dies verstehen wir nach wie vor nicht einmal in Ansätzen.« Ungeachtet dessen, prognostizierten sie andererseits »enorme Fortschritte« für die nächsten zehn Jahre: Man werde die Grundlagen von Alzheimer und Parkinson verstehen und diese Leiden »vielleicht von vornherein verhindern oder zumindest wesentlich besser behandeln können«. Für Schizophrenie und Wunderwerk Gehirn 71 Depressionen wurde gar gleich »eine neue Generation von Psychopharmaka« in Aussicht gestellt, die »hocheffektiv sowie nebenwirkungsarm« sei und die »Therapie psychischer Störungen revolutionieren« könnte. Zehn Jahre später ist klar: Von alldem ist nichts eingetreten. Von einem echten Verständnis der ­Ursachen der Alzheimer-Demenz sind wir so weit entfernt wie 2004, Therapien zur Verhinderung oder Heilung der Krankheit sind bis heute nicht verfügbar; auch die behauptete Revolution in der Therapie psychischer Störungen blieb bislang aus, neue »hocheffektive und nebenwirkungsarme« Medikamente waren pures Wunschdenken. Zum zehnten Jahrestag des Manifests hat daher eine Gruppe von Neurobiologen, Psychiatern, Psychologen und Philosophen eine Art Gegenmanifest verfasst, ein Memorandum »Reflexive Neurowissenschaft«, das scharf mit dem damaligen Papier ins Gericht geht. Die Bilanz falle enttäuschend aus, »eine Annäherung an gesetzte Ziele ist nicht in Sicht«, schreiben die Forscher um den Psychiater und Neurologen Felix Tretter, Chefarzt am Isar-Amper-Klinikum München-Ost. Das Aktivitätsmuster verrät, wo die Nervenzellen im Gehirn besonders viel Sauerstoff verbrauchen. 72 Die Welt im Kopf Zwar würde von »klinisch tätigen Ärzten sowie von Patienten und deren Angehörigen« nichts sehnlicher erwartet als Fortschritte der Neuro­wissenschaften. Doch von solchen sei in der Praxis kaum etwas erkennbar – und das liege nicht etwa an der zu kurzen Zeit oder fehlenden Forschungsgeldern, sondern an grundlegenden »Unzulänglichkeiten im Bereich der Theorie und Methodologie der Neurowissenschaften« – anders gesagt: am fehlenden Verständnis der grundsätzlichen Regeln, nach denen das Gehirn funktioniert. Sex, Schmerz und Zeitgefühl – all das steckt angeblich im selben Hirnareal So gilt heutzutage eine Geistesfunktion häufig schon als »erklärt«, wenn man im Kernspintomografen zeigen kann, welches Hirnareal dabei aktiv wird. Dummerweise sind solche Zuordnungen alles andere als eindeutig. Darauf hat kürzlich auch der Neuropsychologe Ernst Pöppel hingewiesen. Ihm ist aufgefallen, dass die Inselrinde (Insula) im Kortex offenbar ein artistischer Multitasker ist. Je nach Studie scheint sie mal verantwortlich für negative Emotionen, mal für Körpergefühl, wahlweise auch für Aufmerksamkeit, Schmerz, Sex, Begierde oder Zeit­ gefühl. »Das ist Unsinn«, kommentiert Pöppel, »das ist schlimmer als die Phrenologie vor 200 Jahren«. Das Gehirn arbeitet eben nicht nach dem Schubladenprinzip, wie manche Studien suggerieren, es zieht seine Leistung aus der hochdynamischen Vernetzung von rund 100 Milliarden Nervenzellen, die permanent miteinander interagieren. Wie das genau vor sich geht, weiß derzeit niemand. Klar ist aber: »Eine psychische Funktion wird an mehreren Gehirnorten realisiert, und ein Gehirnort ist an mehreren Funktionen beteiligt«, wie es im neuen Memorandum heißt. Daher reiche es nicht, per Kernspin und anderen Methoden immer neue Daten zu sammeln, um die große Frage zu beantworten, wie das Gehirn arbeite und wie am Ende etwas wie Geist und Bewusstsein entstehe. Genau das aber hatten die Hirnforscher 2004 in Aussicht gestellt. In den nächsten 20 bis 30 Jahren werde man »widerspruchsfrei Geist, Bewusstsein, Gefühle, Willensakte und Handlungsfreiheit als natürliche Vorgänge ansehen, denn sie beruhen auf biologischen Prozessen«. Dieser Satz klang so, als wüssten die Neurowissenschaftler bereits, wie man Geist, Bewusstsein et cetera alleine aus biologischen Vorgängen heraus erklären kann. Davon kann jedoch bis heute keine Rede sein. Inzwischen muss man diesen Satz wohl so lesen, dass Gedanken und Gefühle auch auf biologischen Prozessen beruhen – was allerdings eine ziemlich banale Erkenntnis ist. Denn »in einem sehr trivialen Sinne«, schreiben die Kritiker um Tretter, würden ja »alle menschlichen Leistungen ›auf biologischen Prozessen beruhen‹, denn man muss zum Beispiel atmen, um etwas zu leisten, woraus jedoch nicht folgt, dass alle menschlichen Leistungen als Atmung ›angesehen‹ Wunderwerk Gehirn 73 werden können«. Die Autoren des Manifests hätten hier notwendige und hinreichende Bedingungen vermischt. Kann man Die Gegenposition formuliert am Geist, Bewusstsein, provokativsten der Psychiater Thomas Gefühle, Willensakte und Fuchs aus Heidelberg: »Das Gehirn Handlungsfreiheit allein denkt gar nicht«, sagt Fuchs. Es widerspruchsfrei als natürliche sei »immer die ganze Person, die etwas Vorgänge ansehen? wahrnimmt, überlegt, entscheidet, sich erinnert und so weiter, und nicht ein Neuron oder ein Cluster von Molekülen«. Deshalb lasse sich menschliches Denken und Verhalten nur erklären, wenn man den ganzen Organismus und dessen Umwelt betrachte – womit auch kulturelle, soziale und moralische Dimensionen mit ins Spiel kommen. Fuchs, Tretter und die anderen Unterzeichner des neuen Memorandums fordern daher eine neue Perspektive, eine »systemwissenschaftliche« Gesamtschau. Dazu seien einerseits neue, »konzeptionelle Theorieentwicklungen« nötig, zum anderen brauche es eine intensivere Zusammenarbeit der Hirnforscher mit Disziplinen wie der klinischen Psychologie, Systemforschung und Philosophie. Eine ähnliche Forderung findet sich schon im alten Manifest – allerdings wird sie wirkungslos bleiben, solange an den Universitäten immer noch jede Disziplin bei der Vergabe von Forschungs­geldern eifersüchtig über ihre Pfründe wacht. So ist das neue Memorandum nicht weniger als ein Aufruf zur wissenschaftlichen Revolution. Und das völlig zu Recht: Ohne diese Re­vo­lu­tion wird ein besseres Verständnis des Menschen und seines Bewusstseins nicht zu haben sein. von Ulrich Schnabel aus der ZEIT Nr. 9/2014 74 Die Welt im Kopf 2. Grenzzustände des Gehirns Was geschieht in unserem Kopf, während wir schlafen? Wo verläuft die Grenze zwischen Tiefschlaf und Bewusstlosigkeit? Wozu sind Träume da? Haben sie überhaupt einen Sinn und wenn ja, welchen? Was tut unser Gehirn, wenn wir gar nichts tun? Schlaf, Traum, Leerlauf, Koma: Die Grenzzustände unseres Gehirns verraten den Wissenschaftlern Überraschendes über seine normale Funktion – und über unser Bewusstsein. 76 Die Welt im Kopf Jenseits von Gut und Böse Schlafwandler, Wachträumer und ein tragischer Todesfall: Sind wir für unser Verhalten im Schlaf und für unsere Träume verantwortlich? Brian Thomas erwürgte seine friedlich neben ihm schlafende Frau kurz vor dem 40. Hochzeitstag. Vor Gericht gab er die Tat zu. Ein klarer Fall, so schien es: entweder verrückt oder ein Verbrecher. Doch der Staatsanwalt ließ die Anklage fallen, der Richter pries Thomas als »anständigen Mann und hingebungsvollen Ehegatten«. Thomas verließ den Swansea Crown Court als freier Mann. Wenn einer, der seine Gattin getötet hat, einfach so gehen darf, muss er eine gute Entschuldigung haben. In diesem Fall lautete sie: Schlafwandeln. Thomas war mitten in der Nacht über seine Frau hergefallen – geistig abwesend, wie er beteuerte. Seit der Kindheit sei er Schlafwandler gewesen. Mehrere Psychiater hatten ihn begutachtet und befunden, er sei zur Zeit der Tat nicht Herr seiner Handlungen gewesen: »nicht geistesgestörter Automatismus« lautete der Befund. Richter und Anwälte folgerten, zur Tatzeit habe ­Brian Thomas keine Mens rea gehabt, keinen schuldfähigen Geist. Geständig, geistig gesund, aber unschuldig: Kann ein Täter darauf plädieren, nicht er, sondern sein Unbewusstes habe eine Tat begangen? Der Fall Thomas wirft eine grundsätzliche Frage neu auf: Was eigentlich geschieht mit uns, wenn wir schlafen? Seit Langem grübeln Psychologen, Philosophen und Hirnforscher darüber. In den vergangenen Jahren haben bildgebende Verfahren den Blick ins schlafende Gehirn ermöglicht und gezeigt, dass es anders als im Wachzustand funktioniert. Ganz anders, denn jenseits des Wachzustands vollzieht sich ein radikaler Bewusstseinswandel. Nicht nur bei Schlafwandlern. Lange galt Schlaf schlicht als eine Art Wartemodus des Gehirns, in dem das Bewusstsein vorübergehend abgeschaltet wird. Bis zum Jahr 1951. Damals verkabelte Eugene Aserinsky, Bummelstudent der Medizin, in einem Kellerlabor in Chicago den Kopf seines achtjährigen Sohnes und zeichnete nächtelang dessen Gehirnströme auf. Was Aserinsky sah, warf die Lehrmeinung um: Mehrmals pro Nacht schlugen die Zeiger wild aus. Es herrschte alles andere als Sendepause im Hirn. Er beobachtete auch, dass die Augen des Kindes in diesen Phasen munter zuckten. Dieses »Rapid Eye Movement« gab den Phasen wiederkehrenden Grenzzustände des Gehirns 77 Schlaf- und Traumrhythmus 1 2 3 4 5 6 22 Uhr 23 Uhr 24 Uhr 1 Uhr 2 Uhr 3 Uhr 4 Uhr 5 Uhr 6 Uhr 7 Uhr Durchschnittlicher Schlafverlauf in einer Nacht: Kurze Phasen des Tiefschlafs wechseln mit Leicht- und Traumschlafzeiten 1 4 Wachzustand 2 REM- bzw. Traumschlaf 3 Leichtschlaf (Phase 1) Leichtschlaf (Phase 2) 5 Tiefschlaf (Phase 3) 6 Tiefschlaf (Phase 4) Neuronenfeuerwerks ihren Namen, kurz REM. Und Versuchspersonen, die aus dem REM-Schlaf geweckt wurden, fühlten sich fast immer aus Träumen gerissen. REM-Schlaf gleich Traumschlaf, folgerten viele Schlafforscher daraus. Dennoch blieb das Dogma, dass Schlaf eine Form von Bewusstlosigkeit ist. »Wenn jemand irgendeinen Zustand von Bewusstsein hat, dann folgt logischerweise, dass er nicht fest schläft«, erklärte 1956 der amerikanische Philosoph Norman Malcolm. Träume galten den Forschern als Selbsttäuschung des Gehirns beim Aufwachen: entstanden aus dem Restgeflimmer neuronaler Aufräumarbeiten, das das anspringende Bewusstsein schnell zu einer Geschichte formt. Wenige Forscher glaubten daran, dass wir unsere Träume tatsächlich im Kopf durchleben. An einem Freitag, dem 13. aber unternahm Stephen LaBerge, Doktorand der Psychophysiologie, einen Selbstversuch, nachdem die Schlafforscher die Träume nicht mehr wegreden konnten. Das war im Januar 1978. Zehn Jahre zuvor hatte LaBerge, damals Hippie und Physikstudent an der Stanford University, ein fremdartiges Erlebnis gehabt. Er wähnte sich beim Bergsteigen im Himalaya. Um sich herum nahm er dichtes Schneetreiben wahr, aber er fror nicht. Erst als er an sich hinunterblickte und seine kurzen Ärmel sah, wurde ihm klar, dass die Situation nicht real sein konnte – dass er träumte. Berichte über solche »Klarträume«, in denen der Träumer sich seines Zustands bewusst ist, waren seit Jahrzehnten durch die Literatur gegeistert. Das Establishment der Schlafforscher hatte sie als Absurdität oder Okkultismus abgetan. Aber LaBerge war entschlossen, Klarträume experimentell dingfest zu machen. An jenem Freitag gelang es ihm: Mit vorher eingeübten Augenbewegungen gab er einem Kollegen, der im Labor über seinen Schlaf wachte, ein Signal aus einem Klartraum heraus. Links, rechts, links, rechts – die erste Verbindung zwischen Traumwelt und Wirklichkeit. 78 Die Welt im Kopf LaBerge hatte damit zwei Dinge auf einen Streich gezeigt: Träume passieren tatsächlich im Kopf, und wir können sie bewusst erleben. Die beiden führenden Wissenschaftsmagazine Nature und Science lehnten LaBerges ersten Aufsatz zur Veröffentlichung ab. Zwei kleinere Journale zur Schlaf- und Wahrnehmungsforschung griffen zu. Seither hat sich die Fachdiskussion komplett gewendet: Der Zusammenhang von Schlaf, Traum und Bewusstsein ist kein Tabu mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. »Träume sind bewusst, weil sie das Erscheinen einer Welt erzeugen«, sagt Thomas Metzinger, Bewusstseinsphilosoph an der Universität Mainz. Dass der Schein der Traumwelt trügt, zählt dabei nicht. »Selbst wenn alle Inhalte Halluzinationen sind«, sagt Metzinger, »Bewusstheit kann man sich nicht einbilden.« Auch für Hirnforscher schließen sich Schlaf und Bewusstsein nicht mehr aus. »Träumen ist offenbar eine sehr hoch entwickelte Funktion des Gehirns«, sagt Christof Koch, Neurowissenschaftler am Caltech in Los Angeles, »eine besonders lebendige Form von Bewusstsein.« Genau genommen zeigt es sich gleich in mehreren Formen. Die Funktionen des Gehirns spielen dabei in unterschiedlichen Kombinationen zusammen – ein wunderbares Experimentierfeld für Forscher und Philosophen, die nach den Minimalbedingungen für Bewusstsein suchen. In REM-Phasen ist das Gehirn zwar von Außenreizen abgekoppelt, es ist aber sogar aktiver als im Wachen. Der Philosoph und Neurowissenschaftler Antti Revonsuo hält REM-Träume daher für »Bewusstsein in Reinform«. Das Gehirn nutze die Nacht, um ungestört von Sinnesreizen für den Tag zu trainieren – ein Schattenboxen der Neuronen. Im REM-Schlaf unterscheiden sich Hirnchemie und neuronale Aktivität dabei vom Wachzustand. Hirnscans zeigen, dass es beim Träumen in einigen emotionalen Zentren äußerst lebhaft zugeht. Dagegen ruht der präfrontale Kortex, ein Areal der Großhirnrinde hinter der Stirn, in dem, so vermuten Hirnforscher, Gefühle und Erinnerungen zusammenlaufen und eine schlüssige Handlungsabsicht entsteht. Dieser Unterschied lässt sich spüren. Fehlt die Kontrollinstanz, übernehmen Emotionen wie Angst, Aggression und sexuelle Erregung das Kommando. Aus braven Menschen können im Traum Schläger und Lüstlinge werden. Entscheidend für Forscher wie Thomas Metzinger ist, dass sich das »Traumselbst« anders wahrnimmt als das »Wachselbst«. In manchen Traumberichten scheint Sinnesreize – Druck, Wärme und Licht gehören dazu, ebenso wie verschiedene Geschmacksnoten und Duftmoleküle. Sie stimulieren unsere Sinnesorgane, die daraufhin elektrische Impulse an die nachgeschalteten Nervenzellen schicken. Nur einen kleinen Teil der weitergeleiteten Reize nehmen wir überhaupt bewusst wahr – die Interpretation der Impulse findet nämlich im zentralen Nervensystem statt, losgelöst von den Rezeptoren in Haut, Augen und Ohren. Grenzzustände des Gehirns 79 es, als vergesse der Träumende sich selbst. Er kommt in der Traumgeschichte überhaupt nicht vor. »Das autobiografische Selbstmodell ist im Traum stark reduziert«, sagt Metzinger, »im Traum haben wir nur schlechte Erinnerungen an unser vergangenes Wach- und Traumleben. Das bewusste Selbst ist in diesem Zustand äußerst instabil.« Klarträumer hingegen wissen, wer sie sind und dass sie gerade träumen. Oft können sie sogar den Traum selbst steuern – sozusagen ihren Wunschtraum träumen. Die Psychologin Ursula Voss von der Universität Frankfurt am Main hat die Köpfe von Klarträumern mit Elektroden verkabelt und erstmals gemessen, was darin geschieht. Und siehe da: »In Klarträumen erwacht der präfrontale Kortex«, sagt Voss, »sonst sind die Aktivitätsmuster ziemlich die gleichen wie in normalen REM-Träumen.« Damit bestätigt sie: Der präfrontale Kortex ist wirklich verantwortlich für höhere Bewusstseinsstufen, für die Reflexion von Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken – kurz gesagt, für den Realitätssinn. Nun plant Ursula Voss die Gegenprobe: Sie will in normalen REM-Phasen den präfrontalen Kortex mit elektrischer Sti­mu­la­tion »wecken«, um so Klarträume zu erzeugen. Wenn ihr das gelingt, könnte es große therapeutische Bedeutung haben. Denn bei Menschen, die an einer Psychose leiden, funktioniert der präfrontale Kortex auch im Wachen nicht richtig. Schon lange kennen Psychologen die Parallelen zwischen Psychosen und Träumen: Psychotiker können nicht zwischen der Außenwelt und ihrer Einbildung unterscheiden, der Bezug zur Realität geht ihnen verloren. Das Vosssche Verfahren könnte den präfrontalen Kortex von Psychotikern stimulieren und ihnen den Realitätssinn wiedergeben. Realitätssinn war, was Brian Thomas fehlte, als er seine Frau erwürgte. In jener Nacht war nämlich nichts wie sonst. Normalerweise schliefen er und seine 80 Das bewusste Selbst – In der Philosophie bezeichnet das bewusste Selbst die Fähigkeit, über wahrgenommene Reize und Gedanken zu reflektieren und zu begreifen, dass man diese Fähigkeiten besitzt. Das bewusste Selbst er- möglicht so, sich selbst als Individuum wahrzunehmen. Nur so ist es möglich, sich selbst als eigenständiges Wesen zu verstehen und zu begreifen, dass andere Lebewesen nicht dieselben Reize und Gedanken wahrnehmen. Psychose – Diese Erkrankung lässt die Grenzen der Realität verschwimmen. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, aber auch Antriebslosigkeit und Denkstörungen sind mögliche Symptome. Psychosen können organische Gründe wie eine Demenzerkrankung haben, die nicht organischen Ursachen sind noch nicht vollständig erforscht. Fest steht aber, dass manche Medikamente wie zum Beispiel hoch dosiertes Cortison Psychosen auslösen können. Die Welt im Kopf Frau in getrennten Zimmern. Sie war so geplagt von der Nachtaktivität ihres Gatten, dass sie in ein separates Schlafzimmer zog – mit dem Hausschlüssel unter dem Kissen, um ihren Mann daran zu hindern, im Freien herumzustolpern. Doch in der Tatnacht war das Paar im Campingurlaub, schlief ausnahmsweise nebeneinander. Da schreckte sie eine Gruppe Halbwüchsiger mit Motorenlärm auf. Die Eheleute suchten sich einen neuen Standort für ihr Wohnmobil. Diesen Zwischenfall nahm Brian offenbar mit in den Schlaf. Anders als zuvor reagierte er diesmal aggressiv. Im Traum griff er die vermeintlichen Störer an – in Wirklichkeit seine Frau. Wieder wach, wählte er den Notruf: »Ich glaube, ich habe meine Frau umgebracht. O mein Gott! Ich muss geträumt haben. Was habe ich nur getan?« Was genau in jener Nacht in Brian Thomas vorging, weiß niemand. Denn Schlafwandeln ist bis heute ein rätselhaftes Phänomen und erscheint wie das Gegenteil des Klarträumens: Schlafwandler sind zwar körperlich aktiv, aber eben nicht bei Bewusstsein – sozusagen Teilzeitzombies. Sie agieren offenbar ähnlich wie wache Menschen, die sich zum Beispiel geistesabwesend duschen oder die Zähne putzen und sich hinterher darüber wundern, es getan zu haben. Nur ist bei Schlafwandlern der Geist nicht abwesend, sondern er schläft. Erstaunlich ist, zu welch komplexem Verhalten sie fähig sind. Im Juli 1833 erhob sich in Massachusetts die Hausangestellte J­ane ­R ider schlafwandelnd aus dem Bett, deckte säuberlich den Frühstückstisch, schöpfte sogar den Rahm von der Milch, ohne einen Tropfen zu verschütten – alles mit geschlossenen Augen. Im Mai 1987 stand der kanadische Student Kenneth Parks von seiner Couch auf, fuhr 23 Kilometer zu seinen Schwiegereltern und griff sie mit einem Küchenmesser an. Seine Schwiegermutter starb. Er wurde, wie Brian Thomas, freigesprochen. Dem Schweizer Neurologen Claudio Bassetti ist das Kunststück gelungen, einen schlafwandelnden Probanden in einen Gehirnscanner zu bugsieren. Die Aktivität im präfrontalen Kortex und in anderen Regionen, die für absichtsvolles Handeln zuständig sind, war deutlich reduziert, während die emotionalen Zentren stark durchblutet waren. Wenn sich das verallgemeinern lässt, handeln Schlafwandler zwar sehr emotional, aber nicht willentlich. Und damit auch ohne die Mens rea der Juristen. Ob Brian Thomas allerdings ein klassischer Schlafwandler ist, weiß man nicht. Er könnte auch an einer anderen Schlafstörung namens REM sleep behavior disorder (REM-Schlaf-Verhaltensstörung, abgekürzt RBD) leiden, die erst in den achtziger Jahren entdeckt wurde. Auffällig häufig tritt RBD zusammen mit Parkinson auf – woran auch Thomas leidet. Zwar geistern RBD-Patienten ebenfalls nachts herum, aber im Unterschied zu Schlafwandlern träumen sie dabei. Ihr Gehirn versäumt es, sich vom Körper abzukoppeln. Daher leben sie ihre Träume in der wirklichen Welt aus. Und weil sie häufig Albträume haben, beginnen sie zu randalieren. Geübte Beobachter erkennen den Unterschied im Grenzzustände des Gehirns 81 REM sleep behavior disorder (RBD) – Normalerweise erschlafft die Skelett­– muskulatur im REM-Schlaf. Bei RBD-Betroffenen ist das nicht der Fall, sodass sie zu komplexen, zielgerichteten Bewegungen fähig sind. Insbesondere Träume, in denen sie meinen, angegriffen zu werden, führen zu einer hohen Fremdund Eigengefährdung, zu blauen Flecken und sogar Knochenbrüchen. Mehr als 80 Prozent der Betroffenen sind älter als 60 Jahre, die meisten männlich. Parkinson – Bei Betroffenen sterben im Mittelhirn die Dopamin produzierenden Nervenzellen ab, sodass das Großhirn nicht mehr ausreichend aktiviert wird. Die Folge: verlangsamte Bewegungen, Muskelsteifheit, Zittern und wachsende Unsicherheit beim Gehen und Stehen. Parkinson tritt meist zwischen dem 50. und 80. Lebensjahr auf. Heilbar ist es derzeit nicht, die Symptome können aber gut behandelt werden. Bewusstsein zwischen Schlafwandlern und RBD-Erkrankten am Verhalten: »Schlafwandler agieren nur«, sagt Ursula Voss, »Menschen mit RBD reagieren auch.« Doch sind sie für das, was sie dabei tun, ebenso wenig verantwortlich wie gesunde Träumer für ihre im Kopf begangenen Untaten, zu denen sie sich im Wachen niemals hinreißen lassen würden. Bereits der heilige Augustinus, der sich vor 1600 Jahren vom Partylöwen in einen bedeutenden Theologen wandelte, wunderte sich über den Unterschied zwischen dem wachen und dem schlafenden Selbst: »Bin ich dann nicht ich, Herr, mein Gott?«, fragte er in seinen Confessiones. »Wahrhaftig, solch ein Unterschied ist zwischen mir und mir, schon innerhalb des Augenblicks, wo ich von hinnen in den Schlaf hinübergehe oder vom Schlafe zurück herüberkomme.« Für so groß erkannte er den Unterschied, dass er sich die Verantwortung für Traumtaten absprach: »Nicht wir haben es getan, was da irgendwie an uns geschieht.« Auch Augustinus hätte Brian Thomas wohl freigesprochen. von Tobias Hürter aus dem ZEIT Wissen Ratgeber Nr. 2/2013 82 Die Welt im Kopf Sehnsucht nach Schlaf Unser hektischer Alltag erzeugt chronischen Schlafmangel. Erwachsene kann er in den Burn-out treiben und Schulkinder zu Zappelphilippen machen. Wir brauchen eine neue Schlafkultur! Einmal im Jahr, wenn an einem Sonntag im Herbst die Uhren eine Stunde zurückgestellt werden, wird uns allen eine Stunde Schlaf geschenkt. Diese Stunde haben wir bitter nötig. Denn viele von uns sind chronisch übermüdet – und die meisten merken es nicht einmal. So wie die Tänzerinnen des Berliner Staatsballetts, die der Mediziner Ingo Fietze untersuchte. Fast zehn Wochen lang führten sie ein Tagebuch, in dem sie ihre Schlafzeiten vermerkten. Zugleich trugen sie sogenannte Aktometer am Handgelenk, die jede Bewegung aufzeichnen. Damit konnte Fietze, Schlaflaborleiter an der Berliner Charité, für jede Ballerina ein Tätigkeitsprofil erstellen. Der Vergleich zwischen den Tagebuchnotizen und seinen Daten zeigte: Viele der Untersuchten überschätzten ihre Ruhezeiten und häuften ein beachtliches Schlafdefizit an. Die Berliner Ballerinen sind typische Vertreter unserer Leistungsgesellschaft – junge, gut trainierte Menschen, die einen fordernden Job bewältigen. Ebenso typisch ist, dass sie zu wenig Schlaf bekommen und dafür das Gespür verloren haben. Im hektischen Alltag bekommen heute viele Menschen zu wenig Schlaf. Und darunter leidet das körperliche wie das seelische Gleichgewicht. Stu­dien belegen: Wer zu wenig schläft, wird leichter Opfer eines Burn-outs, er erhöht sein Risiko für Übergewicht und Diabetes ebenso wie für Depressionen und Angsterkrankungen. Und bei Kindern gilt Schlafmangel inzwischen sogar als Auslöser für Hyperaktivität. Aktometer – Ein Messgerät zum Erfassen der Bewegungsaktivität. Es sieht aus wie eine klobige Uhr und wird am Handgelenk oder Knöchel des nicht dominanten Fußes (bei Rechtshändern meist der linke Fuß) getragen. Das Gerät zeichnet dreidimensional Beschleunigungen auf. So kann ein Profil der Bewegungs­intensität erstellt werden. Mit diesen Werten lassen sich Rückschlüsse auf Schlaf­pro­ble­me und Erkrankungen ziehen. Depressive Menschen etwa weisen in den Nachtstunden eine höhere motorische Ak­ti­vi­ tät auf als gesunde. Grenzzustände des Gehirns 83 Wissenschaftler haben in zahlreichen Untersuchungen dokumentiert, wie der Schlaf an Raum verliert. »Die Menschen in westlichen Ländern schlafen im Durchschnitt etwa eine Stunde weniger als vor 20 Jahren«, fasst der Schlafmediziner Thomas Pollmächer vom Klinikum Ingolstadt die Datenlage zusammen. Als ideale Schlafdauer für die Mehrheit der Erwachsenen gelten sieben bis neun Stunden. Allerdings gibt es enorme Unterschiede. Für einige sind schon fünf Stunden genug, andere brauchen mindestens zehn Stunden Schlaf. Umfragen zufolge schläft der Deutsche im Schnitt sieben Stunden und acht Minuten. Das heißt aber auch: Viele schlafen deutlich länger, andere sehr viel kürzer. Zu den Unausgeschlafenen gehören vor allem Leistungsträger – und Schüler. Oft wird einfach zu viel gearbeitet. 1,7 Millionen Erwerbstätige in Deutschland arbeiten laut Statistischem Bundesamt pro Woche 60 oder mehr Stunden. »Und je mehr die Men­ schen arbeiten, desto weniger schlafen sie«, sagt Mathias Basner von der University of Pennsylvania in Philadelphia. Er hat das Schlafverhalten empirisch ausgewertet und festgestellt: Viele Menschen stehen morgens extra früh auf, um abends keine Freizeit zu opfern. Zu Bett gehen dann alle fast zur selben Zeit, meist nach der Lieblingssendung im Fernsehen. »Es ist absurd«, sagt Basner, »alle wissen, wie gut Schlaf tut, doch den meisten ist fast alles andere wichtiger.« Die Wissenschaft hat längst gezeigt, wie wichtig der Nachtschlaf ist. Währenddessen werden Organe und Gewebe regeneriert, Infekte bekämpft, Ein drücke verarbeitet, wichtige Erinnerungen verfestigt und unwichtige verworfen. »Wir müssen schlafen, um geistig und immunologisch fit zu bleiben«, bilanziert der Lübecker Endokrinologe Jan Born. Wer ausreichend schlafe, betreibe »aktives Anti-Aging«. Warum wir uns diese Wellness vorenthalten? Vielleicht weil das Gefühl fürs rechte Maß so leicht abhandenkommt. Das zeigt ein berühmt gewordenes Experiment des US-Psychiaters David Dinges. Tagsüber quälte er seine Probanden mit Leistungstests, nachts gönnte er ihnen unterschiedlich lange Ruhe. Manche durften in seinem Schlaflabor in Philadelphia acht Stunden schlafen, andere nur sechs oder vier. Im Laufe der zweiwöchigen Experimentierphase zeigte sich: Nur die Ausgeschlafenen blieben auf der Höhe ihrer Leistung. Die anderen zeigten von Tag zu Tag größere Schwächen; je weniger Schlaf sie bekamen, umso schlechter wurden ihre Testergebnisse. Erstaunlich war allerdings, dass die Wenigschläfer nach etwa vier Tagen nicht mehr müder wurden, sondern sich regelrecht ans Übernächtigtsein gewöhnten. Offenbar macht uns anhaltender Schlafmangel also dümmer, ohne dass wir es merken. Und wie holt man die versäumte Nachtruhe am besten auf? Reicht dazu ein Wochenende? In einer zweiten Studie gönnte Dinges seinen Testschläfern fünf Nächte lang jeweils nur vier Stunden Schlaf und ließ sie danach ausschlafen. Ergebnis: Nach dem Leistungsabfall unter der Woche wurden die Testergebnisse zwar durch längere Bettruhe besser; doch selbst zwei Nächte mit zehn oder mehr Stunden im Bett brachten keine vollständige Erholung, berichtet Mathias Basner, 84 Die Welt im Kopf der zum Team von Dinges gehört: »Vieles deutet darauf hin, dass es ein Gedächtnis für Schlafmangel gibt.« Dabei könnte man das »Schlafkonto« eigentlich leicht auffüllen – mit dem altbewährten Mittagsschlaf. Denn Forscher haben gezeigt, dass wir unsere Schlafration gar nicht am Stück brauchen; auch eine Siesta zwischendurch hilft. In Japan etwa wird deshalb der »Anwesenheitsschlaf« Inemuri praktiziert: Die Samurai erfanden ihn, um gleichzeitig wachen und schlummern zu können. Heute gilt in Japan ein Nickerchen am Arbeitsplatz – oder gar im Parlament – als Ausweis besonderen Eifers. Denn dabei erholt sich, wer besonders fleißig war. In Deutschland dagegen mangelt es dem Kurzschlaf an kultureller Akzeptanz, wie die Bezirksverwaltung Charlottenburg-Wilmersdorf erleben muss­te. Als sie vor drei Jahren spezielle Räume für Nickerchen einrichten lassen wollte, scheiterte sie kläglich – und zwar an den eigenen Mitarbeitern. Die Beamten fürchteten die Häme der Bürger. Dabei könnten solche Ruheräume für viele Berufstätige ein Segen sein, zum Beispiel für Piloten, Lkw-Fahrer oder Schichtarbeiter. Denn wer zu oft zu wenig Schlaf bekommt, läuft Gefahr, an Insomnie zu erkranken. Jeder zwanzigste Deutsche sollte sich deshalb in ärztliche Behandlung begeben. Doch statt ihren Lebensstil zu ändern, nehmen viele Betroffene ständig Schlafmittel – bis diese eines Tages nicht mehr wirken. Schichtarbeit – Sie führt häufig zu einer Diskrepanz zwi­schen der inneren Uhr des Menschen und seinen äußeren Lebensumständen. Manchen Studien zufolge klagen bis zu 90 Prozent der Nacht­schicht­arbei­ ter über regelmäßige Schlafstörungen. In der Forschung wird derzeit diskutiert, ob eine Lichttherapie – blaues Licht ­etwa hält wacher als rotes – dabei helfen kann, den Biorhythmus besser umzustellen. Insomnie – Dazu zählen Ein- und Durchschlafprobleme, die durch unregelmäßigen Schlaf, erlernte falsche Schlafmuster oder organische, neu­ro­lo­ gi­sche sowie psychologische Faktoren verursacht werden. Ein Therapieansatz ist das Biofeedback-Training. Dabei wird die Muskelspannung gemessen und in ein akustisches oder visuelles Signal übertragen, das dem Patienten als Rückmeldung dient. Dies hat sich bei Menschen, die ihre eigene Anspannung nicht spüren oder sich schlecht entspannen können, als wirksam erwiesen. Schlafmittel – haben Nebenwirkungen und können abhängig machen. Besser ist es, auf einen festen Rhythmus und gute Schlafbedingungen wie die richtige Raumtemperatur zu achten, um chronische Schlafprobleme zu bekämpfen. Eine weitere Alternative zu Tabletten sind einer neuen Studie zufolge: Hängematten. Dank der Schaukelbewegungen schliefen die Probanden schneller ein – und womöglich auch tiefer. Grenzzustände des Gehirns 85 Zu einer modernen Schlafkur gehört daher zunächst der Entzug von Schlafmitteln. Anschließend üben die Patienten, etwa mit kognitiver Verhaltenstherapie, Probleme zu erkennen, Gewohnheiten zu ändern, Schlafzeiten bewusst zu begrenzen. Wer lange falsch geschlafen hat, muss es oft erst mühsam wieder lernen. Orangefarbene Isomatten und Beruhigungsmusik gehören seit Kurzem auch für einige Fünft- und Siebtklässler in Steinfurt im Münsterland zum Unterricht. »Viele Kinder können nicht mehr abschalten, schlafen zu wenig und stehen pausenlos unter Strom«, erklärt die Stressberaterin Gerlinde Lamberty. Deshalb übt sie mit den Kleinen nun Entspannungstechniken. Zehn bis elf Stunden Nachtruhe empfehlen Experten für Grundschüler; Zwölfjährige brauchen im Mittel neuneinhalb Stunden Schlaf. Erst zum Ende des Teenageralters nähert sich das Schlafbedürfnis dem der Erwachsenen an. Doch »nur acht Prozent der Jugendlichen schlafen unter der Woche so viel, wie es gängigen Empfehlungen entspricht«, fand der Schlafmediziner Thomas Voderholzer durch Umfragen heraus. Der längere Schulunterricht fordert seinen Tribut ebenso wie Sportverein, Fernsehen, Computerspiele und Internet. Zudem werden Pubertierende schon von Natur aus später müde und deshalb morgens nicht rechtzeitig wach. Die St. George’s School in Middletown, USA, verschob im vergangenen Schuljahr für neun Wochen den Unterrichtsbeginn von acht Uhr auf halb neun. Das zeigte Wirkung: Hatte vorher nur ein Sechstel der 201 untersuchten Teenager mindestens acht Stunden pro Nacht geschlafen, war es nun über die Hälfte. Außerdem erwiesen sich die Schüler als aufmerksamer, sie gingen seltener zum Schularzt und waren weniger trübsinnig. Eine Mehrheit der Schüler und Lehrer forderte daraufhin mit Erfolg den permanenten späteren Schulbeginn. In Deutschland hat vor fünf Jahren eine Statistik gezeigt, dass »Eulen«, die von Natur aus später einschlafen, signifikant schlechtere Abiturnoten haben als früh aufstehende »Lerchen«. Doch wie bemerken Eltern den Schlafmangel ihres Kindes? »Konzentrationsschwäche, gesteigerte Impulsivität und Tagesmüdigkeit«, zählt Oskar Jenni vom Universitäts-Kinderspital Zürich die Symptome auf. Zwar gebe es auch bei Kindern große Differenzen: Manchen genügten acht, anderen erst elf Stunden Schlaf. Ein Alarmsignal sei aber, wenn der Nachwuchs am helllichten Tag bei einer halbstündigen Autofahrt wegnicke: »Schulkinder können tagsüber eigentlich nicht schlafen.« Schülern hilft der Schlaf vor allem bei der Gedächtnisbildung: Befreit von äußerem Input, wiederholt und festigt das Gehirn jene Lerninhalte, die es sich zuvor angeeignet hat. Gerade der lange Schlaf der Kinder ermögliche ihnen ihre »extremen Fähigkeiten beim Lernen«, sagt der Schlafforscher Jan Born. Dass die Leistungen im Alter abnähmen, liege auch daran, dass die Menschen dann immer weniger tief schliefen. Regelmäßig genug zu schlafen würde allen nützen: Alten und Jungen, Kranken und Gesunden. Schon vergleichsweise simple Maßnahmen versprechen große Vorsorgewirkung. Sieben zentrale Forderungen für eine ausgeschlafene Gesellschaft lauten deshalb: 1. Schlaf und Entspannung verdienen in der Gesundheitsvorsorge denselben Stellenwert wie Bewegung und ausgewogene Ernährung. 2. Die Sommerzeit verschiebt die Rhythmen vieler Menschen nach hinten – und erschwert so das Einschlafen. Sie gehört abgeschafft! 3. Arbeitszeiten müssen flexibler werden – nur so vertragen sie sich mit dem individuellen Schlafrhythmus und -bedarf vieler Menschen. 4. Die Schule sollte später beginnen. G-8-Gymnasien sollten Lehrpläne entschlacken oder zu neun Schuljahren zurückkehren. 5. Fördern wir Nickerchen am Arbeitsplatz. 6. Mehr Rhythmus! Arbeit und Unterricht brauchen Unterbrechungen, damit wir uns bewegen und entspannen können. Und abends sollten wir früher ins Bett gehen. 7. Erkennen wir den großen Einfluss an, den das Tageslicht auf unseren inneren Rhythmus hat. Richten wir uns danach. Beim Berliner Staatsballett hat man bereits umgedacht: Wenn sich schon an der körperlichen Belastung, dem Lampenfieber oder dem Druck auf die Tanzprofis nichts ändern ließ, so sollten diese wenigstens ihrem Schlafbedürfnis gehorchen können! Ingo Fietze richtete einen Ruheraum ein und plante eine Folgestudie. Ein Ergebnis steht schon fest: »Der Ruheraum ist dauernd besetzt.« von Peter Spork aus dem ZEIT Wissen Ratgeber Nr. 3/2011 Eulen – nennt man Nachtmenschen und Langschläfer; als Lerchen bezeichnet man dagegen Frühaufsteher. Zu welchem Typ man zählt, ist genetisch bedingt und hängt von der inneren Uhr 86 Die Welt im Kopf ab. Sie ist unser biologischer Taktgeber. Ein wenig ändert sich der Takt jedoch im Laufe des Lebens: Kinder sind eher Lerchen, in der Pubertät wird man zur Eule. Grenzzustände des Gehirns 87 Stichwort Vielleicht auch träumen Warum reisen wir im Schlaf mehrmals pro Nacht in eine Fantasiewelt? Wa­rum erleben wir dort imaginäre Begebenheiten, vollbringen imaginäre Taten – was hat es zu bedeuten? Sind unsere Träume ein Tor zum Unbewussten – und können wir sie deuten? 88 Die Welt im Kopf Träume können furchterregend sein oder beruhigend. Träume sind fantastisch, da in ihnen unmögliche und unlogische Dinge geschehen können und geschehen. Im Traum kann man fliegen, Tote erwachen zum Leben, unbelebte Gegenstände können sprechen. REM-Schlaf Die meisten Menschen träumen im Durchschnitt jede Nacht ein bis zwei Stunden und haben vielerlei Träume. Die meisten Träume werden komplett wieder vergessen, und daher behaupten manche Menschen, sie würden nicht träumen. Forscher haben festgestellt, dass viele Menschen sich ziemlich genau an ihre Träume erinnern können, wenn man sie unmittelbar nach einer REM-Schlafphase weckt (REM steht für rapid eye move­ment). Eine Person, die während des REM-Schlafs geweckt wird, kann fast immer von einem Traum berichten, häufig sehr detailliert. Solche Berichte lassen vermuten, dass man bei Bewusstsein ist, wenngleich man sich nach dem Erwachen nicht immer daran erinnern kann. Hirnstrom-Studien haben gezeigt, dass wir in dieser Schlafphase sehr aktiv sind; bei Männern können Erektionen auftreten, bei Frauen eine verstärkte Durchblutung der Vagina. Traumarten Man sagt, das Wort »Traum« sei von den Wörtern für »Freude« und »Musik« abgeleitet. Viele Menschen sprechen von allerlei verschiedenen Arten von Träumen: von sehr klaren, aber auch von vagen Träumen; von Albträumen und wunderbaren Träumen. Kinder zwischen drei und acht berichten häufig von Albträumen; sind sie jünger als drei oder vier Jahre, scheinen sie selbst kaum eine Rolle in den eigenen Träumen zu spielen. Viele von ihnen berichten von wiederkehrenden Träumen, die sie zum Teil fürchten, zum Teil herbeisehnen. Manche glauben, ihre Träume seien prophetisch. Fast zwei Drittel der Menschen geben an, Déjà-vu-Träume erlebt zu haben. Gewiss gibt es Träume, die über alle Kulturen hinweg zu allen Zeiten von allen Menschen geträumt werden. Der Traum vom Fliegen tritt häufig auf: Menschen berichten, sie könnten fliegen wie ein Vogel, vielleicht mithilfe von Armbewegungen wie beim Brustschwimmen. Andere berichten über Träume vom Fallen, dass sie zum Beispiel von einem hohen Gebäude hinunterfallen oder endlos lange in einen dunklen Abgrund stürzen – oder dass sie einfach ständig hinfallen. Viele träumen davon, plötzlich nackt zu sein und sich vor anderen sehr zu schämen. Der Verfolgungstraum tritt häufig auf: Meist wird man von anderen erbarmungslos gejagt, doch mitunter verfolgt man sie auch selbst. Schüler und Studenten kennen den Traum von der Klassen- oder Prüfungsarbeit: Man sitzt in einer Prüfung und kann sich – trotz ausgiebiger Vorbereitung – partout an nichts erinnern, oder, schlimmer noch, man ist wie gelähmt und kann nichts schreiben. Der Traum, seine Zähne zu verlieren, ist ebenfalls erstaunlich verbreitet. Deutungen Natürlich sind diverse Deutungen solcher Träume vorgeschlagen worden. Zeigt der Traum vom Zahnausfall an, dass man übermäßig um seine körperliche Attraktivität besorgt ist? Symbolisiert er vielleicht Machtverlust und Altern oder die Sorge, man würde übersehen oder nicht ernst genommen? Vielleicht stehen die Zähne für orale Waffen, die ausfallen, weil man Unwahrheiten über andere gesagt hat. Es ist sogar vorgeschlagen worden, dass es dabei um Geld geht: Die Hoffnung, eine fabelhafte Zahnfee würde erscheinen und den Träumenden mit viel Geld beglücken. Doch wie lässt sich der Nackttraum deuten? Geht es dabei nur um Verletzlichkeit und Scham? Man verheimlicht gewisse Informationen, vielleicht eine Affäre, tut etwas Verbotenes und hat ein schlechtes Gewissen. Träume haben nur in Verbindung mit dem Leben des Träumenden eine Bedeutung. Donald Broadribb, 1987 Stichwort 89 Der Traum ist die Spiegelung der Wellen des unbewussten Lebens am Boden der Fantasie. Henri-Frédéric Amiel, 1882 Schlimmer noch, man hat Angst, ertappt und beschämt zu werden, sich lächerlich zu machen. Oder könnte er bedeuten, dass man sich unvorbereitet fühlt für eine wichtige Prüfung oder Aufgabe? Ein seltsamer Umstand ist, dass man sich seiner Nacktheit selbst bewusst ist, doch niemand anders darauf zu achten scheint. Das könnte darauf hindeuten, dass man Sorgen hat, die man aber eigentlich für unbegründet hält. Freudsche Ideen Sigmund Freud vertrat die These, dass Träume aus unseren inneren Konflikten zwischen unbewussten Wünschen und gesellschaftlich auferlegten Verboten, diese Wünsche auszuleben, entstehen. Demnach repräsentieren alle Träume unerfüllte Wünsche, deren Inhalt symbolisch verkleidet ist. Der latente Inhalt wandelt sich zum manifesten Inhalt (der Handlung), der erklärt werden muss, um – der Theorie zufolge – die unbewussten Wünsche der jeweiligen Person zu enthüllen. Träume sind symbolisch; sie sind Metaphern für unsere wahren, zugrunde liegenden Gefühle. Die Traumdeutung war Freuds bevorzugte Methode, um zu einem Verständnis dieses Konflikts zu kommen, und so ermutigte er seine Patienten, rückhaltlos über ihre Träume zu sprechen. Aus seiner Sicht geht es in Träumen um Vergangenheit und Gegenwart eines Menschen, und sie erwachsen aus unbekannten inneren Gefilden. Jeder Traum ist im Kern ein Versuch der Wunscherfüllung. Träume sind der »Königsweg zur Kenntnis des Unbewußten«. Im Traum finden verschiedene Prozesse statt, zum Beispiel die Verdichtung, bei der Themen auf einzelne Bilder reduziert werden, etwa eine offene Tür oder einen tief fließenden Fluss. Psychoanalytiker interessieren sich besonders für die Verschiebung, bei der Menschen, Gegenstände und bestimmte Handlungen einander ersetzen. Außerdem gibt es die Entstellung, bei der Menschen größer oder kleiner, älter oder jünger, mehr oder weniger mächtig werden. Die Freudsche Theorie führt zu diversen Vorhersagen über das Träumen, die inzwischen geprüft wurden. So sollten Männer häufiger Träume über Kastrationsängste haben als Frauen, die dagegen häufiger von Penisneid geprägte Träume haben müssten. In den Träumen von Männern sollten häufiger männliche Unbekannte auftreten, gegen die sie kämpfen (der Vater in der ödipalen Entwicklungsphase). 90 Die Welt im Kopf Evolutionspsychologie Evolutionspsychologen haben darauf hingewiesen, dass es in vielen Träumen um Bedrohung und Gefahr geht, und sie argumentieren, die Funktion von Träumen sei die Darstellung realer, alltäglicher Gefahren, anhand derer wir uns verschiedene Reaktionen vorstellen und sie so durchspielen können. Wäre diese These richtig, müssten die meisten Menschen von realistischen Träumen über aktuelle oder vergangene Bedrohungen in ihrem Umfeld berichten. Freilich scheint diese Erklärung drei Proble- me aufzuwerfen: Erstens geht es in vielen Träumen um positive Gefühle und Ereignisse, insbesondere sexuelle Erfüllung. Zweitens scheinen in vielen Träumen Situationen »verarbeitet« zu werden, die sich am gleichen Tag oder kurz zuvor abgespielt haben, aber nicht unbedingt belastend oder bedrohlich waren. Drittens scheint nicht klar zu sein, wie Träumen tatsächlich eine bessere Anpassung – ein zentrales Konzept der Evolutionspsychologie – lehrt oder fördert. Kritiker fragen, wenn Träume lediglich Wunscherfüllung seien, warum dann so viele davon negativ sind? Zudem gründete Freud seine Theorie auf die wenigen Träume (unter zehn Prozent), die von Patienten erinnert und geäußert werden. Drittens gibt es ein gravierendes Problem mit der Zuverlässigkeit von Traumdeutungen, da verschiedene Therapeuten sehr unterschiedliche Deutungen anbieten. Viertens scheinen Träume, worauf auch C. G. Jung hingewiesen hat, durchweg ähnliche Themen zu haben, und zwar über Zeitalter und Kulturen hinweg, seien sie nun zutiefst repressiv oder erstaunlich liberal. Physische Studien Wissenschaftler haben eine Erklärung für das Träumen vorgeschlagen, die ohne unbewusste Konflikte oder Wünsche auskommt. In der REM-Schlafphase wird ein Schaltkreis von Acetylcholinsekretierenden Neuronen im Pons Varoli (der Gehirnbrücke) aktiv und stimuliert rapide Augenbewegungen, Aktivierung der Hirnrinde und Dieser Tagesrest wird durch die Traumarbeit in einen Traum verwandelt und durch den Schlaf unschädlich gemacht. Sigmund Freud, 1905 Stichwort 91 Ich habe Freud nie recht geben können, daß der Traum eine ›Fassade‹ sei, hinter der sich sein Sinn verstecke; ein Sinn, der schon gewußt ist, aber sozusagen boshafterweise dem Bewußtsein vorenthalten werde. C. G. Jung, 1963 Muskellähmung, wodurch man Bilder sieht. Die Augenbewegungen, die ein Träumender macht, korrespondieren relativ gut mit dem Inhalt seines Traums; die Augenbewegungen entsprechen denen, die auch zu erwarten wären, wenn das geträumte Geschehen tatsächlich stattfinden würde. Die entstandenen Bilder reflektieren häufig Erinnerungen an kurz zuvor erlebte Episoden oder Gedanken. Vermutlich werden die zuständigen Schaltkreise durch ihren erst kurz zuvor erfolgten Gebrauch stärker angeregt. Patienten, die auf eine größere Operation warten, offenbaren ihre Ängste in den Träumen, die sie in den zwei oder drei Nächten vor der Operation haben. Solche Ängste, bei denen es um Skalpelle und OP-Säle geht, werden selten direkt artikuliert; der Bezug ist indirekt, in verdichteter, symbolisierter Form. Häufig drücken Träume das aus, was momentan im Leben einer Person am wichtigsten ist, und nicht etwa irgendein tief liegendes Konzept der Wunscherfüllung. Adrian Furnham Die Dramaturgie der Nacht Im Schlaf räumt das Gehirn auf und festigt Erinnerungen. Schlafforscher erkunden, warum wir dabei so wirres Zeug träumen. 21.00 Uhr (Müdigkeit) Die Nacht beginnt mit dem Lichtwechsel. Lichtempfindliche Zellen in der Netzhaut des Auges melden ans Gehirn: Schlafenszeit! Die Zellen stammen aus den Urzeiten der Evolution und dienen nicht dem Sehen, auch bei Blinden können sie intakt sein. Sie registrieren das Rot des Sonnenuntergangs. Blaues Bildschirmlicht verwirrt sie und behindert das Einschlafen. Auf das Signal der Augen hin schüttet die Zirbeldrüse tief im Gehirn Melatonin aus, das Hormon der Nacht. Es macht schläfrig und sexuell träge und bereitet den Körper auf den Schlaf vor. Eine komplizierte Kaskade von Proteinen und chemischen Botenstoffen kommt in Gang. Manche dieser Stoffe vertiefen den Schlaf. Manche machen wach. Andere blockieren die Wachmacher. Koffein blockiert die Blockierer. 23.00 Uhr (Einschlafen) Die Wirkung des Melatonins wird stärker, die Gedanken fließen langsamer, die Reaktionszeiten werden länger, die Muskelspannung sinkt. Man neigt zum Frösteln, die Körpertemperatur liegt ein halbes Grad Celsius unter ihrem Durchschnittswert. Mit der Temperatur sinkt auch die Stimmung. Melatonin macht melancholisch, daher kommt die Nacht uns manchmal düster vor. Licht aus, der Kopf sinkt ins Kissen. Das Gehirn ist nun mit sich selbst beschäftigt. Sobald die Augen geschlossen sind, ebben die schnellen Hirnstromwellen ab, die im Wachen vorherrschen. Stattdessen branden die gemächlicheren Alpha-Wellen auf, die allen Hirnarealen signalisieren, dass es Zeit zum Entspannen ist. Allerdings hören nicht alle Areale gleich schnell auf sie. Der Thalamus, eine evolutionär uralte Struktur mitten im Gehirn, dämmert etwa neun Minuten früher weg als die Großhirnrinde. Diese neun Minuten versetzen das Bewusstsein in einen anderen Zustand, genannt »Hypnagogie«. Der Thalamus ist der Torwächter des Bewusstseins. Er 92 Die Welt im Kopf Grenzzustände des Gehirns 93 Motorisches Zentrum Präfrontaler Kortex Limbische Bahn Limbisches System Thalamus Hypothalamus Visueller Assoziationskortex Amygdala Zirbeldrüse Hippocampus Basalganglien Hirnstamm Cerebellum entscheidet, welche Signale aus anderen Arealen zur Großhirnrinde dürfen. Was er für unwichtig befindet, hält er zurück. Beim Einschlafen bleibt die Großhirnrinde unbeaufsichtigt. Sie kann nach Belieben mit Bildern und Ideen spielen. Die Gedanken werden immer eigenartiger, ketten sich assoziativ statt logisch aneinander. Manche Menschen beginnen zu halluzinieren. Das kann ergiebig sein. Der Chemiker August Kekulé kam im Jahr 1865 beim Dösen am Kaminfeuer auf die lange gesuchte Struktur des Benzolmoleküls. Robert Louis Stevenson ließ sich von hypnagogen Fantasien zu seiner Geschichte Dr. Jekyll and Mr. Hyde inspirieren, Mary Shelley zu ihrer Gruselromanze Frankenstein, Paul Klee zu vielen Gemälden. Nach einigen Minuten schließt sich das Hypnagogie-Fenster. An langsam rollenden Augenbewegungen erkennt der Mediziner vor dem Monitor im Schlaflabor, dass sein Proband gleich einschlafen wird. 23.30 uhr (Tiefschlaf) Jetzt ist das Bewusstsein ganz abgezogen von den Sinnen. In den folgenden Minuten sinkt der Schläfer stracks in den tiefsten Schlafzustand, den er in dieser Nacht erreicht. Kurz nach dem Einschlafen steigt der Pegel des Wachstumshormons Somatotropin auf sein 24-Stunden-Maximum. Es leitet Erholungsprozesse ein, 94 Die Welt im Kopf repariert müde Muskeln, lässt Haut, Haare und Knochen nachwachsen, reguliert den Fettstoffwechsel und das Immunsystem, entsorgt den Abfall des Stoffwechsels, fördert die Wundheilung. Wer verletzt ist, sollte viel schlafen. Im Gehirn geht es jetzt gemächlich zu. Es verbraucht um die Hälfte weniger Energie als im Wachen. Die Neuronen synchronisieren sich, sodass Wellen elektrischer Aktivität das Gehirn durchlaufen. Je müder der Schläfer vorher war, desto tiefer sinkt er jetzt: desto intensiver und länger wird sein Gehirn von diesen Delta-Wellen geflutet. In den Delta-Wellen vermuten Forscher den Schlüssel zum Verständnis des Tiefschlafs, vielleicht sogar die Antwort auf die Frage, warum wir überhaupt schlafen. Giulio Tononi von der University of Wisconsin hat die heute vorherrschende Theorie dazu entwickelt, der zufolge die Delta-Wellen unser Gehirn entrümpeln: Während des Tages bilden sich durch jede Erfahrung neue Synapsen zwischen den Gehirnzellen. Viele davon sind überflüssig und stören die wirklich bedeutenden Erinnerungen. Die Delta-Wellen spülen sie weg und schaffen Platz für Neues. Die zugrunde liegenden elektrochemischen Prozesse beobachtete Tononi zuerst an Fruchtfliegen, auch deren Gehirne reorganisieren sich im Schlaf. Gleiches wurde an Ratten nachgewiesen. Und in den Gehirnen von Ratten und Menschen, das schließen Wissenschaftler aus den Aufnahmen mit Kernspintomografen, gehen während des Schlafs ähnliche Dinge vor. Nach dem Ausmisten kommt das Aufräumen. Auch das geschieht im Tiefschlaf: Die Erinnerungen werden neu geordnet. Unser Gedächtnis muss im Alltag schwer zu vereinbarende Ansprüche erfüllen: Schnell aufnahmefähig soll es sein, schnell abrufbar, gleichzeitig von Dauer und zuverlässig. Wir wollen uns eine Telefonnummer nicht hundertmal durchlesen, bis sie im Gedächtnis bleibt, wir wollen uns schnell daran erinnern – und die Nummer vergessen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Zu viel für ein einzelnes System. Deshalb hat die Natur unser Gedächtnis aufgeteilt, in Zwischenspeicher und Langzeitspeicher. All die Informationen, die wir während des Wachlebens aufnehmen, landen vorläufig im Hippocampus, mitten im Gehirn. Dieser saugt Daten auf wie ein Schwamm. In den Synapsen der Großhirnrinde, unseres Langzeitspeichers, liegt unser Weltwissen. Sensible Daten also, die gut behütet werden müssen. Deshalb herrscht Wachstumskontrolle in der Großhirnrinde. Neue Neuronen und Synapsen wachsen dort eher selten und langsam. Unser Weltbild soll nicht bei jeder Kleinigkeit durcheinandergeraten. Irgendwann müssen Großhirnrinde und Hippocampus sich abgleichen, und das geschieht im Schlaf. Wichtige Erinnerungen wandern vom Hippocampus in die Großhirnrinde, unwichtige werden verworfen. Jan Born und sein Forschungsteam an der Universität Lübeck haben mit dem EEG verfolgt, wie die Großhirnrinde dem Hippocampus Aufnahmebereitschaft signalisiert und wie im Hippocampus die frischen Erinnerungen reaktiviert und zur Großhirnrinde abgeschickt werden. Victor Spoormaker und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München sahen im Hirnscanner, wie sich das Synapsennetzwerk Grenzzustände des Gehirns 95 dabei umorganisiert. Die Fernverbindungen zwischen den Hirnarealen sind stillgelegt, stattdessen bilden sich lokale Cluster. Diese Areale koppeln sich ab aus dem gehirnweiten Netz, um in Ruhe die neue Information verarbeiten zu können. Auch Hippocampus und Großhirnrinde liegen in so einem Cluster. Das große Reinemachen im Gehirn muss in der Abgeschiedenheit der Nacht stattfinden. Im Wachen würden sich die immer neu einlaufenden Wahrnehmungen und die reaktivierten Erinnerungen in die Quere kommen. Niemand würde wollen, dass sein Gehirn sich neu organisiert, während er Auto fährt. 0.30 uhr (Träumen) Nach einer guten Stunde Tiefschlaf kommt Unruhe in die Hirnstromkurven. Die ruhige Dünung der Delta-Wellen weicht einem tosenden Durcheinander von Theta-, Alpha- und Beta-Wellen. Auf dem Monitor im Labor sieht es aus, als würde der Schläfer erwachen. Tatsächlich ist im Gehirn jetzt nicht weniger los als am Tag. Für das Personal eines Schlaflabors sind diese Phasen eine spektakuläre Abwechslung in der nächtlichen Monotonie. Zuerst kündigen sie sich mit einem sanften Rollen der Augäpfel an. Dann beginnen die Augen, wild herumzuzucken. Dies sind die REM-Phasen (Rapid Eye Movement), in denen geweckte Schläfer fast immer von Träumen berichten. Das Startsignal zu jeder REM-Phase kommt aus dem Hirnstamm durch rhythmische elektrische Reize. Gleichzeitig strömt der anregende Botenstoff Acetylcholin durchs Gehirn. Teile der Großhirnrinde erwachen aus dem Tiefschlaf. Das Gehirn beginnt zu träumen. Von außen betrachtet, herrscht jetzt Ruhe: Die tragenden Muskeln sind schlaff, die Weckschwelle ist hoch. Aber im Innern des Körpers geht es rund: Blutdruck und Herzfrequenz steigen, die Atmung geht schneller, Penis und Klitoris neigen zu Erektionen. Das Gehirn ist abgeschottet von der Welt, aber es bleibt wachsam. Im Hirnscanner kann man beobachten, wie es auf ein Geräusch hin kurz aufhorcht, den REM-Zustand unterbricht, das Geräusch bewertet und nur weiterschläft, wenn es keine Gefahr erkennt. Träumen ist ein bewusster Zustand, aber ein anderer als Wachsein. Die logisch-analytischen Zentren gleich hinter der Stirn, die sonst unsere Triebe im Zaum halten, sind im REM-Schlaf außer Betrieb. Dafür laufen die visuellen und emotionalen Zentren auf Hochtouren. Daher sind Träume meist stark bildlich, sehr gefühlsbetont und oft unlogisch. Wozu dieser seltsame Zustand? Manche Forscher halten REM-Phasen für nichts weiter als Aufwachversuche des Gehirns und Träume für sinnloses Geflimmer. Andere betrachten Träume als überlebenswichtig, sie glauben, dass wir im Traum unser genetisch programmiertes Trieb- und Instinktverhalten in einer Szenen einer Nacht – aus der Sicht der Schlafwissenschaft Träume sind bizarr, weil ein Areal des präfrontalen Kortex stillgelegt ist, das sonst kognitive Prozesse steuert. 96 Die Welt im Kopf Basalganglien und Cerebellum, zwei für die Motorik wichtige Areale, sind aktiv und sorgen für bewegte Szenen. Der im REM-Schlaf aktive visuelle Assoziationskortex sorgt für bildhafte Träume. Die Verbindung zwischen dem Arbeitsgedächtnis und dem Koordinationszentrum Hippocampus ist blockiert. Zeit und Raum verschwimmen. Traumszenen sind oft emotional, weil das limbische System aktiv ist. Es ist beteiligt, wenn wir Angst, Scham, Freude empfinden. Der Hypothalamus steuert unser Triebverhalten. Er ist im Traum aktiv. Grenzzustände des Gehirns 97 selbst erzeugten virtuellen Welt erproben. Dafür spricht, dass Menschen im Embryonalstadium am meisten träumen, später immer weniger. Womöglich geht die Bedeutung der Träume noch darüber hinaus. Sie könnten für unseren Gefühlshaushalt eine ähnliche Funktion haben wie der Tiefschlaf für unser sachliches Gedächtnis: Entrümpeln und Aufräumen. Das Erlebte wird emotional neu bewertet. Ein bisschen so, wie Sigmund Freud es sich einst vorstellte. Vermutlich reorganisiert sich im Schlaf auch das moralische Urteilsvermögen. Erste Studien, die dieser These nachgehen, laufen. Bereits erwiesen ist, dass Schlafmangel die moralische Urteilskraft und das Risikobewusstsein schwächt – zwei Fähigkeiten, die für Politiker und für Soldaten in Kriegsgebieten besonders wichtig sind. Dummerweise ist Schlafmangel unter beiden Berufsgruppen verbreitet. Im REM-Schlaf ist das Gehirn ganz anders vernetzt als im Tiefschlaf, die Vernetzung ähnelt der im Wachen. Das Gehirn arbeitet nun »wie ein Webbrowser«, sagt Randy Stickgold von der Harvard University, »es gliedert neue Erfahrungen ein, indem es durch verschiedene Gedächtnissysteme surft, um Assoziationen und Verknüpfungen herzustellen, die uns helfen, die Welt zu verstehen.« Der REMSchlaf ist die Spielphase des Gehirns nach dem großen Aufräumen. Die folgenden Stunden vergehen im Wechsel zwischen Tiefschlaf und REM-Schlaf. Im Lauf der Nacht wandelt sich allerdings das hormonelle Milieu Schlafbedürfnis REM-Phasen 24 20 16 12 8 4 0 Säugling 16 8 Kleinkind 10,5 2,5 Teenager 8,5 2 Säugetiere und Vögel haben REMPhasen (rot), in denen sie vermutlich träumen. Je schneller der Stoff wechsel, desto mehr Schlaf braucht eine Tierart meistens. Erwachsener 7 1,6 Senior 6 1 Je jünger ein Mensch ist, desto mehr schläft er. Forscher vermuten, dass sich das Babygehirn im REM-Schlaf regelrecht programmiert, indem es, genetisch gesteuert, Synapsen verknüpft. des Gehirns. Das wach machende Stresshormon Cortisol übernimmt das Regime. Gegen Morgen verbringen wir immer mehr Zeit im REM-Schlaf. 4.00 uhr (tiefste Nacht) Physiologisch gesehen, ist jetzt allertiefste Nacht: maximaler Melatonin-Spiegel, minimale Körpertemperatur. 98 Prozent der Menschen schlafen, die höchste Quote im Tagesverlauf. Die restlichen zwei Prozent kämpfen mit der Schläfrigkeit. Schichtarbeitern unterlaufen jetzt die meisten Fehler, Autofahrern passieren die meisten Unfälle. In Labortests zeigen Probanden schon nach drei Stunden simulierter Nachtfahrt so schlechte Werte in Aufmerksamkeits- und Reaktionstests wie mit 0,8 Promille Blutalkohol. Deshalb empfehlen Mediziner, nachts maximal zwei Stunden am Stück zu fahren. 7.00 uhr (Aufwachen) Es lohnt sich, nach dem Weckerklingeln noch etwas liegen zu bleiben und das allmähliche Erwachen des Gehirns zu verfolgen. »Hypnopompie« heißt dieser Zwischenzustand: »am Ausgang des Schlafs«. Lange Zeit unterschieden Fachleute nicht zwischen Hypnagogie und Hypnopompie. Doch Aufwachen ist nicht umgekehrtes Einschlafen: Thalamus und Großhirnrinde wachen gleich schnell auf – oder besser gesagt: gleich langsam. PET-Scans zeigen, dass das Stirnhirn bei manchen Menschen mehr als 20 Minuten braucht, um aus dem Schlaf zu kommen. Die Folge: lange Reaktionszeit, schwache Konzentration. Unmittelbar nach dem Aufwachen aus acht Stunden gutem Schlaf arbeiten Gedächtnis und Kognition schlechter als nach 24 Stunden Schlafentzug. Dagegen springt das vordere Cingulum, ein Areal gleich hinter dem Stirnhirn, sofort an. Es ist verantwortlich für die Willensfindung und die Selbstwahrnehmung. Als Mittler zwischen Verstand und Gefühl nimmt es die Signale aus den analytischen Arealen der Großhirnrinde und den emotionalen Zentren des Gehirns auf und wägt sie gegeneinander ab. Hellwaches vorderes Cingulum, schlaftrunkenes Stirnhirn – so kommt es, dass man sich morgens selbst ganz klar als benebelt wahrnehmen kann. Jetzt ist das Gehirn in einem ähnlichen Zustand wie im REM-Schlaf: rege Gefühle, schlummernder Verstand. Nur dringt jetzt die harte Wachwelt ins verträumte Bewusstsein. Es ist der beste Moment, bewusst seine Gefühle wahrzunehmen. Wer sich ein paar Minuten Zeit lässt, hat die wichtigste Erkenntnis des Tages vielleicht schon vor dem Aufstehen. von Tobias Hürter aus ZEIT WISSEN Nr. 3/2011 98 Die Welt im Kopf Grenzzustände des Gehirns 99 Leerlauf im Kopf Was tut unser Gehirn, wenn wir nichts Bestimmtes tun? Neurologen erforschen einen geheimnisvollen Zustand, der lebensnotwendig ist Als Forschungsgebiet ist das Nichtstun ein Albtraum. Der Proband liegt verkabelt in einer Röhre, sein Gehirn steht unter scharfer Beobachtung durch modernste Bildgebungstechnik – und dann kommt der Befehl, der das Rätsel startet: »Jetzt entspannen Sie sich mal.« Kai Vogeley sieht in diesem Moment etwas, was niemand richtig versteht. Der Kölner Psychiater und Neurowissenschaftler ist dem Müßiggang auf der Spur. Er will herausfinden, was unser Gehirn tut, wenn es nichts Besonderes tut. Bei seinen Probanden springt dann regelmäßig ein typisches Muster der Mußeaktivität in bestimmten Nervennetzen an. Genau da liegt sein Problem. »Normalerweise misst man die Gehirnaktivität im Zusammenhang mit einer definierten Aufgabe«, erklärt Vogeley. »Man bittet die Versuchsperson zum Beispiel, sich eine Folge von Bildern anzusehen. Am Sauerstoff- und Energieverbrauch kann man erkennen, in welchen Regionen des Gehirns dabei die Aktivität steigt.« Daraus leitet der Forscher dann ab, welche Funktion die einzelnen Bereiche erfüllen – dass zum Beispiel Bilder von der Sehrinde im hinteren Teil des Hirns verarbeitet werden. Liegt die Versuchsperson allerdings müßig herum, versagt dieses Prinzip. »Wir wissen nicht, was ein Proband erlebt, den wir zum Nichtstun auffordern«, sagt Vogeley. »Er kann Schafe zählen oder an sein letztes Rendezvous zurückdenken – für den Forscher gibt es keine Möglichkeit, das zu überprüfen.« Dabei hat der Befehl zum Tagträumen in der Hirnforschung Tradition. Er dient in Experimenten als Kontrollzustand. Erst im Vergleich mit dem Nichtstun, dem »Gehirn im Leerlauf«, können Wissenschaftler jene Hirnregionen ausmachen, deren Aktivität beim Lösen einer Testaufgabe ansteigt. Ein solcher Datenabgleich war es, der den US-amerikanischen Hirnforscher Marcus Raichle vor einigen Jahren stutzen ließ. Als er seine Probanden bat, vom Nichtstun zu einer zielgerichteten Aktivität überzugehen, stellte er fest, dass sich in bestimmten Hirnregionen genau das umgekehrte Muster zeigte: Dort nahm die neuronale Aktivität nicht zu, wie zu erwarten, sondern ab. Noch kurioser war der Effekt, wenn die Probanden aufhörten, sich zu konzentrieren: Dann stieg die Betriebsamkeit dieser Hirnregionen sprunghaft an – ein Verhalten, das auch Vogeley bei seinen Untersuchungen immer wieder beobachtet. Den Verbund der rebellischen Hirnregionen taufte Marcus Raichle »Default Network« – ein Begriff, der sich als »Leerlauf-Netzwerk« übersetzen lässt. Nach 100 Die Welt im Kopf An­sicht von Raichle erfüllt dieses Netzwerk eine Basis­funk­tion im Hirn, die anspringt, wenn es nicht bewusst nachdenkt, sondern die Gedanken schweifen lässt. Dass dieses Default Network existiert, ist in der Fachwelt weitgehend anerkannt. Ob es allerdings wirklich einer Art Leerlaufmodus entspricht, wie Raichle im Jahr 2001 skizzierte, ist dagegen hoch umstritten. Die Interpretation der Daten lässt eine Menge Spielraum für Theorien, die ebenso schwer zu wider­ legen wie zu beweisen sind. Um den Leerlaufmodus dingfest zu machen, sagt Vogeley, müsse man erst einmal Informationen darüber haben, was der Proband beim Nichtstun genau erlebe. Fragen ist da keine Option, denn »in dem Moment, wo er sich auf diese Frage konzentriert, ist der Leerlaufzustand ja beendet«. Ein schier unlösbares Dilemma. »Wir zerbrechen uns den Kopf darüber, wie wir diesen Modus beschreiben sollen, ohne ihn zu stören«, klagt der Forscher. Außer Frage steht, dass das Leerlauf-Netzwerk eine große Bedeutung hat. »Es findet sich bei schlafenden Probanden und bei komatösen Patienten«, erzählt Vogeley. »Sogar Affen haben ein Default Network. Wenn es den Leerlaufmodus wirklich gibt, handelt es sich dabei um ein universelles Funktionsprinzip.« Ein Kollege von Vogeley lie­fert dafür ein weiteres Argument. »Die Gehirnregionen des Default Network sind trotz ihres hohen Energieverbrauchs ungewöhnlich selten von Schlaganfällen betroffen«, sagt der Neurologe Andreas Kleinschmidt, der in der Pariser Neuroimaging-Einheit des französischen Atomenergiezentrums forscht. »Das hängt damit zusammen, dass diese Hirnareale sehr gut durchblutet sind. Es ist d ­ enkbar, dass es sich dabei um einen Schutzmechanismus handelt, der im Laufe der Evolution entstanden ist.« Kurz gesagt: Die Funktion des Leerlaufmodus könnte so wichtig sein, dass er vor einem Ausfall unbedingt bewahrt werden muss. Doch worin besteht seine Funktion? Forscher aus den unterschiedlichsten Disziplinen haben inzwischen Erklärungsansätze geliefert. Die Grundlage der meisten Modelle ist eine simple Überlegung: Was haben Schlaf, Koma und ziellose Tagträumerei gemeinsam? Immerhin sind es diese drei Zustände, in denen das Leerlauf-Netzwerk seine Aktivität zuverlässig hochfährt. Aus der Sicht des Gehirns zeichnen sie sich alle durch das Fehlen von »Input« aus, von Informationen, die von außen auf das Denkorgan einstürzen und es zwingen, zu reagieren. Pierre Magistretti vom Brain-Mind-Institut in Lausanne zieht daraus den Schluss, dass der Leerlaufmodus eine nach innen gerichtete Aktivität des Gehirns widerspiegelt, einen Zustand, in dem sich das Zentrum des Bewusstseins mit sich selbst beschäftigt. »Das Gehirn ist nicht bloß ein reflexives Organ«, sagt Magistretti. »Da laufen eine Menge Vorgänge ab, die nichts mit äußeren Reizen zu tun haben.« Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch im Energieverbrauch des Gehirns wider: Die Aktivitätssteigerungen, die Hirnforscher bei zielgerichteten Aufga­ben messen, sind verschwindend gering. »Das Gehirn beansprucht zwanzig Prozent unseres Energieverbrauchs, obwohl es nur zwei Prozent der Körpermasse stellt«, Grenzzustände des Gehirns 101 sagt Magistretti. »Wenn wir gerade eine Aufgabe lösen, verbraucht es zwar noch ein bisschen mehr – im Vergleich zum riesigen Grundbedarf sind diese Differenzen aber sehr klein.« Wer den Leerlaufmodus allerdings einfach mit dem Grundbedarf des Gehirns gleichsetzt, macht es sich zu einfach. Anders als die normale Grundaktivität läuft das Default Network ja gerade nicht durchgehend, sondern reagiert auf Konzentration mit sinkender Aktivität. Trotzdem zeigte Raichles Entdeckung in der Szene der Hirnforscher Wirkung: Seine Veröffentlichung 2001 hat die Aufmerksamkeit ein wenig von dem Energieverbrauch bei den zielgerichteten Gehirnaktivitäten weggelenkt hin zu den Vorgängen, die sich unterhalb dieses Aktivitätsbereichs abspielen. Mehrere Untersuchungen deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Leerlauf-Netzwerk und Ich-Bewusstsein geben könnte. »Bei Kindern bis zu zehn, zwölf Jahren ist der Default-Modus noch nicht besonders aktiv«, erklärt Magistretti. »Auch bei Alzheimer-Patienten finden wir wenig Leerlaufaktivität. Das ist hochinteressant, weil bei beiden Gruppen das, was wir als IchBewusstsein bezeichnen, nicht im gleichen Maße ausgeprägt ist wie bei gesunden Erwachsenen.« Auf der Alltagsebene ergibt der Ansatz durchaus Sinn: Solange das Gehirn mit Informationsverarbeitung beschäftigt ist – etwa in einer brenzligen Situation im Straßenverkehr oder während einer wichtigen Klausur –, wäre es gefährlich, die begrenzte Arbeitskapazität auf die Pflege des Bewusstseins zu verwenden. Schweifen die Gedanken ab, könnte das Gehirn mit dem Leerlaufmodus eine Selbstinspektion in Gang setzen. Diese Vorstellung findet auch Vogeley reizvoll. »Wir wissen, welche Regionen des Gehirns aktiv werden, wenn Menschen über sich selbst nachdenken«, sagt er. »Wenn man sich das Default Network anschaut, stellt man fest: Die Bereiche überschneiden sich.« Vom Leerlaufmodus mag Jan Born dagegen nicht sprechen. Der Neuroendokrinologe beschäftigt sich an der Universität Lübeck (heute Universität Tübingen) mit den Prozessen, die während des Schlafs im menschlichen Gehirn ablaufen. »Es ist ziemlich naiv, zu glauben, dass Menschen, die schlafen oder tagträumen, nichts tun«, sagt er. Für den abgeschotteten Zustand des Gehirns, den Marcus Raichle mit »Default-Modus« beschrieben hat, verwendet der Schlafforscher lieber das Wort »Offline-Modus« – vergleichbar mit einem Computer, der keinen Zugang zum Internet hat und nur auf die Informationen auf seiner Festplatte zugreifen kann. Doch auch Born hat sich Gedanken zu Raichles Theorie gemacht. »Der Input, den Hör- und Sehsinn uns normalerweise liefern, fehlt im Schlaf vollkommen«, sagt er. »Das bedeutet aber nicht, dass wir deshalb in einen Leerlauf fallen, wenn wir schlafen. Tatsächlich erledigt unser Gehirn in diesen Phasen eine lebensnotwendige Aufgabe: Es käut das wieder, was wir vor dem Einschlafen erlebt haben.« Das tägliche Bombardement an Informationen, erklärt Born, würde das Hirn eigentlich in ein gefährliches Ungleichgewicht stürzen – wenn es nicht Ruhepausen gäbe, in denen es sich selbst überlassen sei. Diese Chance nutze es, um seine Netzwerke aus Nervenzellen neu zu organisieren, das Gelernte zu ordnen und zu verarbeiten. Dass ein ähnlicher Prozess während des Tagträumens abläuft, hält der Forscher durchaus für möglich. »Eigentlich ist es völlig banal«, sagt er. »Wenn Sie gerade ein spannendes Experiment mit Bildern gemacht haben und eine Pause bekommen, langweilen Sie sich. Und was passiert als Erstes, wenn Sie sich langweilen? Richtig – die Bilder gehen Ihnen noch einmal durch den Kopf.« Auch wenn bislang nicht geklärt ist, was es genau mit dem Default-Modus des Gehirns auf sich hat – die Beschäftigung mit dem rätselhaften Zustand liefert den Forschern immerhin eine wissenschaftliche Entschuldigung für manchen Brauch des Büro-Alltags. Kai Vogeley zum Beispiel hält es für erwägenswert, »ob man nicht während der Arbeitszeit öfters einen forcierten Zustand des Müßiggangs herbeiführen sollte«. von Josephina Maier aus der ZEIT Nr. 1/2013 Jan Born Jan Born lehrt und arbeitet als Schlafund Gedächtnisforscher in Tübingen. Er konnte beweisen, dass sich das Gedächtnis im Tiefschlaf bildet, nicht – wie lange angenommen – im traumreichen REM-Schlaf. 2010 wurde er mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis ausgezeichnet. 102 Die Welt im Kopf Grenzzustände des Gehirns 103 Stichwort Bewusstseinsstörungen Wachbewusstsein ist die Fähigkeit, uns selbst und die Welt um uns herum bewusst wahrzunehmen. Bei Patienten in einem minimalen Bewusstseinszustand (minimal conscious state) ist sie stark reduziert, bei Patienten im Wachkoma fehlt sie vermutlich vollständig. Neue Methoden haben jedoch gezeigt, dass einige Wachkomapatienten ein gewisses Maß an Bewusstsein zurückbehalten haben, und ermöglichen Forschern, mit ihnen zu kommunizieren. 104 Die Welt im Kopf Das Wachbewusstsein ist eine wesentliche Komponente des Bewusstseins. Es wird von der koordinierten Aktivität vieler Teile des Gehirns erzeugt, vor allem vom zerebralen Kortex, der Dutzende von spezialisierten Bereichen für die Verarbeitung von sensorischen Informationen aus dem Körper und der Umwelt beherbergt. Das Wachbewusstsein hängt zudem von intakten Verbindungen zwischen dem Kortex und subkortikalen Strukturen wie dem Thalamus ab und ist eng mit dem »Wecksystem« v ­erknüpft, das von Teilen des Hirnstamms, dem aufsteigenden retikulären Aktivierungssystem (ARAS), kontrolliert wird. Bessere Diagnosemöglichkeiten Wir wissen, dass Aufmerksamkeit und Wachbewusstsein bei Bewusstseinsstörungen wie beim minimalen Bewusstseinszustand und beim vegetativen Zustand stark beeinträchtigt sind, doch wir haben noch immer keine Möglichkeit, die Stufe des Bewusstseins bei solchen Patienten zu bestimmen oder zwischen diesen Zuständen zu unterscheiden, um sie korrekt zu dia­gnos­ti­zie­ren. Diese Situation begann sich vor zehn Jahren zu ändern, denn dank technischer Fortschritte besserten sich die Dia­gno­se­mög­lich­kei­ten der Ärzte. Mithilfe dieser neuen Methoden ließ sich zeigen, dass ein signifikanter Teil der Wachkomapatienten, von denen man annahm, sie seien völlig ohne Bewusstsein, tatsächlich über ein gewisses Maß an Bewusstsein verfügen und auch in der Lage sind, ihre Gedanken mitzuteilen, obgleich sie bei Verhaltenstests keine Reaktionen ­zeigen. Bewusstseinsstörungen werden meistens von schweren Hirnschäden nach einer traumatischen Hirnverletzung ausgelöst. Schätzungsweise 100 000 bis 200 000 Menschen weltweit leiden an solchen Störungen, auch wenn man gegenwärtig davon ausgeht, dass bis zu 40 Prozent falsch dia­ gnos­ti­ziert worden sein könnten. Jeder dieser Zustände geht mit anderen Folgen einher, doch eine korrekte Dia­gno­se ist eine große Herausforderung. Beispielsweise ist die Erholungswahrscheinlichkeit bei Patienten in einem minimal bewussten Zustand allgemein größer als bei Wachkomapatienten, doch wir können immer noch nicht vorhersagen, wessen Zustand sich bessern könnte oder in welchem Maße. Die klinische Forschung konzentriert sich inzwischen auf die Entwicklung von Methoden, die eine Unterscheidung zwischen diesen Typen von Bewusstseinsstörungen ermöglichen. Die Möglichkeit, korrekte Dia­gno­sen zu stellen, könnte Ärzten helfen, bessere Voraussagen über die Erholungschancen von Patienten zu machen. Zu den wichtigsten Bewusstseinsstörungen gehören: Koma: Ein Koma ist ein Zustand tiefer Bewusstlosigkeit. Komapatienten können sich weder bewegen noch ihre Augen öffnen oder in irgendeiner Form auf äußere Reize reagieren. Sie zeigen keinen normalen Schlafwach-Rhythmus, und man nimmt an, dass ihnen jedes Wachbewusstsein fehlt. Sie können nicht alleine atmen und müssen daher beatmet werden, um zu überleben. Nur selten verbringen Menschen längere Zeit im Koma – entweder bessert sich ihr Zustand ein wenig, oder sie sterben innerhalb weniger Wochen. Vegetativer Zustand: Einige Patienten treten nach einer kurzen Zeit des Komas in einen vegetativen Zustand ein, der auch als Wachkoma bezeichnet wird. Bei denjenigen, die mehr als einen Monat in diesem Zustand verharren, ohne dass es Zeichen der Verbesserung gibt, spricht man von einem andauernden vegetativen Zustand (persistent vegetative ­state). Der Schlaf-wach-Zyklus bleibt im vegetativen Zustand erhalten, und die Patienten wirken, als seien sie wach, doch sie zeigen keinerlei Anzeichen von Wachbewusstsein. Neue Methoden zur Evaluierung der Hirnfunktion haben jedoch demonstriert, dass mindestens einer von fünf Patienten mit der Dia­gno­se »Wachkoma« tatsächlich noch über ein gewisses Maß an Wachbewusstsein verfügt. Stichwort 105 Minimaler Bewusstseinszustand: Der minimale Bewusstseinszustand (minimal conscious ­state) wurde erst kürzlich als eigenständige Bewusstseinsstörung erkannt. Minimal bewusste Patienten geben von Zeit zu Zeit Hinweise, dass sie sich ihrer selbst und ihrer Umwelt bewusst sind. Sie sind nicht kommunikativ, doch sie können einfache Kommandos ausführen, die Hand nach einem Objekt ausstrecken und greifen oder in Reaktion auf emotionale Reize lächeln oder weinen. Zwar ist bei ihnen die Wahrscheinlichkeit, dass sich ihr Zustand bessert, höher als bei Wach­ komapatienten, doch einige verharren auf Dauer in diesem minimalen Bewusstseinszustand. In Kontakt treten Vor mehreren Jahren entwickelten Forscher eine Methode, um mit Wachkomapatienten zu kommunizieren. Sie legten die Patienten in einen Scanner und stellten ihnen eine Reihe einfacher Fragen wie »Haben Sie einen Bruder?«. Sie wiesen die Patienten an, sich vorzustellen, Tennis zu spielen, wenn sie »Ja« antworten wollten, und sich vorzustellen, in ihrem Haus herumzulaufen, wenn sie »Nein« antworten wollten. Die beiden Aufgaben zur bildlichen Vorstellung führten Terri Schiavo Der tragische Fall von Terri Schiavo beleuchtet die ethischen Probleme bei der Pflege von Patienten mit minimalem Bewusstseinszustand. Schiavo erlitt einen massiven Zusammenbruch, der zu schweren Hirnschäden führte. Mehrere Monate später wurde bei ihr ein andauernder vegetativer Zustand (Wachkoma) dia­gnos­ti­ziert. Anschließend kam es zu bitteren juristischen Auseinandersetzungen zwischen Schiavos Ehemann, der argumentierte, sie hätte unter diesen Umständen nicht weiterleben wollen, und verlangte, ihre künstliche Ernährung zu be- 106 Die Welt im Kopf enden, und ihren Eltern, die meinten, ihre Tochter zeige noch Hinweise auf Bewusstsein und solle deshalb am Leben erhalten werden. Der juristische Streit dauerte sieben Jahre; in dieser Zeit wurde ihr Lebenserhaltungssystem zweimal gestoppt und wieder angestellt, und Präsident George W. Bush unterzeichnete ein Gesetz, das darauf abzielte, sie am Leben zu erhalten. Die Auseinandersetzung endete 2005, als ein Bezirksgericht in Florida die ursprüngliche Entscheidung bestätigte, die künstliche Ernährung abzubrechen. Bewusstsein ist das Erscheinen einer Welt. zu einem jeweils anderen Muster der Hirnaktivität – die erste aktivierte den prämotorischen Kortex, der für die Planungen von Bewegungen wichtig ist, die zweite hingegen den Hippocampus und umliegende Regionen, Thomas Metzinger, die für das räumliche Gedächtnis eine deutscher Philosoph, 2009 große Rolle spielen. Anfangs hatten die Forscher keine Ahnung, ob irgendeiner der Patienten die Anweisungen und Fragen verstehen würde, die ihnen gestellt wurden. Zu ihrer Überraschung reagierten jedoch einige Patienten auf die Fragen und beantworteten sie richtig, wie sich später anhand der medizinischen Berichte und durch die Aus­sagen von Familienmitgliedern verifizieren ließ. Die Forscher bauen nun auf diesen ersten Studien auf und sind dabei, für solche Patienten eine ganze Batterie neuropsychologischer Tests zu entwickeln. Sie hoffen, dass diese Tests Klinikern helfen werden, Patienten und das Ausmaß ihrer geistigen Fähigkeiten besser einzuschätzen. Die Möglichkeit, mit solchen Patienten zu kommunizieren, wirft schwierige e ­ thische Fragen auf. Sollte man sie beispielsweise fragen, ob sie gern weiterleben möchten oder lieber sterben würden? Die beteiligten Forscher halten dies für unangemessen, nicht zuletzt deswegen, weil es in den meisten Ländern keine Euthanasiegesetze gibt, die es erlauben würden, die Lebenserhaltungssysteme abzuschalten, wenn ein Patient sagt, dass er sterben möchte. Vielmehr schlagen sie vor, man solle den Patienten Fragen stellen, die dem Pflegepersonal helfen können, den Alltag der Patienten so komfortabel wie möglich zu gestalten, wie »Haben Sie Schmerzen?« oder Fragen, welche Nahrung oder welche Unterhaltung sie bevorzugen. Moheb Costandi Stichwort 107 Das Ringen um Worte Ein Unfall verwandelte Erik Ramsey in eine lebende Statue – unfähig, sich zu bewegen und zu sprechen. Jetzt versuchen Neurologen, mithilfe eines Hirnimplantats seine Gedanken zu lesen und ihm eine neue Stimme zu geben Er will nicht mehr still sitzen. Unruhig tänzelt der Neurologe Philip Kennedy durch sein enges Labor an der McClure Bridge Road nördlich von Atlanta. Aus einem Lautsprecher dudeln die Greatest Hits des Country-Sängers John Denver. Sie sollen den 24-jährigen Erik Ramsey auf dem Be­hand­lungs­stuhl beruhigen, damit das lang erwartete Experiment endlich beginnen kann. Zwei Kabel führen von einem Turm aus blinkenden Messgeräten und Computern zu Eriks Hinterkopf. Sie sind an ein Implantat in dem Teil seines Hirns angeschlossen, der Mund und Zunge beim Sprechen steuert. Erik ist der erste Mensch, dem eine Elektrode in dieses Areal eingepflanzt wurde. Mit ihrer Hilfe will Kennedy heute die Gedanken seines Patienten lesen und das erste Mal live von einer Computerstimme wiedergeben lassen. Der Versuch könnte Medizingeschichte schreiben. Für den blassen Erik geht es allerdings um mehr als den Fortschritt. Es geht um alles oder nichts. Er hofft, bald wieder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen zu können. Seit einem Autounfall vor acht Jahren ist er in einem reglosen Körper gefangen. Gegen Mitternacht war er mit einem Freund vom Kino nach Hause gefahren, als ein entgegenkommender Transporter plötzlich auf der Straße wendete. Nach dem Aufprall überschlug sich ihr Auto dreimal, die Airbags öffneten sich, und Eriks Kopf knallte mit voller Wucht gegen die Kopfstütze. Als er nach der 15-stündigen Not­ope­ra­tion wieder aufwachte, gehorchte sein Körper nicht mehr. Seine Hand wollte die Nase nicht mehr kratzen, wenn sie juckte. Seine Beine wollten sich nicht mehr regen, selbst als er furchtbare Krämpfe hatte. Und auch Zunge, Kiefer und Lippen ließen sich nicht mehr bewegen – Erik konnte nicht mehr sprechen. Sein ganzer Körper war wie in Zement gegossen, der Unfall hatte ihn in eine lebendige Statue verwandelt. Erst nach fünf Tagen stellten die Ärzte fest, dass hinter den leblosen Zügen ein hellwacher Geist steckte. Dass Erik sehen und hören konnte, was um ihn herum geschah, dass er unter Schmerzen litt von den Druckstellen des Bettlakens am Rücken. Die Diagnose: Locked-in-Syndrom, unheilbar. Eine Blutung im Hirnstamm hatte nach dem Unfall jene Nervenbahnen zerstört, über die das Großhirn die Steuersignale an den ganzen Körper übermittelt. Lediglich Augenlider und Pupillen ließen sich noch kon­trol­lie­ren – wenn auch nur unter größter Anstrengung. 108 Die Welt im Kopf Seitdem läuft das Leben vor Eriks Augen ab wie ein Film, dessen Drehbuch andere schreiben. Nach ein paar Wochen in einer Rehaklinik holten die Ramseys ihren Sohn nach Hause und begannen, ihn in seinem neuen Alltag einzurichten. Sie räumten das Wohnzimmer in ihrem Einfamilienhaus aus und stellten ein stählernes Krankenhausbett hinein. Sie ließen einen Kran an die Decke montieren, der Erik morgens in den Rollstuhl hievt und abends wieder zurück ins Bett. Sie kauften für 8000 Dollar einen gigantischen Plasmafernseher, damit Erik trotz verschwommener Sicht fernsehen kann. Sie ersetzten den flauschigen braunen Teppich durch einen Linoleumboden, weil sich sein Katheter regelmäßig löst und der Urin aus dem Bett läuft. Und sie lernten, sich mit Erik zu verständigen. Erst lasen sie ihm langsam das Alphabet vor. Er sollte blinzeln, sobald der Buchstabe kam, den er sagen wollte. Mit dieser Methode hatte der ehemalige Elle-Chefredakteur Jean-Dominique Bauby im Locked-in-Zustand seinen Erfahrungsbericht Schmetterling und Taucherglocke diktiert. Doch Eriks Reaktionen waren zu verzögert. Also stellten die Eltern nur noch Ja-NeinFragen und hofften, dass er genug Kraft habe, die Lider aufzureißen und seine Eddie Ramsey versucht seinen Sohn so Pupillen nach oben zu schieben (»Ja«) oft wie möglich unter Leute zu bringen. oder nach unten (»Nein«). Erik, willst du was anderes sehen? Die Nachrichten? Den Trickfilm? Die Jurassic Park-DVD, die du so magst? Bis heute will sich Eriks Vater nicht damit abfinden, dass das Leben seines Sohnes da­rauf beschränkt sein soll, gewaschen, durch die Gegend geschoben oder von Filmen berieselt zu werden. Nur wenige Monate nach dem Unfall setzte Eddie Ramsey durch, dass Erik wieder zur Highschool gehen durfte. Viermal ließ er ihn die gleiche Klasse wiederholen. Dann bestellte er eine Sozialarbeiterin vom Arbeitsamt nach Hause. Sie sollte herausfinden, ob es nicht doch eine sinnvolle Beschäftigung für den Sohn gebe. Sie kam, stellte die vorgeschriebenen Fragen und verabschiedete sich – ohne Antworten. Sogar zur alten Pfadfindertruppe brachte ihn Eddie Ramsey, damit er dort stumm und steif ein Team von Jüngeren beim Bauen von Grenzzustände des Gehirns 109 Picknickbänken »beaufsichtigen« konnte – Erik wurde zum Eagle Scout ernannt, das ist der höchste Rang bei den Pfadfindern. Schließlich gab es doch noch einen Hoffnungsschimmer: Die Schulbetreuerin empfahl, Philip Kennedy anzurufen. Kennedy hatte Ende der Achtziger die kleine Forschungsfirma Neural Signals gegründet und experimentierte seitdem mit Hirnimplantaten. Zunächst hatte er sie Ratten und Affen eingesetzt, schließlich drei unheilbar kranken Menschen, die wie Erik nicht mehr Herr ihrer Körper waren. Einem war es dank der Elektrode gelungen, mit schierer Willenskraft eine Bildschirmtastatur zu bedienen. Doch wenig später starb er – und Kennedy brauchte einen neuen Freiwilligen. Seit den neunziger Jahren feiern Neuroforscher mit Hirnprothesen einen Erfolg nach dem anderen, ihre Veröffentlichungen lesen sich wie Science-FictionRomane. Sie erfinden Elektroden, mit denen Gelähmte künstliche Gliedmaßen und Computercursors steuern können. Sie bauen Cochlea-Implantate, die Gehörlosen das Gehör wiedergeben. Und sie implantieren Chips, die Kamera­bilder in den Sehnerv einspeisen und Blinde wieder schemenhaft sehen lassen. Was Phil­ip Kennedy nun aber plante, hatte noch niemand versucht: Er wollte einem Lockedin-Patienten eine neue Stimme geben. Also beantragte er Fördermillionen bei den Na­tional Institutes of Health und stellte ein Team aus Forschern von den Universitäten aus Atlanta, Boston, Chicago und Pittsburgh zusammen. Vor vier Jahren bohrte schließlich ein Neurochirurg ein Loch in Eriks Schädel und versenkte einen Glaskolben mit drei Golddrähten fünf Millimeter tief im Gehirn. Um die exakte Position zu bestimmen, waren Erik zuvor während eines Hirnscans Bilder von Tieren gezeigt worden, er sollte die Namen laut vorlesen. Natürlich brachte er keinen Ton hervor, aber einige Nervenzellen seines Sprachzentrums feuerten wie die eines Gesunden – die richtige Stelle war gefunden. An die Elektrode schloss der Chi­rurg einen Verstärker und einen Minisender an, die er direkt unter der Kopfhaut auf den Schädel schraubte. Kennedys Implantate haben eine Besonderheit: Ein paar Tropfen Nährlösung in den winzigen Kolben regen die Nervenzellen in der näheren Umgebung dazu an, hineinzuwachsen und sich an die Drähte zu schmiegen. So werden die Implantate mit den Nervenzellen im Gehirn verbunden und gleichzeitig so fixiert, dass sie nicht verrutschen. »Leider müssen wir einige Monate warten, bis wir wirklich wissen, wie viele Nervenzellen die Elektrode erreichen«, sagt Kennedy. In Eriks Fall waren es 53, genug für den großen Versuch. Dieser Februarnachmittag vier Jahre später soll nun entscheiden, ob sich die riskante Operation gelohnt hat. Aus einer Ecke des Labors beobachtet der Neurowissenschaftler Frank Guenther von der Boston University das Experiment. Er hat den Stimmsynthesizer für Erik programmiert und ist heute extra angereist. Erik wird von Krämpfen geschüttelt, er stöhnt. Er ist aufgeregt, die angestaute Energie entlädt sich unkontrolliert. Der Vater streichelt die Hand des Sohns, versucht ihn mit tiefer Stimme zu beruhigen. 110 Die Welt im Kopf Die beiden Kabel, die mit einer glasigen Paste auf die Beule an Eriks Hinterkopf geklebt sind, dienen zur Stromversorgung und zum Datentransfer. Die Elektronik im Kopf wird angetrieben, wie der Akku einer elektrischen Zahnbürste aufgeladen wird: Es gibt keine Steckerverbindung, die Energie wird durch die Kopfhaut induziert. Das andere Kabel fungiert als Antenne, es empfängt die Gehirnströme, die der Sender aus Eriks Schädel überträgt. Und dann stehen Eriks Füße endlich entspannt auf dem Boden, der erste Durchgang kann beginnen. »Hör zu!«, befiehlt eine Computerstimme – und dann dröhnt ein lang gezogenes »Uuuuuuuuh!« aus dem Lautsprecher. »Sprich!«, sagt die Stimme. Für ein paar Sekunden dröhnt ein dumpfes »Aaaaaaaah« durch den Raum, Erik soll versuchen, den Ton mit der Kraft seiner Gedanken in das »Uuuuuuuuh« zu verwandeln. Das wäre der erste Laut, den er seit dem Unfall aus freien Stücken von sich gibt. Doch es funktioniert nicht. Der CD-Player spielt wieder John Denver: »Und alle, die mich sehen und die an mich glauben, teilen mein Gefühl der Freiheit, wenn ich fliege.« Es ist nicht das erste Mal, dass Kennedy Erik verkabelt hat. Seit Monaten bringt ihn sein Vater zweimal pro Woche ins Labor. Doch bislang zeichneten die Forscher die Gehirnströme lediglich auf, noch nie ließen sie sie von dem Synthesizer vorlesen. Die direkte Rückkopplung soll es Erik ermöglichen, den Umgang mit seinem Implantat zu trainieren – ebenso wie ein Fahrschüler ein Gefühl fürs Autofahren entwickelt, indem er spürt, wie sein Wagen reagiert. Sechster Durchgang: »Hör zu!«, »Uuuuh«, »Sprich!« Und tatsächlich verändert sich diesmal die Farbe der Computerstimme: »Aaaaaaaauuuuuuuuuh«. Aufregung im Labor, Philip Kennedy streckt beide Daumen in die Luft und lacht: »Wir haben es, wir haben es wirklich geschafft. Das ist es!« Erik hat seine neue Stimme entdeckt. Bis zur ersten Unterhaltung wird es allerdings noch dauern. »Bis Jahresende könnte er alle Vokale lernen, bis Ende nächsten Jahres die meisten Konsonanten – und in etwa fünf Jahren kann er vielleicht ganze Sätze sprechen«, schätzt Guen­ther. Bis dahin sind allerdings noch Hindernisse zu überwinden: Der Synthesizer, den Guenther entwickelt hat, arbeitet derzeit mit sogenannten Formantfrequenzen. Jeder Laut, den Erik gedanklich ausspricht, kann durch ein einzigartiges Fre­quenz­mus­ter dargestellt werden – diesen Mustern haben die Forscher in den vergangenen Monaten verschiedene Signale aus Eriks Hirn zugeordnet und so dem Computer beigebracht, Eriks Gedanken in Sekundenbruchteilen zu übersetzen. Dazu musste sich Erik stundenlang wieder und wieder die gleichen Laute anhören und versuchen, sie nachzusprechen. »Die Methode funktioniert prima, allerdings nur mit Vokalen, nicht mit Konsonanten«, sagt Guenther. Daher will er bald einen Synthesizer ausprobieren, der Sprache erzeugt, indem er die Bewegungen von Zunge, Kiefer und Lippen simuliert. Um ihn zu trainieren, müsste Erik keine Laute mehr im Geiste abspielen, sondern die entsprechenden Grenzzustände des Gehirns 111 Mundbewegungen. »Allerdings fürchten wir, dass Eriks Elektrode nicht genug Daten über die Zunge liefert, vielleicht brauchen wir eine zweite – oder einen zweiten Patienten.« Eine neue OP würde für Erik aber enor­me Risiken bergen, zumal Kennedys Elektroden nicht unumstritten sind. »Beim Einsetzen wird das Hirn verletzt, und das kann zu lebensbedrohlichen Infektionen führen«, sagt der Tübinger Neuromediziner Niels Birbaumer. »Ich halte den Ansatz für verfehlt und gefährlich. Gibt es Komplikationen, ist eine eingewachsene Elektrode zudem nur schwer zu entfernen.« Birbaumer experimentiert seit Jahren mit Elektroden, die von außen auf den Kopf geklebt werden. Auch mit dieser Methode, der Elektroenzephalografie (EEG), lassen sich Hirnströme messen und auswerten. Gelähmte konnten damit bereits eine Bildschirmtastatur bedienen. Allerdings müssen sie dazu Monate trainieren – und sich sehr anstrengen, weil die Signale auf dem Weg durch Schädel und Kopfhaut abgeschwächt werden. Und sie verlieren die Kontrolle, sobald sie abgelenkt werden – wenn etwa jemand im Labor das Licht ausschaltet oder sich räuspert. Daher ließ auch Birbaumer schon zwei Patienten Implantate einsetzen. »Diese wurden aber nur auf der Hirnhaut angebracht, nicht ins Hirn gepflanzt«, sagt er. »Dabei war die Infektionsgefahr nicht größer, als wenn man sich in den Finger schneidet.« Bei dieser Methode, der Elektrocorticografie (Ecog), seien die Gehirnströme zehnmal deutlicher zu empfangen. »Ich glaube, dass wir damit ähnlich gute Daten erhalten wie von einem Implantat tief im Hirn. Daher wundere ich mich, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde Kennedys Methode überhaupt erlaubt.« John Donoghue, Neurologie-Professor an der Brown University in Providence, widerspricht: »Von außen lassen sich einfach nicht genug Informationen sammeln.« Er vergleicht die Signale von EEG und Ecog mit der Geräuschkulisse in einem Fußballstadion. »Man kann sich zwar ungefähr vorstellen, wie das Spiel verläuft. Will man aber Genaues über den Spielstand und die Strategien erfahren, muss man Trainer, Spieler und Fans einzeln befragen.« Das heiße auf das Gehirn übertragen: »Wir müssen rein und die elektrischen Signale einzelner Neuronen ableiten.« Ein Glaubensstreit, den die Praxis entscheiden wird. Als Chef der Firma Cyberkinetics leitet Donoghue die zweite Forschergruppe, die Implantate direkt ins Gehirn einsetzt. Sie verwendet einen vier mal vier Millimeter gro­ßen Neurochip mit 100 feinen Silikonhärchen als Elektroden, der mit Luftdruck in die Hirnmasse getackert wird. Anders als Kennedy versucht Donoghue allerdings nicht, seinen Patienten die Stimme wiederzugeben, sondern ihre Mobilität – daher implantiert er den Chip in den Motorkortex. »Wir wissen aus Affenversuchen sehr viel darüber, wie dieses Areal die Hand steuert«, sagt er. »Über das Entstehen von Sprache wissen wir fast nichts. Affen reden ja nicht.« Vier Probanden wurde Donoghues Implantat eingesetzt, darunter einem Querschnittsgelähmten und einem Patienten, der wie der Astrophysiker Stephen Hawking an der tödlichen Amyo­ tro­ phen Lateralsklerose (ALS) leidet. Sein 112 Die Welt im Kopf motorisches Nervensystem starb schleichend ab, bis auch er irgendwann in den Locked-in-Zustand fiel. Der erste Proband, der vom Hals abwärts gelähmte Matthew Nagle, kontrollierte nach etwas Training routiniert einen Cursor und einen Greifarm. »Das ist doch das, was sich die Patienten sehnlich wünschen: sich ein Glas nehmen zu können oder eine E-Mail zu schreiben.« In seinem Büro zeigt Donoghue ein Video, auf dem Nagle auf Anhieb einen Rollstuhl steuert. »Holy shit!«, ruft Nagle – und fährt dem Professor über den Fuß. Mittlerweile ist Nagle an einer Hautkrankheit gestorben; eine Patientin, die neun Jahre lang »locked in« war, erzielt derzeit aber ähnliche Erfolge. Mit zwei Nachteilen von Donoghues Chip muss sie allerdings leben: Erstens bewegt er sich im Kopf minimal hin und her – dabei entsteht Narbengewebe, das die Härchen unbrauchbar macht. Nach ein paar Jahren muss er ausgetauscht werden. Zweitens funktioniert der Chip nicht drahtlos, das heißt, aus dem Kopf der Probandin ragt eine Steckdose für die Kabel. »Kollegen an der Brown University testen an Affen bereits eine Version, die die Signale mit Infrarotlasern durch die Kopfhaut überträgt«, sagt Donoghue. Und die Forscher haben einen noch größeren Traum: Irgendwann wollen sie ganz auf externe Computer verzichten – und kaputte Nervenbahnen durch Glasfaserleitungen ersetzen, an deren Ende eine Elektronik die Muskulatur von Armen und Beinen stimuliert. »Das wäre dann ein bisschen so wie beim hochgerüsteten 6-Millionen-Dollar-Mann aus der alten Fernsehserie«, sagt Donoghue. »Nur dass wir ein paar Jahrzehnte und viel mehr Geld brauchten: Allein das drahtlose System zur Marktreife zu bringen wird 200 Millionen Dollar kosten, bis jetzt haben wir 20 Millionen.« Solche Visionen schüren Hoffnungen bei Patienten wie Erik und ihren Familien: Vielleicht kann er ja eines Morgens selbst entscheiden, welches seiner vielen Heavy-­Metal-T-Shirts ihm angezogen wird. Vielleicht kann er sich den Cowboyhut aufsetzen, den sein Vater ihm auf einer Reise geschenkt hat und der nun verwaist neben dem Plasmafernseher hängt. Vielleicht kann er sogar die kleine Karibikinsel betreten, die er auf einer Kreuzfahrt mit seinen Eltern ge­sehen hat. Da Eriks Rollstuhl nicht auf die kleine Fähre passte, konnte er damals nicht mit an Land gehen. Wie hoch sind deine Erwartungen an das Implantat wirklich, Erik? Eddie Ramsey übersetzt die Frage in Ja-nein-Sprache: »Erik, hoffst du nur, wieder sprechen zu können?« Die Pupillen gehen nach unten – nein. »Erik, hoffst du nur, wieder sprechen und arbeiten zu können?« Nein. »Erik, hoffst du nur, wieder sprechen und als Zeichner für Disney arbeiten zu können?« Erik schiebt die Pupillen nach oben. »Yeah!« Später sagt Eddie Ramsey: »Träume wie diese sind nötig, sonst kann man nicht weitermachen.« von Jens Uehlecke aus der ZEIT Nr. 3/2008 Grenzzustände des Gehirns 113 3. Die Sinne Wir Menschen können nicht besonders gut riechen. Wir sehen im Dunkeln ziemlich schlecht. Wir dröhnen uns die Ohren voll. Unsere Sinne lassen sich leicht überlisten. Können wir uns auf sie verlassen? Haben wir sie zu sehr vernachlässigt? Können wir sie schulen? Fünf Sinne zählen wir: Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken. Hirnforscher haben einen sechsten Sinn entdeckt, den Körpersinn. Er könnte die Basis unseres Bewusstseins sein. 114 Die Welt im Kopf Auf den Geschmack gekommen Riechen und Schmecken gelten als niedere Sinne. Dabei liegt in ihnen der Schlüssel zum Genuss. Wissenschaftler enträtseln, warum wir manche Dinge gern essen und andere nicht Ein Mahl, lieblich wie die dänische Südsee und rau wie die tosende Nordsee. Vorweg etwas süßliche Knollen-Sonnenblume, garniert mit zitronigem Sauerampfer und frischem Koriander. Danach atlantischer Taschenkrebs, schwedischer Kaviar und Austern aus dem Limfjord. Mit unverwechselbaren Aromen aus der Region will das dänische Restaurant Noma »die Welt erhellen« – und das gelingt. Im vergangenen Jahr war das Haus im Hafen Kopenhagens zum zweiten Mal Nummer eins unter den »San Pellegrino World’s 50 Best Restaurants« und damit Nachfolger von Ferran Adriàs El Bulli. Ähnlich wie der berühmte katalanische Koch nähern sich die Macher des Noma dem Erlebnis Geschmack mit fast wissenschaftlicher Akribie. Damit stehen sie in der Tradition der sogenannten Molekularküche, die seit 20 Jahren mithilfe physikalischer und chemischer Kniffe vorher undenkbare gustatorische Knalleffekte wie Apfelkaviar in der Gelkugel ermöglicht. Doch eine zentrale Frage haben die Köche bisher nicht beantworten können: Warum mögen wir bestimmte Nahrungs­mittel und andere nicht? In einer Art zweiter gastronomischer Revolution suchen jetzt Forscher ­a ller Disziplinen nach Antworten. Ausgerechnet Dänemark, das Land der Remoulade und der fett gebratenen Schollen, ist einer der wichtigsten Schauplätze dieses Aufbruchs. Zwei Orte in Kopenhagen sind es vor allem, in denen dieser Aufbruch stattfindet: zum einen das Nordic Food Lab, das in Rufweite des Noma auf einem grauen Hausboot sanft im Hafenbecken schaukelt; es ist einerseits Experimentierstube für das Noma und andererseits ein stiftungsfinanziertes Non-Profit-Labor für eine nachhaltige dänische Küche. Der andere Schauplatz ist der »gelbe Käse«. So nennen die Dänen das grelle Gebäude der Abteilung für Ernährungsforschung der Universität Kopenhagen, an der Per Møller arbeitet. Die Sinne 115 Mit modernen neurowissenschaftlichen Methoden will der studierte Physiker, Mathematiker und Psychologe Møller den Geschmack ergründen. »Neue Speisen sollten nicht nur durch Versuch und Irrtum, wie in der Küche, erschaffen werden«, sagt er, »sondern durch systematische Erkenntnisse verschiedener Wissenschaften.« Zu lange hätten Ernährungswissenschaften sich nur für den Zucker-, Fett- und Eiweißgehalt des Essens interessiert. Doch das Geheimnis guten Essens lüfte man nicht durch isolierte Betrachtung von Fetten oder Kohlenhydraten. Es liege woanders: in der komplexen Reaktion des Gehirns auf den Geschmack. Wie den amerikanischen Neurowissenschaftler Gordon Shepherd, der soeben das Buch Neuro­gastronomy veröffentlichte, treibt Møller eine Überzeugung voran: Wer das Rätsel des Ge­schmacks­­erle­bens löst, kann das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen verbessern. Deshalb hat der Däne zusammen mit dem britischen Physiker Peter Barham das Online-Fachjournal Flavour gegründet. Ende März wird es im Internetportal BioMed Central zum ersten Mal erscheinen. Mitglied des international besetzten Beratergremiums ist unter anderem der theoretische Physiker und Mitgründer von Microsoft Nathan Myhrvold. »Neben dem Kerngeschäft der gastronomischen Forschung wollen wir die ganze Bandbreite abdecken, von der Anthropologie über die Soziologie, von der Ökonomie über die Neurowissenschaften bis hin zur Chemie und Physik«, sagt Møller. Einer der Erstautoren im Fachblatt ist Lars Williams, der Koch des Nordic Food Lab. Wenn der bärtige Amerikaner lächelt, sieht man eine Backenzahnlücke. Er hat schon im britischen Drei-Sterne-Restaurant Fat Duck gearbeitet, im berühmten New Yorker WD‑50 – und im Noma. Jetzt tüftelt Williams auf dem Hausboot an neuen Garmethoden, Fermentationen und Extraktionen von Aromen. »Für uns ist es ein fantastischer Weg, neue Geschmäcke zu erzeugen, indem man unterschiedliche regionale Mikroorganismen zusammenbringt«, sagt er. Denn so wie das Bukett eines Weines für eine Zeit und eine Region stehe, so sollen die Speisen in Williams’ schwankender Laborküche nordisches Terroir widerspiegeln. Als Beleg seiner Kunst reicht Williams eine Pipette mit malzig-würzigen Essig aus Rankenplatterbsen und Gerste zum Kosten über den Stahltisch. In schneller Folge spricht Williams über Säurewerte und Garzeiten und über die Schwierigkeiten, toxische Beiprodukte im Gärprozess zu erkennen. Doch woher weiß der Koch, wann er der perfekten Speise auf der Spur ist? Williams lacht verlegen. »Es braucht viel Hingabe, Arbeit und Aufgeschlossenheit«, sagt er ausweichend. »Es wird immer Kunden geben, die damit nichts anfangen können. Aber so ist es eben – man folgt seiner Intuition.« Per Møller, der mit am Edelstahlmobiliar des Kochlabors sitzt, runzelt die Stirn. Für den Forscher zählen nicht Eingebungen, sondern Fakten. Er träumt Der Amerikaner Lars Williams ist Koch im Nordic Food Lab. Das kulinarische Experimentallabor befindet sich auf einem Hausboot im Hafen von Kopenhagen. 116 Die Welt im Kopf Die Sinne 117 Überlegendes Gespür Der Geruchssinn des Homo sapiens gilt gemeinhin als schwach im Vergleich zu dem anderer Säugetiere. Tatsächlich stehen wir sehr gut da. Mehr als 350 Typen von ­Geruchsrezeptoren stehen uns zur Verfügung. Und was uns an Nasensensibilität fehlt, können wir durch unser überragendes Interpretationsorgan wettmachen, das Gehirn. Diese sensorische Luxusausstattung stellt für Köche die Lebensgrund­lage dar. Biologisch betrachtet aber erscheint sie wie eine gigantische Verschwendung von Ressourcen und Gehirnkapazität. Warum sind wir dann für den Genuss von Geschmäckern so gut ausgestattet? Vielleicht war die Fähigkeit, differenziert riechen zu können, ein evolutionärer Vorteil. So fanden Forscher um die Tübinger Paläoanthropologin Katerina Harvarti kürzlich heraus, dass 118 Die Welt im Kopf das Gehirn des Homo sapiens ein viel größeres Riechareal aufweist als das des ausgestorbenen Neandertalers. Diese olfaktorische Zugabe sei für die Ausbreitung des Menschen außerordentlich nützlich gewesen, denn sie habe es ihm erlaubt, sich selbst in unbekannter Umgebung Genießbares zu erschnüffeln. Darüber hinaus stärkt ein gut ausgebildeter Geruchssinn die mensch­­ li­che Gemeinschaft. »Ol­fak­to­­rische Informationen«, schreiben die beteiligten Wissenschaftler, »ge­lan­gen direkt in Gehirnregionen, die zuständig sind für ­Paarung, Emotionen und Angst.« Befriedigende Düf­te lösen um­ge­hend Be­lohnungs­reak­tionen aus. Kaum etwas fördert den Zu­sam­men­halt so sehr wie ein gutes gemeinsames Mahl. davon, irgendwann genau quantifizieren zu können, wie köstlich ein bestimmtes Gericht für einen bestimmten Menschen ist. Anstatt sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen, arbeitet Møller lieber mit dem »Olfaktometer« – einer Maschine, mit der man Probanden präzise getaktete Stöße verschiedener Aromen in die Nase bläst, wobei ihre Hirnströme mit einem EEG aufgezeichnet werden. Erst kürzlich konnte er mit der Duftmaschine nachweisen, dass Menschen Gerüche nicht nur in der rechten, angeblich emotionserzeugenden Gehirnhälfte verarbeiten, sondern in beiden Hemisphären. Doch vieles sei noch unverstanden, gibt Møller zu, denn bisher seien die Vorgänge im Gehirn während des Essens erst grob entschlüsselt. Im Kochlabor folgt zunächst ein kleiner Grundkurs in Sachen Geschmackswissenschaft. Denn Nahrungsaufnahme ist ein sensorisches Abenteuer, bei dem es um drei Dinge geht: Gefahrenabwehr, Ernährungsoptimierung und Genuss. Als Erstes taxieren Augen und Nase einen Bissen auf Genießbarkeit. Riecht die Substanz fruchtig oder faulig? Dann sondieren Lippen und Mund die Temperatur: Alles über 43 Grad schmerzt – ab hier gerinnt Eiweiß. Sind alle Tests bestanden, landet der Bissen im Mund. Dort bestimmen 3000 bis 10 000 Geschmacksknospen die groben Qualitäten der Speise: Bitterstoffe in Rettich, Broccoli und Kohl weisen zum Beispiel auf Senfölglycoside hin, die in hoher Konzentration den Jodstoffwechsel stören können. Säuernis ist ein Indikator für verdorbene Lebensmittel. Süß und salzig hingegen verheißen Kalorien durch Kohlenhydrate, nützliche Mineralien und Proteine. Und dann gibt es noch – neben süß, sauer, salzig und bitter – einen fünften Geschmack, den jüngsten und seltsamsten der Grundgeschmäcke: Umami. Beschrieben hat ihn erstmals 1908 der japanische Chemiker Kikunae Ikeda, doch im Westen hat das niemand beachtet. Erst als die Molekularbiologie die entsprechenden Rezeptoren vor zehn Jahren entdeckte, änderte sich das. In Reinform erinnert der Geschmack an Brühwürfel. ­Versteckt im Essen, ist er ein gus­ tatorisches Chamäleon, das nach vielem schmeckt, aber immer anheimelnd – so wie etwa das sanfte Nachglühen im Rachen nach dem Genuss eines Stückchens echten Parmesans auf Umami zurückzuführen ist. Im Decodierzentrum des Gehirns steht Umami für »Proteine«. Und dort, nicht etwa auf der Zunge, entfaltet sich auch das, was als Geschmack gilt, als der wahre Genuss. Die eigentliche Schnittstelle dafür ist der retronasale Raum. Flüchtige Stoffe aus der Nahrung steigen in den hinteren Nasen­rachenraum auf und kitzeln dort ebenfalls Geruchsrezeptoren: Ein stinkender Romadur, der im Freien, nach einer ersten nasalen Expertise, noch Übelkeit auslöst, bekommt hier seine zweite Chance. Denn im retronasalen Raum werden Düfte anders wahrgenommen als im vorderen Teil des Organs. Mit der Aktivierung der retronasalen Geruchsrezeptoren beginnt daher das eigentliche Wunder des Geschmacks. Von dort gelangen die Geruchsinformationen über nur drei Um­ schalt­stel­len, vorbei am Tor des Bewusstseins, direkt in den präfrontalen Kortex hinter der Stirn – er ist das oberste Kontrollorgan für Handlungen. Und anders Die Sinne 119 als die Grundgeschmäcke, die bei jedem Menschen fest verdrahtet sind, wird der Geschmack retro­nasale Geruch erlernt: Hier spiegelt entfaltet sich nicht auf der sich die Individualität des Menschen wiZunge, sondern im Gehirn. der, hier begründet sich die Vielfalt der Hier begründet sich die Vielfalt Esskulturen der Welt. der Esskulturen der Welt. Wie effektvoll Köche mit diesen Riechräumen zu spielen wissen, demonstriert Lars Williams mit einer speziellen Quittenessenz. Die klare Flüssigkeit riecht extrem fruchtig. In Erwartung einer Geschmacksexplosion träufelt sich der Gast mit einer Plastikpipette ein paar Tropfen davon auf die Zunge. Doch es geschieht – nichts. Offenbar stecken darin keine Moleküle, die den retronasalen Raum kitzeln können. Ein Verwirrspiel, das sich vielleicht für eine neue interessante Speise einsetzen lässt. Auf solche Überraschungsmomente im Essen ist unser Denkorgan aus. »Wir gewöhnen uns in Sekunden an Gerüche«, sagt Per Møller, »wenn es etwas gibt, das unser Gehirn im Geschmack sucht, dann sind es Neuigkeiten.« Wie groß die Bedeutung des Riechens sowohl für das Indi­vi­duum als auch für unsere Gattung ist, hat gerade erst die Evolutions­forschung nachgewiesen. Das evolutionäre Vermächtnis schlägt sich noch heute in einer frühen Prägung auf Gerüche nieder. In vielen Experimenten hat sich gezeigt, dass unsere Geschmacksvorlieben zum Teil in frühester Kindheit entstehen: Wenn Mütter im letzten Trimester der Schwangerschaft vorzugsweise Karottensaft trinken, bevorzugen später ihre Neugeborenen Milch mit Karotten­geschmack. Der Mensch ist also bereits vor Geburt geschmacklich mit seiner jeweiligen Umwelt verbunden – was nicht heißen soll, dass er nicht im Lauf des Lebens andere Präferenzen erlernen könnte. Die Verbindung von Geschmack und Heimat­region ist vielleicht auch der Grund, weshalb das Noma mit nordischen Geschmäcken bei seinen Gästen so gut anEin befriedigendes kommt – eine unbewusst praktizierte Essen aktiviert im Gehirn des Form der Neurogastronomie. »Es ist uns Menschen nachweislich wichtig, dass die Zutaten von hier komgenau dieselben men«, sagt Noma-Koch Williams und Belohnungszentren wie Sex. erklärt, dass dieses Terroir-Prinzip selbst für »die Mikroorganismen, mit denen wir sie bearbeiten«, gelte. Zum Beweis streift er einige nass glänzende, purpurne Kugeln in eine Schale. Was nach Himbeereis aussieht, 120 Die Welt im Kopf schmeckt seltsam fruchtig, irgendwie angenehm. Vielleicht entfernt nach Süßholz? Weit gefehlt. »Das Aroma ist aus Algen«, sagt Williams. Es handelt sich um die Rotalge Dulse (Palmaria palmata), die bereits im 10. Jahrhundert von skandinavischen Seeleuten ge­gessen wurde und jetzt ihr Comeback im Labor als Ingredienz in dem kalorienarmem Eis mit atlantischem Terroir feiert. Per Møller hatte ebenfalls vom Algeneis gekostet – und war überrascht. »Ich dachte, ich schmecke Malz«, sagt der Neurowissenschaftler, »oder Lakritz.« Auf Letzteres kam er allerdings erst, nachdem jemand anderes das Wort Lakritz ins Spiel gebracht hatte. »Olfaktion reagiert sehr sensibel auf Suggestion«, sagt Møller. Es sei ein Grund dafür, warum Lebensmittelwerbung funktioniere. Was den Neurowissenschaftler wirklich interessiert, sind weniger Williams’ Verführungskünste, sondern die Frage, inwieweit die Qualität des Essens auch Einfluss auf Appetit und Sättigungsgefühl hat. »Hier gehen sie davon aus, dass organisch produziertes, regionales Essen besser ist«, sagt er mit Blick auf das Noma, »aber stimmt das auch?« Die Antwort interessiert ihn nicht zuletzt deshalb, weil in den westlichen Staaten die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig ist. »Wenn wir ein klein wenig besser verstünden, wie Appetit und Zufriedenheit durch die Geschmäcke kontrolliert werden«, sagt Møller, »dann könnten wir dieses Problem möglicherweise besser in den Griff bekommen.« Der Geschmacksforscher hat dazu schon eine These: Je wohlschmeckender eine Mahlzeit, desto schneller ist das Sättigungsgefühl erreicht. »Befriedigendes Essen aktiviert im Gehirn genau dieselben Belohnungszentren wie Sex«, sagt Møller, und dann erzählt er von einem simplen Tomatensuppen-Versuch: Dabei ließ er 40 Studenten antreten und teilte sie in zwei Gruppen ein. Die eine bekam eine schlichte Portion Heinz-Tomatensuppe vorgesetzt, die andere eine mit Chili verfeinerte Variante. Am Ende war die Chili-Gruppe nicht nur zufriedener mit ihrem Mahl, sondern hatte auch weniger gegessen. Daraus folgert Møller: Wer nur labberige Speisen in sich hineinschaufelt, findet nicht, wonach er sucht – und isst deshalb einfach immer weiter. Er propagiert dagegen: »Sattheit durch Zufriedenheit.« Liegt es vielleicht an diesem Prinzip, dass die Japaner ein vergleichsweise dünnes, langlebiges Volk sind? Sie gehen beim Zubereiten des Essens eben nicht von Kohlenhydraten und Fetten aus, sondern vom Geschmack – vor allem von Umami. Diese Idee will Lars Williams auf die nordische Küche übertragen. Im Flavour-Magazin schreibt er zusammen mit dem Biophysiker Ole Mouritsen einen Beitrag über »Algen für den Umami-Geschmack in der neuen nordischen Küche«. Denn dem fünften Geschmack kommt für die Esskultur der gesamten Welt eine zentrale Rolle zu. In Japan ist die Grundlage Dashi, ein flüssiges Extrakt aus der japanischen Alge namens Kombu. Zu dieser Brühe kommt dann Katsuobushi – getrockneter und geräucherter Thunfisch. Die Alge liefert viel Glutamat, der Fisch stellt Ribonukleotide zur Verfügung. Diese Die Sinne 121 Kombination – Glutamat plus Ribonukleotide – erzeugt erst das vollkommene Erlebnis Umami. Dieser Geschmack, argumentiert Ole Mouritsen, sei ein Teil der Lösung für gesündere, weniger kalorienreiche und befriedigendere Gerichte. Im Westen gilt Glutamat bislang allenfalls als teuflischer Geschmacksverstärker in chinesischem und industriell erzeugtem Essen. Doch auch wenn die meisten es nicht wissen: U ­ mami ist überall. Schon das Fruchtwasser enthält Glutamat und die Muttermilch noch viel mehr davon. In der italienischen Küche sorgen sonnengetrocknete T ­ omaten mit ihrem Glutamatgehalt, gepaart mit Nucleotiden aus Anchovis oder Sardinen, für das Umami-Erlebnis. In Williams’ fermentierten Quitten steckt Glutamat ebenso wie in gealterten, ge­pökelten, geräucherten oder marinierten Nahrungsmitteln. »Wir haben weltweit die Küche nach U ­ mami durchsucht«, sagt Mouritsen. »Man findet es überall – aber nicht so rein wie im Dashi.« Lars Williams lüftet in seinem Labor den Deckel einer Plastikschale. Darin liegt wie eine dicke, hellbraune Made eine gepökelte Schweinefiletrolle auf einem Bett aus Gerstenkörnern. Der Koch hat das Fleisch eine Stunde lang im Vakuumbeutel bei 65 Grad gegart und dann zwei Stunden lang in Haselnussholz geräuchert. Anschließend entwässerten Enzyme des Schimmelpilzes Aspergillus oryzae die Fleischrolle und lockerten die Muskelfasern. Das Ergebnis ist die dänische Variante des japanischen Katsuobushi. Zusammen mit einem Extrakt aus nordischen Rotalgen ergibt das ein »Schweine-Bushi«, ein dänisches Dashi. Beide Unterarme des Kochs zieren ausgedehnte Tätowierungen. »Die habe ich, weil wir uns in der Küche, fernab der Gesellschaft, manchmal fühlen wie eine Piraten-Brigade«, sagt er. Ein rebellischer Geist treibt den amerikanischen Koch auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Essen um. Er sieht darin nicht nur eine Möglichkeit, die Vielfalt des Essens systematisch und mithilfe der Wissenschaft zu steigern. Williams hängt der Open-Source-Idee an und hofft, dass die frei zugängliche Fachliteratur möglichst viele Menschen zu neuen Experimenten für ein besseres Essen inspiriert. In seinem Flavour-Artikel finden sich sowohl Hinweise auf die Zucht der Alge als auch Rezepte für Algeneis, Algenbrot und Frischkäse mit Algen. Besonders gerne verfeinert Williams organisch produzierte nordische Zutaten mit asiatischen Techniken. Und im Internet beschreibt das Nordic Food Lab detailliert, wie sich Suppenhuhn-Aromen destillieren lassen: Man nehme einen Drucktopf, entferne das Ventil, schiebe einen Plastikschlauch in das Loch Schlichte Gerichte aus dem Edelrestaurant Noma: Eingelegtes Gemüse mit Knochenmark (rechts), himbeerfarbenes Algen-Eis (Mitte) und Hirschfleisch im Waldmeistermantel. 122 Die Welt im Kopf Die Sinne 123 und führe den Schlauch durch eine eisgefüllte Plastikdose in eine Flasche. So macht Williams aus der esoterischen Kunst der Sterneköche eine Art Do-it-yourself-Küche für den gemeinen Bastler. Der Flavour-Herausgeber Per Møller will das gute Essen ebenfalls aus den Edelküchen befreien. »Snobistisch« nennt er Restaurants wie das Noma. Man müsse aufpassen, dass man das Essen nicht in ein Spiel für die Elite verwandele. »Ein Koch sollte sein Essen zu einem erschwinglichen Preis und in einer nachhaltigen Weise anfertigen«, sagt der Neurowissenschaftler, »und das alles nach wissenschaftlich abgesicherten Kriterien.« Zentral ist für ihn das Geschmacksempfinden. »Die meisten Menschen würdigen nicht, wie wichtig Geschmack und Geruch für unser Wohlbefinden sind«, sagt Møller. Anders als der Hör- oder der Sehsinn sei der Geruchssinn viel direkter mit den Gefühls- und Entscheidungszentren des Gehirns verbunden. Wenn es um die Verführung von Menschen zum Essen geht, lockt das normalerweise die Industrie an. Bei Lars Williams hätten mal zwei Firmen zur Tür hineingeschaut. »Aber wir sind viel zu klein«, sagt er. Jetzt arbeitet das Labor mit dänischen Bauern zusammen, um schmackhaftes Hühnerfleisch zu erzeugen. Sie verfüttern an die Tiere Äpfel, Malz und Algen. »Das Fleisch schmeckt dadurch intensiver nach Huhn«, sagt Williams. Bald könnte die Spezialität im Supermarkt liegen. Per Møller kooperiert mit Firmen wie Unilever und dänischen Fleischproduzenten. Aber er spielt das Engagement der Industrie herunter. »Sie geben etwas Geld und Materialien für die Forschung und bekommen dafür als Erste die Resultate zu sehen«, sagt er. Wird die Industrie jetzt bald mit den Ergebnissen der Neurogastronomie die Kundschaft noch geschickter manipulieren? »Schon möglich«, sagt Møller, »aber es ist wie mit dem Messer: Man kann es zum Schneiden eines Brotes verwenden – oder damit jemanden hinterrücks erstechen.« Und er selbst? Ihn zieht es nicht ins Noma. Er esse jetzt bewusster. Er kaufe Eier von frei laufenden Hühnern und freue sich über die neue Brotvielfalt in Kopenhagen. »Die Ernährung ist besser geworden in Dänemark«, findet Møller. Gelegentlich kocht er sein spezielles Leibgericht, Chili con Carne. Ein großer Block Bitterschokolade müsse hinein und brauner Zucker. Dazu ein Glas würziger Sancerre. Dann ist die Welt des Geschmacksforschers im Lot. Bio­physiker Ole Mouritsen hätte das Erlebnis wahrscheinlich nüchterner beschrieben: viel Umami. von Harro Albrecht aus der ZEIT Nr. 9/2012 124 Die Welt im Kopf Stichwort Sensorische Wahrnehmung Das Gehirn hat sich entwickelt, um Veränderungen der Umwelt wahrzunehmen und darauf zu reagieren, und es empfängt Informationen über die Welt über die Sinnesorgane. Jedes Sinnesorgan registriert einen spezifischen sensorischen Reiztyp, der in die elektrochemische Sprache des Gehirns übersetzt wird. Die fünf Sinne – Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen – wurden bereits vor mehr als 2000 Jahren von dem griechischen Philosophen Aristoteles beschrieben. Die wissenschaftliche Erforschung der sensorischen Wahrnehmung begann im 19. Jahrhundert, und die modernen Neurowissenschaften eröffnen uns ein tieferes Verständnis der beteiligten Mechanismen. Unsere Sinne sind die Fenster, durch die Informationen über die Außenwelt ins Gehirn gelangen. Jedes Sinnesorgan ist darauf spezialisiert, Daten in Form physikalischer Energie wahrzunehmen; diese Energie wird dann in elektrische Impulse umgewandelt, die zum Gehirn geschickt werden, das sie verarbeitet und interpretiert. Daraus entsteht unser kohärentes Erleben der Welt. Alle sensorischen Systeme des Gehirns haben einen gemeinsamen Grundbauplan. Das erste Stadium der Wahrnehmung wird als sensorische Transduktion bezeichnet – es ist der Vorgang, bei dem spezialisierte sensorische Rezeptoren physikalische Reize aus der Umwelt aufnehmen und sie in elektrische Impulse umwandeln. Die Information wird anschließend an eine Hirnstruktur namens Thalamus geschickt, der sie an die zuständigen Regionen des Kortex weiterleitet. Stichwort 125 Einblicke in den Sehsinn Der Seh- oder Gesichtssinn ist der Sinn, den wir bisher am besten verstehen. Die Netzhaut (Retina) enthält mehrere unterschiedliche Typen von Photorezeptoren, die empfindlich auf Lichtteilchen – Photonen – reagieren. Wenn Licht auf die Retina fällt, bewirkt es biochemische Reaktionen in den Photorezeptoren. Die Photorezeptoren leiten Signale, die die Lichtinformationen tragen, an andere Retinazellen weiter, welche bereits eine erste visuelle Verarbeitung vornehmen. Die Information wird dann via Sehnerv an einen Teil des Thalamus geschickt, der als Corpus geniculatum laterale bezeichnet wird und diese an den visuellen Kortex (Sehrinde) weiterleitet. Der visuelle Kortex liegt am hinteren Hirnpol im Hinterhauptslappen und enthält Dutzende eigenständiger Unterregionen. Jede ist auf eine bestimmte Funktion spezialisiert, und die visuelle Information wird in hierarchischer Weise verarbeitet. Die Sehrinde enthält zahlreiche Bahnen, die parallel jeweils einen anderen Typ von Informationen verarbeiten und sie dann im Endstadium der Verarbeitung wieder zusammenführen. Die Verarbeitung beginnt im primären visuellen Kortex (auch Area V1 genannt), dessen Neurone auf Grundmerkmale eines Bildes reagieren wie Kontrast und Orientierung von Kanten. Die Information wird von einer Subregion an die nächste weitergeschickt und mit jedem Schritt zunehmend komplex. Auf diese Weise werden die Grundmerkmale eines Bildes – wie Form, Farbe und Bewegung – miteinander verwoben, während sie durch die Sehbahn verschickt werden, sodass aus dem Lichtmuster, das auf die Retina fiel, das dynamische Bild der Welt rekonstruiert wird, das wir »sehen«. Das Hören Das äußere Ohr lenkt Schallwellen zum Trommelfell, das sie in die Gehörschnecke (Cochlea) weiterleitet, eine spiralförmige Struktur mit drei flüssigkeitsgefüllten Kanälen. Die Schallwellen versetzen diese Flüssigkeit in Bewegung, und diese Bewegungen werden von speziellen Rezeptoren, den Haarzellen, registriert, von denen jede auf Schallwellen einer ganz bestimmten Frequenz reagiert. Die Information wird vom Hörnerv über den Thalamus zu den Schläfenlappen geleitet und dort in speziellen Regionen verarbeitet. Der Schläfenlappen enthält Areale, die All unsere Erkenntniß hebt von den Sinnen an, geht von da zum Verstande und endigt bei der Vernunft ... Immanuel Kant, 1787 126 Die Welt im Kopf für Sprachverständnis und Sprachproduktion unverzichtbar sind; werden sie geschädigt, kann dies zu Schwierigkeiten beim Sprechen und Verstehen führen. Der Hörnerv schickt zudem Informationen zum Colliculus inferior, einem Teil des Hirnstamms, der die Quelle eines Schallereignisses lokalisiert, indem er die Signale vom rechten und vom linken Ohr vergleicht. Der »sechste« Sinn Die Propriozeption, manchmal der »sechste« Sinn genannt, bezeichnet unseren Sinn für die Position unserer Gliedmaßen und ihre Bewegung. Muskeln enthalten Dehnungsrezeptoren, die Muskelspindeln, die Veränderungen der Muskellänge wahrnehmen und sie über periphere Nerven ans Rückenmark übermitteln. Diese Signale werden dann ans Gehirn weitergeleitet, das aus ihnen ein Modell der Haltung des Körpers im Raum konstruiert. Die Welt fühlen Das somatosenso­ rische System verarbeitet Berührungs-, Schmerz- und Temperaturreize, die von Rezeptoren in den Nervenendigungen dicht unter der Hautoberfläche registriert werden. Diese Informationen werden von peripheren Nerven ans Rückenmark übermittelt und dann ins Gehirn weitergeleitet, wo sie im primären somatosensorischen Kortex verarbeitet werden. Bei allen beteiligten Zellen zieht eine einzelne Faser vom Sitz der Zellen direkt unter der Hautoberfläche bis zum Rückenmark – es sind die längsten Zellen im Nervensystem. Die Nervenendigungen dieser sensorischen Neurone enthalten zahlreiche Rezeptoren, die auf die Perzeption verschiedener Typen somatosensorischer Information spezialisiert sind. Einige Rezeptoren nehmen beispielsweise Wärme- oder Kältereize wahr, andere Berührung, Juckreiz oder Schmerz. Jeder Informationstyp wird von den zugehörigen Nervenfasern zum Rückenmark geschickt. Schmerzinformationen werden von speziellen sensorischen Neuronen übermittelt, den Nocizeptoren; sie umfassen Rezeptoren, die einen oder mehrere noxische (gewebeschädigende) Reize registrieren wie extreme Kälte und Hitze, starken mechanischen Druck oder gefährliche Chemikalien. Darüber hinaus enthalten sie Rezeptoren, die empfindlich auf verschiedene chemische Substanzen reagieren, wie sie von geschädigten Zellen ausgeschüttet werden. Die Wissenschaft von Geruch und Geschmack Die Innenseite der Nase ist mit einer dünnen Gewebsschicht, der Riechschleimhaut, ausgekleidet; sie enthält rund 1000 verschiedene Typen von Riechzellen, die in der Luft schwebende Geruchs- oder Odorantmoleküle wahrnehmen. Aus den Riechzellen entspringen Axone, die in verschiedene Teile des Gehirns projizieren und gemeinsam die Wahrnehmung von Gerüchen und den Stichwort 127 Verknüpfte Sinne Synästhesie bedeutet so viel wie »verknüpfte Sinne« und bezeichnet ein Phänomen, bei dem die Reizung eines Sinnes auch in einem anderen Sinn sensorische Empfindungen hervorruft. Der Physiker Richard Feynman war ein sogenannter Graphem-Farben-Synästhet – er verband also mit Buchstaben und Zahlen bestimmte Farbeindrücke –, während der expressionistische Maler Wassily Kandinsky ein Töne-Farben-Synästhet war, der musikalische Klänge mit Farben assoziierte. Weitere Formen sind die Spiegel-Berührungs-Synästhesie (sieht man, dass eine andere Person berührt wird, ruft dies eine Berührungsempfindung hervor) und die Raum-Zeit-Synästhesie (Zeiteinheiten wie Tage und Monate werden so erlebt, als nähmen sie relativ zum Körper spezielle Lagen im Raum ein). Früher glaubte man, Synästhesie sei außerordentlich selten, doch heute schätzt man, dass dieses Phänomen rund ein Prozent der Bevölkerung betrifft. Einer Theorie zufolge entsteht sie, wenn Verbindungen zwischen verschiedenen sensorischen Bahnen, die normalerweise während der Hirnentwicklung eliminiert werden, erhalten bleiben. Einer anderen Theorie zufolge tritt Synästhesie auf, weil es zu viel »Übersprechen« zwischen den sensorischen B ­ ahnen gibt. sozialen Schlüsselreizen ermöglichen, die sie übermitteln. Chemische Substanzen, die als Pheromone bezeichnet werden, spielen eine wichtige Rolle für das tierische und wahrscheinlich auch für das menschliche Verhalten. Die Geschmacksknospen in der Zunge enthalten Rezeptoren, die die Geschmacksrichtungen salzig, sauer, bitter und süß sowie eine »würzige« Geschmacksrichtung namens umami wahrnehmen. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Geschmacksvorlieben zumindest teilweise genetisch festgelegt sind. So entscheiden beispielsweise Variationen in dem Gen, das für den Geschmacksrezeptor OR7D4 codiert, über die Empfindlichkeit für Androstenon, ein Pheromon, das man in gekochtem Schweinefleisch findet; und Menschen, die zwei Kopien einer bestimmten Variante tragen, schätzen Schweinefleisch weniger als andere Menschen. Geschmack und Geruch sind die am wenigsten verstandenen menschlichen Sinne, doch wir wissen, dass sie eng miteinander verknüpft sind: Wenn man sich beim Essen die Nase zuhält, stellt man fest, dass man nicht richtig schmecken kann, was man gerade isst. Moheb Costandi 128 Die Welt im Kopf Tote Nase Der Mensch verlernt das Riechen. Die Natur hat den Geruchssinn ausgemustert – zugunsten des Sehvermögens Kenneth Suslick sorgt sich. Es stehe schlecht um das ursprünglichste Sinnesorgan des Menschengeschlechts, fürchtet der Forscher von der University of Illinois. Im Vergleich mit den Leistungen tierischer Nasen sei das menschliche Riechorgan ein Krüppel. Noch allerdings sei nicht alles verloren, verkündete Suslick unlängst. »Selbst unsere schwer riechbehinderte Spezies kann noch 10 000 Gerüche wahrnehmen.« Der klägliche Rest allerdings ist akut gefährdet. Diese betrübliche Nachricht erreicht den Riechfachmann Suslick und seine Fachkollegen dieser Tage aus Leipzig. Das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie stellte in Zusammenarbeit mit dem israelischen Weizmann-Institut in Rehovot fest: Der Mensch hat seine Nasenfunktion im Lauf der Evolution nicht nur weithin eingebüßt, der Schwund geht weiter. Einst verfügte der Mensch wie andere Säugetiere über knapp 1000 intakte Riechgene in seinem Erbgut. Jedes war für die Wahrnehmung bestimmter Odorantien zuständig. Doch die einstige Vielfalt in der Nasenschleimhaut ist dahin. Rund zwei Drittel dieser Gene sind durch Mutationen funktionsunfähig geworden – Pseudogene nennen die Forscher solche Ruinen, die nun nutzlos im Erbgut sitzen. Und auch der intakte Rest ist bedroht. Die Evolution scheint den Totalzusammenbruch unserer olfaktorischen Infrastruktur beschlossen zu haben. Grand Cru statt Pennerglück Im Überlebenskampf habe der chemische Sinn für den Menschen offenbar keine so wichtige Rolle gespielt wie bei anderen Säugetieren, lautet Yoav Gilads Erklärung für den Niedergang im Riechepithel. Belege dafür fand der israelische Molekulargenetiker beim Vergleich der Riechgenfamilien von Menschen, Affen und Mäusen. Bei den Nagern sind mindestens 80 Prozent der Genfamilie funktionsfähig, doch bei den Primaten setzte im Verlauf der Evolution ein Schwund ein. Ihnen fehlt bereits ein Drittel der Riechfunktion. Die eigentliche Überraschung erlebten die Forscher, als sie die Verlustrate im Menschenerbgut untersuchten. Rund 60 Prozent der Riechgene sind bei Homo sapiens defekt. Mehr als viermal so schnell wie bei Schimpansen, OrangUtans oder anderen Affen kam der Menschheit in den vergangenen Jahrhunderttausenden Riechgen um Riechgen abhanden. Die Sinne 129 Die schwindenden Erbanlagen sind zuständig für die Bildung olfaktorischer Rezeptoren in den Riechzellen der NasenNur 400 schleimhaut. Es handelt sich dabei um intakte Geruchsgene spezielle Antenneneiweiße, die jeweils sind dem Menschen geblieben. bestimmte riechbare Substanzen an Doch sie reichen aus, um sich binden können. Jede Riechsinnesviele Tausend verschiedene zelle bildet nur einen Rezeptor auf ihrer Düfte wahrzunehmen. Oberfläche, doch die vielen chemischen Verbindungen, die von der Nase wahrgenommen werden, können mit verschiedenen Rezeptoren reagieren. So erzeugt jeder Geruch ein charakteristisches Aktivitätsmuster in der Nase. Selbst die knapp 400 intakten Gene, die dem Menschen geblieben sind, reichen daher aus, um viele Tausend verschiedene Gerüche wahrzunehmen. Doch sollte der Genschwund im Riechsinn weitergehen, wie die deutsch-israelische Forschergruppe fürchtet, dürfte in Zukunft als Erstes die Kochkunst leiden. Denn in Wahrheit ist auch der größte Teil des Geschmackssinnes in der Nase angesiedelt. Die Zunge unterscheidet nur zwischen scharf, bitter, süß und salzig – schon der Unterschied zwischen Fußschweiß und Gorgonzolasoße erschließt sich nur bei intaktem Nasenrepertoire. Sogar die Zweiliterflasche Pennerglück zu 1,99 Euro wäre uns ebenso lieb wie ein Grand Cru, würde nicht die Nase ihr Veto einlegen. Einen entscheidenden Verlust, so scheint es, hat die Menschheit ohnehin bereits hinnehmen müssen: Wer die oder den Richtigen für Sex und Fortpflanzung sucht, sollte sich auf seine Nase besser nicht verlassen. Anderen Säugetieren dient das erst vor wenigen Jahren entdeckte Vomeronasalorgan (VNO) zum Aufspüren von Pheromonen: Zwei kleine, zigarrenförmige Strukturen an der Basis der Nasenscheidewand erkennen die Lockstoffe, mit denen sich Paarungswillige chemisch outen. Auch der Mensch, so hatten die Gelehrten bald darauf erkannt, besitzt ein rudimentäres VNO. Und Tests mit getragenen Männer-T-Shirts bei Studentinnen hatten einst glauben gemacht, dass auch das menschliche VNO auf den Körpergeruch reagiert. Reüssiert also Karlchen Müller bei Lieschen Müller nicht mit Kreditkarte, IQ oder Oberarmen, sondern mit dem Achselschweiß? verkünden Emily Liman und Hideki Innan von der University of California in Los Angeles. Ein entscheidendes Gen für den VNO-Riechapparat bei Mensch und Affe habe die Natur vor Urzeiten ad acta gelegt – seit Millionen Jahren ist es bloß noch ein Pseudogen. Wohl mit der Erfindung des Farbensehens, spekulieren die Forscher, begannen unsere Vorfahren, mehr auf die optischen Reize des anderen Geschlechts zu achten – chemische Lockstoffe wurden überflüssig, die dafür zuständigen Riechgene ebenfalls. Dennoch haben manche Gerüche anscheinend auch für Menschen noch immer eine Bedeutung, zum Beispiel als Warnsignal. Das zeigen die Unterschiede bei der Wahrnehmungsschwelle: Ein Teilchen der schwefelhaltigen Giftverbindung Methylthiol riecht der Mensch bereits präzise unter einer Milliarde anderer Moleküle heraus. Dagegen schlägt der Riechkolben erst an, wenn jedes 10 000. Teilchen in der Atemluft ein (relativ harmloses) Methanolmolekül ist. Vollständig werde der Mensch daher den Geruchssinn wohl nicht einbüßen, tröstet uns das Forschungsteam von Yoav Gilad. Den Riechgenen des Menschen prophezeien sie, abhängig von der Substanz, die sie wahrnehmen können, unterschiedliche Schicksale: Die einen, deren Funktion auch dem modernen Menschen noch ebenso dienlich ist wie den Affen, bleiben uns erhalten. Andere, die in der Affenwelt noch wichtig sind, dem Zivilisationswesen aber entbehrlich, werden wir verlieren. Was nutzlos ist, findet vor der Evolution auf Dauer keine Gnade. von Ulrich Bahnsen aus der ZEIT Nr. 13/2003 Beim Sex zählt Geruch nicht mehr Vielleicht eher mit Charme. Die Gemeinde der Riechforscher musste vergangene Woche feststellen, dass auch das menschliche VNO längst von der Evolution ausgemustert worden ist. Allenfalls der gemeinsame Vorfahr von südamerikanischen Neuweltaffen und afrikanischen Primaten habe Sexwillige noch erschnüffeln können. Doch beim Menschen und heutigen Affen sei damit längst Schluss, 130 Die Welt im Kopf Die Sinne 131 Trau den Augen nicht Michael Bach erforscht seltene Augenleiden. Dabei helfen ihm optische Täuschungen: Sie zeigen, wie das Sehen funktioniert Wenn Michael Bach Menschen für die Wissenschaft begeistern will, macht er mit ihnen ein Frankfurter Würstchen. Viel braucht er dazu nicht, weder Fleisch noch heißes Wasser, noch Senf, nur zwei Finger, zwei Augen und ein Gehirn. »Deuten Sie mit den Spitzen Ihrer Zeigefinger vor Ihren Augen aufeinander. Lassen Sie dabei eine Lücke. Und nun sehen Sie zwischen den Fingern hindurch in die Ferne. Na, haben Sie es?« Ja, da schwebt es. Etwas, das aussieht wie ein Frankfurter Würstchen, nur ohne Senf: eine optische Täuschung. Wenn man in die Ferne schaut, haben die Augen für nahe Objekte nicht mehr die richtige Position. Das Bild, das vom rechten Auge wahrgenommen wird, kann deshalb nicht mehr mit dem Bild des linken Auges verschmolzen werden. Das Gehirn schwankt zwischen beiden Möglichkeiten, und währenddessen kommt es zur ­Täuschung: Die Spitzen der beiden Zeigefinger mutieren zu einem Würstchen. »Faszinierend, nicht?« Michael Bachs blaue Augen blicken durch seine Brille und seine Zeigefinger hindurch, über den großen Computerbildschirm in seinem Büro hinweg, dorthin, wo die alte Couch steht und die Plakate vom Theater hängen. Hunderte Male muss er das Würstchen schon ge­sehen haben, aber noch immer freut er sich darüber wie ein Junge, der eben die Süßwarenabteilung eines Supermarktes betreten hat. »Mein Forschungsgegenstand hat den Vorteil, dass er extrem anschaulich ist«, sagt er und grinst. Michael Bach ist Sehforscher. Er leitet die Abteilung funktionelle Sehforschung und Elektrophysiologie an der Universitäts-Augenklinik Freiburg. Dort untersucht er Menschen mit seltenen Augenkrankheiten. Er entwickelt mit seinem Team Verfahren, mit denen man objektiv die Sehschärfe messen kann oder mit denen Ärzte irgendwann schon die Anfänge eines grünen Stars nachweisen sollen. Und er erforscht, was bei optischen Täuschungen im Gehirn vor sich geht. Seit zehn Jahren betreibt er eine weltweit bekannte Website, auf der er 78 optische Täuschungen präsentiert und erklärt. Viele Menschen mit seltenen Augenkrankheiten suchen Michael Bach auf. Der Sehforscher arbeitet an der Universitäts-Augenklinik Freiburg. 132 Die Welt im Kopf Die Sinne 133 »Für mich sind solche Täuschungen mehr als Spielerei«, sagt Bach. Sie verraten dem Forscher, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, wie Sinnesreize im Gehirn verarbeitet werden. Denn Sehen ist ein komplexes Zusammenspiel von Augen und Gehirn: Die Augen nehmen das Bild nur zwei­di­men­sio­nal auf. Das Hirn macht es wieder drei­dimensional, indem es die Information deutet. Sehen heißt deshalb auch immer interpretieren: Das Gehirn nimmt stets die Si­tua­ tion an, die mit der größten Wahrscheinlichkeit das Netzhautbild erzeugt haben könnte. Unter speziellen, meist künstlich geschaffenen Bedingungen führt das zu Fehlinterpretationen – eben zu einer optischen Täuschung. Bach will wissen, wo genau diese Fehlinterpretationen stattfinden und ob man sie bewusst steuern kann. Etwa beim Necker-Würfel: Diese Zeichnung zeigt die Kanten eines durchsichtigen Würfels. Für den Betrachter ändert das Gebilde regelmäßig seine Tiefenausrichtung, weil das Gehirn sich zwischen zwei Möglichkeiten nicht entscheiden kann. »Optische Täuschungen lehren uns, dass wir unseren Sinnen nicht völlig vertrauen können«, sagt er. Manche seiner Kollegen haben Michael Bach in seiner wissenschaftlichen Karriere sicher auch schon für so etwas wie eine optische Täuschung gehalten, denn er arbeitet in ganz verschiedenen Fachgebieten. Dringt mal in diese oder jene Disziplin ein und hält sich immer wieder dort auf, wo er nach traditionellen Maßstäben nicht sein dürfte. So war es von Anfang an. Eigentlich wollte er Chemie studieren. »Da hörte ich: Nur jeder siebte Chemiker erfindet etwas in seinem Leben. Ich dachte dann, ich hätte größere Chancen in einem anderen Beruf.« Also Physik. Nach dem Examen suchte er ein Promotionsthema, das mit einer Stelle verbunden war, weil er mittlerweile eine Familie gegründet hatte. Er fand es in der Neurologie. »Als ich dort ankam, sagte der Leiter: Wir machen ein Tierexperiment. Wir hatten gerade einen Bewerber da, der ist umgefallen und hat sich den Kopf angestoßen.« Bach blieb, blieb stehen und leitete fortan mit Elektroden Der Mensch ... Michael Bach, 58, leitet die Abteilung funktionelle Sehforschung und Elektrophysiologie an der Universitäts-Augenklinik in Freiburg. Der Neurowissenschaftler hat Physik studiert und anschließend in der Hirnforschung promoviert. Bach ist Präsident der International Society for Clinical Electrophysiology of Vision. 134 Die Welt im Kopf ... und seine Idee Bachs Website über optische Täuschungen (www.michaelbach.de/ot) ist weltweit bekannt. Für den Forscher sind die Trugbilder, die er darauf erklärt, mehr als Spielerei: Sie zeigen, dass wir unseren Sinnen nicht völlig vertrauen können. Diese Erkenntnis hilft ihm, wenn er Patienten mit Sehstörungen ohne klare Ursache untersucht. die Ströme in Affenhirnen ab. Seine Gruppe erforschte, wie sich Nervenzellen im Sehzentrum miteinander unterhalten. Danach kamen Angebote aus Amerika, Bach aber wurde lieber in Freiburg Leiter des elektrophysiologischen Labors, in dem Menschen mit Augenkrankheiten untersucht werden. »Ich dachte: Toll, nun kann ich Menschen helfen. Die Operationen an den Tieren haben mir nie Spaß gemacht.« In Bachs Abteilung vereinigen sich Naturwissenschaften, Hirnforschung und Augenheilkunde. Immer geht es darum, was wir sehen und wie wir sehen – und um Täuschungen aller Art. So untersucht Bachs Team mit Elektroden die Nervenzellen von Patienten mit unklaren Sehstörungen, um die Ursache zu finden. Reagieren die Zellen im Auge, kommt jedoch der Reiz nicht im Seh­zentrum an, muss der Fehler auf dem Weg dorthin liegen. Auch Menschen, die nach einem Arbeitsunfall am Auge angeben, nichts mehr sehen zu können, werden zu ihm geschickt. Bachs Team misst dann, ob die Nervenzellen im Sehzentrum auf bestimmte, unerwartete Reize reagieren. So wurde schon mancher Betrüger überführt, aber auch manchem Patienten geholfen. Nun will Bach herausbekommen, ob man das verräterische EEG-Signal, das bei diesen unerwarteten Reizen auftritt, auch bewusst verändern kann. Gleichzeitig versucht er optische Täuschungen zu entlarven, die den Menschen schaden können. Wer an einem Glaukom, dem grünen Star, leidet, unterliegt oft einer solchen Täuschung. Bei dieser Krankheit, die zur Erblindung führen kann, sterben aufgrund eines zu hohen Augeninnendrucks die Nervenzellen im Auge ab. Doch erst wenn etwa 40 Prozent von ihnen zugrunde gegangen sind, fallen Bereiche des Gesichtsfeldes merklich aus – bis dahin fügt das Gehirn Fehlendes ein und erzeugt den Eindruck, man würde ganz normal sehen. Bachs Team überprüft die Nervenzellen mithilfe von Elektroden. Bach will daraus ein elektrophysiologisches Verfahren entwickeln, mit dem Ärzte früh ein Glaukom nachweisen können. Nach der Arbeit bastelt der Neurowissenschaftler weiter an seiner Website. Sie hat ihm schon manche Tür in der Sehforscherszene geöffnet. Er zeigte als Erster den »Lila Chaser« im Internet, eine neue optische Täuschung, bei der lilafarbene Punkte im Kreis auf einem grauen Hintergrund angeordnet sind. Ein Punkt nach dem anderen blendet sich im Uhrzeigersinn kurz aus, und wenn man lange genug auf ein Kreuz in der Mitte schaut, sieht man plötzlich einen grünen Punkt herumkreisen, auch wenn der gar nicht existiert. Im Durchschnitt entwickeln Sehforscher drei solcher Trugbilder im Jahr. Der Lila Chaser verbreitete sich innerhalb von einer Woche rasend schnell im Internet. Rund 13 000 Besucher und eine Million Klicks hat Bachs Seite pro Tag. Sie könnte eine kleine Gelddruckmaschine sein. Würde er Werbung zulassen oder seine Seite verkaufen, könnte er Gewinn machen. Tut er aber nicht. »Ist nur ein Hobby«, sagt er. »Damit kann ich die Leute erreichen, Forschungsergebnisse vermitteln. Die Täuschungen haben ja immer etwas Verblüffendes.« Die Sinne 135 Die Trugbilder machen es ihm leichter, Menschen über die Großartigkeit und die Tücken des Sehens zu informieren. Dutzende Vorträge hält er im Jahr – auch beim Rotary-Club, in Schulen oder im Planetarium. Das Frankfurter Würstchen ist immer dabei. »Es ist herrlich, wenn hundert Leute so machen«, sagt er und führt noch mal die Zeigefinger vor die Augen. Wenn er im Altenheim spricht, geht er gleich vom Würstchen über zum Glaukom. Und sagt, dass man den Sinnen nicht immer vertrauen kann, sondern auch mal nachschauen muss, mit Apparaten. von Christine Böhringer aus der ZEIT Nr. 39/2008 Stichwort Optische Täuschungen Es gibt Illusionen sowohl von Helligkeit und Farbe als auch Form. Es existieren physiologische Illusionen, die aus physischen Gründen »verblüffen«, doch die meisten sind kognitive Illusionen. Viele davon wurden nach ihren Entdeckern benannt und sind weithin bekannt, wie etwa der Necker-Würfel oder die Poggendorf-Täuschung. Es gibt Webseiten, deren einziger Zweck es ist, die bekanntesten Illusionen zu zeigen (etwa 20). Es ist vorgeschlagen worden, dass sämtliche Illusionen zu einer von vier Gruppen gehören: Kippfiguren, Verzerrungen, Paradoxa (unmögliche Figuren) und Fiktionen. Natürlich sind Illusionen für Wissenschaftler, die das Sehen erforschen, und für kognitive Psychologen besonders interessant, da sie wichtige Erkenntnisse über Prozesse der Sinneswahrnehmung ermöglichen. Von jeher waren Künstler an visuellen Illusionen und optischen Täuschungen interessiert. So war zum Beispiel der Grafiker M. C. Escher bekannt dafür, eine Leidenschaft für nicht eindeutige und unmögliche Figuren zu haben. Ganze Stilrichtungen, wie etwa die »Op Art« (Kurzform von Optical Art, »optische Kunst«), erkundeten das Wesen visueller und optischer Illusionen an stationären, aber auch bewegten Kunstobjekten. Die Mechanismen Sinneswahrnehmung ist der Prozess, durch den wir erkennen, was die Informationen darstellen, die von unseren Sinnesorganen geliefert werden. Dieser Prozess läuft sehr schnell, automatisch und unbewusst ab. Er ist kein willentlicher Prozess, und unser Bewusstsein einer optischen Wahrnehmung entsteht gewöhnlich erst, wenn 136 Die Welt im Kopf Stichwort 137 Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 der Prozess abgeschlossen ist: Wir erhalten das fertige Produkt, nicht die Details des Prozesses. Wie funktioniert das also? Was passiert eigentlich, wenn unsere Sinnesorgane Informationen registrieren und wir wahrnehmen, was geschieht? Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, und eine der erfolgreichsten Methoden, die Psychologen gefunden haben, um diesen Prozess zu erklären, ist die Erforschung optischer Täuschungen, um herauszufinden, was sie bedeuten. Figur und Hintergrund Was wir sehen, wird entweder als das Objekt, das wir betrachten (die Figur), oder als Hintergrund interpretiert. Die Interpretation eines Eindrucks als Figur oder Hintergrund ist keine immanente Eigenschaft des Objekts, sondern hängt vom Betrachter ab. Bitte schauen Sie sich das Objekt in Abbildung 1 an – stellt es eine Vase oder zwei Gesichter dar? Figur und Hintergrund können vertauscht werden und auf diese Weise zwei verschiedene Bilder darstellen. Können Sie den Saxofonisten und den Frauenkopf in Abbildung 2 erkennen? Welches Bild sehen Sie zuerst – und warum? Konturen Einer der wichtigsten Aspekte der Gestaltwahrnehmung ist die Existenz einer Kontur. Wenn das Blickfeld eine ausgeprägte Änderung in Helligkeit, Farbe oder Struktur enthält, nehmen wir eine Kante wahr. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen, wie wir illusorische Konturen »sehen« (Linien, die nicht existieren). In der Mitte beider Abbildungen sind Dreiecke zu sehen, die heller zu sein scheinen als der Rest des Bildes. Dies folgt dem Gestaltgesetz der Geschlossenheit, da wir dazu neigen, unvollständige Formen zu komplettieren und Lücken zu schließen. Gestaltgesetze Psychologen interessieren sich naturgemäß für alle Aspekte der Wahrnehmung unserer Welt: wie wir Farben, Bewegung und 138 Die Welt im Kopf räumliche Tiefe sehen, wie wir Objekte und Menschen erkennen und, auch für die ganze Debatte, ob es unterschwellige Wahrnehmungen gibt. Auf der abstraktesten Ebene lassen sich drei Prozesse unterscheiden: Die Rezeption der Lichtwellen durch Iris und Hornhaut, deren Umsetzung in neurochemisch codierte Signale und die Decodierung dieser Signale. Eine zentrale Frage der Forschung ist, wie wir aus den separaten Informationseinheiten, die wir haben, ein komplettes Bild eines Objekts »zusammenbauen« oder formen. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg untersuchten die Gestaltpsychologen die sogenannte Wahrnehmungsorganisation und stellten verschiedene Gesetze auf – die Gesetze der Nähe und der guten Fortsetzung, die zu erklären suchen, wie wir Muster in abstrakten Formen sehen. Insgesamt sind sie als Gestaltgesetze bekannt, und sie beschreiben auch heute noch zutreffend den Vorgang des Sehens. Die Gestaltpsychologen entwickelten ein besonderes Interesse für die Richtigkeit dessen, was wir sehen. Ende des 19. Jahrhunderts hatte eine Gruppe deutscher Psychologen die Gestaltpsychologie begründet – eine Theorie der Gestaltwahrnehmung mit Gesetzen der Prägnanz (oder Prägnanztendenz), die den Prozess der Wahrnehmung erklären. Das Gesetz der Ähnlichkeit (Abbildung 5) besagt, dass Elemente einer Figur mit größerer Wahrscheinlichkeit als zusammengehörig wahrgenommen werden, wenn sie einander ähnlich sind; die Ähnlichkeit kann sich auf Form, Farbe, Größe oder Helligkeit beziehen. Das Gesetz der Nähe (Abbildung 6) postuliert, dass Oberflächen oder Konturen, die nahe beieinander liegen, mit größerer Wahrscheinlichkeit Elemente desselben Objekts sind als solche, die weit auseinander liegen. Andere Gestaltprinzipien sind die Gesetze der guten Fortsetzung, des gemeinsamen Schicksals und der Symmetrie. Der Ponzo-Effekt und die Müller-Lyer-Illusion Diese Illusionen können durch die Annahme erklärt werden, dass bestehendes Wissen über dreidimensionale Objekte fälschlicherweise auf zweidimensionale Muster bezogen wird. Abb. 5 Abb. 6 Stichwort 139 Die Wahrnehmung von Formen ist ausschließlich eine Angelegenheit der Erfahrung. Der Ponzo-Effekt (Abbildung 7; auch als Mondtäuschung bekannt) bedeutet, dass zwei horizontale Linien genau die gleiche Länge haben, obwohl die untere Linie viel kürzer zu sein scheint. Das liegt daran, dass die lineare Perspektive, die durch die konvergierenden Linien der EisenbahnJohn Ruskin, 1890 schienen erzeugt wird, den Eindruck erzeugt, die obere Linie sei weiter entfernt. Wenn sie auf der Netzhaut die gleiche Größe hat, aber weiter entfernt ist, muss sie größer sein – unser Wahrnehmungssystem berücksichtigt irrtümlicherweise auch die Entfernung. Die Müller-Lyer-Illusion (Abbildung 8) lässt sich ähnlich erklären. Die linke Linie wirkt wie die äußeren Ecken eines Gebäudes, während die rechte Linie wie innere Ecken aussieht. Diese inneren Ecken sind in gewissem Sinne weiter entfernt als die äußeren, und so wird die rechte Linie als weiter entfernt wahrgenommen, und nach der gleichen Logik wie beim Ponzo-Effekt wird sie als länger wahrgenommen, da sie die gleiche Größe auf der Netzhaut hat. Diese Illusionen zeigen, dass die Wahrnehmung auch von anderen Faktoren als dem eigentlichen Reiz beeinflusst wird – in diesem Falle von der wahrgenommenen Entfernung und vorheriger Erfahrung. Konstanzphänomene Wenn ein Objekt sich nähert oder entfernt, unterschiedlich beleuchtet wird oder sich dreht, neigen wir dazu, es nicht als unterschiedlich oder veränderlich, sondern als dasselbe Objekt zu sehen. Es gibt verschiedene Arten von Konstanzprozessen – Form, Größe, Farbe, Helligkeit –, die dazu beitragen können, optische Täuschungen zu erklären. Bitte nehmen Sie dieses Buch auf und halten Sie es aufrecht in Ihrem Blickfeld. Es ist ein Rechteck. Dann drehen Sie es, zunächst um die vertikale, dann um die horizontale Achse. Es hat nicht mehr dieselbe Form, doch in Ihrer Wahrnehmung bleibt das Buch dasselbe. Das wird als Formkonstanz bezeichnet. In ganz ähnlicher Weise scheint ein Elefant, der sich von uns entfernt, nicht kleiner zu werden – obwohl sein Abbild auf der Netzhaut durchaus kleiner wird. Kultur und die »carpentered world« (»gezimmerte Welt«) Bitte stellen Sie sich vor, Sie seien in einer Welt aufgewachsen, in der es keine geraden Linien gibt: keine rechteckigen Häuser, gerade Straßen, lange Stangen 140 Die Welt im Kopf oder lange, rechteckige Tische. Die Häuser sind rund, die Felder ebenso. Die Wege sind verschlungen und gewunden. Würden Sie dann immer noch auf optische Täuschungen »hereinfallen«? Wenn Sie noch nie gerade Straßen oder Eisenbahngleise gesehen hätten, würden Sie den Ponzo-Effekt erleben? Oder wenn Sie nie eine Haus- oder Zimmerecke gesehen hätten, würden Sie die Müller-Lyer-Illusion erleben? Es sind verschiedene Studien mit Angehörigen ländlich lebender Stämme der Urbevölkerungen in Afrika und Australien durchgeführt worden, um Hypothesen über den Einfluss von Lernen und Erfahrung auf die Interpretation optischer Täuschungen zu untersuchen. In einer Studie wurden städtisch und ländlich lebende Afrikaner miteinander verglichen, die mit einem Auge eine rotierende, trapezförmige Form, das sogenannte Ames-Fenster, betrachteten. Erwartungsgemäß sah die ländliche Gruppe es nicht rotieren, sondern nach 180 Grad die Drehrichtung wechseln. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass südafrikanische Zulus den Ponzo-Effekt stärker erlebten als weiße Südafrikaner, möglicherweise aufgrund ihrer ausgedehnteren Erfahrung mit weiten, offenen Räumen. Demnach können unsere persönlichen und kulturellen Erfahrungen es mehr oder weniger wahrscheinlich machen, dass wir optische Täuschungen sehen. Abb. 7 Abb. 8 Adrian Furnham Die wahrgenom­mene Länge einer ­Linie hängt von Ausrichtung und Form ­anderer Linien ab, die sie um­geben. Arthur S. Reber, 1985 Stichwort 141 Der sechste Sinn Alle haben ihn, kaum jemand kennt ihn: Den Körpersinn. Ohne ihn würde der Mensch unbeholfen durch die Welt stolpern. Aus dem Gefühl für den Körper könnte einst sogar das Selbstbewusstsein entstanden sein Ian Waterman geht schlurfend, breitbeinig, steif. Immer wieder bleibt er stehen, schaut an sich herunter, macht erneut ein paar Schritte, blickt abermals auf die Beine. Ginge jetzt das Licht aus, der kräftige Zweimetermann würde zu Boden fallen und hilflos liegen bleiben. Denn Ian Waterman spürt vom Nacken abwärts seinen Körper nicht. Er muss seine Bewegungen unablässig mit den Augen kontrollieren. Dabei war dieser Hüne vor 30 Jahren noch ein Teenager wie jeder andere. Bis er als 19-Jähriger an einer heftigen Grippe erkrankte. Plötzlich konnte er seinen Körper nicht mehr aus dem Bett heben und fuchtelte unkoordiniert mit dem Arm herum, wenn er nach einem Buch greifen wollte. Eine Autoimmunreaktion hatte sämtliche Sinnes­nerven aus Muskeln, Sehnen und Haut unterhalb seines Genicks vernichtet. Nervenbahnen, mit deren Hilfe das Gehirn Haltung und Bewegung wahrnimmt. Bei Ian Waterman ist dieser Körpersinn seither unwiederbringlich zerstört. Ein Horrorzustand, doch gelähmt ist er nicht. Die motorischen Nerven, die den Muskeln ihre Kommandos geben, blieben intakt. So konnte er lernen, die Muskeln provisorisch über das Sehen zu kontrollieren. Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken – jeder kennt die fünf Sinne des Menschen. Der Körpersinn dagegen ist weitgehend unbekannt. Denn nur selten wird uns bewusst, mit welcher Macht er unser Leben regiert. Ohne den Körpersinn könnten wir weder geschmeidig gehen noch Fahrrad fahren, weder Sport treiben noch im Dunkeln hantieren. Und nicht nur unseren Körper erfühlt dieser sechste Sinn: Mit ihm spüren wir, wie der Sessel, auf dem wir sitzen, geformt ist. Wir können schätzen, wie viel noch in der Milchtüte ist, wenn wir sie bloß anheben und etwas schwenken. Dieser Sinn informiert uns über Masseverteilung, Schwerpunkt und Ba­ lance darüber, welche Wirkung welche Kräfte auf Bewegungen haben. Mit seiner Hilfe navigiert der Kellner ein überladenes Tablett über den Köpfen der Partygäste. Er lässt Werkzeuge wie Messer und Gabel, Hammer oder Schere, sogar das Auto zu Körperteilen werden. Einen Pinsel spüren wir bis in die Spitze. Anders als beim Riechen oder Hören hat der Körpersinn kein spezifisches Organ. Wir nehmen den Körper und seine Haltung mit mehreren Teilsinnen wahr: mit dem Tastgefühl und dem Gleichgewichtssinn, vor allem aber mit 142 Die Welt im Kopf sogenannten Tiefensensoren in Muskeln, Sehnen und Gelenken. Diese winzigen Messstationen informieren unser Gehirn dauernd über Stellung, Spannkraft und Bewegung der Körperteile. In den Armen, im Rumpf und den Beinen dominieren sie den Körpersinn. Das Gefühl für die Hände – sie sind beim Menschen besonders hoch entwickelt – entsteht dagegen gleichermaßen aus Tiefen- und Tastsinn. Eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung des Körpers spielt zudem das Gedächtnis. Denn die Interpretationen von Tiefensinn und Tastgefühl müssen nach der Geburt erst erlernt werden. Wie fühlt es sich an, eine Tür zu öffnen? Viele Male muss ein Kind zugreifen. Doch wenn es genug Erfahrung gesammelt hat, sieht es einer Tür von Weitem an, wie schwer- oder leichtgängig sie ist. Auch eine große Eisenkugel sieht aus der Entfernung schwer aus – weil wir mit Eisen schon früher einmal hantiert haben. Dass ein so bedeutender Sinn bis vor etwa 100 Jahren übersehen wurde, ist schwer zu glauben. Doch nachdem Aristoteles in der Antike die fünf Sinne Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten identifiziert hatte, blieb es mehr als 2000 Jahre lang dabei. Erst im frühen 19. Jahrhundert fragte sich der schottische Physiologe Charles Bell, wie Blinde es schaffen, so geschickt und zielgerichtet zu agieren. Er folgerte daraus, dass Ohne den es einen Sinn für die Lage und Bewegung Körpersinn können wir des Körpers geben müsse. Der Neurologe weder geschmeidig gehen und Medizinnobelpreisträger Charles noch Fahrrad fahren, Sherrington zeigte schließlich zu Beginn weder Sport treiben noch im des 20. Jahrhunderts, dass Muskeln und Dunkeln hantieren. Sehnen vollgepackt sind mit Sinneszellen, die er Propriozeptoren nannte, also Rezeptoren zur Selbstwahrnehmung. Der so enthüllte Körpersinn heißt seither Propriozeption. Dieses lebenslang geschulte Gefühl lehrt uns nicht nur, unsere Bewegung und die der Dinge zu verstehen. Auch die Anfänge der Physik waren unbewusst von Konzepten geprägt, die offensichtlich von körpersinnlichen Erfahrungen rührten. Etwa der Wurf: Noch im Mittelalter glaubten die Gelehrten, dass der Werfer aktiv einen »Impetus« erzeugt und auf das Wurfobjekt überträgt. Werfen wir einen Stein, fühlt sich das tatsächlich so an, als ob wir ihm einen Impuls mitgeben, der ihn durch die Luft trägt. Der über den Körpersinn vermittelte Eindruck, dass wir mithilfe solcher Impulse gezielt auf Dinge und Lebewesen einwirken können, ist vielleicht das Urbild unseres Konzep­tes der »Kausalität«, vielleicht gar die Wurzel der Unterscheidung von Ich und Welt. Der Körpersinn spielt nicht nur eine entscheidende Rolle für unsere Fähigkeit, die mechanischen Eigenschaften der Dinge im Wortsinn zu begreifen. Auch Die Sinne 143 das abstrakte Denken könnte seine Wurzel in körpersinnlichen Erfahrungen und Bewegungsintelligenz haben, vermuteten der Biologe Konrad Lorenz und der Entwicklungspsychologe J­ean Piaget. Ebenso könnten Gefühle auf Körperwahrnehmungen beruhen, glaubt der amerikanische Neuropsychologe Antonio Damasio. Und der Anthropologe Daniel Povinelli von der University of Louisiana behauptet sogar, das menschliche Selbst-Bewusstsein habe sich im Zuge der Evolution zuerst als Körper-Bewusstheit entwickelt, das den Menschenaffen bis dahin unmögliche Kletterkünste erlaubte. Bei Feldstudien im Regenwald Sumatras war Povinelli und seinem Kollegen John Cant aufgefallen, dass kleine­re Affen sich mithilfe weniger stereotyper Bewegungsschemata durchs Geäst hangeln, Orang-Utans sich jedoch äußerst flexibel und erfindungsreich durch die Bäume schwingen. Povinelli und Cant vermuten, dass nur ein hoch entwickeltes Körperbewusstsein solche Bewegungskreativität ermöglicht. Für große Tiere ist die Bewegung im Geäst anspruchsvoller als für kleine. Nicht nur weil die Schwergewichte meist an mehreren Ästen gleichzeitig turnen müssen. Auch hängen die Äste unter ihrem Gewicht stark durch und schwanken, was das Kraxeln und das Wechseln zwischen Bäumen kniffliger macht. Große Affen kommen deshalb mit Bewegungsstereotypien nicht mehr aus. An deren Stelle tritt ein neues »psychologisches System«, das Freiheit, Flexibilität und Bewegungsintelligenz stark vergrößert: das Bewusstsein für das körperliche Selbst. Wir Menschen gehen trotzdem nicht nur mit Werkzeugen viel geschickter um als Affen. Gefühlsbetont tanzen wir zu schöner Musik. Und nach entsprechendem Training turnen viele von uns besser, als Menschenaffen es je könnten. Im Zuge der Evolution vom Großaffen zum Menschen hat sich der Körpersinn offenbar noch einmal sprunghaft entwickelt – und an die menschliche Lust gekoppelt, forschend und übend mit unseresgleichen und den Dingen umzugehen. So stapeln Kinder Bauklötze und andere Gegenstände zu immer höheren Türmen. Indem sie mit Objekten hantieren, lernen sie viel über Massenverteilung, Schwerpunkt und Stabilität ihrer Bauwerke. Die Geduld der Menschenaffen ist da schneller am Ende. Povinelli glaubt, dass die­se Tiere nur ein rudimentäres Gefühl für die mechanischen Eigenschaften von Gegenständen entwickeln, weil ihr Verständnis dafür noch vom Sehsinn geprägt ist. Deshalb hätten Affen von Massenverteilung und Schwerpunkt kaum eine Ahnung. Menschen nutzen ihren Körpersinn viel intensiver als Affen, um die eigene Körpermechanik und die Physik der Dinge zu begreifen. Die Augen sind nur Damit sich Affen im Regenwald Sumatras von Ast zu Ast schwingen können, brauchen sie ein ausgeprägtes Körperbewusstsein. 144 Die Welt im Kopf Die Sinne 145 ein unvollständiger Ersatz. Das Schicksal Ian Watermans zeigt: Es bedarf jahrelangen harten Trainings, die mit dem Körpersinn verlorene Kontrolle wenigstens zum Teil zurückzugewinnen und mithilfe der Augen etwa einen Becher zu greifen. Die meisten körperblinden Menschen bleiben lebenslang ans Bett oder an den Rollstuhl gefesselt. Dass Ian Waterman es geschafft hat, sogar wieder zu gehen, ist eine Ausnahme. Er verdankt das vor allem einem selbst er­dachten kreativen Trainingsprogramm, seinem eisernen Erfolgswillen und Fleiß. Noch immer wirken selbst Alltagsbewegungen oft unbeholfen. Nichts ist automatisch, er muss jedes Detail seiner Aktionen planen. Wenn er sich bewegt oder auch nur sitzt, darf seine Konzentration keinen Augenblick nachlassen. Die ganz normalen Bewegungen eines Tages kosteten ihn die Anstrengung eines Top­athleten, wie er sagt. Gesunde Menschen dagegen bemerken kaum, in welche Richtung und wie stark sie sich zurücklehnen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Über das Körpergefühl geschieht das wie von selbst. von Franz Mechsner und Victor Smetacek aus ZEIT Wissen Nr. 4/2008 So klingt das Leben Musik kann trösten und glücklich machen. Kranke werden mit den richtigen Klängen gesund, und wer sich isoliert fühlt, findet wieder Anschluss an die Welt Die Frau im gelben Kleid steht allein auf der Bühne vor dem dunklen Saal. Im Orchestergraben hebt Ivan Repušić sachte den Taktstock, Flötenklänge steigen auf. Dann setzt Karolina Anderssons Sopranstimme ein, und mit einem Mal scheinen Sehnsucht und Entzücken mit Händen greifbar. Es ist ein Donnerstagabend in der Komischen Oper in Berlin. Gespielt wird Rigoletto. Die Zuhörer waren zunächst unruhig, doch jetzt, bei der berühmten Arie der Gilda im ersten Akt, wird es mucksmäuschenstill. Selbst die flüsternde Schulklasse und der Dauerhuster verstummen. Immer höher steigt der Gesang empor, fragend, klagend und schließlich in unbändigem Jubilieren. Nicht weit entfernt, in einer Halle am Stadtrand, schlägt Christoph Schneider einen schnellen Wirbel über seine Drums. Bass und E-Gitarre kommen hinzu, dröhnen durch die Halle. Schneider grinst und verfällt in einen dumpfen, stampfenden Viervierteltakt. Augenblicklich geht ein Ruck durch die Zuhörer, sie bewegen sich synchron im Takt. Als der Sänger die Bühne betritt, fliegen die Arme in die Höhe, beim Refrain schallt Gesang aus allen Kehlen. Rammstein proben Songs für ihre nächste große Tournee. Die Band testet ihren derben, harten Sound, der bald Zehntausende in Taumel versetzen wird. Zwei Musikstile, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und doch vermitteln die beiden Konzerte einen Eindruck davon, wie Melodien und Rhythmen uns in ihren Bann ziehen. Es gibt wohl nur wenige Dinge, die uns so einfach mit Glück erfüllen und einen so großen Einfluss auf unser Leben haben wie Musik. Beim Kochen schnippen wir im Takt zu Popsongs aus dem Radio. In der Kneipe plaudern wir mit Freunden, während im Hintergrund Jazz für lässig-entspannte Atmosphäre sorgt. Musik ist so alltäglich und vertraut, dass wir uns eine Frage oft überhaupt nicht stellen: Wie kommt es, dass Menschen in allen bekannten Kulturen und seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte komplizierte Muster aus Schallwellen erschaffen? Schallwellen – Sie bringen durch minimale Druck- oder Dichteveränderungen die Moleküle in einem elastischen Medium wie Luft oder Wasser zum Schwingen. Die Frequenz beschreibt 146 Die Welt im Kopf dabei die Anzahl der Schallwellen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten. Grundsätzlich gilt: Je kürzer die Wellen, desto höher die Frequenz und desto höher der Ton. Die Sinne 147 Wie könnten wir einem außerirdischen Besucher die menschliche Leidenschaft für Es klingt Rhythmen und Melodien erklären? Ist paradox: Musik ist Ausdruck Musik Ausdruck kosmischer Naturgesetkosmischer Naturgesetze – ze oder eine spezifisch menschliche Erfinund gleichzeitig eine spezifisch dung? Die Antwort muss lauten: beides menschliche Erfindung. zugleich. Denn unter den vielen natürlichen Geräuschen, die an unsere Ohren dringen, nehmen wir einige als Töne wahr, und in ihnen steckt schon eine grundlegende Struktur von Musik. Töne entstehen immer dann, wenn einfache Objekte wie Membranen oder Saiten in Schwingung geraten und nur wenige Frequenzen erzeugen, die in einem klar strukturierten Verhältnis zueinander stehen. Die gesamte Schwingungsenergie steckt dann in diesen wenigen Frequenzen, weshalb sie deutliche, weithin hörbare Signale produzieren. Bewusst nehmen wir meist nur die tiefste Frequenz wahr, die anderen schwingen aber als Obertöne immer mit und bestimmen die Klangfarbe, etwa den Unterschied zwischen einer Geige und einer Trompete. Der erste Oberton liegt immer bei der doppelten Frequenz des Grundtons. Hört man einen zweiten Ton, dessen Grundton in dieser doppelten Frequenz schwingt, dann empfinden alle Menschen diese beiden Töne als verblüffend ähnlich – sie erklingen im Abstand einer Oktave. Dass Töne zu Musik werden, ist das Verdienst einer enormen Analyseleistung des Gehirns: Es ordnet scheinbar mühelos ein kompliziertes Gemisch aus Schallwellen einzelnen Instrumenten und Stimmen zu und erkennt darin musikalische Phrasen und Motive. Diese Leistung wird nicht von einem spezialisierten »Musikzentrum« vollbracht, vielmehr arbeiten hier verschiedene Hirnareale zusammen. Musik hat also einen direkten Einfluss auf unser Gehirn. Der deutsche Neurowissenschaftler Stefan Koelsch hat in Untersuchungen zeigen können, dass fröhliche Musikstücke wie zum Beispiel das Allegro Noch erholsamer als aus Bachs Viertem Brandenburgischem passives Musikhören wirkt Konzert oder eine irische Tanzweise bei Patienten die Konzentration des Stressaktives Musizieren und Singen. hormons Cortisol im Blut verringerten – Darum erkunden Forscher während einer Operation benötigten sie den therapeutischen Einsatz eine geringere Dosis des Narkosemittels von Tönen. Propofol. Klänge und Rhythmen wirken also den Stressreaktionen unseres Körpers entgegen. 148 Die Welt im Kopf Eine Studie der kalifornischen Forscherin Sky Chafin und ihrer Mitarbeiter deutet sogar darauf hin, dass Musik den Blutdruck senken kann. Für ihre Studie stresste Chafin 75 Studenten mit einer Rechenaufgabe, die sie unter Zeitdruck bewältigen sollten. Bereits nach drei Minuten hatten die Studenten einen beschleunigten Herzschlag und einen deutlich erhöhten Blutdruck. Anschließend wurden die Probanden gebeten, in getrennten Zimmern zu warten. In einigen Räumen war es still, in anderen lief Musik: Jazz, Klassik oder Pop. Nach zehn Minuten maßen die Forscher erneut Blutdruck und Herzfrequenz der Versuchspersonen. Das Ergebnis: Wer in der Wartezeit Pachelbels Kanon oder Vivaldis Vier Jahreszeiten gehört hatte, war deutlich entspannter als die Studenten, die in Stille gewartet oder Musikstücken anderer Genres gelauscht hatten. Klassik kann eine erholsame Wirkung haben, schlossen die Forscher. Und zwar körperlich messbar. Mit diesem Versuch bestätigten sie Studien, die gezeigt hatten, dass Musik nicht nur Herzschlagfrequenz und Blutdruck senken kann, sondern auch den Atem verlangsamen, die Spannung in den Muskeln verringern und bewirken, dass man weniger schwitzt. Dass unterschiedliche Musik unterschiedlich wirkt, hat jeder schon selbst erlebt. Die Wissenschaft bestätigt die Alltagserfahrungen: Schnelle, harte Rhythmen, etwa in Heavy-Metal-Stücken, versetzen uns in Unruhe, Techno lässt den Cortisolspiegel im Blut steigen. Wenn wir sanfte Sphärenklänge zur Meditation einsetzen und uns mit Rock oder Elektro in Partystimmung bringen, tun wir also intuitiv das Richtige: Ruhige Melodien entspannen, schnelle, harte Rhythmen regen an. Noch erholsamer als passives Musik­hören wirkt aktives Musizieren und Singen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung mit 31 Sängern eines Kirchenchors. Der Musikwissenschaftler Gunter Kreutz ließ die Sänger vor und nach ihrer Chorprobe Fragebögen zu ihrem Befinden ausfüllen und eine Speichelprobe abgeben. Eine Woche später sollten sie der Aufnahme des Musikstücks lauschen, das sie in der Probe geübt hatten. Auch diesmal sammelte Kreutz vorher und nachher Speichelproben ein und befragte die Sänger nach ihrer Stimmung. Das Ergebnis: Sowohl das Singen als auch das Musikhören hatte die Laune der Sänger verbessert und ihren Cortisolspiegel sinken lassen. Die Effekte waren beim Singen aber viel stärker als beim Hören. Auch andere Studien haben ergeben, dass Singen das Wohlbefinden steigert, zum Beispiel eine britisch-australische Untersuchung mit mehr als 600 Teilnehmern. Hier füllten die Versuchspersonen Fragebögen aus, Stresshormone im Blut wurden nicht gemessen. Aufgrund solcher und anderer Wirkungen untersuchen Forscher zunehmend den Einsatz von Musik als Medizin. Manche Menschen lernen nach einem Schlaganfall oder Hirntrauma gemeinsam mit einem Therapeuten am Klavier, ihre Bewegungen wieder zu koordinieren. Und Tinnituspatienten kann speziell bearbeitete Musik dabei helfen, das rätselhafte Pfeifen und Klingeln in den Ohren wieder loszuwerden. Die Sinne 149 Bei Menschen mit Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen kann gemeinsames Singen Verhaltensstörungen wie Aggressionen mildern. Die richtige Musik kann verschüttete Erinnerungen zurückholen und dem Leben wieder einen emotionalen Halt geben. Wegen ihrer stimmungsaufhellenden Wirkung wird Musik sogar als Mittel zur systematischen Behandlung von Depressionen erprobt. Eine Studie der National University of Singapore hat beispielsweise gezeigt, dass Menschen in Altersheimen weniger unter Depressionen litten, wenn ihnen eine halbe Stunde am Tag ihre Lieblingsmusik vorgespielt wurde. Musik kann nicht nur Emotionen verändern, sondern ermöglicht auch Kommunikation ohne Worte. »Musiktherapie ist in erster Linie dann angezeigt, wenn Menschen nicht sprechen können«, sagt Karin Schumacher, Professorin am Musiktherapiezentrum der Universität der Künste in Berlin. Sie erforscht vor allem die Möglichkeiten, durch improvisierte Musik mit autistischen Kindern in Kontakt zu treten und deren zwischenmenschliche Fähigkeiten zu fördern. Doch auch andere Menschen kann man so zum Sprechen bringen, etwa demente Patienten oder solche, die aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas oder eines Schlaganfalls die Fähigkeit zu sprechen verloren haben. »Sogar Patienten im Wachkoma versuchen wir mit Musik zu erreichen«, sagt Schumacher. Mangelnde Kommunikation kann sich gerade auf die Entwicklung von kleinen Kindern empfindlich auswirken. Aus diesem Grund wenden die Therapeuten der KunstMusikRäume in Berlin-Kreuzberg seit einiger Zeit eine neue Methode an, um mithilfe von Musik Defizite auszugleichen. In der Einrichtung betreut ein kleines Team aus spezialisierten Musiktherapeuten Kinder, deren Erzieher und Lehrer angesichts massiver Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten nicht mehr weiterwissen und die vom Jugendamt hierher verwiesen werden. Zentrum der Praxis ist ein heller, weiter Raum, in dessen Mitte eine große Trommel steht, die von Sitzkissen umsäumt wird. An den Wänden hängen verschiedene, meist einfache Instrumente, in der Ecke steht ein Klavier. Der zweijährige Paul* und seine Mutter lassen sich auf dem Boden nieder. Paul ist hier, weil es ihm schier unmöglich ist, sich auch nur für kurze Zeit von seiner Mutter zu lösen und sich anderen Dingen zuzuwenden. Die Therapeutin Kathrin Vogt setzt Musiktherapie – Sie kommt unter anderem zum Einsatz bei psychischen Krankheiten, kindlichen Entwicklungsstörungen und behinderten Menschen. Bei der rezeptiven Musiktherapie steht 150 Die Welt im Kopf das Hören im Vordergrund. Bei der aktiven Musiktherapie hingegen spielt der Patient selbst Instrumente. Das soll ihm helfen, sich auszudrücken. sich zu den beiden, schlägt die Saiten ihrer Gitarre an und singt dazu ein improvisiertes Lied: »Hallo, Paul, hallo, Paul, was ist denn da?« Zunächst wandert der Blick des kleinen Jungen ziellos im Zimmer umher. Er schmiegt sich in den Schoß seiner Mutter. Als diese Pauls Arme hebt, hält Vogt in ihrem Lied inne, es entsteht eine kleine dramatische Pause. Erst als die Hände von Mutter und Kind heruntersinken, fährt sie mit dem nächsten Ton fort. Ein kurzes Lächeln huscht über das Gesicht des Jungen. Ermutigt durch den lustigen Effekt, hebt er, diesmal aus eigenem Antrieb, erneut seine Arme – und wieder hält die Therapeutin inne. Immer wieder reagiert sie auf kleinste Impulse, kommentiert mit Gitarre und Gesang das Verhalten von Mutter und Kind, während diese zu gemeinsamen Aktionen zusammenfinden. Ein halbes Jahr später ist daraus ein vergnügtes Spiel geworden, bei dem der Junge begeistert durch den Raum rennt. »Die Probleme von Paul rühren daher, dass die Mutter bislang sehr verhalten und unsicher reagiert hat und auf die Signale ihres Kindes nicht angemessen eingehen konnte«, erklärt die Therapeutin. Bei solchen Störungen der Mutter-Kind-Beziehung stößt Kathrin Vogt etwas an, das normalerweise früh in der Entwicklung des Kindes geschieht. Durch lautmalerische Übertreibungen in ihrer Sprache versuchen Eltern, die Aufmerksamkeit ihres Babys auf sich zu ziehen und eine Kommunikation herzustellen. »Die Musik hat viele Elemente dieser frühen Babysprache«, sagt Vogt. »Ich bringe damit Mutter und Kind in Kontakt und synchronisiere ihre Aktionen und Empfindungen.« Das von den beiden Psychotherapeutinnen Katrin Stumptner und Cornelia Thomsen entwickelte Konzept soll demnächst auch an der Berliner Universität der Künste gelehrt werden. Die kanadische Psychologin Sandra Trehub, die lange die Interaktion von Kleinkindern und Müttern und deren Babysprache studiert hat, vermutet in dieser lautmalerischen Sprechweise sogar einen Ursprung von Musik. Und die amerikanische Anthropologin Dean Falk sieht darin einen Beleg für die gemeinsamen Wurzeln von Sprache und Musik: Als die Gehirne der frühen Hominiden größer wurden, kamen Babys zunehmend unreif zur Welt, damit ihre Köpfe noch den Geburtskanal passieren konnten. Während neugeborene Affen sich im Fell ihrer Mütter festklammern können, mussten die Vormenschen, so Falk, eine Wachkoma – Schwere Hirnschädigungen verursachen diesen Zustand, meist hervorgerufen durch ein SchädelHirn-Trauma, Sauerstoffmangel oder Blutungen im Gehirn. Das Großhirn, das für die Wahrnehmung zuständig ist, stellt dabei in weiten Teilen oder sogar komplett die Arbeit ein. Die vegetativen Funktionen sind allerdings meist intakt, sodass viele Wachkoma-Patienten selbstständig atmen können und einen Tag-Nacht-Rhythmus besitzen. Die Sinne 151 Möglichkeit entwickeln, ihr Kind auch auf akustische Weise zu beruhigen. Wenn sie mit dem Säugling durch Säuseln und Gurren in Kontakt blieben, konnten sie ein waches Kind leichter ablegen und hatten die Hände frei, so die Theorie. Mit Sicherheit hat die Menschheit das Musizieren schon lange vor der Landwirtschaft entwickelt, manche Funde von Knochenflöten sind älter als 30 000 Jahre. Dabei ist die Unterteilung in Musiker und passive Zuhörer eine recht neue Entwicklung. In der Geschichte der Menschheit war Musik wohl meist ein gemeinschaftliches, oft mit Tanz verbundenes Erlebnis. Musik könnte frühzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl von Stammesgruppen gestärkt haben. Der Psychologe Robin Dunbar von der University of Liverpool argumentiert, dass schon frühe Hominiden ihre Gehirne durch gemeinsames Musizieren und Tanzen quasi in beglückenden Endorphinen gebadet hätten – als Äquivalent zum gegenseitigen Lausen von Affen, das zu einer Dopaminausschüttung im Gehirn führt und so soziale Strukturen festigt. Musik, so Dunbar, schließe heutzutage gleichsam die »Endorphinlücke«, die seit der Entstehung der eher verstandesbetonten Kommunikation durch Sprache entstanden sei. Allerdings ist der Mensch auch ohne Musik vorstellbar. Der Kognitionswissenschaftler Steven Pinker hat Musik daher einmal als »akustischen Käsekuchen« bezeichnet. So wie Käsekuchen die menschlichen Vorlieben für Zucker und Fett befriedige, sei Musik ein Zufallsprodukt, das unsere Lustzentren befeuere. Eine ähnliche Meinung vertritt der Psychologe Gary Marcus von der New York University: »Ich glaube nicht, dass wir mit einem Instinkt für Musik geboren werden. Wir werden mit einer ganzen Reihe von Fähigkeiten geboren, die uns empfänglich für Musik machen, aber das gilt auch für Videospiele.« Der amerikanische Neurobiologe Mark Chanzini bezeichnet Musik als »kulturellen Symbionten«, der sich grundlegende Fähigkeiten des Gehirns zunutze mache. Von jeher sei der Mensch darauf angewiesen gewesen, akustische Signale aus der Umwelt zu interpretieren. Musik sei zunächst in die Gehirne der Menschen gelangt, weil die Klangstrukturen emotional bedeutsame Geräusche der Natur imitierten – insbesondere den gleichmäßigen Rhythmus eines gehenden Mitmenschen. Dann aber habe sich der Symbiont gemeinsam mit dem Menschen weiterentwickelt – und so zusammen mit anderen kulturellen Fertigkeiten wie der Sprache das Menschsein überhaupt erst begründet. Symbiont – Der Begriff stammt ursprünglich aus der Biologie. Ein Symbiont ist ein Organismus, der sich im Rahmen einer Symbiose mit einem Wirt verbindet, der in der Regel größer ist als er selbst. Symbiosen können unterschiedlich aus- 152 Die Welt im Kopf So intellektuell reizvoll derartige Theorien auch sein mögen, ganz begreifen werden wir die Faszination, die Magie der Musik wohl nicht. Wie entstehen musikalische Ideen, die dann ihren Siegeszug um die Welt antreten und mitunter unsterblich werden? »Wir haben eine Gabe, diese martialisch-majestätischen Klänge zu erzeugen«, sagt der Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider. »Wenn Besuch da ist« – so nennen die Bandmitglieder jenen magischen Moment, wenn ein neues Stück entsteht, das ihre Fans gefangen nehmen wird. »Wir wissen es immer sofort, wenn uns ein solcher Gänsehautmoment gelingt, dann darf nichts mehr geändert werden.« Giuseppe Verdi kann sich zur Quelle seiner Inspiration nicht mehr äußern, doch durch seine Wirkung über die Jahrhunderte hinweg ist er der Unsterblichkeit so nahe wie irgend möglich gekommen. »Seine Musik klingt so einfach, und doch ist Verdi so tief, so reich, jede Note hat etwas zu erzählen«, schwärmt Ivan Repušić, nachdem er am Ende von Rigoletto den donnernden Applaus des Opernpublikums entgegengenommen hat. Der junge, aus Kroatien stammende Dirigent ringt kurz nach Worten. »Etwas, was man nicht beschreiben kann, was man nur fühlt – das ist Musik.« von Birgit Herden aus dem ZEIT Wissen Ratgeber Nr. 2/2013 geprägt sein: In der Protokooperation leben die Organismen in einer lockeren Al­lianz, während sie eine Eusymbiose eingehen, wenn sie ohne einander nicht überleben können. Die Sinne 153 Volle Dröhnung Mit allen möglichen Tricks kämpfen Plattenfirmen und Rundfunksender um die Aufmerksamkeit der Hörer. Musik und Werbespots klingen immer lauter – und schaden auf Dauer dem Gehör. Kennen Sie das auch? Im Fernsehen läuft der Film, den Sie im Kino verpasst haben, und plötzlich schlägt der erste Werbeblock ein. Die Musik des Spots reißt Sie vom Sofa, so laut klingt sie im Vergleich zum Film. Hektisch greifen Sie nach der Fernbedienung, um den Ton zu drosseln – und merken gar nicht, dass Sie Opfer eines Krieges geworden sind. Es ist der Loudness War, der da tobt – ein Krieg der Lautstärken, mit dem Werbung, Rundfunksender und Plattenfirmen um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Das Verblüffende daran: Die maximale Lautstärke all der Aufnahmen, die uns täglich beschallen, ist nicht höher als vor dreißig Jahren. Die Aufnahmen klingen nur so – dank der Finessen der modernen Tontechnik, die gelernt hat, das menschliche Gehör auszutricksen. Dabei gerät die Kunst der leisen Töne in Vergessenheit – und bis zu zehn Millionen EU-Bürgern droht eine Schwerhörigkeit durch die derart produzierte Musik, wenn sie sie über Kopfhörer hören. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Der Loudness War könnte bald vorbei sein. Dass er überhaupt beginnen konnte, hat mehrere Gründe. Einer liegt darin, dass das Gehör nicht wie ein unbestechliches physikalisches Messgerät funktioniert. Wie laut ein Schallsignal klingt, das unser Ohr erreicht, hängt von seiner Intensität, Frequenz und Dauer ab. Die psychoakustische Forschung hat herausgefunden, dass tiefe und hohe Töne leiser wirken als mittlere mit einer Frequenz zwischen einem und fünf Kilohertz. Und einen stakkatoartigen Ton nimmt der Mensch lauter wahr als einen durchgehenden, auch wenn beide die gleiche Frequenz und Intensität haben. Was landläufig als Lautstärke bezeichnet wird, ist deshalb keine eindeutig messbare Größe, sondern eine subjektive Empfindung – Wissenschaftler sprechen von Loudness, Lautheit. Diese gefühlte Lautstärke ähnelt der gefühlten Temperatur: Null Grad Celsius kommen uns kälter vor, wenn ein scharfer Wind weht, sommerliche 30 Grad wärmer, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Werden schon einzelne Töne unterschiedlich wahrgenommen, gilt das erst recht für Musik, diese äußerst komplexe Überlagerung vieler Töne. Die Tontechnik hat sich das zunutze gemacht und manipuliert nun die gefühlte Lautstärke. Der grundlegende Trick ist dabei erstaunlich simpel: Man macht erst die lauten Passagen etwas leiser, die leisen lauter und hebt dann alle zusammen an – und 154 Die Welt im Kopf schon horcht der Zuhörer auf, weil ein derart verändertes Stück aus anderen, nicht bearbeiteten Liedern heraussticht. Das erste Musiklabel, das diesen Trick bereits in den sechziger Jahren anwandte, war die legendäre Soulschmiede Motown. Wenn ein Kneipenbesucher sie in der Jukebox drückte, klangen die Singles von Marvin Gaye, den Su­premes oder den Temptations schärfer als die der Konkurrenz. Um dies hinzubekommen, tricksen Tontechniker bis heute mit der Dynamikkompression. Als Dynamik eines Musikstücks bezeichnet man die Abfolge der leisen und lauten Stellen: das Flirren von Streichern, das sich zu einem Crescendo steigert, in das Paukenschläge drängen, oder eine gezupfte E-Gitarre, die plötzlich verzerrt und gedroschen wird, um zu verstummen und einem E-Piano Platz zu machen. All diese Klänge muss der Tontechniker in einer begrenzten Lautstärkeskala unterbringen, die vom Tonträger abhängt. Für CDs beträgt sie rund 96 Dezibel Full Scale (dbFS) – von minus 96 bis 0 dbFS. Die Einheit gibt an, mit welchem Schalldruck der Trommelschlag, die Trompete oder das Klavier im Verhältnis zueinander aus einem Lautsprecher kommen. In einer Audiosoftware erscheint das Stück als gezacktes Muster, in dem die höchsten Ausschläge die lautesten Stellen, die flacheren leise Passagen darstellen (siehe Grafik). Mithilfe von Kompressoren – früher spezielle elektronische Schaltungen, heute Software – kann der Toningenieur die niedrigen, leisen Ausschläge anheben und die hohen, lauten absenken. Die Folge: Das Zackenmuster variiert weniger, die Dynamik der Ausschläge ist gestaucht. Wird diese komprimierte Aufnahme als Ganzes nun noch ein Stück in Richtung Maximalpegel – 0 dbFS – hochgezogen, ist die gefühlte Lautstärke für den Hörer mit einem Mal größer als die der unkomprimierten Fassung. Das ist nicht unbedingt schlecht. »Manche Musik lässt sich unkomprimiert kaum alltagstauglich genießen. Gerade klassische Musik hat zuweilen eine so hohe Dynamik, dass sie fernab des Konzertsaals nicht mehr funktioniert«, sagt Marina Riester, Dozentin an der Electronic Media School in Potsdam. Wer etwa die unkomprimierte Liveaufnahme einer Mahler-Sinfonie im Autoradio hören möchte, müsste an einer Pianissimo-Stelle die Lautstärke weit aufdrehen, um das Motorengeräusch zu übertönen. Ein überraschendes Fortissimo wäre dann so laut, dass der Fahrer womöglich vor Schreck das Steuer verrisse. Was für Klassikfreunde auf der Autobahn noch eine sinnvolle Hilfe ist, verselbstständigte sich in den achtziger Jahren in der Pop- und Rockmusik. Als die Band Guns ’n’ Roses 1987 ihr Album Appetite for Destruction herausbrachte, setzte sie in puncto Loudness neue Maßstäbe. Weil der fette Sound beim Publikum gut ankam, zogen nun andere Studios nach und komprimierten ebenfalls heftig – oft auch auf Druck von Musikern oder Plattenfirmen. Ein akustisches Wettrüsten setzte ein. Eine Wunderwaffe sind dabei die Multibandkompressoren. Sie teilen das Musiksignal in verschiedene Frequenzbänder auf, also in Bereiche unterschiedlicher Tonhöhe, und komprimieren sie unterschiedlich stark. Selbst mittelmäßige Die Sinne 155 Aufgeblasen: Wie die Musik ihre Dynamik verliert Richard Wagner, »Rienzi« 156 Red Hot Chili Peppers, »Otherside« The Beatles, »Twist and Shout«, 1987 The Beatles, »Twist and Shout«, 2007 Klassische Musik (links) hat im Original viel »Dynamik«, das heißt, laute und leise Passagen wechseln einander ab. Rockmusik (rechts) wird heute so abgemischt, dass sie über weite Strecken gleich laut klingt. Viele ältere Alben, etwa von den Beatles, wurden inzwischen neu gemischt. Dabei nahm nicht nur die maximale, sondern auch die durchschnittliche Lautstärke zu, weil leise Passagen verstärkt wurden. Das Gehör werde dadurch verdorben, klagen Experten. Aufnahmen klingen dann plötzlich druckvoll, und eigentlich brillante Pop-Klassiker aus den siebziger Jahren erscheinen im Vergleich seltsam lahm. Das schwerste Geschütz ist der Limiter. Er kappt Signale, die oberhalb eines bestimmten Pegelwerts liegen – etwa besonders laute Beckenschläge oder den besonders starken Bass. Mit einem hart eingestellten Limiter lassen sich sämtliche Passagen bis auf den allerletzten Millimeter an das Maximum von 0 dbFS heranschieben. Das Pegelmuster zeigt keine Zacken mehr, sondern sieht eher wie ein Ziegelstein aus – weshalb man auch von Brickwall Limiting spricht. Derart abgeschnittene Signale haben jedoch eine Kehrseite: Sie können verzerren oder gar ein Knacken erzeugen. Berüchtigtstes Beispiel hierfür ist das Album Death Magnetic der US-Band Metallica. Auch im Radio wird der Loudness War ausgefochten. Wer heutzutage das UKW-Band durchhört, wird feststellen, dass es gerade in Ballungsräumen mit vielen Sendern erhebliche Klangunterschiede zwischen den einzelnen Rundfunkstationen gibt. Vor allem werbefinanzierte Privatsender versuchen, sich in akustischem Druck gegenseitig zu überbieten, um Hörer anzuziehen. Sie schicken bereits komprimierte Musik ein zweites Mal durch den Kompressor, um noch etwas mehr Loudness herauszukitzeln. Holger Schulze, Sound-Studies-Forscher an der Universität der Künste Berlin, findet das bedenklich. »Sind Kompressionen allgegenwärtig, dann klingt jede nicht komprimierte Produktion dürftig«, sagt er. »Die Hörenden verlieren ihr ästhetisches Gespür für nicht komprimierte Hörsituationen im Alltag.« Die Europäische Rundfunkunion will den Loudness War nun beenden. Ihre PLOUD-Arbeitsgruppe hat neue Grenzwerte für die Lautstärke entwickelt, die in Deutschland seit Jahresanfang von den öffentlich-rechtlichen Sendern angewendet werden. Anders als früher werden dabei nicht mehr die Spitzenwerte der Lautstärke begrenzt, sondern die Loudness eines Programms – also wie nah dessen durchschnittliche Lautstärke dem maximalen Sendepegel kommt. Die Privatsender haben den Standard noch nicht übernommen. Das sollten sie aber tun: Wer täglich komprimierte Musik über Kopfhörer konsumiert, tut sich keinen Gefallen. »Diese Musik übt einen wesentlich größeren Stress auf das Gehör aus als dynamische Musik bei gleichem Schalldruck«, also gleicher Lautstärkeeinstellung, warnt der Toningenieur Friedemann Tischmeyer. Starke Kompression verringere auf Dauer die Fähigkeit, Gesprächen zu folgen, man müsse sich dann stärker auf sie konzentrieren, sagt er. Der Wahlkalifornier hat 2009 die Pleasurize Music Foundation gegründet. Die Stiftung unterstützt Tonstudios mit einer Software, die während der Produktion die Dynamik von Aufnahmen anzeigt. Zudem will die Organisation bewirken, dass die Plattenfirmen die Verbraucher über den Dynamikumfang ihrer Musik informieren – um so dynamischere Aufnahmen wieder populär zu machen. Immerhin: »Im vergangenen Jahr hatte ich mehr Anfragen für ein dynamisches Mastering als in vielen Jahren zuvor«, sagt der US-Tontechniker Bob Ludwig, der für Jimi Hendrix, die Rolling Stones, Nirvana und Radiohead gearbeitet hat. »Das ist ein ermutigendes Zeichen, denn lange gab es nur die Anweisung, die Aufnahme ›scharf‹ zu machen – das heißt: laut.« Gerade jüngere Bands verzichten neuerdings darauf, das Maximum aus ihrer Musik herauskitzeln zu lassen. Am Ende könnte der Loudness War dadurch beendet werden, glaubt Ludwig, dass laut produzierte Platten plötzlich altmodisch klingen – »wie ein schlechter Drumcomputer aus den Achtzigern«. Die Welt im Kopf von Niels Boeing und Jochen Reinecke aus ZEIT WISSEN Nr. 2/2012 Die Sinne 157 4. Das erkrankte Gehirn Sucht, Schmerz, Panik, Phobie, Depression – jedes Jahr durchlebt ein Drittel der Bevölkerung ein psychisch bedingtes Leiden. Die wenigsten Menschen reden darüber. Eine psychische Erkrankung gilt noch immer als Stigma. Das Versteckspiel hat Folgen. Viele Patienten suchen erst spät professionelle Hilfe. Und ihr Rückzug verschlimmert die Situation meist noch. Die Parole heißt: Nicht raus aus dem Alltag, rein in den Alltag. Das ist oft die beste Therapie. 158 Die Welt im Kopf Immer auf der Kippe Zwischen Neurose und Psychose, zwischen Angst und Wahn spielt sich das Leben von Borderlinern ab. In einer Hamburger Klinik lernen sie, anderen Menschen zu vertrauen Die Ansage auf dem Anrufbeantworter in der psychotherapeutischen Praxis war unmissverständlich: »Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer – außer Sie sind Borderliner.« Diese Abfuhr erlebte eine Patientin, die jetzt in der Asklepios Klinik Nord in Hamburg unter­gekommen ist. Borderlinepatienten gelten als besonders schwierige psychisch Kranke. Oft schlagen ihnen negative Reaktionen entgegen. Nicht nur in der Familie. Freunde und Kollegen sind von den sozialen Dissonanzen, die diese Patienten oft auslösen, äußerst angestrengt. Und auch viele Therapeuten. Der Hamburger Psychiater Birger Dulz gehört nicht dazu. Er ist Chefarzt der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen und einer der renommiertesten Borderlinespezialisten in Deutschland. Er versteht die Abneigung seiner Kollegen gegen diese Patientengruppe nur zu gut, denn Borderliner seien oft »unflexibel, lahmarschig, humorlos, selbstbezogen, begriffsstutzig, aggressiv, feige, kommunikationsfaul, kleingeistig, borniert, unfähig zum Verfolgen eigener Einsichten«. Die Stärken der Borderline­patienten sieht Dulz aber auch: Sie könnten »kreativ, pfiffig, witzig, selbstironisch, hilfsbereit, intelligent, streitbar, mutig, schlagfertig, großherzig, zugewandt, einsichtig« sein. Diese Gegensätze fordern Dulz heraus, und er bekennt: »Ja, ich mag Borderliner!« Auf Station O52A behandeln Dulz und seine Kollegen ausschließlich Bor­ der­line­pa­tien­ten. Sie arbeiten an Fragen, die jeden Menschen umtreiben: Wie viel Nähe zu anderen kann ich ertragen? Wie viel Distanz ist für mich und andere nötig? Das hört sich harmlos an, doch für die Kranken sind solche Fragen von existenzieller Bedeutung. Ihr Problem ist es nämlich, einen Korridor zu finden zwischen überschwänglicher Zuneigung und hasserfüllter Abneigung. Das führt immer zu erheblichen Problemen mit anderen Menschen – und nicht selten zu Übergriffen und Kriminalität. »35 Prozent der erstinhaftierten männlichen Straftäter sind Borderliner«, sagt Dulz. »Bei den Frauen sind es 20 Prozent.« Im Sportraum der Klinik im Norden Hamburgs sitzen zwei Teddys auf dem Boden, einander zugewandt. Eine 34-jährige Frau, die hier Sandra Fischer heißen Das erkrankte Gehirn 159 soll, hat sie so dahin gesetzt. Sie selbst hockt in der Ecke des Raums, halb hinter einer Säule. Die Aufgabe in der Körpertherapie heute: Die Patienten sollten ihr wichtigstes Problem darstellen und sich dazu positionieren. »Meine Themen sind Partnerschaft und Nähe«, sagt Fischer, als sie an der Reihe ist. »Und der große Wunsch nach einer eigenen Familie.« Die Teddys stehen für Mutter und Kind. Am Ende der Therapiestunde sollen die Patienten einen großen Schritt auf ihr Symbol zu machen. Fischer macht aber bloß ein winziges Schrittchen. »Muss ich wirklich?«, fragt sie. Sandra Fischer ist zum dritten Mal auf der Borderlinestation. Vorher war sie in vielen anderen Kliniken, bei vielen anderen Therapeuten. Einen Freund hatte sie noch nie. Mit Mitte zwanzig hat sie angefangen, mit Fäusten und dem Kopf gegen Wände und Glasscheiben zu schlagen, sich mit Rasierklingen zu schneiden. Selbstverletzungen sind ein typisches Zeichen für eine Borderlinestörung. In den Patienten herrschen gleichzeitig große Leere und enorme Anspannung. Die Autoaggressionen wirken als Ventil, durch das der Druck entweichen kann. Vorüber­gehend. Dann baut er sich wieder auf. Die Borderlinestörung ist eine Mischerkrankung – der Begriff entstand, weil bei den Betroffenen sowohl neurotische Symptome wie Angst diagnostiziert werden als auch psychotische Symptome wie Wahnvorstellungen. Sie befinden sich also im Grenzbereich zwischen Neurose und Psychose. Viele Patienten selbst interpretieren den Begriff anders, sehen sich als »Grenzgänger«, immer auf der Kippe. Die Borderlinestörung ist eine Krankheit der Beziehungen. Sie wird ausgelöst durch Beziehungen – verletzende, lieblose, nicht vorhandene. Und sie zeigt sich in Beziehungen – macht sie kompliziert oder instabil oder verhindert sie ganz. Die Störung lässt sich aber auch durch Beziehungen wenn nicht heilen, so doch lindern. Das ist das Konzept der Sta­tion O52A. »Man kann sich das vorstellen wie eine Waage«, sagt der Chefarzt Birger Dulz. »Bei den Patienten liegen viele schlechte Beziehungserfahrungen in der einen Schale. Von denen können wir sie nicht befreien. Wir versuchen aber, sie durch gute Beziehungserfahrungen aufzuwiegen.« Dulz sieht seine Arbeit als sportliche Herausforderung. »Wenn man nicht bereit ist, mit den Patienten zu kämpfen und um sie zu kämpfen, ist man hier falsch«, sagt er. Gern spielt der Chefarzt den bad cop, der die Patienten mit Unangenehmem konfrontiert, während der jeweils zuständige Therapeut sie als good cop in Schutz nimmt. Das Rollenspiel soll die Beziehung zwischen Therapeut und Patient stabilisieren. Doch nicht nur auf die Beziehungen zu den Therapeuten, auch auf die zu den anderen Patienten kommt es an. 22 Borderliner leben auf der Station, für Wochen und Monate, sie teilen sich die Zimmer, das Bad, die Waschmaschine. Diese Wohngemeinschaftstherapie sei das Anstrengendste an dem ganzen Aufenthalt, hat eine Patientin einmal zu Dulz gesagt. Es ist wie eine 22er-WG mit mehr als normal nervigen Mitbewohnern. 160 Die Welt im Kopf »Ganz am Anfang bin ich hier nur rumgeschlichen«, erzählt Sandra Fischer. Die Border»Da haben drei Leute auf dem Flur Karten line-Störung ist eine gespielt, und ich habe mich nicht mal geKrankheit der Beziehungen: traut, hallo zu sagen.« Damit so zurückSie wird ausgelöst durch gezogene Patienten wie sie wenigstens Beziehungen, und sie zeigt zum Pflegeteam Kontakt halten, müssen sich in Beziehungen. sie sich regelmäßig im Dienstzimmer melden. »Das war der Horror«, erinnert sich Fischer. »Ich konnte nicht mal sagen, warum es mir scheiße ging.« Sie verließ die Klinik, kehrte zurück: »Da konnte ich mich ein bisschen mehr öffnen.« Jetzt, beim dritten Mal, sei sie schnell da angekommen, wo sie an sich arbeiten wolle, »bei den Themen Partnerschaft, Sexualität, Familie. Jetzt bin ich mittendrin in meinen Gefühlen.« Ein paar Männer hat sie schon kennengelernt, im Internet, sie hat ihnen geschrieben, aber immer wenn ein Mailkontakt sie treffen wollte, zog sie sich zurück. »Ich hab einfach nichts gespürt.« Einmal kam es doch zum Treffen, es folgten schneller Sex und wenig Gefühl. Denn so sehr sich Sandra ­Fischer auch nach Nähe sehnt, so sehr fürchtet sie diese auch. Sex ist da leichter. Andererseits ist Sexualität ein großes Tabu für sie. Plaudern Bekannte über erotische Vorlieben, würde Sandra Fischer sich am liebsten unsichtbar machen. Dann aber wieder fühlt sie sich häufig nicht wahrgenommen, nicht verstanden, nicht geschätzt. »Frau Fischer empfindet sich wie viele Bor­der­liner vor allem als Opfer«, sagt Cornelia Bothe, Fischers Therapeutin. »Und sie dreht die Tatsachen immer so, dass sie auch als Opfer dasteht. Dass sie, wie alle anderen, auch mal böse sein kann, sieht sie nicht.« Bothe versucht, ihre Patienten aus dieser Schwarz-WeißSicht auf sich und die Welt zu reißen. »Es ist für sie wichtig, zu sehen, dass sie mitunter auch Kotzbrocken sind und selbst Anteil daran haben, wenn andere von ihnen genervt sind.« Das zeigt Bothe den Kranken auch: dass sie manchmal wirklich sauer ist – aber trotzdem die Beziehung zu ihnen nicht abbricht. Sie und ihre Kollegen bieten sich den Patienten als Spiegel an und als Sparringspartner. Der Schwarz-Weiß-Blick auf die Welt ist ein Relikt aus einer Zeit, als die meisten Borderline­patienten tatsächlich Opfer waren – ihrer Kindheit und Jugend. 80 Prozent von ihnen haben das erlebt, was Psychologen Realtrauma nennen: Missbrauch, Aggression, Misshandlung. Noch schlimmere Spuren als körperliche Angriffe hinterlassen aber emotionale Vernachlässigung und Missachtung. Deren Folgen zu behandeln sei weit komplizierter, sagt Dulz: »Wenn etwas vorgefallen ist, kann man daran arbeiten. Wenn etwas gefehlt hat, ist das deutlich schwieriger zu therapieren.« Missachtung und Vernachlässigung – das haben alle Patienten erlebt, auch Sandra Fischer. Als sie zur Welt kam, litt ihre Mutter an Ängsten und Panik­ attacken, für ihr Kind war sie nicht da. Der Vater, ein Lehrer, war streng und Das erkrankte Gehirn 161 forderte Leistung. Sex war das große Tabu. Wenn Fischer sich als Jugendliche schick anzog, warf ihr der Vater vor, sie sei »aufreizend«, die Männer würden ihr »hinterhergeifern«. Außerdem »sexualisiere« sie ihre Geschwister. Selbst die Zahl Sechs durfte im Haushalt Fischer nicht ausgesprochen werden. Und immer wieder flog ein Hausschuh, gab es Fußtritte. Die Mutter sei ein »stilles Mäuschen« gewesen, erinnert sich Fischer, sie habe vor allem nicht auffallen wollen. Wenn die junge Frau auf einem Fest laut lachte, herrschte die Mutter sie an, sie solle sich nicht so auff ühren. Als Reaktion auf die beklemmenden Umstände ihrer Kindheit wurden die meisten Borderlinepatienten zu Überlebenskünstlern. Sie sind Meister der Anpassung, sie haben gelernt, sich unsichtbar zu machen. »Keine Schwäche zu zeigen hat es ihnen ermöglicht, die Situation in ihren Familien durchzustehen«, sagt Birger Dulz. Bei vielen ist diese Stillhaltetechnik so ausgeprägt, dass sie ihre Probleme selbst nicht mehr erkennen können. »Eigentlich hab ich ja gar nichts«, sagen sie im Gespräch mit den Therapeuten und untereinander. Die anderen Patienten werden dann unwillig. »Klar, du machst hier ja nur Urlaub«, geben sie zurück, oder: »Sicher, und nächste Woche bringst du dich dann wieder um.« Das Verhalten vieler Borderliner mag gleichgültig erscheinen, in ihren Köpfen aber herrscht Aufruhr. Zwischen den anderen im Aufenthaltsraum sitzt ein großer, breitschultriger Mann im Fußballtrikot. Erst vor ein paar Tagen ist er auf die Station O52A gekommen. Er hört zu, ab und zu sagt er etwas, leise und ein bisschen schüchtern – ganz gewöhnlich eigentlich. Wie wenig normal diese Normalität ist, versteht nur, wer weiß, was der Mann im Trikot kurz zuvor in der Männertherapiegruppe erzählt hat. Als er vier, fünf Jahre alt war, hatte der neue Freund seiner Mutter immer wieder zur Waffe gegriffen und auf ihn geschossen. Nicht um ihn zu töten – sondern damit er in Todesangst »tanzte«. Die Mutter war dabei und hatte gelacht. Die anderen Patienten waren geschockt. Nicht nur von der Geschichte, sondern auch davon, dass der Mann sie gleich in der ersten Stunde erzählte. Dr. Birger Dulz Birger Dulz ist Gründer des Hamburger Netzwerkes Borderline. Für ihn ist Angst und nicht Wut der zentrale Affekt der Borderline-Erkrankung. Seit 2006 ist Dulz Chefarzt der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen in der Hamburger Asklepios Klinik Nord. 162 Die Welt im Kopf »Wenn du so früh die Schotten aufmachst, landest du ganz schnell auf der Geschlossenen«, warnten die Männer ihn. Der Neuankömmling hatte in früheren Therapien zu hören bekommen, er öffne sich nicht genug. Auf den Platz in der Asklepios Klinik hat er vier Monate lang warten müssen. Jetzt will er alles richtig machen. Bis die Patienten ihre Probleme nicht nur sehen, sondern auch bewältigen können, braucht es viel Zeit. Sandra Fischer ist keine Ausnahme, viele Patienten kommen zwei, drei Mal auf die Station, für mehrere Monate. »Ambulant ist eine derart intensive beziehungszentrierte Therapie gar nicht zu leisten«, sagt Dulz. »Außerdem tauchen Borderliner immer gerade dann ab, wenn es ihnen schlecht geht.« Der Aufwand an Zeit, Geld und Nerven lohne sich aber, nicht nur für die Betroffenen selbst: »Was wir hier machen, ist eigentlich Prävention. Damit die Kinder der Patienten nicht auch noch dran glauben müssen.« Etwa 70 Prozent der Patienten verließen die Station »fast wiederhergestellt«, sagt der Psychiater. Doch das Phänomen Borderline greift weiter um sich. Dulz hat den Eindruck, dass die Störung zunimmt, auch wenn das schwer zu bemessen sei, weil Borderliner früher oft eine andere Diagnose bekommen hätten oder gar keine. »Entscheidend ist die Atmosphäre in den Familien«, sagt der Psychiater. Und die sei heute häufiger angespannt. Die Familienstrukturen verändern sich, Paare trennen sich, die Zahl der Alleinerziehenden wächst. »So trifft die Kinder schneller der Frust der Erwachsenen«, sagt Dulz. »Früher sind sie vielleicht zum Spielen zur Oma gegangen, wenn Vater oder Mutter gestresst von der Arbeit kamen.« Das Risiko für Kinder, in verletzenden oder lieblosen Beziehungen aufzuwachsen, hängt auch davon ab, wie viel Druck und Frust in einer Gesellschaft entstehen und wie sie sich verteilen. Sandra Fischer, die früher von Klinik zu Klinik irrte, sagt, sie habe auf Station O52A endlich das Gefühl, die Therapeuten wüssten, wie es in ihr aussehe. »Faszinierend«, sagt sie, und in ihrer Stimme schwingt Ungläubigkeit mit. »Hier geht mein Gegenüber trotz allem nicht weg.« Hier wird sie gesehen, das ist ihr wichtig. Aber hier hält man ihr auch den Spiegel vor. von Stefanie Schramm aus der ZEIT Nr. 47/2013 Das erkrankte Gehirn 163 Stichwort Illusion und Realität: Wahn »Dieser Kandidat in der Castingshow glaubt, er könne singen – ­anscheinend hat er Wahnvorstellungen.« »Dieser Politiker scheint größenwahnsinnig zu sein.« »Was ihre Hoffnungen auf eine Beförderung angeht – ich fürchte, das ist e ­ ine Wahnvorstellung.« Was sind Wahnvorstellungen? Eine Wahnvorstellung ist eine fixe, unveränderliche, fortdauernde, falsche Überzeugung ohne reale Grundlage, die Überzeugung einer Person oder einer Gruppe, die nachweislich falsch, völlig abstrus oder schlicht und einfach eine Selbsttäuschung ist. Ein Betroffener ist sich häufig seiner Wahnvorstellungen vollkommen sicher und absolut davon überzeugt. Er ist weitgehend uneinsichtig und lehnt unwiderlegbare Argumente und Beweise über die eklatante Unrichtigkeit seiner Vorstellungen rundweg ab. Gewisse religiöse Wahnvorstellungen können unmöglich verifiziert und daher auch nicht widerlegt werden. Auch haben manche Wahnvorstellungen eine selbst erfüllende Qualität; so könnte zum Beispiel ein wahnhaft eifersüchtiger Mensch seinem unschuldigen Partner Untreue vorwerfen, ihn dadurch in die Arme eines anderen treiben und so erst das Eintreten seiner Wahnvorstellungen herbeiführen. Diverse Varianten Ein Mensch kann Wahnvorstellungen über Geruch (olfaktorisch), Geschmack (gustatorisch), Temperatur (thermozeptiv) und Berührung (taktil) haben. Er kann sehr abstoßende, 164 Die Welt im Kopf angenehme oder ungewöhnliche Gerüche wahrnehmen, wenn er einer bestimmten Person begegnet. Gewöhnliche Nahrungsmittel (Orangen, Schokolade, Milch) können für ihn einen ganz anderen Geschmack haben als das, was er und andere Menschen gewöhnlich schmecken. Er kann einen kühlen Gegenstand als brennend heiß empfinden oder einen warmen Gegenstand als eiskalt. Er kann ein normalerweise glattes Material (etwa einen Ballon oder das Fell einer Katze) plötzlich sehr rau oder uneben finden. Es ist gezeigt worden, dass die in der Literatur am häufigsten behandelte Wahnvorstellung, nämlich der Verfolgungswahn (oder die Paranoia), in verschiedenen Phasen verläuft: generelles Misstrauen, selektive Wahrnehmung anderer, Feindseligkeit, p ­ aranoide »Erleuchtung« (alle Puzzlestücke fallen plötzlich an ihren Platz) und schließlich paradoxe Wahnideen von Einfluss und Verfolgung. Wahnvorstellungen nehmen einen Menschen oft völlig gefangen und verursachen ihm erhebliches Leiden. Es sollte festgehalten werden, dass Wahnvorstellungen etwas anderes sind als Illusionen. So können wir zum Beispiel visuelle und akustische Illusionen haben, dass die Sonne sich um die Erde dreht oder dass die Puppe eines Bauchredners tatsächlich spricht. Dissimulation und Wahnvorstellungen Vielfach wird – durchaus zu Recht – behauptet, dass viele Menschen in Gesprächen und Fragebögen lügen oder Tatsachen verfälschen oder verschweigen würden. Psychologen nennen dieses Verhalten »Dissimulation« (bewusstes Verheimlichen von Krankheiten), wobei sie neuerdings zwei sehr unterschiedliche Arten dieses Phänomens voneinander abgrenzen. Die erste wird Impression Management genannt; dabei geht es darum, sich selbst möglichst positiv darzustellen, unter Umständen gewisse Details unter den Tisch fallen zu lassen und kleine, harmlose »Schwindeleien« über andere zu verbreiten. Die andere ist Selbsttäuschung; dabei handelt es sich, genau genom- men, nicht um Lügen, sondern eher um Wahnvorstellungen. Wenn zum Beispiel ein Mensch behauptet, er habe Humor, alle seine Freunde und Bekannten das jedoch bestreiten, dann täuscht er sich selbst. Oder wenn ein Mensch sich für hässlich oder unattraktiv hält, sein Umfeld jedoch gegenteiliger Meinung ist, unterliegt er einer negativen Selbsttäuschung. In Gesprächen können manche Formen der Selbsttäuschung fast zu Wahnvorstellungen werden, doch sind Wahnvorstellungen schwieriger zu ändern. Sicherlich ist es jedoch bei beständigem Feedback wahrscheinlicher, dass eventuelle Selbsttäuschungstendenzen einer Person »geheilt« oder zumindest reduziert werden. Stichwort 165 Arten des Wahns In der Psychiatrie werden fünf Arten von Wahnvorstellungen unterschieden. Liebeswahn oder Erotomanie – Die betroffene Person glaubt, ein anderer Mensch würde sie leidenschaftlich lieben – und zwar eher auf eine romantische, aus Hollywoodfilmen bekannte oder gar spirituelle Art als im sexuellen Sinne. Häufig ist der andere Mensch eine Berühmtheit (etwa ein Filmstar oder bekannter Sportler) oder auch ein wichtiger Vorgesetzter am Arbeitsplatz. Oftmals wird ein solcher Liebeswahn geheim gehalten, doch in anderen Fällen wenden die Betroffenen viel Energie auf, um mit dem wahnhaft geliebten Menschen durch E-Mails, Besuche oder gar Stalking in Kontakt zu treten. Die meisten Betroffenen sind Frauen, doch Männer im Liebeswahn neigen dazu, energischer zu handeln und mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, besonders wenn sie glauben, die »Geliebte« sei in Schwierigkeiten oder unmittelbarer Gefahr. Größenwahn – Diese Wahnvorstellungen manifestieren sich, wenn ein Mensch – ohne reale Gründe – glaubt, er sei etwas Besonderes, habe erstaunliche Fähigkeiten, überragenden Scharfsinn oder eine weltbewegende Entdeckung gemacht. Häufig sind solche Wahnvorstellungen religiöser Art, und die Betroffenen glauben, sie hätten eine einzigartige und privilegierte Beziehung zu »dem Allmächtigen«. In anderen Fällen meinen sie, prominent zu sein und besondere Beziehungen zu anderen Prominenten zu haben. 166 Die Welt im Kopf Eifersuchtswahn – Dieser Wahn manifestiert sich in dem starken, aber unbegründeten Glauben, der Partner sei nicht treu und würde fremdgehen. Es werden skurrile »Beweise« für solche Behauptungen erbracht, ein Privatdetektiv engagiert oder versucht, den Partner einzusperren oder ihn verbal und körperlich zu attackieren. Verfolgungswahn – Hierbei handelt es sich um den Glauben, eine Person oder Gruppe würde sich gegen den betroffenen Menschen verschwören. Er glaubt, er werde betrogen, ausspioniert, belästigt, verleumdet, vergiftet oder unter Drogen gesetzt. Häufig ist er zornig und überempfindlich und fühlt sich zutiefst ungerecht behandelt. In vielen Fällen versucht er, die Verfolgung durch juristische Mittel oder mithilfe staatlicher Autoritäten zu unterbinden. Verfolgungswahn ist die häufigste aller wahnhaften Störungen. Manche Betroffene werden sogar aggressiv und gewalttätig gegen ihre vermeintlichen Verfolger. Hypochondrischer oder somatischer Wahn – Die Wahnvorstellung, der eigene Körper sei irgendwie fremd oder würde nicht richtig funktionieren. Das kann zum Beispiel der Glaube sein, man würde seltsam riechen oder bestimmte Körperteile (Nase, Brüste, Füße) seien besonders merkwürdig, missgestaltet oder hässlich. Häufig glauben Menschen mit solchen Wahnvorstellungen, in ihrem Körper existiere ein Insekt oder Parasit, und dieses Wesen würde versuchen, einen bestimmten Körperteil zu zerstören. Die Psychiatrie und wahnhafte Störungen Unter bestimmten Umständen kann ein Psychiater bei einem Patienten eine wahnhafte Störung diagnostizieren. Erstens müssen sich bei der betroffenen Person im Laufe eines Monats oder länger eine oder mehrere nicht bizarre Wahnvorstellungen manifestieren. Zweitens treffen für die Person keine anderen Verhaltenskriterien zu, die auf Schizophrenie hindeuten würden. Drittens sind akustische und visuelle Halluzinationen nicht ausgeprägt, während erhebliche taktile und olfaktorische Halluzinationen durchaus auftreten können. Viertens ist das psychosoziale Funktionieren der Person trotz ihrer Wahnvorstellungen oder dem damit einhergehenden Verhalten nicht gravierend eingeschränkt, sie wird also nicht für besonders seltsam oder exzentrisch gehalten. Wenn fünftens die spezifischen Wahnvorstellungen Auswirkungen auf die Stimmung der Person haben, halten diese Stimmungsschwankungen nicht sehr lange an. Sechstens ist die Störung nicht die Folge physiologischer oder medizinischer Ursachen (etwa der Medikamente, die eine Person einnimmt). Mitunter sagen Psychiater, eine wahnhafte Störung sei schwierig zu unterscheiden von anderen Störungen wie zum Beispiel Hypochondrie oder Krankheitswahn (zumal bei Patienten mit mangelnder Selbsterkenntnis), Körperbildstörung (oder körperdysmorphe Störung, zwanghafte Beschäftigung mit eingebildeten körperlichen Defekten), Zwangsstörungen oder einer paranoiden Persönlichkeitsstörung. Die Wahnvorstellungen schizophrener Menschen sind oft ausgesprochen bizarr. So könnte ein Betroffener zum Beispiel glauben, sein Gehirn sei durch dasjenige eines anderen Menschen ersetzt worden oder er sei auf einen Meter Körpergröße geschrumpft. Andererseits können auch nicht bizarre Wahnvorstellungen auftreten; so kann zum Beispiel der Patient davon überzeugt sein, dass er verfolgt, fotografiert oder gefilmt wird, von jemandem allmählich vergiftet wird, sein Partner ständig fremdgeht oder seine Chefin oder eine Nachbarin in ihn verliebt sei. Ursachen Im Wesentlichen sind die Ursachen von Wahnvorstellungen nicht bekannt. Das heutige Interesse an Neuropsychologie hat zu Spekulationen geführt, es gebe biologische Funktionen, die im Falle einer Störung das Problem verursachen oder verschlimmern können. Manche Wissenschaftler haben Gehirnstrukturen im Verdacht, etwa die Basalganglien, andere das limbische System und wieder andere den Neokortex. Bisweilen werden auch genetische Faktoren für die beste Erklärung gehalten, da viele Patienten mit wahnhaften Störungen Verwandte ersten Grades haben, die ebenfalls unter solchen oder vergleichbaren Störungen leiden. Stichwort 167 Andere Forscher verweisen darauf, dass viele Menschen mit Wahnvorstellungen eine »schwierige«, von Instabilität und Turbulenzen, Desinteresse und Gefühlskälte geprägte Kindheit hatten. So sehen manche psychoanalytisch disponierte Psychologen Wahnvorstellungen als eine Beeinträchtigung der Ich-Abwehr, die dazu dient, das Selbst zu schützen und zu stärken. Demnach wird Verfolgungswahn als der Versuch angesehen, das auf andere zu projizieren, was der Betroffene sich selbst nicht eingestehen will. Die Behandlung besteht in Beratung und Psychotherapie, aber auch der Verschreibung von Neuroleptika. Ohnmächtig im Strudel negativer Gedanken Keine psychische Erkrankung ist so häufig wie die Depression. Innere Leere, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen: Wer Anzeichen früh erkennt, kann das Leiden beherrschen Adrian Furnham »Inzwischen gehe ich so offen mit meiner Depression um, dass ich darüber reden kann«, sagt Louisa Kaiser*. »Meine Umwelt aber verkraftet es häufig nicht, dass ich psychisch krank bin. ›Aber du bist doch total normal?‹, heißt es dann. Sie schauen mich mit großen Augen an, wenn ich von meiner Krankheit erzähle.« Louisa Kaiser ist 27 Jahre alt, die Depression zieht sich seit mehr als zehn Jahren durch ihr Leben. Viele psychische Krankheiten sind stetige Begleiter. »Irgendwann ist es schwer, sich an den Alltag davor zu erinnern«, sagt Kaiser. Aber mithilfe von Psychotherapie oder Medikamenten ist es möglich, die Erkrankung schließlich als solche anzuerkennen und nicht sein gesamtes Leben durch sie bestimmen zu lassen. »Heute kann ich auch wieder lachen, ohne affektiert zu wirken. Die Depression ist ein Teil von mir, den ich akzeptieren muss.« Depressionen können jeden treffen, sie zählen zu den häufigsten psychischen Krankheiten in Deutschland. Eine von acht Frauen leidet im Lauf ihres Lebens daran, aber nur etwa einer unter 20 Männern. Typisch ist das episodenhafte Auftreten der Symptome – sie können für Wochen und Monate verschwinden und dann plötzlich wieder in voller Intensität da sein. Die Ursache dafür ist vermutlich ein Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn: Ein Mangel an Noradrenalin und Serotonin wird für die Symptome der Erkrankung verantwortlich gemacht. Zudem treten Depressionen oft in Verbindung mit anderen Krankheiten auf. Ist ein Mensch auffallend oft traurig und unzufrieden, kaum zu motivieren und desinteressiert, können das erste Anzeichen sein. In diesen Phasen lassen sich Betroffene kaum aufmuntern, die negative Grundstimmung hält, unabhängig von äußeren Ereignissen, an. Depressive Menschen sind wie gelähmt. Sie fühlen sich innerlich leer, verbunden mit einer tiefen Hoffnungslosigkeit. Die schlechte Stimmung schlägt auch auf den Körper: Betroffene schlafen oft schlecht und haben kaum Appetit. Häufige Erkältung, Magenprobleme und Kopfschmerzen sind körperliche Leiden, die oft mit einer Depression einhergehen – sind dann also psychosomatisch bedingt. *Name von der Redaktion geändert 168 Die Welt im Kopf Das erkrankte Gehirn 169 Manche greifen auch zu mehr Alkohol oder zu Medikamenten. Dies ist Teil der als ausweglos empfundenen Situation. »Ein Schub kündigt sich meist dadurch an, dass ich mich zurückziehe, mich immer öfter dabei ertappe, die Wand anzustarren, ja geradezu selbst zu erstarren«, sagt Louisa Kaiser über ihre eigenen Gefühle. Ständig niedergeschlagen, selbst ohne erkennbaren Grund Bei ihr begann es mit 16 Jahren. Auslöser waren Probleme in der Familie oder durch die Pubertät, dachte sie zuerst. Vermutlich hatte beides Anteil, sagt sie heute. Bis dahin war sie eine Musterschülerin, brachte nur gute Noten nach Hause, sei »ehrgeizig, aber normal« gewesen. Sie war nie eine Außenseiterin, hatte Freunde, war Teil der Klassengemeinschaft. Aber als sie dann doch aus der Reihe fiel, bröckelte diese Gemeinschaft. Von den Lehrern kam auch keine Hilfe. »Sie ignorierten mein Weinen, machten mich sogar noch weiter fertig«, erzählt Kaiser. Der Vertrauenslehrer habe sich über ihren Plan, die Schule zu wechseln, nur lustig gemacht: »Wir haben schon Wetten abgeschlossen, wann du wieder zurückkommst.« Wenn sich die Stimmung immer weiter verschlechtert und die Gedanken immer wieder um dieselben Dinge kreisen, droht in schweren Phasen der Selbstmord. Jeder zweite Depressive hat irgendwann Suizidgedanken. 15 von 100 Personen mit einer schweren Depression versuchen dann tatsächlich, sich umzubringen. Kaiser würde diesen Schritt nicht wagen, »dafür ist mein Verantwortungsgefühl gegenüber Familie und Freunden zu groß«, sagt sie. Aber theoretisch durchgespielt hat sie diesen Gedanken schon: »Natürlich habe ich mir überlegt: ›Wie würde ich es machen?‹ Foren im Internet bringen die Betroffenen auch immer wieder auf solche Ideen. Deswegen halte ich mich bewusst davon fern. Natürlich wäre es einfacher, wenn ich nicht mehr da wäre, diese Krankheit nicht ertragen müsste.« Dennoch ist Kaiser froh, dass sie durchgehalten hat, auch dann, als ihr Leben aus den Fugen geriet. »Und jedes Mal aufs Neue muss ich lernen, den nächsten Schub zu akzeptieren, mich für das Leben motivieren, mir erklären, dass ich kein Freak bin, dass es einen Sinn hat, auf dieser Welt zu sein, einfach krank zu sein«, sagt sie. »Alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, auch nicht mit Ehrgeiz. Die Depression ist zu stark, sie hält einen gefangen.« Der Schritt, sich Hilfe zu suchen, fällt schwer. »Es dauert lange, bis man endlich so weit ist, den eigenen Stolz und die Lähmung durch die Depression zu überwinden.« Doch dann kommt die nächste Hürde, mit der man in diesem Moment nicht rechnet: Vier Monate Wartezeit bei den meisten Therapeuten – das kostet Energie, oft die letzten Reserven. Ein Teufelskreis. Trotzdem nicht aufzugeben kann schwerfallen. »Ich habe mir oft Hilfe gewünscht in der Zeit zwischen dem Hilferuf und dem Beginn der Therapie«, sagt 170 Die Welt im Kopf Louisa Kaiser. Unterstützen können dabei vor allem Angehörige und Freunde, psychologische Notfallambulanzen oder auch der Hausarzt. Vielen können auch Medikamente helfen, das Chaos der Botenstoffe im Gehirn wieder zu ordnen. Bei der Wahl des richtigen Psychotherapeuten ist die Beziehung zueinander sehr wichtig. »Besonders schwer fällt es, offen gegenüber dem fremden Menschen zu sein, der da vor einem sitzt und nun der Ratgeber fürs eigene Leben sein soll«, sagt Kaiser. »Am Anfang war ich nicht zu hundert Prozent ehrlich, so etwas baut sich erst mit der Zeit auf.« Deshalb sollte man versuchen, bei einem Therapeuten zu bleiben. Wenn es zwischenmenschlich nicht passt, kann aber auch ein Wechsel sinnvoll sein. Louisa Kaiser hatte Glück mit ihrer ersten Psychotherapeutin. Die unterstützte ihren Ehrgeiz, trotz der schlechten Noten und der Konzentrationsprobleme das Abi zu schaffen. Es folgten ein Schulwechsel und ein Intelligenztest mit dem Ergebnis »Hochbegabung«. »Sie gab meiner ›Störung‹ auch einen Namen. Irgendwann habe ich mal im Bericht das Wort Depression gelesen. Von da an wusste ich, dass ich etwas habe, das andere auch haben. Das war eine Erleichterung, kein Schock.« Seitdem hat sie die Depression akzeptiert. Mittlerweile hat sie mit Erfolg ihr Masterstudium abgeschlossen – auch wenn sie sich immer wieder Auszeiten für die Krankheit nehmen musste. »Ich habe eingesehen: Es ist erlaubt, krank zu sein! Außerdem ist es mir wichtig, dass ich vor meinen Freunden so sein darf, wie ich will, und mich nicht zusammenreißen muss«, sagt Kaiser. »Dieses Verständnis hilft, die eigene Krankheit als Teil des Selbst anzunehmen. Kommt dann wieder eine Episode, sieht zwar alles schrecklich aus, aber irgendwo weiß ich doch, dass ich wieder ›gesund‹ werde – zumindest so weit das möglich ist.« von Julia Völker, ZEIT Online, 22. August 2013 Das erkrankte Gehirn 171 Mitten ins Leben Psychisch kranke Menschen haben es schwer, Arbeit zu finden. Dabei wäre das oft die beste Therapie Seit ihrem 20. Lebensjahr arbeitet Anna Vogel*. Als Erzieherin, als Tischlerin, dann wieder als Erzieherin. Seit ihrem 20. Lebensjahr kämpft Anna Vogel auch immer wieder mit den Stimmen. Sie geben ihr zu verstehen, dass sie auf dieser Welt nichts zu suchen hat. Vogel ist an einer schizophrenen Psychose erkrankt. Sie hat mehrmals versucht, sich umzubringen. Aber Anna Vogel ist noch da. Heute ist sie 56 Jahre alt. »Zu arbeiten und damit Sinn über mich selbst hinaus zu stiften, das war meine Rettung«, sagt sie. »Es ist unstrittig, dass Arbeit günstige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit schwer psychisch Erkrankter hat.« So steht es in der neuen Leitlinie für psychosoziale Therapien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Ein Prozent der Menschen in Deutschland ist wie Anna Vogel an einer Psychose erkrankt, fast drei Prozent leiden an einer chronischen Depression und fünf Prozent an einer schweren Angststörung – das sind insgesamt fast 6,5 Millionen Menschen. Viele der Betroffenen wollen arbeiten. Doch nur knapp sechs Prozent der Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben eine Vollzeitstelle. Dabei ist die Inklusion, die Integration Behinderter im Alltag wie im Arbeitsleben, von den Vereinten Nationen zum Menschenrecht erklärt worden: Für Rollstuhlfahrer werden Rampen und Fahrstühle gebaut, Schulen müssen bald behinderten Kindern genauso offenstehen wie nicht behinderten. Das Recht auf Inklusion gilt auch für psychisch Kranke. Aber mit der Umsetzung hapert es. Zwar wurde die Psychiatrie Anfang der achtziger Jahre geöffnet, die Patienten sollten in Tageskliniken und Wohngruppen behandelt und in das Alltagsleben integriert werden. Der erste Schritt gelang – der zweite nicht. Es entstanden Arbeitseinrichtungen für psychisch Kranke, Wohneinrichtungen für psychisch Kranke, Freizeiteinrichtungen für psychisch Kranke. »Aus der Gemeindepsychiatrie ist eine Psychiatriegemeinde geworden«, sagt der Medi­zin­ sozio­lo­ge Dirk Richter. Das allgemeine Misstrauen gegenüber psychisch kranken Menschen ist der Grund dafür, dass diese Parallelwelt sich so hartnäckig hält. Hinter dem Misstrauen verbirgt sich eine ganz grundsätzliche Frage: Was ist normal, was verrückt? Innerhalb *Name von der Redaktion geändert 172 Die Welt im Kopf der Psychiatrie wird das gerade heftig diskutiert, Anlass ist die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM-V. Darin versuchen amerikanische Psychotherapeuten, die Grenze zwischen normalem menschlichem Verhalten und behandlungsbedürftiger Krankheit zu definieren. Doch viele Psychologen und Psychiater gewinnen mehr und mehr die Einsicht, dass es keine klare Grenze gibt – sondern ein breites Spektrum zwischen krank und gesund, verrückt und normal. Im Alltag kommt diese Erkenntnis jedoch nur langsam an. Wie also könnte eine Rampe für psychisch Kranke aussehen, wie ein Lift für Menschen mit Psychosen, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen? Die Krankheit Als Anna Vogel zum ersten Mal in die Psychiatrie kam, war sie 13 Jahre alt. Sie hatte mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Die Psychiater diagnostizierten eine Psychose, gaben ihr starke Medikamente und sagten, sie werde ihr Leben lang krank bleiben. »Da ist in mir das Gefühl entstanden, ich würde nie dazugehören.« Eine schizophrene Psychose ist eine der gravierendsten psychischen Krankheiten; sie macht es den Betroffenen besonders schwer, am Leben teilzuhaben. Doch Psychosen sind vielgestaltig – wie die meisten psychischen Erkrankungen. Manche Erkrankte sind zwischen den Schüben nahezu beschwerdefrei, und viele haben Techniken entwickelt, um mit ihrer Krankheit zu leben. Die amerikanische Juristin und Psychologin Elyn Saks hat untersucht, warum es einige Menschen mit Psychosen schaffen, selbstbestimmt zu leben. Dazu hat sie Betroffene befragt: Studenten, Manager, Techniker, Ärzte, Rechtsanwälte, Psychologen. Einige hinterfragen ihre Wahnvorstellungen systematisch, viele kontrollieren die Sinneseindrücke, die auf sie einstürzen (etwa durch den Blick auf kahle Wände oder das Hören leiser Musik), die meisten haben herausgefunden, was ihre Symptome hervorruft, und versuchen, diese Auslöser zu vermeiden, zum Beispiel Stress durch Reisen. »Aber die Technik, die die allermeisten nannten, war Arbeit«, sagt Saks. Sie lenke von den Symptomen ab und gebe Selbstbewusstsein. Die Professorin kann das gut beurteilen: Sie leidet selbst an einer Psychose, seit mehr als 30 Jahren. »Meine wissenschaftliche Arbeit hat mich gerettet«, sagt sie. »Sie hält das verrückte Zeug an der Peripherie.« Der Mangel an Zutrauen Hätte Elyn Saks vor 30 Jahren auf den Rat ihrer Ärzte gehört, säße sie heute an einer Kasse im Supermarkt. Stattdessen sitzt sie auf einem Lehrstuhl an der Gould School of Law der University of Southern California. Sie war die Beste ihres Jahrgangs in Oxford und Yale. Und sie hat ein eigenes Institut gegründet, das Saks Institute for Mental Health Law, Policy, and Ethics. »Die Ärzte sagten mir damals, ich solle meine Erwartungen herunterschrauben. Das war ein schlechter Rat. Große Ziele zu haben, das hat mir geholfen.« Das erkrankte Gehirn 173 Immer noch trauen Ärzte, Arbeitgeber, auch Angehörige psychisch Kranken wenig zu. »Menschen mit Psychosen sind wesentlich rehabilitationsfähiger, als wir lange gedacht haben«, sagt Peter Falkai, Direktor der Uni-Klinik für Psychiatrie und Psychologie in München. Mehr Zutrauen, auch von Arbeitgebern, könnte den Betroffenen nicht nur zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen, sondern auch Selbstvertrauen geben. »Viele glauben nicht mehr daran, dass sie es schaffen können«, sagt Falkai. »Das ist wie bei einem Arbeiterkind, das immer nur hört, es sei höchstens für eine Bäckerlehre geeignet.« Anna Vogel hat früh erkannt, dass Arbeit hilft. »Verantwortung zu übernehmen und ein Teil der Gesellschaft zu sein hat mein Selbstbewusstsein gestärkt«, sagt sie. »Auch in meinen kritischsten Phasen habe ich so lange wie möglich gearbeitet.« Sie hatte Glück: Gerade in einer besonders schwierigen Zeit fand sie Therapeuten, die sie unterstützten. Vier Jahre lang war sie am Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in ambulanter Behandlung. »Die Psychologen dort haben mich sehr gut beraten, ob ich in meinem jeweiligen Zustand noch arbeiten kann«, erzählt Vogel. »Das war für mich eine ganz wichtige Kontrolle. Ich wollte ja die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, nicht in Gefahr bringen.« Das Stigma Wenn Anna Vogel von ihren Jahrzehnten mit der Psychose erzählt, wirkt sie klar in der Beurteilung ihrer selbst und nachsichtig mit anderen, immer um Ausgewogenheit bemüht. Dann wird sie plötzlich laut: »Man kann nicht sagen, dass man eine Psychose hat, nicht im Beruf. Über eine Depression kann man sprechen, über eine Psychose nicht.« Das ist auch das Ergebnis der Forschung von Georg Schomerus von der Uni-Klinik Greifswald. Zwei Dinge schrecken viele Menschen: dass psychisch Kranke gefährlich sein könnten und dass sie unberechenbar oder schlicht anders seien. Die erste Sorge kann Schomerus entkräften: »Studien zeigen, dass die tatsächliche Gefährdung viel geringer ist, als die Bevölkerung annimmt. Im Einzelfall besteht die größte Gefahr für die Betroffenen selbst und für ihr unmittelbares Umfeld, von einer allgemeinen Gefahr kann aber wirklich keine Rede sein.« Das Unbehagen gegenüber dem Andersartigen ist dagegen viel schwieriger zu vertreiben. Aufklärung hilft nicht immer: Seit psychische Krankheiten vermehrt biologisch erklärt werden können, hat sich die Stigmatisierung von Menschen mit Psychosen sogar verschlimmert, hat Schomerus herausgefunden. Offenbar verstärke sich der Eindruck, dass es unabänderliche Unterschiede zwischen »Verrückten« und »Normalen« gebe. »Stigma ist keine Kopfsache; was hilft, ist nicht Wissen, sondern sind Erfahrung und Begegnung.« Das zeigt auch eine Befragung der Psychologin Sofie Stadler: Menschen, die alltägliche Kontakte zu psychisch Kranken hatten, waren ihnen gegenüber deutlich positiver eingestellt. Doch solche Kontakte sind selten, wenn die Betroffenen 174 Die Welt im Kopf entweder in der Parallelwelt der Psychiatriegemeinde verschwinden oder sich aus Angst vor Stigmatisierung zurückziehen. Die Macht des Stigmas ist auch davon abhängig, was wir für gesund halten und was für krank – und wie wichtig wir diese Unterscheidung finden. »Früher habe ich gedacht, man ist gesund, wenn man so ist wie die anderen«, sagt Anna Vogel. »Inzwischen bin ich sehr einverstanden mit meinem Leben, es ist meine Antwort auf meine Möglichkeiten.« Sie benutze die Begriffe »gesund« und »krank« nicht mehr. Niemand sei »nur gesund oder nur krank«. Die Psychiaterin Sandra Dehning, die an der Münchner Uni-Klinik eine Tagesklinik leitet, sieht das ähnlich: »Wenn sich mehr Menschen klarmachen würden, dass es keine deutliche Trennung zwischen gesund und krank gibt, sondern ein ganzes Spektrum, dann würden psychisch Kranke vielleicht weniger stigmatisiert«, sagt sie. »Tatsächlich kennt jeder das eine oder andere Symptom einer Psychose.« Dass viele Menschen in Denkfallen tappen, aus denen im Extremfall psychotische Symptome, zum Beispiel Wahnideen, entstehen können, nutzt Steffen Moritz vom UKE für die Therapie. Im sogenannten metakognitiven Training, das er für Psychosepatienten entwickelt hat, erklärt der Psychologe zunächst, wie Denkverzerrungen funktionieren. Zum Beispiel an verbreiteten »Mini-Wahnideen«: Die Mondlandung sei bloß vorgetäuscht gewesen, Paul McCartney sei nach einem Unfall durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Erst dann geht Moritz die krankhaften Ausprägungen an. »Diese Normalisierung entspannt die Kranken.« Womöglich funktioniert das auch andersherum: Die Hinweise auf die Normalität des Wahns könnten auch die Gesunden entspannen. Das könnte dann der Anfang für ein verständnisvolleres Miteinander sein: Toleranz. Das Reha-System Sie habe großes Glück gehabt, sagt Anna Vogel. Vor allem hatte sie oft ein gutes Gespür dafür, welche Beschäftigung ihr guttun würde. Als ihr die Arbeit mit Jugendlichen zu viel wurde, entdeckte sie das Handwerken mit Holz. Da konnte sie anpacken, das gab Halt. Nach ein paar Jahren wurde klar, dass es in der Werkstatt für sie nicht weitergehen würde: Sie besaß weder viel Sinn für Design noch ausgeprägte Körperkräfte. Sie bewarb sich wieder als Erzieherin. Ausgerechnet eine gemeinnützige Stiftung für Menschen mit Behinderung traute ihr diesen Job zunächst nicht zu. »Das war relativ irre, eigentlich total verrückt«, sagt Vogel. Schließlich sprach sich eine Bereichsleiterin für sie aus – weil sie sich an die Tischlerin Anna Vogel erinnerte: Die hatte ihr einmal ein Regal gebaut, pünktlich und passend. Viel zu oft hängt es von glücklichen Fügungen ab, ob ein Mensch mit einer psychischen Krankheit eine erfüllende Tätigkeit findet. Die allermeisten Programme funktionieren nach dem Prinzip first train then place: erst in einer geschützten Einrichtung ausbilden, dann auf dem regulären Arbeitsmarkt Das erkrankte Gehirn 175 unterbringen. »Es bringt wenig, jemanden in ein Reha-Zentrum auf der grünen Wiese zu schicken und zu hoffen, dass der schon irgendwas lernt«, sagt Psychiater Falkai. »Da wird einer in die Holzverarbeitung gesteckt, und hinterher sagt er: ›Ich hatte eigentlich noch nie Bock auf Holz.‹ Wir sollten die Betroffenen öfter fragen, was sie selbst eigentlich wollen.« In den USA versucht man es schon seit den achtziger Jahren genau andersherum: Die Patienten bekommen früh einen Platz auf dem freien Arbeitsmarkt und werden dort von Job-Coaches unterstützt. Ein mindestens doppelt so hoher Anteil der Teilnehmer solcher Supported-Employment-Programme hat später einen regulären Arbeitsplatz, verglichen mit Patienten, die ein berufsvorbereitendes Training erhalten hatten. So also könnte die Rampe aussehen, die psychisch Kranken den Weg in den Alltag ebnet. Beschrieben wird sie auch in der neuen Leitlinie für psychosoziale Therapien: »Programme mit einer raschen Platzierung direkt auf einen Arbeitsplatz des ersten Arbeitsmarktes und unterstützendem Training (sollten) ausgebaut werden.« Doch bisher gibt es nur Modellprojekte. Und das werde sich so schnell nicht ändern, sagt der Medizinsoziologe Dirk Richter von der Fachhochschule Bern: »Das deutsche Sozialrecht ist darauf nicht ausgerichtet. Es gibt zwar solche Möglichkeiten, aber bisher nur für geistig Behinderte, nicht für psychisch Kranke.« Statt Arbeit gibt es für die Betroffenen meist eine Rente. »Das ist der beste Weg, jemanden nicht zu rehabilitieren«, sagt Peter Falkai. Anna Vogel hilft inzwischen anderen Menschen, die mit einer Psychose kämpfen. Sie arbeitet als Peer-Beraterin in einer Hamburger Klinik. »Ich wollte mich selbst rehabilitieren, meine Verstörung anders verstehen, nicht mehr als Minderwertigkeit.« Deshalb fing sie mit 52 Jahren noch einmal etwas ganz Neues an und machte die EX-IN-Ausbildung. EX IN ist ein Projekt für Menschen, die mit ihrer Erfahrung aus psychischen Krisen andere unterstützen wollen. »Ich muss mich nicht mehr verstecken, und ich kann in ganz existenziellen Fragen hilfreich sein«, sagt Anna Vogel. Die Stelle in der Peer-Beratung hat sie wegen, nicht trotz ihrer Psychose bekommen. von Stefanie Schramm aus der ZEIT Nr. 46/2013 176 Die Welt im Kopf Stichwort Nicht neurotisch, nur anders Seit Langem sind Macht, Praxis und Anmaßung von Psychiatern infrage gestellt w ­ orden. Kritiker, Dissidenten und Reformer haben zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern die konventionelle akademische und biologische Psychiatrie scharf angegriffen. Politik und Psychiatrie Indem die Psychiatrie sich immer mehr etablierte und institutionalisiert wurde, war es unvermeidlich, dass sich Kritiker zu Wort meldeten, denen weder die Macht der Psychiater noch deren Kategorien behagten. Es existieren vielfältige Berichte von Künstlern und Schriftstellern sowie von Patientenorganisationen, die sich vehement gegen bestimmte Formen der Behandlung (Medikamente, Elektroschocks, Operationen) von »Geisteskrankheiten« einsetzen. Es gab aufsehenerregende Fälle im »Dritten Reich« und in der Sowjetunion, die zeigten, wie die Psychiatrie als politisches Unterdrückungsinstrument eingesetzt wurde. In gewissen Situationen scheint die Zunft der Psychiater als ausführendes Organ staatlicher Unter­drückung zu fungieren. Die antipsychiatrischen Kritiker stellten drei Dinge infrage: die Vereinnahmung von Verrücktheit durch die Medizin, die Existenz von Geisteskrankheiten »Unser ganzes Leben ist bestimmt von der Sorge um Sicherheit und unser Auskommen, sodass wir eigentlich gar nicht wirklich leben.« Leo Tolstoi, 1900 Stichwort 177 Die Neurose ist stets ein Ersatz für legitime Leiden. sowie die Macht der Psychiater, bestimmte Individuen zwangsweise zu diagnostizieren und zu therapieren. Die Antipsychiatrie-Bewegung richtete sich gegen mehr als nur Zwangseinweisungen: Sie drückte C. G. Jung, 1951 häufig eine Antiregierungshaltung, eine fast anarchische Haltung aus. Sie betrachtete viele staatliche Institutionen, zumal psychiatrische Anstalten, als Instrumente, die der Verfälschung und Unterdrückung humanistischer Ideale und menschlichen Potenzials in verschiedenen Bevölkerungsschichten dienten. Erst in den 1960er-Jahren wurde der Begriff »Antipsychiatrie« geprägt. Es gab eine Reihe verschiedener Strömungen in den diversen Organisationen, die sich unter diesem Dachbegriff formierten. Und man mag es für paradox halten, dass die schärfsten Kritiker aus den Reihen der Psychiater selbst stammten. Geschichte der Bewegung Die Bewegung hatte drei Ausgangspunkte. Der erste nahm in den frühen 1950er Jahren Form an und war das Ergebnis einer erbitterten Fehde zwischen der Freudschen Schule psychoanalytischer Psychiater und den Anhängern der neu aufkommenden biologisch-physischen Psychiatrie. Die Ersteren, die zunehmend an Einfluss verloren und ausgedehnte, dynamische Gesprächstherapien bevorzugten, wurden von den Letzteren herausgefordert, die diesen Ansatz nicht nur für kostspielig und ineffektiv, sondern auch für zutiefst unwissenschaftlich hielten. Die neuen, biologisch fundierten psychologischen Behandlungsmethoden waren operativ und pharmazeutisch und konnten einige wichtige frühe Erfolge verzeichnen. Die neue Schule forderte die alte heraus. Die zweite Attacke begann in der 1960er Jahren mit Persönlichkeiten wie David Cooper, R. D. Laing und Thomas Szasz, die in verschiedenen Ländern lautstark Kritik übten an der Instrumentalisierung der Psychiatrie mit dem Ziel, von gesellschaftlichen Normen abweichende Menschen zu beherrschen. Demnach wurden Menschen, die man für sexuell, politisch oder moralisch abweichend oder anders hielt, psychiatrischer Behandlung und Kontrolle zugeführt. Szasz’ bekanntes Buch The Myth of Mental Illness (Geisteskrankheit – ein moderner Mythos?) erläutert diese Position sehr gut. Die dritte Gruppierung waren US-amerikanische und europäische Soziologen, insbesondere Erving Goffman und Michel Foucault, die die 178 Die Welt im Kopf hinterhältige Macht der Psychiatrie und deren Auswirkungen, nämlich die Etikettierung, Stigmatisierung und Einweisung von Menschen, kritisierten. Ihren Höhepunkt erreichte diese Bewegung in den 1960er Jahren im Rahmen der antiautoritären Gegenkultur dieser Zeit. Populäre Kinofilme (wie etwa Einer flog über das Kuckucksnest) und radikale Zeitschriften erschienen, die die biologische Psychiatrie sowie staatliche Anstalten und Praktiken infrage stellten. Die Antipsychiatrie-Bewegung war stets eine lose Koalition verschiedener Gruppierungen von Sozialaktivisten und tendierte dazu, sich auf sehr spezifische Probleme wie Schizophrenie oder die Sexualstörungen zu konzentrieren. Sie setzten sich für Authentizität und Befreiung, für Emanzipation und Selbstbestimmung anstelle pharmazeutischer Intervention ein. Viele Gruppen begannen, die Pharmaindustrie und etablierte Instituti­onen wie etwa die viktorianisch geprägten psychiatrischen Anstalten zu attackieren. Fundamentale Überzeugungen Die Bewegung hatte bestimmte fundamentale Überzeugungen und Anliegen gemein. Die erste davon lautete, dass Familien, Institutionen und der Staat ebenso sehr Ursache von Krankheiten waren wie organische Beeinträchtigungen oder genetische Ausstattung eines Individuums. Zweitens opponierten ihre Anhänger gegen das medizinische Krankheits- und Therapiemodell. Sie glaubten, Die neue Psychiatrie Viele Psychiater sind bemüht, der antipsychiatrischen Kritik durch Einführung bestimmter Prinzipien oder Richtlinien Rechnung zu tragen. Daher ist zunehmend Folgendes zu beobachten: Erstens wird zugestanden, dass das Ziel einer Therapie eine Besserung ist, anstatt lediglich Einsichten oder Selbsterkenntnis fördern zu wollen. Zweitens sollte die Therapie auf Tatsachen beruhen und nur bewährte Behandlungsverfahren einsetzen. Drittens muss anerkannt werden, dass Patienten das Recht haben, die sie betreffenden Unterlagen einzusehen, die gestellte Diagnose zu kennen und über die verfügbaren Behandlungsalternativen sowie die damit jeweils verbundenen Risiken informiert zu werden. Patienten und Psychiater sollten realistische Vorstellungen über die Möglichkeiten und Grenzen einer Therapie haben. Alle psychisch kranken Patienten verdienen Fürsorge, Mitgefühl und Respekt. Stichwort 179 dass Menschen, die nach einem anderen Verhaltenskodex lebten, in irriger und gefährlicher Weise als wahnhaft abgestempelt wurden. Drittens waren sie davon überzeugt, dass bestimmte religiöse und ethnische Gruppen unterdrückt wurden, weil sie in einem gewissen Sinne abnorm waren. Sie wurden pathologisiert und so zu dem Glauben verleitet, sie müssten therapiert werden. Die Anhänger der Bewegung waren sehr beunruhigt über die Macht diagnostischer Etiketten. Sie meinten, solche Etiketten würden einen falschen Eindruck von Richtigkeit und Unangreifbarkeit erzeugen. Diagnostische Etiketten und Handbücher wurden abgelehnt, da kaum Einigkeit unter den Experten besteht. Normal in einer verrückten Umgebung Eine der bekanntesten Antipsychiatrie-Studien wurde in den frühen 1970er Jahren durchgeführt. Acht »normale«, geistig gesunde Forscher bemühten sich an mehreren psychiatrischen Anstalten in den USA, aufgrund einer entsprechenden Diagnose eingewiesen zu werden. Als einziges Symptom gaben sie an, sie würden Stimmen hören. Sieben von ihnen wurden als schizophren diagnostiziert und eingewiesen. Nach der Aufnahme in die jeweilige Anstalt verhielten sie sich normal und wurden ignoriert, wenn sie höfliche Fragen stellten. Nach Ende der Studie berichteten sie, das diagnostische Etikett »Schizophrenie« habe in der Klinik zu einem niedrigen Status und geringer Glaubwürdigkeit geführt. Dann offenbarten sie sich und beichteten, keine Symptome zu haben und gesund zu sein. Gleichwohl dauerte es fast drei Wochen, bis sie entlassen wurden, häufig mit der Diagnose 180 Die Welt im Kopf »abklingende Schizophrenie«. Also können normale, gesunde Menschen leicht als »abnorm« diagnostiziert werden. Ist jedoch auch das umgekehrte Szenario denkbar? Dieselben Forscher erzählten psychiatrischem Anstaltspersonal, dass mehrere falsche oder Pseudopatienten behaupten könnten, schizophren zu sein, um so in die jeweilige Klinik aufgenommen zu werden. Daraufhin wurden 19 echte Patienten von zwei oder mehr Mitgliedern des Personals, darunter ein Psychiater, als Simulanten verdächtigt. Daraus lässt sich schließen, dass es in psychiatrischen Kliniken nicht möglich ist, die Normalen von den Verrückten zu unterscheiden. Wenngleich diese bekannte Studie aus ethischen und versuchsmethodischen Gründen weithin kritisiert worden ist, verlieh sie der AntipsychiatrieBewegung erhebliche zusätzliche Stoßkraft. Angriffe auf Therapien Außerdem konzentrierte die Bewegung ihre Opposition auf sehr spezifische Therapien, insbesondere Medikamente – zum Beispiel solche, die entwickelt wurden, um hauptsächlich Probleme im Kindesalter (ADHS) und Depressi­onen zu therapieren. Sie griffen solche Therapien wegen ihrer Kosten und Nebenwirkungen an, aber auch, weil den Patienten die Wahrheit über solche Medikamente vorenthalten wurde. Antipsychiatrie-Aktivisten haben zahlreiche Aspekte des Verhaltens von Pharmaherstellern kritisiert und argumentiert, die Industrie würde ihre Daten fälschen und Medikamente zu weit überhöhten Preisen verkaufen, was wiederum dazu geführt hat, dass die Industrie sehr genau überwacht und durch gesetzgeberische Maßnahmen kontrolliert wird. Andere Angriffsziele waren die Elektrokrampftherapie (EKT) sowie sehr spezifische Verfahren wie etwa die Gehirnchirurgie. Ungeachtet gewisser Hinweise auf manche Erfolge solcher Operationen, argumentierten Kritiker, sie würden ahnungslosen Patienten »aufgezwungen« und schwerwiegende, permanente Nebenwirkungen verursachen. Die Macht von Psychiatern, einen Patienten zwangsweise in eine geschlossene Abteilung zu verlegen oder in eine Anstalt einzuweisen, wird ebenfalls von der Bewegung kritisiert. Viele Kritiker halten Psychiater für ausführende Organe des Staates, vergleichbar mit Polizisten, Richtern und Geschworenen. Die Anhänger der Antipsychiatrie-Bewegung setzen sich für eine humanere Psychiatrie ein. Nach wie vor stellen sie den psychiatrischen Jargon und die Illusion einer biomedizinischen, wissenschaftlichen Psychiatrie, die nach biologischen und genetischen Erklärungen sucht, infrage. So halten sie zum Beispiel nicht etwa Neurotransmitter-Fehlfunktionen, sondern Armut für die wichtigste Ursache von Depressionen. Die ursprünglichen Bewegungen bestanden aus ideologischen, hochgradig politisierten Antireduktionisten. Sie versuchten, der Psychiatrie die bösen Geister auszutreiben und sie zu rehabilitieren. Sie opponierten gegen »das System«. In vielerlei Hinsicht hatten sie Erfolg: Viele Behandlungsmethoden sind eingestellt, viele psychiatrische Anstalten geschlossen worden. Psychiatrische Etiketten haben sich verändert und werden heute sehr viel vorsichtiger verwendet. Die Antipsychiatrie-Bewegung hat sich zur patientenbasierten Verbraucherbewegung gewandelt. Ihr Anliegen ist inzwischen weniger die Abschaffung der organisierten Psychiatrie, sondern vielmehr die Durchsetzung von Rechten und Mitbestimmung der Patienten. Adrian Furnham Stichwort 181 Auf der Suche nach der gesunden Mitte Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt: Menschen, die an einer Bipolaren Störung leiden, leben in den Extremen. Oft wird die Krankheit verkannt, das ist lebensbedrohlich Ein Rausch der Gefühle, unglaubliche Energie, die Welt verbessern, jetzt und hier. Und alle sollen helfen. Es ist der Enthusiasmus einer Manie, die eine Seite der Bipolaren Störung. Denn an anderen Tagen sind die vielen Ideen, die sexuelle Energie oder der Kaufrausch plötzlich verflogen. Angst und tiefe Traurigkeit bestimmen das Leben, die Depression übernimmt. Monique Seidel lebt seit mehr als 20 Jahren in diesen Extremen. Sie kennt das Leben im Rausch: »Ich kann dann nicht mehr aufhören, rutsche hinein, kaufe Bücher wie eine Verrückte und schreibe und schreibe, ohne zu schlafen – unglaublich produktiv!« Doch sie weiß auch um die andere Seite, wenn all die Energie von einem Tag auf den anderen einfach weg ist. Dann ist Seidel müde, oft sogar lebensmüde. Ein quälender Stillstand macht sich breit, und die 46-Jährige verfällt in eine Depression. Seidel ist eine Getriebene, stets auf der Suche. Ihr Leben ist geprägt von langen Phasen mit ausufernden Stimmungszuständen. »Das kann reichen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt«, weiß der Berliner Psychiater Thomas Stamm. Dementsprechend groß ist die Herausforderung für Bipolare, zwischen den Welten ihre innere Balance zu finden. Totale Lähmung, nichts geht mehr Die depressiven Episoden sind für Seidel deutlich belastender als der positive Rausch. Die Phasen erstrecken sich über Wochen bis Jahre. Der Körper wird dann zu einer leblosen Hülle, in der sie gefangen ist. »Ich kann nichts mehr, nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, mich zu nichts aufraffen, so als gäbe es mich gar nicht«, sagt die Bipolare. Besonders schlimm ist, dass sie mit ihrem Willen allein nicht weiterkommt: »Ich habe immer gekämpft, aber in der depressiven Phase fühle ich mich ausgeliefert.« Mehr als zwanzig Jahre lang blieb Seidels Krankheit unentdeckt. In der Zeit hat sich die Krankheit tief in ihr Leben gefressen. »Ich hatte immer wieder Suizidgedanken«, sagt sie. »Mein Mann konnte mit den Depressionen nicht 182 Die Welt im Kopf umgehen. Am Ende ist meine Ehe zerbrochen.« Erst vor drei Jahren stellte ein Psychiater die Diagnose – endlich. Etwa ein bis drei Prozent der Deutschen sind bipolar, viele, ohne es zu wissen. »Viele Bipolare werden gar nicht oder als rein Depressive behandelt«, sagt Thomas Stamm, Leiter des Klinischen Bereichs Bipolare Störungen der Charité Berlin. Das liegt zum einen am irreführenden Verhalten der Betroffenen. Bipolare werden oft als anders wahrgenommen, vor allem in manischen Phasen. Aber anders sein heißt nicht unbedingt gleich krank sein. Eine gesteigerte Redebereitschaft, vermindertes Schlafbedürfnis oder vermehrte sexuelle Lust wirken im ersten Moment nicht wie eine Krankheit, sondern sympathisch, formen das Gegenüber zu einem interessanten Menschen. Zum anderen ist es oft auch für Ärzte schwierig, eine Bipolare Störung zu diagnostizieren. Die Betroffenen suchen meist in einer depressiven Phase Hilfe. Die Krankheit wird verkannt, die richtige Behandlung bleibt aus. »Die Gefahr, sozial abzurutschen, oder die eines Suizids ist dann hoch«, sagt Stamm. Der manische Teil der Störung ist nicht zu unterschätzen. Je intensiver und länger die Phase anhält, desto schlimmer wird die darauffolgende depressive Episode – so wie auch bei einem größeren Feuer mehr Asche zurückbleibt. Auch neigen die Betroffenen derweil zur Aggression: Sie stellen plötzlich alles infrage, ihren Arbeitsplatz oder ihre Beziehung. Sie provozieren bewusst, auch im sexuellen Bereich. Im Rausch der Manie überkommt viele Betroffene die Lust und damit ein reger Partnerwechsel. Andere leiden unter psychotischen Gedanken. Sie verlieren den Bezug zur Realität und laufen beispielsweise schreiend durch die Straßen, um die Menschheit vor vermeintlich großem Unheil zu bewahren. Monique Seidel durchlebte solch einen Schrecken nur einmal – doch es war die schlimmste Phase ihres Lebens. Sie hatte An manchen Tagen sich in einer eigenen, psychotischen Geverläuft das Leben wie im dankenwelt verloren. Nach einer maniRausch. Doch plötzlich schen Schreibattacke konnte sie plötzlich ist die Energie weg. Dann nicht mehr zurück. Es war, als würde sich in ihrem Gehirn eine Barriere auflösen, macht sich ein quälender die bis dahin Gedanken und Realität vonStillstand breit. einander getrennt hatte. Die Energie ihrer Manie katapultierte sie direkt in eine andere Welt, in der Wahngedanken und Realität ineinander verschwammen. »Es war wie im Film, ich dachte, alles um mich herum würde gleich in die Luft fliegen und ich wäre die Einzige, die es verhindern könnte. Das war wahnsinnig anstrengend, ein Gedanke verdrängte den nächsten, immer nur denken. Schlafen war gar nicht Das erkrankte Gehirn 183 mehr möglich«, beschreibt sie die Situation. Sie war kurz davor durchzudrehen, wollte alle retten und schrie wild um sich. Die Menschen um sie herum wandten sich ab. »Das versteht ja auch keiner, was da dann abläuft.« Trotz all des Schreckens: Seidels Psychose ist glimpflich ausgegangen. Auch war sie ausschlaggebend dafür, dass der Psychiater die Bipolare Störung überhaupt dia­ gnos­ ti­ zie­ ren konnte. Dank Medikamenten hat Seidel nach wenigen Tagen wieder zurück in den Alltag gefunden. Ein Glücksfall. Denn Einsicht in das eigene Verhalten haben die Betroffenen in solchen Situationen kaum. Sie zu erzwingen ist nahezu unmöglich. »Maniker reagieren besonders empfindlich auf Bevormundung oder Fremdbestimmung«, erklärt der Berliner Psychiater Stamm, »statt sie einzuengen oder sogar den Konflikt mit ihnen aufzunehmen, sollte man an ihre Eigenverantwortlichkeit appellieren und versuchen, wieder Realität herzustellen.« Die Betroffenen lernen, wie sie die ersten Anzeichen einer Depression oder Manie rechtzeitig erkennen und abbremsen können. Dritteln der Bipolaren, die es schaffen, ihr Leben trotz Krankheit in den Griff zu bekommen und sogar in einer Führungsposition zu arbeiten. Gewinnt hingegen die Bipolare Störung die Überhand, stehen Alkoholabhängigkeit sowie Angstund Schlafstörungen meist am Ende eines Lebens mit vielen Brüchen. Ein entscheidender Schritt, um das zu vermeiden: die Krankheit als Teil von sich zu akzeptieren. Seidel bekämpft ihre psychische Störung nicht mehr dauerhaft, sondern versucht, sie in positive Energien umzuwandeln. »Da ich im kreativen Bereich tätig bin, bemerke ich immer wieder, dass ich eine besondere Sensibilität habe für Gedichte oder Romane von Schriftstellern, die häufig sogar selbst bipolar sind«, sagt sie. Womöglich zieht Seidel gerade aus den Extremen ihrer Erkrankung die schöpferische Sensibilität und die Kraft, um ihren Alltag zusammen mit drei Kindern, Beruf und der Krankheit zu meistern. von Julia Völker, ZEIT Online, 29. Oktober 2013 Was hilft, ist eine langfristige Behandlung mit Medikamenten Im Notfall, etwa wenn der Betroffene selbst oder sein Umfeld gefährdet ist, folgt die Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik. »Eine Zwischenlösung ist der Sozialpsychiatrische Dienst, da er auch zu Patienten nach Hause kommt und dort mit ihnen spricht, ohne diese mit in die Klinik zu nehmen«, empfiehlt Psychiater Stamm. Seidel sagt, sie würde seit der Psychose nur noch funktionieren: »Ich bin nicht mehr glücklich. Aber langsam sehe ich wieder Licht, bin auf dem Weg zur Mitte.« Die Krankheit in den Griff zu bekommen braucht Zeit. Denn eine Bipolare Störung ist eine Diagnose auf Lebenszeit. »Die akute Behandlung der Stimmungszustände hilft nicht allein, sondern vor allem eine langfristige Medikation«, sagt Stamm. Medikamente wie Lithium oder auch spezielle Antiepileptika helfen den Patienten, eine stabile Stimmung und damit die Basis für eine weitere Psychotherapie zu erlangen. Eine alleinige Psychotherapie wirkt bei Bipolaren deutlich weniger effektiv als bei reinen Depressionen. »Deshalb ist es so wichtig, auch leichte Manien nicht zu übersehen«, sagt Stamm. In Einzelgesprächen oder Gruppentherapien können Betroffene lernen, wie sie erste Anzeichen einer Depression oder Manie rechtzeitig erkennen und abbremsen können. »Erst wenn der Umgang mit den Akutsymptomen gut eingeübt ist, kann eine tiefergehende Psychotherapie beginnen«, sagt der Berliner Psychiater. Zu verstehen, was mit ihr los ist, hat auch Monique Seidel geholfen. Sie hat gelernt, die Extreme weitestgehend zu beherrschen, und gehört nun zu den zwei 184 Die Welt im Kopf Das erkrankte Gehirn 185 Schau mir in die Augen Autisten nehmen ihre Umwelt als eine Flut von Details wahr. Gesichter überfordern sie, oft sind sie unfähig, soziale Beziehungen aufzubauen. Nun soll ein Roboter autistischen Kindern helfen, aus der Isolation auszubrechen. Erste Begegnungen stellen verbreitete Thesen infrage Zwölf Sekunden lang schaut Paul seinem Gegenüber in die Augen. Zwölf Sekunden lang rutscht er nicht auf dem Stuhl hin und her, ruft nicht »tut weh, tut weh«. Zwölf Sekunden – eine kleine Ewigkeit und ein kleines Wunder. Denn der 15-jährige Paul ist Autist. Normalerweise kann er sich nur für wenige Augenblicke konzentrieren, bevor sein Blick wieder durch den Raum zappelt, als verfolge er eine Fliege – und bevor sein Fuß wieder zu zucken beginnt, dann das Bein und schließlich der ganze Körper. Nur wenn Kaspar da ist, ist es anders. Kaspar trägt Jeans, eine Baseballkappe und ein T-Shirt mit viel zu langen Ärmeln. Und ihm gelingt, was Pauls Lehrer oft vergeblich versuchen: Er verwickelt Paul in ein Spiel. Abwechselnd schlagen sie auf ein Plastiktamburin, erst Kaspar, dann Paul, dann wieder Kaspar. Für die Sprachtherapeutin Lisabeth Connor, die das Treffen im Gymnastikraum der St.-Elizabeth’s-Förderschule nördlich von London beobachtet, ist das unfassbar. Schließlich ist Kaspar nur ein ferngesteuerter Roboter. In den Kinderklamotten Größe 52 stecken Teile einer Puppe, ein Computer, Motoren und eine Gummimaske mit menschlichen Zügen. Seit Wochen ist der Maschinenjunge mit dem Robotikforscher Ben Robins von der University of Hertfordshire unterwegs. Robins besucht eine Förderschule nach der anderen, um eine These seiner Arbeitsgruppe zu belegen: Roboter können helfen, autistische Kinder zu therapieren. Mit einem Notebook, von dem aus vier Kabel in Kaspars Rücken führen, steuert Robins den Roboter wie ein Marionettenspieler seine Puppe. Es surrt leise, Kaspar blinzelt, sssst, Kaspar winkt, sssst, Kaspar verzieht die Lippen zu einem Lächeln. Jetzt grinst auch Paul über beide Ohren. »Unglaublich«, flüstert die Therapeutin. Autisten wie Paul leiden an einer unheilbaren Entwicklungsstörung des Gehirns. Meist treten die Symptome schon in den ersten beiden Lebensjahren auf. Bereits autistische Säuglinge schauen lieber die Gitterstäbe ihres Bettchens an als ihre Mutter. Das Gesicht überfordert sie, anstelle des liebevollen Lächelns sehen sie unzählige Details. Die Lachfältchen am Mund – für sie irritierend. Die großen Augen mit den hochgezogenen Brauen – ein Rätsel. Nicht nur die Züge der Mutter, ihre ganze Umwelt nehmen Autisten als Flut überscharfer Einzelheiten wahr. Geräusche 186 Die Welt im Kopf wie das Quietschen der Gummiente oder das Dingdong der Spieluhr machen ihnen Angst. Kleinste Berührungen versetzen sie in Panik. Die Kinder schotten sich von der Außenwelt ab und verpassen eine normale Entwicklung. Während Gleichaltrige mit Modellautos nachspielen, wie ihre Familie in die Ferien fährt, sortieren Autisten die Autos der Farbe nach – um wenigstens ein bisschen Ordnung in die Welt da draußen zu bringen. Ihr Leben lang bleiben Autisten unfähig, sich in andere hineinzuversetzen. »Seelenblindheit« nennt der britische Psychologe Simon Baron-Cohen das. Viele empfinden Blickkontakt als unangenehm und unerheblich. Stark betroffene Patienten wie Paul lernen zudem nie richtig sprechen und scheuen jede Initiative. Bricht ihm im Unterricht der Bleistift ab, verlangt er keinen neuen, sondern starrt aus dem Fenster, bis es dem Lehrer auffällt. Rollt auf dem Bolzplatz ein Ball auf ihn zu, schießt er nur, wenn er dazu aufgefordert wird: »Paul! Schuss!« Jeder Moment, in dem Paul sein inneres Exil verlässt, ist daher kostbar. Als Robins an diesem Morgen den nächsten Jungen hereinbitten will, macht Paul eine Faust und schlägt mit der anderen Hand darauf. In seiner Zeichensprache heißt das: »Mehr!« Für Robins ein kleiner Triumph. Kaspar vermittelt erfolgreich zwischen Pauls Welt und der der anderen. »Er ist dazu das ideale Werkzeug«, sagt der Forscher. »Autisten lieben technische Dinge, etwa Computer und ferngesteuerte Autos. Einen Das Verhalten des Roboter wie Kaspar lieben sie besonders, weil Roboters ist kalkulierbarer er puristische Gesichtszüge hat.« Sein Verhalals das von Menschen, ten sei kalkulierbarer als das von Menschen, eine verlässliche Konstante eine verlässliche Konstante in einer Welt in einer Welt voller voller Unwägbarkeiten. »Noch ist es aber zu Unwägbarkeiten. früh, einen therapeutischen Effekt festzustellen«, sagt Robins. »Das hier sind ermutigende Einzelfälle, mehr nicht. Genaueres werden wir erst nach einer Langzeitstudie wissen.« Paul darf bleiben. Und als Lenny schließlich mit am Tisch sitzt, vollführt der Roboter das nächste Kunststück. Lenny ist neun, und die Situation ist ihm sichtlich unangenehm. Er versteckt sein Gesicht hinter dem Ärmel seines T-Shirts und kichert andauernd in sich hi­nein. Robins drückt ihm eine Minitastatur mit Symbolen in die Hand. Ein Trommelstock steht für die Tamburinschläge. Bam, bam-bam, Kaspar legt los. Äußerlich unbeteiligt steuert Lenny den Roboter, Paul soll ihn imitieren. Dann passiert es: Aus dem Augenwinkel sieht Lenny, dass der Mitschüler auf den Tisch klopft, weil er kein Tamburin hat. Er nimmt Robins eines aus der Hand und hält es Paul hin. »Diese Jungs würden nie miteinander spielen«, sagt die Therapeutin. »Wenn Kaspar ihnen eine Brücke baut, ist das ein riesiger Schritt.« Zwei Wochen zuvor, Das erkrankte Gehirn 187 Die Roboterpuppe Kaspar wurde von Ben Robins von der Universität Hertfordshire entwickelt. Kaspar beherrscht menschliche Ausdrücke, und die sind bei ihm zum Glück immer eindeutig – anders als bei echten Menschen. erzählt sie, habe ein Kind einem anderen beim Spielen mit Kaspar sogar die Hand auf die Schulter gelegt. »Wir waren erstaunt, das Kind hatte bis dahin jeden Körperkontakt gemieden.« Ein paar Tage später, Kaspar war lange fort, habe sich die Szene beim Sport wiederholt: Ganz nebenbei lehnte sich der Junge bei dem anderen an. Können Roboter wirklich helfen, die Symptome des Autismus zu lindern? Die Szene dürfte sich so gar nicht abgespielt haben, glaubt man einigen Experten. »Vielleicht animieren Roboter Kinder dazu, miteinander zu spielen«, sagt Beate Herpertz-Dahlmann, Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirates im Bundesverband Autismus. Unwahrscheinlich sei aber, dass sich das auf Situationen übertragen lasse, in denen kein Roboter da ist. »Schließlich lässt sich Autismus auf eine tiefgreifende Störung des Gehirns zurückführen.« Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass die Hirne autistischer Kleinkinder vom zweiten Lebensjahr an deutlich schneller wachsen als gewöhnlich. Ob der Autismus die Ursache dafür ist oder eine Folge davon, ist unklar. Sicher ist nur, dass vor allem die weiße Masse schließlich im Überfluss vorhanden ist. So werden die Nervenfasern zwischen Hirnzellen aufgrund ihres Aussehens in Hirnschnitten genannt. Eine mögliche Erklärung: Beim Hirnwachstum werden normalerweise unnötige Verbindungen gekappt, übrig bleiben nur die, die wirklich gebraucht werden – bei Autisten versagt dieser Mechanismus offenbar. Autismus – Gefangen im Ich Lange Zeit glaubten Wissenschaftler, Autismus sei die Folge fehlender Mutterliebe, sie sprachen von »Kühlschrankmüttern«. Heute gehen sie davon aus, dass es sich um eine genetisch veranlagte Entwicklungsstörung handelt. Sie beeinträchtigt Wahrnehmung und Informationsverarbeitung im Gehirn. Neuen Schätzungen zufolge könnte jedes 60. Kind betroffen sein, vier Fünftel davon Jungen. Der 188 Die Welt im Kopf frühkindliche Autismus, der sich schon bei Kleinkindern bemerkbar macht, geht oft mit einem geringen Wortschatz und geistiger Behinderung einher. Das mildere Asperger-Syndrom wird dagegen oft erst ab dem dritten Lebensjahr entdeckt. Die Kinder können trotz aller Defizite hochintelligent sein, Inselbegabte entwickeln sogar extreme Talente: Sie kennen Telefonbücher auswendig oder berechnen Zahlen auf 60 Dezimalstellen genau. Das drastische Wachstum betrifft allerdings nur die Verbindungen innerhalb einzelner Hirnareale. Untereinander sind die Regionen viel schlechter verdrahtet. Es ist, als müssten sich die Informationen ihren Weg durch ein Labyrinth unzähliger Feldwege bahnen, weil Schnellstraßen fehlen. Vielleicht ist das der Grund, warum Autisten sich nach einem Treffen bis auf den letzten Leberfleck an ein Gesicht erinnern, aber nicht sagen können, ob der andere glücklich oder traurig war. »Hirnscans haben gezeigt, dass bei Gesunden ein kleiner Bereich im Temporallappen aktiv wird, wenn sie ein Gesicht sehen. Autisten reagieren nicht darauf«, sagt Herpertz-Dahlmann. Sie nähmen Gesichter nicht als Ganzes, sondern als Ansammlung von Details wahr. »Es ist kaum vorstellbar, dass ein Roboter so etwas Grundlegendes beeinflusst.« Zögerlich reagierte zunächst auch der Autismusexperte Simon Baron-Cohen, als er von dem Kaspar-Experiment hörte. Als er dann jedoch Videos davon sah, war er begeistert. Jetzt will er die Arbeit mit dem Roboter genauer verfolgen. Und Fritz Poustka, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Frankfurt, würde gern selbst mit Kaspar experimentieren »Die Prognose bessert sich Das erkrankte Gehirn 189 deutlich, wenn die Betroffenen lernen, andere zu imitieren«, sagt er. »Wir haben gute Erfahrungen mit interaktiven PC-Programmen gemacht, bei denen Patienten am Bildschirm die Mimik von Gesichtern erkennen und nachahmen sollen.« Warum sollten also nicht auch Roboter helfen, den sozialen Umgang zu lernen? »Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Autisten je so spontan auf Menschen reagieren wie Gesunde. Ihr Verhalten wird immer hölzern wirken.« Richard ist diese Debatte egal. Der 16-Jährige ist nicht mehr zu stoppen, wenn Ben Robins mit seiner Umhängetasche über den Schulflur geht. Er weiß, da drinnen sitzt Kaspar. Und er ist zu stämmig, als dass ihn jemand aufhalten könnte. Heute begegnet Richard dem Roboter zum dritten Mal. Brüllend tobt er durch den Raum, als er bemerkt, dass Lenny noch am Tisch sitzt. Kaspar teilen, das kommt nicht infrage. Als er ihn endlich für sich hat, streichelt er behutsam über den schwarzen Schopf und krempelt ihm die T-Shirt-Ärmel hoch. Tief schaut er ihm in die Augen: »Kameras«, murmelt er. »Ja, die Pupillen, das sind Kameras«, sagt Robins. Richard pflegt eine eigentümliche Beziehung zu Kaspar. Längst hat er erkannt, dass das seltsame Wesen eine Maschine ist. Längst weiß er, wie das Programm funktioniert, das den Kopf hin- und herdreht. Und trotzdem drückt er seine Nase vorsichtig auf die des Roboters, als wäre er sein kleiner Bruder. Auf die Idee, dass Roboter eine besondere Anziehungskraft auf Autisten ausüben könnten, kam Kerstin Dautenhahn, die Leiterin von Robins’ Arbeitsgruppe, bereits vor zehn Jahren. »Damals dachte ich, alle Welt forscht an immer komplexeren Maschinen«, sagt sie. »Für Autisten ist aber gerade ein niedrigeres technisches Niveau viel interessanter.« Auf einem Kongress in Zürich erzählte sie einem kanadischen Roboterbauer von ihrem Einfall. Prompt schenkte der ihr Labo-1, ein flaches Gefährt mit dicken Reifen und Hitzesensor. »Wir haben es so programmiert, dass es den Standort der Kinder orten und sie verfolgen konnte, ihnen aber davonfuhr, wenn sie selbst darauf zuliefen.« Autisten liebten das Spiel. Der 50 Zentimeter große Kaspar ist nun der erste Roboter mit menschlichem Gesicht, mit dem Dautenhahn und ihr Team experimentieren. Er soll ihnen auch helfen herauszufinden, wie Roboter idealerweise beschaffen sein müssen, damit sich Autisten auf sie einlassen. Die Ergebnisse sollen in das von der EU mit mehr als zwei Millionen Euro geförderte Iromec-Projekt einfließen: Forscher aus sechs Ländern wollen gemeinsam einen Roboter entwickeln, der Kinder mit den verschiedensten Behinderungen beim Lernen unterstützt. Ein Team aus Wien erforscht beispielsweise die Bedürfnisse körperlich Behinderter. »Von Kaspar haben wir gelernt, dass er gerade auf Autisten unglaublich anziehend wirkt, weil er ein wenig Maschine, ein wenig Mensch ist«, sagt Dautenhahn. »Er beherrscht menschliche Ausdrücke, allerdings sind diese immer eindeutig.« Leicht geschlossene Augen und herabgezogene Mundwinkel stehen für Traurigkeit, offene Arme und ein Lächeln für Freude. Diese Mimik wirkt so echt, dass sich gesunde Erwachsene unwohl fühlen, wenn sie Kaspar sehen. 190 Die Welt im Kopf Zombie-Effekt nennen Roboterforscher dieses Phänomen – es tritt auf, wenn künstliche Gesichter zu stark echten ähneln, zugleich aber auch verstörend leblos sind. Genau das scheint Kinder wie Richard aber zu beruhigen. Nie käme man auf die Idee, dass gerade der Junge am Tisch sitzt, der gewalttätig wird, sobald ihm ein Mitschüler zu laut ist. Als die Stunde vorbei ist, streicht er Kaspar noch einmal liebevoll über die Gummibacken, fährt noch einmal mit der Fingerspitze über die winzigen Lippen. Und als der Computer herunterfährt und der Roboter in sich zusammensackt, fragt er: »Ist Kaspar traurig?« von Jens Uehlecke aus ZEIT Wissen Nr. 5/2007 Das erkrankte Gehirn 191 Wahnsinns-Typen Wie gestört muss man sein, um Besonderes zu leisten? Erstaunlich viele Chefs sind psychisch auffällig Eine Frage der Weltgeschichte: Muss man außergewöhnlich sein, um Außergewöhnliches zu leisten? Und was heißt außergewöhnlich? Bloß wunderlich, ganz speziell intellektuell, mental auffällig oder sogar psychisch gestört? Da ist die Studie der Cass Business School in London, in der mehr als jeder dritte Firmengründer bekennt, Legastheniker zu sein. Die Lese- und Rechtschreibstörung tritt bei Unternehmenslenkern demnach achtmal häufiger auf als im Durchschnitt der Bevölkerung. Oder ADHS. Studenten mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, so haben Forscher der Erasmus-Universität Rotterdam beobachtet, werden später mit überdurchschnittlich großer Wahrscheinlichkeit ein Unternehmen gründen. Es kann sogar ganz schlimm kommen: Konzernkarrieristen sind übermäßig häufig gefährliche Irre. In den Führungsetagen von Unternehmen finden sich dreieinhalbmal so viele Psychopathen wie im Durchschnitt der Bevölkerung, wie Robert Hare, Psychologe und Forensiker aus Vancouver, und der New Yorker Unternehmensberater Paul Babiak durch Hunderte von Interviews herausgefunden haben. Zwischen Legasthenie und Psychopathie liegt eine gewaltige Spanne von mentalen Defiziten – sie reicht von der Rechenschwäche bis zum Narzissmus, von der Depression über die bipolare Störung bis hin zum Autismus. Mal sind die Leiden relativ harmlos, mal schwerwiegend. Und alle diese Verrücktheiten stehen in einer seltsamen Verbindung zum beruflichen Erfolg. Narzissmus – Wer unter einer narzisstischen Persönlichkeits­störung leidet, hat ein geringes Selbstwertgefühl und lehnt sich selbst ab, versucht dies jedoch durch übertriebenes Selbstbewusstsein nach außen zu kaschieren. Narzissten überschätzen dabei deutlich ihre Fähigkeiten, sind aber der Meinung, dass ihre Mitmenschen sie genau so sehen, wie sie sich selbst sehen. Um ihr Ansehen zu steigern, bauen sie nicht selten Lügenkonstrukte 192 Die Welt im Kopf auf. Bei Miss­erfolgen fühlen sie sich erniedrigt und wertlos und können mit Kritik schwer umgehen. Die Klassifikation ICD-10 der Weltgesundheits­organisation kennt die narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht als Diagnose. Unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden mehr Männer als Frauen, insgesamt aber weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Nur sehr ­wenige Betroffene lassen sich behandeln. Selbst ins Fernsehen hat das Phänomen schon gefunden: Die CIA-Agentin Carrie Mathison jagt in der gefeierten US-Serie Homeland wie besessen Terroristen. Ihre Erkrankung, die manisch-depressive Störung, ist das Geheimnis ihres Erfolgs. Oder der von Phobien geplagte Superdetektiv Adrian Monk, der mit seiner absurden Logik jeden Fall löst. Auch im realen Leben sind Sonderlinge mit sozialen Defiziten oder mentalen Störungen auf einmal gefragt; Softwarefirmen umgarnen eigenbrötlerische Computerfreaks; Hedgefonds reißen sich um verschrobene Zahlen-Nerds; Politiker preisen exzentrische Firmengründer: Die Arbeitswelt hat sich zu einem Eldorado für Sonderlinge entwickelt. Psychisch Auffällige sitzen tatsächlich bemerkenswert häufig in den Topetagen von Unternehmen, Kultureinrichtungen und Parteibüros. Dort, wo es auf besondere Fähigkeiten und Führungsqualitäten ankommt, trifft man Menschen mit Außenseiterhirnen. Zum Beispiel Mark Zuckerberg, Anfang 30: Der Chef des Milliardenunternehmens Facebook kann bis heute seinem Gegenüber kaum in die Augen schauen. Welche Rolle würde so jemand als junger Mensch heute auf dem Schulhof spielen? Wohl die des sozialen Sonderlings. Und dann definiert ausgerechnet so einer das Verständnis von Freundschaft und sozialer Beziehung neu. Und macht damit ein Vermögen. »Züge von Asperger-Autismus« attestiert ihm ein ehemaliger Facebook-Manager. Zuckerberg gebe »kaum aktives Feedback oder eine Rückmeldung, dass er dir zuhört«, schrieb der einstige Mitarbeiter auf dem Internetportal Quora. Oder Richard Branson. Der Flugliniengründer und Weltraumreise-Pionier pflegt als in die Jahre gekommener Milliardär noch pubertäre Gockeleien. Im Frührentenalter ließ er sich fotografieren, wie er beim Kitesurfen die Elemente bezwingt – umklammert von einem nackten Model. Wo verläuft hier die Grenze zwischen »normaler« Eitelkeit und einer ernsthaften narzisstischen Störung? Oder Steve Jobs. Zu seinen Lebzeiten galt der Chef von Apple als Charismatiker und Choleriker. Vor allem aber galt er als jemand, der in die Zukunft sah. Er verlieh Dingen Gestalt, die andere noch nicht einmal erkennen konnten. Er war schwerer Legastheniker, erfolgloser Student – aber ein Visionär. Man hat die Geschichten vieler großer Persönlichkeiten immer als Erfolgsgeschichten herausragender Talente erzählt. Aber womöglich sind es zugleich Krankengeschichten. Dann müsste man sich zwei Fragen stellen: Ist Genie und Wahnsinn doch ein und dasselbe? Muss man ein Abweichler sein, um Besonderes zu leisten? Aus einem psychisch Kranken wird womöglich der Manager des Jahres Durchaus möglich, meint Nassir Ghaemi, Psychiatrieprofessor in Boston, der erstaunliche »Zusammenhänge zwischen psychischen Störungen und Führungsfähigkeiten« entdeckt hat. Der Wissenschaftler glaubt, dass die Karrieren etlicher großer Männer aus Politik, Militär und Wirtschaft ohne ihre Krankheitsschübe anders verlaufen wären. »Wenn Frieden herrscht, und das Staatsschiff nur auf Kurs bleiben Das erkrankte Gehirn 193 muss, eignen sich geistig gesunde Führer. Wenn unsere Welt aber in Aufruhr gerät, eignen sich geistig kranke Führer am besten«, behauptet Ghaemi in seinem Buch A first-rate madness (»Erstklassiger Wahnsinn«). Er nennt seine Theorie the inverse law of sanity, das umgekehrte Gesetz der Vernunft, was zur alten Psychiater-Weisheit passt: »In guten Zeiten behandeln wir sie, in schlechten regieren sie uns.« Das Problem, vor dem Forscher wie Ghaemi stehen: Geistige Leiden sind schwer zu beweisen, die Grenzen zwischen Normalsein und Wahnsinn oft fließend. Präzise Diagnosen sind aus der Ferne kaum möglich. Die Betroffenen müssten schon bereit sein, sich untersuchen zu lassen. Doch wer erfolgreich und gesellschaftlich anerkannt ist, legt sich freiwillig kaum auf die Couch oder in die Röhre. Seine Krankheit geht als Spleen durch. Und aus einem Fall für den Therapeuten wird jemand, der Grenzen überwindet und Wunder vollbringt. Aus einem psychisch Kranken wird womöglich der Manager des Jahres. Nassir Ghaemi hat sich deshalb einen Kniff einfallen lassen: Er erforscht die psychischen Leiden von Verstorbenen. Dafür wälzt er Biografien, studiert Krankenakten, spricht mit Zeitzeugen. Dem britischen Staatsmann Winston Churchill zum Beispiel bescheinigt Ghaemi schwere DepresDie Grenzen sionen. Er, der sein Land durch den zwischen Normalsein Zweiten Weltkrieg navigierte und daund Wahnsinn sind oft fließend. rüber hinaus den Literaturnobelpreis Präzise Diagnosen sind gewann, bezeichnete seine Krankheit aus der Ferne kaum möglich. als seinen »schwarzen Hund«, der ihn treu begleite, bis ins hohe Alter. Weil Churchill Angst hatte, sich während eines Krankheitsschubs das Leben zu nehmen, mied er zeitlebens Felsvorsprünge und Bahnsteigkanten. Er fürchtete: »Eine spontane Aktion würde alles beenden.« Gerade depressive Phasen, argumentiert Ghaemi, hätten Churchill geholfen, herausragende Führungsqualitäten zu entwickeln. Die bewies er in der schwersten Krise des vergangenen Jahrhunderts. 1930, weit vor allen anderen, warnte er vor den Nazis und drang auf eine militärische Aufrüstung. Als Arthur Neville Chamberlain das Münchner Abkommen mit Hitler unterzeichnet hatte, verweigerten nur Churchill und eine Handvoll Abgeordnete dem Premier den Applaus und blieben demonstrativ auf den Parlamentsbänken sitzen. Sie wurden ausgebuht – und hatten doch recht. »Depressive sehen die Welt tendenziell klarer, mehr so, wie sie ist«, schreibt Ghaemi. Wer kein Vertrauen ins Leben und in die Zukunft hat, lässt sich nicht täuschen. Auch bei Willy Brandt gingen finstere Tage mit einer klarsichtigen Politik einher. 194 Die Welt im Kopf John F. Kennedy steht für ein anderes Extrem. Ghaemi attestiert dem jungen amerikanischen Präsidenten manische Züge, die sich oft in völlig übersteigertem Tatendrang äußerten. Obwohl Kennedy körperlich sehr angeschlagen war, arbeitete er wie ein Besessener. Er las Manuskripte im Gehen, diktierte ohne Unterlass Briefe und Memos, konnte Hände und Füße kaum still halten. Was andere Präsidenten in einem Jahr an Regierungserklärungen und Gesetzesanträgen bewältigten, erledigte Kennedy in gerade mal zwei Monaten. Zwei Stühle verschliss der umtriebige Präsident im Weißen Haus durch permanentes Wippen und Aufspringen. Seine Besessenheit und, damit verbunden, die Begeisterungsausbrüche eines Manikers trugen viel zum glänzenden Image bei, das Kennedy bis heute anhaftet. Je nach Umgebung gelangen sehr unterschiedliche Abnormitäten und psychische Auffälligkeiten zu ihrer Blüte. Andy Grove, einer der Gründer des Chipkonzerns Intel, hat in den neunziger Jahren ein Buch mit einem prophetischen Titel geschrieben: Nur die Paranoiden überleben. Man hat Grove damals ironisch verstanden, aber der Mann dürfte es todernst gemeint haben. Paranoia äußert sich oft als Verfolgungswahn und ist eigentlich eine behandlungsbedürftige Krankheit – kann aber in einer wettbewerbsintensiven Branche zum entscheidenden Plus werden. Denn wer überall Verfolger und Verräter wittert, tut alles, um Wettbewerber früh aus dem Weg zu räumen. So wie Gina Rinehart, die mächtige australische Bergbauunternehmerin, eine der reichsten Frauen der Welt. Rineharts Kosmos besteht aus zwei Lagern: aus Verbündeten und aus Feinden, die sie ums Erbe bringen wollen. Über Jahre zerrte die eisenharte Lady ihre Stiefmutter vor Gericht und bezichtigte sie des Mordes an ihrem Vater. Sie setzte Privatdetektive auf sie an, bestach Zeugen, die ihre Widersacherin mit Falschaussagen belasten sollten, und bewirkte schließlich eine Autopsie ihres Vaters. Diese ergab, dass der 82-Jährige eines natürlichen Todes gestorben war. Ihre eigenen Kinder zwang Rinehart, Schweigeabkommen zu unterzeichnen, die es ihnen verbieten, schlecht über die Mutter zu reden. Restlos geklärt ist sie nicht, die Frage, wie psychische Leiden und beruflicher Erfolg zusammenhängen, aber es gibt Erklärungsversuche. Zum Beispiel bei der Lese- und Rechtschreibstörung. So lernen Legastheniker schon in der Schule, Arbeit abzugeben, indem sie Mitschüler oder Mütter dazu bringen, die Hausaufgaben für sie zu machen. Die Fähigkeit, Aufgaben zu delegieren, die anderen die Kleinarbeit machen zu lassen und sich derweil ums Große und Ganze zu kümmern, zeichnet Führungskräfte aus. Die Erklärung mag sich simpel anhören, aber fest steht, dass viele prominente Legastheniker ökonomische Weltreiche erschaffen haben. Dazu zählen neben Steve Jobs auch die Gründer von Konzernen wie Ford, General Electric, IBM und Ikea. Auch Charles Schwab (der Gründer des gleichnamigen Finanzmaklerunternehmens), John Chambers (der Chef von Cisco) und Ferdinand Piëch (VW) kämpften mit dem Gewimmel der Buchstaben. Das erkrankte Gehirn 195 Beim »Zappelphilipp-Syndrom« ADHS, das ebenfalls bei zahlreichen Firmengründern zu finden ist, geht die Vermutung in eine andere Richtung: Jemand, der sich nicht lange auf eine Sache konzentrieren kann und sich schnell langweilt, ist vielleicht ein Chaot, aber eben auch ein Quell immer neuer Ideen. Er ist kreativer und risikofreudiger als andere. Eines sollte dabei aber nicht vergessen werden: Psychische Leiden und mentale Störungen jeder Art sind kein Glück für den Betroffenen. Im Normalfall ist eine Krankheit auch kein Karrierebeschleuniger. Oft zerstört die Diagnose nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch das ihrer Familie und Freunde. Das wohl prominenteste Beispiel ist die Geschichte des genialen Mathematikers und Spieltheoretikers John Forbes Nash, die unter dem Titel A Beautiful Mind ein Massenpublikum im Kino begeisterte. Nash litt unter Schizophrenie und gewann den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Vor einiger Zeit verblüffte der ebenso kauzige wie geniale Mathematiker Grigori Perelman die Öffentlichkeit, als er für die Lösung eines mathematischen Jahrhunderträtsels die Fields-Medaille, eine Art Mathematik-Nobelpreis, sowie eine Million Dollar Preisgeld ablehnte. Er hätte zur Verleihung nach Madrid reisen müssen. Nach Medienberichten verlässt der akademische Eremit äußerst ungern seine Dreizimmerwohnung, in der er mit seiner Mutter am Rande von St. Petersburg lebt. Schon vor 2500 Jahren brachte Aristoteles Genie und Wahnsinn in einen Zusammenhang. Doch erst im 19. Jahrhundert entwickelte der italienische Psychiater Cesare Lombroso daraus eine bekannte Theorie. Diese wurde wiederum Anfang des 20. Jahrhunderts stark angezweifelt, etwa von dem britischen Naturforscher Francis Galton. Dieser war überzeugt, dass Genialität nur einem gesunden Geist entspringen könne. »Seither gab es diverse Phasen, in denen wir psychiatrischen Erkrankungen mal mehr und mal weniger aufgeschlossen gegenüberstanden. Derzeit befinden wir uns in einer toleranten Phase«, sagt der Neuropsychologe Niels Birbaumer von der Universität Tübingen. Zwischen Genie und Wahnsinn liegt ein schmaler Grad, der mitunter in den Abgrund führen kann. Vor allem dann, wenn Kontext, Krankheit und Karriere auf unheilvolle Weise zusammenwirken. Dann hat auch das Böse seinen Platz auf der Karriereleiter. »Schlangen in Anzügen«, so nennen der Psychologe Robert Hare und der Unternehmensberater Paul Babiak die psychisch gestörten Aufsteiger, die auf ihrem Weg an die Spitze erst die anderen, dann dem ganzen Unternehmen und letztlich auch sich selbst schaden. Der Tübinger Psychologe Birbaumer würde ihnen gerne eine echte klinische Diagnose stellen, kommt aber nicht nah genug an sie heran: »Ich bin sicher, dass ein erheblicher Teil der Topmanager erfolgreiche Psychopathen sind, aber ich kann es nicht beweisen. Dafür müsste ich sie in den Kernspintomografen stecken«, sagt er. So könnte er die aktiven und die abgeschalteten Hirnregionen erkennen und beobachten. 196 Die Welt im Kopf Kevin Dutton hat eine andere Methode gewählt, um sich Psychopathen anzunähern: Er ist selbst einer geworden. Der britische Psychologe unterzog sich einem »psychopathischen Umstyling«. Dafür ließ er sich auf einem speziell präparierten Zahnarztstuhl festschnallen, seinen Kopf mit einem Geschirr fixieren und setzte diesen einem elektromagnetischen Feld aus. Dabei wurde – vereinfacht ausgedrückt – jener erdnussgroße Bereich seines Gehirns, der dafür verantwortlich ist, wie wir Dinge empfinden, deaktiviert. Für eine halbe Stunde fühlte Dutton wie ein Psychopath. Und erschrak über sich selbst: Beim Anblick von Fotos von Verstümmelten, Gefolterten und Hingerichteten, auf die er zuvor im Gehirnscan noch heftig reagiert hatte, zeigte er nun keinerlei Regung. Sein Puls blieb ruhig, die Gehirnströme glitten in sanften Wellen dahin. Hätte er sich vorher beim Anblick der Bilder noch fast übergeben, sagte er jetzt: »Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, ein Lächeln zu unterdrücken.« Zum ersten Mal spürte Dutton am eigenen Leib, was allen Psychopathen fehlt: die Fähigkeit zur Empathie. Mit Entsetzen stellte der Gelehrte fest, dass es sich in dieser Gefühlskälte wunderbar leben lässt. »Ich fühlte mich großartig! Es war ein bisschen, wie betrunken zu sein, aber ohne die Trägheit und Müdigkeit von Alkohol. Ich war enorm fokussiert und platzte vor Selbstvertrauen.« Dutton trägt eine auffällige Hornbrille, das nach hinten gekämmte Haar fällt auf ein rosafarbenes Hemd mit Blümchenmuster. Er empfängt im altehrwürdigen Magdalen College der Oxford-Universität, das sich rühmt, sieben Nobelpreisträger hervorgebracht zu haben. Dutton führt durch den von Efeu umrankten Innenhof mit den spitzen Türmchen und den hohen Fenstern, umrundet den perfekt getrimmten Rasen, der so aussieht, als hätte ihn noch nie jemand betreten. Sein Büro liegt im neueren Teil des Colleges, wobei in Oxford als neu gilt, was nicht älter als 300 Jahre Psychopathen ist. Wo einst der Literaturwissenschaftler verfügen über Eigenschaften, C. S. Lewis, der Verfasser der Chroniken die im Beruf sehr nützlich von Narnia, sein Arbeitszimmer hatte, sein können. Sie sind Meister serviert Dutton Tee mit Zitrone, entder Manipulation. schuldigt sich für die fehlenden Biskuits und versinkt in einem Polstersessel. Auf dem Tisch liegt Duttons neuestes Werk, das vor wenigen Monaten auf Deutsch erschienen ist: Psychopathen: Was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann. Man fragt sich natürlich, ob man überhaupt etwas von ihnen lernen will. Sind Psychopathen nicht diese blutrünstigen Serienkiller, die Frauen verstümmeln und Kinder verscharren? »Das sind nur die extremsten Vertreter, die früher oder später im Gefängnis landen.« Für Dutton sind das die erfolglosen Das erkrankte Gehirn 197 Psychopathen – die weitaus größere Zahl, glaubt Dutton, laufe frei herum und sei im Job sogar überaus erfolgreich. Denn Psychopathen verfügen über Eigenschaften, die im Beruf sehr nützlich sein können: Sie halten sich für grandios, können extrem charmant sein, kennen weder Skrupel noch Reue oder Angst, scheuen kein Risiko und wissen, wie man andere geschickt für seine Zwecke einsetzt. Sie sind Meister der Manipulation. Wohl niemand beherrschte das besser als Adolf Hitler, der vielleicht schlimmste Irre der Weltgeschichte, der die Psychopathie gewissermaßen zur Staatsform erhob. Dutton wollte nicht nur wissen, was Psychopathen erfolgreich macht, sondern auch, in welchen Berufen sie häufig anzutreffen sind. In einer groß angelegten Studie setzte er britischen Berufstätigen einen Persönlichkeitstest vor, mit dem er psychopathische Merkmale abfragte. Die Berufe mit dem höchsten Anteil an Psychopathen waren – in dieser Reihenfolge – Vorstandsvorsitzende, Anwälte, Rundfunkjournalisten, Verkäufer, Chirurgen. Auch Geistliche und Beamte waren unter den Top Ten. »Psychopathen lieben Machtstrukturen, die sie manipulieren und kontrollieren können. Manche Berufe bieten dafür ein ideales Umfeld«, sagt Dutton. Ein Manager, der unter großem Druck harte Entscheidungen treffen und andere ausstechen kann, ist erfolgreicher als einer, der sich in Selbstzweifeln ergeht. Ein Strafverteidiger, der seinen Mandanten rücksichtslos vertritt, bringt es weiter als einer, der Mitleid mit dem Opfer hat. Ein Chirurg, der sich von seinem Patienten emotional ganz und gar distanziert, operiert womöglich präziser. So argumentiert Dutton. Erfolgreiche Business-Psychopathen sind dabei nicht unbedingt weniger gestört als inhaftierte Gewaltverbrecher. Das zeigt eine Studie der beiden Psychologinnen Belinda Board und Katarina Fritzon aus dem Jahr 2005, die die Wesenszüge von 39 britischen Firmenchefs mit Ein Manager, denen von über tausend Insassen der der harte Entscheidungen englischen Hochsicherheitsklinik Broadtreffen und andere moor verglichen. Das Ergebnis: Die Wirtausstechen kann, ist schaftsführer übertrafen die verhaltenserfolgreicher als einer, der sich gestörten Kriminellen sogar in manchen in Selbstzweifeln ergeht. Eigenschaften, die Psychopathen zugeschrieben werden. Sie traten noch herrischer auf, zeigten noch weniger Mitgefühl und waren noch besser darin, andere zu manipulieren. Das bedeutet: Die Kombination aus mangelnder Empathie und fehlender Angst vor den Folgen des eigenen Handelns kann einen Menschen je nach Umstand zu einem blutrünstigen Ted Bundy machen oder zu einem smarten James Bond. 198 Die Welt im Kopf Auch in Richard Fuld, einstiger Chef der Pleite-Bank Lehman Brothers, deren Zusammenbruch den Ausbruch der globalen Finanzkrise markiert, erkennen manche einen Paradepsychopathen. Fuld, auch bekannt unter dem Spitznamen Gorilla, drohte in einem internen Firmenvideo Widersachern an, ihnen das Herz bei lebendigem Leibe herauszureißen und es zu verschlingen. Das US-Magazin Time wählte Fuld unter die »25 Menschen, die die Finanzkrise verschuldet haben«. Darüber, ob die Finanzkrise das Werk von Psychopathen ist, lässt sich nur spekulieren. Aber es ist plausibel, dass in einer kompetitiven und auf kurzfristige Gewinne ausgerichteten Geschäftswelt Psychopathen leichter nach oben gelangen. Dutton glaubt sogar, dass unsere Gesellschaft insgesamt psychopathischer wird. Eine Meta-Analyse der US-Psychologin Sara Konrath mit mehr als 13 000 amerikanischen Collegestudenten zeigt, dass die Empathiewerte zwischen 1979 und 2009 kontinuierlich abnahmen, am deutlichsten war der Abfall nach dem Jahr 2000. Die Studenten zeigten immer weniger Anteilnahme für Menschen, denen es nicht so gut ging wie ihnen. »Gleichzeitig hat der Narzissmus in dieser Zeit zugenommen mit dem stärksten Anstieg in den vergangenen zehn Jahren«, sagt Dutton. Die Folgen können gewaltig sein, wenn einflussreiche Narzissten zerstörerisch wirken. »Wir mussten den Mann schließlich rausnehmen, weil die ganze Organisation nach und nach in Schockstarre verfiel«, erzählt der ehemalige Personalchef einer international operierenden Großbank über den Ex-Vorstandsvorsitzenden einer nationalen Tochter. »Der CEO hatte alle Anzeichen einer narzisstischen Störung und glaubte, besser zu sein als alle anderen. Dann begann er, ausschließlich Menschen um sich zu versammeln, die ihm bedingungslos zustimmten. Wer ihn kritisierte, flog raus.« Lange sei die Entwicklung unbemerkt geblieben, erinnert sich der Personaler. Und selbst als das Verhalten auffiel, habe sich die Bank nur schwer von dem Chef trennen können. Denn auf dem Papier waren die Ergebnisse des Topmanagers prächtig, an den Umsätzen und Gewinnen der von ihm gelenkten Tochtergesellschaft war nichts auszusetzen. Zudem konnte er gegenüber seinen eigenen Vorgesetzten äußerst charmant und überzeugend auftreten. Dass ihn seine narzisstische Störung schließlich doch den Job kostete, lag daran, dass es kaum ein Mitarbeiter bei ihm aushielt. »Er feuerte viele Leute, die besten gingen freiwillig, weil sie so nicht mehr weiterarbeiten wollten«, erzählt der ehemalige Personalchef. »Die Bank verlor auf diese Weise viel wertvolles Know-how. Lange wäre das nicht mehr gut gegangen.« Mit Entwicklungsstörungen und psychischen Leiden ist es wie mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Psychopathen oder Narzissten können ein Unternehmen zum Erfolg führen oder es zugrunde richten. Oder beides – in dieser Reihenfolge. Ein manischer Manager kann ungeahnte Kreativität freisetzen oder seine Mitarbeiter in den Wahnsinn treiben. Ein depressiver Chef kann Weitsicht entwickeln oder in Tatenlosigkeit verfallen. Es kommt also sehr darauf an, in welche Richtung eine Krankheit ausschlägt. Und wie die Umgebung reagiert – ob sie die Störung auffängt oder sie noch verstärkt. Das erkrankte Gehirn 199 Es kommt aber auch darauf an, was eine Gesellschaft für »normal« hält. Der deutsche Softwarekonzern SAP hat diese Definition als eines der ersten Unternehmen erweitert. Vor wenigen Wochen kündigte die Firma an, gezielt auch Autisten einzustellen. Autismus ist eine unheilbare Entwicklungsstörung, bei der Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen beeinträchtigt sind. Viele Autisten sind arbeitsunfähig und können ihren Alltag ohne Hilfe nicht meistern. Aber gerade diejenigen mit Asperger-Syndrom, einer milden Ausprägung von Autismus, unterscheiden sich in Intelligenz und Sprachvermögen nicht von anderen Menschen. Nur tun sie sich mit den einfachen Dingen im Leben enorm schwer. Der Kinofilm Rain Man, in dem Dustin Hoffman einen genialen Autisten spielt, der mit seinem Bruder (Tom Cruise) durch Amerika tourt, hat das Leiden Millionen Menschen zum ersten Mal nähergebracht. Autisten haben Probleme, soziale Situationen richtig einzuschätzen und mit anderen Menschen zu kommunizieren. Jede Mimik, jede Geste ist für sie ein Code, den sie mühsam knacken müssen. Sie lernen Gesichter zu lesen wie andere chinesische Schriftzeichen. Menschliche Begegnungen bedeuten für sie Stress. Sie vermeiden Blickkontakt, Smalltalk empfinden sie als Qual, was ihre Routine stört, bringt sie aus der Fassung. Schon ein Blumentopf, der nicht an seinem gewohnten Platz steht, kann eine Krise auslösen. Etwa ein Prozent der Bevölkerung lebt mit einer Form von autistischer Störung. Der Softwaregigant SAP hat sich nun verpflichtet, diese Quote auch bei seinen Angestellten zu erreichen. SAP hat weltweit 66 000 Mitarbeiter, Hunderten von Autisten winkt nun also ein Arbeitsplatz. Diese Aktion ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung, denn SAP glaubt, dass Autisten in der Welt der Computerprogramme Spitzenleistungen vollbringen können. Autismus – Menschen mit Autismus haben Probleme, soziale Situationen richtig einzuschätzen und mit anderen Menschen angemessen zu kommunizieren. Es handelt sich dabei um eine tief greifende Entwicklungsstörung. Unterschieden wird zwischen frühkindlichem Autismus, atypischem Autismus und dem AspergerSyndrom. Weil die Abgrenzung zunehmend schwerfällt, wird heute oft der Oberbegriff Autismus-Spektrum-Störung 200 Die Welt im Kopf verwendet. Woher Autismus kommt, ist unklar. Wahrscheinlich wirkt mehreres zusammen: Schädigungen am Gehirn, biochemische Störungen und die Gene. Menschen mit Asperger, benannt nach einem Wiener Kinderarzt, der diese milde Form des Autismus 1944 erstmals beschrieb, besitzen eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz. Etwa 6 von 1000 Menschen sind Autisten, die Hälfte von ihnen leidet am Asperger-Syndrom. Viele Autisten sind sehr geschickt im Umgang mit Zahlen, Daten, Formeln. Ihr Blick für Details und ihre Vorliebe für Regeln sind ideale Voraussetzungen für die Arbeit mit Algorithmen. Computer funktionieren nach binären Regeln, sie haben eine klare Struktur und eine logische Sprache und müssen nicht erst mühsam entschlüsselt werden. Maschinen sind berechenbarer als Menschen. »Wir bekommen unglaublich viele Bewerbungen, seit wir unseren Plan publik gemacht haben«, sagt Anka Wittenberg, Chief Diversity Officer bei SAP und verantwortlich für das Autismus-Programm. In den Büros im indischen Bangalore habe der Konzern schon einige Erfahrung gesammelt. Dort arbeiten Autisten seit zwei Jahren, »sie sind so weit integriert, dass sie mittlerweile selbstständig zur Arbeit kommen können, ohne dass sie von Familienmitgliedern begleitet werden müssen. Stellen Sie sich diesen Freiheitsgewinn vor«, sagt Wittenberg. SAP profitiert von den Neuen, weil Autisten oft »ein fotografisches Gedächtnis haben und Fehler sehr schnell erkennen«, sagt die Managerin. Zum Beispiel entdecken sie kleinste Fehler in seitenlangen Programmcodes besser als andere. Autisten üben auch solche Tätigkeiten überdurchschnittlich gut aus, die sich sehr oft wiederholen. Außerdem habe sich das Betriebsklima gewandelt. »Menschen mit Autismus verstehen keine Ironie und keinen Sarkasmus, sie benötigen eine klare Kommunikation. Dies kommt allen Mitarbeitern zugute. Seit die Teams gemischt sind, geht man höflicher und ehrlicher miteinander um«, sagt Wittenberg. Demnächst soll das Programm auch in den SAP-Büros in Palo Alto im Silicon Valley starten. Die Gegend südlich von San Francisco wird von Firmen wie Google, Facebook und Apple beherrscht, sie gilt als Brutstätte des Nerds, jenes sozialen Sonderlings, der in analogen Dingen zwar ein Problemfall ist, im digitalen Kosmos aber ein Held. Mit komplizierten Programmcodes und Formeln jonglierend, wurde er zum Leitbild einer ganzen Generation. In der Fernsehserie Big Bang Theory wird dem Nerd ein Denkmal gesetzt. Im Silicon Valley scheint Asperger schon fast zum Gencode eines erfolgreichen Unternehmers zu gehören. The Geek Syndrome nannte das Technologiemagazin Wired den Asperger-Autismus einmal, das Computerfreak-Syndrom. Microsoft-Gründer Bill Gates werden autistische Züge zugeschrieben. Craig Newmark, der Gründer des erfolgreichen Kleinanzeigenportals Craigslist, hat einmal gesagt, die Symptome kämen ihm »auf unbehagliche Weise vertraut« vor. Peter Thiel, einer der frühen Investoren in Facebook, erzählte vor zwei Jahren im New Yorker von den besonderen Menschen im Tal der digitalen Wunder: »Sehen Sie sich all die Internetunternehmen der vergangenen zehn Jahre an«, sagt er. »Deren Führungskräfte sind alle auf irgendeine Art und Weise autistisch.« Im Valley kursiert der Witz, das ganze Internet sei von Autisten für Autisten erfunden worden. Tatsächlich gibt es in der Region überdurchschnittlich viele Menschen mit autistischen Symptomen. Die Diagnose trifft eines von 88 Kindern. Kein Zufall. Der Autismusforscher Simon Baron-Cohen hat herausgefunden, dass Das erkrankte Gehirn 201 Cambridge-Studenten, die Mathematik, Physik oder Ingenieurwesen studieren, mit größerer Wahrscheinlichkeit autistische Verwandte haben als etwa Literaturstudenten. Gerade der Umgang mit dem Asperger-Syndrom zeigt, wie produktiv es sein kann, die Definitionen des Normalen zu allen Zeiten infrage zu stellen. Vielleicht brauchen neue Zeiten neue Menschen. Es könnte ja sein, dass Erfindungen und unerwartete Entwicklungen der Arbeitswelt die Stärken der Schwachen zutage treten lassen. Dass das Anderssein sich plötzlich als evolutionärer Vorteil entpuppt. Dass als genial entdeckt wird, was eben noch als krank galt. Und dass die Verlierer von gestern die Gewinner von morgen sind. von Kerstin Bund und Marcus Rohwetter aus der ZEIT Nr. 34/2013 Coach oder Couch Über seelische Leiden wird so offen geredet wie nie. Doch ernsthaft Betroffene finden kaum richtige Hilfe. Was läuft schief? Als sich Hanna Pohl* zum ersten Mal bei ihrer Psychotherapeutin fallen lässt, hat sie noch immer das Gefühl: Eigentlich gehöre ich gar nicht hierher. Die 40-Jährige, zierlich, asymmetrischer Kurzhaarschnitt, hat viel erreicht. Sie lebt in einer schönen Altbauwohnung in Berlin und entwickelt Vermarktungsstrategien für ein globales Technologieunternehmen. Sie ist gefördert worden, gut bezahlt, war immer passioniert bei der Arbeit. Bis sich ihre Abteilung, von Schließung bedroht, in ein Haifischbecken verwandelt hat. Die Teamleiterin Pohl erlebt, wie sie »leistet und leistet«, aber im Konkurrenzkampf trotzdem »fertiggemacht und weggebissen« wird. Zwei Jahre geht das so, jetzt hat sie sich endlich einen Ruck gegeben: »Lass dir mal helfen. Rede mit jemandem nur über dich. Den Luxus gönnst du dir.« Die Geschichte klingt wie eine jener typischen Burn-out-Episoden, von denen man seit einiger Zeit überall hört und liest. Doch sie wirft eine Frage auf, die dabei selten gestellt wird und längst nicht nur gestresste Manager und Erschöpfungsgeplagte betrifft: Warum hat Hanna Pohl so lange gewartet, bis sie zu einem Therapeuten ging? Kann es sein, dass – trotz all der Berichte über ausgebrannte Fernseh- und Fußballstars – noch immer viele Menschen Hemmungen haben, sich einem »Seelenklempner« anzuvertrauen? Fehlt ihnen im Dschungel der diversen Therapieformen die Orientierung, das richtige Angebot? Zwei Hörstürze hat Hanna Pohl erlebt, bevor sie endlich Hilfe sucht. Mehrmals ist sie mit Schmerzen in der Brust beim Kardiologen gewesen, auch am Wochenende, jedes Mal ohne organischen Befund. Sie schläft schlecht, fühlt sich zu Hause wie gelähmt, bedrohlich oft überfällt sie der Gedanke: Wofür lebst du überhaupt noch? Nur die Verantwortung für ihren dreijährigen Sohn ist es, die sie hält. Die Analytikerin diagnostiziert eine schwere Erschöpfungsdepression, die auch tiefer liegende Konflikte wachgerufen hat. Nun sieht Hanna Pohl die Therapie nicht mehr als Luxus. In der Rückschau sagt sie: »Schwach und gekränkt zu sein, das war für mich und meine Welt total tabu.« Tabu? Das klingt paradox in einem Land, in dem die Selbsterfahrungskultur blüht und sogar die Arbeitsministerin öffentlich erklärt, dass »psychische Störungen« zu den »drängendsten Problemen in der Arbeitswelt« *Name von der Redaktion geändert 202 Die Welt im Kopf Das erkrankte Gehirn 203 zählen. Wie passt das zusammen? Was stimmt nicht mit unserem System der Versorgung, wenn sich jemand über Monate, ja Jahre mit einem schweren seelischen Problem quält und nicht die richtige Hilfe bekommt? Der Bedarf ist längst erkannt. Pro Jahr durchlebt ein Drittel der Bevölkerung ein psychisch bedingtes Leiden; in der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen betrifft das sogar 45 Prozent. Das haben Psychologen der TU Dresden jüngst im Auftrag des Robert-Koch-Institutes ermittelt und damit frühere Befunde bestätigt. Die Krankheitsformen reichen von Verdauungsbeschwerden bis Kopfschmerzen, Panikattacken bis Phobien, Sucht bis Depressionen. Manches Problem löst sich von selbst, andere müssen behandelt werden. 53 Millionen Krankentage gingen allein 2010 auf solche Ursachen zurück. 27 Milliarden Euro geben Arbeitgeber und Versicherungen laut dem Statistischen Bundesamt jährlich für die Behandlung seelischer Störungen aus. Diese sind in fast vierzig Prozent der Fälle die Begründung dafür, dass sich Lehrer, Manager oder Schichtleiter vorzeitig in den Ruhestand abmelden. Dennoch sagt der Hamburger Psychiater und Psychotherapeut Michael Stark: »Psychisch krank zu sein ist nach wie vor ein Stigma.« In seiner Klinik erlebt er, dass sich Patienten nicht trauen, ihren Freunden zu erzählen, wo sie sind. Auch viele Hausärzte bekommen, wenn sie eine Überweisung zum Psychotherapeuten schreiben wollen, vor allem von Männern zu hören: Ich hab doch nichts am Kopf. Bin doch nicht bekloppt. Geh doch nicht in die Klapsmühle. Viele Kranke würden sich »lieber operieren lassen, als zum Therapeuten zu gehen«, sagt Peter Henningsen, Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Technischen Universität München. Alles – bloß nicht die Seele! Auf andere Weise schauen auch Gesundheitspolitiker weg. Dem immensen Bedarf an Hilfe steht ein Engpass bei den Therapieplätzen gegenüber. Bundesweit stehen Klienten im Durchschnitt drei Monate lang auf den Wartelisten, ehe sie einen Therapeuten auch nur ausprobieren können. Hanna Pohl fasste beim ersten Versuch kein Vertrauen, suchte lange weiter nach einem passenden Helfer und musste sich dann noch einmal fast ein Jahr lang gedulden, bis sie bei der gewünschten Analytikerin unterkam. Auch die psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken könnten derzeit fast alle anbauen. Die Zahl der Menschen, die dort wegen psychischer Störungen behandelt werden, hat laut dem Krankenhausreport der Barmer GEK in den vergangenen 20 Jahren um 129 Prozent zugenommen. 1990 waren es 3,7 von tausend Versicherten, 2010 bereits 8,5. Insgesamt ist die Behandlungsrate außerordentlich gering: Nicht mal ein Drittel der Betroffenen hat sich überhaupt versorgen lassen, stellen die Forscher der TU Dresden fest; und wenn, dann häufig erst Jahre nach dem Beginn ihrer Krankheit. Nur etwa zehn Prozent bekommen früheren Studien zufolge die Therapie, die ihrer Diagnose angemessen wäre. »Skandalös« findet Rainer Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, diese Unterversorgung. Verantwortlich dafür 204 Die Welt im Kopf sei nicht zuletzt ein langjähriges politisches Desinteresse an dem Thema. Auch das lasse sich als Ausdruck eines Stigmas interpretieren. Ob wirklich überall neue Kapazitäten Psychisch krank fehlen, ist unter Experten umstritten. Dazu zu sein gilt als Stigma: sind die Informationen über das, was in Ich habe doch nichts am den Praxen und Kliniken geschieht, oft zu Kopf. Bin doch nicht ungenau und die Unterschiede in der Verbekloppt. Geh doch nicht in sorgungslage viel zu groß. Beispielsweise die Klapsmühle. wartet man in ländlichen Regionen länger auf einen Therapieplatz als in Großstädten, im Ruhrgebiet oder im Osten länger als im Süden. Sicher aber ist: Die vorhandenen Angebote werden häufig nicht bedarfsgerecht vergeben. Längst nicht jeder Hilfesuchende landet bei dem Therapeuten, den er eigentlich brauchte. »Eine vergleichbare Lage in der somatischen Medizin würde niemand tolerieren«, vermutet der Psychiater Michael Welschehold vom psychiatrischen Krisenzentrum Atriumhaus in München. Ein Grund für die Misere sind ausgerechnet die verstärkten Debatten um schwammige, aber psychologisch nicht definierte Syndrome wie Burn-out oder Mobbing. Die führen dazu, dass der Ansturm auf die Psychotherapie-Praxen steigt – und dass oft nur die Durchsetzungsfähigsten einen Therapieplatz erobern, wie die Psychologin Katja Salkow von der Berliner Salus-Ambulanz beschreibt: »Klienten mit einer schwerwiegenden Diagnose, die einen Therapieplatz viel nötiger hätten, werden oft weitergeschickt.« Michael Welschehold bestätigt: »Nicht jeder, der sich ausgebrannt und erschöpft fühlt, ist auch im engeren Sinne psychisch krank und behandlungsbedürftig.« Oft brauchten diese Menschen eher vielfältige Lebenshilfe als eine Analyse oder Medikamente. Sie nehmen den Schwerkranken die Plätze weg. Offensichtlich passen also die Seelenlage der Nation, deren öffentliche Wahrnehmung und die Konzepte, sie zu stabilisieren, nicht mehr zusammen – auf Kosten der Schwächsten. Dabei werden psychische Leiden so verständnisvoll verhandelt wie nie zuvor. »Auch die Schönen und Reichen haben oft verletzte Seelen«, stellt zum Beispiel die Bunte mitfühlend fest und schildert episch, wie selbstverständlich Carla Bruni ihre Selbstzweifel offenbart oder Mr. and Mrs. Obama ihre Ehekrisen zum Therapeuten tragen. Als Hanna Pohl ihr Depressionsproblem einem Bekannten anvertraute, beruhigte der sie sogar schulterklopfend: »Ist doch schon fast ein Makel, wenn man noch nicht zum Psycho geht!« Menschen aber, die gravierende Krankheiten wie Sucht, Schizophrenie oder Psychosen durchleiden, bleiben stigmatisiert; die Ablehnung ihnen gegenüber hat sich sogar leicht verstärkt, fand eine Forschungsgruppe der Universität Greifswald Das erkrankte Gehirn 205 für mehrere westliche Länder, auch Deutschland, heraus. Derart psychisch Erkrankte will eine deutliche Mehrheit weder als Nachbarn noch anderweitig in der Nähe haben. »Je fremder und unberechenbarer, desto weniger«, sagt Georg Schomerus, einer der Autoren der Studie. Auch Martina Mayer* kennt die bohrende Sorge, »dass die Nachbarn tuscheln könnten: Jetzt ist sie ganz verrückt«. Die 38-Jährige hat seit Langem Angst- und Essstörungen. Ob diese Leiden Ursache oder Folge ihres beruflichen Scheiterns sind, ist schwer zu sagen. Klar ist: In ihrem 500-Seelen-Dorf in Brandenburg findet die gelernte Altenpflegerin keine Arbeit mehr. Dabei unternimmt sie seit Jahren immer neue Bewerbungsanläufe, als Übersetzerin, in einem Fotoladen – und hat immer wieder Pech. Als Alleinerziehende, die wegen ihrer Diabeteserkrankung nicht alles machen kann, habe sie es einfach besonders schwer, sagt Mayer. Schließlich hat sie sich kaum mehr aus dem Haus getraut und ihre Verletzlichkeiten, aber auch Fähigkeiten in einem weichen Panzer aus zu vielen Kilos verschanzt. Jahre hat es gedauert, bis sie sich endlich zu einer Psychotherapie entschlossen hat. Doch das wird sie nur ihren Eltern erzählen: »Glauben Sie denn, dass die Gesellschaft schon so weit ist?« Tatsächlich kommt zu den persönlichen Gefühlen von Scham und Schuld oft die Angst hinzu, ausgegrenzt zu werden. Schließlich gibt es bei psychischen Krankheiten noch immer Vorurteile und eine Missachtung, die bei körperlichen Erkrankungen unmöglich wäre. Da lehnt die private Krankenkasse es ab, die Kosten für den Psychotherapeuten zu übernehmen. Da zögert der Staat, Bewerber zu verbeamten, wenn sie einmal in einer Therapie waren. Jugendliche beschimpfen sich in der U-Bahn: Du Schizo, Depri, Psycho! Ein Kollege geht lieber zum Coach – das klingt nicht so peinlich wie die Couch. In mehr als der Hälfte der Fälle zögerten selbst Familienmitglieder und Freunde, denen sich Betroffene anvertrauten, einen Psychotherapeuten zu empfehlen, schreibt das Autorenteam einer Studie der Universität Leipzig. Während für regelmäßige Besuche im Fitnesscenter Bonuspunkte bei der Kasse diskutiert werden, gilt ein Selbsterfahrungswochenende in der Psychoklinik eher als verdächtiges Unterfangen denn als gesundheitliche Prävention. Das Tabu greift unterschiedlich stark. Bei Männern, in der älteren Generation, auf dem Land und in toughen Managementetagen wirkt es in der Regel stärker als bei Frauen, jüngeren Leuten, in sozialen Berufen, in der Stadt. In jedem Falle erschwert es die Lage der Betroffenen, weil sie im Verborgenen leiden. Und je länger wiederum eine seelische Erkrankung beiseitegeschoben wird, desto komplizierter kann sie sich entwickeln. Die Eskalationen treiben die Behandlungskosten in die Höhe. Martina Mayer etwa hat über die Jahre zusätzlich zu ihrer Angst alle möglichen psychosomatischen Störungen ausgeprägt, die teils chronisch wurden. Auch Hanna Pohls Zustand wäre womöglich nicht so dramatisch geworden, hätte ein Arzt sie früher zum Therapeuten überwiesen. Gegen die Depression musste sie fast zwei Jahre lang Psychopharmaka einnehmen. 206 Die Welt im Kopf Dabei ist die Wirksamkeit der Psychotherapie selbst für erhebliche Störungen längst nachgewiesen. Dass vielen der Gang zum Therapeuten dennoch so schwerfällt, erklärt der Greifswalder Psychologe Georg Schomerus auch mit Veränderungen der wissenschaftlichen Deutung. In den sechziger bis achtziger Jahren, als gesellschaftskritische Psychoanalytiker wie Alexander und Margarete Mitscherlich oder Horst-Eberhard Richter die »Geisteskrankheit« enttabuisierten und die »Antipsychiatrie«-Bewegung die Würde der diskriminierten »Verrückten« verteidigte, wurden psychische Störungen auf soziale Ursachen zurückgeführt. Schuld waren die autoritäre Gesellschaft, die sexuellen Tabus, der »Leistungsdruck«, die »Konsumgesellschaft«. Heute sprechen mehr und mehr Psychologen von einem komplexen »biopsychosozialen« Zusammenhang. Doch in den vergangenen Jahrzehnten standen die genetischen Prägungen besonders im Fokus der Ursachenforschung, oder man untersuchte minutiös chemische Vorgänge im Gehirn, um bessere Psychopharmaka entwickeln zu können. In den Gesundheitsrubriken populärer Zeitschriften zeigten bunte Bilder die aktiven zerebralen Areale. Diese »Biologisierung«, sagt Schomerus, habe psychische Krankheiten leider nicht – wie erhofft – durch Wissen entdämonisiert. Im Gegenteil, das Stigma des Schicksalhaften, Dunklen, Unberechenbaren sei eher noch verstärkt worden. Bei vielen Patienten macht sich die fatalistische Haltung breit: Es liegt an mir. Dazu kommt der allgegenwärtig signalisierte Zwang zum individuellen Erfolg, dessen Druck sich auch Hanna Pohl irgendwann nicht mehr gewachsen fühlte. In den scripted reality-Shows im Fernsehen habe sie nur die zwei Extreme gesehen: »Germany’s Top-Erfolgreiche – oder die Verlierer und Versager«. Da muss im Privatleben alles stimmen; zugleich wird die berufliche Anerkennung immer wichtiger für das Selbstwertgefühl. Fehlt die Wertschätzung am Arbeitsplatz, obwohl man sich ständig anstrengt, führt das besonders häufig zu seelischen Krankheiten. Untersuchungen belegen, dass die mangelnde Bestätigung dann schädlicher ist als der reine Arbeitsstress. Wenn zudem die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben verschwimmen, weil man in Teams enger zusammenarbeitet und per Handy ständig erreichbar ist, wachsen die Hemmschwellen erst recht, sich und anderen einzugestehen, dass man am Anschlag ist. »Mein Chef, der mich tagsüber demütigte und hinterging, rief abends bei mir zu Hause an, um seine Sorgen bei mir abzukippen«, erzählt Hanna Pohl. Die Debatte über Burn-out hat zwar einerseits mehr Akzeptanz für seelische Leiden geschaffen. Andererseits wird schon sprachlich sorgsam das Stigma der Depression vermieden, die oft hinter der Erschöpfung liegt. »Sogar die Krankheit muss man sich noch durch Leistung verdienen«, sagt Georg Schomerus, »darf man nicht einfach krank sein?« In so einem Klima werde den arbeitslosen und ärmeren Menschen umso mehr unterstellt, sie seien selbst an ihrer seelischen Erkrankung schuld, schreiben die Psychologin Irene Kühnlein und der Wirtschaftssoziologe Gerhard Mutz in einer Studie über den Wandel der Psychotherapie. Das erkrankte Gehirn 207 Martina Mayer scheint das verinnerlicht zu haben: »Es gibt die Starken und die Schwachen. Zu den Starken gehöre ich nicht.« Für sie ist es nur ein schwacher Trost, wenn Arbeitsministerin Ursula von der Leyen »mit höchster Priorität« nach Lösungen für das Problem der psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz suchen will – denn dabei geht es ja vorwiegend um jene, die unter einem Zuviel der Anforderungen leiden. Doch fast noch schlimmer ist es in einer Leistungsgesellschaft, aus dem Arbeitsprozess ganz herauszufallen. Arbeitslose bekommen in Deutschland etwa doppelt so häufig psychische Probleme wie Berufstätige. Ihre oft langwierigen Qualen haben weit weniger Glamour als das Burn-out eines Prominenten. Immerhin: Eine Suchbewegung hat begonnen, um in der widersprüchlichen Situation zwischen Psycho-Boom und Psycho-Tabu neu zu klären: Wer gilt als krank und wer als gesund? Wem sollen die Gesundheits- und Sozialsysteme helfen? Und wie werden die Mittel gerechter verteilt? Bislang gehen vor allem Fachkreise diesen Fragen nach, und angesichts der ungenauen Datenlage drohten »Willkür« und »politischer Kuhhandel«, wenn jetzt über neue Versorgungsstrukturen nachgedacht werde, kritisiert der Psychologe Hans-Ulrich Wittchen, der die Untersuchung an der Technischen Universität Dresden geleitet hat. Schon weisen sich unterschiedliche Berufsgruppen gegenseitig die Schuld zu. Da werfen Psychiater den Psychotherapeuten vor, sie kümmerten sich nur um die leichteren, bequemeren Fälle sich selbst bespiegelnder Mittelschichten; die Therapeuten Ein Drittel der kontern, Psychiater verdienten schnelles Geld Bevölkerung durchlebt mit Medikamentenrezepten im Minutentakt. pro Jahr ein psychisch Hinter dem Streit stecken knallharte Verteibedingtes Leiden. lungskämpfe, die womöglich erneut auf KosDoch es mangelt an ten der sozial Schwächsten gehen. Schon jetzt geeigneten Therapiewerden viele Psychologen lieber Coach, weil plätzen. man mit Beratung besser verdient; Unternehmen schließen angesichts der langen Wartelisten langfristige Verträge mit Therapeuten, um sich eine schnelle Betreuung für ihre Mitarbeiter zu sichern. Denn zumindest in den großen Firmen ist – schon wegen der hohen Krankheitskosten – einiges in Bewegung geraten. Gesundheitsabteilungen versuchen, Führungskräfte zu sensibilisieren, zur Vorbeugung sollen Arbeitszeiten flexibler gestaltet oder Mitarbeiter an Entscheidungen beteiligt werden. »Wenn Betriebsärzte jemals ernst genommen wurden, dann heute«, sagt die Arbeitsmedizinerin Marianne Engelhardt-Schagen. Wichtig sei, nicht bei der Verhaltensprävention stehen zu bleiben, sondern die Verhältnisse zu verbessern. »Seelische Störungen sind nicht nur ein persönliches, sondern auch ein strukturelles Problem. Es kann einfach nicht sein, dass so viele scheitern.« 208 Die Welt im Kopf Beim Blick auf die Versorgungsstrukturen ist kaum mehr strittig, dass sich Hausärzte, Fachärzte und Kliniken besser koordinieren müssen, um flexibler auf die einzelnen Klienten eingehen zu können. Einige Therapeuten schlagen eine Sprechstunde wie beim Hausarzt auch für Psychotherapeuten vor; sie würde mehr kurze Gesprächsinterventionen ermöglichen als die zigstündige Behandlung nach langwierigen Genehmigungsverfahren. Eine größere Vielfalt an Beratungsstellen müsse geschaffen werden, die Menschen in seelischen Notlagen kurzfristig helfen oder an die richtigen Stellen lotsen können. Beispiele dafür sind die psychiatrischen Krisenambulanzen in Berlin und München. Oder die psychologische Salus-Ambulanz in Brandenburg: Dort wird eine intensive Zusammenarbeit mit Arbeitsämtern und Suchtkliniken erprobt. Im Rahmen dieses neuen Modells empfahl eine aufmerksame Betreuerin des Jobcenters auch Martina Mayer, eine psychologische Beratungsstelle in Potsdam aufzusuchen, damit sie seelisch stabiler wird und sich ihre Vermittlungschancen erhöhen. Die Gespräche in der Salus-Ambulanz haben Mayers Blick für die eigenen Lebensumstände und Verhaltensmuster allmählich geschärft, und ihre Entscheidung reifte, trotz aller Ängste und Vorurteile nun doch eine Psychotherapie in Angriff zu nehmen. Damit wuchs auch die Hoffnung, dass sie noch einmal eine Chance bekommt: »Das Reden hilft mir.« Auch Hanna Pohl geht es heute besser. Sie habe sich davon befreit, sagt sie, »ständig äußeren Anforderungen gerecht zu werden und dabei die eigenen Bedürfnisse und Stärken gar nicht mehr zu erkennen«. Aber ihre Stelle habe sie dafür erst kündigen müssen, und freiberuflich zu arbeiten bringe natürlich weniger Geld und Sicherheit. »Wäre ich früher zur Therapeutin gegangen«, glaubt Hanna Pohl heute, »dann hätte ich mich vielleicht innerhalb des beruflichen Gefüges behauptet – und nicht so einen hohen Preis bezahlt.« von Christiane Grefe aus der ZEIT Nr. 28/2012 Das erkrankte Gehirn 209 5. Das alternde Gehirn Am 3. November 1906 stellt der Psychiater Alois Alzheimer auf einer Tagung in Tübingen seinen Kollegen erstmals die »Krankheit des Vergessens« vor. Seit mehr als hundert Jahren versuchen Forscher, die Demenz zu verstehen. Warum gibt es die Krankheit überhaupt? Was entscheidet darüber, ob ein Mensch dement wird? Die Antwort fehlt. Eine wirksame Therapie gegen Alzheimer gibt es nicht. Aber der Blick auf die Krankheit wandelt sich. 210 Die Welt im Kopf Ist Alzheimer angeboren? Der Weg ins Vergessen beginnt mit der Geburt: Eine Hypothese zur Ursache des Hirnleidens Es scheint kein Kraut gewachsen gegen das Zellsterben im Gehirn, das den Menschen erst ihr Gedächtnis, dann ihre Selbstständigkeit, schließlich ihr Ich raubt. Alzheimer ist nicht zu heilen, der Verlauf kaum zu bremsen. Die großen Pharmakonzerne haben mit neuen Wirkstoffen reihenweise Schiffbruch erlitten. Eine hochgelobte Substanz nach der anderen fiel in klinischen Studien durch. Trotz dieser herben Rückschläge gehen die Tests weiter. Bei den Medizinern wächst die Überzeugung, dass ihre Arzneien durchaus effektiv wären – wenn man sie nur früh genug einsetzte, nämlich lange bevor die Patienten handfeste Symptome zeigen. Über die Erfolgsaussichten dieser Bemühungen kann man nur spekulieren. Denn das Grundrätsel der Alzheimerkrankheit ist ungelöst: W ­ arum gibt es das Leiden überhaupt? Wieso verdämmern manche Menschen mit 70 Jahren im Vergessen, während andere mit 95 noch rüstig und rege sind? Gesucht wird so etwas wie ein Zündmechanismus, der darüber entscheidet, ob ein Mensch irgendwann in seinem Leben demenzkrank wird oder nicht. Ist es in dieser Lage denkbar, dass die Variablen dieser Alzheimerformel tatsächlich schon alle auf dem Tisch liegen? Dass sie nur noch zusammengesetzt werden müssen zu einer schlüssigen Erklärung für jene Tragödie, die jedes Jahr Tausende Familien in Deutschland trifft? Einfache Erklärungen sind in der Medizin selten die richtigen. Dennoch – dieser Artikel wagt eine Hypothese. Stimmt das Gedankenspiel, ist ein Jahrhunderträtsel gelöst. Es gibt keine wissenschaftliche Veröffentlichung, in der die Hypothese so vorgedacht wird und auf die sich dieser Artikel berufen könnte. Analysen und Experimente, um die Idee zu bestätigen oder sie zu widerlegen, stehen noch aus. Doch starke Indizien existieren. Was die Lösung für das Rätsel Alzheimer sein könnte, findet sich in einer Spurensuche; in Etappen führt sie querbeet durch die Welt der neuromedizinischen Forschung. Das alternde Gehirn 211 Die Saat Was den Untergang der Nervenzellen bewirkt, ist den Wissenschaftlern inzwischen ziemlich klar: Es sind toxische Fragmente eines Eiweißmoleküls, sie heißen A-beta. Schreitet die Krankheit fort, verklumpen sie zu Amyloid-Plaques, den typischen Ablagerungen, die Pathologen in geschrumpften Hirnen von Alzheimerpatienten finden. Doch der Niedergang der Neurone beginnt Jahrzehnte bevor die Patienten erste Symptome zeigen. Ganz neu ist die Erkenntnis, dass dafür wohl nicht die auffälligen ­Plaques verantwortlich sind, sondern unsichtbar winzige Aggregate aus nur wenigen A-beta-Molekülen. Man nennt sie seed, die Saat. Mit Tierexperimenten haben der Tübinger Neurowissenschaftler Mathias Jucker und sein amerikanischer Kollege L ­ ary Walker die Pio­nier­arbeit bei der Erkundung der seed geleistet. Die besitzt eine fatale Eigenschaft – ihre Moleküle haben eine fremde, eine bösartige Gestalt angenommen. Und sie sind infektiös: Treffen sie auf normal geformte A-beta-Moleküle, dann zwingen sie auch diesen die gefährliche Form auf (ZEIT Nr. 3/12). So verbreiten sie sich wie ein virulenter Erreger. Sie zerfressen das Nervengewebe, so wie der Rinderwahnsinn BSE das Gehirn der Kuh, wie Scrapie das des Schafs und wie die Creutzfeldt-JakobKrankheit (CJD) das des Menschen. »Im Hirngewebe ist die seed infektiös«, sagt Jucker, der für seine Forschungen gerade mit dem Hamburger Wissenschaftspreis ausgezeichnet wurde. »Das heißt aber nicht, dass die Patienten für andere Menschen ansteckend wären.« Die meisten Wissenschaftler sind inzwischen davon überzeugt, dass Alzheimer wie Scrapie, BSE oder CJD zu den Hirnleiden gehört, die durch infektiöse Proteine (Prionen) ausgelöst werden, die sich wie ein Schwelbrand im Nervensystem ausbreiten. Langsam, aber nicht aufzuhalten. Die Lehre des Downsyndroms Woher aber stammt der Zündstoff, und wer hält die Lunte? Wieso entstehen die infektiösen Ei­weiße überhaupt? Bei der Suche nach Antworten stößt man auf Menschen mit dem Downsyndrom. Sie können eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome aufweisen, und sie sind mehr oder weniger stark geistig behindert. Infolge der besseren medizinischen Versorgung ist die Le­bens­erwar­tung von Downpatienten deutlich gestiegen. Seither beobachten die Neurologen etwas Neues: Downpatienten entwickeln sehr häufig nach dem 40. Lebensjahr eine Demenz vom Alzheimertypus. Dieses Zusammentreffen ist nicht überraschend: Das Downsyndrom entsteht durch eine Chromosomenstörung; die Betroffenen besitzen ein drittes, überzähliges Chromosom 21, auch in ihren Hirnzellen. Und just das Chromosom 21 trägt die genetische In­for­ma­tion für das Eiweiß A-beta. Sind drei Kopien dieses 212 Die Welt im Kopf Gens vorhanden, wird zu viel A-beta produziert, die Moleküle nehmen leichter die toxische Gestalt an und starten ihr Zerstörungswerk. Dass die dreifache Gendosis für die Alzheimerkrankheit bei Downpatienten verantwortlich ist, gilt als sicher. Es gibt nämlich auch Menschen, die zwar kein drittes Chromosom 21 besitzen, sondern bei denen »nur« der betreffende Genabschnitt auf diesem Chromosom verdoppelt ist. Auch sie tragen die Gen­ infor­ma­tion für A-beta dreifach in sich. Und auch diese Menschen erkranken sicher an Demenz. Der Fluch der Familien Es gibt Familien, in denen Alz­hei­mer-­Demenz vererbt wird. Wie unter einem Fluch trifft die Krankheit jede Ge­ne­ra­tion aufs Neue. Jeder zweite Blutsverwandte fällt ihr zum Opfer. Schlimmer noch: Die Symptome beginnen früh im Leben, oft weit vor dem 50. Lebensjahr. In Frankreich sind über 100 betroffene Fa­mi­lien bekannt, in Deutschland gibt es wohl noch mehr. Unterschiedliche Veränderungen in drei Genen (den sogenannten Alzheimer-Genen APP, PS1 und PS2) können für diese frühe familiäre Alzheimer-Demenz (FAD) verantwortlich sein; wer sie geerbt hat, bildet früh im Leben zu viel A-beta und wird unweigerlich erkranken. Offenbar wirkt die Über­pro­duk­tion wie ein Brandbeschleuniger, der die Verwandlung von A-beta in ein toxisches Prion erleichtert – in die Saat. Das sind Extremfälle. Die weitaus meisten Alzheimer-Opfer jedoch, über 99 Prozent, sind älter als 60 Jahre, wenn sie erkranken. Woher stammt die Saat bei ihnen? Es gibt eine Verbindung zwischen der seltenen, vererbten und der üblichen, spontanen und spät einsetzenden Variante der Krankheit. Sie findet sich in den furchtbaren Schicksalen einer Mutter und ihrer Tochter. Eine Tragödie in England John Collinge ist Prionforscher. Er leitet die Abteilung für Neurodegenerative Krankheiten des University College London am Queens ­Square. Als der Rinderwahnsinn in Großbritannien grassierte, war Col­linge einer der am heftigsten von den Medien belagerten BSE-Experten. Es ist kein Zufall, dass er, wie viele seiner Kollegen aus der Prion­szene, intensiv in der Alzheimerforschung mitmischt. Bei Col­linge begann es mit der Tragödie einer Familie, über die er bereits 2004 berichtet hatte. »Heute ist das von viel größerem Interesse.« Viele Jahre zuvor war – nennen wir sie Edna Miller, vielleicht aus einem kleinen Ort unweit Londons, mit erst 42 Jahren von den ersten Symptomen einer unheimlichen, fortschreitenden Nervenkrankheit befallen worden. Bald litt sie unter Lähmungen und ausgeprägter Demenz. Zunächst konnten Col­linge und seine Mitarbeiter in den Blutproben der Frau keinen der bekannten Erbdefekte für Alzheimer aufspüren. Nach 16-jähriger Leidenszeit starb Edna Miller mit 58 Das alternde Gehirn 213 Jahren. Nach ihrem Tod entdeckten die Forscher im Hirn das typische Bild der Alzheimer-Demenz – ausgebranntes Nervengewebe, durchzogen von Plaques. Zu dieser Zeit war auch Ednas Tochter, Alice mag sie geheißen haben, bereits schwer krank. Bei ihr hatte es schon im Alter von 27 Jahren begonnen, die Symptome unterschieden sich von denen ihrer Mutter, doch auch Alice litt unter Lähmungen und fortschreitender Demenz. Sie starb noch vor ihrem 40. Geburtstag. Alice, stellte Collinges Team fest, war das Opfer der früh einsetzenden, erblichen Variante des Alzheimerleidens mit krassem Verlauf: Sie hatte von ihrer Mutter Edna einen Defekt im Gen PS1 geerbt, der Alzheimer auslöst. Bei genauen Untersuchungen in Geweben der Mutter stießen die Londoner Wissenschaftler auf die Lösung des Rätsels. Ednas Schicksal hatte sich bereits in den ersten Tagen ihres Lebens entschieden, als sie noch ein Embryo im Mutterleib war. Bei einer Zellteilung trat der Fehler im PS1-Gen auf. Die mutierte Zelle teilte sich weiter, und ihre Nachkommen verteilten sich in den keimenden Organen und Geweben. Edna wurde zu einem genetischen Mosaik. Manche ihrer Körperzellen trugen die gefährliche Erbanlage – auch jene Eizelle, aus der ihre Tochter Alice entstehen sollte. Bei der Mutter entdeckten Collinge und seine Mitarbeiter den Defekt in jeder zwölften Blutzelle. Das Verhängnis aber lauerte in Ednas Großhirn – etwa 14 Prozent der Nervenzellen waren von der Mutation im Alzheimer-Gen betroffen. Hatte die verstreute Zellpopulation so viel tödliches A-beta in Marsch gesetzt, dass Edna Millers frühe Demenz programmiert war? Wenn die Antwort Ja lautet – und die Wissenschaftler halten das für gesichert –, dann stellt sich eine beunruhigende Frage: Könnte es sein, dass die vielen Patienten mit der häufigen, der späten Form des Leidens einem ähnlichen Verhängnis anheimfallen? Dass auch sie solche genetische Muster im Hirn tragen, die ihnen das Leiden vorherbestimmen? Das Ich, ein Mosaik Erst seit kurzer Zeit kann man vermuten, dass Edna Miller nur Pech hatte. Vor wenigen Wochen haben die neuesten Befunde eines Teams um den Neurowissenschaftler Fred Gage und des Neurogenetikers Alysson Muotri zu einer alarmierenden Erkenntnis geführt: Jeder noch so gesunde Mensch trägt ein höchst komplexes Patchwork im Kopf. In ihrer Erbinformation gleicht keine Nervenzelle eines Menschen der nächsten – manche Neurone besitzen überzählige Chromosomen, viele haben reihenweise genetische Information verloren, andere zuhauf vervielfacht; springende Gene können sich im Erbgut von Hirnzellen frei bewegen und ebenso ungehindert Unheil anrichten. Manche Forscher sehen in dieser genetischen Vielfalt des Hirngewebes und seiner Schaltkreise sogar eine Basis für die individuelle Personalität. Womöglich liegt hier aber auch der Ursprung der Demenz. In genetischen Veränderungen in Zellmosaiken; in Mustern aus zwei, drei oder zehn Prozent der Hirnzellen, die Alzheimer-Gene tragen und schließlich die Demenz auslösen. Bei der Suche nach Belegen für diese Vorstellung stößt man auf alte Forschungsarbeiten, die schon beinahe vergessen waren. Zusammen mit Fred Gages aktuellen Befunden zeigen sie, was Downpatienten, was Edna Miller und die vielen Kranken mit spät einsetzendem Alzheimerleiden verbinden könnte: Im Hirn jedes Menschen, auch jedes gesunden, gibt es viele Nervenzellen mit fehlenden Chromosomen (Monosomie) oder eben mit überzähligen (Trisomie). Vielleicht sind nur ein oder zwei Prozent betroffen. Aber selbst das würde zwei Milliarden Zellen bedeuten, die seed produzieren. Bei verstorbenen Alzheimerpatienten wurden sogar über zehn Prozent Neurone mit Trisomie 21 gefunden. »Als Erste haben das russische Kollegen schon Ende der 1960er Jahre veröffentlicht«, sagt der Neuroforscher Thomas Arendt vom Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung in Alzheimer: Wissenschaftler unterscheiden drei mögliche Formen der Entstehung. Die Tragödie des Vergessens aber ist die gleiche. Downsyndrom – Menschen mit Trisomie 21 tragen das Chromosom 21 dreimal und damit auch die Gene für das Eiweiß A-beta: Es wird vermehrt in giftiger Form produziert 214 Die Welt im Kopf Erblicher Alzheimer – Patienten tragen mutierte Gene APP, PS1 oder PS2 in allen Zellen, es entsteht viel toxisches A-beta. Vom 40. Lebensjahr an erkranken alle Betroffenen Alters-Alzheimer – Nur einzelne Hirnzellen tragen Mutationen. Diese produzieren die giftige A-betaVariante, die im Hirn ansteckend ist. Die Krankheit tritt spät auf Das alternde Gehirn 215 Chromosom Neurone betroffen sind, wie bei den seltenen erblichen Fällen, dann beginnen die Symptome schon mit Anfang 40. Wer hingegen sehr wenige gestörte Zellen im Gehirn hat, wird nie Anzeichen für Alzheimer entwickeln – oder, bei utopischer Lebenserwartung, erst mit 130 Jahren. Erkranken werden Menschen also insbesondere dann, wenn die rasante Zellteilung während der embryonalen Entwicklung des Gehirns zu viele Nervenzellen mit einem genetischen Alzheimer-Defekt erzeugt hat. Oder dann, wenn sich diese Zellen zufällig an einem besonders anfälligen Ort im Hirn versammeln, an dem das große Nervensterben normalerweise beginnt: im Nucleus coeruleus oder dem entorhina len Kortex. Alzheimer im Alter PS1 PS2 Wie genetisch geschädigte Neurone einen Flächenbrand im Hirn verursachen 21 1, 14 Wenn das Gen für das Amyloid-Precursor-Protein (APP) verdoppelt (Trisomie 21) oder durch eine Mutation verändert wurde, entsteht aus dem APP-Protein zu viel schädliches A-beta. Die beiden Gene PS1 und PS2 enthalten die Informationen für ein Enzym, das das APP-Eiweiß in A-beta umwandelt. APP-Gen e e Enzym APP Nerven-Zelle Immer mehr Hirnzellen werden durch Aggregationen von A-beta vergiftet. Das Zellsterben im Hirn kommt ins Rollen e N e e e R EL L K E en Z 46 A-beta e Ch ro m o s o m Das Enzym spaltet A-beta aus dem APPProtein heraus. Mutationen in den Genen PS1 oder PS2 verändern die Enzymaktivität und verstärken die Bildung der toxischen Form des A-beta A-beta ... kommt es zur Umwandlung in toxisches A-beta. Das gefährliche Eiweiß vermehrt sich in einer Kettenreaktion Bei der Begegnung mit normalen A-beta ... Das A-beta spaltet sich ab und wandert Leipzig, der sich mit dem Phänomen schon ein halbes Forscherleben lang beschäftigt. »Aber die Publikationen waren auf Russisch, das hat natürlich kein Mensch gelesen.« Auch wenn es im Detail noch Ungereimtheiten gibt – Arendt und eine Reihe anderer Forscherteams haben diese Befunde inzwischen mehrfach bestätigt. Bis zur Entdeckung der infektiösen Natur des aggregierten A-beta hatte sich nie erklären lassen, wie eine kleine Schar unter den 100 Milliarden Hirnzellen so viel toxisches Beta-Amyloid auswerfen könnte, dass schließlich das Gehirn der zerstört wird. »Der Dosiseffekt ist viel zu gering«, sagt etwa Konrad Beyreuther, ein alter Recke der Alzheimerforschung. Nun aber, mit der Erkenntnis, dass sich die Saat selbst vermehren und dabei in immer größere Areale des Großhirns vordringen kann, gäbe es eine Erklärung für das große Enigma. Einfach gesprochen: Je mehr Nervenzellen mit Alzheimer-Defekten ein Mensch im Hirn besitzt, desto mehr prionartiges A-beta wird er bilden. Und desto früher wird er erkranken. Wenn alle seine 216 Die Welt im Kopf fazit All dies ist erst eine Hypothese. Doch erweist sie sich als stimmig, wird sie erhebliche Konsequenzen haben. Etwa: Alzheimer wäre dann komplett schicksalhaft. Menschen würden, gerade frisch geboren, bereits den Weg in die Demenz antreten. Und: In ganz ähnlicher Form könnten so auch andere neurodegenerative Leiden erklärt werden, vor allem die Parkinsonkrankheit. Erst heute verfügen die Genomexperten über Verfahren, die ihnen die Suche nach genetischen Mosaiken im Hirn erlauben: Mit Erbgutanalysen einzelner Nervenzellen können die Wissenschaftler im Hirn von verstorbenen Patienten nach verstreuten Neuronen mit Alzheimer-Gendefekten fahnden. Tatsächlich hat die Mosaik-Hypothese in der Forscherszene Resonanz erzeugt. »Wir diskutieren die Idee bereits«, sagt der Münchner Demenzexperte Christian Haass, eine der führenden Figuren am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Für die Wissenschaftler wäre eine Bestätigung der Mosaik-Hypothese jedoch keineswegs eine Revolution oder die Aufforderung, umzudenken. Sie wäre vielmehr eine weitere Bestätigung, dass man bei der Strategie für eine erfolgreiche Therapie auf dem richtigen Weg ist. Und dass sich langer Atem lohnt. Die Mediziner müssen nun Wege finden, um die Prionen im Hirn früh zu stoppen und das Hirn vor der Zerstörung zu retten. Diese Arbeit hat bereits begonnen: Derzeit werden gescheiterte AlzheimerMedikamente erneut getestet. Man kann heute Probanden therapieren, bei denen Alzheimer noch gar nicht ausgebrochen ist. Das sind die Menschen, die erblich mit Alzheimer-Mutationen belastet sind und bei denen der Ausbruch der Krankheit als sicher gelten darf. Gelingt es, die Alzheimerkrankheit bei diesen Menschen zu verhindern oder wenigstens zu verzögern, dann sollte das auch bei allen anderen Patienten möglich sein. Vorausgesetzt, man lernt, wie man das nahende Leiden rechtzeitig erkennt. von Ulrich Bahnsen aus der ZEIT Nr. 3/2014 Das alternde Gehirn 217 Stichwort Das alternde Gehirn Wenn wir älter werden, baut das Gehirn langsam ab, und das geht gewöhnlich mit einem Nachlassen der geistigen Funktionen einher. Neue Studien sprechen jedoch dafür, dass das Gehirn funktionelle Veränderungen durchmacht, die die altersbedingte Degeneration kompensieren können, und wir beginnen gerade zu verstehen, wie eine gewisse Lebensweise hilft, dem Zahn der Zeit besser zu widerstehen. 218 Die Welt im Kopf Wir alle fürchten den Abbau geistiger Fähigkeiten im Alter und sind mit dem pessimistischen Bild dessen vertraut, was an unserem Lebensabend geschieht. Allgemein wird angenommen, dass unsere geistigen Fähigkeiten mit Ende zwanzig auf ihrem Höhepunkt sind und es von da an nur noch bergab geht – dass das Gehirn unwiderruflich abbaut, was zu beeinträchtigtem Denkvermögen und möglicherweise zu seniler Demenz führt. Zum Glück ist dieses Bild nicht ganz richtig. Etwa ab dem 50. Lebensjahr beginnt das Gehirn, langsam abzubauen, doch auch wenn jüngere Leute ältere Menschen bei verschiedenen Tests durchweg übertreffen, entspricht das nicht unbedingt unserer Alltagserfahrung. Der Alterungsprozess wirkt sich auf verschiedene Individuen durchaus unterschiedlich aus: Viele erleben einen Abbau ihrer geistigen Fähigkeiten, wenn sie altern, doch viele andere bleiben bis ins hohe Alter geistig fit, und die meisten von uns kennen einen Menschen, der körperlich und geistig jung geblieben ist, obwohl er schon 80 Jahre oder noch älter ist. Bildgebende Verfahren wie Hirn­ scans ermöglichen uns heute Einblicke in altersbedingte Hirnveränderungen, und so hat sich im letzten Jahrzehnt ein neues, teils überraschendes Bild des alternden Gehirns herauskristallisiert. Wie es aussieht, macht das Gehirn funktionelle Veränderungen durch, um den altersbedingten Abbau zu kompensieren, und die Forscher haben sogar einige Menschen gefunden, deren Gehirn komplett immun gegen die negativen Auswirkungen des Alterungsprozesses zu sein scheint. Die Erfahrung lebe hoch! Mit zunehmendem Alter verschlechtern sich in der Regel verschiedene geistige Fähigkeiten; die bestuntersuchte davon ist das Gedächtnis. Ältere Menschen haben oft Erinnerungslücken, wenn es um das episodische Gedächtnis geht, vergessen Details, zum Beispiel, wo sie ihr Auto geparkt haben, und das liegt wahrscheinlich an Defiziten bei Codierung, Speicherung oder Abruf von Erinnerungen. In Labortests zeigen sie signifikante Beeinträchtigungen bei Aufgaben, bei denen es darum geht, seine Aufmerksamkeit rasch von einer Sache auf eine andere zu richten, sowie bei Aufgaben zum Arbeitsgedächtnis, bei denen verlangt wird, Informationen kurze Zeit zu speichern und zu manipulieren. Auf der anderen Seite haben ältere Menschen in der Regel keine Probleme mit dem semantischen (konzeptuellen) Gedächtnis, und ihr Wissen über die Welt übertrifft häufig das jüngerer Erwachsener. Zudem wurde festgestellt, dass ältere Erwachsene über mehr Empathie verfügen und sich emotional wohler fühlen als jüngere Menschen. Altersbedingte Veränderungen Altersbedingt kommt es zu verschiedenen Veränderungen in der Hirnstruktur, doch wie diese eigentlich mit kognitiven Funktionen verknüpft sind, ist bisher ungeklärt. Die auffälligste Veränderung ist ein kleiner, aber signifikanter Rückgang in der Dichte der grauen Substanz. Wenn wir altern, schrumpft die graue Substanz, vor allem im frontalen Kortex, Hippocampus, Nucleus caudatus und Kleinhirn, sodass es im Alter zwischen 20 und 90 Jahren zu einer insgesamt etwa zehnprozentigen Abnahme des Gehirnvolumens kommt. Dieser Schrumpfungsprozess geht mit dem Absterben von Zellen im Denn es ist … nicht zu glauben, daß alternd einer noch viel zu lernen vermag …; vielmehr gehören alle großen und anhaltenden Anstrengungen der Jugend. Platon, um 380 v. Chr. Stichwort 219 cerebralen Kortex einher. Einer Schätzung zufolge sterben etwa 9,5 Prozent der corticalen Zellen während dieser Zeit ab – das Äquivalent von 85 000 Neuronen pro Tag oder einem Neuron pro Sekunde; das führt zu einem Ausdünnen des Kortex und einer Reduktion in Gesamtgewicht und Oberfläche. Hirnstudien mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass es altersbedingt auch zu einer Abnahme in der Dichte der weißen Substanz kommt. Diese Abnahme findet breitflächig statt, ist aber am deutlichsten bei den Bahnen ausgeprägt, die unterhalb der Stirn-, Schläfen- und Scheitellappen verlaufen. Auch die weiße Substanz im Corpus callosum (Balken), das die beiden Hirnhälften verbindet, nimmt im Alter ab. Diese Veränderungen sind offenbar enger mit dem langsamen Abbau geistiger Fähigkeiten korreliert als der Rückgang der grauen Substanz und könnten mit der verringerten Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung in Zusammenhang ­stehen. Mit dem Alterungsprozess gehen auch verschiedene chemische Veränderungen im Gehirn einher – so zeigen viele Studien, dass wir dann weniger Dopamin produzieren. Die Zahl der Dopaminrezeptoren im ganzen Gehirn nimmt mit zunehmendem Alter ebenfalls ab, und das könnte Super Ager Amerikanische Forscher haben kürzlich eine kleine Gruppe Menschen jenseits der 80 ausgemacht, deren Gehirn offenbar dem altersbedingten Abbau trotzt. In Labortests, bei denen es unter anderem um das Memorieren von Wortlisten ging, übertrafen diese Personen – von den Forschern Super Ager genannt – andere gesunde Personen gleichen Alters und schnitten so gut ab wie gesunde 50- bis 65-Jährige. Strukturelle MRT-Scans zeigten, dass ihr Gehirn nicht die normalen Abbauerscheinungen aufweist, die gewöhnlich mit dem Alter einhergehen. Ihr Neokortex war genauso 220 Die Welt im Kopf dick wie derjenige jüngerer Erwachsener, und das Gesamtvolumen ihres Gehirns war etwa gleich groß. Besonders eine Region – der Gyrus angularis anterior – war bei den Super Agern sogar dicker als bei gesunden jüngeren Erwachsenen. Diese Befunde zeigen, dass Hirnabbau und Nachlassen geistiger Fähigkeiten im Alter nicht unausweichlich sind. Weitere Untersuchungen dieser Personen könnten Hinweise erbringen, wie sich den Beeinträchtigungen geistiger Fähigkeiten, die normalerweise mit dem Altern einhergehen, vorbeugen lässt oder man sie zumindest lindern kann. für die Beeinträchtigung von Aufmerk­samkeit, Gedächtnis und Mobilität verantwortlich sein, die viele ältere Menschen erleben. Mit zunehmendem Alter können sich im Hirngewebe auch amyloide Plaques und neurofibrilläre Knäuel bilden. Diese Strukturen sind pathologische Anzeichen für die Alzheimer-Krankheit, und obgleich ihr Auftreten ein normaler Teil des Alterns ist, entwickelt sich nur bei manchen Menschen ein klinisches Krankheitsbild. Warum das so ist, wissen wir nicht, doch es wird vermutet, dass die Alzheimer-Krankheit das Ergebnis eines anomalen oder beschleunigten Alterungsprozesses ist. Kompensation Das Gehirn behält zeitlebens die Fähigkeit, sich zu verändern – ein Phänomen, das als Neuroplastizität bekannt ist –, doch nach allem, was wir wissen, nimmt diese Fähigkeit im Alter ab. Dennoch sprechen aktuelle Studien dafür, dass das Gehirn funktionelle Veränderungen durchmacht, die altersbedingte Beeinträchtigungen kompensieren. Wie zahlreiche Hirnscan-Studien zeigen, sind gewisse Regionen im Gehirn älterer Menschen bei einer breiten Palette von Prozessen aktiver als bei jüngeren, zum Beispiel bei Aufgaben, bei denen motorische Kontrolle sowie autobiografisches, episodisches und Arbeitsgedächtnis eine Rolle spielen. Warum einige Menschen von altersbedingtem Abbau stärker betroffen sind als andere, wissen wir nicht, doch wahrscheinlich gibt es genetische Varianten, die ihren Träger mehr oder weniger empfindlich für die Auswirkungen des Alterns machen. Offenbar kann ein gewisser Lebensstil – wie Bildung, regelmäßige körperliche Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und sogar Kontaktpflege – ein gesundes Altern fördern und genetischen Prädispositionen bis zu einem gewissen Grad entgegenwirken. In den letzten Jahren sind Computerprogramme zum Trainieren des Gehirns (»Hirnjogging«) enorm populär geworden. Die Hersteller behaupten, diese Programme könnten einem altersbedingten geistigen Abbau entgegenwirken und das Alzheimer-Risiko senken. Solche Programme mögen die Leistungsfähigkeit für die Fertigkeiten verbessern, die sie trainieren, doch es gibt bisher keinerlei Beweise, dass sich dies positiv auf die geistigen Fähigkeiten im Allgemeinen auswirkt. Moheb Costandi Stichwort 221 Damit die Würde bleibt Die Diagnose Alzheimer löst oft Horrorvorstellungen aus. Dabei kann man auch mit dieser Krankheit Freude am Leben haben. Ein Plädoyer für einen neuen Blick Mit ihm sei es wie mit einer Sandburg, sagt Christian Zimmermann: »Ständig bröckelt etwas ab.« Doch die Burg, die sei »standhaft«, die sei immer noch da. Zimmermann spricht gern in Bildern. Seine Bilder helfen ihm, sich verständlich zu machen, wenn er wieder einmal die Worte nicht findet. Wenn ihm die Sätze, die Gedanken auseinanderfallen. Seit vier Jahren lebt der 62-Jährige mit der Dia­gno­se Alzheimer. Vorher arbeitete er in seinem Betrieb, der auf die Herstellung von Kunststoffspiegeln spezialisiert ist. Irgendwann machte er plötzlich Fehler, einmal sägte er sich fast den Finger ab. Beim Autofahren verlor er die Orientierung, überfuhr Bordsteinkanten. Eines Tages fiel er aus der Duschkabine, einfach so. Der lange Weg durch die medizinische »Maschinerie« begann, bis ihm der Neurologe ein Bild seines atrophierten Gehirns zeigte. »Dann sitzt man da und schaut«, sagt Zimmermann und macht eine lange Pause. Mit Dreitagebart und Nickelbrille sitzt er am Küchentisch seiner Dachwohnung im Münchner Stadtteil Haidhausen und redet über seine Krankheit. Zimmermann will raus aus seiner Burg. An schlechten Tagen, erzählt er, steige die Angst in ihm hoch. Dann kommt es vor, dass wieder etwas abbröckelt, dass ihm Namen, Orte und Begriffe verloren gehen. Er sucht die Schlüssel, das Handy, das Portemonnaie; lässt die Einkaufstüte im Supermarkt liegen oder bringt die falschen Dinge nach Hause. An guten Tagen malt er, geht mit Freunden spazieren – oder berichtet anderen von seiner Situation. Eigentlich sei es die »bestbetreute Zeit« seines Lebens, sagt Zimmermann. Manchmal schaue er in seiner alten Firma vorbei. Immerhin erkenne er noch heute, wenn die Mitarbeiter wieder einmal etwas falsch zusammenbauten – obwohl er es selbst nicht mehr zusammenbrächte. Es freut ihn, wenn die Leute überrascht reagieren. Man müsse die Krankheit eben »überlisten«, diesen Alzheimer »übermalen«, so wie es ein Maler mit einem schlechten Bild mache. Und wenn die Leute im Supermarkt mal wieder grantig werden, weil er so lange zum Einpacken braucht, erklärt er einfach, er habe Alzheimer. »Dann reagieren die immer ganz betroffen und packen mit mir zusammen die Tüte ein.« Alzheimer – schon der Begriff löst bei vielen Hor­ror­vorstel­lun­gen aus. Es ist die Rede von »lebenden Toten«, von »welken Hüllen«, die sinnlos dahinvegetierten. 222 Die Welt im Kopf Man denkt an sabbernde Greise, die lallend durch die Altenheime irren. Die im Nachthemd auf die Straße laufen, die ihre engsten Angehörigen nicht mehr erkennen und am Ende nicht mal mehr sich selbst. Alzheimer, dieses Schicksal möchte niemand erleiden. Gunter Sachs hat sich – so schreibt er in seinem Abschiedsbrief – aus Angst vor »der ausweglosen Krankheit A.« erschossen. Der Tod schien ihm die bessere Alternative. Doch Menschen mit Demenz (von der es neben dem Alzheimer-Typ noch andere Formen gibt) erleben sich selbst keineswegs nur im Zustand abgrundtiefer Verzweiflung. Wie Befragungen zeigen, finden sie durchaus noch Freude am Leben. Ihre Zufriedenheit hängt ab von erfüllenden Tätigkeiten, von der Bindung an Familie und Freunde, vom Gefühl, doch noch irgendwie gebraucht zu werden. Die medizinische Diagnostik nimmt allerdings vor allem die Defizite in den Blick: den schleichenden, jahrelangen Prozess der Hirnveränderung; die Gedächtnisprobleme und Wortfindungsstörungen, die irgendwann so groß werden, dass die Betroffenen nicht mehr selbstständig leben können; der schließliche Verlust der Sprache, zunehmende körperliche Probleme bis hin zur Inkontinenz und Bettlägerigkeit; das Endstadium mit künstlicher Ernährung. Selten ist in diesem Zusammenhang davon die Rede, dass Demenzkranke häufig mehr Fähigkeiten haben, als wir ihnen gemeinhin zutrauen. Auch in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit Wir müssen können sie mitteilen, was ihnen wichtig ist, was Menschen mit Demenz als sie wollen und was nicht. Und selbst schwerst Person ernst nehmen. demenzkranke Menschen haben – wie neuere Sie haben mehr Fähigkeiten, Studien­zeigen – noch immer ein subjektives Erleben und einen Rest von Selbst. Dieser als wir ihnen gemeinhin andere Blick auf die Alzheimerkrankheit legt zutrauen. nahe, dass wir Menschen mit Demenz als Personen ernst nehmen müssen – und dass wir ihnen Selbstbestimmung zugestehen sollten, solange sie dazu noch irgendwie in der Lage sind. Mehr als eine Million demenzbetroffene Menschen leben derzeit in Deutschland. Bis zum Jahr 2050 soll sich die Zahl mehr als verdoppeln. Jeder dritte Mann, jede zweite Frau könnte – so warnt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft – im Laufe des Lebens an einer Demenz erkranken. Und da uns die Medizin wenig Hoffnung auf eine wirksame Therapie macht, folgt daraus zwangsläufig: Wir müssen lernen, mit demenzkranken Menschen zu leben und nicht nur über sie zu reden, sondern mit ihnen. »Wir stehen mitten in einem großen Veränderungsprozess«, sagt Peter Wißmann, Herausgeber des Demenz-Magazins, das über Fragen des Umgangs mit den Betroffenen berichtet. Die Gesellschaft dürfe Menschen mit Demenz nicht länger »ins Abseits der Krankheit und Pflegebedürftigkeit« schieben. Immer Das alternde Gehirn 223 Ab 80 steigt das Risiko Häufigkeit von Demenz in verschiedenen Altersgruppen nach Geschlecht, in % Häufigkeit von Demenz in verschiedenen Altersgruppen nach Geschlecht, in Prozent 32,1 32,3 31,6 36,0 Frauen 90–94 94 95–99 0,2 0,1 1,9 1,6 0,5 2,2 1,1 4,6 3,9 5,0 6,7 12,1 13,5 18,5 22,8 Männer 30 – 59 Jahre 60 –64 65 – 69 70 – 74 75–79 80 – 84 85 – 89 ZEIT-Grafik/Quelle: Demenz-Report 2011 des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung mehr Betroffene gehen mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit. Statt den Blick nur auf die Krankheit zu richten, so lautet ihre Botschaft, sollten wir uns mehr auf die Menschen dahinter konzentrieren. Vor 30 Jahren erstritten sich behinderte Menschen die gesellschaftliche Anerkennung. Aus den »Krüppeln« von einst sind weitgehend gleichberechtigte Dialogpartner geworden. Heute geht es um die Rechte von Menschen mit Demenz. »Wir verletzen tagtäglich die Menschenwürde von Demenzkranken«, sagt der Bonner Gerontopsychiater Rolf Hirsch. Schätzungen zufolge ist jeder dritte Pflegeheimbewohner in Deutschland von freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen: An ihren Betten werden Gitter angebracht, ihre Türen werden verschlossen, oder man stellt sie mit Psychopharmaka ruhig. Überall fehlt es an Geld und an Personal. Doch wer die Demenz nur auf ein Pflegeproblem reduziert, der redet am eigentlichen Notstand vorbei. Die Alzheimerkrankheit rührt auch an unser Menschenbild, das sich einseitig am kognitiven Leistungsvermögen orientiert: Wer geistig nicht mehr folgen, wer nicht mehr sinnvoll kommunizieren kann, der droht aus der menschlichen Gemeinschaft herauszufallen. Schon sprechen einige Philosophen Menschen mit schwerer Demenz den Personenstatus ab (siehe Kasten). Da ist der Schritt nicht mehr groß vom Menschen zur Sache, vom »Jemand« zum »Etwas«. Dabei hat die Wissenschaft gerade erst begonnen, das persönliche Erleben von Demenzkranken zu erforschen – ihre Ängste, ihre Freuden, ihren Blick auf die Welt. Forscher der Universität Bangor in Wales etwa befragten Heimbewohner mit leichter bis mittelschwerer Demenz. Was sie in den Interviews zu hören bekamen, war zum einen bedrückend. Viele Betroffene äußerten Gefühle von Angst, Entfremdung und Einsamkeit. »Ich fühle mich so allein hier. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Warum die Leute nicht mehr mit mir reden. Ich fühle 224 Die Welt im Kopf mich wie ein Außenseiter.« Andere erklärten, sie seien »ein Haufen Mist« – oder eine »seltsame Kreatur«, die irgendwie auf die Erde gekommen sei: »Aber ich weiß nicht, wer das ist.« Demenzkranke Menschen entwickeln aber auch Strategien, um mit dem fortschreitenden geistigen Verfall zurechtzukommen. Während einige ihre Krankheit herunterspielen oder so lange wie möglich zu verstecken suchen, setzen sich die anderen aktiv damit auseinander, gehen in Selbsthilfegruppen, beteiligen sich an Forschungsprojekten. Manchen gelingt es sogar, mit ihren Defiziten humorvoll umzugehen. Oft helfen die intakten Langzeiterinnerungen. Aus der Rückschau auf ihr früheres Leben schöpfen viele neues Selbstwertgefühl. So hatte eine scheinbar völlig apathische Heimbewohnerin zeitlebens ihren Beruf als Schreibkraft geliebt. Als ihr die Forscher eine alte Schreibmaschine und Papier gaben, fing die Frau nach kurzer Zeit zu tippen an, bis am Ende alle Blätter vollgeschrieben waren. Auf dem Papier stand zwar nur Buchstabensalat. Doch als die Frau das letzte Blatt ausgespannt hatte, atmete sie tief ein, strahlte plötzlich übers ganze Gesicht und sagte nur: »Da hast du aber was weggeschaff t.« Von »Selbstaktualisierung« spricht Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg. In jeder Person gebe es etwas, das Kontinuität zeige bis zuletzt. Das Seelische drücke sich aus, es teile sich mit – auch wenn es sich bei Menschen mit schwerer Demenz nur noch situativ äußere, für einen Augenblick. Um solche Formen der »Selbstaktualisierung« aber wahrzunehmen, müssten wir uns ebenso bemühen, die Emotionen, Empfindungen und sozialen Bedürfnisse der Betroffenen zu erfassen. In den vergangenen Jahren sind die Heidelberger Wissenschaftler auch in die Erlebenswelt jener Demenzkranken vorgedrungen, die sich nicht mehr sprachlich äußern können. Per Videokamera beobachteten die Forscher demente Heimbewohner in verschiedenen Alltagssituationen – wenn sie Besuch von Verwandten bekamen, in ihrer Lieblingszeitschrift blätterten oder am Fenster standen und die Vögel beobachteten. Dabei wurden zunächst die mimischen Ausdrucksmuster aufgezeichnet, vom kleinsten Stirnrunzeln bis zum Anflug eines Lächelns; dann ordneten die Forscher diesen Mustern Basisemotionen wie Freude, Ärger oder Traurigkeit zu. »Auch schwerst demenzkranke Menschen verfügen über ein höchst differenziertes emotionales Erleben«, fasst Kruse das Ergebnis seines Projekts zusammen. Wenn die Menschen Zuwendung und Ansprache bekämen, zeigten viele Ausdrücke von Freude oder Wohlbefinden, ebenso wenn sie ihren Lieblingsaktivitäten nachgingen. Hingegen reagierten sie verärgert, wenn man sie zu etwas drängte oder nötigte. Trotz weit fortgeschrittener Demenz, glaubt Kruse, hätten diese Menschen ein intuitives Empfinden, dass sie selbst es sind, die eine Handlung in Bewegung setzen – und nicht jemand anderer. Wegen ihrer kognitiven Defizite neigten wir allerdings dazu, die Fähigkeiten von Demenzbetroffenen zu unterschätzen, sagt Kruse. Dabei besäßen sie oft noch Ressourcen und Potenziale, die geweckt werden könnten. Das alternde Gehirn 225 Das erlebte zum Beispiel die schottische Psychologin Maggie P. Ellis, die das Kom­mu­ni­ka­tions­ver­hal­ten einer schwerst demenzkranken, bettlägerigen Frau studierte. Schon vor Jahren hatte diese ihr Artikulationsvermögen verloren, sie reagierte auf keine normale Ansprache mehr. Manchmal allerdings stieß sie einen durchdringenden hohen Ton aus. Als Ellis den Ton nachahmte, hob die Frau ihren Kopf und rieb ihn an der Hand der Forscherin. Als diese sich zu ihr herabbeugte und sich die beiden Köpfe berührten, schaute die demente Frau überrascht und gab wieder ihren Ton von sich. Plötzlich bekam die Interaktion etwas Spielerisches – abwechselnd produzierten die beiden ihre Töne und lachten immer wieder dabei. Solche Erlebnisse zeigen: Trotz ihres devastierten Gehirns sind die Äußerungen demenzkranker Menschen keineswegs reflexhaft oder beliebig. Sie folgen vielmehr, wie die Heidelberger Wissenschaftler nachwiesen, einer bestimmten Logik. Das erschüttert allerdings die traditionelle Vorstellung, die Autonomie einer Person basiere lediglich auf ihrer rationalen Fähigkeit zum Planen und Entscheiden. Die Philosophin Agniesz­ka Jaworska von der Universität Stanford etwa argumentiert, Autonomie sei weniger eine Sache des rationalen Urteilsvermögens, sondern eher der Fähigkeit, etwas­als »wichtig« ansehen zu können. Und diese Fähigkeit besäßen selbst hochdemente Menschen: Mit ihren Emotionen brächten sie weiterhin ihre Wertvorstellungen zum Ausdruck, auch wenn ­ihnen jegliche Möglichkeit fehlte, diese in Handeln umzusetzen. Die Frage nach der Autonomie von Demenzkranken treibt ebenso den Deutschen Ethikrat um. Wie zum Beispiel soll eine frühere Patientenverfügung interpretiert werden, wenn ein schwer Demenzkranker erkennen lässt, dass er nun eigentlich doch weiterleben möchte? Was ist sein »autonomer« Wunsch? Oder: Wann überwiegt das Fürsorgeprinzip, wann muss man dem Kranken Selbstbestimmung zugestehen? Solche Fragen sind von drängender Relevanz: Tagtäglich laufen Pflege­personen und Angehörige Gefahr, die Selbstbe­stim­mung demenzkranker Menschen ein­zu­schrän­ken – aus Überfürsorglichkeit, aus Achtlosigkeit oder schlicht aus Zeitmangel. Doch die Positionen zur Frage der Autonomie sind im Ethikrat gespalten. Die einen argumentieren, wer kein Reflexionsvermögen mehr besitze, könne keinen »Gesamtbegriff seiner Si­tua­tion« mehr fassen. Folglich sei ein solcher Mensch nicht mehr selbstbestimmungsfähig. Eine frühere Patientenverfügung, im Vollbesitz der geistigen Kräfte festgelegt, habe daher Vorrang, auch wenn der Kranke später andere Präferenzen zeige. Andere Experten halten dagegen: Demenzkranke Menschen seien selbst in späten Phasen der Erkrankung noch in der Lage, Situationen zu bewerten und ihren e­ igenen Willen zu äußern – und sei es am Ende nur noch durch mimische Reaktionen. »Wer eine Patientenverfügung unterzeichnet, hat keine Vorstellung davon, wie es tatsächlich ist, dement zu sein«, sagt etwa der Psychiater Hans Lauter, Mitbegründer der Alzheimer Gesellschaft. Statt verbindlicher Verfügungen fordert er ein »ethisches Konzil« aus Angehörigen und Ärzten, das im Ernstfall das Für und Wider weiterer medizinischer Maßnahmen abwägen soll. 226 Die Welt im Kopf Die Philosophin Agnieszka Jaworska geht noch einen Schritt weiter: Sie plädiert dafür, Demenzkranke auch im täglichen Leben in ihrer Autonomiefähigkeit gezielt zu fördern, indem man ihnen hilft, nach ihren noch verbliebenen Wertvorstellungen zu leben. Ein früherer Wissenschaftler etwa, der selbst an Alzheimer erkrankte und nun an einem Demenz-Forschungsprojekt teilnahm, zog daraus tiefe Befriedigung. Obwohl er kaum noch verstand, worum es in dem Projekt überhaupt ging, steigerte die bloße Mitwirkung sein Selbstwertgefühl: Als Projektteilnehmer könne er »viel mehr machen«, erklärte der Mann – im Heim hingegen sei er »nichts«. Nach Auffassung des amerikanischen Psychiaters Steven Sabat sind Menschen mit Demenz immer noch »semiotische Subjekte«, also sinngeleitete Wesen, die ein Anliegen, einen Sinn verfolgen – auch wenn es für Außenstehende oft schwierig ist, diesen Sinn zu entschlüsseln. Was etwa soll man von der Heimbewohnerin halten, die aus dem Kaffeegeschirr kleine Bauwerke errichtet? Oder von dem Mann, der ständig mit dem Rollstuhl unterwegs ist, um nach Gegenständen zu fahnden, die er in ihre Einzelteile zerlegen kann? Die Heidelberger Gerontologin Marion Bär hat solche Verhaltensweisen zu deuten versucht. Nach ihrer These machen schwer demenzkranke Menschen durchaus Sinnerfahrungen. Natürlich könne jegliche Interpretation solcher Handlungen von außen fehlgehen. Doch indem wir Demenzbetroffene überhaupt als »Sinnsucher« anerkennen, so meint Bär, können wir die kognitive Ungleichheit überwinden – und damit das Gefühl der Fremdheit, das uns von ihnen trennt. Wachsendes Problem Von 100 000 Menschen erkranken an Demenz: Wachsendes Problem Von 100 000 Menschen erkranken an Demenz 183 (1,1 %) 2005 203 (1,31 %) 2015 247 (1,67 %) 2030 Das alternde Gehirn 227 Durch das Erzählen erschaffen wir unser Selbst. Dazu braucht es Zuhörer Menschen sind im Kern »narrative« Wesen: Mit unseren Geschichten erzählen wir uns und anderen, wer wir sind. Unser Selbst steckt demnach nicht in einem bestimmten Hirnareal, sondern es besteht aus einem Netz all der Geschichten, aus denen wir unsere Identität immer wieder neu zusammenweben. Demente Menschen tun im Grunde­nichts anderes. Nur müssen sie immer wieder neue Geschichten erfinden, weil sie ihre früheren Rollen nicht mehr ausüben können. Marion Bär erzählt etwa von einer Heimbewohnerin, die mit leuchtenden Augen ihre Tätigkeit als Sekretärin in der Einrichtung beschrieb, obwohl sie dort nie irgendwelche Arbeiten übernommen hatte. Ihr Sinnpotenzial verwirkliche sich durch das Erzählen, meint Bär: Sie erschafft sich gleichsam eine neue Geschichte – und damit ein neues Selbst. Doch wer erzählt, der braucht Zuhörer. Nur im sozialen Raum, im Austausch mit anderen, mit unserer Unterstützung können Menschen mit Demenz ihren Sinn verwirklichen – und ihr Selbstgefühl aufrechterhalten. Es liegt also an uns, die Vergesslichen an ihr Selbst zu erinnern. Wir alle schreiben mit an ihren Geschichten. Das allerdings zwingt zum genauen Zuhören, zum Verstehenwollen, es erfordert Entschleunigung, Toleranz und Empathie. Es dauert manchmal quälend lange, bis Christian Zimmermann, der Demenzbetroffene in München-Haidhausen, einen Satz zu Ende bringt. Manchmal findet er den Spickzettel nicht, auf den er sich etwas notiert hat. Mitunter liegt die Schwierigkeit aber auch bei seinem Gegenüber. Als Interviewer etwa wird mir plötzlich bewusst, wie ich selbst überdeutlich spreche. Wie ich auf seine Defizite achte. Die Wortfindungsstörungen. Die Wiederholungen. Hat er mich richtig verstanden? Als ich später das Band abhöre, wundere ich mich weniger über seine klugen Antworten als über die Banalität meiner Fragen. Wer wirklich zuhört, kann von Menschen wie Zimmermann lernen – von ihrer Kreativität, von ihrem Humor, von ihren Bildern. Klar, irgendwann sei seine »Sandburg« abgebröckelt, sagt Zimmermann. In solchen Momenten frage er sich zum Beispiel, ob er nicht doch was falsch gemacht habe mit seiner Burg, die er einst so akribisch geplant hatte. Mit seinem Leben. »Das schleppst du immer mit. Das kriegst du voll rein. Dann reißt das Seil. Erinnern oder Vergessen, das ist der Knackpunkt.« Stellen wir uns ähnliche Fragen nicht alle? Und haben wir nicht alle womöglich auf Sand gebaut? Schließlich gehört der Verfall, das »Ab­bröckeln«, zu jeder Existenz. Solange die Burg bröckelt, ist sie noch da. In diesem Punkt sind alle Menschen gleich – mit oder ohne Demenz. Uns alle eint unser emotionales Erleben, das soziale Bedürfnis, die Suche nach Sinn. Was uns trennt, sind unsere ­unterschiedlichen kognitiven Defizite. In den ­allerletzten Phasen der Krankheit kann es sein, dass wir bei einem dementen Menschen nichts Kognitives mehr finden, kaum noch Emotionen oder einen Ausdruck von Selbst. Aber wir dürfen nicht aufhören, danach zu suchen. von Thomas Vašek aus der ZEIT Nr. 20/2011 228 Die Welt im Kopf Im Dorf des Vergessens Im niederländischen De Hogeweyk genießen Menschen mit Demenz maximale Freiheit. Nun wird ein solches Projekt auch in Deutschland geplant Ruth weiß schon lange nicht mehr, in welcher Welt sie lebt, aber sie weiß genau, was sie will: ihrem Besucher einen Kuss geben – auch wenn es sich bei diesem um einen wildfremden Journalisten han­delt. Sie nimmt meine Hand, schaut mir tief in die Augen, zieht mich zu sich herunter und küsst mich fest auf die Wange. Dann schnappt sie sich ihren Gehstock und spaziert los, einem Ziel entgegen, das sie selbst nicht kennt. Ruth hat schwere Demenz. Aber hier, im niederländischen De Hogeweyk, darf sie sein, wie sie ist. Denn dieses Dorf ist ganz auf Menschen mit Demenz eingestellt. Seine 152 Bewohner leiden allesamt unter der Alterssenilität – und können doch tun, wonach ihnen der Sinn steht. Wer etwa, wie Ruth, nachmittags lieber im Morgenmantel spazieren geht, statt Tee zu trinken, darf dies. Denn verlaufen kann sie sich nicht. De Hogeweyk ist so verschachtelt gebaut, dass sie immer wieder an ihrem Ausgangspunkt landet. »Menschen mit schwerer Demenz verstehen die Welt da draußen nicht mehr. Wir schaffen ihnen eine Welt, die sie verstehen: einen normalen Alltag in einem normalen Haus«, sagt die Managerin Yvonne van Amerongen, die das weltweit einmalige Projekt vor rund 20 Jahren aus der Taufe hob. Heute ist das Demenzdorf, das 20 Kilometer von Amsterdam entfernt im Städtchen Weesp liegt, zu einer Pilgerstätte für Pflegemanager, Wissenschaftler und Gesundheitspolitiker aus aller Welt geworden. Nach dem Vorbild De Hogeweyks werden gerade in vielen Ländern ähnliche Einrichtungen geplant – auch in Deutschland. »Normalität« ist der Schlüsselbegriff dieses Konzepts. Auf den ersten Blick gleicht De Hogeweyk einem ganz normalen niederländischen Dorf. Es gibt einen Friseur, ein Restaurant und ein Café, einen Teich und eine Promenade zum Spazierengehen. Die 23 Wohnungen sind den Milieus nachempfunden, aus denen ihre Bewohner stammen, sie reichen von Oberschicht bis Arbeiterklasse, sieben verschiedene Lebensstile gibt es in De Hogeweyk. Wer in den einzelnen WGs wohnt, verraten die Namen, die in großen und bunten Buchstaben neben den Haustüren stehen. Die Kranken leben tagsüber mit Pflegern und Helfern zusammen. Diese tragen statt weißer Uniform Alltagskleidung. Unterscheiden kann man sie erst gegen Abend, wenn die Pflegekräfte beim Schichtwechsel nach Hause fahren. Man muss schon genau hinsehen, um die Brüche in der Illusion der Normalität Das alternde Gehirn 229 De Hogeweyk bietet seinen dementen Bewohnern so viel Normalität wie möglich. zu bemerken: etwa die Tatsache, dass jede Wohnung zwei Eingangstüren hat – eine normale für den Alltag und eine versteckte, für Notfälle. Oder die Tatsache, dass das ganze Dorf nur einen zentralen Ein- und Ausgang hat, der Tag und Nacht kontrolliert wird. Kritiker sprechen von einem »Ghetto«, in dem Demente isoliert und weggesperrt werden. Andere dagegen sehen Dörfer wie De Hogeweyk als Lösung eines immer drängender werdenden Problems. Jan Bennewitz plant im rheinland-pfälzischen Städtchen Alzey das erste deutsche Demenzdorf nach dem niederländischen Vorbild. Mitte 2014 sollen die ersten von 120 Bewohnern in die Wohnungen einziehen und »damit eine echte Alternative zum klassischen Pflegeheim haben«, wie Bennewitz sagt. Der für soziale Einrichtungen tätige Unternehmensberater ist mit seiner Partnerin Yvonne Georgi die treibende Kraft hinter dem Projekt Alzey. Das Wort »Demenzdorf« meidet Bennewitz; er redet lieber von einem »Quartier, in dem wirkliches soziales Leben stattfindet«. Ein Café soll die Alzeyer Bevölkerung dorthin locken, Arzt und Friseur sollen nicht nur für die dementen Anwohner da sein. Vermutlich werden bald noch andere Kommunen hierzulande ähnliche Pläne schmieden. Denn der Betreuungsnotstand in der Versorgung von Demenzpatienten ist unbestritten. Rund 1,3 Millionen Menschen leiden derzeit in Deutschland an Demenz. Für das Jahr 2050 rechnet das Berlin-­Insti­tut für Bevölkerung und Entwicklung mit 2,6 Millionen Demenzkranken. Viele Familien sind von 230 Die Welt im Kopf der kräftezehrenden Aufgabe der Pflege überfordert, Pflegeheime stoßen schon heute an ihre Kapazitätsgrenzen. Oft fehlt ihnen das Know-how im Umgang mit Dementen, obwohl diese einen immer größeren Teil ihrer Patienten ausmachen. Oder sie konkurrieren miteinander um Fachkräfte, die in der Not aus dem Ausland angeworben werden. Zudem belastet die Betreuung die So­zial­kas­sen und den Staatshaushalt, ein Pflegeheimplatz kostet mehrere Tausend Euro pro Monat. Für manche ist das ein einträgliches Geschäft. Denn in Deutschland sind Kranken- und Pflegekasse getrennt. Wird bei einem Patienten Pflegebedürftigkeit festgestellt, wechselt er von der Kranken- in die Pflegekasse. Für den Altersforscher Wolf Dieter Oswald ist das eine »unselige Trennung«. Sie führe dazu, dass nicht die Aktivierung von Menschen mit Demenz belohnt werde, sondern das Gegenteil: Je pflegebedürftiger ein Mensch sei, desto mehr Geld bringe er für die Heime. Und »dort herrscht oft Grabesruhe«, sagt Oswald, Professor am Institut für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg: »Die Leute werden mit Medikamenten sediert, möglichst im Bett gehalten. Denn dann gibt es die höchste Pflegestufe.« Stu­dien zeigen, dass zwischen 26 und 42 Prozent der Kranken in irgendeiner Weise fixiert werden, fünf bis zehn Prozent werden sogar mit Gurten fest­geschnallt. Der ökonomische Druck auf die Pflegeheime, der Fachkräftemangel und das Aufbrechen traditioneller Familienstrukturen werden sich in Zukunft noch Das alternde Gehirn 231 verschärfen. Ohne ein grundsätzliches Umdenken in der Gesellschaft wird der demografische Wandel ziemlich hässliche Seiten bekommen. »Jeder bekommt Alzheimer, wenn er nur alt genug wird«, sagt Wolf Dieter Oswald provokativ. Deshalb fordert er mehr Re­ha­bi­li­ta­tion, Prä­ven­tion und Aktivierung: Auch im Pflegeheim sollten die Menschen gefördert und je nach Niveau gefordert werden. Dafür hat er ein Programm entworfen, das viele Punkte enthält, die auch im niederländischen De Hogeweyk umgesetzt werden. Dort herrscht an einem Nachmittag im Dezember rege Geschäftigkeit. Aus dem dorf­eige­nen Café dringt der Gesang von Kindern, dazwischen hört man die Stimmen einiger Bewohner. Gerade ist eine Kindergartengruppe zu Gast, die mit den Dementen die Ankunft von Sinterklaas, dem niederländischen Nikolaus, feiert. Nebenan in der lichtdurchfluteten Einkaufspassage wird mit Unterstützung von zwei Pflegehelfern an Advents­gestecken gewerkelt – eine von vielen Aktivitäten, die Bewohner wählen können, neben Singen oder Basteln und dem unvermeidlichen Bingo. Wichtig ist, dass die Dementen aktiv sind, auch im Alltag. Deshalb werden sie bei vielen Tätigkeiten einbezogen: Sie helfen beim Kartoffelschälen, Blumenbeetharken oder Tischdecken. Auch einkaufen gehen können die Bewohner. Im Dorfladen »Hogeweyk Super« gibt es Äpfel, Fertiglasagne und Duschlotion. »Alles ganz normal«, sagt die Managerin Yvonne van Amerongen. Ungewöhnlich ist höchstens, dass es niemand stört, wenn mit Knöpfen oder Taschentüchern bezahlt wird – alles ist erlaubt, solange es die Il­lu­sion von Normalität auf­recht­erhält. Und was ist mit dem Eierlikör-Regal, das schon fast leer geräumt ist? Trinkt sich hier jemand heimlich einen Rausch an? Kein Problem, die Mitarbeiter kennen schließlich jeden der 152 Bewohner. Und bevor einer von ihnen mit zwei Flaschen Eierlikör zu Hause ankommt, hat die Verkäuferin schon längst in seiner Wohngruppe angerufen und die Pfleger informiert. Dieser Umgang mit den Demenzkranken hat auch Markus Vögtlin beeindruckt. Er ist Direktor der Dahlia Oberaargau AG, die insgesamt vier Pflegeheime in der Schweiz führt. Nach einem Besuch in De Hogeweyk will er nun am Standort Wiedlisbach, rund 30 Kilometer von Bern entfernt, das erste Schweizer Demenzdorf bauen. 100 Plätze sind geplant; wenn alles gut läuft, können die ersten Bewohner 2019 einziehen. »Uns hat überzeugt, wie dort Normalität gelebt wurde«, sagt Vögtlin. »Wir waren beeindruckt, wie ruhig die Bewohner waren, wie glücklich. So etwas habe ich noch nie erlebt.« Die Simulation des Alltags hat mehrere positive Effekte: Sie schafft soziale Kontakte und fördert die geistige Aktivität. Und wie wichtig diese sind, weiß auch die Wissenschaft. »Wir haben uns gefragt: Was hält das Gehirn fit?«, beschreibt Elmar Gräßel, Professor am Uni-Klinikum Erlangen, die Herausforderung. »Auf einmal ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen.« Gräßel fasst die Antwort in dem Kürzel MAKS zusammen – motorische, alltagspraktische, kognitive und spirituelle Aktivität. Sein Konzept ist vom Bundesgesundheitsministerium als eines von 29 »Leuchtturmprojekten Demenz« 232 Die Welt im Kopf ausgezeichnet worden. Mit geistiger Anregung, psychomotorischen Übungen, alltagspraktischen Tätigkeiten und Kommunikation in der Gruppe will Gräßel jenen Prozess verlangsamen, der das Gehirn in sich zusammenfallen lässt. Langfristig aufhalten lässt dieser sich allerdings nicht. Denn bislang gibt es keine wirksamen Medikamente, häufig zeigen Anti­demen­ti­va nur einen geringen Effekt. Umso wichtiger ist es, den Alltag möglichst lange aufrechtzuerhalten. Denn bei vielen Betroffenen setzt die beginnende Demenz einen Teufelskreis in Gang. Wer unter Vergesslichkeit leidet und sich den Anforderungen des Alltags nicht mehr ganz gewachsen fühlt, zieht sich langsam zurück. Betroffene gehen nicht mehr einkaufen und wissen irgendwann nicht mehr, wie man den Bus benutzt. Sie bleiben zu Hause, um Fehler zu vermeiden, und weichen Gesprächen aus, die sie überführen könnten – was die Isolation noch steigert und den geistigen Verfall befördert. Irgendwann greift die Krankheit auf das Langzeitgedächtnis über. Die Betroffenen wissen nicht mehr, wie man sich die Schuhe bindet und wozu eine Gabel gut ist. Sie vergessen das Gesicht des Nachbarn, haben Angst vor der Schwiegertochter, die zum Putzen vorbeikommt, haben keinen Hunger mehr und wollen um Mitternacht einen Spaziergang mit dem Hund machen, der seit 30 Jahren tot ist. Der Weg in das Vergessen ist schmerzhaft. Die Betroffenen merken, wie nach und nach das eigene Ich zerfließt. Wehren können sie sich nicht. Noch wissen Forscher viel zu wenig über die Entstehung. Bis heute steht fest: Rund zwei Drittel der Fälle gehen auf die Alzheimer-Erkrankung zurück, rund ein Drittel sind vaskuläre Demenzen, aus­gelöst durch eine Reihe kleiner Hirn­infark­te. Die dritte und kleinste Gruppe sind die familiären Demenz­erkran­kun­gen, die häufig schon vor dem 60. Lebensjahr auftreten. Wäre also ein Demenzdorf die geeignete Lösung für jene Menschen, die früher oder später stationäre Hilfe in Anspruch nehmen müssen? »Ich kann mir ein solches Modell gut in Deutschland vorstellen«, sagt Elmar Gräßel vom Uni-Klinikum Erlangen. Allerdings müsse hinter dem Projekt das entsprechende therapeutische Konzept stecken. So komme es etwa darauf an, wie gut das Dorf in das Gemeindeleben eingebunden ist. Nicht zu nah am Verkehr, aber auch nicht auf der grünen Wiese müsse es angesiedelt sein. »Ghettobildung hat sich nie bewährt«, warnt Gräßel. Andere sehen solche Einrichtungen kritischer. »Dort wird eine Art Disneyland aufgebaut, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat«, schimpft Peter Michell-Auli, Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Altershilfe. Ihm schwebt anderes vor. »Fast immer wollen die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben, das sollten wir ihnen ermöglichen«, sagt er. Er plädiert für eine enge Einbindung der Demenzkranken innerhalb ihres gewohnten Wohnquartiers mit nachbarschaftlicher Hilfe, einem barrierefreien öffentlichen Raum, einem Netz aus Beratung und Dienstleistungen. »Darauf müssen wir viel mehr achtgeben als auf solche Sonderformen wie das geplante Demenzdorf in Alzey«, sagt er. Noch radikaler ist Reimer Gronemeyer. Der emeritierte Professor von der Universität Gießen empfindet es als Kränkung, eine Il­lu­sion wie in De Hogeweyk Das alternde Gehirn 233 mit allen Mittel aufrechtzuerhalten. Überhaupt sollten wir aufhören, Demenz als Krankheit zu sehen, fordert er. Vielmehr sei sie ein Teil des Lebens, das »vierte Lebens­a lter«: »Wir müssen uns fragen, wie wir diese große humane Aufgabe lösen, ohne uns wegzudrehen und zu sagen: Gebt sie doch den Ärzten.« Auch Klaus Pawletko war skeptisch, als er zum ersten Mal von der Idee der Demenzdörfer hörte. Der Vorsitzende des Vereins »Freunde alter Menschen« in Berlin gründete schon Mitte der neunziger Jahre die erste »Demenz-WG«, in der Kranke und Gesunde zusammenleben. Mittlerweile hat das Konzept Nachahmer in ganz Deutschland. In der Gesellschaft habe sich seitdem eine ganze Menge verändert, glaubt Pawletko: »Wir sind unglaublich viel weiter, einfach deshalb, weil über die Krankheit geredet wird.« Künstliche Welten wie in De Hogeweyk habe er anfangs abgelehnt, erzählt er. Nach und nach aber habe er seine Meinung geändert, auch weil Kollegen ihm berichteten, noch nie so entspannte Demenzkranke wie in De Hogeweyk gesehen zu haben. »Mittlerweile kann ich mir ein Demenzdorf grundsätzlich hier vorstellen«, sagt er. »Ich weiß nur nicht, ob das mit der Mentalität der Deutschen zusammenpasst.« Fragt man ihn nach seiner Idealvorstellung, skizziert Pawletko eine ähnliche Utopie wie Michell-Auli. »Keine Spezialeinrichtungen mehr. Menschen mit Demenz können frei auf der Straße herumlaufen, Nachbarn und die Menschen auf der Straße sind hoch sensibilisiert. Aber um das zu erreichen, müsste man in so viele Bereiche eingreifen«, sagt er und klingt dabei eher skeptisch. Dass das im Prinzip funktionieren kann, hat der Erlanger Professor Elmar Gräßel selbst einmal erlebt, als er in Irland auf dem Weg zu einer Tagung war: In seinem Bus saß eine offensichtlich verwirrte Dame, die an jeder Haltestelle aussteigen wollte. Doch der Busfahrer hielt sie zurück. Erst an der richtigen Adresse rief der Fahrer der Frau zu, nun könne sie aussteigen, dort drüben sei ihr Haus. Dann nahm die Frau ihre Einkaufstüten und machte sich auf den Heimweg. Leider klappt so eine aufmerksame nachbarschaftliche Hilfe eher in überschaubaren Räumen als in Großstädten. Doch die Diskussion, wie wir in Zukunft mit unseren vergesslichen Alten um­gehen wollen, hat in Deutschland gerade erst begonnen. Klar ist nur, dass sie unsere Vorstellung einer optimierten Leistungsgesellschaft massiv infrage stellt. Denn uns allen droht am Ende der Sturz ins Vergessen, unabhängig von Schicht und Bildung. »Wir müssen akzeptieren, dass Leben Wandel ist«, sagt Elmar Gräßel. »Deshalb sollten wir tolerant sein und bedenken, dass nichts so bleibt, wie es ist.« von Fritz Habekuß aus der ZEIT Nr. 5/2013 234 Die Welt im Kopf Stichwort Neurodegeneration Neurodegenerative Erkrankungen sind progressive, altersabhängige Zustände, denen ein gemeinsamer pathologischer Mechanismus zugrunde liegt. Unter solchen Krankheiten leiden weltweit Millionen von Menschen, und es könnten in den kommenden Jahren noch mehr werden, denn die Bevölkerung der westlichen Welt altert zusehends. Daher stellen diese Krankheiten eine schwere, mit enormen Kosten verbundene Last für das Gesundheitssystem dar. Neurodegenerative Erkrankungen führen zum Absterben bestimmter Neuronengruppen im ZNS. Man kann sie grob in zwei Kategorien einteilen: Demenzen Bewegungsstörungen • Alzheimer-Krankheit (häufigste und •Parkinson-Krankheit bekannteste Form der Demenz) • Chorea Huntington • frontotemporale lobäre Degeneration • Motoneuronenkrankeiten (wie • vaskuläre Demenz amyotrophe Lateralsklerose ALS) •Pick-Krankheit • spinozerebelläre Ataxien Transmissible (übertragbare) spongiforme Enzephalopathien oder Prionenkrankheiten bilden eine weitere Gruppe neurodegenerativer Erkrankungen. Sie führen zu Demenz und Bewegungsstörungen, darunter: • bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE oder »Rinderwahnsinn«) • Variante der Creutzfeldt-JakobKrankheit (vCJK) •Gerstmann-Sträussler-ScheinkerSyndrom (GSS) • letale familiäre Schlaflosigkeit •Kuru • Scrapie (bei Schafen) Stichwort 235 Kannibalismus und der »zitternde Tod« Kuru ist eine Prionenkrankheit, die in den 1950er Jahren beim Stamm der Fore in Papua-Neuguinea entdeckt wurde, dessen Mitglieder die Infektion durch ritualisierten Kannibalismus Verstorbener weitergaben. Wenn ein Stammesmitglied starb, verlangte der Brauch, dass die weiblichen Verwandten den Leichnam zerlegten und aufaßen, einschließlich des Nervensystems. Kuru-Opfer galten als besonders reiche Nahrungsquelle, da die Krankheit mit einer Vermehrung des Fettgewebes einhergeht, das ähnlich wie Schweinefleisch schmeckt. Der Begriff Kuru bedeutet in der Sprache der Fore so viel wie »zitternder Tod« und beschreibt die Symptome – die Krankheit befällt vor allem das Kleinhirn und führt zu unstetem Gang und Muskelzittern. In den 1950er Jahren forderte ein Ausbruch das Leben von mehr als 100 Mitgliedern des Fore-Stammes, bevor Kannibalismus von der australischen ­Regierung verboten wurde. Vor rund fünf Jahren kehrten jedoch Forscher nach PapuaNeuguinea zurück und identifizierten elf Kuru-Fälle. Kuru, so vermuten sie, hat eine außerordentlich lange In­ku­ba­ tions­zeit, was die Besorgnis auslöste, nach der BSE-Krise Ende der 1980er Jahre könnte Großbritannien eine vCJK-Epidemie drohen. Die Prionenhypothese Prionenkrankheiten sind extrem selten und gerieten erst Ende der 1980er Jahre in den Blick der Öffentlichkeit, als eine BSE-Epidemie (»Rinderwahnsinn«) in den britischen Rinderbeständen wütete. Anschließend starben 156 Menschen an der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, offensichtlich deshalb, weil sie Fleisch von infizierten Kühen gegessen hatten. Die meisten Infektionen werden von Mikroorganismen hervorgerufen, doch Prionenkrankheiten sind einzigartig: Der Prionenhypothese zufolge werden sie von einer abnormen Form eines Nervenzellproteins hervorgerufen, das sowohl zwischen den Mitgliedern einer Art als auch über Artgrenzen hinweg übertragen werden kann. »Prion« leitet sich vom englischen Ausdruck proteinaceous in­ fec­tious particle (proteinöses infektiöses Teilchen) her und beschreibt dessen einzigartige Übertragungsweise. Das Prionprotein findet sich in sämtlichen Nervenzellen, doch seine normale Funktion ist bislang unbekannt, wenn sein Sitz in der Zellmembran auch dafür spricht, dass es eine Rolle bei der Signalübermittlung von Zelle zu Zelle spielt. Mutationen im Prion-Gen bewirken, dass sich das Protein falsch faltet; diese abnorm gefalteten Moleküle häufen sich an und bilden unlösliche Klumpen, die für Neurone toxisch sind. Die Klumpen brechen dann in kleinere Fragmente auseinander; diese wirken als »Keime«, die sich ausbreiten und normale 236 Die Welt im Kopf Prionenmoleküle veranlassen können, die pathologische Konfiguration einzunehmen. Falsch gefaltete Proteine An fast jeder bekannten neurodegenerativen Krankheit ist ein pathologischer, prionenartiger Mechanismus beteiligt, bei dem ererbte oder spontan auftretende Genmutationen dazu führen, dass sich Proteine falsch falten, als unlösliche Klumpen oder Faserbündel in oder rund um Neurone ablagern und deren Funktion in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Der Typ des beteiligten Proteins, die Verteilung und die Auswirkungen der Klumpen variieren in Abhängigkeit von der Krankheit. Bei einigen neurodegenerativen Krankheiten spielt mehr als ein einziges falsch gefaltetes Protein eine Rolle, und in vielen Fällen setzen Proteinablagerungen lange vor dem Auftreten der ersten Symptome ein. Typisch für die Alzheimer-Krankheit ist beispielsweise die Ablagerung von Beta-Amyloid-Peptiden, die in den Zwischenräumen der Neurone sogenannte P ­ laques bilden, sowie von Tau-Protein, das in den Neuronen neurofibrilläre Knäuel bildet. Solche Anomalien breiten sich ganz ähnlich wie ein Virus von Zelle zu Zelle aus. Der Zelltod führt zu einem Schrumpfen des Gehirns, das normalerweise im Hippocampus einsetzt und zu Problemen bei Gedächtnis und räumlicher Orientierung führt. Dieses Schrumpfen lässt sich lange vor dem Auftreten von Symptomen auf Hirnscans erkennen, doch die Verklumpungen sind nur mikroskopisch nachweisbar; daher lässt sich eine definitive Diagnose gewöhnlich erst nach dem Tod des Patienten bei der Obduktion stellen. In ähnlicher Weise sind für die Parkinson-Krankheit Ansammlungen von falsch gefaltetem Alpha-Synuclein-Protein typisch, die in den Neuronen sogenannte Lewy-Körper bilden, sowie ein Absterben von Dopamin produzierenden Neuronen im Mittelhirn. Bei der Chorea Huntington (Huntington-Krankheit) spielt hingegen ein mutiertes Protein namens Huntington eine Rolle, das sich im Zellkern der Neurone anhäuft. Normalerweise werden falsch gefaltete Proteine und andere Zelltrümmer Die Obduktion zeigt Veränderungen, die eine extreme Form seniler Demenz darstellen ... merkwürdige, sich stark anfärbende Fibrillenbündel. Emil Kraepelin, deutscher Psychiater, in einer frühen Beschreibung der Alzheimer-Pathologie, 1910 Stichwort 237 Ursache oder Folge? Bei einigen neurodegenerativen Erkrankungen sind verklumpte Proteine eine direkte Ursache der Symptome, doch bei anderen ist der Zusammenhang nicht so klar. Allgemein wird angenommen, dass Ablagerungen von Beta-Amyloid und Tau-Protein Alzheimer hervorrufen und Medikamente, die diesen Prozess blockieren, der Krankheit vorbeugen oder sie verlangsamen können. Doch das muss erst noch eindeutig nachgewiesen werden – genauso gut könnte es sein, dass die Verklumpung eine Folge statt eine Ursache der Krankheit ist. abgebaut, entweder von Mikroglia, den »Haushaltszellen« des Gehirns, oder durch biochemische Reaktionen (im sogenannten Ubiquitin-LysosomSystem), die wie ein zellulärer Mülleimer wirken. Inzwischen häufen sich die Belege, dass diese Mechanismen bei neurodegenerativen Krankheiten nicht richtig funktionieren – das könnte erklären, warum sich falsch gefaltete Proteinen ansammeln, statt abgebaut und weggeräumt zu werden. Eine drohende Epidemie? Ererbte Mutationen können zu schweren, früh einsetzenden Fällen neurodegenerativer Krankheiten führen, doch die meisten Fälle sind sporadisch, und Alter ist der größte einzelne Risikofaktor. So verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, bei einem Alter über 65 alle fünf Jahre und erreicht nach dem 85. Lebensjahr rund 50 Prozent. Warum das so ist, wissen wir nicht, doch einige Forscher vermuten, dass neurodegenerative Krankheiten von einem beschleunigten normalen Alterungsprozess ausgelöst werden. Die Bevölkerung der westlichen Welt altert, teilweise aufgrund der dramatischen Zunahme der Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren, aber auch wegen der niedrigen Geburtenrate. Inzwischen sind mehr als die Hälfte der Menschen in Westeuropa und Nordamerika älter als 50 Jahre. Diese Zahl wird weiter steigen, wenn die Babyboomer-Generation in den kommenden Jahrzehnten in Rente geht; einige Experten vermuten daher, dass es zu einem starken Anstieg der Zahl der Menschen kommen wird, die eine neurodegenerative Krankheit entwickeln. Unter der Alzheimer-Krankheit, der häufigsten neurodegenerativen Erkrankung, leiden heute allein in Amerika schätzungsweise 5,4 Millionen Menschen; in Deutschland liegt die Zahl bereits bei über einer Million. Bis zum Jahr 2050 wird sich diese Zahl verdoppelt oder verdreifacht haben. Moheb Costandi 238 Die Welt im Kopf Drück mich! In Japan ist der Kuschel-Roboter »Paro« bei alten Menschen beliebt. Jetzt soll er auch in Europa verkauft werden. Demente Bewohner eines Altenheims in Baden-Baden haben ihn zwei Jahre lang getestet – und ins Herz geschlossen Plötzlich ist alle Lethargie gewichen. Herr Kühn hebt die Augenbrauen, Frau Mayer nippt noch einmal am Wasserglas, Frau Merz reckt den Hals, ein Lächeln gräbt tiefe Furchen in ihre Wangen. Es ist kurz vor halb zehn, die Therapeutin Wilma Falk tritt in der Altenwohngruppe des Baden-Badener Christinen-Stifts ihren Dienst an, unter dem Arm ein weißes Fellbündel. Schon von Weitem waren Laute zu hören gewesen wie von einem bettelnden Hündchen. »Ich habe Besuch mitgebracht«, sagt Falk überdeutlich. »Gell, ich hab’s doch versprochen!« Der Besuch heißt Paro und ist eine weiße Babyrobbe aus Plüsch, mit großen schwarzen Augen und viel Technik im Bauch, programmiert darauf, möglichst lebendig zu wirken. Seit zwei Jahren bringt Wilma Falk sie fast täglich mit. So lange testet das Christinen-Stift bereits, ob Plüschroboter alten Menschen Nähe und Geborgenheit geben können. Die Wohngruppe von Herrn Kühn, Frau Mayer und Frau Merz steht dabei im Mittelpunkt, alle Bewohner hier leiden an Demenz. Manche können sich Kleinigkeiten nicht mehr merken, ob es Käse oder Marmelade zum Frühstück gab zum Beispiel. Andere haben vergessen, wer sie sind. Behutsam bettet Wilma Falk das Plüschtier auf Frau Merz’ Schoß. Es windet sich ein wenig und juchzt. Erst als die Seniorin zärtlich seinen Kopf streichelt, hält es still und schließt andächtig die Augen. »Ja, du bist mir ein ganz ein Lieber«, flüstert sie. Roboter in Pflegeheimen? Auf die Idee kam der japanische Robotikforscher Takanori Shibata bereits in den 90er Jahren. Er hatte gelesen, dass ein Haustier Kranke und Alte aufheitern, ihren Stresslevel senken und so ihr Leben verbessern, womöglich sogar verlängern könne. Da aber die meisten nicht mehr für einen Hund oder eine Katze sorgen können oder sogar in Einrichtungen leben, die keine Tiere gestatten, erfand er Paro: eine Hausrobbe, die für Entspannung sorgen und das soziale Miteinander stärken soll, 57 Zentimeter groß, 2,7 Kilogramm schwer, abwaschbar. Die japanische Öffentlichkeit war wie so oft begeistert vom technischen Fortschritt, mehr als 1000 Robben für umgerechnet je 3200 Euro hat Shibata seit 2003 verkauft. Als jedoch vor ein paar Jahren die ersten Bilder von kuschelnden Können wir es uns leisten, eine Technik zu ignorieren, die die Lebensqualität alter Menschen erhöhen könnte?«, sagt Barbara Klein, Professorin für Pflegewissenschaften an der Fachhochschule Frankfurt. Das alternde Gehirn 239 Diese Plüschrobben sind Roboter, 57 Zentimeter lang, 2,7 Kilogramm schwer und gespickt mit Dutzenden Sensoren. In Paros Fall erzeugt die Technik eine perfekte Illusion – das Äußere und das Verhalten sind kanadischen Babyrobben nachempfunden. »Erst haben wir mit Hunde- und Katzen-Robotern experimentiert. Doch die wurden von vielen abgelehnt, weil sie eben nicht ganz genau wie ihre alten Haustiere waren«, erklärt Shibata. »Eine Robbe dagegen hat noch niemand besessen, deshalb wirkt Paros Verhalten auf die meisten ganz natürlich.« Um auf ihre Umwelt zu reagieren, hat sie Dutzende Sensoren: Lichtsensoren, um Tag und Nacht zu erkennen. Mikrofone, um bis zu 50 Stimmen auseinanderzuhalten. Und Drucksensoren, die Streicheleinheiten und Schläge registrieren. Ein Computer im Bauch verarbeitet die Eindrücke und steuert lautlose Motoren in Flossen, Hals und Lidern. Paro kuschelt, Paro nickt, Paro zwinkert. Frau Mayer ist heute dennoch nicht so gut auf ihn zu sprechen. Paro robbt auf dem Tisch herum, sie zupft an seiner rechten Flosse. Ein Winseln, er hebt den Kopf. »Was machst du für Sachen?«, schimpft sie. »Hast du schon wieder mein Glas ausgetrunken?« Dass die Robbe lebt, glaubt in der Demenzgruppe des Christinen-Stifts immerhin jeder Zweite. Aber auch die anderen lassen sich auf das Spiel ein. Niemand hat je erwähnt, dass eine Babyrobbe in Baden-Baden ja eigentlich nichts zu suchen habe. Niemand hat je gefragt, warum sie nicht wächst. »Sich in Paro einzufühlen ist wohl wie im Kino«, erklärt Christine Riesner, Pflegewissenschaftlerin 240 Die Welt im Kopf an der Universität Witten/Herdecke. »Da versetzt man sich ja auch in den Film hinein, obwohl das auf der Leinwand nur Schauspieler sind.« Bewohnern einer Demenzwohngruppe falle das noch leichter. Die meisten von ihnen leiden an Alzheimer, der Krankheit, die für etwa zwei Drittel aller Demenzfälle in Deutschland verantwortlich ist. Oft schleicht sie sich in den Alltag der Betroffenen ein: Sie stocken plötzlich mitten im Satz, weil ihnen ein geläufiges Wort nicht mehr einfällt. Sie kommen aus dem Supermarkt, in dem sie seit Jahren einkaufen, und wissen nicht mehr, ob es rechts oder links nach Hause geht. Sie wollen morgens den Briefkasten leeren und haben vergessen, welcher ihnen gehört. Schuld daran sind Eiweißpartikel, die sich zu Abermillionen im Hirn ablagern und Nervenzellen schädigen, vermuten Mediziner. In spezielle Wohngruppen wie die im Christinen-Stift kommen die Erkrankten oft erst, wenn das zerstörerische Werk noch weiter fortgeschritten ist. Wenn sie über Nacht verlernt haben, die Dusche zu bedienen oder den Herd wieder auszumachen, wenn sie ständig Angst haben, zu verhungern, obwohl der Kühlschrank randvoll ist. Dann geraten sie in die Situationen, in denen Shibatas Kuschelrobbe helfen soll: Sie schämen sich für ihre Ausfälle, reden weniger und werden manchmal depressiv, weil sie bemerken, wie ihr Ich verfällt. Sie leben mehr und mehr in einer eigenen Welt, in der die Mutter wieder eine junge Frau ist oder der verstorbene Ehemann gleich von der Arbeit heimkommt. Und oft fühlen sie sich dann unverstanden von allen anderen, wollen weglaufen oder werden aggressiv. »Herausforderndes Verhalten« heißt das dann auf Pflegedeutsch. Im Idealfall versuchen die Betreuer dann nicht, das krude Weltbild zu korrigieren. »Die Betroffenen auf ihre Defizite aufmerksam zu machen löst oft Ängste oder Abwehr aus«, sagt Christine Riesner. »Besser ist es, demente Menschen zu bestärken und sich mit ihnen über die Dinge zu unterhalten, an die sie sich noch erinnern können.« Eine Busfahrerin sollte man von ihrer Lieblingsroute erzählen lassen, auch wenn sie es zum hundertsten Mal tut. Und ein ehemaliger Hausmeister soll ruhig den ganzen Tag lang die Gartenmöbel hin und her räumen dürfen, wenn er sich dabei wohlfühlt. Bei Frau Burghard half Zuhören und gutes Zureden irgendwann nicht mehr, sie wurde depressiv und aggressiv. Der Hausarzt überwies sie in die Psychiatrie. »Dort bekam sie Psychopharmaka, und tatsächlich ging es ihr bald ein wenig besser«, erzählt Keller. »Als sie dann aber zurück zu uns kam, war sie nicht mehr die alte.« Es fiel ihr schwer, sich einzugewöhnen, den Aufenthaltsraum mit der Holzvitrine wieder als ihre Stube zu akzeptieren und sich im bunt bemalten Flur zurechtzufinden. Auch mit ihren Pflegern wollte sie nicht so recht sprechen. Bis Wilma Falk sie mit Paro bekannt machte. Frau Burghard lernte sein weiches Fell lieben, begann sich um den Roboter zu kümmern, deckte ihn abends zu, wenn die Programmierung ihn schläfrig werden ließ. Eines Tages nannte sie ihn »das Bubele« und behauptete steif und fest: »Der ist auf mich fixiert.« – »Der größte Erfolg war, dass wir ihre Medikamentendosis senken konnten, weil sie ausgeglichener und zufriedener wurde«, erinnert sich Keller. Das alternde Gehirn 241 Selbst wenn Frau Burghard wie heute einen schlechten Tag hat, in der Ecke des Aufenthaltsraums sitzt und eigentlich lieber allein sein möchte, macht sie für die Robbe eine Ausnahme. »Möchten Sie sich nicht zu Paro und den anderen setzen?«, fragt Keller. Frau Burghard schüttelt den Kopf. »Möchten Sie die Robbe vielleicht kurz mal halten?« Frau Burghard richtet den Blick aus dem Fenster, denkt nach. Dann streckt sie beide Arme aus und drückt Paro an sich. Ein Juchzen – die Robbe kuschelt zurück. Momente wie diesen gebe es dauernd, sagt Wilma Falk, auch mit den nicht dementen Bewohnern: »Wenn zwei sich streiten, hilft Paro, die Lage zu entspannen. Wenn ein Bewohner mal aufgedreht ist, wirkt das weiche Tier beruhigend.« Aber lassen sich diese Einzelfälle auch verallgemeinern? Takanori Shibata glaubt schon. In Pilotstudien sammelte er erste Hinweise auf eine therapeutische Wirkung der Robo-Robben. Einem Altenwohnheim im japanischen Tsukuba überließ er für drei Wochen zwei Paros und beobachtete mit Videokameras das Sozialleben. Und tatsächlich, die neuen Mitbewohner veränderten die Stimmung. Die Alten verbrachten mehr Zeit miteinander, unterhielten sich mit den Robben (»Guten Morgen, warst du auch ein guter Junge?«) – und über die Robben. (»Heute sieht er aber hungrig aus!«) Sogar Bewohner, die nie miteinander geredet hatten, kamen sich näher. Für ein zweites Experiment durften Besucher eines ambulanten Pflegezentrums fünf Wochen lang mit Paro spielen, ein Drittel war dement. Vorher und nachher sollten die Studienteilnehmer aus 20 gemalten Gesichtern jeweils das auswählen, das ihre Stimmung am ehesten widerspiegelte, zusätzlich nahmen die Forscher Urinproben. Der Versuch zeigte, dass sich nicht nur die Stimmung der meisten Alten besserte, sondern auch weniger Abbauprodukte des Stresshormons Cortisol in ihrem Urin nachzuweisen waren. Das Spielen hatte sie offenbar entspannt. »Besonders interessant war aber, dass wir die Betreuer einen Burn-out-Fragebogen ausfüllen ließen und auch bei ihnen eine Entlastung feststellen konnten«, sagt Takanori Shibata. Allerdings, schränkt der Forscher selbst ein, seien die Ergebnisse nur begrenzt aussagekräftig, zu klein war die Zahl der Studienteilnehmer. »Allein aufgrund der bemerkenswerten Einzelbeobachtungen lohnt es sich aber, Paro weiter zu erforschen«, sagt Barbara Klein. Sie plant mit britischen Kollegen eine internationale Studie, in der sie die Wirkung auf Heimbewohner und ihre Betreuer Die Roboter verändern die Stimmung. Die alten Menschen reden mit den Robben – und über sie. So kommen sie sich näher. 242 Die Welt im Kopf Das alternde Gehirn 243 genauer untersuchen will. Und auch Pflegeforscher der Universität Bremen haben sich schon an die Maternus-Kliniken gewandt, um die augenscheinlichen Erfolge mit Paro zu überprüfen. »Aber selbst wenn sich eine therapeutische Wirkung eindeutig nachweisen ließe, wären Roboter wie Paro kein Allheilmittel«, sagt Klein. In vielen Heimen fehlten bislang ausreichende Betreuungsangebote. »Das können auch Robben nicht gut machen. Sie können nur ein Arbeitsmittel für Pflegekräfte sein wie zum Beispiel auch Handpuppen oder Besuchshunde, und sie müssen in das Gesamtkonzept passen.« Ähnlich sieht das der Pflegeexperte Claus Fussek. Er nannte es vor Jahren noch »pervers«, Roboter zu streicheln. »Am Ende entscheidet aber das Motiv darüber, ob sie in der Pflege einen Platz haben sollten. Geht es darum, dass Pflegekräfte das Leben dementer Menschen würdevoller gestalten wollen, sind sie hilfreich. Geht es aber nur darum, Geld zu sparen, sind sie ein Skandal!« Im Christinen-Stift wird demnach bisher alles richtig gemacht. Wilma Falk lässt die Bewohner nie aus den Augen, wenn sie mit Paro spielen. Wie so oft, versucht sie auch heute über ihn ins Gespräch zu kommen. Vorsichtig reicht sie die Robbe wieder zurück an Frau Merz. »Sie mögen Tiere, oder?« »Ja.« »Haben Sie nicht einmal auf einem Bauernhof gewohnt?« »Doch, da hatten wir Schweine und einen Hofhund.« »Aber keine Robbe, oder?« »Nee, so einen Lieben nicht.« Dann beugt sich Herr Kühn von der Seite mit einer Babybürste herüber und beginnt, Paro zu striegeln und ihm leise vorzusingen: »Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt – Erika. Heiß von hunderttausend kleinen Bienelein wird umschwärmt – Erika.« Frau Merz stimmt ein. von Jens Uehlecke aus ZEIT Wissen Nr. 6/2008 244 Die Welt im Kopf Autorenverzeichnis Harro Albrecht Harro Albrecht studierte Medizin an der Universität Hamburg und war Redakteur des Spiegel. Seit 2000 ist er Redakteur im Wissenschaftsressort der ZEIT. Ulrich Bahnsen Ulrich Bahnsen studierte Biologie in Hamburg und arbeitet seit 1994 als Wissenschaftsjournalist. Seit 2001 ist er Redakteur im Ressort Wissen der ZEIT. Nils Boeing Niels Boeing studierte Physik und Wissenschaftstheorie in A ­ achen und Berlin. Er war Ressortleiter bei der Woche, arbeitet heute als freier Journalist und ist Autor bei ZEIT Wissen. Anhang Autorenverzeichnis • Bildnachweis Christine Böhringer Christine Böhringer studierte Geschichte, Kommunikationsund Medienwissenschaft sowie Umweltwissenschaften in Basel. Sie ist Absolventin der Henri-Nannen-Journalistenschule und arbeitet als freie Journalistin mit den Schwerpunkten Wissen, Medizin und Bildung. Kerstin Bund Kerstin Bund studierte Kommunikationswissenschaft und Wirtschaft an der Universität Hohenheim. Seit 2009 ist sie Redak­teurin im Wirtschaftsressort der ZEIT. Moheb Costandi Moheb Costandi ist Neurowissenschaftler und Wissenschaftsautor. Er hat zahlreiche Artikel in Wissenschaftsjournalen veröffentlicht, darunter in Nature, New Scientist, Science und Scientific American. Zudem schreibt er das Blog Neurophilosophy des Guardian. Er lebt in London. Autorenverzeichnis 247 Adrian Furnham Adrian Furnham ist Professor für Psychologie am University College London (UCL). Er ist Fellow der British Psychological Society, ehemaliger Präsident der International Society of Individual Differences und schreibt regelmäßig für die Sunday Times und den Daily Telegraph. Jochen Reinecke Jochen Reinecke ist freier Journalist und lebt in Berlin. Christiane Grefe Christiane Grefe studierte Politikwissenschaft und besuchte die Journalistenschule in München. Sie schrieb für Natur, GEO und das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Seit 1999 arbeitet sie als Reporterin im Berliner Büro der ZEIT. Marcus Rohwetter Marcus Rohwetter ist studierter Jurist und seit 2000 Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT. Fritz Habekuß Fritz Habekuß studierte Wissenschaftsjournalismus mit den Schwerpunkten Biowissenschaften und Medizin in Dortmund. Seit 2014 ist er Redakteur im Ressort Wissen der ZEIT. Ulrich Schnabel Ulrich Schnabel studierte Physik und Publizistik an der Universität Karlsruhe und an der FU Berlin und arbeitet seit 1993 als Wissenschaftsredakteur für die ZEIT. Birgit Herden Birgit Herden hat in Deutschland und Israel Biochemie studiert. Sie war Redakteurin von Vanity Fair und arbeitet heute als freie Wissenschaftsjournalistin. Stefanie Schramm Stefanie Schramm studierte Volkswirtschaftslehre und Politik und besuchte die Kölner Journalistenschule. Seit 2005 schreibt sie für das Ressort Wissen der ZEIT. Tobias Hürter Tobias Hürter studierte Philosophie und Mathematik in München und Berkeley. Er war Redakteur bei der MIT Technology Review und bei der ZEIT und ist jetzt stellvertretender Chefredakteur des Philosophiemagazins Hohe Luft. Werner Siefer Werner Siefer studierte Neurobiologie in München und Madurai (Südindien). Er ist freier Wissenschaftsjournalist und Buchautor; zuletzt erschien von ihm »Wir und was uns zu Menschen macht« im Campus Verlag. Katharina Kluin Katharina Kluin, geboren 1980, schreibt seit ihrer Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule über Psychologie, Medizin und Gesellschaft. Als freie Autorin arbeitete sie unter anderem für stern, GEO und ZEIT WISSEN. Seit 2009 ist sie Redakteurin beim stern. Victor Smetacek Victor Smetacek ist Meeresbiologe und Leiter des Fachbereichs Pelagische Ökosysteme am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Josephina Maier Josephina Maier studierte Wissenschaftsjournalismus in Darmstadt. Seit 2008 schreibt sie regelmäßig für das Ressort Wissen der ZEIT. Jetzt studiert sie Medizin und arbeitet als freie Wissenschaftsjournalistin in Hamburg. 248 Franz Mechsner Franz Mechsner war bis 2012 außerordentlicher Professor für Psychologie an der Northumbria University im britischen Newcastle. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge für deutsche und internationale Zeitschriften. Peter Spork Peter Spork ist Wissenschaftsautor und Neurobiologe und berichtet seit Jahren aus der Welt der Schlafforschung. In seinem aktuellen Buch »Wake up!« plädiert er für eine ausgeschlafenere Gesellschaft. Autorenverzeichnis 249 Jens Uehlecke Jens Uehlecke hat Politikwissenschaften in Hamburg studiert sowie Business Administration, Entrepreneurship und Innovation in Berkeley, Kalifornien. Zwischen 2008 und 2013 war er Redakteur des Magazins ZEIT WISSEN in Hamburg und San Francisco; heute leitet er »Greenhouse«, das Innovation Lab von Gruner + Jahr. Thomas Vasek Thomas Vasek war Chefredakteur von Technology Review und P.M.; außerdem ist er Gründungs-Chefredakteur des Philosophiemagazins Hohe Luft. Julia Völker Julia Völker ist Ärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Heidelberg. Als ausgebildete Wissenschaftsjournalistin schreibt sie unter anderem für ZEIT ONLINE und GEO WISSEN. Bildnachweis Umschlag 4r3p /Westend61/Strandperle Kap. 1 Wunderwerk Gehirn Im Labyrinth des Denkens: Seite 21, Nicolas Righetti/rezo.ch; Seite 22, EPFL/Alain Herzog. Ich bin zwei: Seite 32, ZEIT- ­Info­ grafik, Jelka Lerche; Seite 36/37, Appold/plainpicture. Sind die Gedanken noch frei?: Seite 40, Michael Körner/action press; Seite 43, MARK STROZIER/VintageMedStock/Archive Photos/ Getty Images; Seite 47, ZEIT-Infografik. Bauteile für die Seele: Seite 56, ZEIT-Infografik, Jelka Lerche; Seite 58, MFK MedizinFotoKöln. Die Zellen des Anstoßes: Seite 62, privat; Seite 65, Basso Cannarsa/LUZphoto/fotogloria. Die große Neuro-Show: Seite 72, ZEPHYR/SPL/Agentur Focus. Kap. 2 Grenzzustände des Gehirns Jenseits von Gut und Böse: Seite 78, ZEIT-Infografik. Die Dramaturgie der Nacht: Seite 94, ZEIT-Infografik, Jelka Lerche; Seite 96/97, ZEIT-Infografik; Seite 98, ZEIT-Infografik. Leerlauf im Kopf: Seite 102, privat. Das Ringen um Worte: Seite 109, Ann States 2008/laif. Kap. 3 Die Sinne Auf den Geschmack gekommen: Seite 117, Claes Bech-Poulsen/ www.claasbp.com für NordicFoodLab; Seite 122, Erik Refner/ The New York Times/Redux/laif; Seite 123, NordicFoodLab; Seite 123, Claes Bech-Poulsen. Trau den Augen nicht: Seite 133, Benjamin Doerr. Der sechste Sinn: Seite 144, Vitaly Titov & Maria Sidelnikova/Shutterstock. Volle Dröhnung: Seite 156/157, Ela Strickert. Kap. 4 Das erkrankte Gehirn Immer auf der Kippe: Seite 162, Asklepios Klinik Nord; Seite 189, Dominik Gigler. 250 Bildnachweis 251 Kap. 5 Das alternde Gehirn Ist Alzheimer angeboren?: Seite 214/215, ZEIT-Infografik, Anne Gerdes; Seite 216, ZEIT-Infografik, Anne Gerdes. Damit die Würde bleibt: Seite 224, ZEIT-Infografik, Quelle: DemenzReport 2011 des Berlin Instituts für Bevölkerung und Entwicklung; Seite 227, ZEIT-Infografik, Quelle: Demenz-Report 2011 des Berlin Instituts für Bevölkerung und Entwicklung; Seite 230/231, Pavel Prokopchik/The New York Times/Redux/laif; Seite 240, Silke Wernet/laif; Seite 243, Silke Wernet/laif. 252











