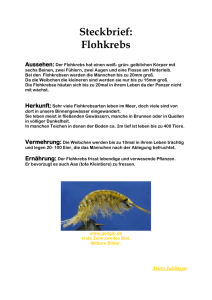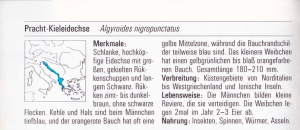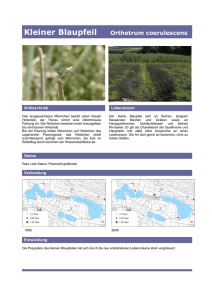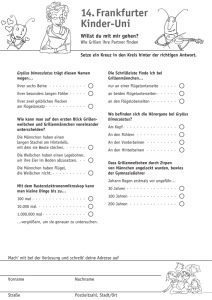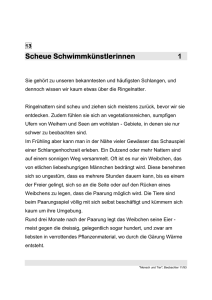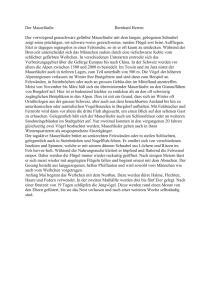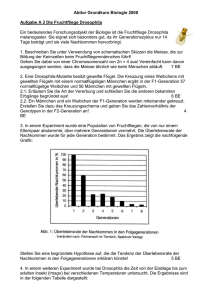Vorwort zur zweiten Auflage - Konrad Lorenz Forschungsstelle
Werbung
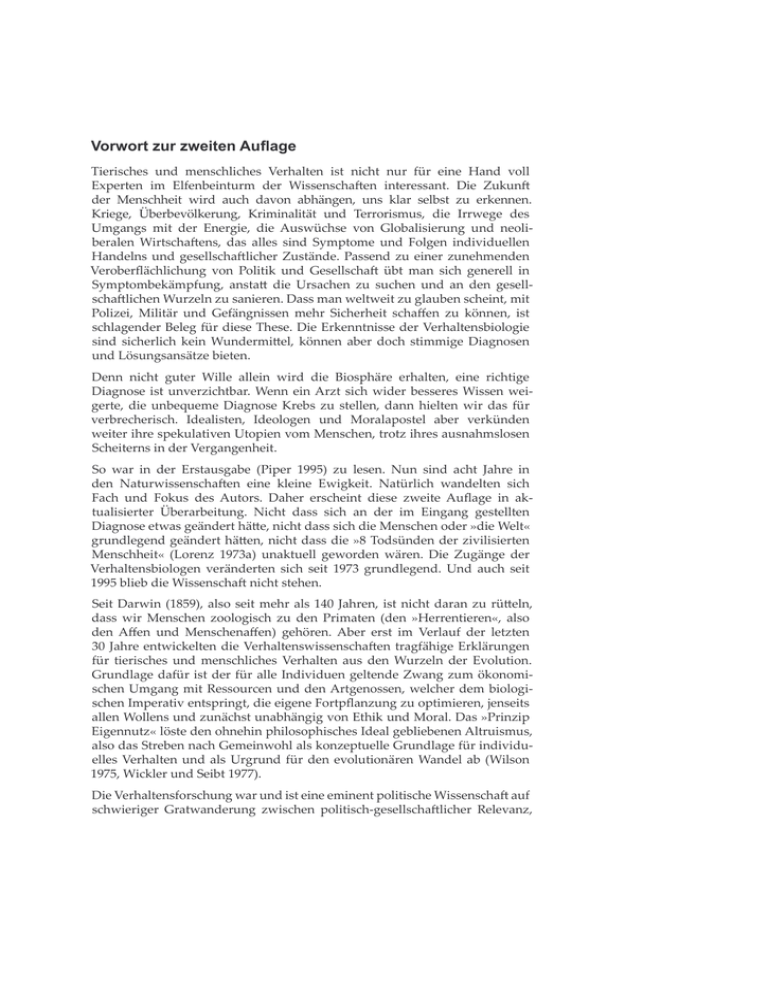
Vorwort zur zweiten Auflage Tierisches und menschliches Verhalten ist nicht nur für eine Hand voll Experten im Elfenbeinturm der Wissenscha�en interessant. Die Zukun� der Menschheit wird auch davon abhängen, uns klar selbst zu erkennen. Kriege, Überbevölkerung, Kriminalität und Terrorismus, die Irrwege des Umgangs mit der Energie, die Auswüchse von Globalisierung und neoliberalen Wirtscha�ens, das alles sind Symptome und Folgen individuellen Handelns und gesellscha�licher Zustände. Passend zu einer zunehmenden Veroberflächlichung von Politik und Gesellscha� übt man sich generell in Symptombekämpfung, ansta� die Ursachen zu suchen und an den gesellscha�lichen Wurzeln zu sanieren. Dass man weltweit zu glauben scheint, mit Polizei, Militär und Gefängnissen mehr Sicherheit schaffen zu können, ist schlagender Beleg für diese These. Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie sind sicherlich kein Wundermi�el, können aber doch stimmige Diagnosen und Lösungsansätze bieten. Denn nicht guter Wille allein wird die Biosphäre erhalten, eine richtige Diagnose ist unverzichtbar. Wenn ein Arzt sich wider besseres Wissen weigerte, die unbequeme Diagnose Krebs zu stellen, dann hielten wir das für verbrecherisch. Idealisten, Ideologen und Moralapostel aber verkünden weiter ihre spekulativen Utopien vom Menschen, trotz ihres ausnahmslosen Scheiterns in der Vergangenheit. So war in der Erstausgabe (Piper 1995) zu lesen. Nun sind acht Jahre in den Naturwissenscha�en eine kleine Ewigkeit. Natürlich wandelten sich Fach und Fokus des Autors. Daher erscheint diese zweite Auflage in aktualisierter Überarbeitung. Nicht dass sich an der im Eingang gestellten Diagnose etwas geändert hä�e, nicht dass sich die Menschen oder »die Welt« grundlegend geändert hä�en, nicht dass die »8 Todsünden der zivilisierten Menschheit« (Lorenz 1973a) unaktuell geworden wären. Die Zugänge der Verhaltensbiologen veränderten sich seit 1973 grundlegend. Und auch seit 1995 blieb die Wissenscha� nicht stehen. Seit Darwin (1859), also seit mehr als 140 Jahren, ist nicht daran zu rü�eln, dass wir Menschen zoologisch zu den Primaten (den »Herrentieren«, also den Affen und Menschenaffen) gehören. Aber erst im Verlauf der letzten 30 Jahre entwickelten die Verhaltenswissenscha�en tragfähige Erklärungen für tierisches und menschliches Verhalten aus den Wurzeln der Evolution. Grundlage dafür ist der für alle Individuen geltende Zwang zum ökonomischen Umgang mit Ressourcen und den Artgenossen, welcher dem biologischen Imperativ entspringt, die eigene Fortpflanzung zu optimieren, jenseits allen Wollens und zunächst unabhängig von Ethik und Moral. Das »Prinzip Eigennutz« löste den ohnehin philosophisches Ideal gebliebenen Altruismus, also das Streben nach Gemeinwohl als konzeptuelle Grundlage für individuelles Verhalten und als Urgrund für den evolutionären Wandel ab (Wilson 1975, Wickler und Seibt 1977). Die Verhaltensforschung war und ist eine eminent politische Wissenscha� auf schwieriger Gratwanderung zwischen politisch-gesellscha�licher Relevanz, 8 Vorwort zur zweiten Auflage Anbiederung und Missbrauch. So wurde schon Darwin vor den Karren des Sozialdarwinismus gespannt, Pawlow und Skinner mussten zur Stütze eines konformen Menschenbildes in so gegensätzlichen Gesellscha�ssystemen, wie dem Sovietstaat und der US-Demokratie herhalten. Schließlich geriet die Biologie zu einer der wichtigsten Stützen der NS-Ideologie, für Rassenwahn und »Ausmerzung unwerten Lebens«. Und noch 60 Jahre danach sind Scha�en geblieben. Verständlich die besonders in Mi�eleuropa immer noch verbreitete Skepsis bezüglich der Verbindung zwischen Erkenntnissen der Biologie, menschlichem Verhalten und Gesellscha�. Genetiker und Molekularbiologen, vor allem aber Verhaltenswissenscha�ler sollte diese Vergangenheit immer an ihre Verantwortung erinnern. Trotzdem: Das evolutionäre Gewordensein auch des Menschen wurde nicht von Ideologen erfunden. Menschen entstanden wie alle Tiere im Verlauf der Evolution. Wir haben uns damit auseinanderzusetzen, denn es wäre absurd, in einer Zeit, in der die Menschheit in rascher Abfolge in immer he�igere Krisen schli�ert, aus ideologischen Gründen die evolutionäre Basis für das Verhalten des Menschen auszublenden. Natürlich hat es sich auch unter den Verhaltensbiologen herumgesprochen, dass Menschen und Tiere trotzdem nicht bloß die egoistischen Sklaven ihrer Gene sein müssen. Dafür sorgt das menschliche Gehirn und unsere Neigung, friedlich in Kleingruppen zu leben (Chance 1988). Aber auch Gehirn, soziales Verhalten, Verstand, Bewusstsein, ja selbst unsere Neigung zur Selbstreflektion durch Philosophie und Religion fielen nicht einfach vom Himmel, sondern entstanden als überlebensfördernde kognitive Werkzeuge im Verlauf der Evolution (Lorenz 1978, Riedl 1981a). Gerade auf Basis dieses Verstandes definieren wir Menschen uns so gerne als Kulturwesen und sind blind, ja abweisend-ignorant gegenüber unserer biologischen Herkun�. Aber Natur und Kultur sind kein Gegensatzpaar; es geht heute vielmehr darum, die biologische Basis der Kulturentstehung zu verstehen. Im Buch möchte ich mich mit jener Wissenscha� auseinandersetzen, die es als Einzige versucht, tierisches und menschliches Verhalten im evolutionären Zusammenhang zu erklären. Da sich Soziologie und Psychologie nur auf den Menschen konzentrieren, fehlt ihnen schlicht die vergleichende Perspektive und daher die evolutionäre (Außen-)Sicht für menschliches Verhalten. Diese Feststellung gilt trotz Erstarken der »evolutionären Psychologie«, vor allem in den USA. Ein zunehmender Verlust der vergleichenden Perspektive könnten die allzu sehr mensch-zentrierten Ansätze wieder in jene alte Sackgassen führen, gegen die besonders Konrad Lorenz in den 1930er Jahren antrat. Konrad Lorenz und die Folgen Die Erfahrungen als Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie in Grünau im oberösterreichischen Almtal ließen meinen Beschluss reifen, dieses Buch zu schreiben. Aus vielen Kontakten mit allen Schichten der Bevölkerung und mit vielen Vertretern der Medien wurde klar, wie groß das öffentliche Interesse an der Verhaltensforschung und an Konrad Lorenz Konrad Lorenz und die Folgen 9 noch immer ist. Diesem Interesse steht aber ein meist nur recht bescheidener Informationsstand gegenüber. Dies nährt selbst bei Interessierten manch seltsames Missverständnis. So sieht man Verhaltensforscher noch immer gerne als Leute, welche verträumt an romantischen Orten das muntere Treiben von putzigen Tierchen belauschen, darob einerseits verzückt über die Harmonie in der Natur sinnieren und andererseits düster über die menschliche Bosheit und Unvernun� lamentieren. Am Zustandekommen dieses Gartenlaubenklischees waren Konrad Lorenz und jene, die sein spätes Image prägten, nicht ganz unbeteiligt. Wo Information nicht klar genug durchdringt, schaffen Medien und Meinungsmacher gemeinsam mit ihren Konsumenten sta� dessen eben ihre eigenen Klischees. Ungeachtet der Fakten bestimmt das Image, also die eigentlich relevante Wahrheit in den Köpfen der Menschen, unser Handeln. Diese kann man entweder erfüllen, oder man kann versuchen, gegenzusteuern; auch ein Ziel dieses Buches. Das Bild der Verhaltensforschung ist in der deutschsprachigen Öffentlichkeit noch immer durch Konrad Lorenz geprägt. Er war schon zu Lebzeiten ein Mythos und einzigartig populär. Daher ist für uns, die wir versuchen, durchaus in seiner Tradition moderne Verhaltenswissenscha�en zu betreiben, diese Aufgabe einfach und schwierig zugleich. Einfach, weil der Name Lorenz immer noch einen guten »Trade mark« darstellt, trotz aller Mäkelei an seiner Theorie (Zippelius 1992a,b) und trotz seiner immer wieder thematisierten »braunen Flecken« (Föger und Taschwer 2002; Kotrschal u. a. 2001b); schwierig, weil dem Erbe von Konrad Lorenz wohl niemand neutral gegenübersteht. Das kann zu solch absurden Auswüchsen führen, dass Verhaltensbiologen allesamt eine (politisch) »rechte« Gesinnung angehängt wird. Wir sind nicht die Gralshüter der Lorenzschen Tradition. Aber wir stehen zum vergleichenden, naturwissenscha�lich-evolutionären Ansatz der Erforschung von Verhalten. Nicht alle Erkenntnisse überdauerten, die ethologische Theorie entwickelte sich dynamisch weiter und erlebte mit dem Paradigmenwechsel von der Gruppen- zur Individualselektion sogar eine regelrechte Revolution. Lebendige Wissenscha� bleibt eben nicht stehen. Nüchtern betrachtet, war Konrad Lorenz weder der »Vater der Vergleichenden Verhaltensforschung«, noch stellte er die Ethologie rechtzeitig auf ein tragfähiges evolutionäres Fundament. Dies überließ er grollend den Öko-Ethologen und Soziobiologen. Trotzdem, das Gesamtgebäude blieb intakt und steht heute stärker denn je. Manche der »klassischen« Konzepte der Ethologie gewinnen gerade in der modernen Verhaltensbiologie wieder an Bedeutung. Lorenz ist zwar nicht Haup�hema dieses Buches, wird aber wiederholt Ausgangspunkt und Eckpfeiler für Ausflüge in die merkwürdig mäandrierenden Muster wissenscha�licher Moden sein, aber auch für die Diskussion, wie »objektiv« von konkreten Menschen betriebene Wissenscha� denn eigentlich sein kann. Noch immer löst Lorenz Kontroversen aus. Auch ein Zeichen dafür, dass er Wichtiges zu sagen ha�e. 10 Vorwort zur zweiten Auflage Entwicklungsskizze Es sollen in diesem Buch verschiedene Geschichten erzählt werden: Von der Tierpsychologie, und deren Weg in die Ethologie, von der Weiterentwicklung in die Soziobiologie und Öko-Ethologie und von deren gegenwärtigen, manchmal recht seltsam anmutenden Verzweigungen bis in die Niederungen menschlicher Spermakonkurrenz. Wissenscha� wird an konkreten Orten und in den Köpfen von Menschen aus Fleisch und Blut gemacht. In ihrem Streben nach Perfektion sind alle Wissenscha�ler fehlbar und müssen Kompromisse eingehen. Es war Karl Popper, der in Gegenposition zu den Positivisten darauf hinwies, dass Naturwissenscha� fehlbar sein muss. Unsere Ergebnisse sind nie sterile Perfektion, unumstößliche Wahrheit; sie entstehen im Spannungsfeld zwischen menschlicher Wahrnehmung und Kommunikation und disziplinierender Methodik. Auch darum soll dieses Buch auch von Menschen, Tieren und deren Zusammenwirken an unserer Grünauer Forschungsstation handeln. Solche Beispiele sollen es erleichtern, den Wandel in der internationalen Verhaltensforschung nachzuvollziehen. Die naturwissenscha�liche Forschung boomt und die »weißen Flecken« in unserer Kenntnis von den Vorgängen in der Natur werden kleiner. Aber ist deswegen alles ausgeforscht? Keineswegs! Verblüffend, wie scheinbar geringfügige Paradigmenwechsel eine volle, neue Drehung der Wissenscha�sspirale verursachen, so etwa der Wechsel von der noch von Konrad Lorenz und Niko Tinbergen vertretenen Gruppenselektion zur Individualselektion von William. B. Hamilton, Richard Dawkins und Edward O. Wilson. Dieser Paradigmenwechsel führte zu einer völlig neuen, o� verblüffenden Sicht bereits bekannter Dinge und zu einem beinahe beängstigendem Erklärungspotential der evolutionären Verhaltensbiologie. Es wäre aber gefährlich, in sa�er Zufriedenheit anzunehmen, dass wir nun die Welt erklärt hä�en. Im ständigen Spiralprozess zwischen Theoriebildung und deren Überprüfung durch Daten sind neue Annäherungen an die Wirklichkeit zu erwarten, die wir jetzt noch nicht vorhersehen können. Zweifellos, mit zunehmender Einsicht in die komplexen biologischen Systeme werden die Erklärungen der Welt nicht gerade einfacher. Damit müssen wir leben. Ist Musterbildung im Meer chaotischer Information nicht eine Grundeigenscha� lebender Systeme? Die Essenz der evolutionären Mechanismen liegt im Informationstransfer. In unserer Informationsgesellscha� scheint Kulturinformation hart mit der genetischen um diesen Transfer zu konkurrieren. Die Verhaltensmechanismen, die in der Weitergabe beider Arten von Information zum Einsatz kommen, sind nahezu identisch. Auch deswegen werde ich argumentieren, dass die besonders von den Geisteswissenscha�en gepflegten Gegensätze zwischen Natur und Kultur, zwischen Tier und Mensch völlig obsolet sind (vgl. Eibl-Eibesfeldt 1995). Gleichzeitig aber sind dem naturwissenscha�lichen Erkenntnisdrang methodische und prinzipielle Grenzen gesetzt. Naturwissenscha� definiert sich auch im Anrennen gegen solche Grenzen. Neue Durchbrüche ergeben Noch einige Vorbemerkungen 11 sich o� durch neue methodische Zugänge. Oder manchmal einfach durch Kombination und Neubewertung bereits vorhandenen Wissens. Kümmerte sich die Ethologie zunächst um das »arteigene Verhalten«, so liegt der Fokus immer konsequenter auf dem Individuum, was sich in neuesten Untersuchungen zur evolutionären Funktion von Persönlichkeit niederschlägt. Die Herausforderungen der Zukun� werden in den Kapiteln zu den Brennpunkten der gegenwärtigen Verhaltenswissenscha�en diskutiert. Bereitwillig gebe ich zu, dass Sichtweise und Themenauswahl subjektiv sind. Möglicherweise blieben gerade die wichtigsten Zukun�sthemen unberücksichtigt. Wer weiß, was sind die Maßstäbe? Noch einige Vorbemerkungen Vor dem Blick in die Zukun� sollen die begrifflichen Schubladen der Verhaltensforschung mit Inhalt gefüllt werden. Vieles hieran ist nicht neu, nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber so wie Recycling-Flaschen gleiche Inhalte wieder und wieder transportieren, ist es auch mit geistigen Inhalten: Sie müssen immer wieder neu verpackt und unter die Leute gebracht werden, damit die Klu� zwischen Wissenscha� und der Öffentlichkeit (also jenen Leuten, die unsere Forschung bezahlen) nicht zu groß wird. Redundanz ist ein Grunderfordernis jedweder Öffentlichkeitsarbeit. Und die hat die Verhaltensbiologie dringend nötig, will sie etwas erreichen. Aus diesem Grund ist das Buch weniger für eine Handvoll ohnehin eingeweihter Kollegen gedacht; vielmehr wünsche ich mir ein breites Publikum interessierter Leser, von denen ich bereits viele als Besucher unserer Station kennenlernen dur�e. Daher ist der Stil dieses Buches nicht rein wissenscha�lich, und Rhythmuswechsel zwischen erzählerischen und eher theoretischen Teilen sind beabsichtigt. Im Interesse der Lesbarkeit wird einige Fach- und Hintergrundinformation in Exkursen ausgeführt, die man lesen kann, aber nicht unbedingt muss. Diese Exkurse sind durch unterschiedlichen Satz kenntlich. Fachjargon wurde weitgehend vermieden, bzw. in einem Glossar am Ende des Tex�eils erklärt. Und manch scheinbare sprachliche Vermenschlichung tierischen Verhaltens dient der Umschreibung komplexerer Sachverhalte. Wenn es etwa heißt, ein Tier könne zwischen alternativen Strategien »wählen«, oder es »treffe Entscheidungen«, dann ist eine evolutionäre Voreinstellung, nicht unbedingt eine kognitive Leistung bzw. rationales Abwägen gemeint. Und wenn ich über »Tiere« schreibe, dann sind in der Regel auch die »Menschen« gemeint; umgekehrt steht »Mensch« nicht für »Krone der Schöpfung«, sondern für eine der vielen Arten von Wirbeltieren. Anthropozentrismus, also das Hervorheben der Einzigartigkeit des Menschen und allzu menschenzentrierte Forschung war immer schon erkenntnishemmend. Eine letzte Vorbemerkung betri� die Bezeichnung für das Gesamtfach. Die deutschen Begriffe »Verhaltensforschung« oder »Verhaltensbiologie« schließen alle Arbeitsrichtungen ein und eignen sich daher recht gut als Überbegriff. Dasselbe tri� auf die anglo-amerikanische Bezeichnung »animal behaviour« zu. Der Begriff »Ethologie« war lange Zeit der Lorenz-Tinbergenschen 12 Vorwort zur zweiten Auflage Richtung vorbehalten und wurde abgrenzend vor allem gegenüber dem Behaviorismus, später auch gegenüber der Soziobiologie gebraucht. Heute wird »Ethologie« vielfach für das Gesamtfach verwendet (Barlow 1989), so auch in diesem Buch. Wo der Begriff im historischen Sinne, also abgrenzend verwendet wird, ist dies erkennbar. Dank Dass dieses Buch entstehen konnte, ist vor allem auf den Fortbestand der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie im Almtal zurückzuführen. Darum ist es eine angenehme Pflicht, allen jenen zu danken, die ihren Teil dazu beitrugen, dass diese kleine, aber einzigartige Einrichtung samt ihrer freilebenden Graugansschar auch über den Tod von Konrad Lorenz im Jahre 1989 nicht nur weiterbestehen, sondern sich über die Jahre recht produktiv entwickeln konnte. Zu nennen sind der damalige Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Ratzenböck, sowie sein Nachfolger, Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Dr. Erhard Busek, Ernst August, Prinz von Hannover, die Vertreter der Herzog-von-CumberlandSti�ung und dem Cumberland Wildpark, anfangs Dipl. Ing. Karl Hüthmayr und nun schon seit vielen Jahren Dipl. Ing. Harald Lindner und Mitarbeiter. Dank an das Zoologische Institut der Universität Wien und dem Inhaber des Lehrstuhles für Ethologie, o. Prof. Dr. John Di�ami für das Abstellen zweier Mitarbeiter (K. Kotrschal und J. Hemetsberger) nach Grünau und für die gute Zusammenarbeit. Projekte wurden von der Österreichischen Nationalbank (OeNB) und dem Fonds zur Förderung der wissenscha�lichen Forschung in Österreich (FWF) finanziert. Ein herzliches Dankeschön den Mitgliedern des Trägervereins, die unsere Arbeit jährlich mit einem nicht unbeträchtlichen Obulus unterstützen, sowie der Gemeinde Grünau, für welche die Forschungsstelle auch als touristischer Imageträger fungiert. Großen Dank vor allem auch unserem Sponsor, der Firma Mayr Schulmöbel. Viele Studenten, die hier nicht namentlich genannt werden können, halfen uns ganz entscheidend mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Einsatzfreude. Ihnen verdanken wir unsere Produktivität. Schließlich möchte ich meiner Frau Rosemarie und meinen Kindern Katharina und Alexander für ihre Geduld und für ihren Rückhalt danken. Allen diesen Personen und Institutionen ist dieses Buch gewidmet. 13 Ziele und Fragen der modernen Verhaltensforschung: Von den Mechanismen zur evolutionären Funktion Warum Verhalten? Viele Fragen – einige Antworten Warum träumen wir? Warum schlagen wir am Morgen die Augen auf? Warum stehen wir nach dem Aufwachen auf oder bleiben liegen? Diese Fragen sind nur vordergründig trivial. Wenn etwa ein Choleriker seinen regelmäßigen Wutanfall bekommt, so erklären das die Psychologen und Sozialwissenscha�ler wohl vor allem aus seiner aktuellen Reizsituation und seinem gegenwärtigen und früheren (sozialen) Umfeld. Den Physiologen werden die Geschlechts- und Stresshormonwerte sowie der Blutdruck interessieren, einen Verhaltensgenetiker wahrscheinlich die Verbreitung innerhalb der Verwandtscha� und die Erblichkeit der mangelnden Impulskontrolle. Die klassischen Ethologen gingen erst mal daran, die Form dieses Wutanfalls genau zu beschreiben und seine Auslöser und Motivationsabhängigkeit bzw. seine Abhängigkeit von physiologischen Faktoren zu untersuchen. Dann würden die Ethologen die Ausdrucksformen von Wut innerhalb unserer nächsten Verwandten, der Menschenaffen, vergleichen, eine Stammesgeschichte des Wutanfalls rekonstruieren und schließlich über den Anpassungswert dieses Verhaltens spekulieren. Die Öko-Ethologen und Soziobiologen hingegen suchten gleich nach Wegen, den Anpassungswert tatsächlich nachzuweisen, und stellten die Frage nach der Fitnessrelevanz (gemessen in Zahl von Nachkommen) der Wutanfälle. So theoretisch dieses Beispiel auch scheinen mag: Ähnliches erhob unlängst der englische Primatologe R. Dunbar anhand von Wikingersagas. Er fand, dass in der Mordgesellscha� der Wikinger in Familien mit einem »Berserker« (triebha�-gewal�ätiger Kämpfer) signifikant mehr junge Männer überlebten, weil Nicht-Berserkerfamilien aufgrund der vom Berserker ausgehenden Gefahr eher bereit waren, ansta� Blutrache zu üben, eine Kompensationszahlung von Seiten der Berserkerfamilie zu akzeptieren. Daher überlebten mehr männliche Mitglieder einer Berserkerfamilie. Aber das nur nebenbei. Alle diese Fragen und Ansätze beleuchten jede für sich nur einen Teilbereich. Will man Verhalten möglichst vollständig erklären, dann braucht man alle Ebenen. Im Lichte dieser schlichten Erkenntnis scheint der alte Kompetenzstreit um die Exklusivlizenz zur Erklärung menschlichen Verhaltens zwischen Ethologen und Psychologen lächerlich, es sei denn, man sieht den Menschen als abgehoben von seinen tierischen Verwandten, ohne Wurzeln in der Evolution. Warum Vögel singen: Physiologie Ein klassisches Beispiel zur Verdeutlichung des Prinzips der unterschiedlichen Erklärungsebenen (Tinbergen 1963, Exkurs 1,2) stellt der Vogelgesang dar (Krebs und Davies 1993). Es ist bekannt, dass die Männchen vieler Vogelarten vor allem im Frühling singen. Sie tun dies, weil ihr Blutspiegel an männlichem Geschlechtshormon im Frühjahr ansteigt. Das passiert, weil es 14 Ziele und Fragen der modernen Verhaltensforschung eine innere Jahresuhr gibt, welche dem Organismus mi�eilt, wann Frühling ist. Diese innere Uhr wird über den Lichtrhythmus, die Temperatur und andere sogenannte »Zeitgeber« feinjustiert. Dies wäre die physiologische oder funktionelle, in der englischen Fachliteratur auch »proximat« (naheliegend, unmi�elbar) genannte Erklärungsebene. Warum Vögel singen: Selektionswert, Fitness Mehr noch als die Frage, was Verhalten unmi�elbar verursacht, interessiert uns meist dessen Funktion. Es ist zwar schön und auch notwendig zu wissen, warum ein Vogel singt, noch mehr wird im allgemeinen aber das Wozu interessieren, was der Vogel also damit bezweckt. Angenommen, er singt nicht nur zu seinem eigenen Vergnügen (obwohl es sicherlich eine berechtigte Arbeitshypothese darstellt, den Lustgewinn durch die Ausführung einer Triebhandlung als eigentliche Motivation, also als physiologische Ursache vieler Verhaltensäußerungen anzunehmen, und dies nicht nur im sexuellen Bereich), dann gibt es sicher einen Empfänger, bei dem der Gesang etwas bewirken soll. Das können Reviernachbarn oder andere, zufällig vorbeikommende Artgenossen sein, denen mitgeteilt wird, dass dieses Territorium besetzt ist. Vogelgesang zählt zu den komplexen Signalen und dient der Artunterscheidung, der Balz und der Revierabgrenzung. Der Gesang des Vogelmännchens ist zunächst nicht an artfremde Nachbarn gerichtet. Der Revierinhaber signalisiert vielmehr in Richtung anderer Individuen seiner eigenen Art. Hier wird bereits ein geänderter Schwerpunkt der modernen im Vergleich zur klassischen Ethologie erkennbar: Das Individuum und seine Strategien, sein Verhaltensspielraum als Reaktion auf bestimmte Umweltbedingungen spielen die Hauptrolle in der Entstehung von Verhalten. Der noch von Konrad Lorenz gepflegte Mythos vom »Arterhaltungswert« von Verhalten konnte nicht bestätigt werden. Die »Arterhaltung« gilt als Nebeneffekt egoistischer Strategien. Denn überleben die Individuen, dann überlebt natürlich auch die Art, es sei denn, artinterne Konkurrenz- und Wahlmechanismen fördern ausgesprochen überlebenshinderliche Strukturen, wie etwa das Geweih des ausgestorbenen Riesenhirsches, und treiben damit die Art in eine evolutionäre Sackgasse. In der Frage ob Gesang der Arterkennung oder innerartlichen Funktionen dient, geht es nicht um semantische Spitzfindigkeiten. Tatsächlich kommt es darauf an, wie Evolution funktioniert, wo die Selektion ansetzt. Überwiegend ist dies das Individuum, nicht die Gruppe, denn Tiere verhalten sich grundsätzlich nicht »zum Besten der Art«, sondern egoistisch. Dieses Thema wird uns im Folgenden noch intensiver beschä�igen. Natürlich soll auch den Weibchen durch Gesang signalisiert werden, dass es hier ein gutes Revier mit tollem Besitzer gibt, dem es ein Anliegen wäre, ihre Eier zu befruchten und die gemeinsamen Jungen großzuziehen. Und da gibt es noch die Fressfeinde, denen gegenüber ein singender Vogel seinen Standort schwer geheimhalten kann. Jedes Verhalten hat also Nutzen und Kosten, und die Gesamtbilanz wird in der Währung der wieder reproduktionsfähigen Nachkommen gemessen; sie tragen die Linie weiter, bringen die Gene in die Warum Verhalten? Viele Fragen – einige Antworten 15 nächste Generation. Auf dieser evolutionären Erklärungsebene zeigt also Verhalten seinen eigentlichen Überlebenswert, ist Mi�el zum Zweck des Fortbestands der eigenen Gene in kün�igen Generationen. Verhalten ist daher sowohl Eintri�skarte ins Spiel der Evolution, bestimmt den Spieleinsatz und natürlich auch Strategie und Taktik. In der englischen Fachliteratur wird die evolutionäre Erklärungsebene auch »ultimat« (letztlich) genannt. Exkurs 1: Die verschiedenen Ebenen der Untersuchung von Verhalten. Tinbergens vier Fragen (1963) Trotz fachlicher und sogar persönlicher Kontroversen in der Vergangenheit, besonders zwischen +klassischen* Ethologen und Öko-Ethologen/Soziobiologen, stehen die unterschiedlichen Richtungen der Verhaltensbiologie nicht im Widerspruch. Sie stellen vielmehr einander ergänzende, kohärente Ebenen der Erklärung von Verhalten dar. Frage nach Untersuchungsebene Forschungsrichtung Hauptvertreter 1. WOZU? dem Überlebenswert Evolution/ Anpassung Öko-Ethologie, Soziobiologie (evolutionäre Psychologie) Hamilton, Lack, Wilson, etc. 2. WIE? den Mustern und Mechanismen von Verhalten Form, Anatomie, Physiologie, Psychologie »klassische« Ethologie, Verhaltensphysiologe, Neuroethologie Loeb, Pawlow, v. Frisch, Lorenz, Beach, v. Holst, Huber, etc. 3. WOHER? der individuellen Entwicklung von Verhalten Ontogenie »klassische« Ethologie, Verhaltensphysiologe, Entwicklungspsychologie, div. Lerntheorien Heinroth, Whitman, Pawlow, Lorenz, Piaget, Thorndike, Skinner, etc. 4. WOHER? dem evolutionären Wandel evolutionäre Geschichte Vergleichende Verhaltensforschung, div. taxonomische Methoden, einschl. vergleichende Genetik Whitman, Heinroth, Lorenz, etc. Warum Vögel singen: Individualentwicklung Vögel singen nur dann, wenn die Reifung der für ihren Gesang zuständigen Gehirnzentren ungestört verlief. Manche groben Gesangsstrukturen entspringen vorwiegend genetischen Dispositionen (Marler 1984), das sind die erblichen Grundkomponenten des arteigenen Gesangs. Die Feinheiten oder gar lokale Dialekte werden aber gewöhnlich erlernt und nach Art von Kulturtraditionen weitergegeben. Wobei natürlich auch die Bereitscha� für diese Lernleistung erblich ist. O� lange bevor der Jungvogel selber singt, hört er einen Tutor, meist seinen Vater. Ein Muster dieses Gesanges prägt sich seinem Gehirn ein, mit dem er später, während der Übungsphase, seinen eigenen Gesang vergleicht und vervollkommnet (Immelmann 1969, Ten Cate 1989). Generell entstehen alle Merkmale lebender Organismen während Ziele und Fragen der modernen Verhaltensforschung 16 der Individualentwicklung im ständigen Austausch zwischen Genen und Umwelteinflüssen. Exkurs 2: Fragen und Forschungsansätze in der Ethologie Die Geschichte der biologisch-naturwissenschaftlichen Erforschung von Verhalten lässt sich bis Aristoteles zurückverfolgen. Systematisch und kontinuierlich entwickelt wurden diese Wissenschaften erst, als Darwin eine akzeptable evolutionstheoretische Basis schuf. Einige Richtungen der frühen verhaltensbiologischen Forschung sind im Text behandelt. In der folgenden Tabelle sind einige der bedeutendsten zusammengestellt. Tabelle 1: Die Hauptrichtungen der Erforschung tierischen Verhaltens. Die Richtungen überlappen natürlich zeitlich, manche, wie Öko-Ethologie und Soziobiologie, auch im Konzept. Die Zeitrahmen sind großzügig gewählt; auch manche der Exponenten können mehreren Richtungen zugeordnet werden. Zeit Disziplin Hauptvertreter vorwiegende Ansätze Fragestellungen 1850–1940 Tierpsychologie Heinroth, Morgan, etc. deskriptiv Intelligenz, einsichtiges oder instinktives Verhalten 1880 bis heute Behaviourismus Skinner experimentell Lernmechanismen 1900 bis heute Ethologie Whitman, Heinroth, deskriptiv, indukLorenz, Tinbergen, tiv-experimentell, v. Frisch, etc. Modelle 1900 bis heute Verhaltensv. Holst, v. Frisch, physiologie, Ewert, Beach, etc. Neuroethologie, Verhaltens-endokrinologie, etc. 1950 bis heute Humanethologie Eibl Eibesfeldt, etc. wie Ethologie 1950 bis heute Evolutionäre Erkenntnistheorie Lorenz, Riedl, etc. deskriptiv-deduktiv adaptive Funktion und Evolution von Gehirn und kognitiven Leistungen 1950 bis heute Öko-Ethologie Tinbergen, Lack, Hamilton, Wickler, etz. experimentell deduktiv Ökonomie und Anpassungswert von Verhalten 1975 bis heute Soziobiologie Wilson, Dawkins, etc. deskriptiv und experimentell evolutionäre Funktion von Sozialleben 1980 bis heute ethologische Kognitionsforschung Griffin, Kamil, Kacelnik, Clayton, etc. deskriptiv und experimentell Funktionen und Anpassungswert kognitiver Leistungen, Modularität, (soziales) Lernen, Traditionsbildung experimentell Form und v.a. proximate Funktion, Verhalten als stammesgeschichtliches Merkmal physiologische Basis von Verhalten menschliches, vorw. nichtverbales Verhalten, Universalien, evolutionäre Strategien Warum Verhalten? Viele Fragen – einige Antworten 17 Tabelle 2: Die folgende Liste entspricht etwa jener Auswahl an einführender Literatur, wie ich sie Studenten im Rahmen der Einführungsvorlesung in die Verhaltensbiologie empfehle. Sie soll hier Hilfe für die Auswahl weiterführender Lektüre sein. Sachgebiet Verfasser Sprache Bemerkungen gesamte Ethologie Alcock (1996) deutsch Schwerpunkt auf evolutionären Aspekten Franck (2000) deutsch knappe Gesamtdarstellung mit klassischem Schwerpunkt und Beispielen aus der Forschung Manning und StampDawkins (1992) englisch knappe, aber umfassende Einführung McFarland (1989) deutsch Schwerpunkt auf klassisch-mechanistischen Aspekten Eibl Eibesfeldt (1999) deutsch das wohl detaillierteste Lehrbuch der vergleichenden Verhaltensforschung Immelmann (1983) deutsch etwas konservativer Einführungstext Lamprecht (1972) deutsch sehr knappe, verständliche Einführung Lorenz (1978) deutsch Lorenzscher Klassiker, Vorkenntnisse günstig Tinbergen (1979) deutsch Klassiker, Vorkenntnisse erforderlich Verhaltensbiologie des Kindes Hassenstein (1987) deutsch klassische Ethologie der Verhaltensentwicklung des Kindes Verhaltensphysiologie Bischof (1989) deutsch Neuroethologie Verhaltensökologie, Soziobiologie Krebs und Davies (1997) englisch, deutsch präzise und verständlich, der beste Einführungstext Krebs und Davies (1993) englisch aktuelle zentrale Probleme im Überblick Voland (2000) deutsch knappe, intensive Einführung in die Soziobiologie einschließlich Mensch Griffin (1985) deutsch gut lesbare, teils eigenwillige Beispielsammlung Verhaltensbiologie Mensch Eibl Eibesfeldt (1995) deutsch umfassendendstes Lehrbuch der klassischen Humanethologie Verhalten Mensch Grammer (1993) deutsch Humanethologie, Biologie der Liebe Lorenz (1992) deutsch das »russische Manuskript«, geschrieben 1944-1948 Übungsbeispiele Kotrschal (2000) deutsch Sammlung von 26 einfachen Beispielen für ethologische Übungen für Schüler und Studenten Wörterbuch Verhaltensbiologie Immelmann (1982) deutsch Wörterbuch der v.a. klassischen Ethologie Methoden, Planung Lamprecht (1999) deutsch Praktischer Leitfaden, Planung bis Publikation der Ergebnisse Methoden Martin und Bateson (1993) englisch knappe, verständliche Einführung in die quantitativen Methoden der Ethologie »klassische« Ethologie, vergleichende Verhaltensforschung Biologie der Kognition 18 Ziele und Fragen der modernen Verhaltensforschung Warum Vögel singen: evolutionäre Geschichte Schließlich produziert der Vogel seinen arteigenen Gesang, weil Generationen vor ihm bereits so sangen und dieser Gesang sich sehr wahrscheinlich von einfachen Lauten zur heutigen, komplexen Folge von Tonstrukturen entwickelte. Die evolutionäre Geschichte hängt zwar mit der oben erwähnten funktionellen Erklärungsebene von Selektionswert und Fitness zusammen, ist aber nicht mit ihr identisch. Die Frage nach der Funktion von Verhalten zielt gleichzeitig in Richtung Motor und Mechanismus der Evolution. Hingegen beschä�igt sich die Erklärungsebene der evolutionären Geschichte mit deren Ergebnis. Alle Erklärungsebenen sind nötig Ein Forschungsansatz auf mehreren Ebenen und, damit eng verschränkt, das Abwägen von Alternativhypothesen ist in der modernen Ethologie nicht nur erlaubt, sondern gefordert. Es gibt Beispiele aus der Geschichte der Verhaltenswissenscha�en für die schlimmen Folgen der Vernachlässigung von Erklärungsebenen. Das tri� paradoxerweise für die Ebene des Überlebenswertes in der klassischen Ethologie zu. Dieser wurde gemeinhin als gegeben angesehen weil es eben als sonnenklar galt, dass Verhalten zum »Besten der Art« zu sein hä�e. Die Soziobiologie und Öko-Ethologie hingegen vernachlässigten o� genug die physiologischen Grundlagen und Mechanismen von Verhalten im Streben nach der Erforschung des Überlebenswertes; Verhaltensweisen wurden o� als »black boxes« behandelt, einfach als gegeben angesehen. Mit einem bestimmten Reiz konfrontiert, produzieren Individuen eben bestimmte Verhaltensreaktionen; nicht gefragt war, das Wie, also etwa was sich dabei im Körper abspielt. Erst in jüngster Zeit setzt sich vermehrt die Einsicht durch, dass ein zu reduktionistischer bzw. dogmatischer Ansatz zum Stillstand im Erkenntnisgewinn und sogar zu falschen Erklärungen von Ursachen führen kann. So beschä�igten sich evolutionäre Erklärungsmodelle, etwa zur optimalen Nahrungswahl, ausschließlich mit den Auswirkungen von Verhalten. Diese Modelle können aber große Fragezeichen hinterlassen. Denn wie schaffen es Tiere eigentlich, Nahrungsdichten abzuschätzen, Partner zu finden, Fressfeinden zu entgehen? Erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt beschwörten eine Anzahl von Autoren (z. B. Barlow 1989, 1991, Stamp-Dawkins 1989, Stamps 1991) eine »neue Synthese« zwischen der Öko-Ethologie und Soziobiologie und ihrer 30 Jahre geringgeschätzten Mu�er, der klassischen Ethologie. Individuen müssen nicht nur Entscheidungen im ökologischen Rahmen treffen, z. B., ob es geraten ist, ein gewissens Fressfeindrisiko einzugehen und auf Nahrungssuche zu gehen, oder eher sicher zu Hause, und folglich hungrig zu bleiben. Wenig überraschend fand man darüber hinaus auch, dass sich Individuen nicht immer optimal (z. B. bezüglich ihrer Energieeffizienz) verhalten können, weil sie nicht immer über alle nötigen Informationen verfügen. Woher sollte etwa eine Amsel wissen, dass sie sich auf einem Wiesenstück mit maximaler Regenwurmdichte befindet, wenn sie nicht gelegentlich mit angrenzenden, weniger dichten Flächen vergleicht? Zudem gibt es Beschränkungen der Wahrnehmung und die Gehirne von Tieren und Warum Verhalten? Viele Fragen – einige Antworten 19 Menschen entwickelten sich im Überlebenszusammenhang als »ratiomorphe Apparate«, wie es R. Riedl einst ausdrückte. Rationales Denken ist uns und den anderen Tieren nicht in die Wiege gelegt, es muss mühsam gelernt werden. So war zunächst auch die Überraschung von Wirtscha�swissenscha�lern groß, dass sich die Akteure am Markt nicht nur nach den Vorhersagen der Spieltheorie richteten, also keine perfekt rationalen Spieler waren. Menschliche Regungen verhindern o� die Gewinnmaximierung. Seltsam, denn wo sonst sollte absolut rational gehandelt werden, wenn nicht in der Wirtscha�? Schuld daran sind die psychisch-evolutionären Voreinstellungen, die Menschen im Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz dazu anhalten, in bestimmter Weise miteinander umzugehen. Das Zusammenleben unter Bekannten und Freunden ist letztlich auf Nachhaltigkeit und Gegenseitigkeit angelegt, nicht auf schnelles »Abräumen« um jeden Preis. Darum bereitet es uns nicht nur Freude, zu nehmen, sondern auch zu geben, darum versuchen wir, unser Ansehen, unser »Gesicht« und das unserer Partner zu bewahren. Und wenn Partner diese Spielregeln verletzen, sind wir empört, beleidigt, versuchen zu bestrafen, können entweder vergeben oder brechen den Kontakt ab. All dies ist nicht rational im Sinne der Spieltheorie. Wir sind eben nicht darauf angelegt, in jedem »Spiel«, (also in jeder Interaktion bei der es um geben und nehmen geht) unter Optimierung des Verhältnisses zwischen Einsatz und Gewinn zu triumphieren. Emotionen und Nachhaltigkeit bestimmen unser Handeln, unser Zusammenspiel, von Kleinkindern in der Sandkiste genauso, wie von Konzernbossen bei der Fusionierung von Großfirmen. Rational (also rücksichtslos) »ausgenommen« werden (wenn überhaupt) Lau�undscha�en oder einmalige Partner. Belege für diese Hypothese liefern etwa manche Gastronomiebetriebe im Strom des Massentourismus. Die Nobelpreise für Wirtscha� 2002 wurden übrigens für diese Einsichten vergeben. Auch die neuen Richtungen der Soziobiologie und Öko-Ethologie sind ihrer pubertären Phase längst entwachsen, die Synthese mit der Arbeit der Gründergeneration ist eben im Entstehen. Und das nicht etwa aus Sentimentalität oder Pietät den Altvorderen gegenüber, sondern allein aus der Einsicht, dass neue Durchbrüche, die wissenscha�lichen Revolutionen (Kuhn 1981), nur durch Integration, nie durch Ausgrenzung entstehen. Wissenscha� insgesamt ist wie die Evolution ein Stufen- und Spiralprozess, mit gelegentlichen revolutionären Sprüngen, wie etwa durch C. Darwin, der die Basis für eine allgemein gültige Evolutionstheorie schuf, oder durch die Ideen von W. Hamilton, der mit seinem Konzept der »inklusiven Fitness« viele verbliebene Grundprobleme von Ethologie und Evolutionstheorie mit einem Schlag löste. Für den Fortgang der Wissenscha� sind die Bewegung einer Amöbe oder das Wachstum eines Baumes brauchbare Bilder. Viele Spezialisten treiben ihre Richtungen in relativer Isolation voneinander voran. Langsam tasten sich feine Pseudopodien der Amöbe voran, bis ihr Plasma an einer bestimmten Stelle wieder massiv austri� und so wie eine wissenscha�liche Revolution die Richtung der Bewegung bestimmt. Die Triebspitzen des Baumes der Wissenscha� wachsen rasch, meist durch die genialen Leistungen weniger 20 Ziele und Fragen der modernen Verhaltensforschung Wissenscha�ler, viel stärker aus als andere und bilden so neue tragfähige Äste für weiteres Spezialistentum. Dass Spezialisten (also jene, die von immer weniger immer mehr wissen) und Generalisten (jene, die von immer mehr immer weniger wissen; so es letztere in den modernen Naturwissenscha�en überhaupt noch gibt) dazu neigen, einander gering zu achten, ist unvernün�ig und entspringt einer Froschperspektive, welche uns die Leistungen und die Bedeutung der jeweils anderen Seite verkennen lässt. Könnte es daran liegen, dass die Spezialisten immer weniger vom Gesamtfach wissen und sich daher auf Querkontakte nicht mehr einlassen wollen, während die Generalisten mangelndes Detailwissen gelegentlich mit Arroganz we�zumachen trachten? Genau daran setzt eine sehr gewichtige Kritik der modernen Naturwissenscha�en an: Die Erkenntnisfelder wachsen nebeneinander, nicht miteinander, Integration wird immer schwieriger und unüblicher. Was Wunder, dass Pessimisten den modernen Wissenscha�sbetrieb mit einiger Berechtigung als einen neuen »Turmbau zu Babel« sehen. 21 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenschaft und Ideologie Wer bestimmt, was geforscht wird? Tradition Wir werden o� gefragt, ob denn an den Graugänsen überhaupt noch was zu erforschen sei. Erschöp�e die Ethologie sich nur in der Beschreibung und Katalogisierung von Verhaltensweisen, dann wäre diese Frage berechtigt; Graugänse und andere Entenvögel hä�en tatsächlich ausgedient, denn dieser Bereich wurde in der Vergangenheit weitgehend abgedeckt (Fischer 1965, Heinroth 1910, Lorenz 1941, 1988). Trotzdem: Immer noch bildet das aufwändige Katalogisieren und Vergleichen von Verhaltensweisen die unentbehrliche Basis für die Bildung von Hypothesen (Lorenz 1992). Ein solches »Ethogramm« besteht aus Beschreibungen von Form und Ablauf von Bewegungen, ist eine Inventarliste aller bei einer Art möglichen Verhaltensweisen. Es bildet daher eine wichtige Grundlage für weiterführende Fragen, nicht mehr und nicht weniger. Dies gilt aber generell für jedwede Muster, seien es nun Ethogramme oder räumlich-zeitliche Verbreitungen, Populationsdichten oder Ernährungsweisen. Dies alles ist Vorfeldarbeit, eine Art »monitoring«, die Basis für die eigentliche naturwissenscha�liche Arbeit, welche sich mit Ursachenzusammenhängen befasst. Dies gilt natürlich auch für unsere eigene, sich ständig weiterentwickelnde Arbeit an der Konrad Lorenz Forschungsstelle. Ob Graugänse, Raben, Waldrappe oder Wachteln: Es beschä�igen uns die Zusammenhänge zwischen Umwelt, Hormonen und Sozialverhalten, bis hin zu scheinbar so abgehobenen Fragen, wie Eltern über Hormone und »Erziehung« die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Nachkommen beeinflussen. Es wäre heute natürlich weder sinnvoll, noch möglich, Verhaltensforschung im Stile der 50er Jahre zu betreiben. Wer bestimmt, was geforscht wird? Kollegen, Geld und Moden Wissenscha�liche Arbeit ist von der Interaktion mit Fachkollegen abhängig. Gute Kommunikation ist daher unverzichtbar, etwa im Zuge von Diskussionen bei diversen Kongressen. Ein anderes tragendes Element der modernen Wissenscha� ist das Peer-Review-System. Dies bedeutet, dass Kollegen (peers) anonym Projektanträge und Publikationsentwürfe begutachten und mit ihrem Urteil entscheidend mitbestimmen, ob ein Projekt finanziert, ein Manuskript von einer guten Fachzeitschri� angenommen wird, oder nicht. Nur so gelingt es, das hohe Niveau in der internationalen Forschung zu halten. Fehlerha�e Ansätze, mangelha�e Daten, falsche Analysen und überzogene Interpretationen werden so ausgeschieden. Gute Journale gehen dabei äußerst strikt vor, es werden tatsächlich 50–90 % der eingereichten Manuskripte abgelehnt. Der Markt für wissenscha�liche Ergebnisse ist genauso durch Angebot und Nachfrage bestimmt wie der Markt für Fahrräder oder Kaugummi. Ja sogar in einem noch höherem Maß, denn Analoga zu staatlichen Regulierungen oder Kartellabsprachen existieren nicht. Je höher die Ablehnungsrate eines 22 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Publikationsorgans, desto höher seine Qualität. Dies bestimmt das Verhältnis von Marktwert eines Ergebnisses zum Marktwert eines Journals. Je mehr Autoren also in einer bestimmten Fachzeitschri� publizieren wollen, desto höher können Ansprüche und Ablehnungsraten dieses Journals gehalten werden, desto höher wird aber auch die Aufmerksamkeit sein, die ein dort publizierter Artikel unter Fachkollegen genießt. Als »wissenscha�liche Publikation« wird daher zu Recht ausschließlich anerkannt, was den Peer-Review-Prozess erfolgreich durchlief. Denn nur so kann ein hoher Standard gewahrt werden. Auch seriöse Wissenscha�sjournalisten sollten nur Ergebnisse akzeptieren, die bei einer seriösen Fachzeitschri� bereits zum Druck angenommen wurden. Denn dies verhindert, dass sich der (hoffentlich immer vorhandene) begeisterte Optimismus von Forschern in Irreführung der Öffentlichkeit mi�els einer journalistischen Seifenblase verwandelt. Umgekehrt tun seriöse Wissenscha�ler gut daran, mit den Medien partnerscha�lich zusammenzuarbeiten, aber ihre Ergebnisse erst dann anzubieten, wenn diese von einem guten Journal zum Druck angenommen wurden. Dies minimiert nicht nur das Risiko, sich zu blamieren; Spitzenjournale, wie etwa »Science« oder »Nature« verweigern die Annahme selbst der spannendsten Ergebnisse, wenn diese zuerst die Runde durch den Boulevard machten. Zu Recht, denn ein Präjudizieren des Peer-Review-Systems, der höchsten Instanz für Qualität in der internationalen Wissenscha�, bleibt inakzeptabel. Selbst in engen Fachgebieten wird heute mehr publiziert, als man zu lesen imstande ist. Vielfach überfliegt man selbst als aktiver Wissenscha�ler nur noch Zusammenfassungen. Es ist nicht mehr möglich, selber die Qualität jedes relevanten Artikels zu prüfen. Deswegen muss man sich auch auf die kritische Vorauswahl guter Journale (und ihrer Gutachter) verlassen können. Natürlich kann man auch in der »Afiesler Monatsschri�« oder in den gewöhnlich kaum qualitätskontrollierten Annalen irgend eines Museums wichtige Erkenntnisse verstecken. Damit erspart man sich zwar die zuweilen mühsame Auseinandersetzung mit den Gutachtern, solche Ergebnisse werden allerdings weder wahrgenommen, noch fördern sie die eigene Karriere. Den Weg des geringsten Widerstands beim Publizieren zu gehen, ist beinahe so unwirksam, wie Ergebnisse gleich im Schreibtisch liegenzulassen. Wie in der Wirtscha�, kommt es auch in der Forschung nicht nur darauf an, ein Produkt herzustellen, man muss es auch verkaufen. Denn nicht publizierte Ergebnisse existieren nicht; es ist, als hä�e die zugrundeliegende Forschungsarbeit nie sta�gefunden. So einfach ist das. Dieses System aus Forschen und recht reglemetiertem Publizieren sichert zwar einerseits die Qualitätsstandards, kann andererseits die Ausbreitung neuer Ideen behindern, kann aber Substantielles sicherlich nicht verhindern: Alfred Wegeners Kontinentaldri�theorie oder Lynn Margoulis‘ erweiterte Symbiontentheorie zur Erklärung der Entstehung vielzelliger Lebewesen mit echtem Zellkern, sowie Amoz Zahavis Handicap-Theorie (1984, 1997) zur Erklärung der Evolution von Signalen sind nur einige Beispiele von vielen für erfolgreiche Ideen, die zunächst von der Kollegenscha� recht skeptisch aufgenommen wurden. Aus heutiger Sicht ist es geradezu beschämend, dass all Wer bestimmt, was geforscht wird? Kollegen, Geld und Moden 23 diese revolutionären Ideen zunächst vom wissenscha�lichen Establishment abgetan, ihre Urheber verlacht wurden. Man mag bedauern, dass der Spießrutenlauf durch die kollegiale Kontrolle den naturwissenscha�lichen Prozess verlangsamt und so manch unkultiviertes Genie scheitern lässt. Aber das ist durchaus gewollt, wirkt es doch einer allzu raschen Veränderung von Konzepten entgegen und führt zu einer gewissen Pufferkapazität gegen Unreflektiertes. Das Peer-Review-System macht Wissenscha� im positiven Sinne konservativ. Scharlatane sind mi�elfristig chancenlos. Klar, dass dieses System seinen Preis hat. So setzen sich dadurch neue Ideen ebenso schwer durch, wie sich manche Irrtümer beharrlich halten. Lehrbuchautoren sind weiter ungeliebte, aber leider notwendige Komponente im System. Denn sie sorgen für zusätzliche Trägheit. Und sie verfügen auch dadurch über eine kaum zu überschätzende Macht und Verantwortung, dass sie die Filter zwischen dem aktuellen Wissenscha�sgeschehen und einer neuen Generation heranwachsender Wissenscha�ler sind. Tatsächlich finden sich einerseits zahlreiche Beispiele von jahrzehntelang mitgeschleppten Irrtümern, wie gerade am Beispiel der »klassischen« Ethologie zu zeigen ist (Exkurs 3,4). Andererseits kann nur verwundern, wie lange es o� dauert bis »gesichertes Wissen« endlich Eingang in ein Lehrbuch findet. Schließlich ist es tabuisierte Tatsache, dass auch wissenscha�liche Seilscha�en und Chauvinismen bestimmen, welche Ergebnisse und Forscher durch Aufnahme in ein verbreitetes Lehrbuch quasi in den »Adelsstand« erhoben werden und welche nicht. Exkurs 3: Schlüsselkonzepte der modernen Verhaltensbiologie Auf folgenden Schlüsselkonzepten beruhen die heute bedeutendsten Disziplinen der Verhaltensbiologie, die »klassische« Ethologie, Öko-Ethologie und Soziobiologie. 1. »Klassische« Ethologie (»klassisch« bezieht sich auf die u.a. von Konrad Lorenz, Erich v. Holst und Karl v. Frisch vertretene mechanistisch-physiologische Richtung im Gegensatz etwa zur evolutionär-adaptiv orientierten ÖkoEthologie): Basierend auf Otis Whitman, Wallace Craig und Oskar Heinroth schufen Konrad Lorenz (1978) und Niko Tinbergen (1953a) ein Theoriensystem, das auch heute noch in seinen Grundzügen gültig ist (vgl. Exkurs 4). Wie Vergleiche herkunftsgleicher (homologer) Verhaltensweisen zwischen Arten zeigen, wandeln sich Verhaltensmerkmale im Verlauf der Evolution genauso, wie körperliche Merkmale. Verhalten muss daher genetisch erblich sein, es »mendelt« (nach den Erbgesetzen von G. Mendel) meist, bildet sich also bei Hybriden in der Fl-Generation intermediär aus. Die genetische Basis für Verhalten ist auch durch die Zwillingsforschung beim Menschen zu belegen (Bouchard u. a. 1990). Daher sind die in der Stammesgeschichtsforschung für morphologische Merkmale verwendeten Homologiekriterien anwendbar (Lorenz 1978), und Verhaltensweisen sind genauso brauchbar zum Herstellen verwandtschaftlicher Beziehung, wie körperliche Merkmale. Der Schwerpunkt der klassischen Ethologie liegt daher auf dem artspezifischen Verhalten (Instinkthandlungen, 24 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Erbkoordinationen, »angeborene« Verhaltensweisen), also klar ansprechbaren, relativ stereotypen motorischen Mustern, deren innerartliche Variabilität geringer ist als die zwischenartliche. Daher kann man auch Verhaltenskataloge (Ethogramme) für einzelne Arten erstellen. Es ist die Modellvorstellung der klassischen Ethologie, dass alles Verhalten motivationsgesteuert mit Appetenz(Such)handlungen beginnt (Suche nach bestimmten Reizkonstellationen) und nach Kontakt mit spezifischen Auslösern (den »Schlüsselreizen« der frühen Ethologie) zum Ablauf der Endhandlung, einer »Erbkoordination«, führt (Abbildung 1). Einer der konzeptuellen Hauptunterschiede zwischen Erbkoordination und Reflex wäre, dass Erbkoordinationen auch »spontan«, gemäß dem Lorenzschen psychohydraulischen Triebmodell (Kotrschal u. a. 2001b, Lorenz 1978), nach Aufstau der spezifischen Handlungsbereitschaft (»aktionsspezifische Energie«) ablaufen können. Erbkoordinationen weisen eine stereotype und eine Taxis- (Zielorientierungs)ko mponente auf, welche die stereotype Triebbewegung so steuert, dass sie auch ihre Funktion erfüllen kann (z. B. dass im Zuge der instinktiven Eirollbewegung der Graugans das Ei im Nest und nicht irgendwo daneben landet: Lorenz und Tinbergen 1939). Auslösemechanismen (AM) können »angeboren« (AAM, z. B. löst ein felliges Tier in Hundegröße Flucht auch bei naiven Graugänsen aus) oder »erworben« (EAM, z. B. die fluchtauslösende Wirkung eines sonst vertrauten Menschen auf Graugänse, nachdem dieser vor aller Augen ein Individuum zur Beringung fing und dadurch zum Gegenstand von »Mobbing-Lauten« wurde) sein oder in der »Instinkt-Dressur-Verschränkung« entstehen (EAAM). Durch Lernen kommt es zu einer flexibleren Kombinierbarkeit der Bausteine des Verhaltens, der Erbkoordinationen. Organismen mit »geschlossenen« Programmen zeichnen sich durch eine weitgehende Vorangepaßtheit des Verhaltens aus (durch Lernen kaum modifizierbar), solche mit »offenen« Programmen sind weitgehend lernfähig. Die Evolution stattete also Erstere vor allem mit auf Artniveau angepasster Reaktionsfähigkeit an die (meist stabile) Umwelt aus, die Zweiteren mit entsprechenden Lernfähigkeiten, um Individuen an eine meist variable Umwelt anzupassen. Die Lern- und Reizunabhängigkeit (d. h. ihre »angeborene« Natur) und die Möglichkeit der Spontaneität der Erbkoordinationen wurde bereits in den 1950er Jahren durch Erich von Holst über den physiologischen Nachweis des Vorhandenseins von Mustergeneratoren im Zentralen Nervensystem bestätigt. Die Lorenz-Tinbergensche Verhaltenstheorie wurde teils mit Recht als zu starr kritisiert (Exkurs 4), musste in Details revidiert werden (Zippelius 1992a, Lamprecht 1993b) und gilt als historischer Entwicklungsschritt. Sie bildet aber nach wie vor eine geeignete theoretische Basis und vor allem ein sehr anschauliches Denkmodell für die mechanistische Verhaltensbiologie. Nicht zuletzt war und ist sie eine fruchtbare Basis für die Verhaltensphysiologie. In der modernen Ethologie werden die eher kybernetischen klassischen Funktionsmodelle zunehmend durch direkte physiologische (z. B. über Funktionen von Nervensystemen und Hormonen) ersetzt. »Zwischenvariable«, etwa der Begriff der »Motivation«, werden dadurch entbehrlich. Die Konzentration auf das »artspezifische Verhalten« mag dazu beigetragen haben, auf der Ebene der evolutionären Funktion (Exkurs 1) den »Arterhaltungswert« von Verhalten zu betonen. Dieser gruppenselektionistische Ansatz ist nach gegenwärtigem Wissensstand für die Wer bestimmt, was geforscht wird? Kollegen, Geld und Moden 25 Abbildung 1: Schematische Darstellung der wichtigsten Elemente zweier historischer Theorien für die Erklärung von Verhalten, der Pawlowschen Reflexke�entheorie (oben) und der daraus hervorgegangenen LorenzTinbergenschen Theorie der +klassischen* Ethologie (unten). Organismus-interne Prozesse sind innerhalb der gepunkteten Zone dargestellt. Die Pfeile zeigen das Gefüge von Kausalzusammenhängen und Kopplungen, wobei ein + eine fördernde, ein – eine hemmende Wirkung bedeutet. evolutionäre Wirkung von Verhalten weitgehend unbedeutend und wurde durch das Prinzip der Individualselektion (siehe unten) ersetzt. 2. Ökoethologie: Ihr Schwerpunkt liegt nicht auf den Verhaltensmechanismen, wie in der »klassischen« Ethologie (siehe oben), sondern auf deren Überlebenswert und der Auswirkung auf die Fitness (Krebs und Davies 1993), also auf evolutionärer Ebene. Die Einheit der Selektion ist das Individuum, das Maß für Fitness und evolutionären Erfolg ist die Zahl der wieder reproduktiv aktiven Nachkommen. Da für alle Individuen Zeit und Energie limitiert sind, steht nur ein beschränktes Ausmaß an Ressourcen für die Produktion von Nachkommen zur Verfügung. In der Ressourcennutzung überlegene Individuen haben ein höheres Reproduktionspotential und daher eine potentiell höhere Fitness. Verhaltensstrategien variieren individuell entsprechend den herrschenden ökologischen Randbedingungen in ständiger Interaktion zwischen Genen und Umwelt. Es sind daher immer manche Individuen einer Population effizienter als andere. Wie Wirtschaftsbetriebe am freien Markt sind daher Tiere gezwungen, ökonomisch optimale Entscheidungen zu treffen (Exkurs 7). Da Tiere aber meist nicht im Besitz aller relevanten Informationen sind und zudem nicht immer frei, opti- 26 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie mal zu handeln (eingeschränkt etwa durch Konkurrenten, Räuber usw.), liegen sie in ihren Entscheidungen meist nahe, selten aber exakt am theoretischen Optimum. Individuelle Unterschiede in der Effizienz der Ressourcennutzung führen zu unterschiedlichen Möglichkeiten, in Nachkommen zu investieren, und damit zu Fitnessunterschieden zwischen Individuen. Die evolutionär relevante Konkurrenz um Ressourcen findet daher primär innerartlich, nicht aber zwischen den Arten statt. Mechanismen sind etwa Ausbeutungs- und Interaktionskonkurrenz, der Ausschluss anderer, Territorialität. 3. Soziobiologie: Ihr Fokus liegt auf den evolutionären Auswirkungen von Verhalten. Die Konzepte der Ökoethologie (siehe oben) gelten auch für die Soziobiologie, erweitert um einen starken Bezug zu sozialen Interaktionen. Das basale Konzept der Soziobiologie ist die »inklusive Fitness« (Gesamtfitness oder Gesamteignung; Hamilton 1964, Wilson 1975). Dabei geht es darum, möglichst viele eigene Allelvarianten der Gene in die nächste Generation zu bringen. Es ist unerheblich, ob dies in Form eigener Nachkommen geschieht, oder in Form der Förderung des reproduktiven Erfolgs (naher) Verwandter, welche proportional zu ihrem Verwandtschaftsgrad natürlich ebenfalls Träger der eigenen Allele sind. Das Maß für Fitness und evolutionären Erfolg ist die Frequenz der eigenen Gene in den wieder reproduktiv aktiven Nachkommen, in die man investierte, unabhängig davon, ob dies eigene Nachkommen oder jene von Verwandten waren. Daher bestimmt der Verwandtschaftsgrad maßgeblich die Kooperationsbereitschaft. Wie John Maynard-Smith es einmal sinngemäß ausdrückte, würde er sich entweder für zwei eigene Kinder oder zwei Geschwister aufopfern (Anteil der eigenen Gene 50 %), oder aber für vier Halbgeschwister, vier Enkel (25 %) oder acht Nichten/Neffen. William Hamilton begründete zunächst mit dem Konzept der Gesamtfitness, warum die meisten Weibchen sozialer Insektenstaaten als Arbeiterinnen besser daran tun, für ihren Verwandtenklan zu sorgen, als selber zu reproduzieren. Denn sie sind aufgrund von Besonderheiten im Vermehrungsmodus mit ihren Schwestern stärker verwandt, als sie es zu eigenen Nachkommen wären. Es kann daher unter Umständen einen stärkeren Gewinn für die eigene Gesamtfitness bedeuten, die erfolgreiche Reproduktion Verwandter (als Helfer, meist der Eltern) zu unterstützen, als geringen eigenen Reproduktionschancen hinterherzulaufen. So verwundert nicht, dass (selber bereits postreproduktive) Großeltern an Ausstattung und Erziehung ihrer Enkel mitwirken und damit über die Förderung von deren zukünftigem Reproduktionspotential letztlich ihre eigene Gesamtfitness erhöhen. Dies gilt übrigens auch noch heute, nach dem offensichtlichen Zerfall der Großfamilie, denn in keine anderen Verwandten wird mehr investiert als in Enkel. Der Fokus der Soziobiologie liegt daher auf dem adaptiven Wert von Verhalten, insbesondere auf Kooperation (zwischen Verwandten oder auf Gegenseitigkeit) und Konflikten, auf der Fitnessrelevanz sozialer Interaktionen, etwa der Partnerwahl. Soziobiologie und Ökoethologie stellen auf der Basis der Individualselektion ein recht geschlossenes Theoriegebäude zur evolutionären Erklärung tierischen und menschlichen Verhaltens dar. Das grundlegende Konzept der gesamten modernen Biologie ist die Individualselektion; der in der älteren Literatur häufig auftauchende Terminus des »Arterhaltungswerts« von Merkmalen, einschließlich des Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 27 Verhaltens, ist dagegen missverständlich. Tiere wie Menschen konkurrieren innerhalb von Populationen miteinander, möglichst viele ihrer eigenen Gene in die nächste Generation zu bringen (»inklusive Fitness«, siehe oben), und sind nur nach Maßgabe des Verwandtschaftsgrades oder auf Basis von Gegenseitigkeit »altruistisch« (selbstlose Hilfe an andere bis hin zur eigenen Aufopferung). Genereller »arterhaltender« Altruismus ist evolutionär nicht stabil (Fisher 1930). Daher sind Tiere wie Menschen im Grunde nicht »am Überleben der Art« interessiert, sondern an kurzfristigen fitnessfördernden Vorteilen. Das »Überleben der Art« ist daher Folge, nicht aber (evolutionäre) Ursache für Verhalten. Dass das Prinzip Eigennutz (einschließlich Nepotismus) das Überleben der Art dermaßen gut gewährleisten kann, dass sich diese schließlich selbst gefährdet, zeigt auch die weltweite menschliche Bevölkerungsexplosion. Diese Konzepte der modernen Verhaltensbiologie gelten prinzipiell und uneingeschränkt auch für den Menschen (Voland 2000). Dank des »Peer-Review-Systems« findet Zweifelha�es kaum Eingang in die entsprechenden Journale, ein Segen für die Wissenscha�ler, welche in der Publikationsflut ohnehin beinahe ertrinken. Sie müssen darauf mit zunehmender Spezialisierung reagieren, ob sie es wollen oder nicht. Man kann diesen Zustand als eines der Grunddilemmata der modernen Naturwissenscha�en betrachten. Ganz parallel zu anderen Bereichen des Gesellscha�slebens, wie in der Architektur oder der Mode, ist aber das Korse� des Stiles und der Dogmen in der Wissenscha� um die Jahrtausendwende gelockert; Leuten, die vorgeben, im Besitz irgendwelcher Wahrheiten zu sein, ist tief zu misstrauen. Das Feld entwickelt sich parallel zur Gesellscha� in der wir leben, pluralistischer denn je zuvor. Dies gilt sogar für die Psychologie mit ihrer im Vergleich zur Ethologie verwirrenden Vielfalt verschiedener Schulen und Theorien. Man beginnt zu akzeptieren, dass es nicht eine einzig richtige Lehrmeinung geben kann, sondern dass der Vielschichtigkeit von Verhalten und Psyche eine »Vielfalt der Themen und Methoden« (Jü�emann 1992) entsprechen muss. Das bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit. Denn jedwede Aussagen zu Natur und Leistungen des Menschen, sogar wenn sie Philosophie oder Religion betreffen, sind nur dann haltbar, wenn sie mit den Erkenntnissen zum evolutionären Fundament des Menschen (oder anderer Organismen) logisch widerspruchsfrei in Übereinstimmung zu bringen sind. Auf einem anderen Bla� steht, dass man von Seiten der Öffentlichkeit einfache, klare Antworten von der Wissenscha� erwartet, was nicht nur mit dem wissenscha�lichen Prozess, sondern auch mit der angesprochenen Vielfalt der Betrachtungsebenen unvereinbar ist (Exkurs 5). So war auch die Wissenscha� vom tierischen Verhalten seit ihrem Entstehen einem beständigen Wandel unterworfen, wovon das folgende Kapitel berichten soll. Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie Wie auch für gegenwärtige Kultur und politische Systeme der Fall, kann man die moderne Ethologie nur aus ihrem geschichtlichen Werdegang verstehen. Gerade am Beispiel der Verhaltensforschung ist der für jeden 28 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Wissenscha�szweig gültige lenkende Einfluss von bestimmenden Persönlichkeiten und der zwischen ihnen ausgetragenen, gelegentlich gar nicht so fachlichen Fehden zu zeigen. Dies wird an den Beispielen der Verzahnung von Forschung und Weltbild der jeweiligen Forscher besonders deutlich. Detailliert würde solch ein geschichtlicher Überblick selbst im Falle einer jungen Wissenscha� wie der Ethologie Bände füllen. Die Aufgabe wird dadurch erleichtert, dass es dazu Übersichtsartikel, etwa von Barlow (1989, 1991) und Dewsbury (1989) oder Kotrschal u. a. (2001b) gibt. Diese Beiträge entstanden aus dem Bedürfnis, die Position der Ethologie im letzten Jahrzehnt unseres Jahrtausends neu zu bestimmen. Kurze Zusammenstellungen finden sich auch bei Heinroth (1974) und Oeser (1992). Eine eingehende Darstellung des Weges der Vergleichenden Verhaltensforschung, ihrer antithetischen Entstehung aus Vitalismus und Mechanismus zeichnet Lorenz (1992). Eine ausführliche deutschsprachige Bearbeitung dieses Themas aus neuerer Sicht ist überfällig, kann aber auch hier nur ansatzweise geboten werden. Immer noch fehlt in breiteren Kreisen, ja selbst in der nicht-ethologischen Biologie-Kollegenscha� weitgehend das Verständnis für die gegenwärtigen Zielsetzungen der Ethologie. Und wenn Lorenz im privaten Kreis das Wort »Soziobiologe« gelegentlich als Schimpfwort gebrauchte, obwohl (oder gerade weil) bereits Hinde (1966) eine Synthese zwischen der klassischen Ethologie und der Soziobiologie anbahnte, dann ist dies erklärungsbedür�ig. Im Prinzip lässt sich auch die Ethologie auf den »Adam aller Naturwissenscha�en«, auf Aristoteles zurückführen. Gräbt man nur ausdauernd genug, dann tauchen sowohl in Europa als auch in der Neuen Welt Leute in den Tiefen der Geschichte auf, die sich schon lange vor uns für tierisches Verhalten interessierten und darüber auch schrieben. Kurze, aber dichte Zusammenstellungen der Urgeschichte der Verhaltensforschung finden sich in der Einleitung zu G. Tembrocks »Grundlagen der Tierpsychologie« (1962) oder im Beitrag von K. Heinroth zur »Geschichte der Verhaltensforschung« im (trotz seines Alters empfehlenswerten) Sonderband von »Grzimeks Tierleben« über Verhaltensforschung (1974). Woher stammt das Interesse am Verhalten? Tiere stehen nicht bewegungslos in der Landscha� rum und setzen wie Pflanzen ihren Assimilationsfarbstoff dem Licht aus; sie sind heterotroph, müssen also ihre Nahrung suchen oder erjagen und dabei verhindern, selber gefressen zu werden. Sie müssen Partner finden, Nachkommen zeugen und aufziehen, denn das ist schließlich die Essenz des evolutionären We�bewerbs (Exkurs 11). Kurz, Tiere wie Menschen müssen sich verhalten. Darum beobachteten Menschen immer schon nicht nur das äußere Erscheinungsbild der sie umgebenden Tiere, sondern die Gesamtheit ihrer Gestalt, einschließlich der charakteristischen Bewegungen und Interaktionen mit ihrer Umwelt. Diese Fähigkeit zur Tierbeobachtung machte in einer Zeit, da Menschen noch selber jagten und von Beutegreifern bedroht waren, wahrscheinlich maßgebend den Überlebenswert unseres sich rasch entwickelnden Erkenntnisapparates aus. Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 29 Wie weit man die Wurzeln der bewussten Tierbeobachtungen in die Tiefen der Geschichte wachsen lässt und wo man die Grenze zu den unvermeidlichen und überlebensnotwendigen Wahrnehmungen von Menschen in Kontakt mit Tieren zieht, ist letztlich Geschmacks- und Definitionsfrage. Denn alle Tiere erwarben im evolutionären Spannungsfeld zwischen fressen und gefressen werden die Fähigkeit, die möglichen Absichten anderer schon im Ansatz zu erkennen. Diese Fähigkeit nannte der wahrlich nicht zum Metaphysischen neigende, große englische Verhaltensbiologe John Krebs einstens »mind reading«. Er bezeichnete damit die entsprechende Reaktion auf zumindest für unser Bewusstsein unterschwellige Reize. So etwa scheinen Gazellen zu erkennen, ob ein vorbeischlendernder Löwe hungrig und auf Jagd, oder sa� und ungefährlich ist. Gleichermaßen scheinen Graugänse in der Lage zu sein zwischen einem nur vorbeifliegenden Steinadler und einem auf Jagd zu unterscheiden. Dies zeichnet Tiere zwar als hervorragende Beobachter aus, macht sie aber nicht schon zu Verhaltenswissenscha�lern. Denn ihre Hypothesen bleiben implizit, während wissenscha�liche Hypothesen explizit ausformuliert werden müssen, um als solche zu gelten. So müssen wohl unsere steinzeitlichen Vorfahren im Rahmen ihrer Jagdund Tiergö�erkulturen durchaus genaue Tierbeobachtungen angestellt haben; über die Identifikation mit Tieren mag Gruppenbewusstsein, mögen Religionen gewachsen sein (Hernegger 1976). Menschen, deren Überleben von Jagd oder Tierhaltung abhängt, müssen das Verhalten ihrer Nutztiere genau genug kennen, um es vorhersagen zu können und damit erfolgreich zu sein. Es genügte ihnen also nicht, Tiere zu beobachten; sie mussten, um zu Überleben, (bewusste oder unbewusste) Hypothesen über tierisches Verhalten bilden. Die sichernde Beute verrät Aufmerksamkeit; ein nach oben gereckter Hals der verharrenden Tiere muss also jedem Beutegreifer verraten, dass die prospektive Beute nun alarmiert ist. Daraus sollte die Einsicht reifen, dass jede kleinste Bewegung von Seiten des Räubers die Flucht der Beute zur Folge hä�e. Fehlinterpretationen durch den Raubfeind produzieren Misserfolge, kosten eine Mahlzeit, der Beute kosten sie das Leben. Aber auch dazu ist es nicht nötig, dass die zugrunde liegenden Hypothesen klar ausformuliert werden, Intuition reicht vollkommen. Somit befanden sich unsere Vorfahren schon recht nahe am Kern der Naturwissenscha�en. Aber Beobachtungen werden erst dann zur Wissenscha�, wenn sie Welt- und Gegenstandsbilder verändern oder bestätigen. Solche Bilder, also Hypothesen und Theorien, werden im Bereich der Wissenscha� rational, standardisiert und damit nachvollziehbar ausformuliert. Auf ihrer Basis kann empirisch gearbeitet werden, sie stehen unter ständigem kritischen Beschuss durch ganze Heere von Naturwissenscha�lern. Die zentralen Paradigmata zu falsifizieren (Popper 1974) und damit die Theorie wieder ein Stückchen an die Wirklichkeit (umgangssprachlich gemeint, eine Diskussion dieses Begriffs würde hier viel zu weit führen) heranzubringen, stellt die Königsdisziplin der Naturwissenscha� dar. Diese charakteristische Verzahnung von Theorie und Empirie ist bislang einer der wenigen, aus den Wurzeln der antiken griechischen Kultur entwi- 30 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie ckelten Wege zur rational-replizierbaren Erforschung der Gesetzmäßigkeiten der Natur. An den wissenscha�stheoretischen Grundlagen, dem geistigen Rüstzeug unseres Geschä�s änderte sich erstaunlicherweise seit Aristoteles und D. Hume nur wenig. Die Tragfähigkeit des antiken Konzepts darf gerade angesichts der Errungenscha�en der modernen Biologie bewundert werden. Diese »gute alte« Wissenscha�stheorie brachte uns auf den Mond und erlaubte die Entschlüsselung des Genoms. Damit werden die Vorgänge in der Natur zunächst beschreibbar, dann vorhersagbar und schließlich in ihren Ursachenzusammenhängen erklärbar. Verhalten zwischen Instinkt und Vernun� Für eine Reihe griechischer Philosophen waren Beweggründe für Tierbeobachtungen die Suche nach der Seele, z. B. bei Thales von Milet, oder sogar die Begründung der Abstammung des Menschen vom Tier (!), wie bei Anaximander. Die Kontinuität der Antike mit der europäischen Geistesgeschichte der Neuzeit erklärt, dass die wissenscha�lichen Tierbeobachtungen des Abendlandes aus der idealistischen Tradition kommen. So ist auch die Dominanz der dominierenden Dualismen des Idealismus, des Leib-Seele-Problems, der Frage ob Verhalten triebha� oder durch Einsicht gesteuert sei, oder die Abgrenzung »des Tieres« vom Menschen in den Naturwissenscha�en der frühen Neuzeit zu verstehen. Dies sind deduktionistische Chimären, bzw. Pseudofragen. Denn lange vernachlässigten Wissenscha�ler Empirie und Induktion und klebten sta� dessen, bedingt durch ihre philosophische Tradition, auf der Leimrute der Spekulation (vgl. Lorenz 1992). Bereits Aristoteles schilderte eine Fülle von Beobachtungen, zum Beispiel über Balzverhalten und Vogelgesang oder über das Territorialverhalten von Adlern. Er kam zum Schluss, dass tierisches Verhalten sowohl triebha�, als auch zweckmäßig sei. Eine andere Gruppe von Denkern der Antike wird als Atomisten bezeichnet. Sie führten Ursachen und Wirkungen in der Natur auf die kleinsten Teile der Materie, die Atome, zurück. Sie folgerten, dass Tiere und Menschen aus denselben Stoffen aufgebaut seien und deshalb auch ihre Seelen gleich sein müssten. Dies führte unter anderem zu einer langen Tradition der Vermenschlichung tierischen Verhaltens, welche bis in die Tierpsychologie des frühen 20. Jahrhunderts hineinwirkte und offenbar in der »Hausverstandspsychologie« einiger kognitiver Ethologen seine Fortsetzung findet (Griffin 1991). Der Grundstein einer von vielen Auseinandersetzungen um die Antriebe des Verhaltens war gelegt, nämlich ob tierisches Verhalten triebha�-zweckmäßig oder über einsichtiges Denken gesteuert sei. Mit Weltanschauung und gesellscha�lichem Hintergrund schwingt das Pendel bis heute von einer Seite zur anderen. Die Verzahnung von Wissenscha� und Ideologie war und bleibt ständiger Begleiter der Interpretation tierischen und menschlichen Verhaltens. Im Mi�elalter ha�en die Kleriker das Monopol auf Gelehrsamkeit; es wurde fast ausschließlich deduziert. Aristoteles und andere Denker der Antike, nicht aber die eigene Anschauung waren die Quellen naturwissenscha�licher Erkenntnis, womit die empirischen Naturwissenscha�en im heutigen Sinne Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 31 nicht existierten. Trotz vieler Textstellen über tierisches Verhalten stammen daher keine wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Zeit. Man zog es in scholastischer Manier vor, über Naturerscheinungen in den Schri�en der alten Griechen nachzulesen, zu philosophieren und diskutieren, ansta� einfach nachzusehen. Empirismus wurde als Mangel an Glauben und daher als Charakterschwäche betrachtet. Der scholastische Diskurs darüber, ob Fliegen vier oder sechs Beine hä�en, bedarf aus heutiger Sicht keines weiteren Kommentars. In der Renaissance finden sich bereits Ansätze zu systematischen Beobachtungen und kongruenten Interpretationen von Verhaltensmechanismen, etwa bei Julius Caesar Scaliger (um 1500). Die absolute Vorherrscha� des dogmatischen Denkens wurde brüchig; man dur�e auch wieder relativ öffentlich darüber nachdenken, ob Tiere eine Seele hä�en, ob ihre Handlungen vernun�gesteuert oder automatenha� seien, wie es zum Beispiel René Descartes oder Gomez Peireira taten. Man beobachtete vor allem wieder. Glisson schrieb 1623 in bemerkenswert genauer Art über die Beziehung zwischen Reiz und Reaktion (Bewegung). Einen beinahe schon Lorenzschen Instinktbegriff findet man bei Dilly (1691), den man heute wohl als Neuroethologen oder Verhaltensphysiologen bezeichnen würde. Relativ dicht werden Tierbeobachtungen in der Literatur der Au�lärung. Es geht wieder vor allem um das Problem der Seele und der Abgrenzung des Menschen vom Tier. Nebenbei bemerkt, ist der Ausdruck »das Tier« eigentlich eine bis heute gebräuchliche Abstraktion für alles Nicht-menschliche, deren Berechtigung durch den Behaviorismus auch wissenscha�lich untermauert wurde. Denn für B. Skinner war der stammesgeschichtliche Hintergrund egal; ob Taube, Ra�e oder Affe, alle verfügten über dieselben Lernmechanismen. K. Lorenz dagegen kannte den Einfluss der Stammesgeschichte auf Verhalten und Lernbereitscha�en; zum »Tier« bemerkte er, dass dieser Ausdruck eine Erfindung von Menschen sei, welche nichts von Tieren verstünden; es gibt schließlich nicht nur ein Tier und einen Menschen, sondern viele verschiedene. So soll er auch regelmäßig nachgefragt haben, wenn von »dem Tier« die Rede war, was denn damit gemeint sei, Regenwurm oder Schimpanse. William Harvey interpretierte etwa in der Mi�e des 17. Jahrhunderts Instinkte als Zeichen des »gö�lichen Hauchs«. Auch in der Folge blieb der Instinktbegriff besonders durch die Vitalisten, die ihn einer Erklärung weder für bedür�ig noch für zugänglich hielten, stark metaphysisch besetzt. Heinroth verwendete ihn daher gar nicht, Lorenz nur ungern (1992). Heute ist die Verwendung des Instinktbegriffes vor allem wegen seiner umgangssprachlichen Unschärfe problematisch, es fehlt ihm aber seine frühere metaphysische Bedeutung. Besonders wissenscha�lich tätige Geistliche, wie der Pfarrer Johann Friedrich Zorn oder der Abbé von Condillac, betonten immer wieder Triebha�igkeit und Zweckmäßigkeit (Teleologie) des Verhaltens, wohl auch deshalb, weil sich diese Interpretation vorzüglich mit einem gö�lichen Willen als Ursache vertrug. Auch hier zeigt sich die Anfälligkeit der Verhaltenswissenscha�en für ideologisch motivierte Interpretationen. Dies wird von der damaligen Gegenposition bestätigt. Denn was lag näher, als dass die Vertreter der 32 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie aufgeklärten Wissenscha�en, die Begründer des Zeitalters der Vernun�, den Verstand als Basis für tierisches Verhalten heranzogen? Damit lagen sie nach unserem gegenwärtigen Wissen eher noch weiter daneben als ihre zumeist klerikalen Opponenten. Eine der fatalen Folgen dieser Theorie der Vernun�steuerung tierischen Verhaltens war eine weitgehende Vermenschlichung der Tiere. Man schloss einfach vom Menschen auf die Mitgeschöpfe. Wobei zu bemerken wäre, dass sich die Idee der reinen Vernun�steuerung menschlichen Verhaltens als unhaltbar herausstellte, denn vieles an unserem Verhalten ist triebha� und die menschliche Vernun� steht massiv unter dem Pantoffel der Emotionen (Ciompi 1993). Der bekannte Alfred Brehm, machte im 19. Jahrhundert mit seinem Werk »Brehms Tierleben« diese Vermenschlichung derart populär und verankerte sie so fest im Bewusstsein der Öffentlichkeit, dass sie auch heute noch, also fast 150 Jahre später, dort zu finden ist. Auch heute noch terrorisieren uns in der populären Literatur das »hochmütige Kamel«, der »listige Fuchs«, der »stolze Adler« und viele andere. Aber vielleicht bürden wir hier Brehm etwas zuviel an Verantwortung auf. Ist es denn nicht eine typisch menschliche Eigenscha�, Wahrnehmung und Selbsterfahrung ständig in unsere Umgebung zu projizieren? Das liegt wahrscheinlich daran, dass Auslöser auch bei uns Menschen eine wichtige Rolle spielen (Grammer 1993). Wir übertragen die Bedeutung menschlicher Mimik und Körperhaltung einfach auf Tiere. Natürlich ist des Adlers Mimik kein Ausdruck von Stolz und Kühnheit, sondern Ergebnis der Selektion von Schnabel und Überaugenwülsten im Zusammenhang mit seiner Lebensweise. Menschliche Wahrnehmung kann offenbar nicht anders. So ist es zu erklären, dass der im Vergleich zu weniger verwegen dreinschauenden Tieren relativ »dumme und faule« Adler das Wappentier vieler Staaten und Völker abgibt. Wegen der unterschiedlichen Ansätze, Sichtweisen und Interpretationen der Naturforscher nach der Au�lärung ist es müßig, genau entscheiden zu wollen, ab wann man die Tierpsychologie als exakte Wissenscha� gelten lassen kann. Das hängt von den handelnden Personen ab, die zu unterschiedlichen Zeiten durch unvoreingenommene Beobachtung oder auch durch sauber geplante Experimente die anthropomorphen Interpretationen ablösten, also die philosophisch-deduktive Arbeitsweise durch eine eher naturwissenscha�lichinduktive ersetzten. Charles Darwin als wohl bedeutendster Naturforscher aller Zeiten ist hier sicherlich an erster Stelle zu nennen. Im Allgemeinen wurde dieser Schri� aber erst sauber von den »Materialisten« und »Mechanisten« vollzogen. Damit sind jene Wissenscha�ler gemeint, die in bewusster Gegenposition zu metaphysischen Ansätzen (etwa dem Vitalismus) naturwissenscha�lich an Verhalten herangingen, also darauf beharrten, dass Verhalten auf materieller Basis, v. a. den physiko-chemischen Vorgängen im Gehirn erklärbar sein muss. Pioniere waren K. Lorenz und seine Zeit- und Kampfgenossen, aber auch seine Lieblingsfeinde, die Behavioristen. Nach Erscheinen von Darwins Hauptwerk, der »Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl« im Jahre 1859 hä�e eigentlich klar sein müssen, dass mit dem Darwinschen Mechanismus der Selektion auch die Entstehung und Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 33 Funktion von Verhalten erklärbar ist. Aber dahin war noch ein langer Weg. Darwin selbst war, wohl dem Zeitgeist entsprechend, Anhänger der klassisch-aufgeklärten Tierpsychologie, dass nämlich Tiere und Menschen dieselben Sinneseindrücke, Empfindungen, Leidenscha�en usw. hä�en, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Dies entspricht in etwa auch dem modernen Mainstream. Eine weitere, wahrha� kuriose Station auf den verschlungenen Wegen zur modernen Verhaltensforschung war der sogenannte Psycho-Lamarckismus. Instinkte wurden als zur Gewohnheit gewordene und dann sich vererbende (darum Lamarckismus) Verstandeshandlungen (darum die Vorsilbe Psycho-) interpretiert. Das läu� dem heutigen Verständnis von Evolution natürlich diametral entgegen, demzufolge individuelle Erfahrungen (wenn überhaupt) ausschließlich über Selektion, nicht aber über individuelle »Assimilation« Zutri� zum Erbmaterial der Keimbahn finden können. Aber auch diese Feststellung stimmt in ihrer absoluten Form nicht mehr. Vielmehr gibt es auch »epigenetische« Wege der Weitergabe erworbener Eigenscha�en über Generationen, worüber im Zusammenhang mit der »mü�erlichen Manipulation« noch zu berichten sein wird. Doch die Wegbereiter der Synthese der Verhaltensforschung mit dem Darwinismus formierten sich bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert. Zu den bedeutendsten zählen August Weismann in Deutschland, der aufgrund seiner genetischen und entwicklungsbiologischen Arbeiten zu Geschlossenheit und Kontinuität der Keimbahn dem Psycho-Lamarckismus die Basis entzog, sowie der Engländer C. Lloyd Morgan und schließlich der zu Lebzeiten recht unbekannte Amerikaner Otis Whitman. Letzterer folgerte auf der Basis seiner vergleichenden Untersuchungen vor allem an Tauben (Whitman 1898, 1919), dass die Darwinsche Theorie auch für »Instinkte« – Whitman gebrauchte diesen Begriff im modernen, nichtmetaphysischen Sinn und meinte damit eine vererbte Verhaltensanweisung, entsprechend der »arteigenen Triebhandlung« Oskar Heinroths bzw. den »Erbkoordinationen« von Konrad Lorenz - gültig sei, und schuf somit tatsächlich das geistige Fundament für die moderne Vergleichende Verhaltensforschung. Sein Schüler Wallace Craig tat dann den nächsten wichtigen Schri� und trennte Appetenz von Endhandlung. Auch in der Frühphase wurde viel Arbeit aus purem Interesse an Tieren geleistet, eine Hauptmotivation für induktive Verhaltensforschung generell. Und seitdem es sich im letzten Jahrzehnt herumsprach, wie sehr unser Intellekt, unsere Vernun� durch Emotion gelenkt wird, sollte es auch wieder erlaubt sein, offen zuzugeben, dass Forschung durchaus durch Interesse oder sogar Liebe zu Tieren und Natur motiviert sein darf. Auf theoretischem Gebiet jedoch dominierte bald die Frage, ob tierisches und menschliches Verhalten »angeboren« oder »erlernt« sei. In der europäischen Tierpsychologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte vielfach ein recht diffuses Bedürfnis vor, der tierischen Intelligenz (im menschlichen Sinne) auf die Schliche zu kommen, ohne klare evolutionäre Hypothesen im Hintergrund, warum dies eigentlich interessant sein sollte. So versuchte man etwa zu ergründen, wie weit das Pferd zählen, wie stark die Taube abstrahieren könne, und tut dies z. T. noch heute. Der Erkenntnisgewinn 34 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie bezüglich der Evolution kognitiver Fähigkeiten war vielfach gering, da meist weder auf ein artgemäßes Umfeld, noch auf Leistungsdispositionen und -motivationen Rücksicht genommen wurde, die nicht nur von Art zu Art verschieden, sondern auch innerartlich im Verlauf der Lebensgeschichte wandelbar sein können. Außerdem wurden diese Untersuchungen kaum breit vergleichend, sondern meist an einer eher zufällig ausgewählten »Modelltierart« durchgeführt; ein echter ökologischer Bezug fehlte. Wieweit diese Projekte einen Beitrag zum Verständnis der Stammesgeschichte menschlicher kognitiver Fähigkeiten leisteten, bleibe daher dahingestellt. Erst seit wenigen Jahren kommt es zu einer raschen Neubelebung der kognitiven Ethologie aus einer wirklich evolutionären Perspektive. Das Tier-Mensch-Kontinuum und der genetische Determinismus Auf einer anderen Ebene nährte das von Charles Darwin erstmals explizit angesprochene Kontinuum zwischen tierischem und menschlichem Verhalten die Verhaltensforschung. Tatsächlich war Darwins 1872 erschienenes Buch »The expression of the emotions in man and animals« für viele Zeitgenossen und deren anthropozentrisches Weltbild eine Provokation. Viele betrachten dieses Buch als jenen Paukenschlag, mit dem die Ära der modernen Ethologie begann. Damit startete Darwin nicht nur eine der größten Auseinandersetzungen in der Geschichte der Ethologie und Biologie überhaupt, sondern bereitete – sicherlich ungewollt – den Boden für einen der folgenschwersten Missbräuche in der Wissenscha�sgeschichte. Dem Zeitgeist entsprechend, wurde Darwin zunächst als ideologisches Zugpferd vor den sozialdarwinistischen Karren gespannt. Gesellscha�liche Unterschiede seien »blutsbedingt« (heute würde man das »ererbt« nennen) und daher durch Erziehung nicht zu verändern. Die gesellscha�liche Einmauerungs- und Absicherungsstrategie der oberen Zehntausend ist aus der industriellen Revolution und dem sich langsam organisierenden Industrieproletariat erklärbar. Wozu in die Bildung der Arbeiterscha� investieren, wenn der Unterschied zwischen »oben« und »unten« ohnehin go�gewollt und biologisch bedingt ist? Dieses Gedankengut hielt sich erstaunlich lange und bildete als Kulmination die pseudowissenscha�liche Basis für Hitlers eugenisch-rassistisches Terrorregime. Biologen wurden immer in den Dienst von Ideologien gestellt, mehr oder weniger freiwillig. Viele europäische Biologen, allen voran Ernst Haeckel, prägten den sozialdarwinistischen Zeitgeist, aber es gab sogar viele US-amerikanische Vertreter dieser Richtung. Dass auch Konrad Lorenz vor dem Krieg in einer Nebenrolle das Seine zur Rechtfertigung der (NS-) Eugenik beitrug, mag uns heute unangenehm berühren, lässt sich aber durch Originaltexte belegen (Lorenz 1940). Diese Tatsache unter den Teppich kehren zu wollen ist gerade gegen den Hintergrund der von Rassismus geprägten deutschen und österreichischen Vergangenheit keine Lösung. Es wurde in jüngster Zeit versucht, die Scha�en in Lorenz‘ Schaffen aufzuarbeiten (Bischof 1991, Föger und Taschwer 2001, Kotrschal u. a. 2001, Wuketits 1990). Was bleibt ist ein differenziertes Bild. Lorenz war ein genialer Biologe, Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 35 aber auch hemmungslos opportunistisch, wenn es darum ging, sein Hauptziel, die Einrichtung eines Kaiser Wilhelm Institutes zu erreichen. Dies gelang nicht, obwohl er durchaus mit einigen Aspekten der NS-Ideologie, wie etwa der Eugenik, sympathisierte und auch ab 1938 NSDAP-Mitglied war. Lorenz war einer von Vielen und die Biologie war eine wichtige Stütze der NS-Ideologie (Bäumer 1990). Fest steht, dass die Bedeutung der eugenischen Äußerungen Lorenz‘ von seinen Kritikern zum Teil maßlos übertrieben, ja dazu benutzt wurden, den wissenscha�lichen Wert der Lorenzschen Theorie zu diskreditieren (vgl. Schleidt 2001). Ihn etwa, wie es einige österreichische Journalisten taten, zum »Vordenker des Holokaust« hochzustilisieren, ist aufgrund der Faktenlage absolut unhaltbar. Wäre er wirklich so wichtig gewesen, man hä�e ihn wohl nicht als einfachen Soldaten 1944 an die Ostfront geschickt. Fest steht aber auch, dass Lorenz seine damals in einer Fachzeitschri� publizierten Äußerungen (1940) nie in gleichwertiger Form zurücknahm und es damit seinen Kritikern bis heute leicht macht. Er entschuldigte sich in seiner Nobelpreisrede zwar für sein Naheverhältnis zum NS-Regime, eine fachliche Aufarbeitung seiner Gründe für dieses Naheverhältnis vermied er aber lebenslang. Aus seinen 1973 erschienen »8 Todsünden der zivilisierten Menschheit« wird erkennbar, dass sich sein genetisch-deterministisches Denken auch nicht veränderte. So hielt Konrad Lorenz lebenslang an seinem Vorurteil der »Selbstdomestikation des Menschen« im Umfeld der Zivilisation fest, und auch daran, dass die »genetische Degeneration« als Ursache für den Niedergang der »sozialen Instinkte« zu sehen sei (vgl. Kotrschal 2001). Eben dieses Denken deckte sich 1938 hervorragend mit der Ideologie der Nazis. Aus heutiger Sicht kann man sich über einen derart starren genetischen Determinismus nur wundern. Der moderne Mainstream lehnt solche Ideen nicht nur aus ideologisch-menschlichen, sondern auch aus guten fachlichen Gründen ab. Leider bieten diese »braunen« Flecke von Konrad Lorenz noch immer den Vorwand dafür, dass gelegentlich von Seiten mancher Sozialwissenscha�ler (im Gegensatz zu den Naturwissenscha�en ist es in den Sozialwissenscha�en inakzeptablerweise immer noch üblich, Wissenscha� explizit von einem ideologischen Standpunkt aus zu betreiben) und Journalisten Ethologie und rechte Ideologie gleichgesetzt werden, was natürlich völliger Unsinn ist. Dass in der Vergangenheit der aus der Lorenzschen Tradition kommende, große Humanethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt, der aufgrund seiner Bekanntheit das Bild der Ethologie in der Öffentlichkeit maßgeblich prägt, simplistische politische Empfehlungen in Ausländer- und Zuwandererfragen abgab, dient auch nicht gerade der Entflechtung von Wissenscha� und Ideologie. Es macht aber auch deutlich, dass dies wahrscheinlich letztlich weder zu erreichen noch wünschenswert ist. Denn Wissenscha�ler müssen einfach aus dem Elfenbeinturm heraustreten und Verantwortung übernehmen. Eibl-Eibesfeldt ist ein differenzierter Standpunkt zuzubilligen (1988, 1994). Leider bleibt jedoch im Zuge der vereinfachenden medialen Au�ereitung der Eindruck zurück, Ethologie würde sich (wieder einmal) zur Rechtfertigung einer rassistisch-faschistischen Politik hergeben. 36 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Vor dem Hintergrund der Geschichte des Sozialdarwinismus ist es, um einen Vorgriff zu tun, verständlich, dass in den USA die Soziobiologie nach ihrer offiziellen Begründung durch Wilson (1975) misstrauisch, teils mit offener Ablehnung aufgenommen, ja wieder mit ähnlichen Argumenten bekämp� wurde wie einst der Sozialdarwinismus. Man befürchtete nicht ganz zu Unrecht ein Wiederaufleben eines sozialen, rassischen (man sollte heutzutage wohl politisch korrekt, den Begriff »ethnisch« verwenden) und sexistischen Determinismus. Der »psychologische Determinismus« besteht darin, jedes Verhalten auf bestimmte Ursachen zurückzuführen, während der »biologischgenetische Determinismus« die relative Unveränderbarkeit von ererbtem Verhalten durch Umwelteinflüsse betont. Im späten Gefolge gab es tatsächlich Biologen, wie Herrnstein und Murray (1994), in ihrem Buch »The Bell Curve« sehr datenreich nachzuweisen versuchten, dass Afro-Amerikaner bildungsunfähiger und triebha�er als weiße Kaukasier seien. Es war relativ einfach, dies als einen bestenfalls naiven, sicherlich aber biologistischen Missbrauch biologischer Erkenntnisse im Sinn einer Ideologie zu entlarven. Alleine methodisch wäre es unmöglich, saubere einschlägige Daten zu gewinnen, denn die Eigenscha�en aller Organismen, so auch der Menschen sind durch die Interaktion von Genen und Umwelt während der Entwicklung bestimmt. Da Afro-Amerikaner in immer dramatischerem Ausmaß in anderen sozialen Schichten aufwachsen als Weiße, ist ein Schluss auf die genetische Disposition diverser Eigenscha�en unzulässig. Und schließlich kennt man dieses Denken schon vom Sozialdarwinismus: Wozu Bildungsaufwand, wenn es für die Katz´ ist, weil die Unterschiede ja ohnehin »blutsbedingt« sind? Welch katastrophale Auswirkungen sogar ein entsprechender Verdacht gegen den Hintergrund konservativer Regierungen in den USA haben kann, braucht nicht ausgeführt zu werden. Der Weg in die Vergleichende Verhaltensforschung und Ethologie Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde sowohl von Biologen als auch von Psychologen in Europa, vor allem aber in den USA rege an tierischem Verhalten geforscht (Dewsbury 1989; Exkurs 2). Stärkster Antrieb war das Streben nach dem Verständnis der menschlichen Psychologie. Daher hieß die Verhaltensforschung damals auch »Tierpsychologie«. O. Whitman, W. M. Wheeler, W. Craig, G. W. Peckham, um nur einige Namen zu nennen, betrieben naturwissenscha�liche Tierbeobachtungen und enthielten sich anthropomorpher Interpretationen. Besonders Otis Whitman (1898), wie auch später Oskar Heinroth (1910) und Konrad Lorenz (1941) verglichen Verhaltensweisen zwischenartlich. Sie sind daher die Begründer der Vergleichenden Verhaltensforschung. Diese Richtung nützt Unterschiede zwischen in ihrer Herkun� vergleichbaren (homologen) Verhaltensweisen, um stammesgeschichtliche Rückschlüsse zu ziehen (Lorenz 1978). Ganz wichtig waren auch Verhaltensphysiologen, wie zum Beispiel Jacques Loeb, die bahnbrechende Arbeiten zu den einfachen Orientierungsmechanismen der Tiere, den Tropismen, lieferten. Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 37 Auch in Europa gab es prominente Vertreter der Tierpsychologie, etwa O�o Koehler, Oskar Heinroth und viele andere. Ansätze und Fragestellungen waren vielfältig, aber erst Konrad Lorenz, Niko Tinbergen und Erich von Holst scha�en es in den 1950er Jahren, das kunterbunte Stückwerk in einem in sich konsistenten Theoriengebäude unterzubringen (Exkurs 3). Die klassische Tierpsychologie dagegen führte in eine Sackgasse. Die scheinbar unvermeidliche Rückwirkung von Konzepten und Begriffen aus der Psychologie des Menschen nebst einer teilweise ungenügenden vergleichenden Tierkenntnis, sowie generell eine spekulativ-deduktive Arbeitsweise und die freizügige Durchmischung von physiologischen und psychischen Konzepten (vgl. Lorenz 1992) behinderte eine vorurteilsfreie Interpretation, eine eigenständige und fachlich einwandfreie Entwicklung der Verhaltenswissenscha�en aus der Tierpsychologie heraus. Dabei versuchte man damals durchaus, menschliches und tierisches Verhalten in einem einheitlichen Konzeptrahmen zu sehen. Lorenz und andere Biologen, etwa Jakob von Uexküll, standen, obwohl unterschiedlichen Lagern zugehörig, der Unterscheidung von Tier- und Humanpsychologie immer ablehnend gegenüber: »Es gibt nur eine Psychologie« oder: »Für den Biologen gibt es keine Tierpsychologie!«, kann man vielerorts lesen (s. unten). Mit dem Au�reten von O. Whitman und seinen europäischen Ethologenkollegen war das Rennen um die Naturwissenscha�lichkeit der Verhaltensforschung noch lange nicht gelaufen, ganz im Gegenteil. Ihre Ergebnisse gingen um die Jahrhundertwende sowohl in Europa als auch in den USA im Streit zwischen den Vitalisten und Mechanisten unter – vom Standpunkt des Erkenntniswertes ein Kampf der Blinden gegen die Lahmen, wie wir heute wissen. Wahrha� in einer Fußangel der tierpsychologischen Tradition hingen die aus der idealistisch-geisteswissenscha�lichen Tradition kommenden Vitalisten und Zweckpsychologen (z. B. Edward C. Tolman). Sie betonten einmal mehr die Zweckmäßigkeit der Instinkte, sahen aber als ihre Ursache eine Naturkra�, die Vis vitalis, an, welche einer Erklärung weder zugänglich noch bedür�ig sei. Sie verweigerten sich daher der Naturwissenscha� der Au�lärung, besonders aber dem Darwinismus, der das einigende Konzept aller biologischer Richtungen des 20. Jahrhunderts werden sollte. »Wir betrachten den Instinkt, aber wir erklären ihn nicht« (Johan A. Bierens de Haan). Freiwillige Selbstbeschränkung in der Forschung und Zuflucht zu einer höheren Instanz also, und die ist bekanntlich weder nützlich noch wirksam. Nebenbei bemerkt: Dies gilt auch für die gegenwärtig immer stärker werdenden staatlichen Regulierungstendenzen, etwa in den allgemein als heikel angesehenen Gebieten der Gentechnologie oder der Verwendung fötalen Gewebes. Wissenscha� ist wie die Evolution weder gut noch schlecht, sie ist einfach. Wenn Probleme entstehen, dann durch die missbräuchliche Anwendung wissenscha�licher Ergebnisse im Spannungsfeld der Politik. Trotzdem gab es unter den Vitalisten bedeutende Verhaltenswissenscha�ler, die durchaus induktiv arbeiteten, etwa Jakob von Uexküll (1934). Dieser verschloss sich allerdings einer rational-darwinistischen Erklärung der ebenso mannigfaltigen wie offensichtlichen Anpassungen von Organismen an ihre 38 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Umwelt genauso wie der hoch angesehene Teilhard de Chardin. Wie die meisten anderen Naturwissenscha�ler seiner Zeit war Uexküll dem TypusDenken verha�et. Für ihn waren die Anpassungen der Organismen an ihren Lebensraum ein Ergebnis unveränderlicher und vorgegebener Baupläne, nicht aber der formenden Wirkung von Mutation und Selektion. Zu den materialistischen, reduktionistischen Mechanisten auf der anderen Seite zählt man vor allem die »Assoziationspsychologen«, »Behavioristen« wie J. Thorndike und B. Skinner, und die auf den bahnbrechenden Erkenntnissen von I. Pawlow au�auenden »Reflexologen«. Alle diese Richtungen sind als naturwissenscha�lich-induktionistisch einzustufen. Die Vokabeln materialistisch, reduktionistisch und mechanistisch mögen alles andere als sympathisch klingen. Sie sollen aber wertfreie Bezeichnungen für die Grundeigenscha�en des naturwissenscha�lichen Ansatzes darstellen (Exkurs 5,6): Materialistisch, weil alle Erscheinungen unserer Welt auf Basis der Interaktionen der Materie, ohne deus ex machina, ohne Bezug auf ein transzendentales Prinzip, zu erklären sein sollten; reduktionistisch, weil man niemals Systeme in ihrer gesamten Komplexität untersuchen kann, sondern allemal Parameter von Untersystemen (eine gewisse Ausnahmestellung hält hier der vergleichende Ansatz); und mechanistisch, weil es eben die Gesetzmäßigkeiten von Physik und Chemie sind, die letztlich die Materie und unser Verhalten bestimmen. Im Gegensatz zu den Vitalisten bestri�en die materialistisch eingestellten Mechanisten, dass ein transzendentales Prinzip zur Erklärung der belebten Welt, insbesondere des Verhaltens, erforderlich sei. So gab es für Lorenz natürlich keinen vom Körper selbständigen Geist, sondern es war klar, dass jedwede »seelischen«, also geistig-kognitiven und subjektiv-psychischen Leistungen auf der Basis von objektivierbaren physiko-chemischen Vorgängen im Gehirn zustande kommen. Mi�lerweile stützt eine rasch anwachsende Basis an Daten diese damals noch recht deduktiv gewonnene Überzeugung des jungen Lorenz (vgl. z. B. »Spektrum der Wissenscha�« 1992, Spezialausgabe »Gehirn«). Die Reflexologen führten alles Verhalten auf Reflexe, ausgelöst durch Außenreize, zurück. Eine Fülle von Wissenscha�lern, einschließlich dem jungen Konrad Lorenz und Karl von Frisch, hingen der Reflextheorie an. Dass aber selbst komplizierte Verhaltensabläufe nichts anderes als Reflexke�en, also Reaktionen auf die Meldungen der äußeren und inneren Sinnesorgane sein sollen, wurde schließlich durch E. von Holst gemeinsam mit K. Lorenz widerlegt. Sie zeigten, dass es im Zentralen Nervensystem Zentren gibt, die bestimmte zeitlich-räumliche Bewegungsmuster generieren, und dass Verhalten durchaus spontan aus dem Inneren von Tieren kommen kann, unabhängig von Außenreizen. Aus zoologisch-materialistischer Richtung war die Motivation für die Untersuchung tierischen Verhaltens das Interesse an der Naturgeschichte von Tieren einerseits, o� schlichte Liebhaberei, und sie kam andererseits aus einer in den USA bereits fruchtbaren experimentellen Tradition, welche vor allem auch wertvolle methodische Ansätze beisteuerte. Verständlich, dass die auf Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 39 diesem Gebiet vorerst dominierenden vergleichenden Psychologen Tiere untersuchten, weil sie mehr über menschliches Verhalten erfahren wollten. Bekannt wurden in diesem Zusammenhang vor allem die Lernstudien und Arbeiten zur Verhaltensentwicklung. Die psychologische Schlagseite in den amerikanischen Verhaltenswissenscha�en führte zu einer starken Betonung des Menschen als Forschungsziel (während paradoxerweise der Mensch als Forschungsgegenstand der Ethologie erst durch den vom Lorenz-Schüler EiblEibesfeldt [1995] ausgehenden Ansatz der Humanethologie wieder größeres Gewicht gewann). Darunter li� die zoologisch und stammesgeschichtlich orientierte Verhaltenswissenscha� vor allem in den USA; wie sehr dies der Fall war, ist daran zu ersehen, dass selbst ein Artikel von Staddon (1989) den bezeichnenden Titel trägt: »Animal psychology: The tyranny of anthropocentrism«. Tierisches Verhalten per se war lange Zeit in der vergleichenden Psychologie kein Thema. Die berechtigte Forderung von Konrad Lorenz (1992), die Vergleichende Verhaltensforschung müsse die Grundlagenwissenscha� der Psychologie werden, verhallte ziemlich unbeachtet. Erst in jüngster Zeit, über die Hintertür der Primatologie, und »evolutionäre Psychologie« hält dieser Lorenzsche Grundsatz Einzug in die Psychologie. Trotz der reichen US-amerikanischen Tradition, aber vielleicht gehemmt durch deren MenschZentriertheit, gelang schließlich die Integration der Ethologie in Europa. Eine Synthese in den USA wurde wohl durch die extrem gegensätzlichen Richtungen der Experimentalpsychologen, der Zweckpsychologen und der Behavioristen verhindert; der Aufstieg von Lorenz und Tinbergen wurde dadurch hingegen katalysiert. Wichtiger Wegbereiter, Lehrer und väterlicher Freund für Konrad Lorenz (und von diesem auch als Begründer der modernen Verhaltensforschung bezeichnet) war Oskar Heinroth. Zwischen den Weltkriegen Direktor des Berliner Tiergartens, ha�e Heinroth Zugang zu einer Fülle von Tierarten, was eine Voraussetzung für Vergleichende Verhaltensforschung darstellt. Er stellte, wie später Lorenz, vergleichende Untersuchungen an Enten und Gänsen an und entdeckte die innerartliche Formkonstanz von Verhaltensweisen (1910). Er nannte diese Verhaltensweisen »arteigene Triebhandlungen«. Im Namen steckt bereits, dass sie wie körperliche Merkmale vererbt werden und natürlich auch so evoluieren. Zwischenartlich variieren diese homologen Triebhandlungen im Einklang mit der stammesgeschichtlichen Verwandtscha� von Arten, sie sind also zur Rekonstruktion des Stammbaums ebenso brauchbar wie körperliche Merkmale (Exkurs 3). Somit kamen O. Heinroth und O. Whitman, zunächst ohne voneinander zu wissen, zu ganz ähnlichen Ergebnissen – die Vergleichende Verhaltensforschung als Wissenscha� war begründet. Jahre ihres Lebens steckten die Eheleute Oskar und Katharina Heinroth in die Handaufzucht aller Vogelarten, deren sie nur habha� werden konnten. Daraus entstand mit dem dreibändigen Werk »Die Vögel Mi�eleuropas« (Heinroth und Heinroth 1966) eine der bis heute wohl umfangreichsten Informationsquellen zur Verhaltensentwicklung von Tieren. Obendrein ist dieses Werk recht amüsant zu lesen; das Kapitel über die Kolkraben sei als 40 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Einstieg empfohlen. Stellvertretend für eine ganze Reihe weiterer wichtiger Vetreter der frühen Ethologie sei Julian Huxley genannt, der am Beipiel der Balz der Haubentaucher (1914) die Evolution von ritualisiertem Verhalten beschrieb. Konrad Lorenz und die Ethologie Konrad Lorenz arbeitete, wie Oskar Heinroth, breit vergleichend. Eine Inventur der von ihm meist im Freiflug und in Gruppen gehaltenen, o� handaufgezogenen Vogelarten, welche er in seinen Briefen an Heinroth zwischen 1930 und 1940 (herausgegeben von O�o König 1988) erwähnt, ergab deren 77; berücksichtigt man, dass er wahrscheinlich nicht alle von ihm gehaltenen Vogelarten erwähnte, so ist dies eine recht konservative Schätzung. Dazu kommen noch einige Dutzend anderer Wirbeltiere, von Fischen bis zu Säugetieren. Konrad Lorenz entwickelte die meisten zentralen Konzepte der Ethologie (Exkurs 3), die zwar da oder dort korrigiert werden mussten und teils nur noch als historisches Denkmodell gelten (Kotrschal u. a. 2001), andernteils aber bis heute nichts an Aktualität und Konfliktpotential verloren haben (Exkurs 4). Er vereinigte schließlich diese Konzepte gemeinsam mit anderen zu einem tragfähigen theoretischen Gebäude. Selbst eine unvollständige Aufzählung der wichtigsten Entdeckungen von Lorenz liest sich wie die Inhaltsangabe eines Lehrbuches der klassischen Ethologie. So gehen eine Vielzahl von Begriffen auf Lorenz bzw. seine maßgebliche Beteiligung zurück: Das »angeborene auslösende Schema« (später von einer Kommission unter Vorsitz von O�o Koehler auf »angeborenen Auslösemechanismus«, AAM, umbenannt), die »Erbkoordination«, Spontaneität und Staubarkeit von Verhalten, »Appetenz« und »Endhandlung«, »Motivation«, das »psychohydraulische Modell«, »Prägung«, die »Instinkt-Dressur-Verschränkung« (Zusammenhang zwischen Instinkthandlungen und Lernen), usw. Lorenz betonte die materielle Basis psychischer Vorgänge und machte eloquent verständlich, dass unser Erkenntnisapparat als Spiegelbild einer realen Welt evoluierte. Er schuf damit eine gewichtige Gegenposition zu manchen Strömungen der idealistischen Philosophie. Große Bedeutung erlangte Lorenz auch auf in der Erarbeitung einer sauberen naturwissenscha�lichen Wissenscha�stheorie für die Verhaltensforschung. Er kritisierte eine allzu deduktionistische Arbeitsweise und betonte die Notwendigkeit, die objektivierbaren physiologischen Mechanismen sauber vom subjektiven Erleben zu trennen (Lorenz 1992), obwohl er Introspektion im Gegensatz zum Verständnis des damaligen und heutigen Mainstreams als Erkenntnisquelle propagierte. Selbst wenn nicht alle Lorenzschen Hypothesen einer kritischen Überprüfung standhielten (Exkurs 4, unten): Er war für die Ethologie richtungsweisend. Gerade mit seinen kontroversiellen Konzepten etwa zur Aggression (Lorenz 1963) initiierte er weltweit eine große Anzahl wichtiger Untersuchungen. Wie alle wahrha� großen Wissenscha�ler, ging er an den »großen« Themen nicht vorbei. Es hä�e seiner Persönlichkeit nicht entsprochen, beispielsweise lebenslang nur alle Einzelheiten der »Eirollbewegung« zu erforschen, er war an den großen Mustern und Fragen interessiert, an Aggression etwa, letztlich an der Zukun� der Menschheit. So mischte sich der angeblich »unpolitische« Lorenz auf Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 41 Basis seiner Verhaltenskompetenz immer wieder in gesellscha�liche Belange ein, in seiner unrühmlichen Schri� zur Eugenik (1940) genauso wie in seinem besorgten Manifest zu den Fehlentwicklungen der zivilisierten Menschheit (1973). Je allgemeingültiger die Aussagen eines Wissenscha�lers, desto weiter wagt er sich auf dünnes Eis, ferne der trügerischen Sicherheit klarer Daten. Konrad Lorenz war mutig genug dafür, ja er brauchte offenbar das Wagnis. Und er wurde, wohl ebenfalls zu recht, immer wieder dafür kritisiert. Mit Niko Tinbergen, einem weiteren Begründer der klassischen Ethologie und Wegbereiter der Öko-Ethologie, verband Konrad Lorenz eine lebenslange Freundscha� und weitgehende Übereinstimmung in den Konzepten. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass Tinbergen der Einzige war, mit dem Lorenz auch nach seiner Emeritierung 1973 einen ausführlichen Briefverkehr unterhielt. Meilensteine der Entwicklung der Ethologie waren sicherlich die Berufung Tinbergens nach Cambridge (England) und die Installierung eines Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie für Konrad Lorenz, zuerst in Buldern in Westfalen, dann in Seewiesen am Starnberger See, zusammen mit seinem Partner Erich von Holst. Ganz wichtige Stützen der neuen Richtung waren die Schaffung eines entsprechenden Publikationsorgans, der »Zeitschri� für Tierpsychologie« (heute: »Ethology«), durch O�o Koehler und andere, sowie die regelmäßigen Tagungen der Ethologischen Gesellscha�. Auch nur auf die bedeutendsten Schüler und Nachfolger von Tinbergen und Lorenz einzugehen würde den Rahmen einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Verhaltenswissenscha�en sprengen (s. Kotrschal 2001). Exkurs 4: Ethologie: Die Kritik an der Lorenz-Tinbergenschen Theorie Instinkt versus lernen: In der Vergangenheit wurde die Lorenz-Tinbergensche Theorie (Lorenz 1978) vor allem von Lerntheoretikern kritisiert, denen die Erbkoordinationen, also die stark genetisch determinierten Verhaltenselemente, ein Dorn im Auge waren. Dies entsprang einem Mißverständnis, denn natürlich wussten auch die frühen Ethologen, dass Lernen Verhalten modifiziert. Und es bestätigte sich, dass das grundlegende Verhaltensinventar, die »Erbkoordinationen« nicht erlernt werden können, sie sind weitgehend genetisch determiniert und entwickeln sich beinahe ohne Anteil von Umwelteinflüssen. Verhalten kann daher nicht zur Gänze erlernt sein, wie die extremen Behavioristen meinten. Und es wird auch nicht in eine leere Matrix hineingelernt, sonder auf Basis weitgehend erblicher Lerndispositionen. Konrad Lorenz stellte zu Recht die Frage, warum lernen adaptiv sei. Er postulierte einen »angeborenen Lehrmeister«, der bestimmt wofür sich Individuen interessieren und was sie lernen (können). Solche artspezifischen Lerndispositionen sind heute klar bestätigt. Andererseits blieben die frühen Ethologen recht diffus bezüglich ihrer evolutionären Lerntheorie. Lorenz etwa lehnte den Behaviorismus ab, weil Lernmechanismen artspezifisch seien. Heute wissen wir, dass dies zwar für den »angeborenen Lehrmeister« gilt, nicht aber für die eigentlichen Mechanismen. Die Behavioristen sollten aber insofern Recht behalten, als es 42 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie heute schein (Shettleworth 1998), dass es tatsächlich nur ein eingeschränktes Spektrum an gemeinsamen Lernmechanismen für alle (Wirbel)tiere gibt, gleich ob Fisch, Eidechse, Taube, Ratte oder Mensch. Dazu zählen die Habituation, die Pawlowsche und die operante Konditionierung, sowie ein paar Zusatzmechanismen für das Lernen im sozialen Zusammenhang. Und die Ethologen hatten darin Recht, dass die Aufmerksamkeit auf bestimmte Umweltreize und die Lernbereitschaften artspezifisch sind. Noch immer wird gelegentlich diskutiert, welche Merkmale / Eigenschaften / Verhaltensweisen »angeboren« bzw. »erlernt / erworben« seien. Tatsächlich wurde diese Schein-Kontroverse bereits in der fachlichen Auseinandersetzung zwischen Daniel Lehrman (1953) und Konrad Lorenz, bzw. den anderen Ethologen gelöst. Lehrman kritisierte scharf die damals von den Ethologen eingesetzten Kaspar-Hauser-Versuche (Erfahrungsentzug) als Nachweismethode von Erbkoordinationen. Prinzipiell ist die Unterscheidung zwischen »angeboren« bzw. »erlernt / erworben« sinnlos, da alle biologischen Merkmale im Zuge der Individualentwicklung in Interaktion zwischen Genen und Umwelt entstehen (Lamprecht 1981, Lehrman 1970, Exkurs 8). Natürlich gibt es Merkmale, wie etwa Erbkoordinationen, die weitgehend genetisch determiniert sind, trotzdem sollte man diese nicht als »angeboren« bezeichnen, da damit das starre und daher falsche genetisch-deterministische Denken gefördert würde. Wie allgemeingültig ist die »ethologische Theorie«?: Schweres Geschütz fuhr die Bonner Ethologin Hanna Maria Zippelius in ihrem Buch »Die vermessene Theorie« (1992a) auf. Sie bestreitet die Allgemeingültigkeit der LorenzTinbergenschen Theorie, stellt sie als inkonsistent dar und zweifelt vielfach die empirischen Daten an, auf welchen sie begründet ist. Zippelius versuchte eine Theorie zu Fall zu bringen, die ohnehin längst weitgehend unbeachtet vor sich hin bröckelte; andere Kollegen arbeiteten die vergangenen 30 Jahre an ihren zumeist öko-ethologischen und soziobiologischen Problemen, ohne sich viel um dies alte Theoriegemäuer zu kümmern. Nur in den Schulbüchern wird die »klassische« Theorie zum Dogma erhoben. Man könnte zu dem Schluss kommen, die Entwicklungen der Ethologie seien in den 1960er Jahren stehengeblieben. Es lässt bezüglich der Hol- und Bringschuld von Wissenschaftlern und Öffentlichkeit tief blicken, dass Abiturienten heute noch aus allen Wolken fallen können, wenn sie erfahren, dass Tiere zumeist nicht um Arterhaltung bemüht sind und dass nicht alle Auslöser »angeboren« sind. Die Lorenzschen Theorien sind zu Glaubenssätzen verkommen, kritischer Wind ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Gelegentlich fand man, dass frühe Ergebnisse, welche die Theorie stützten, kaum reproduzierbar waren, wie im Falle des aggressionsauslösenden roten Bauches von Stichlingen (Tinbergen 1948, Lamprecht 1993 a,b). Einiges war schlicht falsch, wie die noch heute in nahezu jedem Schul-Lehrbuch reproduzierten Tinbergenschen Flugfeindattrappen (1949), die zeigen sollen, dass sogar die Umrisse möglicher Luftfeinde bei Küken weitgehend angeboren sind, also »Schlüsselreize« darstellen. Und dies, obwohl bereits Wolfgang Schleidt (1961) zeigte, dass naive Küken auf jedes dunkle Objekt, welches mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit über sie hinweggezogen wurde, mit Alarm reagierten, sie also »erblichermaßen« wohl auf einfache Reizkombinationen, Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 43 nicht aber spezifisch auf eine komplexe Gestalt reagieren. Diese Ergebnisse erregten in der Öffentlichkeit kein Echo und wurden von der Fachwelt beinahe kommentarlos zur Kenntnis genommen. Im Bewusstsein letzterer wandelte sich die klassische Lorenz-Tinbergensche Theorie zunehmend von einem unmittelbar-physiologischen Erklärungsschema zu einem kybernetischen Denkmodell, das jahrzehntelang als konzeptuelle Stütze der wissenschaftlichen Arbeit gute Dienste leistete, das man aber getrost dann zur Seite legen kann, wenn situationsbezogen-direkte, mehrdimensionale und physiologische Erklärungsprinzipien für Verhalten etabliert sind. Längst war die Theorie entsprechend kommentiert und relativiert worden (Hinde 1966, 1982, McFarland und Huston 1981). So hat etwa Lorenz sein Konzept der Staubarkeit von Verhalten sicherlich zu universell ausgelegt. Das Beispiel der Aggression (Lorenz 1963) zeigt, dass diese stark anlaßbezogen eingesetzt wird (Archer 1988); sie staut sich gewöhnlich nicht unspezifisch auf, sodass etwa auf eine längere friedliche Periode Individuen ihre »aufgestaute Aggression« unbedingt »abreagieren« müssten. Die scharfe Attacke von Zippelius wirbelte daher bei einigen Wissenschaftsjournalisten und dann auch in der Öffentlichkeit wesentlich mehr Staub auf als unter Fachkollegen. Es wurde der Eindruck erweckt, als ob alle Einsichten, zu denen Lorenz und Tinbergen je gelangt sind, Schrott wären; manch deduktionistischen Humanisten und Sozialwissenschaftler ließen sich mit einem »Ich hab‘ es immer schon gewußt!« in ihren Lehnstuhl fallen und hielten die Abrechnung mit Lorenz für gelaufen. War wirklich alles falsch? Natürlich nicht! Zippelius hat aber sicherlich insofern Recht, dass viele Modelle der klassischen Ethologie zu starr ausgefallen und in ihrer kybernetischen Ausformung zu fern der tatsächlichen Realität angesiedelt waren, dass es oft an empirischen Belegen mangelt und zum Teil komplexe Hilfskonstruktionen errichtet werden mussten, um Beobachtungen in Einklang mit der Lorenzschen Theorie zu bringen. Dass es zu der maßlos übertriebenen Behauptung kam, die klassische Theorie sei widerlegt, mag unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die Diskussion unter Fachkollegen um das Buch von Zippelius auf einem relativ differenziertem Niveau geführt wurde. Journalisten aber müssen ihre Geschichten »verkaufen«, und eine Schlagzeile, die da lautet »Teilaspekt der Lorenz-Tinbergenschen Theorie muss überdacht werden« verkauft sich sicherlich schlechter als die Behauptung, alles sei »falsch«, ein »Irrtum der Wissenschaft« gewesen. In erster Linie hatte Zippelius mit ihrer Kritik weit über das Ziel hinausgeschossen. Das klingt wie eine Verteidigungsbehauptung für Lorenz und Tinbergen, was mir aber fern liegt. Es sei auf die differenzierten Stellungnahmen von Lamprecht (1993 a,b) und Witte (1993) verwiesen. Die Komplexität der Materie verbietet es, sie hier im Detail zu erörtern. Das wäre ein eigenes Buch wert, zumal auch Wissenschaftspsychologie mit im Spiel zu sein schienen. Einer der Ansatzpunkte der Kritik von H. M. Zippelius waren die durch ihre Diplomandin Ursula Eipasch nachgestellten, aber im Ergebnis nicht reproduzierbaren Versuche von Tinbergen (1949) und Tinbergen und Perdeck (1950). Dabei wurde mittels der Pickraten von Möwenküken auf Eltern-Schnabelattrappen untersucht, ob dies ein »angeborener Schlüsselreiz« sei und auf welche Reize es ankäme. Da erstens die für die Replikation verwendeten Methoden mit jenen 44 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie des Originalversuchs nicht identisch waren und die neuerlichen Versuche wenig biologisches Fingerspitzengefühl verraten, ist ihre Gültigkeit zweifelhafter als jene der Originalversuche. Man nahm zunächst an, dass »Schlüsselreize«, also Auslöser für Erbkoordinationen, großteils erblich seien, während es sich nun zunehmend herausstellt, dass bei naiven Tieren zumeist nur grobe Reizkombinationen bzw. eine rasche Lernfähigkeit vorhanden sind. Für die Gültigkeit der Theorie ist es aber ziemlich unerheblich, ob Auslöser rein vererbt oder das Ergebnis eines prägungsähnlichen Lernprozesses sind. Bereits die Nomenklatur der frühen Ethologie unterschied den »angeborenen Auslösemechanismus« (AAM) von einem »erworbenen Auslösemechanismus« (EAM) und einem Hybriden, dem EAAM (»erworben-angeborener Auslösemechanismus«). Der beste Beleg für die Meriten der Lorenz-Tinbergenschen Theorie ist ihre ungebrochene Aktualität als konzeptuelle Basis der Neuroethologie (Bischof 1989), also in der Erforschung der (verhaltensrelevanten) Funktionen des Nervensystems. Um bei der Gebäude-Metapher für die »klassische Ethologie« zu bleiben: Es ist etwas Putz abgefallen. Man misst dem alten Palast heute vielleicht nicht mehr dieselbe Bedeutung zu wie früher. Die Fundamente sind aber im Wesentlichen gesund, das alte Theoriegebäude wird nicht einstürzen. Man muss es auch nicht zur Gänze abreißen; stückweises Renovieren und eine flexiblere Nutzung reichen völlig aus. Die Ethologen und die anderen Alte Auseinandersetzungen innerhalb der Verhaltensbiologie wurden durch Synthesen obsolet, neue Konflikte sind an ihre Stelle getreten. Das Forschungsgebiet entwickelte sich enorm in die Breite, es gibt heute eine Vielzahl verschiedener Richtungen und Ansätze. Verhaltensgenetik und -endokrinologie sind zu nennen; die moderne Molekularbiologie ermöglicht es, tatsächliche Ve rwandtscha�sverhältnisse zu ergründen, und gab so in den letzten Jahren der bereits etwas stagnierenden Öko-Ethologie und Soziobiologie neuen Schwung; notfalls kann man etwa mit dem Verfahren der PCR (polymerase chain-reaction) aus Spuren von Gewebsresten wieder genügend Erbmaterial für die Analyse von Verwandtscha�sbeziehungen herstellen, wie aus der gerichtsmedizinischen Praxis bereits hinlänglich bekannt ist. Auch auf vielen anderen Randgebieten werden rasche Fortschri�e erzielt, etwa bei der Erforschung der Gehirnmechanismen. Dem entspricht auf ethologisch-psychologischem Sektor eine rege Forschungstätigkeit zu kognitiven Fähigkeiten. Wir kennen heute unendlich mehr Fakten als noch Lorenz und Tinbergen, aber sind wir deswegen viel gescheiter geworden? Sicherlich nähern wir uns dem Ziel, die Ursachen von Verhalten, der Psyche und des Soziallebens zu verstehen. Der größte Fortschri� liegt wahrscheinlich in der Anerkennung der Berechtigung und Notwendigkeit, verschiedene Ebenen der Erklärung für Verhalten heranzuziehen, sofern diese mit der evolutionären Theorie vereinbar sind. Die Verhaltenswissenscha� wurde also ab Beginn unseres Jahrhunderts vor allem durch zwei Richtungen vertreten, durch die vorwiegend US-amerikani- Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 45 schen Behavioristen und die vorwiegend europäischen Ethologen. Waren die frühen Ethologen vorerst ebenfalls Anhänger der Reflexlehre, so distanzierte sich Lorenz später von dieser Richtung. Die frühen Verhaltenswissenscha�ler waren durch ihren Hang zu Erklärungsmonismen geprägt. So erklärten die Behavioristen jegliches Verhalten über Lernen durch Versuch und Irrtum; die Reflexologen glaubten offensichtlich an den alleinseligmachenden bedingten Reflex. Lorenz anerkannte die Richtigkeit und weitreichenden Konsequenzen beider Entdeckungen, sah diese Einzelmechanismen aber mit Recht als ungenügend an, das gesamte Verhalten zu erklären; so er zeigte er beispielsweise die Möglichkeit spontaner Verhaltensentstehung auf. Biologen konnten der Ansicht Edward Thorndikes und Frederic Skinners nicht zustimmen, dass es keinen Unterschied mache, Lernvorgänge bei Tauben, Affen oder Ra�en zu studieren, dass daher auch die Stammesgeschichte auf diesem Gebiet keine Rolle spiele. Der Konflikt der die prädisponierenden Effekte der Evolution negierenden Behavioristen mit den Ethologen war vorprogrammiert. Das Hauptinteresse der Letzteren galt ja gerade der stammesgeschichtlichen Entwicklung von Verhaltensweisen; der Standpunkt der extremen Behavioristen wurde daher mit Recht als unzureichend abgelehnt. Die extremen Standpunkte der Behavioristen sind heute Geschichte, ihre Ansätze und Methoden aber sind mi�lerweile gewinnbringend in die moderne Ethologie eingeflossen. Es wurde bereits von Lorenz darauf hingewiesen, dass die behavioristische Doktrin mehr mit Ideologie als mit Wissenscha� zu tun ha�e. Ein einheitlicher Lernmechanismus quer durchs Tierreich wurde vorerst nicht hinterfragt, sondern als gegeben angenommen. Diese Ansicht wurde zumindest auf der Ebene der Synapsen, also der recht dynamischen Verbindungen zwischen Nervenzellen bestätigt; am Modell der Meeres-Nacktschnecke Aplysia, aber auch am Säuger-Hippocampus (ein alter, für das Anlegen von Gedächtnisinhalten entscheidender Teil unserer Hirnrinde) wurde gezeigt (Kandel u. a. 1991), dass bei Gebrauch synaptischer Verbindungen über Kalziumströme Kurz- und Langzeitveränderungen an diesen Kommunikationsstellen zwischen Nervenzellen sta�finden, welche die Durchlässigkeit für zukün�igen Informationsfluss verändern. Sicherlich ist diese Veränderung an Synapsen ein wichtiger Mechanismus, aber ist das die ganze Geschichte? Die Erforschung von Gedächtnis und Denken bleibt die Herausforderung für die Neurobiologie des 21. Jahrhunderts. Auch an Ra�en, die von einer sehr reizarmen in eine gut strukturierte Umgebung versetzt wurden, fand man in der Großhirnrinde eine markante Zunahme synaptischer Verbindungen (Benne� 1977, zitiert nach Shepherd 1983). Synapsen und ihre postsynaptischen Gegenstücke auf den dendritischen Ästen der Nervenzellen, die sogenannten »spines«, sind auch im Gehirn von erwachsenen Säugetieren relativ plastisch und durch Gebrauch beeinflussbar. Sie scheinen eine zentrale Rolle bei Lernen und Gedächtnis zu spielen, wahrscheinlich über die Kompartimentierung eines der universellsten und wichtigsten Botenstoffe im Organismus, der Kalziumionen. Niemand bezweifelt, dass die synaptischen Mechanismen eine bedeutende Rolle beim 46 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Lernen spielen, aber Lernvorgänge sind sicherlich nicht nur Einzelereignisse an Synapsen; es bedarf der Koordination, um sinnvolle Informationsströme und nicht nur chaotisch-unorganisierte Pakete von Information zu speichern und abzurufen. Die Kandelsche Theorie erklärt daher nicht, wie komplexes Lernen zustande kommt. Wissenscha� und Ideologie Es wurde von den Behavioristen behauptet, dass Verhalten großteils oder sogar zur Gänze erlernt sei. Für uns Menschen (wie alle anderen Organismen) würde dies bedeuten, dass wir alle als unbeschriebene Blä�er zur Welt kämen und uns allein unsere Erziehung, das Umfeld, in dem wir aufwuchsen, zu den Persönlichkeiten formte, welche wir nun sind. Die Erblichkeit von Verhalten und Persönlichkeit, ja sogar erbliche Lerndispositionen wurden zunächst abgelehnt. Der Mensch wäre demnach also beinahe uneingeschränkt form- und manipulierbar. Wieder ist die Verbindung dieses wissenscha�lichen Dogmas zur politischen Ideologie klar zu erkennen. Bei den politischen Systemen der beiden Großmächte nach dem Zweiten Weltkrieg fiel eine solche Doktrin auf fruchtbaren Boden, denn beide wollten einen »neuen Menschen« schaffen. Und dies, obwohl die US-Demokratie und der UdSSR-Totalitarismus diametral gegensätzliche Systeme waren. Die Gründe für die seltene Einigkeit der Hauptwidersacher im Kalten Krieg waren unterschiedlich. Den Totalitaristen ha�e es in ihrem Streben nach Bildung eines perfekten »sozialistischen Menschen« vor allem dessen vermeintliche totale Lenkbarkeit angetan. Auf der westlichen Seite entsprach das Bild eines völlig freien und daher selbstverantwortlichen Menschen dem Geist der amerikanischen Verfassung. Daher ha�e der Langzeiterfolg der behavioristischen Doktrin in den USA zwei Väter: Diese Geisteshaltung harmonierte nicht nur hervorragend mit dem traditionellen »American way of life« (im besten Sinne), sondern lieferte andererseits eine scheinbar solide wissenscha�liche Basis für die Ablehnung des Sozialdarwinismus. Letzterer war ja zumindest unterschwellig bis über die Mi�e dieses Jahrhunderts in Europa noch vorzufinden; er hä�e in den USA mit ihren immanenten Rassenproblemen gefährlichen Zündstoff bedeutet. Viel später wurde aus demselben Grund der Soziobiologie (Wilson 1975) in den USA ein recht heißer Empfang bereitet. Aber Doktrin bleibt Doktrin und hat mit Wissenscha� nichts zu tun, ganz egal, wie gesellscha�lich nützlich und ethisch positiv sie auch sein mag. Dass die totale Formbarkeit des Menschen Illusion ist, belegt anschaulich und überzeugend der Zusammenbruch des Systems im ehemaligen Ostblock. Trotz erheblichen Erziehungsaufwandes gelang es über all die Jahrzehnte offensichtlich nicht, den idealen sozialistischen Menschen zu schaffen. Auch auf der anderen Seite des Atlantik scheint der »American dream« zu einer ausgeleierten Floskel verkommen; dass mit dem »American way of life« vor allem eine liberale Geisteshaltung, und die hohen Ideale einer Gesellscha� freier Bürger gemeint waren und nicht das Schwelgen im verschwenderischen Konsum, ist fast vergessen; die ursprünglichen Ideale der alten Demokratie sind korrumpiert. Es bildete sich in den USA eine Zweidri�elgesellscha�, mindestens ein Dri�el der Bevölkerung lebt auf dem Niveau eines Dri�e-Welt- Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 47 Landes. Nach Schätzungen der Clinton-Administration waren 7 Millionen Amerikaner ganz oder teilweise obdachlos, was etwa 5 % (!) der Bevölkerung entspricht. Männliche schwarze Jugendliche tragen ein erschreckend hohes Risiko, erschossen zu werden, jeder zweite landet irgendwann im Gefängnis. Es wird in den Strafvollzug, also in Symptombekämpfung investiert, ansta� durch wesentlich mehr Augenmerk auf Bildung und Sozialsystem die Probleme an ihren gesellscha�lichen Wurzeln anzugehen. Die Ereignisse des 11. September 2001 verschär�en die simplistische law-and-order Mentalität der US Politik eher, als dass sie zu einem Umdenken beigetragen hä�en. Realität und Staatsverfassung klaffen immer weiter auseinander, die Desintegration, die Abgrenzung zwischen ethnischen und sozialen Gruppen, schreitet voran, wie auch US-amerikanische Soziologen bemerken. Gegenmaßnahmen, etwa die Zwangsdurchmischung in den Schulen durch das System des »busing«, muten hilflos an; sie erweisen sich als kontraproduktiv, da sie, von oben verordnet, von den betroffenen Menschen nicht akzeptiert werden. Ganz parallel zum Bankro� der ehemaligen UdSSR kämp� offenbar auch in den USA ein weiteres idealistisches Gesellscha�smodell mit seinen Grundsätzen. Ein später Triumph für Konrad Lorenz, welcher der totalen »Machbarkeit des Menschen« immer widersprochen ha�e und die »Indoktrinierbarkeit« sogar als eine seiner »8 Todsünden der zivilisierten Menschheit« anführt (1973); eine späte Niederlage dagegen für Pawlow, Thorndike und Skinner, aber auch ein Lehrstück über die negativen Folgen der Gängelung der wissenscha�lichen Ratio durch Ideologie und Doktrinen. Tatsächlich weisen Ergebnisse neuester Zwillingsforschung (Bouchard u. a. 1990) darauf hin, dass sich etwa 70% der Persönlichkeitsstruktur ziemlich unabhängig von der Umwelt während des Heranwachsens entwickeln, dass Persönlichkeitsmerkmale zu einem recht hohen Ausmaß genetisch determiniert sind (0,2–0,5). Dies bedeutet natürlich nicht, dass es sinnlos wäre, in Bildung und Erziehung zu investieren, da die genetische Fundierung eben noch eine ganze Menge Einflussmöglichkeiten für die Umwelt offenlässt. Ein reiner genetischer Determinismus wäre ebenso verfehlt, wie ein ohnehin vielfach gescheiterter rein milieutheoretischer Ansatz. Die »Freiheit des Menschen« kann sich eben nur im Rahmen der evolutionären Möglichkeiten gestalten. Während doktrinäre Pseudowissenscha� die Aufgabe hat, deduktiv vorgefasste Meinungen zu bestätigen (was viele sogenannte wissenscha�liche Gutachter leider ebenfalls tun), lässt sich ein »wahrer« Wissenscha�ler vor keinen Karren spannen und verallgemeinert nur auf der Basis vorliegender Daten. Auf der Basis solcher Daten gefasste Meinungen nennt man Arbeitshypothesen. Diese wiederum liegen der darauffolgenden Datenaufnahme zugrunde, welche darauf abzielen sollte, die ursprünglichen Hypothesen zu testen und gegebenenfalls zu verwerfen (Exkurs 5). Nur wenn dies trotz Bemühens nicht gelingen sollte, wird die vormalige Arbeitshypothese als (vorläufige) Erklärung angenommen. Dass auch viele Wissenscha�ler ihre Lieblingshypothesen trotz gegenteiliger Behauptungen nicht gerne »zum Frühstück verzehren« und lieber über Daten hinwegsehen, 48 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie die ihre Hypothesen gefährden könnten, scheint zutiefst menschlich, verpflichtet aber zu fachlichem Misstrauen jeglicher wissenscha�lichen Aussage gegenüber. Man muss sich der Stärken und Schwächen dieser induktiv-deduktiven naturwissenscha�lichen Arbeitsmethode bewusst sein, um wissenscha�liche Ergebnisse richtig nutzen und interpretieren zu können (Exkurs 5, 6 und unten). Die verbreitete Verwechslung von wissenscha�lichen Ergebnissen mit Wahrheit mag das Ihre zur heute weit verbreiteten Wissenscha�sfeindlichkeit und zur Flucht in verschiedensten mystischen und metaphysischen Hokuspokus beitragen. Exkurs 5: Wissenschaftstheorie 1: Hypothesen müssen testbar sein: Zur »Wahrheit« in der Wissenschaft Naturwissenschaftler finden und beschreiben zuerst Regelmäßigkeiten (»Muster«), ermitteln dann experimentell Ursachenzusammenhänge und erstellen schließlich Modelle und Theorien, um die gefundenen Muster möglichst umfassend zu erklären und um damit eine Basis für weitergehende Forschung zu schaffen. Im Wesentlichen ist es das Ziel jeder wissenschaftlichen Arbeit, zu ermitteln, ob Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Gruppen bestehen, und die Ursachen für diese Unterschiede festzustellen. Solche Unterschiede wird es fast immer geben. Angenommen, man hätte zwei große Säcke mit Bohnen und es wäre nur erlaubt, aus jedem der beiden Säcke je eine Handvoll zu entnehmen; wir müssten aufgrund dieser recht bescheidenen Stichprobe entscheiden, ob die Größe der Bohnen in den beiden Säcken gleich oder unterschiedlich sei. Wir sollten daher im Zusammenhang mit jeder gestellten Aufgabe in der Lage sein, zwischen zwei Hypothesen unterscheiden zu können, zwischen der sogenannte »0-Hypothese« und der »Arbeitshypothese«. Im Bohnenbeispiel würden die beiden gegeneinander zu testenden Hypothesen lauten: 1. 0-Hypothese: Kein Unterschied. Die Bohnen entstammen derselben Grundgesamtheit (identische Bohnensorte, Anbauort, Erntezeit, Trocknungsmethode usw.). 2. Arbeitshypothese: Die Bohnen entstammen unterschiedlichen Grundgesamtheiten, d. h. die Durchschnittsgrößen (die Verteilung der Größen) aller Bohnen in jedem der beiden Säcke sind tatsächlich verschieden. Um zwischen den beiden Hypothesen mit einer definierten Irrtumswahrschein lichkeit (als notwendiges Maß für die Verlässlichkeit einer wissenschaftlichen Aussage) unterscheiden zu können, gibt es eine Fülle verschiedener statistischer Tests; welche man davon anwenden kann, entscheidet die Datenstruktur. So sie auf Normalverteilung basieren (wie auf die Bohnengrößen anzuwenden), berücksichtigen diese Tests den Mittelwert, den Streu der Daten und die Zahl der gezogenen Stichproben. Zeichnung 2 zeigt die Verteilung der Bohnengrößen für zwei Fälle: 1. Die Stichproben entstammen derselben Grundgesamtheit (0-Hypothese bestätigt). Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 49 2. Die Stichproben entstammen unterschiedlichen Grundgesamtheiten (Arbeitshypothese bestätigt). Ein Mittelwertvergleich durch bloßes Hinschauen erlaubt keine Entscheidung zugunsten oder gegen eine der beiden Hypothesen, womit klar wird, dass die beiden Hypothesen tatsächlich gegeneinander getestet werden müssen. Die Fälle (in unserem Beispiel Bohnen) aus den verschiedenen Grundgesamtheiten müssen dabei in ihrer Größe nicht sauber getrennt sein, sondern können überlappen. Ein geeigneter Test wird bei ausreichender Stichprobenanzahl trotzdem einigermaßen verläßlich über die Zugehörigkeit der beiden Proben Auskunft geben. Am Ausdruck +einigermaßen verlässlich* lässt sich demonstrieren, wie es um den Begriff der »Wahrheit« in der Wissenschaft bestellt ist. Jede Entscheidung zugunsten oder gegen die 0-Hypothese fällt auf der Basis von Wahrscheinlichkeit. Die »Irrtumswahrscheinlichkeit« in Prozent gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass unsere Entscheidung für oder gegen die 0-Hypothese zutrifft. Liegt also eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % vor, dann ist mit 5%iger Wahrscheinlichkeit die getroffene Entscheidung falsch. Anders ausgedruckt: Von 100 Entscheidungen werden 5 falsch sein; die beiden Grundgesamtheiten werden als verschieden beurteilt, obwohl sie tatsächlich gleich sind und die 0-Hypothese aufrechtzuerhalten wäre. Selbst bei sehr ge- Abbildung 2: Zu entscheiden, ob Grundgesamtheiten gleich, oder verschieden sind, ist wohl das zentrale Problem der Naturwissenscha�en. Im vorliegenden Beispiel soll mi�els begrenzter Zufallsstichprobe, (n = 8) aus den Säcken entschieden werden, ob die Nullhypothese gilt (Säcke A und B: Grundgesamtheiten nicht signifikant verschieden) oder zurückgewiesen werden kann (Säcke A´ und B´: Grundgesamtheiten signifikant voneinander verschieden). Dafür müssen geeignete statistische Tests herangezogen werden, da eine solche Entscheidung durch bloßen Augenschein nicht getroffen werden kann. 50 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie ringen Irrtumswahrscheinlichkeiten, etwa von unter 0,01 %, tragen wir immer noch ein Restrisiko von 1/10000, dass die getroffene Entscheidung nicht zutrifft. Da aber jegliche Entscheidung zwischen Hypothesen immer auf Basis von Irrtumswahrscheinlichkeiten fällt, können Entscheidungen in der Wissenschaft bestenfalls mit »an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit« getroffen werden, sind aber niemals unumstößliche »Wahrheit«. Diese Einsicht ist nicht neu, sie ist nur eine andere Ausformulierung des bereits von David Hume (1711–1776) formulierten Induktionsproblems. So ist der Satz »Alle (Höcker-)Schwäne sind weiß« zwar zutreffend, aber doch niemals »wahr«, also weder ein Naturgesetz noch eine Gewissheit; er ist nicht beweisbar. Denn wer garantiert, dass nicht doch einmal ein schwarzer (Höcker-)Schwan auftaucht? Wahrheit, Glaube, Wissenschaft Hypothesen müssen also testbar und zumindest potentiell falsifizierbar sein (Popper 1974, 1976), sonst qualifizieren sie sich nicht als wissenschaftliche Hypothesen, sondern sind Mythen, die in der Naturwissenschaft keinen Platz haben, weil sie keinen Erkenntnisgewinn bringen können. Die Aussage »Gott hat die Welt erschaffen« mag wahr sein, aber sie liegt außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Naturwissenschaften, weil sie nicht testbar, nicht falsifizierbar ist. Man kann dran glauben. Woran man aber im Gegensatz dazu nicht glauben darf, sind naturwissenschaftliche Hypothesen. Wenn also ein Naturwissenschaftler erklärt, er sei fest von der Richtigkeit einer Hypothese überzeugt, hat er eigentlich den Boden der Naturwissenschaften bereits verlassen. Es liegt im Wesen von Hypothesen, dass sie nicht einfach akzeptiert, geglaubt werden dürfen. Wahr können sie niemals sein, höchstens mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zutreffen. Komplizierter wird die Sache dadurch, dass es »harte« und »weiche« Hypothesen gibt. Die »harten« treffen Aussagen über gegenwärtige Wirkgefüge und sind testbar im eigentlichen Sinne. So ist etwa die Aussage, dass geschlechtsspezifische Steroidhormone die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale bewirken, direkt durch Entzug bzw. Substitution dieser Hormone belegbar. »Weiche« Hypothesen betreffen hauptsächlich historische Abläufe. Evolutionäre, also geschichtliche Hypothesen können nicht experimentell »getestet«, wohl aber glaubhaft gemacht werden. Streng genommen gehören sie daher ins Reich der Mythen (Popper 1976). Dennoch erlauben es die Fossilbelege oder auch Artvergleiche, solche Hypothesen dermaßen gut zu belegen, dass die Unterscheidung zwischen »harten« und »weichen« Hypothesen zwar wissenschaftstheoretisch berechtigt ist, für die Praxis aber oft belanglos bleibt. Die Spirale des wissenschaftlichen Fortschritts: Induktion und Deduktion Als »Induktion« bezeichnet man den Vorgang des Ableitens allgemeiner Sätze von Beobachtungen, also die Entwicklung von Theorie. »Deduktion« dagegen ist das Überprüfen bereits vorhandener Theorie mittels empirischer Daten bzw. mit Hilfe des gezielten Experiments. Man braucht kein großer Gelehrter zu sein, um zu erkennen, dass Induktion und Deduktion zwei Seiten einer Medaille darstellen, dass die alternierende Abfolge zwischen den beiden den Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 51 Forschungsprozeß in Gang hält. Das erklärt auch, warum naturwissenschaftliche Forschung nie an ein definitives Ziel gelangen kann. Die induktiv-deduktive Methode wurde übrigens in ihren Grundzügen bereits von Aristoteles dargestellt. Induktion kann es ohne Deduktion nicht geben und umgekehrt. Ohne den Schritt zur Verallgemeinerung vollziehen zu wollen, ist das Sammeln von Daten letztlich sinnlos. Und sind solche allgemeinen Zusammenhänge einmal etabliert, dann müssen sie sich an der Wirklichkeit bewähren, was wiederum im nächsten Induktionsschritt zu ihrer Modifizierung führen kann. Durch die induktiv-deduktive Methode nähern sich wissenschaftliche Aussagen der Wirklichkeit asymptotisch an, können sie aber niemals erreichen. Grund dafür ist das oben skizzierte Induktionsproblem. Konrad Lorenz wetterte gegen die Deduktion, weil er sah, dass in der wissenschaftlichen Praxis zu seiner Zeit allzu rasch zur Verallgemeinerung geschritten wurde oder man allgemeine Sätze von zweifelhaftem Wert dadurch bestätigen (nicht überprüfen!) wollte, dass man die passenden Daten dazu suchte. Diese Gefahr besteht immer dann, wenn eine starke grundlegendeTheorie vorliegt, wie etwa im Falle der Öko-Ethologie. Darum plädierte Lorenz für das »unvoreingenommene Beobachten« als Induktionsbasis jeder Untersuchung, obwohl dies eigentlich gar nicht möglich ist. Objektive Aussagen durch subjektive Wissenschaftler? Erklärungsmonismen, Denken in Gegensätzen, Alternativhypothesen Ziel aller Wissenschaften ist es, die Welt zu erklären, zu objektivieren und damit vorhersagbar zu machen. Dem stehen aber Eigenschaften unserer Sinnesorgane, unseres Gehirns gegenüber, die uns dieses Vorhaben nicht gerade erleichtern (vgl. Grammer 1988, Lorenz 1943). Evoluiert, um uns an eine variable (physische, vor allem aber soziale) Umwelt anzupassen und letztlich, Reproduktionsraten zu optimieren, müssen ständig große Informationsmengen kategorisiert werden. Lorenz bezeichnet dies als »Prägnanztendenz« des Menschen, die sich unter anderem dadurch äußert, dass wir beinahe zwanghaft alle Phänomene erkennen, einordnen, benennen wollen. Wahrscheinlich gibt es diese Eigenschaft in abgestufter Form bei fast allen Tieren. So entstand ein »ratiomorpher« Apparat, der uns entsprechende »Denkzwänge« auferlegt (Riedl 1981b, 1984), obzwar er hervorragend geeignet ist, einfache Optimierungen durchzuführen (Poundstone 1992), muss er doch erst individuell und methodisch diszipliniert lernen, in weiteren Bereichen objektiv zu denken. Die für Naturwissenschaften nötige Objektivierung erfordert eine a-priori Definition der Werkzeuge und Methoden. Wenn jemand zu Recht gegen das hemmende Methodendiktat wettert, so sollte klar sein, dass wir dieses im gewissen Ausmaß zur Überwindung der eigenen Unzulänglichkeit benötigen. Wir müssen unsere eigene, subjektive Umwelt (im Sinne von Jakob von Uexküll [1934] am ehesten als »Welt unserer Wahrnehmung« zu verstehen) überwinden und auf der Basis objektiver, physikalischer Messungen (nicht im Sinne eines Abbildes der Wirklichkeit, sondern von Replizierbarkeit) arbeiten. Unsere Sinnesorgane, unser Erkenntnisapparat sind nicht geeignet, die physikalische Wirklichkeit zu erfassen, denn: 1. Unsere Sensorien sind ungeeignet. Sie können fehlen, beispielsweise für Radioaktivität, für magnetische oder elektrische Felder, und zudem messen unsere Sinnesorgane keine 52 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie absoluten Werte, sondern Kontraste, welche sie noch zusätzlich verstärken. Da also die individuelle menschliche Wahrnehmung nicht von sich aus objektiv ist, benötigen wir Hilfsmittel, um unsere physikalische Umwelt, der auch die Raum-Zeit-Bewegungen, also das Verhalten anderer Organismen angehören, reproduzierbar zu machen, sie durch standardisiertes Quantifizieren zu erfassen. Dazu schufen Menschen sich Instrumente mit Messkonstanz. Diese sind im einfachsten Fall Ergänzungen unserer Sinnesorgane. So sind wir kaum in der Lage, die tatsächliche Umgebungstemperatur zu schätzen. Dieselben 20° C Raumtemperatur mögen uns, abhängig von unserer jeweiligen Vorgeschichte, kalt oder warm vorkommen, eine Temperaturerhöhung auf 21° C nehmen wir bereits als spürbare Erwärmung wahr. Das Instrument zur Objektivierung ist hier schlicht ein Thermometer. 2. Unser Erkenntnisapparat neigt offenbar dazu, in linearen Kausalitäten zu denken. Einfache, monistische Erklärungen werden komplexeren vorgezogen. Alles muss möglichst eine einzige Ursache haben, das in der Dynamik vernetzter Systeme auftretende Chaos ist in unserer Vorstellungswelt nicht repräsentiert. Menschen wollen die Welt vollständig in ordentlichen, also deterministischen Systemen erklären. Wenn-dann-Hypothesen dominieren (Grammer 1988, Lorenz 1973). Wissenschaft ist eine der möglichen Erklärungsmethoden, Religion eine andere. Die Populisten in der Politik etwa nutzen diese grundlegend menschlichen Denkvorlieben geschickt für sich. Chaos finden wir wahrscheinlich bedrohlich, weil es Vorhersagbarkeit untergräbt und damit keinen (oder nur fallweisen) Überlebenswert hat. Diese Prägnanztendenz treibt uns dazu, ständig nach möglichst generellen Erklärungsprinzipien zu suchen. Den Monotheismus kann man als einen Kulminationspunkt dieser Entwicklung ansehen, als Erklärung des Universums durch ein einziges Prinzip. Besonders in der Ökologie suchte man bisher mit mäßigem Erfolg nach allgemeinen Prinzipien, die für das Verhalten möglichst aller Populationen, möglichst aller Ökosysteme zuträfen. Fruchtbarer wird diese Suche erst durch eine neue Generation von Modellen, die statt an der gesamten Population am Individuum ansetzen (Judson 1994). Eine Grundproblem der Suche nach Allgemeingültigkeit sind negative Ergebnisse, die um so wahrscheinlicher werden, je allgemeiner das Ziel angesetzt ist. Es gilt die allen negativen Ergebnissen gemeinsame Grundproblematik, dass es entweder das gesuchte Prinzip nicht gibt oder dass man es (aufgrund eines falschen Ansatzes etwa) noch nicht gefunden hat. Negative Ergebnisse sind in dieser Hinsicht nicht schlüssig. Differenziertes Denken in Alternativhypothesen fällt Menschen anscheinend schwer, nicht nur in der Wissenschaft. Erfolglose Politik etwa sucht immer nach einem Sündenbock und findet den auch meistens. So neigt man in der Öko-Ethologie etwa dazu, die Verteilung von Tieren mit der Verteilung lebensnotwendiger Ressourcen zu erklären. Das ist sicherlich richtig, es zeigte sich aber, dass in vielen Fällen die tatsächliche Verteilung einen Kompromiss aus Ressourcen und Raubfeinddruck darstellt, dass also der Parameter Ressourcenverteilung nur einer von vielen ist und dass Tiere sich vielmehr auf Ressourcenverfügbarkeit einstellen. Beispiele ließen sich viele finden. In der Regel hat jedes beobachtbare Phänomen mehr als nur eine Ursache. Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 53 3. Unser Erkenntnisapparat neigt zur Kontrastbildung. Daraus scheint eine allgemeine menschliche Neigung zu entspringen, im Sinne der Prägnanztendenz in Gegensatzpaaren zu denken: gut–böse, Inländer–Ausländer, alt–jung, schwarz–weiß, Freund–Feind, Stadt–Land, angeboren–erworben, Körper– Geist, Schaf–Wolf usw. Man neigt dazu, die Endpunkte von Kontinuen, die solche Dualismen darstellen, höher einzuschätzen als die Zwischentöne. Journalisten neigen besonders dazu, solche Endpunkte überzubetonen, Aussagen zuzuspitzen, eindeutig zu machen, was wiederum eigentlich nur die Bedürfnisse des Marktes, der Medienkonsumenten widerspiegelt. Klare Aussagen (ja oder nein, so oder anders, wenn–dann) sind positiv belegt, während differenziert abwägende Zeitgenossen eher zu den +Intellektuellen* gezählt werden, denen öffentliches Misstrauen sicher ist. Beinahe unnötig zu erwähnen, dass dieser menschliche Denkzwang zur Kontrastbildung ein schwerwiegendes Hemmnis für differenzierende Wissenschaft und ihre Akzeptanz darstellt. Aber die Naturwissenschaft beschreibt eben keine schwarz-weiße Welt, sondern eine Welt der Zwischentöne. 4. Unser Erkenntnisapparat ist nicht objektiv, er blendet aus, was er nicht sehen will. »Aber Kind, wozu hast du denn deine Augen?« soll der alte Lorenz gesagt haben, als ihn eine Mitarbeiterin Mitte der 80er Jahre fragte, ob es nicht möglich wäre, einen Computer für die Forschung an den Grünauer Gänsen anzuschaffen. Diese Episode zeigt den Gegensatz zwischen den Befürwortern der ganzheitlichen Gestaltwahrnehmung und den reduktionistischen Quantifizierern. Ein Problem der Gestaltwahrnehmung ist, dass sie ohne die Hilfe der Ouantifizierung objektives Arbeiten unmöglich macht und damit eigentlich kein Instrument der Naturwissenschaften sein kann. Lorenz war dem Vernehmen nach enttäuscht, als er hörte, eine Auswertung umfangreicher Schar-Daten der Seewiesener Graugänse hätte ergeben, dass diese im Prinzip lebenslang partnertreuen Tiere doch wesentlich häufiger wechseln, also bloßes Hinschauen vermuten ließ (Exkurs 9). Derselbe Lorenz hielt häufiges Triumphgeschrei für das Zeichen einer »guten« Paarbindung. Ein bisschen Quantifizieren unsererseits zeigte eher das Gegenteil: Gerade die Ganter instabiler Paarungen hatten die höchste Triumphgeschrei-Frequenz (Mausz u. a. 1992). Wenn sich also ein qualitativ derart genauer Beobachter wie Konrad Lorenz in solch einfachen Fragen der Häufigkeit des Auftretens irren konnte, bedarf es keines weiteren Kommentars, warum Quantifizierung ein Grunderfordernis der Naturwissenschaft ist. Statistik bietet Instrumente zur geistigen Disziplinierung vor der Datenerhebung und zur Auswertung und Interpretation derselben an. Dass Statistik bedeutet, mit Zahlen zu lügen, ist sowohl eine dümmlich-witzige Schutzbehauptung Unkundiger, als auch eine reale Gefahr. Die Instrumente der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung stellen allerdings, richtig angewandt, unsere wichtigsten Hilfsmittel gegen den Selbstbetrug dar, wie bereits aus dem Abschnitt über Wahrheit und Wissenschaft hervorging. Natürlich gibt es vielfältige Möglichkeiten, mit falsch angewandter Statistik willentlich oder unabsichtlich zu »lügen«. Das beginnt bei einer der Grundgesamtheit nicht adäquaten Probennahme, erstreckt sich über die Missachtung von Voraussetzungen für statistische Verfahren (etwa der Normalverteilung) bis hin zur irreführenden graphischen Darstellung von Daten. Manipulationsmöglich- 54 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie keiten gibt es wahrlich viele, was man aber nicht der Methode, sondern den Anwendern anlasten muss. Schnelle Computer mit der bestmöglichen StatistikSoftware sparen zwar Rechenzeit, entheben aber die Anwender nicht der Verantwortung, die richtigen statistischen Prozeduren anzuwenden. Das (meist unbeabsichtigte) »Lügen durch Zahlen« ist daher eine tatsächlich bestehende Gefahr, der wir uns aber stellen müssen, da jegliche wissenschaftliche Arbeit, im induktiven wie deduktiven Bereich, ohne Statistik undenkbar wäre. Statistik erlaubt nicht nur den Vergleich zwischen zwei Gruppen, sondern bietet auch im multivariaten Bereich Möglichkeiten, Muster in einer großen Zahl von erhobenen Variablen zu finden, etwa durch Faktorenanalyse. Gewonnen wird durch diesen Umweg über Statistik die Reproduzierbarkeit. Anwendungsbeispiele betreffen die evolutionäre und ontogenetische Hirnentwicklung bei Karpfenfischen (Kotrschal und Palzenberger 1991) oder die komplexen Schwimmpfade von Fischen (Essler und Kotrschal 1994). Meinungsunterschiede zwischen Wissenschaftlern Einer der häufigsten Vorwürfe der Öffentlichkeit gegenüber Wissenschaftlern betrifft deren Konfliktfreudigkeit: Dass zwei Wissenschaftler zu einem bestimmten Thema gewöhnlich mindestens drei verschiedene Meinungen vertreten, kommt der Sache recht nahe. Das hat mehrere Ursachen, wovon einige das Resultat des wissenschaftlichen Prozesses und daher akzeptabel, andere wiederum das Ergebnis menschlicher Unzulänglichkeit und daher im Rahmen der Naturwissenschaften inakzeptabel sind. Um mit letzteren zu beginnen: Man bedient sich leider allzuoft des wissenschaftlichen Deckmantels, um Gruppeninteressen durchzusetzen. Wer kennt sie nicht, die »unfehlbaren Experten« irgendwelcher Lobbies, die, direkt oder indirekt von ihren Auftraggebern abhängig, deren Interessen mit der Autorität akademischer Titel vertreten. So ist die von den allgegenwärtigen Handy-Masten ausgehende Strahlung je nach Auftraggeber der Expertise entweder völlig harmlos oder eine tödliche Gefahr. Dieser klare Missbrauch ist besonders infam, weil oft schwierig zu durchschauen, und auch, weil er die Wissenschaft generell in Verruf bringt. Wofür die Wissenschaft etwas kann und wofür sie sich nicht zu schämen braucht, sind die aus dem wissenschaftlichen Prozess stammenden Meinungsverschiedenheiten. Zu einem geringeren Teil betreffen diese die Gültigkeit von Ansätzen und Methoden, die wiederum für die Aussagekraft der resultierenden Daten entscheidend sein können. Überwiegend jedoch entstehen Meinungsverschiedenheiten bei der Interpretation ein und derselben Daten, was natürlich Irritationen verursacht. Diese Diskussionen sind Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Zum ersten sind wissenschaftliche Aussagen nicht »wahr«, sondern werden auf Grundlage definierter Wahrscheinlichkeiten getroffen (siehe oben), was natürlich Interpretationsspielraum zulässt. Zum Zweiten drehen sich die Spiralen des induktiv-deduktiven Prozesses selbst auf der Basis derselben Daten bei verschiedenen Arbeitsgruppen selten in dieselbe Richtung. Dermaßen auftretende Konzeptunterschiede führen wieder zu unterschiedlichen Arbeitshypothesen und Testansätzen. Dies tritt um so eher auf, je größer der von den Daten erlaubte Interpretationsspielraum ist. Das heißt nicht notwendigerweise, dass die einen Recht haben, während die anderen irren – es ist ein Beleg für die Vielfalt und Komplexität dieser Welt. Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 55 So ist zweifelsfrei belegt und daher auch von allen ernsthaften Wissenschaftlern akzeptiert, dass die Ozonlöcher über den Polen der Erde größer werden oder dass der steigende CO2-Gehalt der Erdatmosphäre mit einem Temperaturanstieg korreliert. In der Interpretation ist man sich schon nicht mehr so einig. Abhängig von den verwendeten Simulationsmodellen reichen die Vorhersagen für die Folgen dieser Entwicklung für Klima und Leben auf der Erde von vernachlässigbar über regional bis global katastrophal. Keine Woche vergeht, ohne dass widersprechende Berichte in der wissenschaftlichen Literatur erscheinen. Hier sind die Naturwissenschaften im Bereich der Simulationen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen. Wir werden damit leben müssen, dass auch wissenschaftlich nicht alles »machbar« bzw. vorhersagbar ist. Damit könnte man sich begnügen und sich als Wissenschaftler in den Elfenbeinturm zurückziehen. Das wäre aber der falsche Weg, hieße es doch, die Welt den schillernden Kindern der Irrationalität zu überlassen. Die zukünftige KlimaEntwicklung ist ein gutes Beispiel für wissenschaftliche Verantwortung in einer Grauzone abseits harter Daten. Es ist unbestritten, dass CO2 genauso wie viele andere menschengemachte Emissionen zu Veränderungen in der Biosphäre führen. Der Streit dreht sich hauptsächlich darum, wie rasch und wie schlimm die Folgen sein werden. Hier wäre es selbstverständlich falsch, zu warten, bis diese Folgen tatsächlich eintreten, um sie dann naturwissenschaftlich nachzuweisen. Natürlich sind wir verpflichtet, die schlimmsten Vorhersagen zur Basis unserer gegenwärtigen Maßnahmen zu machen. Der Konflikt Behaviorismus - Ethologie Ethologen und Behavioristen waren im 20. Jahrhundert sozusagen Lieblingsfeinde. Dieser Gegensatz war persönlich und ging tief. Das gilt für Konrad Lorenz vor allem für die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, während seine Auseinandersetzung mit dem Behaviorismus in seinem »Russischen Manuskript« (geschrieben 1944–1948, erstmals veröffentlicht 1992) noch recht objektiv verläu�. Generell war es eine Auseinandersetzung von europäischen Ethologen mit vor allem US-amerikanischen Experimentalpsychologen um die Bedeutung von Genen, bzw. Umwelt in der (Verhaltens-) Entwicklung. Obwohl Argumente und Polemik schon früher ausgetauscht wurden, brach die offene Auseinandersetzung doch erst nach dem öffentlichen Angriff Daniel S. Lehrmans (1953) auf Lorenz aus. Dafür waren sicherlich nicht nur rein fachliche Gründe maßgebend, sondern auch die jüngste deutsche Geschichte, die Massenvernichtung von Juden im Dri�en Reich. Lehrman war jüdischer Herkun� und machte Lorenz aufgrund einiger seiner während des Krieges erschienenen Schri�en (z. B. Lorenz 1940) zumindest implizit für die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes mitverantwortlich (vgl. Föger und Taschwer 2001, Kotrschal u. a. 2001, Wuketits 1990). So griff denn auch in der erste Version seines Manuskripts D. Lehrmann K. Lorenz recht persönlich an (Hess, zitiert nach Barlow 1989). Der Herausgeber musste auf Lehrman einwirken, das Manuskript zu entschärfen. Ungeachtet dessen, dass diese Publikation der Ausgangspunkt einer fruchtbaren Diskussion 56 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie und schließlich einer Synthese durch andere Wissenscha�ler wurde, fanden beide keine rechte fachliche Gesprächsbasis mehr, allen gegenseitigen Freundscha�sbeteuerungen zum Trotz. Immerhin traf man einander in den 1950er Jahren, auf den ersten ethologischen Konferenzen nach dem Krieg in Deutschland und Holland zu offenen Diskussionen, die allerdings auf die zutiefst genetisch-deterministische Einstellung von K. Lorenz keinen nachweisbaren Einfluss ha�en. Lehrman selber vermerkte (1970), dass Lorenz zwar versuche, seine ursprünglichen Positionen besser zu erläutern, sie aber inhaltlich nicht wesentlich modifiziert habe. Gerade auf der Basis der von Lehrman kritisierten Konzepte der Erbkoordination und des Triebmodells wurde von Ethologen und Physiologen in den 50er und 60er Jahren viel empirische Forschungsarbeit geleistet. Dabei stellte sich der Dualismus »angeborenes« gegen »erworbenes« (erlerntes) Verhalten als grobe gedankliche Vereinfachung und daher als nicht nützlich heraus; man erkannte vielmehr, dass in der individuellen (ontogenetischen) Entwicklung das Verhalten jedes Organismus in einem komplizierten Wechselspiel von endogenen Dispositionen und Reizen aus der Umwelt rei�. Exkurs 6: Wissenschaftstheorie 2: Die »Not« der Naturwissenschaften – Reduktionismus versus »Holismus« Naturwissenschaften nach der Aufklärung sind von ihrer Arbeitsweise her notwendigerweise materialistisch, mechanistisch und reduktionistisch. Das wird ihnen heute vielfach zum Vorwurf gemacht. Die Begriffe Materialismus und Mechanismus beziehen sich darauf, dass auch die Phänomene des Lebens, um die sich die Biologie kümmert, restlos aus den Gesetzen der Materie erklärbar sein müssen. Das ist in der Physik relativ einfach, wird aber in der Biologie, wo es vielfach um komplexe, ja chaotische Systeme geht, schwierig. Ein Rückgriff auf die Metaphysik, auf eine »höhere Instanz«, etwa eine Vis vitalis, ist aber trotzdem im Rahmen der Naturwissenschaft weder sinnvoll noch erlaubt, weil damit neben der kausalen Begründbarkeit u. a. die Reproduzierbarkeit – ein Grunderfordernis für die Ergebnisse der Naturwissenschaften – beeinträchtigt würde und etwa im Bereich der Evolution dem spekulativ-mystischen Kreationismus Tür und Tor geöffnet wäre. Letztlich ist die a-priori Annahme einer metaphysischen Instanz Deduktionismus in Reinkultur und mit (induktionistisch zu betreibender) Naturwissenschaft unvereinbar (Lorenz 1992). Unsinnig ist auch der umgekehrte Weg, nämlich Gott und die Auferstehung aus der Physik heraus berechnen zu wollen (Tipler 1994). Gott ist keine testbare Hypothese, kann deswegen auch nicht Gegenstand der Naturwissenschaften sein. Besonders schmerzlich mag in unserer Zeit, in welcher das Wort »ganzheitlich« ein positiv besetztes Schlagwort ist, der Zwang zum Reduktionismus anmuten. Bedeutet dies doch, um bei einer Metapher von Konrad Lorenz zu bleiben, den Versuch, die Funktion eines Automobils aus der Beschreibung seiner zerlegt vorliegenden Einzelteile ergründen zu wollen. Es mag mit Mühe gelingen, die Funktion des Motors zu rekonstruieren, wie dieser die Räder treibt, zu zeigen, dass ein Auto also fährt. Unergründbar ist aber aus diesem Ansatz, wohin und zu welchem Zweck das Vehikel rollt. Genauso arbeiten aber letztlich insbeson- Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 57 dere die experimentellen Naturwissenschaften, die dem methodischen Zwang unterliegen, immer nur eine einzige Variable in einem System verändern zu dürfen, um gültige Aussagen über ursächliche Wirkungsbeziehungen treffen zu können. Damit verbietet sich den Naturwissenschaften anscheinend die Arbeit mit komplexen dynamischen Systemen von selbst, wie z. B. einem Individuum in seinem Lebensraum oder gar einer Sozietät, die aus interagierenden Individuen in einem Lebensraum besteht. Wollte man etwas über die Wirkbeziehungen eines Hormons auf Individuen und ein Sozialsystem wissen, so hätte man mit Zellkultur und kontrollierten Milieus zu beginnen, sich dann die Wirkung dieses Hormons auf die individuelle Entwicklung anzusehen usw. Im Prinzip ist das auch so. Manche systemisch orientierte Kritiker lehnen daher mit einem logisch scheinbar richtigen Argument die Naturwissenschaften ab oder schränken zumindest ihre Kompetenz stark ein: Es wird darauf hingewiesen, dass man aus der Kenntnis der Teile nicht auf die Eigenschaften des Systems rückschließen könne, da aus deren Zusammenwirken ganz neue Systemeigenschaften entständen. So wäre es tatsächlich unmöglich, das Wesen eines Menschen aus der Kenntnis der Struktur und Funktion all seiner Organe, Herz, Nieren, Eingeweide, ja sogar Gehirn, zu erkennen. Mit ihrem rigorosen Methodenanspruch stellen sich die Naturwissenschaften also scheinbar selbst eine fatale Falle: Man erforscht etwa in einer Zeit, da Menschen und Biosphäre um das Überleben ringen, mit Akribie die Handbewegungen des Japan-Makaken beim Waschen der Kartoffel und beweist damit eigentlich nur die eigene Impotenz, die Welt zu erklären (könnte man meinen). Natürlich haben nicht nur die Esoteriker die Ganzheitlichkeit gepachtet, sie muss anzustrebendes Ideal eines jeden vernünftigen Naturwissenschaftlers bleiben. Denn aus der Not des Reduktionismus eine Tugend machen zu wollen wäre engstirnig und würde den Widerstand aller Menschen mit Hausverstand gegen diese Art der Wissenschaft rechtfertigen. Aber naturwissenschaftliche Ganzheitlichkeit liegt in ihrem Erklärungsanspruch, nicht in der Arbeitsmethode. Wissenschaftspessimisten sind im Irrtum, wenn sie glauben, das Korsett des Reduktionismus sei nicht zu sprengen. Sie übersehen, dass es eine Reihe naturwissenschaftlich zulässiger »Krücken« gibt, deren Vernetzung es den Naturwissenschaftlern erlaubt, zu gültigen Aussagen über die Funktion (und deren Ursachen) von Systemen zu kommen. Zu nennen wären 1. die »unvoreingenommene« Beobachtung, 2. der vergleichende Ansatz, 3. Modellbildung und Simulation, 4. ein vernetzter experimenteller Ansatz und, als wichtiges methodisches Rüstzeug in unterschiedlichsten Ansätzen, 5. statistische Methoden, die es erlauben, mehrere Variablen gemeinsam zu hantieren bzw. den gleichzeitigen Einfluss mehrerer Parameter auf Systeme aufzutrennen. 58 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie 1. Die »unvoreingenommene« Beobachtung war die bevorzugte Methode von Konrad Lorenz, weil sie im Gegensatz zum Experiment rein induktionistisch ist, also (scheinbar) ohne a-priori-Hypothesen auskommt (Exkurs 5). Es ist eine Binsenweisheit, dass man vor der Planung jeglichen Experiments erst sein System durch eingehende Beobachung kennenlernen muss. Damit erhält man Information, wie sich ein System verhält, wie also seine Teile zusammenwirken, nicht aber, warum. Natürlich entspringen jeder »unvoreingenommenen« Beobachtung zunächst eher intuitive Ideen über Ursächliches. Diese Ideen bilden die Basis für Arbeitshypothesen und jegliche Theoriebildung, die dann wiederum die einzig erlaubte Basis für ein kontrolliertes Experiment ist. Somit ist Experimentieren der einzige naturwissenschaftliche Ansatz, vorher vermutete Ursachenzusammenhänge auch nachzuweisen. Ein Beweis im mathematischen Sinn ist diese härtestmögliche naturwissenschaftliche Aussage allerdings nicht, da sie niemals mit absoluter Sicherheit, sondern aufgrund der Variabilität biologischer Systeme nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit getroffen werden kann (zum Induktionsproblem vgl. Exkurs 5). Eigentlich gibt es sie gar nicht, die »unvoreingenommene« Beobachtung, darum auch die Anführungszeichen. Denn das würde bedeuten, dass jemand mit einem Tabula-rasa-Gehirn, ohne die geringste Ahnung wozu, ein x-beliebiges System beobachtete, einfach so. Diese Annahme ist absurd. Natürlich hat jeder »unvoreingenommene« Beobachter eine gewisse Erwartungshaltung, und sei es nur, dass er seine Tiere lieb und interessant findet. Gründe dafür mögen im Unbewussten liegen, aber es gibt sie, womit das Wort »unvoreingenommen« eigentlich als Selbstbetrug entlarvt ist. Das Lorenzsche Tabu, an Beobachtungen mit einer Arbeitshypothese heranzugehen, saß tief. Als ich von einer ehemaligen Mitarbeiterin erfahren wollte, was der eigentliche Grund für Lorenz‘ Interesse an Halfterfischen gewesen sei (vgl. Lorenz u. a. 1998), lautete die Auskunft zunächst, dass sie ihn eben interessiert hätten und er sie schön gefunden habe. Erst nach längeren Gesprächsumwegen kam heraus, dass Lorenz bestimmte Erwartungen bezüglich ihres Soziallebens hegte. Lorenz wusste natürlich selber, dass es die »unvoreingenommene« Beobachtung strenggenommen nicht gibt. Was er meinte war, induktiv an die Sache heranzugehen, also zunächst einmal einfach zu beobachten, was Tiere tun, und erst anschließend Hypothesen zu bilden, nicht aber umgekehrt. Darum auch seine Abneigung gegen das »Testen von Hypothesen«. Zu oft war gerade dem jungen Tierkenner Lorenz bewusst geworden, dass Beobachtungen so hingebogen oder ausgewählt werden können, dass man mit ihnen sogar die absurdesten Hypothesen zu stützen vermag. Im Sinne der induktiven Datenerhebung behält also die (möglichst) »unvoreingenommene« Beobachtung immer ihre Gültigkeit. Die eher ganzheitliche Beobachtung kann vieles lehren, zur Feststellung von Ursachenzusammenhängen ist sie aber ungeeignet. Anders betrachtet, stellt sie einen Weg dar, aus einer »Sicht von oben« den Wald als Ganzes auszumachen, bildet eine unentbehrliche Basis dafür, in diesem Wald einzelne Bäume zu untersuchen, ohne Gefahr zu laufen, die Gesamtheit aus den Augen zu verlieren. 2. Der vergleichende Ansatz stellt noch mehr als die Beobachtung und im Gegensatz zum Experiment ganzheitlich orientierte Systembetrachtung »von oben« dar. Sie ist daher besonders geeignet, vernünftige Arbeitshypothesen zu bilden und die Gefahren des Reduktionismus zu vermeiden. Vergleichen kann Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 59 man auf vielen Ebenen. So ist der Artvergleich die »klassische« Methode, um zu erfahren, wozu etwa Strukturen wie Körperbau und Verhaltensweisen gut sind, welchen Anpassungswert sie haben könnten. Dies gilt für die Beziehungen zwischen Lebensraum, Ernährung, Körpergröße und Sozialsystem bei verschiedenen Wirbeltieren (Crook 1964, Crook und Gartlan 1966, Jarman 1974). Ein anderes, eigenes Beispiel betrifft die Struktur des Gebisses und die Ernährungsweise bei den Schleimfischen des Mittelmeeres (Kotrschal und Goldschmid 1983). Alle untersuchten 14 Arten tragen Schneidezähne, ähnlich unserem menschlichen Gebiss. Die Algenfresser in dieser Runde haben breite Gebisse, mit vielen feinen Zähnen. Arten, in deren Darm grobe, hartschalige Tiere wie etwa kleine Schnecken und Muscheln gefunden wurden, zeigen pinzettenartige Gebisse, die mit wenigen, aber kräftigen Zähnen besetzt sind. Die Struktur des Gebisses korrelierte also hervorragend mit der Ernährung. Naheliegender Schluss war, dass es eine deterministische, also nicht-zufällige Beziehung zwischen Nahrung und Gebiss gibt. Da Korrelationen noch nichts über Ursachenbeziehungen aussagen, lag der zweite Schritt nahe, die an den Mittelmeerfischen gewonnene Arbeitshypothese zu testen. Weil evolutionäre, daher historische Fragestellungen nicht experimentell, also »hart-naturwissenschaftlich« testbar sind, wurde ein »weicher« Test gewählt: Ein weiterer Artvergleich an 34 Arten schleimfischartiger Fische aus dem Golf von Kalifornien zeigte, dass die deterministische Beziehung zwischen Gebissstruktur und Ernährung nicht so einfach verallgemeinert werden kann, sondern dass die vererbten Werkzeuge der Fische Flexibilität in ihrer Nahrungswahl nicht ausschließt (Kotrschal und Thomson 1986, Kotrschal 1989). Ein paradoxer, nicht erwarteter Zusammenhang zeigte sich schließlich bei einer Ausweitung des Vergleichs auf alle wichtigen Gruppen von tropischen Riff-Fischen, nämlich dass ein höherer Grad an »morphologischer Spezialisierung« des Gebisses generell mit einer höheren Flexibilität bei der Nahrungswahl einhergeht (Kotrschal 1987). Vergleichen kann man natürlich nicht nur Arten, sondern alles, was im Licht einer Fragestellung sinnvoll ist, etwa Individuen in Populationen oder sogar verschiedene Alters- oder Lebensgeschichte-Stadien desselben Individuums. Der vergleichende Ansatz ist also nicht nur geeignet, größere Zusammenhänge und Arbeitshypothesen zu finden, sondern kann, an zusätzlichen Systemen angewandt, auch zu deren Test dienen (Exkurs 5). 3. Modellbildung und Simulation. Um die Allgemeingültigkeit von Prinzipien der Ökologie, aber auch des Verhaltens zu belegen, werden Modelle erstellt. Zur möglichst detaillierten Vorhersage des Verhaltens von Systemen dienen dagegen Simulationen. Auf allen Gebieten der Naturwissenschaften erfuhren beide Bereiche einen gewaltigen Aufschwung, der mit der Entwicklung leistungsfähiger Rechner und Theorien gekoppelt ist. Als Faustregel sollte eine gute Simulation so viele Parameter wie möglich, ein gutes Modell aber nur so wenige wie nötig enthalten (Maynard Smith 1974). Erzielt man mit einem Modell eine gute Näherung an das Verhalten eines Systems, dann kann man einigermaßen sicher sein, dass die im Modell verwendeten Komponenten auch für das Verhalten des modellierten natürlichen Systems von Bedeutung sind. Zudem kann man mit den Komponenten spielen und so quasi im »virtuellen Experiment« herausfinden, wie die Komponenten 60 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie das System beeinflussen (Exkurs 7). Dazu müssen die Vorhersagen des Modells natürlich wieder mittels empirischer Daten getestet werden. Ein passendes Beispiel dafür ist die Anwendung des Grenzwerttheorems für die Entscheidung von Staren, wieviel Nahrung sie in Abhängigkeit von der Distanz zwischen Nistkasten und Nahrungsfläche sammeln sollen (Kacelnik 1984; Exkurs 7). Die Frage, nach welchen Gesichtspunkten Lebewesen Entscheidungen treffen, ist spieltheoretisch seit von Neumann und Morgenstern (1944) unverändert aktuell (Poundstone 1992), sie ist eine der Grundfragen der Verhaltensbiologie. Da niemals alle Variablen und Randbedingungen berücksichtigt werden können, sind Modelle natürlich per se reduktionistisch, zielen aber auf generell gültige Aspekte des Systemverhaltens. Sie sind also auch ein geeignetes Werkzeug, um gemeinsam mit anderen Ansätzen den allzu engen Reduktionismus zu überwinden. Simulationen sollten dagegen möglichst genaue Vorhersagen bezüglich des Verhaltens von Systemen erlauben. Aktuelle Beispiele sind etwa Versuche, das Wetter der kommenden Tage aufgrund der gegenwärtigen Lage vorherzusagen, oder Voraussagen über zukünftige Klimaverschiebungen in Abhängigkeit vom Treibhauseffekt. Je mehr Variable eingehen, desto genauer gewöhnlich die erzielten Vorhersagen. So waren vor 20 Jahren einigermaßen wahrscheinliche Wettervorhersagen bis etwa 3 Tage im Voraus möglich; Satellitendaten in Verbindung mit leistungsfähigen Rechnern und Simulationen steigerten den einigermaßen verlässlichen Vorhersagezeitraum auf 5 bis 6 Tage. 4. Ein vernetzter experimenteller Ansatz kann eine Gerüststruktur aufbauen, welche die systemblinde Froschperspektive des Einzelexperiments zu überwinden vermag. So etwa wurde die Funktion des Steroidhormons Testosteron nicht nur dadurch erforscht, dass man Veränderungen bei Kastraten wahrnahm, sondern es wurden auch Substitutionsexperimente durchgeführt (Berthold 1849, Becker u. a. 1982, Nelson 2000); es wurde durch künstliche Zufuhr von Testosteron wieder männliches Aussehen und Verhalten induziert. Ferner stimulierte man die Ausschüttung des Hormons oder blockierte dieselbe, testete die Veränderung des Testosteronwertes im Blut auf die Darbietung von Weibchen oder Rivalen, untersuchte die Wirkung des Hormons auf Hirngebiete und neuronale Botenstoffe usw. Jedes einzelne dieser Experimente gibt wenig Aufschluß über die Gesamtheit der vielfältigen Wirkungsweisen des männlichen Geschlechtshormons, durch die vernetzende Zusammenschau aber entsteht ein differenziertes Bild des Systems. Es erscheint zunächst vermessen, je aus der bloßen Kenntnis der Struktur des Erbmaterials die Entstehung der Merkmale der Lebewesen erklären zu wollen. Denn der Weg vom Gen zum Merkmal verläuft über viele Stufen, die alle nicht einfach nur von der »Blaupause Genom« gesteuert sind (eine irreführende Analogie), sondern alle unter Einfluss von äußeren und inneren Reizen moduliert werden können. Die sogenannte »Epigenetik« beschäftigt sich mit der Umsetzung von Genen in Proteine und Merkmale. Durch ein Netz von Experimenten weiss man mittlerweile zumindest ansatzweise, was Gene dazu bringt, aktiv zu werden und Proteine zu kodieren, wie die Übersetzung der Erbinformation (des »Genotyps«) in den »Phänotyp« funktioniert und wie Reize diese Vorgänge beeinflussen. Obwohl jedes der Einzelexperimente hoffnungslos reduktionistisch scheint, ist es die Gesamtheit der sich gegen- Die Anfänge bei Darwin und in der Tierpsychologie 61 seitig kohärent stützenden Ergebnisse, die uns im dritten Jahrtausend einem Gesamtverständnis der Entstehung von Individuen nahebringt. Dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, trifft unverändert zu. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass es unmöglich wäre, aus einer planmäßigen Erforschung der Teile auf das Ganze rückschließen zu können. Die modernen Naturwissenschaften haben vielfach den Beweis dafür angetreten, dass dies durch Vernetzung von Einzelergebnissen möglich ist. Durch eine Vielfalt von an sich reduktionistischen naturwissenschaftlichen Ansätzen kommt man schließlich zu einer relativ ganzheitlichen Sicht biologischer Erscheinungen, ohne dass hierzu über den Materialismus und Mechanismus hinausgehende Zusatzannahmen nötig wären. Der Aufstieg der evolutionären Richtungen In den 1960er Jahren, einer Zeit der Stagnation der »klassischen« Ethologie, wurden schließlich die Ökoethologie und Soziobiologie marktbeherrschend. Die einstmals so gefeierten klassischen Konzepte verschwanden in der Versenkung, ohne eigentlich adäquat »durchforscht« worden zu sein. Aber wissenscha�liche Interessen verlagern sich eben rasch auf Gebiete, die aufregende neue Durchbrüche bringen (s. oben). So kam es dann auch, dass in den 1990er Jahren ausgerechnet aus der Ökoethologie die »klassische« Ethologie und die mechanistische Richtung neu belebt wurde. Für die Neuroethologie allerdings, blieb die klassische Ethologie über die Jahrzehnte eine brauchbare Konzeptbasis, was deren Allgemeingültigkeit unterstreicht. Es erfolgte ein Wandel des wissenscha�lichen Interesses: weg vom eigentlichen Verhalten und dessen zugrundeliegenden Mechanismen, hin zu dessen Selektionswert (Exkurs 1). Das ist aus mehreren Gründen verständlich. Einmal traf das scheinbar ausgeschöp�e Erklärungspotential der klassischen Konzepte in der Ethologie mit einer gewissen wissenscha�lichen Stagnation und Inaktivität auf Seiten einiger ihrer Hauptexponenten zusammen. Wichtige »opinion leaders«, etwa Erich von Holst oder Klaus Immelmann waren viel zu früh verstorben, andere, wie etwa Konrad Lorenz oder Niko Tinbergen waren in die Jahre gekommen. Zudem revolutionierte William Hamilton mit seinem Prinzip der »inklusiven Fitness« und der damit verbundene, radikale Wechsel von der Gruppen- zur Individualselektion die Verhaltensbiologie. Vielleicht wollten die jungen, aufstrebenden Verhaltensbiologen mit der »verstaubten alten Ethologie« auch nichts mehr zu tun haben; ein wenig Mode und eine Portion »Vatermord« war wohl beteiligt. Außerdem liegt es in der menschlichen Forschernatur, dass möglichst umfassende Erklärungen für Erscheinungen in der Natur bevorzugt werden. So wie sich Materialeigenscha�en am befriedigendsten aus der Atomphysik erklären lassen, ist die letztliche, die evolutionäre Relevanz des Verhaltens von Individuen die in ihrem Erklärungswert befriedigendste Ebene des Verhaltens. Kein Wunder also, das die meisten Verhaltensbiologen in den vergangenen 20 Jahren soziobiologisch und öko-ethologisch arbeiteten und 62 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie sich damit konsistent in das große Theoriengebäude der Evolutionsbiologie einfügten. Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie Von der Gruppen- zur Individualselektion Wie bereits erwähnt, war Konrad Lorenz in zwei grundlegende wissenscha�liche Auseinandersetzungen verwickelt. Mit dem Behaviorismus gab es von seiner Seite keinen wirklichen Frieden, nur einen Waffenstillstand; der wissenscha�liche Fortschri� dagegen machte aus einem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch. Die zweite große Kontroverse trug der reife Lorenz eher lustlos mit den Öko-Ethologen und Soziobiologen aus. Meiner Vermutung zufolge ging es dabei von seiner Seite aus mehr um Ästhetik und Werte denn um fachliche Inhalte. Dem romantischen Wunschdenken von der Harmonie in der Natur, bestimmt von selbstlosen Leistungen der Einzelindividuen für die Gemeinscha� in der frühen Ethologie stand die kalte Ästhetik eines von Kosten-NutzenRechnung, Eigennutz, Ökonomie und Nepotismus diktierten Verhaltensbildes der Öko-Ethologie und Soziobiologie gegenüber. Nach Bemerkungen im Briefverkehr der alten Ethologengarde zu schließen, wurde die Bedeutung der neuen Richtung unterschätzt. Edward Wilsons und Richard Dawkins Standpunkte wurden von Lorenz als semantisch überspitzte, anthropomorphe Formulierungen von Inhalten betrachtet, die »man« ohnehin schon lange wüsste, geboren vielleicht aus einem Profilierungsbedürfnis der Jungen. Sie wussten tatsächlich viel, die Alten, aber sie hä�en es eben auch kundtun sollen: Nichtpublizierte Inhalte existieren in der Wissenscha� einfach nicht. Ein wichtiger rationaler Grund für die Ablehnung der neuen Richtungen durch Lorenz mag darin gelegen haben, dass sich die Art, wie hier Forschung betrieben wurde, nicht mit seiner ziemlich strikten Vorstellung einer induktiven Methode der Naturwissenscha� deckte. In der Öko-Ethologie und Soziobiologie geht man auf der Basis von sehr starken Konzepten an das Erheben von Daten und lau� so beständig Gefahr, das zu finden, was man finden wollte, also die Theorie immer nur zu bestätigen. Die wichtigsten dieser Konzepte heißen Individualselektion, Fitnessmaximierung und inklusive Fitness, um nur einige zu nennen. Man arbeitet also hauptsächlich deduktionistisch, was natürlich das Misstrauen des Altmeisters geweckt haben muss. Die Stärke der Öko-Ethologen und Soziobiologen ist die »unvoreingenommene« Beobachtung wahrlich nicht. Gegen Deduktion im Sinne von Karl R. Popper wäre auch nichts einzuwenden: Es soll nach Beispielen gesucht werden, um die bestehenden Hypothesen zu falsifizieren. In der Praxis dominiert aber die Suche nach Beispielen, welche geeignet sind, die bestehende Theorie zu bestätigen. Dieser Ansatz war Lorenz gleichermaßen immer suspekt und doch zu eigen. So schreibt er in seinem »Russischen Manuskript« (1992, S. 78): »Auf einem völligen Verkennen des Wesens aller induktiven Methode aber beruht folgendes Verfahren, das in der Verhaltensforschung und Psychologie häufig noch für völlig zulässig und ›naturwissenscha�lich‹ erachtet wird: Es wird auf Grund ganz weniger Tatsachen eine Hypothese gebildet und nachträglich Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 63 nach Beispielen gesucht, welche diese Hypothese zu unterstützen geeignet erscheinen. Demjenigen, der in dieser Weise die statistische Natur aller induktiven Forschung übersieht, sei gesagt, dass es keine noch so absurde und blödsinnige Hypothese gibt [und dafür schien Lorenz manche der neuen Konzepte zu halten, Anm. des Verfassers], für welche sich bei einer derart voreingenommenen Auswahl der Tatsachen nicht reichlich ›Beispiele‹ beibringen ließen.« Eigentlich unnötig zu betonen, dass es in den Naturwissenscha�en gar nicht möglich ist, entweder induktiv oder deduktiv zu arbeiten; wissenscha�liche Arbeit ist ein ständiger Spiralprozess, der von Beobachtungen zur Bildung von Arbeitshypothesen und zu deren Überprüfung durch weitere Beobachtungen oder Experimente führt, was zumeist zur Modifikation der originalen Arbeitshypothese führt und weitere Beobachtungen und Experimente nach sich zieht (Exkurs 5). Es ist, ganz abgesehen von den vorangestellten Überlegungen, ziemlich einsichtig, warum es nicht Konrad Lorenz war, der die zwingende Verbindung zwischen Verhalten und ökologischen Randbedingungen zum Brennpunkt seiner Arbeit machte. Von Anbeginn bevorzugte Lorenz zahme Wildtiere in seiner Obhut als Forschungsobjekte und kam so zu detaillierten Einsichten über Ablauf und Mechanismen von Verhalten. Verständlich, dass die Frage nach dem evolutionären Warum und Wozu von Niko Tinbergen und anderen Forschern gestellt wurde, die ihre Zeit vorwiegend mit der Beobachtung von freilebenden Wildtieren verbrachten. So legte der tierhaltende »Bauer« Lorenz die maßgeblichen konzeptuellen Grundsteine für die Verhaltensphysiologie und den zwischenartlichen Vergleich, während der Wildtiere beobachtende »Jäger« Tinbergen das Fundament für die Erforschung des Anpassungswertes von Verhaltensweisen lieferte (Festetics 1983). Tinbergen als Wegbereiter für die Öko-Ethologie Tinbergens wie Lorenz‘ wache Geister und lebenslange Neugier (von Lorenz für ein neotänes menschliches Merkmal gehalten) ließen sie in bester induktiver Manier ein buntes Spektrum von Organismen untersuchen, was sich als wichtige Voraussetzung zur Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens herausstellte. Natürlich ist das keine Spitze gegen jene Forscher, die zeitlebens einem einzigen Tiermodell die Treue halten, sei es der Honigbiene oder einem Fadenwurm oder sogar dem Menschen, und damit tiefgreifende Erkenntnisse über biologische Prozesse sammeln. Das muss kein »falscher« Weg sein, denn das induktive Lorenzsche Grundspielchen des »Was es so alles gibt«, also einer gründlichen Bestandserhebung der vorhandenen Muster als Grundlage für jegliche Verhaltensforschung, kann man durchaus auf verschiedenen Ebenen betreiben. Ein Beispiel soll die beobachtend-experimentelle Arbeitsweise Tinbergens erläutern: Als er solitäre Wespen, sogenannte Bienenwölfe (Tinbergen und Kruyt 1938), in seiner frühen Forscherphase beobachtete, fiel ihm deren verblüffendes Heimfindevermögen auf. Wobei zu bemerken ist, dass jenes selbstgegrabene Loch im Boden, welches diese Wespen wiederholt aufsuchen, eigentlich nicht ihr eigenes »Heim«, sondern das ihrer Kinder ist 64 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie (wenn man Maden als solche bezeichnen darf). Der Frage, wie Bienenwölfe es schaffen, nach dem Jagdflug eines ihrer Brutlöcher punktgenau anzusteuern, ging Tinbergen nach, indem er einfach markante Steinchen in Lochnähe parallel verschob; das Loch blieb natürlich, wo es war. Prompt suchten die Bienenwolfweibchen ihre Löcher um jene Strecke versetzt, um welche ihre Landmarken, die Steinchen, versetzt worden waren. Damit war gezeigt, dass die Raumorientierung dieser Tiere zumindest im Nahbereich über den Vergleich eines gelernten Schemas mit visuell wahrgenommenen Landmarken erfolgt. Auf eine klare Frage erbrachte ein einfaches Experiment eine klare Antwort. Natürlich blieben – wie immer in der Wissenscha� – viele Fragen offen, gemäß der Faustregel, wonach jede beantwortete Frage viele neue bedingt. So wäre es natürlich wichtig zu wissen, über welche Lern- und Speicherleistungen das Sinnes- und Nervensystem eines Insekts diese sagenha�e Ortsgenauigkeit scha�. Ein anderes, mi�lerweile in vielen Lehrbüchern der Verhaltensbiologie zitiertes Beispiel Tinbergenscher Arbeit ist das Eischalen-Entfernen bei Lachmöwen. Diese Vögel brüten in lockeren Kolonien, zum Beispiel in den niederländischen Dünen (Tinbergen 1953b). Ihre Brutbiologie wurde von Tinbergens Arbeitsgruppe untersucht. Es ist jeweils nur ein Partner des Möwenpaares am Nest, während der andere mit Nahrungssuche beschä�igt ist. Und selbst der oder die gerade Brütende benötigt eine gelegentliche Pause. Während der Abwesenheit des Elters sind die Eier auf ihre fleckige Tarnfärbigkeit angewiesen, um nicht von Fressfeinden, wie z. B. Krähen, entdeckt zu werden. Es fiel dem genauen Beobachter auf, dass die Möwen nach dem Schlüpfen der Jungen die Eischalen vom Nest wegtragen. Dieses Verhalten nimmt im gesamten Zeitbudget einer Möwe nur einen verschwindenden Bruchteil ein, wird daher leicht übersehen oder nicht beachtet. Und doch, so schloss Tinbergen, muss diese Verhaltensweise wichtig sein, sonst würde der Elternvogel die Eischalen wohl am Nest liegenlassen. Überlebenswichtig, genaugenommen, sonst wär‘s im Evolutionsprozess nicht selektioniert worden. Überlebenswichtig allerdings nicht im Sinne von Alles-oder-nichts: Eine nicht entfernte Eischale ist nicht unbedingt das Todesurteil für ein Küken, aber seine Risiko, verspeist zu werden, steigt. Eine plausible Arbeitshypothese war rasch gefunden: Da die Innenseite der Eischale nicht Tarnfarben, sondern weiß ist, fällt diese bereits über große Distanz auf, würde den Neststandort verraten und Küken oder restliche Eier zur leichten Beute der Krähen machen. Man pinselte also Hühnereier tarnfarbig á la Möwe und legte diese in den Dünen aus. Aufgebrochene MöwenEischalen wurden diesen tarnfarbigen Eiern in 15 cm, 1 m und 2 m Distanz zugesellt. So konnte gezeigt werden, dass Krähen doppelt so viele Eier finden, wenn aufgebrochene Schalen in 15 cm, verglichen mit 2 m Entfernung, liegen. Das Wegtragen der Eischale ist also eine bedeutende Maßnahme gegen Raubfeinde. Damit endet die Geschichte allerdings noch nicht. Um das Risiko, von Krähen entdeckt zu werden, zu minimieren, sollte der Vogelelter die Eischalen sofort nach dem Schlupf entfernen. Dies geschieht aber nicht. Und zwar wohl Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 65 deswegen, weil Kolonienachbarn keine Hemmungen haben, das eben geschlüp�e, noch nasse und darum gut schluckbare Küken zu kannibalisieren (nicht gerade ein Verhalten, welches zum Besten der Art wäre). Um dieses Risiko zu verringern, muss der Elter mit der Entfernung der Eischale zumindest warten, bis sein Küken trocken ist und dem Nachbarn daher im Halse stecken bliebe, würde der versuchen, es zu fressen. Es ist also ein zweifaches Risiko gegeneinander abzuwägen, eine optimale Entscheidung bezüglich des Zeitpunkts zu treffen, wann die Eischale entfernt werden muss, um das Überleben des Nachkommen zu optimieren. Dieser Zeitpunkt wird ziemlich genau dann sein, wenn das Junge gerade getrocknet ist. Öko-Ethologie: von der Ökonomie der Tiere Sowohl im Falle der Bienenwölfe als auch bei den Möwen haben die auf genauen Beobachtungen basierenden, sehr einfachen Freilandexperimente Tinbergens gezeigt, dass und in welcher Weise die untersuchten Verhaltensweisen adaptiv, also überlebenswichtig sind. Eine exakte Vorhersage, wann die Eischalen denn nun entfernt werden sollten, ist aber so nicht möglich. Dazu benötigt man Modelle, etwa auf der Basis der oben angestellten Überlegung. Spontane Einwände dagegen könnten lauten: Warum und wozu sollten wir daran interessiert sein, auf die Sekunde genau vorhersagen zu können, wann genau wieviel Nahrung wo aufgenommen wird? Welchen Erkenntnisfortschri� soll es bringen, auf das Joule genau die Kosten oder den Profit diverser Verhaltensweisen zu errechnen? Ist das der Einfluss des Zeitgeistes in der Ethologie? Was soll dieser buchhalterische Kleinkram, entspringt dieser vielleicht gar dem Minderwertigkeitsgefühl der Biologen, die endlich nach dem Muster der Physik auch aus der Ökologie und der Ethologie eine exakte Wissenscha� formen wollen? Vielleicht. Jedenfalls ist das Streben nach größtmöglicher Genauigkeit in der Wissenscha� sicherlich kein Schönheitsfehler, sondern legitimes Ziel. Denn qualitative Ergebnisse sind gut, aber Vorhersagbarkeit zu erzielen und die damit verbundene Gewissheit, den Spielregeln für Verhalten, für Zusammenleben wieder ein Stück nähergekommen zu sein, ist besser. Und ein Modell, welches geeignet ist, das Verhalten realer Systeme nachvollziehbar zu machen, kann schon ziemliche Sicherheit über die Bedeutung der beteiligten Faktoren geben. Trotzdem kann selbst von den besten Modellen nicht erwartet werden, dass sich deren Ergebnisse exakt mit den empirisch erhobenen Daten decken (siehe unten). Der Zwang, optimal zu handeln, oder besser: optimale Entscheidungen zu treffen, entspringt der engen Einbindung von Tieren in ihre ökologischen Randbedingungen, verbunden mit dem aus dem evolutionären Mechanismus kommenden Erfolgsautomatismus, der zur Entwicklung von individuellen Merkmalen führt, die es gesta�en, mehr reproduktive Nachkommen zu hinterlassen, als andere Mitglieder der Population. Der Eindruck vom fröhlich singenden Vogel, der den Tag in harmonischem Naturgenuss verbringt, ist grundfalsch. Natürlich ebenso falsch ist die Annahme, dass ein kastrierter und darum von seinem Geschlechtstrieb nicht mehr beunruhigter Singvogel in einem gut geheizten Käfig bei voller Fu�erschüssel im Paradies lebt. Es 66 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie mangelt ihm exakt an jenen Reizen, welche vom Korse� der natürlichen Zwänge (Konkurrenz, Räuber, ungünstige physikalische Faktoren usw.) ausgehen, woran sich das gesamte Verhaltensgefüge dieses Vogels im »äonenlangen Werden« angepasst hat, wie sich Konrad Lorenz möglicherweise ausgedrückt hä�e; einschließlich seiner Fressfeinde, denen er zu entkommen trachtet. Der Vogel ist also »disponiert«, mit bestimmten Reizen und Situationen zurechtzukommen und kann er das nicht, weil es diese nicht gibt, erfüllt sich sozusagen seine Identität nicht. Der materielle Wohlstand in Sicherheit stellte für unseren Vogel eine künstlich verarmte Umgebung dar. Derselbe intakte Vogel in Freiheit hat natürlich andere Probleme. Genau damit beschä�igen sich die Öko-Ethologen (Exkurs 7), weil die individuelle Bewältigung dieser Problem letztlich individuell unterschiedliche Fortpflanzungsraten bedingt. Dies ist der Grundmechanismus evolutionären Wandels; ständig muss unser Vogel aufpassen, nicht zu verhungern und nicht selber gefressen zu werden, muss zum richtigen Zeitpunkt einen Partner finden, muss mit Artgenossen konkurrieren und kooperieren und muss o� über weite Strecken in die richtige Richtung ziehen. Und wenn er dies alles effizient scha�, wird er in seiner o� nur kurzen Lebenszeit auch Nachkommen hinterlassen. Da das Angebot an Nahrung und Geschlechtspartnern begrenzt und daher der Konkurrenz unterworfen ist, da unterschiedliche Nahrungsquellen sich nicht nur im Angebot unterscheiden, sondern auch im Raubfeind- und Konkurrenzdruck und der Tag schließlich für alle nur 24 Stunden hat, sind Tiere gezwungen, äußerst ökonomische Entscheidungen zu treffen, sonst passiert ihnen ganz analog zu einem schlecht organisierten Wirtscha�sunternehmen der Bankro�, also ein vorzeitiger Tod oder ein Leben ohne Nachkommen, was evolutionär betrachtet ein So-gut-wie-totSein bedeutet. Exkurs 7: Einige Modelle in der Öko-Ethologie Alle Tiere müssen ökonomisch handeln; solche, die mehr (und bessere) Nahrung finden, können mehr Nachkommen aufziehen, das ist schließlich die Essenz des evolutionären Spieles. Genauso wichtig ist auch der individuelle Umgang mit Stressoren und die »soziale Kompetenz«, also Geschick und Effizienz im Umgang mit den anderen. Das klingt ziemlich trivial, denn was hindert Tiere daran, sich genügend Nahrung einzuverleiben? Konkurrenten und Feinde, zum Beispiel. Freilebende Tiere können fast niemals kompromisslos schlaraffische Nahrungsquellen nutzen, sondern müssen ständig Kosten bzw. Gefahren und Nutzen gegeneinander abwägen, etwa das Risiko, zu verhungern, gegen das Risiko, gefressen zu werden. Sie müssen also ständig Entscheidungen treffen. Räuber haben daher einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob und wo ihre prospektive Beute selber Nahrung aufnimmt. Da Tiere durch Hunger unterschiedlich motiviert sein können (von satt bis unmittelbar vor dem Verhungern), kann die Entscheidungsregel nicht fix sein, also einfach lauten, ein bestimmtes Risiko für einen bestimmten Gewinn in Kauf zu nehmen. Genau das zeigten Manfred Millinski und Mitarbeiter in Versuchsserien mit Stichlingen, unterschiedlich dichter Wasserflohbeute und sie bedrohenden Eisvogelattrappen (1985). Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 67 Die Risikoabschätzung zwischen Fressen oder Gefressenwerden ist nur eine von vielen Einschätzungsleistungen, mit denen jedes Tier im täglichen Leben konfrontiert ist. Daher müssen von Tieren ständig optimale Entscheidungen getroffen werden, denn nur so können sie entsprechende Überschüsse für die erfolgreiche Vermehrung erwirtschaften. Bis an welche Ertragsgrenze sollte man eine bestimmte Nahrungsquelle nutzen, bevor man eine neue sucht? Wie weit im Umkreis sollte man Nahrung suchen? Soll man ein Territorium verteidigen? Wie groß muss/darf es sein? Natürlich sind optimale Entscheidungen auch in Bereichen zu treffen, welche direkt die Vermehrung und damit die Fitness betreffen: Viele Fische müssen sich »entscheiden«, ob sie bereits früh im Leben relativ wenige Nachkommen haben »wollen« oder das Risiko auf sich nehmen, noch eine Zeit zu wachsen, dann aber viel mehr Nachkommen erzeugen können. Singvogelweibchen etwa müssen »entscheiden«, ob sie erstes Weibchen bei einem Männchen mit mäßiger Territoriumsqualität werden »wollen« oder lieber zweites Weibchen eines Männchens mit gutem Territorium. Vogelmännchen müssen sich »entscheiden«, ob sie sich ganz der Versorgung der Erstbrut widmen »wollen« oder sich lieber nach weiteren Weibchen umtun. Vielfach müssen sich die Männchen »entscheiden«, ob sie tatsächlich die Kosten der Verteidigung eines Territoriums auf sich nehmen, um zu Kopulationen zu gelangen, oder sich lieber als alternative »Strategen« Kopulationen erschleichen, ohne viel dafür zu leisten usw. Dieser Bereich der optimalen Entscheidungen, die Währungen und Regeln, mit denen Tiere umgehen, die Randbedingungen, denen sie unterworfen sind, ist der zentrale Bereich der Ökoethologie. Die Anführungsstriche an den Zeitwörtern im vorhergehenden Absatz beziehen sich darauf, dass alles so klingen könnte, als ob das Leben ein kompliziertes Schachspiel wäre, welches bewusst gespielt, nur von den intelligentesten Spielern gemeistert werden könnte. Erstes stimmt, zweites nicht. Es wird keinesfalls verlangt, dass Tiere (und Menschen, etwa im sozial-sexuellen Bereich) bewusste, kühl durchüberlegte Entscheidungen treffen. Die Strategieanweisungen sind evolutionär eingebaut. Situationen müssen nicht bewusst werden, es reichen spezifische Appetenz, Belohnungsund Strafsysteme – also Hunger, der Suche auslöst, Lust bei Begegnung mit Nahrung oder Sozialpartnern, Angst vor Räubern und überlegenen Rivalen – dass Tiere sich nahe an den situationsspezifischen Optima bewegen. Modelle dienen nun dazu, bezüglich definierter Währungen (z. B. Energiegewinn oder ersparnis, Raubfeindrisiko usw.) und Entscheidungsvariablen (z. B. fressen oder flüchten, weiter ausbeuten oder Suche neuer Nahrungsquellen, sozial oder territorial sein usw.) im Zusammenhang mit sorgfältig definierten Randbedingungen (z. B. Qualität der Nahrungsquelle, des Territoriums, Nahrungsaufnahmekapazität, Raubfeinddruck u. a.) quantitative Vorhersagen über die Entscheidung von Tieren zu treffen. Ziel von Modellen ist es also, evolutionäre Spielregeln besser zu verstehen, zu Vorhersagbarkeit zu kommen und damit den adaptiven Wert konkreter Entscheidungen beurteilen zu können, ja sogar Hilfen für rationale Entscheidungen im Bereich des Naturschutzes zu geben. Die Voraussagen des Modells werden aber durch die Entscheidungen der Tiere bestenfalls weitgehend, nie aber vollständig erfüllt. Je nach Geschmack und Standpunkt passt das Modell dann entsprechend gut oder schlecht. Das 68 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Modell kann unzutreffend oder ungenau in der Auswahl der Parameter sein. Andererseits darf man nicht annehmen, Tiere seien immer im Besitz aller Informationen, z. B. über Nahrungsdichten und Feindgefahr. Wie denn auch, wenn sie keine Erfahrung machen konnten? Tiere müssen Erfahrungen sammeln, anders ausgedrückt: Sie müssen immer eine gewisse Rate an Fehlentscheidungen treffen, um nahe am Optimum bleiben zu können. Wie sollten sie sonst wissen, wo dieses liegt? Wie soll ein Waldrapp etwa wissen, dass er den Fleck der Wiese mit der höchsten Regenwurmdichte erwischt hat (also für ihn den geringsten Zeitaufwand pro eingenommener Kalorie), wenn er nicht gelegentlich davon abweicht und dann natürlich weniger Würmer pro Zeiteinheit findet? Einen weiteren Streich spielen uns die Sinnesorgane. Sie liefern keine exakten Meßwerte, sondern informieren uns eher über Gegensätze (Exkurs 5), welche uns die Einschätzung von mehr oder weniger erlauben, wie im dritten der nachfolgenden Beispiele erläutert wird. 1. Wie weit – wie viel? Alex Kacelnik lieferte das ob seiner Eleganz und Vollständigkeit mit Recht wohl bekannteste Modell der Ökoethologie (1984). Stare, die Junge füttern, haben eine gewisse Distanz von der Nisthöhle zum Futterplatz zurückzulegen und laden dort ihren Schnabel vorzugsweise mit Käferlarven voll, die sie aus dem Boden eines Rasens zirkeln, um sie nach der Rückkehr ans Nest ihren Jungen zu verfüttern. Da also der Schnabel nicht nur Transport-, sondern auch Sammelinstrument ist, kommen mit zunehmender Beladung beide Funktionen in immer größeren Konflikt. Laden sie die ersten 4 bis 5 Larven relativ rasch, so steigt darüber die Suchzeit immer mehr an, um bei 8 ein Maximum zu erreichen; mehr geht nicht. Die Währung des Spieles lautet Energiemaximierung für die Jungen, denn die müssen möglichst rasch flügge werden. Sollen die Eltern nun bereits mit rasch gefundenen 4 Larven zurückkehren oder lange bleiben und erst mit dem Maximum von 8 Larven abfliegen? Wie das Modell zeigt, kann die Antwort darauf nur lauten: Das kommt darauf an, nämlich auf die Distanz zwischen Nest und Nahrungswiese. Je kürzer der Anflug, desto eher sollten sie wieder zurückfliegen, und umgekehrt. Das Maximum ist also nicht immer ein Optimum. Empirische Daten zeigen, dass sich wirkliche Stare statistisch gesehen erstaunlich nahe an den Vorhersagen des Modells bewegen, dass aber Individuen natürlich entsprechende Abweichungen zeigen. 2. Fressen oder gefressen werden? Zu den klarsten Untersuchungen zum Thema Nahrungssuche unter Feinddruck zählen die Arbeiten von Manfred Millinski (1985) und Mitarbeitern zur Nahrungssuche von Stichlingen unter Bedrohung durch Eisvögel. Hohe Beutedichten erlauben hohe Fangraten, daher greifen hungrige Stichlinge vorzugsweise dichte Schwärme von Wasserflöhen an. Das Dilemma für die Stichlinge ist dabei, dass sie sich bei hohen Beutedichten sehr auf das Fangen konzentrieren müssen, da der »Konfusionseffekt«, also die Verwirrung des Räubers durch die Beute, mit deren steigender Gruppendichte ebenfalls ansteigt. Das bedeutet, dass Stichlinge, die an dichten Wasserflohschwärmen fressen, weniger gut auf Fressfeinde, etwa Eisvögel, aufpassen können, daher gefährdeter sind, selber gefressen zu werden, als Stichlinge, die an weniger dichten Schwärmen fressen. Tatsächlich bevorzugen nur mäßig hungrige Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 69 Abbildung 3: Stareneltern optimieren ihre Entscheidung, wie lange sie in einem Rasen wurmförmige Käferlarven suchen, bzw. wieder zum Nistkasten zurückkehren sollten, in Abhängigkeit von der Flugstrecke (Flugzeit) zwischen Nest und Fu�erplatz und der Form der Ladekurve. Diese Kurve ergibt sich daraus, dass es in Abhängigkeit der sich bereits im Schnabel befindlichen Beutestücke immer schwieriger wird, weitere aufzunehmen. Das Optimum liegt umso höher, je weiter ein Vogel anfliegen muß. Im Beispiel liegt das Optimum des weiter anfliegenden Stars bei 7 Larven, des anderen, mit näher gelegenem Nest dagegen bei 6. Nach Kacelnik (1984). Stichlinge und solche, die eben mit einer Räuberattrappe konfrontiert wurden, niedrige Beutedichten. Klar, denn lieber langsamer fressen, dafür aber selber nicht gefressen werden! Als faszinierende Nebenerkenntnis zeigt sich, dass ein Hauptvorteil des Gruppenlebens, nämlich der erhöhte Schutz vor Fressfeinden, für die Wasserflöhe erst dann eintritt, wenn ihr Räuber selber unter Druck gerät. Der Eisvogel macht die Gruppenverteidigung der Wasserflöhe gegen Fische erst wirksam. 3. Fressen in der Gruppe: ideale freie Gänse? Wenn Tiere begrenzte Ressourcen wie z. B. Nahrung nutzen, kommt es zwangsläufig zu Konkurrenz, die entweder über Fressraten ausgetragen wird (Ausbeutungskonkurrenz) oder dadurch, dass Individuen die Nahrungsquelle gegenüber anderen verteidigen (Interaktionskonkurrenz). Ausverkaufskunden an einem Wühltisch wären ein Beispiel für ersteres, während Obstbäume in einem umzäunten Garten eher zu den verteidigten Ressourcen gehören (wie zumindest die ehemaligen Lausbuben unter uns aus ihrer Kindheit wissen). 70 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Abhängig von Nahrungsdichte, -qualität und Motivation kann das eine in das andere umschlagen (Kotrschal u. a. 1993, Krebs und Davies 1993). Das einfachste Modell, wie sich Konkurrenten in Abhängigkeit vom Ressourcenangebot und voneinander verteilen sollten, stellt die »ideale freie Verteilung« dar (Fretwell und Lucas 1969, Kacelnik u. a. 1992). Wenn Tiere fähig sind, sich entsprechend der Profitabilität ihrer eigenen Nahrungssuche zu verteilen, dann sollten sie zunächst die reichsten Nahrungsquellen aufsuchen, die ihnen die maximalen Fressraten erlauben. Je mehr Tiere (Konkurrenten) aber dort ankommen, desto geringer wird ihr Gewinn, bis es schließlich für Neuankömmlinge lohnender sein kann, weniger reiche Nahrungsquellen anzusteuern, an denen aber auch der Konkurrenzdruck geringer ist. Zwei wichtige Voraussetzungen für dieses Modell drücken sich bereits in der Überschrift aus: Es müssen in dem Sinne »ideale« Tiere sein, dass sie im Besitz aller Informationen sind (meist nicht ganz realistisch), und sie müssen frei sein, dorthin zu gehen, wo es für sie am lohnendsten ist. Es darf also keine Despoten geben, die sie daran hindern. Die Verteilung der Kunden an Supermarktkassen ist ein gutes Beispiel für dieses Modell (Krebs und Davies 1997): Man stellt sich dort an, wo man hofft, am schnellsten durchzukommen. Millinski (1988) bestätigte dieses Modell durch Versuche mit Fischen (Stichlingen) mit der Wahlmöglichkeit zwischen zwei Nahrungsquellen, die konstante, aber ungleiche Futterraten abgaben. Trotz Fehlens aggressiver Auseinandersetzungen kommt es vor, dass, aus welchen Gründen immer, Individuen nicht identisch in ihrer Konkurrenzfähigkeit sind, dass also manche rascher fressen als andere. Individuen sollten sich bei gegebener Ressourcenverteilung somit eigentlich nicht nach der Verteilung der bereits vorhandenen Individuen, sondern nach den Summen der Konkurrenzfähigkeit (kompetitives Gewicht) der bereits Anwesenden richten (Sutherland und Parker 1985). Wenn die Schwelle zur Annahme der weniger guten Nahrungsquellen bei 3 dort anwesenden, vollen Konkurrenten liegt, sollte sie bei 6 Konkurrenten liegen, wenn diese nur die halbe Konkurrenzfähigkeit aufweisen. In der Supermarkt-Analogie wäre dies der Fall, wenn eine Warteschlange doppelt so lang wäre, wie die andere (also doppelt so viele Konkurrenten enthielte), deren Einkaufswagen aber nur den halben Füllungsgrad (das halbe kompetitive Gewicht) aufwiesen. Tatsächlich wissen wir wohl alle aus eigener Erfahrung dass Supermarktkunden ihre Warteschlange nicht nur die Zahl der Einkaufswagen, sondern auch nach deren Füllungsgrad wählen. Menschen verhalten sich ganz offensichtlich gemäß den Voraussagen der Theorie der Idealen Freien Verteilung. Graugänse leben in großen, komplexen Gruppen (Exkurs 9). Sie genießen nicht nur die Vorteile des Gruppenlebens, sondern müssen auch mit dessen Nachteilen, z. B. mit der Konkurrenz um Nahrung, zurechtkommen. Tatsächlich konkurrieren Individuen in der Schar auf eine komplexe Weise sowohl durch Ausbeutungs- wie auch Interaktionskonkurrenz (Kotrschal u. a. 1993). Bietet man hungrigen Gänsen auf großen Flächen Körner an, so herrscht zumindest anfangs reine Ausbeutungskonkurrenz; jede Gans pickt so rasch wie möglich, ohne sich um die anderen zu kümmern. Erst nach einigen Minuten oder nach Absinken der Körnerdichte unter eine kritische Schwelle beginnen Höherrangige gegen andere aggressiv zu werden und Teile der Fläche für sich zu monopolisie- Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 71 ren, und das auch nur bei begehrter Nahrung wie Getreide. Werden die weniger begehrten, einen hohen Faseranteil aufweisenden Pellets gestreut, dann findet dieser Umschlag nicht statt. Dafür lohnt es sich offenbar nicht, die Mühe auf sich zu nehmen, andere zu vertreiben. Unter ausschließlicher Pelletfütterung handelt es sich also tatsächlich um »freie« Gänse, aber wie »ideal« verhalten sie sich? Die Frage lautet, zwischen welchen Randbedingungen hochsoziale Tiere wie Gänse ihre Nahrungswahlentscheidungen treffen müssen. Um dieser Frage nachzugehen, bietet die Theorie der Idealen Freien Verteilung einen guten Ausgangspunkt. Die Nahrung muss in Schar-adäquater Form, also flächig verteilt geboten werden, am einfachsten in unterschiedlichen Dichten auf zwei aneinandergrenzenden Feldern. Außerdem darf die Datenaufnahme nur in den ersten Minuten erfolgen, da nur dann die Gänse standardisiert hungrig sind und die Anfangsdichte noch nicht wesentlich unterschritten ist. Der Theorie entsprechend sollten die Gänse sich nach der Profitabilität richten, also danach, wieviel Nahrung pro Zeit aufgenommen werden kann. Ein adäquates Maß dafür sind die Pickraten. Es stellt sich also die Frage, welche Randbedingungen die Verteilung der Gänse auf Hoch- und Niedrigdichtefeld und ihre Pickraten beeinflussen. a) Verteilung der Gänse, Nahrungsdichten, Pickraten und Flächengrößen Bei Nahrungsdichten von 1000 Körnern pro m2 bzw. 3000 Körnern pro m2 waren die Pickraten entsprechend der Vorhersage aus dem Modell (Kacelnik u. a. 1992) auf beiden Feldern gleich, die Gänse verteilten sich aber recht konstant 1 : 2. Zwei Drittel der Gänse waren also auf dem Hochdichtefeld, der Nahrungsdichte entsprechend hätten es aber drei Viertel sein sollen. Da die Pickraten auf beiden Feldern gleich waren und sich auf beiden Flächen ein repräsentativer Scharquerschnitt von Gänsen befand, ist anzunehmen, dass kein Unterschied zwischen den Gänsen in ihrer Konkurrenzfähigkeit besteht. Es ist daher unklar, warum sich die Gänse zwar tendenziell, nicht aber genau nach den gebotenen Pelletdichten verteilten. Vermutlich erlauben die geistigen Fähigkeiten der Tiere zwar die Feststellung, auf welcher Seite es mehr gibt, nicht aber quantitativ, um wieviel mehr. Keinen Einfluss hatte die Feldgröße. Die 1 : 2-Verteilung der Gänse stellte sich unabhängig davon ein, ob die Feldgrößen 2 × 25 m2, 2 × 50 m2 oder 2 × 100 m2 betrugen; für uns zusätzlich zur fehlenden Aggression ein klarer Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um »freie« Gänse handelt, denn gäbe es versteckte Interaktionskonkurrenz, dann hätte die Gänseverteilung auf den kleinen Feldern gegen 1 : 1, auf den großen Feldern gegen 1 : 0 zugunsten des Hochdichtefeldes gehen müssen. Es gab übrigens keinen Unterschied in sozialem Status, Rang, Alter oder Geschlecht zwischen den Gänsen, die das Niedrig- bzw. Hochdichtefeld nutzten. Scharmitglieder nutzen also beide Flächen gleichmäßig. b) Welchen Einfluss auf die Gänseverteilung hat das Bedürfnis zum Gruppenleben? Wie wirkt sich also steigender Abstand zwischen beiden Nahrungsflächen auf die Verteilung aus? In einer Serie von Versuchen wurden zwei 50 m2-Felder (1000 bzw. 3000 Körner pro m2) im Abstand von 1 m bzw. 11 m zueinander geboten. Während bei geringem Abstand die Gänseverteilung erwartungsgemäß wieder annähernd 2 : 1 72 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie war, näherte sie sich bei weitem Abstand etwa 5 : 1. Nur ein Sechstel der Schar entschied sich für das Niedrigdichtefeld. Je weiter die Flächen voneinander entfernt sind, desto mehr neigen die Individuen dazu, sie nacheinander in geschlossener Schar auszubeuten. Hier wird wahrscheinlich von den Gänsen die Schutzfunktion der Schar vor Raubfeinden gegen den potentiellen Nutzen einer nicht konkurrierten Nahrungsquelle in Rechnung gestellt. Risiko vermeiden ist unter Umständen wichtiger als kurzfristiger Energiegewinn. c) Welchen Einfluss haben Faktoren wie Temperatur oder Bedrohung durch Raubfeinde auf Pickraten und Gänseverteilung? Dass Temperatur einen starken Einfluss auf Pickraten haben kann, war ein Zufallsergebnis, als zwischen zwei Versuchsserien mit gleichen Pelletdichten stark unterschiedliche mittlere Pickraten auftraten. Der einzige Unterschied zwischen den Versuchen war die Temperatur, die während der ersten Serie im Schnitt +1 °C betrug. Die zweite Serie wurde während einer anschließenden Kälteperiode durchgeführt, mit einer mittleren Temperatur von –10 °C. In der Kälte fraßen die Gänse etwa 1/3 langsamer; das verlangsamte »handling« der Körner durch den kalten Schnabel war offensichtlich dafür verantwortlich. Zufallsbeobachtungen zeigten zudem, dass Gänse, die durch vorangegangene Störungen »nervös« sind (was man am ständigen Sichern merkt), die Flächen nur zögernd annehmen, recht langsam fressen und wenig auf ihre Verteilung achten. Aufgrund der Theorie und entsprechender Ergebnisse an anderen Systemen (Millinski 1988, Pitcher 1986, Power 1984) ist vorauszusagen, dass die Pickraten sich bedroht fühlender Gänse sinken. Schwer vorhersagbar ist, wie sich die Gänse verteilen werden, da dichte Pellets im Gegensatz etwa zu dichten Wasserflohschwärmen (Millinski 1985) kaum einen Verwirrungseffekt auf den »Räuber«, also die Gans, ausüben können, im Gegenteil: Auf Hochdichteflächen kann man auch dann rascher fressen, wenn man sich mehr auf die Umgebung konzentrieren muss. Die Gänse sollten unter Feindbedrohung entweder weniger auf ihre Verteilung achten oder aber die Hochdichteflächen bevorzugen. Versuche mit einem angelernten Hund als Feinddarsteller zeigten einen signifikanten Anstieg des Sicherverhaltens und einen damit zusammenhängenden Abfall der Pickraten. Die Verteilung der Gänse, die ohne Feinddarsteller etwa 2 : 1 zugunsten des Hochdichtefeldes (5mal größere Dichte als Niederdichtefeld) ausfiel, tendierte bei Anwesenheit des Hundes gegen 1 : 1. Keinerlei Auswirkungen gab es auf die Verteilung unterschiedlicher Individuen (bezüglich Alter, Sex, Rang, sozialem Status) über die beiden Felder. Es ist also durch Wahl der Versuchsbedingungen durchaus möglich, mit »idealen freien Graugänsen« zu arbeiten. Verschiedene Tests eines im Grunde einfachen Modells zeigten eindrucksvoll, dass auch Gänse im engen Netz des Wirkungsgefüges der Lebensumstände ständig und recht flexibel fein balancierte Entscheidungen treffen. Die Bedeutung solcher Ergebnisse geht über die Gänse hinaus. Diese ökologisch und evolutionär begründeten Prinzipien der Entscheidungsfindung sollten für alle unter ähnlichen Randbedingungen stehenden Tiere einschließlich Mensch gelten. Es handelt sich dabei übrigens um Systemeigenschaften, die ganz parallel zu den Gänsen auch auf die Wirtschaft umlegbar sind, etwa auf Gruppen kooperierender Firmen. Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 73 Modellierte Tiere So sind ständige Abwägungen durchzuführen. In anderen Worten: Tiere sollten die einkommenden Informationen mit bereits gespeicherten Sollgrößen vergleichen, um im relativ komplexen Umfeld »richtige«, d. h. ihre Fitness fördernde Entscheidungen treffen zu können (Exkurs 7). Die Ökoethologie beschä�igt sich letztlich mit der Frage, nach welchen Regeln Tier Entscheidungen treffen, weswegen sich auch im englischen Sprachgebrauch als Synonym der Begriff »decision making« einbürgerte. Modelle dienen dazu, eben diese Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Eine Gruppe von besonders erfolgreichen Modellen, die sozusagen das Rückgrat der Öko-Ethologie bilden, sind Optimalitätsmodelle. Es werden Regeln aufgestellt, welche Entscheidung ein Tier unter gegebenen Bedingungen fällen sollte, um bezüglich einer bestimmten Währung das Optimum an Gewinn in Bezug auf die investierten Kosten zu erhalten. Um Verhalten modellieren zu können, ist eine durch Beobachtung erworbene genaue Grundkenntnis des Systems erforderlich. Dann muss als erster Schri� die Währung festgelegt werden. So kann ein nahrungssuchender Vogel seinen eigenen Energiegewinn maximieren, etwa um vor dem Zug in kürzester Zeit möglichst viel Fe� zu speichern. Energie maximieren gewöhnlich auch fü�ernde Elternvögel, nur stecken sie ihren Gewinn in den Nachwuchs. Derselbe Vogel kann während anderer Jahreszeiten unter ganz anderen Zwängen stehen. Im Winterquartier wird zum Beispiel o� die Fresszeit minimiert. Im letzteren Fall heißt die Devise: Energie sparen, zu Hause bleiben, sich so möglichst wenig den Fressfeinden aussetzen und auf diese Weise die eigene Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen. Energiemaximierung ist also nicht die einzige, sondern eine von vielen möglichen Währungen von Optimalitätsmodellen. Als weitere wichtige Annahmen müssen die Randbedingungen und die Entscheidungsvariablen in das Modell eingehen. Die Währungen sind ebenso variabel wie die Randbedingungen, die Alternativen der zu treffenden Entscheidung sind frei festsetzbar (Exkurs 7). Alle Modelle dienen letztlich der Vorhersage der Entscheidung von Tieren. Wurden die Annahmen richtig gewählt, dann sollten sich die abgeleiteten Vorhersagen weitgehend mit dem beobachteten Verhalten der Tiere decken. Es stimmt natürlich, dass Modelle nur einen kleinen Teilaspekt der wirklichen Welt abdecken können und die Komplexität natürlicher Systeme unzureichend oder gar nicht erfassen. Unabhängig davon, ob ein bestimmtes Modell das Verhalten von Organismen adäquat beschreibt oder nicht, liegt einer der Vorteile von Modellen darin, dass man gezwungen ist, exakte Arbeitshypothesen zu formulieren und die beteiligten Variablen genau zu bedenken. Dieser Zwang zur Exaktheit ist bei beobachtenden und beschreibenden Ansätzen weniger stark ausgeprägt. Es tri� auf Modelle zu, was für die Wissenscha� im allgemeinen zutri�: Der Weg ist o� wichtiger als das Ziel. Die jahrzehntelange Beschä�igung der Ökoethologen mit Entscheidungen bedingte das Wiedererstarken der kognitiven Ethologie. Als klar wurde, zu welch komplexen geistigen Leistungen Tiere befähigt sind (z. B. Häher, 74 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie die bis zu 30 000 Samenkörner verstecken und sie zu über 90 % wiederfinden), war man immer weniger bereit, sie als »Verhaltensmaschinen« zu betrachten, kurz: Man interessiert sich wieder dafür, wie Tiere denken. Im Zusammenhang mit den Unschärfen in den Modellen der Ökoethologie interessieren nun wieder verstärkt die Mechanismen des Informationserwerbs, jene Näherungsverfahren, welche Tiere verwenden, um etwa die Qualität von Fu�erplätzen, den energetischen Wert von Nahrung abzuschätzen; wie sie herausfinden, ob es besser für sie ist, sich einer Gruppe anzuschließen oder allein zu bleiben, ob es sich um einen guten Partner handelt. Vielfach werden dazu indirekte Reize benutzt. So reicht es für eine zufällig vorbeikommende Möwe, eine Aggregation von fressenden Möwen anzusteuern, um einigermaßen sicher zu sein, dass es dort Nahrung gibt. Der Vogel braucht den Reichtum der Fu�erquelle nicht direkt abzuschätzen, wenn etwa der Reichtum einer Nahrungsquelle und die dortige Aggregation von Artgenossen in Zusammenhang stehen. Suchbilder Es war eine Entdeckung von großer Tragweite, dass Räuber lernen, wie ihre Beute aussieht, sie also sogenannte Suchbilder erwerben. Durch Lernen können sich Räuber ein Schema anlegen, mit dem dann die Bilder aus der Umwelt verglichen werden. Das macht ihre Beutesuche effizienter. Die Auswirkungen dieses einfachen Vorgangs auf Individualverhalten von Räuber und Beute, auf die Selektion bestimmter Beutemerkmale und auf Ökosysteme sind aber beträchtlich. Luc Tinbergen beobachtete in den 1950er Jahren in niederländischen Wäldern, dass Vögel bestimmte Insekten mit höherer Frequenz nahmen, als diese Beute im Lebensraum vorkam. Er führte diese Bevorzugung auf die Bildung eines Suchbildes für diese Beute zurück. Als Effekt dieser Suchbild-bedingten Bevorzugung eines Beutetyps wird häufig wahrgenommene Beute überproportional zu ihrer Häufigkeit genommen, ohnehin seltene Beute ist dagegen unterproportional im Nahrungsspektrum vertreten. Man beachte, dass es dabei nicht auf die tatsächliche Häufigkeit der Beute ankommt, sondern auf die subjektive, also die Frequenz, mit der ein Räuber die Beute entdeckt. Daraus folgt, dass Beute gut daran tut, sich zu verstecken bzw. zu tarnen. Von der Frequenz des Entdecktwerdens kann wiederum die Fähigkeit von Räubern abhängen, Suchbilder anzulegen. Ein kleines bisschen mehr an Tarnung kann also unter Umständen eine starke Verringerung des Fressfeinddruckes bringen. Soweit die groben Grundlinien dieser Geschichte, von der Seite der Beute betrachtet. In einem evolutionären »Rüstungswe�lauf« bezüglich der Such- und Abwehrstrategien muss neben der prospektiven Beute auch der Räuber in Betracht gezogen werden. Die Gegenmaßnahme des Räubers liegt u. a. in einer Verbesserung seiner Fähigkeit, auch besser versteckte oder getarnte Beute zu finden, z. B. über eine Verbesserung seiner Suchbild-Bildung, also seiner Wahrnehmungsund Lernleistung. Somit kann Beute einen bedeutenden Selektionsdruck auf die Verbesserung mancher »Intelligenzleistungen« von Räubern ausüben. Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 75 In einer vergleichenden Untersuchung von relativen Gehirngrößen (Gehirnvolumen/Körpervolumen) von hawaiianischen Riff-Fischen fanden Bauchot u. a. (1977), dass diejenigen Fische die größten Gehirne aufweisen, die ihrer Beute aktiv nachjagen. Ähnlich große Gehirne ha�en aber auch die möglichen Beutefische, die offenbar ziemlich umsichtig sein müssen, um nicht von einem dieser »intelligenten« Räuber erwischt zu werden. Die relativ kleinsten Gehirne wurden bei den Lauerern unter den Räubern gefunden, die so lange gut getarnt umherliegen, bis sie im richtigen Augenblick das Maul weit aufzureißen, um ein argloses Beutefischchen einzusaugen; in 20 Millisekunden, dem Fün�el einer hundertster Sekunde, ist bei letzteren des Tages Arbeit getan. Ein ganz ähnliches Ergebnis erbrachte eine breit vergleichende Studie zu den relativen Gehirngrößen der Fische des Tanganiijkasees. Dieser See im afrikanischen Grabenbruch ist etwa 8 Millionen Jahre alt und ein wahres Laboratorium der Evolution. In der Frühzeit besiedelte diesen See wohl eine unspezialisierte Art von Buntbarschen, ein Insektenlarven- und Wurmfresser, der mit den verschiedensten Lebensräumen zurechtkam. Daraus entstanden bis heute hunderte Arten verschiedenst angepasster Buntbarsche, die Felsbis Schlammböden, Freiwasser, Flachwasser und die großen Tiefen bewohnen. Sie legen ihre Eier entweder auf Steinen oder in Schneckenschalen ab, wo sie das Männchen bewacht, oder das Weibchen erbrütet sie im Maul. Am vielfältigsten entwickelte sich wohl die Ernährung. Von Insekten- PlanktonPflanzen- bis zum Fischfresser ist alles vertreten; einige Arten haben wahrha� exotische Nischen erobert. Manche leben von den Augen oder Flossen anderer Fische, wieder andere haben sich darauf verlegt, brütenden Weibchen die Eier oder Jungen aus dem Maul zu saugen. Die größten Vorderhirne zeigten die Bewohner reich strukturierter Felsküsten, entweder selber aktive Räuber, oder unter entsprechender Fressfeindbedrohung (Kotrschal u. a. 1998). Sollte relatives Hirnvolumen etwas mit geistiger Leistungsfähigkeit zu tun haben, was zumindest innerhalb enger Verwandtscha�srunden anzunehmen ist, dann darf man aus diesen Geschichten wohl schließen, dass ein evolutionärer Räuber-Beute-We�lauf, die Besiedlung eines komplexen Lebensraumes und fordernde soziale Beziehungen kognitive Fähigkeiten fördern. In diesem Zusammenhang liegt natürlich bezüglich der beinahe explosionsartigen Evolution der geistigen Leistungsfähigkeit des Menschen die Spekulation nahe, dass ein besonderer Selektionsdruck auch daher kam, dass die ursprünglichen Menschen sowohl Jäger als auch Gejagte waren. Das ist aber sicherlich nur ein Teilaspekt der Erfolgsgeschichte des menschlichen Gehirns. Eine besonders gut begründete Hypothese nimmt einen sozialen Hauptkontext für die menschliche Gehirnentwicklung an (vgl. Dunbar 1993). Aber zurück zum Suchbild, zu Vögeln und Insekten. Die Bildung eines Suchbildes durch ein Individuum lässt sich durch eine Lernkurve darstellen. Da wohl das Phänomen, nicht aber der genaue Verlauf dieses Lernprozesses im Freiland zu beobachten ist, haben sich Ökoethologen eine Apparatur einfallen lassen und mit dem amerikanischen Blauhäher einen Vogel gefunden, der mit Begeisterung darin die »Testperson« spielte (Pietrewicz und Kamil 1981). Man bauten eine Skinner-Box, in welcher Bilder von Insekten projiziert 76 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie werden konnten. »Glaubt« der Vogel, ein (mehr oder weniger gut getarntes) Insekt erkannt zu haben, pickt er einen Knopf und erhält eine Belohnung. War seine Entscheidung falsch, bekommt er nichts und der zeitliche Abstand zur nächsten Bildpräsentation wird erhöht. Wie auch in Freiheit wirkte sich also eine Fehlentscheidung auf eine Verlängerung der Suchzeit des Vogels aus und verminderte damit seine Effizienz. Zeigte man nun im Zuge einer Bilderserie abwechselnd entweder nur die Borke eines Baumes oder denselben Untergrund mit einer einzigen Art gut getarnter Nachtschme�erlinge, so steigerte der Vogel rasch seine Erkennungsleistung von anfänglich etwa 70 % richtige Entscheidungen auf bis knapp unter 100 %. Mit dieser Lernkurve war die Bildung eines Suchbildes auch experimentell nachgewiesen. Noch interessanter war allerdings das Ergebnis, wenn dem Vogel in Zufallsreihenfolge zwei unterschiedliche Farbvarianten eines getarnten Nachtschmetterlings gezeigt wurden. Es ist schon lange bekannt, dass manche getarnten Insekten in verschiedenen Morphen, also Erscheinungsbildern existieren, ohne dass die Funktion eines solchen Polymorphismus besonders einsichtig gewesen wäre; erklärt wurde er o� damit, dass auch der Untergrund in verschiedenen Ausführungen vorliege, dieselbe Schme�erlingsart also ein weiteres Spektrum von sie tarnenden Unterlagen zur Verfügung habe. Das kann durchaus der Fall sein, aber der oben erwähnte Versuch lieferte ein im Lichte unseres gegenwärtigen Verständnisses des evolutionären Mechanismus besseres, bzw. zusätzliches Argument: Die Testvögel scha�en es bei abwechselnder Präsentation der zwei Ausbildungsformen desselben Schme�erlings nämlich nicht, ein Suchbild auch nur für eine der beiden Morphen aufzubauen (also mit der Zeit besser zu werden). Es konnte gezeigt werden, dass Polymorphisms, also ein unterschiedliches Erscheinungsbild von Individuen einer Population/ Art eine effiziente Gegenstrategie gegen die Suchbild-Bildung bei Räubern sein kann. Räuber selbst selektionieren unter Umständen ihre Beutepopulationen auf die für die letzteren idealen Verhältnisse von Morphen, also unterschiedliche körperliche Ausbildungsformen, indem sie eine der Morphen so lange bevorzugen, bis sie entsprechend selten bzw. die andere entsprechend häufig wurde, um dann auf die andere Form umzusteigen. Der Begriff Beute gilt, nebenbei bemerkt, nicht nur für Nahrung tierischen Ursprungs, genauso gut können Pflanzenfresser für bestimmte Pflanzenarten Suchbilder au�auen. In Grünau stehen den Gänsefamilien jedes Frühjahr zumindest 50 fressbare Pflanzenarten in nennenswerten Quantitäten zur Verfügung. Tatsächlich genützt werden jedes Frühjahr aber nur ganz wenige dieser Arten. Das wäre allein noch nicht so aufregend. Was aber tatsächlich auf Suchbild-Bildung schließen lässt, sind die jährlich wechselnden »Moden«. Was im Vorjahr mit Begeisterung gefressen wurde, kann im darauffolgenden Frühjahr total »out« sein (Walther 1980). Gössel lernen offenbar in ihren ersten Lebenstagen ein kleines Inventar von Pflanzenarten, nach denen man eben pickt, zum Teil selber, durch Versuch und Irrtum, zum Großteil aber über Vermi�lung ihrer Eltern (Fritz und Kotrschal 2000, Fritz u. a. 2000). Diese Angewohnheit/Tradition wird sehr konservativ beibehalten, andere Pflanzen werden konsequent ignoriert. Die zweite Synthese der Ethologie: Öko-Ethologie und Soziobiologie 77 Mit dem Suchbild wurde gezeigt, dass einfache kognitive Prozesse im »Alltagsverhalten« von Tieren durchaus eine wichtige Rolle spielen. Suchbilder können aber auch planktonfressende Fische bilden. Für eine ausgeprägte »Intelligenzleistung« sollte man die Fähigkeit zur Suchbild-Bildung natürlich nicht halten, eher für eine spezialisierte Wahrnehmungsfähigkeit, angepasst an eine sowohl kurzzeitig als auch in evolutionären Zeiträumen instabile Umwelt. Muss alles »angepasst« sein? Als darwinistischer Öko-Ethologe nimmt man zunächst einmal recht bereitwillig an, dass jede Struktur, jede Verhaltensweise eines Organismus in der richtigen Situation fitnessfördernd sei. Dieses alles erklärende Credo der sogenannten »Adaptionisten« musste zwangsläufig Widerstand hervorrufen und wurde prompt von Evolutionsbiologen als »panglossian« (etwa: alles erklärend) kritisiert (Gould und Lewontine 1979): Man könne für alles und jedes ein Geschichtchen erfinden, warum es adaptiv sein müsse, und damit alles (scheinbar) erklären. Warum aber soll z. B. die Flügeldeckenstruktur vieler Käfer nicht bloß ein (selektiv neutrales) Nebenprodukt der Entwicklung sein? Dasselbe gilt für Farbmuster und Steigungswinkel von Schneckengehäusen usw. Was kostenneutral sei (d. h. sich bezüglich der Fortpflanzungsrate weder positiv noch negativ auswirkt), wird von der Selektion geduldet. Dass es Merkmale einschließlich Verhaltensweisen gibt, welche nicht durch den direkten Zwang zur Anpassung geformt wurden, sondern Folgen von Entwicklungsvorgängen bzw. physiologischen Mechanismen, oder aber schlicht stammesgeschichtliche »Mitbringsel« darstellen, ist nicht unwahrscheinlich, stellt aber die wissenscha�liche Untersuchung vor ein Dilemma: Verhaltens- oder sonstige Merkmale, die offensichtlich »funktionslos« sind, für welche also in jedem denkbaren Versuch die 0-Hypothese nicht widerlegt werden kann, lassen uns direkt ins Induktionsproblem schli�ern (Exkurs 5). Man stelle sich einen Vogel mit grauem Schnabel vor. Warum ausgerechnet grau? Vielleicht, weil diese Farbe chemisch einfach und energetisch günstig im Köper herzustellen ist? Für welche Aufgaben sollte ein grauer Schnabel denn besser geeignet sein als ein weißer, blauer, brauner oder grüner? Angenommen, man würde 100 verschiedene Arbeitshypothesen zur Funktion der Schnabelfarbe Grau samt zugehöriger Tests entwickeln und hä�e in allen Fällen ein negatives Ergebnis, die Schnabelfarbe Grau hä�e also keinen besonderen Anpassungswert in der Vermeidung von Fressfeinden, beim Anlocken von Beute, im sozialen Bereich usw.: Wie können wir sicher sein, dass nicht die 101. Arbeitshypothese zutri�? Mit anderen Worten: Gerade bei Tests des Anpassungswertes von Strukturen ist ein negatives Ergebnis niemals endgültig. Während ein positives Resultat eindeutig ist, lässt ein negatives immer die Optionen von »kein Anpassungswert« bzw. »unpassende Arbeitshypothese« offen. Aber selbst positiven Ergebnissen gegenüber ist immer höchste Vorsicht angebracht; Alternativhypothesen werden dadurch natürlich nicht ausgeschlossen. Monokausale Erklärungen (eine Ursache, eine Wirkung) gaukeln o� die trügetische Sicherheit vor, schon alles »im Griff zu haben«. Polykausale 78 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Modelle kommen Ursache-Wirkungs-Netzen in der Natur meist wesentlich näher. Monokausale Erklärungen entsprechen offenbar den menschlichen Denkstrukturen und schaffen geistige Geborgenheit, sind aber angesichts der Komplexheit lebender Systeme trügerisch (Exkurs 5). Aber zurück zum Anpassungswert der Schnabelfarbe: Dieses Beispiel wurde nicht erfunden. Bur� (1984) konnte tatsächlich zeigen, dass diese scheinbar nebensächliche Laune der Natur sehr wohl Auswirkungen haben kann. Amerikanischen Fliegenschnäppern fangen ihre Insektenbeute von Ansitzen aus mit kurzem Vorstoß. Ihnen wurde der graue Schnabel weiß-glänzend lackiert, und prompt zogen sie sich von besonnten Warten in den nahrungsärmeren Scha�en zurück, da wahrscheinlich der helle Schnabel die visuellen Insektenjäger blendete. Dieses Beispiel zeigt also, dass auch Merkmale, welche uns intuitiv nebensächlich vorkommen mögen, sehr wohl adaptiv sein können. Die Kritik am Adaptionismus einfach abzuschme�ern wäre ebenso unklug, wie sich dadurch in allzu große Verunsicherung stürzen zu lassen. Es gibt schließlich schon alleine aus den angeführten wissenscha�stheoretischen Gründen keine echte Alternative für die Arbeitshypothese, dass morphologische Strukturen, physiologische Vorgänge und Verhalten prinzipiell angepasst sind. Nur ist diese Annahme nicht der Weisheit letzter Schluss. Man darf nicht einfach annehmen, dass jegliches Verhalten adaptiv sei, man muss es allemal nachweisen und auch zeigen, wie wichtig eine bestimmte Merkmalsausprägung für die Fitness ihres Trägers ist. An entsprechenden Beispielen herrscht kein Mangel. Auch scheinbare Selbstverständlichkeiten sind zu hinterfragen, die Welt ist noch voller Rätsel. Warum etwa sind Raben schwarz? Man suche nach testbaren Arbeitshypothesen und die Forschung kann losgehen. Soziobiologie: Nepotismus, Egoismus und Wie-du-mir-so-ich-dir Die moderne Ökoethologie lässt sich als quantitativer Ansatz der Untersuchung der Konsequenzen von Verhalten auf die Fitness charakterisieren (Exkurs 3). Es geht dabei um nicht weniger als um Wesen und Mechanismus der Evolution. Die Ökoethologie bildet damit die solide Grundlage, wohl aber nicht den ausschließlichen Grund für die anhaltende Blüte der Verhaltenswissenscha�en in den letzten 20 Jahren. Dieser Aufschwung ist vor allem auf das Konzept der Verwandtenselektion zurückzuführen: W. Hamilton (1964), E. Wilson (1975) und andere Autoren zeigten die entscheidende Bedeutung des Verwandtscha�sgrades für Interaktionen zwischen Tieren. Auf diesem Konzept der inklusiven Fitness (Exkurs 3) beruht die Soziobiologie, die in jüngster Zeit wohl erfolgreichste Richtung der Verhaltensbiologie, vor allem deswegen, weil dadurch soziale Organisation biologisch erklärbar wurde (Bezzel 1993). Zudem bildet sie die Basis für die Einsicht, dass Kultur und ihre Merkmale, einschließlich Religionen in der Evolution wurzelt (Bonner 1983). Ethologen war schon lange aufgefallen, dass nicht alle Tiere immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind, sondern anderen helfen, sich sogar für andere aufopfern bzw. auf die eigene Reproduktion verzichten. Sie verhalten sich, als wären sie am »Überleben der Art« interessiert. Dieser Altruismus Soziobiologie: Nepotismus, Egoismus und Wie-du-mir-so-ich-dir 79 stellt aber für einen konsequent gedachten Darwinismus ein großes Problem dar. Im Sinne des gruppenselektionistischen Weltbildes von Konrad Lorenz war so etwas aber gar nicht verwunderlich. Vor allem die beliebten Naturdokumentationen des Fernsehens trugen das Ihre dazu bei, den »Zum Besten der Art«-Gedanken so tief ins öffentliche Bewusstsein einzupflanzen (wie übrigens auch die durchwegs irreführenden Ideen von der »Harmonie in der Natur« oder auch vom »ökologischen Gleichgewicht«, Pimm 1991), dass er, wie zu befürchten ist, noch lange das evolutionäre Credo der breiten Öffentlichkeit darstellen wird. So tief sitzt diese Überzeugung, dass selbst heute noch sogar manche biologisch Versierte die geistige Gefolgscha� verweigern, geht man daran, den romantischen Mythos vom »Überleben der Art« zu hinterfragen. Diesem Widerstand, die traditionelle Sicht von Altruismus und Gruppenselektion über Bord zu werfen, entspricht wahrscheinlich ein tief in uns steckendes Bedürfnis nach Harmonie in und mit der Natur. Wer akzeptiert schon gerne Dinge, wie sie wirklich sind, wenn die Möglichkeit besteht, sie im vertrauten, wenn auch falschen Sinne zu interpretieren? Vor diesem Hintergrund ist der Aufruhr verständlich, den Hamilton (1964), Wilson (1975) und andere verursachten, als sie mit dem in bezug auf Genetik und evolutionäre Mechanismen schlüssigen Konzept der Individualselektion (Exkurs 3) antraten, um Kooperation im Tierreich zu erklären. Nicht nur, dass sich neue Ideen in der Wissenscha� anfangs eher zäh verbreiten – auf dieses Konzept reagierten viele wie auf eine kalte Dusche. Dies um so mehr, als aufgrund der allseits akzeptierten Kontinuität zwischen tierischem und menschlichem Verhalten das Prinzip Eigennutz konsequenterweise auch auf den Menschen anzuwenden ist. Schützenhilfe kam von der bereits vorher entwickelten Spieltheorie (Maynard Smith 1976, Poundstone 1992), die aber natürlich keine empirischen Daten, sondern nur Modelle beisteuern kann. Welch scheinbare Verletzung anerkannter Prinzipien der gesellscha�lichen Ethik und Moral: Der in menschlichen Gesellscha�en weit verbreitete, aber vielfach geachtete Nepotismus – ein »biologisches Grundgesetz«, als solches natürlich und daher gut? Nicht unbedingt. Die Natur bietet zahlreiche Beispiele für scheinbaren Altruismus, also selbstlose Hilfe oder sogar Aufopferung für Artgenossen. So verzichten etwa die allermeisten Weibchen bei staatenbildenden Insekten auf die eigene Fortpflanzung und sorgen offenbar »lieber« als Arbeiterinnen für das Fortkommen ihrer Schwestern. Bei Kämpfen zwischen Männchen gibt es fast immer Ritualisierungen im Verhalten, die verhindern, dass es sofort zum Beschädigungskampf um wichtige Ressourcen, meist den Zugang zu den Weibchen, kommt. Bei vielen Vögeln, aber auch manchen Fischen und Säugetieren bleiben entweder die vorhergehenden Jungen oder sogar nichtverwandte Individuen bei den Brütern und helfen ihnen durch Fü�ern des Nachwuchses oder durch Verteidigung des Territoriums. Eigentlich recht einleuchtend, dass diese Phänomene zunächst dadurch erklärt wurden, dass sie das Überleben der Art fördern würden. Natürlich tun sie das offensichtlich auch, aber deswegen anzunehmen, der Überlebenswert dieser Verhaltensweisen 80 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie für die Art wäre unter Selektionsdruck gestanden, bedeutet Ursache und Wirkung zu verwechseln. Warum dem so ist, bedarf einiger Erklärung. Beginnen wir beim Grundstein der Darwinschen Theorie, bei der Einheit der Selektion: Das ist in den allermeisten Fällen das Individuum, nicht aber die Gruppe oder gar die Art. Prinzipiell haben alle Arten das Potential zur exponentiellen Vermehrung. Dass die Erde trotzdem noch nicht schon meterdick von Kaninchen, Elefanten oder Tauben bedeckt ist, liegt daran, dass Ressourcen, wie Nahrung und Lebensraum nicht unbeschränkt verfügbar sind. Dies bedeutet, dass notwendigerweise Konkurrenz um diese Ressourcen herrschen muss. Zudem sind alle genetisch produzierten Individuen (m.A. eineiiger Mehrlinge) genetisch einzigartig; alle bringen daher unterschiedliche Voraussetzungen mit, in konkreten Umwelten heranzuwachsen und zu leben. Die natürliche Selektion äußert sich nun nicht im Kampf »mit Klauen und Zähnen«, sondern in unterschiedlichen Überlebens-, vor allem aber in unterschiedlichen Fortpflanzungsraten. Gewisse Geno-Phänotypen werden in einer bestimmten Umwelt mehr Nachkommen hinterlassen, als andere, die Frequenz ihrer Allele (Genvarianten) in der Population wir also von einer Generation zur nächsten ansteigen. Damit verschieben sich aber auch die Merkmale. Dies ist der Kernprozess der Evolution. Es sind in der Regel zwei Individuen, ein Weibchen und ein Männchen, welche die zunächst haploiden (ein Chromosomensatz) Genome ihrer Geschlechtszellen (Ei/Spermium) zu wieder diploiden (doppelter Chromosomensatz) Nachkommen zusammenführen. Daher ist auch das Individuum, nicht aber Population oder Art die Haupteinheit der Selektion. Was mögliche Gruppeneffekte nicht ausschließt. Konsequent weitergedacht sind eigentlich die Gene selber die Einheiten der Selektion (Dawkins 1977), ihr Konkurrenzkampf treibt das Verhalten der Tiere und Menschen. Was zunächst völlig absurd klingt, wurde teils von Molekularbiologen belegt: So liefern sich mü�erliches und väterliches Genom sogar noch im Körper des Embryos he�ige hormonale Kämpfe um das Wachstum desselben (Hurst u. a. 1992). Von väterlichen Genen kodiertes Hormon (IGF-II) versucht das Wachstum des Embryos anzukurbeln, also mehr mü�erliche Ressourcen für den Nachkommen zu requirieren, als die Physiologie der mü�erlichen Seite zu investieren bereit ist. Als Gegenmaßnahme bildet das mü�erliche Genom Rezeptormoleküle, die nur dazu dienen, das durch väterliche Gene kodierte Wachstumshormon zu inaktivieren. Der strategische Kampf der Geschlechter um Fortpflanzungserfolg (siehe unten) setzt sich also sogar noch im Nachkommen fort. Generell werden nach einer Verschmelzung des weiblichen und männlichen Genoms im heranwachsenden Nachkommen nicht einfach wahllos und zufällig Gene mü�erlicher oder väterlicher Herkun� verwendet. Vielmehr bewirkt die sogenannte »Genomprägung« (genomic imprinting), dass für die Ausbildung bestimmter Merkmale nur das Genom eines Elters verwendet wird. Ein besonders spannendes Beispiel ist unser Gehirn; es konnte gezeigt werden, dass tiefere und ursprünglichere Hirnteile, wie Hirnstamm (basale Lebensfunktionen) und Hypothalamus (Steuerung von Sexualität) fast ausschließlich durch die Verwendung väterlicher, also Männlicher Gene zu- Soziobiologie: Nepotismus, Egoismus und Wie-du-mir-so-ich-dir 81 stande kommt. Hingegen wird jener Hirnteil, welcher die spezifisch menschlichen Eigenscha�, wie Denkfähigkeit, soziale Verantwortung und bewusste Selbstreflektion trägt, die Großhirnrinde, ausschließlich von Genen mü�erlicher Herkun� kodiert (Keverne 2001). Die Tragweite dieser Entdeckung ist noch kaum abzuschätzen. Etwas überspitzt könnte man meinen, dass den Frauen der Vor-Menschen vor etwa 700 000 Jahren ihr unkultiviertes Leben inmi�en männlicher Jagd-und Mordgesellen reichte und sie daher beschlossen hä�en, nun endlich ein »ordentliches«, kultur-und sprachfähiges Gehirn zu entwickeln. Selbstverständlich ist dies keine ernstha�e Arbeitshypothese. Aber der Gedanke passt zur durchaus ernstha�en »sozialen Intelligenzhypothese« (Dunbar 1993), wonach die Evolution unseres Gehirns besonders stark unter sozialen Selektionsdrucken gestanden wäre. Das Individuum wäre also jener »Sack voller (miteinander konkurrierender) Gene«, der sich ständig in einer realen Umwelt zu bewähren hat, was hier ganz konkret bedeutet: mehr Nachkommen hinterlassen als die nächsten Konkurrenten. Denn gelingt dies nicht, dann ist eine Verwandtscha�slinie, sind deren Gene bald erloschen. Alle heute lebenden Individuen aller Arten sind offenbar die Nachkommen erfolgreicher Individuen, denn die weniger erfolgreichen Linien sind bereits ausgestorben. Und dieses Spiel um den Fortpflanzungserfolg wird in jeder Generation wieder neu gespielt. Erklärt die Ökoethologie, wie Individuen ihre Ressourcennutzung für den letztlichen Zweck der Fortpflanzung optimieren, so gibt uns die Soziobiologie das passende konzeptuelle Rüstzeug zur Untersuchung der Frage, wie die Individuen in der Konkurrenz mit Artgenossen um die Zahl der Nachkommen bestehen können (Exkurs 3). Es mag vordergründig nicht so aussehen, aber wir alle, d. h. alle sexuell reproduzierenden Organismen auf der Welt, sind auf Reproduktions-Optimierung hin konzipiert. Solche Strategien lenken auch unser menschliches Verhalten (Voland 2000). Der amerikanische Populationsgenetiker Fisher (1930) argumentierte bereits plausibel, warum das Individuum, nicht aber die Gruppe die Einheit der Selektion sein sollte: Angenommen, es gäbe eine Population von rückhaltlos altruistischen Lemmingen, die, weil sie sich eben so stark vermehren, von Zeit zu Zeit kollektiven Selbstmord begingen, damit das Überleben der Art sicherten, da sie den wenigen Überlebenden wieder einen Lebensraum voller verfügbarer Ressourcen hinterließen. Da jegliches Verhalten auch genetisch begründet ist (Exkurs 3), variieren, genau wie körperliche Merkmale auch, Verhaltensrnerkmale innerhalb von Populationen um einen Mi�elwert; man denke nur an Körpergewicht bzw. -größe: Es gibt an den jeweiligen Enden der Frequenzverteilung dieses Merkmals besonders große bzw. kleine Individuen (Exkurs 5). Es wird also in unserer Population von Altruisten einige geben, die ganz besonders altruistisch sind, aber auch einige, deren Aufopferungsbereitscha� für die Art eher gering entwickelt ist. Im Selbstmordritual der Lemminge würden daher überwiegend die eher wenig altruistischen überleben. Außerdem ist damit zu rechnen, dass gelegentlich Mutationen Betrüger hervorbringen, die gar nicht altruistisch sind. In ganz wenigen Generationen wird also unweigerlich aus einer Population von über- 82 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie wiegenden Altruisten eine Bande von Egoisten. Altruismus kann also keine evolutionär stabile Strategie sein, alle Organismen sind prinzipiell »egoistisch«. Damit wird das »Überleben der Art« zum Sekundäreffekt im Konkurrenzkampf ums Replizieren der eigenen Gene. Wir sehen uns mit einer Welt konfrontiert, die prinzipiell vom Egoismus beherrscht wird, in welcher man einander nur dann beisteht, wenn es um das Fortkommen der eigenen Gene geht. Dafür sind besonders Verwandte prädestiniert, die je nach Verwandtscha�sgrad anteilig Gene gemeinsam haben. Nach dem Verwandtscha�sgrad richtet sich dann auch recht direkt die Kooperationsbereitscha�. Je größer der Anteil an gemeinsamen Genen, desto mehr kann man durch Verwandtenförderung auch für die eigene Fitness tun. Zur Zusammenarbeit mit Nichtverwandten ist man allenfalls bereit, wenn diese wiederum Gleiches mit Gleichem vergelten und daher zumindest ein symmetrischer eigener Vorteil herausspringt. Es ist also nicht so weit her mit der Harmonie in der Natur, wie noch unsere Altvorderen dachten, bzw. wie wir das gerne hä�en. Konflikte bestimmen die Welt. Paarpartner gehen Zweckbündnisse ein, wenn diese zur Aufzucht der gemeinsamen Kinder nötig sind; man sucht einander auch bei der Kinderaufzucht zu »übervorteilen«. Selten investieren beide Partner gleichmäßig in die Nachkommen. So sind innerhalb der Familien die Konflikte vorprogrammiert: Männchen und Weibchen gelingt es aufgrund der asymmetrischen Anfangsinvestitionen in Nachkommen nur über unterschiedliche Strategien, ihren Fortpflanzungserfolg zu optimieren; darum sind Seitensprünge und gegenseitigem Ausnutzen die Regel, nicht die Ausnahme. Ein anderer evolutionärer Konflikt besteht zwischen Eltern und Nachkommen: Kinder wollen aus Gründen, die noch zu diskutieren sein werden (S. 205), immer mehr von ihren Eltern, als diese zu geben bereit sind. Heute sieht es nach Sieg auf allen Linien für die Individualselektion aus, die alte Gruppenselektion hat offensichtlich ausgedient. Plötzlich war auch erklärbar, warum es bei der Übernahme von Weibchen und Weibchengruppen durch neue Männchen, etwa bei Löwen, Gorillas und anderen Affen, aber gelegentlich auch beim Menschen, zu Kindestötungen kommt. Mit Arterhaltung hat das wohl nichts zu tun. Und als »pathologisch« kann es wohl auch nicht abgetan werden, wenn Kindestötung ein regelmäßiger Bestandteil dieses sozialen Wechsels ist, außer man unterstellt, dass alle Männchen einer Art pathologisch veranlagt wären. In diesem Fall verschleiert eine oberflächliche Diagnose bloß die eigentlichen Ursachen. Denn sehr wohl erklärbar sind solche diese Kindestötungen im Lichte der Individualselektion: Die mordenden Männchen haben nichts davon, die Nachkommen fremder Väter aufzuziehen, da diese nichtverwandten Nachkommen nicht ihre Gene tragen. Zudem bleibt ihnen meist nur begrenzte Zeit für die eigene Reproduktion. Es liegt daher in ihrem vitalen (evolutionären, also unbewussten) Interesse, dass die ihnen zur Verfügung stehenden Weibchen rasch wieder empfängnisbereit werden, was der Fall ist, wenn diese Weibchen keine Nachkommen mehr zu versorgen haben. Das Töten fremder Nachkommen erhöht daher den Reproduktionserfolg auf seiten der Männchen, nicht aber jenen der Weibchen, denen in den angesprochenen Systemen meist keine Alternative bleibt, weil Das wiedererwachende Interesse am Verhalten und seinen Mechanismen 83 sie keine Möglichkeit haben, sich gegen den Kindermord zu wehren. Dieser ist daher eine Strategie, die sehr wohl den Männchen zugute kommt, den weiblichen Interessen aber massiv zuwiderläu� - ein klassischer Konflikt von vielen mit direkten Wurzeln in der Evolution, der bis in den menschlichen Bereich hinein wirksam ist (Grammer 1993, Voland 2000). Das wiedererwachende Interesse am Verhalten und seinen Mechanismen Die klassische Ethologie ist unverzichtbare Basiswissenscha� für die evolutionär orientierte Öko-Ethologie und Soziobiologie, denn warum sich Tiere verhalten, ist nicht zu beantworten, ohne zu wissen, wie sie es tun. Eine »black box« ist ein Ding, welches auf einen bestimmten Einfluss hin reagiert, ohne dass man wüsste, was darin geschieht. Religionen als Welterklärungsmodelle setzen in diese »black box« gewöhnlich ihr höheres Wesen und sind es damit zufrieden. Die Aufgabe der Naturwissenscha�en dagegen besteht in der Aufklärung der Vorgänge in dieser »black box«, die wir Welt nennen. Auch ein Computer, der durch unsere Aktion am key board genau das tut, was wir von ihm erwarten, ohne dass wir wissen, wie die Technik dahinter funktioniert, wäre eine »black box«. Aber worum geht es denn in der Verhaltensbiologie eigentlich, wenn nicht um Verhalten? Ökoethologen und Soziobiologen beschä�igen sich vorrangig mit den evolutionären Konsequenzen, nicht aber damit, wie Verhalten nun im mechanistischen Sinne eigentlich abläu�. Man behandelte die Verhaltensmechanismen über 20 Jahre lang als eine Art »black box«, vergleichbar mit der Behandlung des Versuchstieres im frühen Behaviorismus oder des Gehirns durch die Kybernetiker: Man untersuchte, wie Tiere auf bestimmte ökologische und soziale Bedingungen, also auf verschiedene Umwelten, reagieren, aber kaum, was dabei im Tier vor sich ging. Man prü�e allemal, ob Tiere zu optimalen Entscheidungen befähigt sind, vernachlässigte aber die Frage, wie diese zu solchen Entscheidungen kommen. Die Theorie war der Forschung am Tier weit voraus. Wie in allen boomenden Wissenscha�szweigen ließ man jene Gebiete, die man für weniger wichtig hielt, etwas links liegen. Das zeigen auch die Titel der in den letzten Jahrzehnten in den führenden Zeitschri�en der Verhaltenswissenscha�en veröffentlichten Arbeiten. In »Ethology« oder in »Animal Behavior« dominierten Ökoethologie und Soziobiologie. Und es wurde ein eigenes, mi�lerweile sehr angesehenes Journal namens »Behavioural Ecology and Sociobiology« gegründet. Das Pendel schlägt nun seit einiger Zeit wieder deutlich in die Gegenrichtung aus, in Richtung mechanistischer Ethologie. Was Niko Tinbergen mit seinen vier Fragen als Ausdruck des Huxley-Lorenzschen Ansatzes empfahl (Exkurs 1), nämlich möglichst viele Erklärungsebenen – jene der individuellen Entwicklung, der physiologischen und evolutionären Ursache sowie der evolutionären Geschichte – zu berücksichtigen, kehrt wieder verstärkt als Forschungsansatz und Forschungsgrundsatz zurück. Man ist sich heute darin einig, dass Verhalten auf allen seinen Ebenen, d.h. in Vernetzung mit seinen grundlegenden Randbedingungen, untersucht werden sollte. So ist 84 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie es nicht nur wichtig, den Anpassungs- und Überlebenswert zu untersuchen, sondern genauso jene Mechanismen und Strukturen, welche Verhalten direkt steuern, also Sinnesorgane, Nervensystem, Motorik, Hormone usw. Namen wie Lorenz, Tinbergen, von Frisch, von Holst und andere Klassiker tauchen wieder in einschlägigen Arbeiten auf. Es war Alex Kacelnik, der mit seinen experimentellen Arbeiten zu den Entscheidungsregeln nahrungssuchender Stare wieder die Frage nach den kognitiv-psychologischen Voreinstellungen stellte. Und es waren John Krebs und andere, etwa seine Schülerin Nicki Clayton, die aus ihrer Arbeit an fu�erversteckenden Meisen die Frage stellten, wie denn die beobachteten Unterschiede zwischen den Arten zustandekämen. Wenig überraschend fand man, dass bei besonders versteckaktiven Arten, bzw. Individuen der Hippocampus, also jenes alte Großhirnareal, das maßgeblich in Lernvorgänge, aber in die räumliche Orientierung von Wirbeltieren involviert ist, besonders gut entwickelt ist. Dies wäre etwa aus der vorhandenen Literatur über Fischhirne vorhersagbar gewesen (Kotrschal u. a. 1998). Aber eine nicht unwesentliche Komponente zur Erlangung wissenscha�lichen Ruhms ist eben auch die publikumswirksame Wiedererfindung des Rades. Vor allem zur Beurteilung evolutionärer Modelle ist es wichtig zu wissen, wie denn nun eigentlich ein Vogel Nahrungsdichten, Konkurrenzoder Raubfeinddruck abschätzt, nach welchen Reizen, mi�els welcher Mechanismen Dungfliegenmännchen über die Kopulationsdauer entscheiden usf. Viele dieser Fragen hängen mit Leistungen des Nervensystems, des Hormonhaushaltes oder anderer Subsysteme zusammen und sind daher ohne fundierte Kenntnisse auf diesen Gebieten nicht zu lösen. Immer ist das evolutionäre Erbe, sind also Körperbau und die Art und Weise wie die höchst komplexen Vorgänge im Körper funktionieren höchst relevante Randbedingungen für Entscheidungsfreiheit im Verhalten. So können Elefanten selbst dann nicht fliegen, wenn es für sie vorteilha� wäre und die heute lebenden Reptilien sind wechselwarm, auch wenn für sie die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur besser wäre. Umgekehrt verbrauchen wir Säugetiere allein zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur etwa 70% der aufgenommenen Energie. Eine evolutionäre Notlösung, diesen Ausgabeposten zu Zeiten ungünstiger ökologischer Konjunkturbedingungen zu verringern, wäre etwa der Winterschlaf. So ist die eher mechanistische »klassische« Ethologie sowohl eigenständige Wissenscha� als auch Basiswissenscha� für die evolutionären Richtungen. Ganz entscheidend ist die Frage, wann und wie Verhaltensweisen erstmals in der Individualentwicklung au�reten. Verhalten entsteht natürlich erst aus komplexen Interaktionen zwischen den (Lern-) Dispositionen und der Umwelt des Individuums. In diesem Wechselspiel entsteht das art- und individuenspezifische Verhaltensinventar. Und schließlich ist es äußerst wichtig für die richtige Deutung der Herkun� und Funktion von Verhalten, über dessen geschichtlichen, also evolutionären Werdegang Bescheid zu wissen. Da es weder fossilisierte Verhaltensweisen gibt und wir auch keine Zeitreisen zurück in die Erdgeschichte unternehmen können, um die Vorfahren der heute Das wiedererwachende Interesse am Verhalten und seinen Mechanismen 85 lebenden Tiere zu beobachten, bleibt uns nur der Ansatz der Vergleichenden Verhaltensforschung. Der herausragende Geniestreich von Konrad Lorenz lag wahrscheinlich darin, ganz parallel zu den Methoden der anatomischen Forschung die vergleichende Methode auch für das Verhalten salonfähig gemacht zu haben. Wie von den Begründern dieses Zweiges, O. Heinroth und K. Lorenz, praktiziert, kann man Verhaltensweisen ganz genau wie die körperlichen Merkmale dazu benutzen, Stammbäume zu rekonstruieren. Ein zweiter, genau umgekehrter Weg besteht darin, dass man versucht, die Ausbildung einer Verhaltensweise mit einem auf anderen, etwa körperlichen Merkmalen basierenden Stammbaum zur Deckung zu bringen, um so eine recht genaue Hypothese der historischen Entwicklung dieser Verhaltensweise zu gewinnen. Einmal also stammesgeschichtliche Forschung mit Hilfe von Verhalten, das andere Mal stammesgeschichtliche Verhaltensforschung. Vererbt oder tradiert? Der Umwelteinfluss beim Heranwachsen Stamps (1991) führt mehrere Gründe dafür an, warum die klassische Ethologie die evolutionären Richtungen fundiert und ergänzt. Im Zuge vieler Untersuchungen an hochsozialen Insekten, Vögeln oder Säugetieren erkannte man etwa, wie wichtig das elterliche Verhalten für Ausbildung und Weitergabe phänotypischer Merkmale sein kann. Der Phänotyp, also das Erscheinungsbild des Individuums, ist sowohl von dessen Genen als auch von der Art der Umwelt, in welcher es aufwächst, bestimmt; dabei kann man den Grad der Erblichkeit in einer bestimmten Umwelt angeben, nicht aber, welcher Anteil eines Merkmales generell ererbt bzw. erworben wäre (Lamprecht 1981; Exkurs 8). Bei vielen Tieren wird ebendiese Umwelt maßgeblich von den Eltern beeinflusst. Diese elterlichen Effekte (in der Literatur als »maternale Effekte« bezeichnet, obwohl auch die Väter maßgeblich dazu beitragen können, wenn sie sich an der Brutpflege beteiligen) können stark die Intensität und Richtung der Selektion und damit die evolutionären Veränderungen beeinflussen. So bestimmen etwa die Nahrungsqualität und -menge, welche Vogelnestlinge von ihren Eltern erhalten, deren spätere Körpergröße; Investitionsunterschiede beginnen schon bei der Do�ermenge und den Steroidhormonen, die ein Weibchen dem einzelnen Ei zuteilt. Überlebenswahrscheinlichkeiten der Nachkommen, aber auch deren »Persönlichkeit« können so manipuliert werden. Ein Elter mit begrenzten Ressourcen vermag beispielsweise entweder viele kleine oder wenige große Nachkommen großzuziehen. Auf diese Weise kann es vorkommen, dass Merkmale von Eltern mit denen ihrer Kinder korreliert sind, ohne dass dieses Merkmal direkt genetisch festgelegt wäre. Menschliche Fe�leibigkeit etwa, welche durch Ernährungstraditionen innerhalb der Familie entsteht, ist ein gutes Beispiel. Wie wir heute wissen, kann sehr vieles, was man früher der genetischen Disposition zuschrieb, durch soziale Tradition weitergegeben werden, angefangen von Nahrungspräferenzen bis zum Gesangsdialekt, den viele Singvögel im Herbst von älteren Männchen erlernen, und zur Rangstellung und Sozialisierung von Individuen, die in 86 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie vielen Affengesellscha�en über die Mu�er weitergegeben wird (Alcock 1996, McFarland 1989). Prinzipiell gilt natürlich, dass jegliches Merkmal eine genetische Basis aufweist. Dies gilt auch für das Merkmal Fe�leibigkeit, derer genetische Disponiertheit sogar zwischen Familien stark schwanken kann. Ein weiteres Beispiel ist die Partnerwahl. Es ist intuitiv klar, dass in Populationen von Tieren (einschließlich des Menschen) nicht völlig zufällig gepaart wird, sondern dass sich Partner nach gewissen Kriterien zusammenfinden, und sei es bloß deren räumliche Nähe. Je stabiler die daraus hervorgegangenen sozialen Bindungen, desto aufwändiger wird der vorhergehende Auswahlprozess sein müssen; darum sind etwa bei Langzeit-monogamen Vögeln ausgedehnte »Verlobungsperioden« nicht selten. Jedenfalls werden zukün�ige Partner getestet (Choudhury und Black 1993). Die freie Durchmischung innerhalb von Populationen durch Zufallspaarungen, wie von Populationsgenetikern als Basis für ihre Modelle gerne angenommen, findet kaum sta�. Dass sich die Partnerwahl an Vorbildern orientieren kann, ist bekannt. Wer zählt die Männer, die bei Partnerinnen landen, welche ihrer Mu�er ähnlich sind? Andererseits sollte direkter Inzest zumeist vermieden werden. Der daraus resultierende Ödipuskonflikt ist aus biologischer Sicht diskutierbar (Bischof 1985). Verglichen mit dem im Gehirn geprägten, als Vorbild abgelegten Schema vor allem der Geschwister muss der Partner gewisse Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten aufweisen, je nachdem, welcher Grad an Inzucht (oder deren Vermeidung) im Moment gerade opportun scheint; somit wäre diese Art der Partnerwahl eine Methode, die genetische Variabilität an die Variabilität der Umwelt anzupassen. Denn Inzucht muss nicht automatisch schlecht sein; es ist auch ein Weg, bewährte Genotypen zu erhalten, was besonders in stabilen Umwelten geraten wäre. Die Balance zwischen Inzucht und Auszucht wäre daher ein wichtiger Regelmechanismus des Individuums zur Erhöhung seiner Fitness. Der Nachweis dieser Hypothese der adaptiven Inzucht ist naturgemäß schwierig. Einschlägige Ergebnisse stammen bislang von Versuchen an Wachteln und Hühnern (Bateson 1983). Jedenfalls sind die elterlichen Manipulationsmöglichkeiten an den Nachkommen vielfältig und hängen sowohl vom jeweiligen Sozial- und Brutsystem, als auch vom Gleichgewicht der Krä�e im Interessenkonflikt zwischen Eltern und Nachkommen ab. Bei den Menschen ist dies der Bereich der Erziehung und der Generationenkonflikte. Es kann sogar so weit gehen, dass Eltern, meist natürlich die Mu�er, das Geschlechterverhältnis ihrer Nachkommen manipulieren, mit dem Effekt einer Erhöhung der eigenen Fitness. Wie von Clu�on-Brock u. a. (1982) gezeigt, produzieren rangniedere Rothirschkühe vor allem weibliche Nachkommen. Der Grund dafür scheint zu sein, dass Söhne dieser rangniederen Mü�er von Haus aus einen Startnachteil gegenüber den Söhnen ranghoher Mü�er aufweisen, der im schlechteren Zugang zu Ressourcen begründet ist; damit haben die Söhne der Rangtiefen nur geringe Chancen, je Platzhirsch zu werden, was aber Voraussetzung für eine erfolgreiche Reproduktion der Männchen wäre. Da bei den Rothirschen, wie bei vielen anderen Säugetieren, wenige Männchen alle Nachkommen zeugen, aber alle Weibchen ziemlich gleichmäßig reproduzieren, ist es also Das wiedererwachende Interesse am Verhalten und seinen Mechanismen 87 für rangtiefe Weibchen eine bessere Strategie, auf Nummer Sicher zu gehen und über ihre Töchter relativ wenige Enkel zu bekommen, als sich auf das Hasardspiel einzulassen, über Söhne möglicherweise Großmu�er vieler Enkel zu werden, wahrscheinlich aber gar keine Enkel zu bekommen. Für die ranghohen Weibchen dagegen liegen die Gewinnchancen genau in der umgekehrten Strategie. Das Geschlechterverhältnis der Nachkommen von Hirschkühen mit mi�lerem Rang ist folgerichtig ziemlich genau 1 : 1 Rangtiefe produzieren mehr Töchter, Ranghohe mehr Söhne. Der Mechanismus der Geschlechterselektion durch die Weibchen ist noch unklar. Da aber von der Befruchtungswahrscheinlichkeit her das Geschlechterverhältnis 1 : 1 sein sollte, ist wahrscheinlich ein selektiver Abtreibungsmechanismus im Spiel. Selbst das ist also keine menschliche Erfindung. Bei Ra�en konnte gezeigt werden, dass die Art des Umgangs mit den Säuglingen maßgeblich deren Verhalten als Erwachsene bestimmt; individuelle Eigenscha�en, wie Aktivitätsraten, Lernfähigkeit und Stressresistenz, werden bereits im Säuglingsalter beeinflusst. Beobachtungen an Rhesusaffen zeigten, dass auch komplexe Persönlichkeitsmerkmale, wie etwa Sozialisierbarkeit und Vertrauenswürdigkeit, von der Mu�er auf die Kinder über Generationen weitergegeben werden und so richtiggehende Familiencharakter-Traditionen entstehen; genetisch festgelegt ist daran wahrscheinlich sehr wenig, wie Transplantationsversuche von Babys zwischen verschiedenen Familien bei Affen zeigten: Kinder selbstbewusster Weibchen wuchsen unter Obhut nervöser Mü�er zu nervösen Jungtieren heran und umgekehrt (Hinde und Stevenson-Hinde 1986). Sogar die Lagerung des Fötus in der Gebärmu�er neben einem Bruder oder einer Schwester kann die Persönlichkeitsstruktur, das Verhalten der erwachsenen Individuen beeinflussen (vom Saal 1979). So sind weibliche Ra�en, die in utero neben männlichen Geschwistern lagerten, aggressiver als Schwestern weiblicher Föten. Bei Prairiemäusen wurde gezeigt, dass Weibchen, welche in utero neben männlichen Geschwistern lagen, weiter vom Geburtsort wegwanderten als weibliche Nachbarn weiblicher Föten; in diesem Sozialsystem, wie bei den meisten Säugetieren, wandern nämlich die jungen Männchen aus, während die Weibchen gewöhnlich nahe am Geburtsort bleiben. In diesen Fällen gehen Steroidhormone vom Bruder auf die Schwester über, vermännlichen deren Nervensystem und beeinflussen damit sogar das Auswanderungsverhalten. Exkurs 8: Die Unterscheidung zwischen »angeborenem« und »erworbenem« Verhalten ist sinnlos Erbkoordinationen, Triebhandlungen oder »angeborene Verhaltensweisen« sind Synonyme für jene kleinsten Bausteine des Verhaltens, die im Zentrum der Lorenz-Tinbergenschen Theorie stehen (Lorenz 1978). Hier stoßen wir aber sofort auf ein Problem. Denn außer jenen Merkmalen, die bereits bei der Geburt vorhanden sind, wie etwa Gliedmaßen, Geschlecht, Saugreflex usw., gibt es 88 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie genaugenommen keine »angeborenen« Merkmale, also auch keine »angeborenen« Verhaltensweisen. Wissenschaftlich verwendete man den Begriff »angeboren« aber eigentlich nicht im Zusammenhang mit der Geburt, sondern man meinte damit hochgradig erbliche Merkmale, die kaum während der Entwicklung durch Umweltbedingungen beeinflussbar sind (Lamprecht 1981). Was zunächst als rein semantisches Problem erscheint, hat aber inhaltliche Bedeutung. Einen scheinbar klaren Weg, den Einfluss der Umwelt und der Gene voneinander abzutrennen, stellen Kaspar-Hauser-Versuche dar (Lorenz 1966). Man lässt Tiere isoliert unter weitgehendem Reizentzug aufwachsen. Was von ihrem Verhalten noch übrigbleibt, sofern sie diesen, für soziale Tiere fallweise grausamen Versuch überhaupt überleben, sei »angeboren«. Weitgehender Reizentzug, hieß es eben. Um gültige Ergebnisse zu erbringen, sollte die Reizabschirmung aber vollständig sein. Und gerade das ist unmöglich. Es bleibt als Reizquelle immer noch der eigene Körper, die Begrenzung des Käfigs. Lebewesen können in der Regel nicht unter vollständigem Erfahrungsentzug aufgezogen werden, was die Aussagekraft solcher Versuche entsprechend mindert. Dies ist einer der Punkte, die bereits Lehrman (1953) an KasparHauserVersuchen kritisierte. Ein anderer schwerwiegender Kritikpunkt betrifft die mit Reizentzug verbundenen unspezifischen Veränderungen im Organismus, die dann natürlich zu Verhaltensänderungen führen, die aber mit der Frage, wie weit spezifische Verhaltensweisen erblich sind, wenig zu tun haben. Ratten kann man beispielsweise gar nicht isoliert aufziehen, da sie ohne Stimulierung der Ano-Genitalregion keinen Urin abgeben können und daran sterben. Versuche, Hunde unter völligem sozialem Reizentzug aufzuziehen, ergaben bedauernswerte Individuen mit autistischen Zügen, indifferent sogar gegenüber starken Schmerzreizen. Solche Tiere lassen natürlich keine Aussagen zum Thema »angeboren–erworben« zu. Besonders drastische Auswirkungen hat Reizentzug auf die Reifung des Gehirns. Das geht so weit, dass man durch visuellen Reizentzug in kritischen Phasen bei Säugetieren verhindern kann, dass sich der visuelle Kortex normal entwickelt (Blakemore und Cooper 1970). Aber auch Ratten aus reizarmen Laborhaltungen, deren Hirnrinde nach Versetzen in eine reich strukturierte Umgebung durch Synapsenbildung erheblich zunimmt (Shepherd 1983), zeigen, wie stark der Gesamtorganismus durch Reizentzug verändert werden kann. Dies heißt aber nicht, dass Kaspar-Hauser-Versuche wertlos sein müssen. So konnte J. Kear mit eben geschlüpften (also weitgehend erfahrungslosen) Entenküken zeigen, dass junge Bodenenten vor einer Kante zurückweichen, während Baumentenküken versuchen, über diese Kante runterzuspringen, also ein Verhalten ausführen, das bei diesen Nestflüchtern dazu dient, das Nest in einer Baumhöhle zu verlassen. Ein klarer Nachweis von tatsächlich weitgehend erblichem Verhalten mittels eines einfachen und unproblematischen KasparHauser-Versuchs. Heute neigt man zur Auffassung, die Unterscheidung »angeboren–erworben« sei ziemlich bedeutungslos, vor allem aber wissenschaftlich unergiebig (Hinde 1966, Eibl-Eibesfeldt 1975, 1999). Dies deswegen, weil sich alle Merkmale, auch Verhalten, in ständiger Interaktion zwischen Genen und Umwelt entwi- Das wiedererwachende Interesse am Verhalten und seinen Mechanismen 89 ckeln. Genexpression kann durch Umweltreize moduliert werden. Schließlich ist die Individualentwicklung ein dynamischer Prozess, und was im Augenblick vor sich geht, basiert auf dem Ergebnis der vorangegangenen Gen-UmweltInteraktion. So können geringe anfängliche Unterschiede in der Reizsituation von genetisch identischen Individuen über Rückkoppelungen mit ihrer Umwelt zu individuell recht unterschiedlichen Entwicklungen führen. Beispiele aus der Zwillingsforschung zeigen, dass, vorsichtig geschätzt, immerhin 30 % der Variabilität in der Individualentwicklung umweltbedingt sind. Ein anderes Beispiel betrifft die Lagerung von Föten in der Gebärmutter. Geringe Unterschiede in der diffundierenden Menge der für die Sexualisierung des Gehirns zuständigen Geschlechtshormone hängen davon ab, ob der Fötus neben einer Schwester oder einem Bruder gelagert war (vom Saal 1979). Das Verhalten des Individuums in der Geschlechtsreife kann dadurch erheblich beeinflußt werden. Es ist auf direktem Wege nicht messbar, wieviel in der Ausprägung eines Merkmals erblich, wieviel umweltbestimmt ist. Man kann aber mit Aufzucht- und Kreuzungsexperimenten ermitteln, wie groß der Grad an genetischer Determiniertheit eines Merkmals im Hinblick auf bestimmte Umweltbedingungen während seiner Ausbildung ist. Werden Verhaltensweisen innerartlich stereotyp gezeigt, dann liegt die Annahme nahe, dass es sich dabei um Verhaltensweisen handelt, die unter Regie eines weitgehend starren (d. h. gegen Reizeinflüsse abgeschotteten) Entwicklungsfahrplans heranreifen. Für diese invarianten Merkmale wird im allgemeinen Sprachgebrauch wohl auch in Zukunft der Begriff »angeboren« verwendet werden, obwohl der Terminus »erblich« treffender wäre. Es besteht die Gefahr, dass dieser Sprachgebrauch auch weiterhin das schwerwiegende Missverständnis nähren wird, ein Verhalten sei entweder »angeboren« oder »erworben« und so ein genetischer Determinismus perpetuiert wird, der in der Wissenschaft längst überwunden ist. Partnerwahl Früher nahm man an, dass Präferenzen für die Partnereigenscha�en genetisch festgelegt wären. Vielfach ist das auch so, zum Beispiel in Fällen, in denen Weibchen die Männchen aufgrund bestimmter Auslöser wählen. So werden bei Witwenvögeln, Pfauen und anderen Vögeln die Weibchen das Männchen mit den längsten und symmetrischsten Schwanzfedern bevorzugt (Møller 1988); bei anderen Tieren sind es Farbflecken, akustische Signale oder auffällige Bewegungsweisen, welche das Weibchen zu seiner Wahl veranlassen. Diese scheinbar so zwecklosen, ja dem Überleben hinderlichen Merkmale liefern den Weibchen wahrscheinlich wichtige Informationen über die genetische Qualität des Partners (Watson und Thornhill 1994). Partnerpräferenzen – und umgekehrt Inzes�abus – könnten aber auch durch Prägung, also Lernvorgänge in der Juvenilphase entstehen. Auch Weibchen, welche sich an Balzarenen ihren Paarungspartner aussuchen, können nicht direkt dessen Gene analysieren, sie verwenden dazu ganz bestimmte Reize. Natürlich ist nicht verlangt, dass Weibchen über ein Konzept von Genen verfügen, es genügt, wenn das Weibchen jenes Männchen wählt, das am besten seinen (meist nach oben offenen) Ansprüchen entspricht: das 90 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie den lautesten Balzruf von sich gibt, den größten roten Fleck auf der Brust trägt, die längsten (und/oder symmetrischsten) Schwanzfedern zeigt, am höchsten springt, am schnellsten läu� usw. Die Kriterien sind mannigfaltig, das Prinzip scheint immer gleich zu sein. Wäre ein in Hinblick auf das verlangte Kriterium noch »besseres« Männchen vorhanden als der momentan Auserkorene, dann würde das Weibchen den anderen vorziehen. Ohne Gegenmechanismus würde diese Art von Partnerwahl zur Eskalation des entsprechenden Merkmals führen. Ginge es nur nach der Vorliebe der Weibchen, so hä�en die armen Pfauenmännchen wahrscheinlich bald kilometerlange Schwanzfedern. Fressfeinde sorgen wohl dafür, dass die Produkte sexueller Selektion nicht völlig ausufern, sich irgendwo an einem Kompromiss zwischen individueller Überlebenswahrscheinlichkeit und sexueller A�raktivität einpendeln. Warum legen Weibchen aber letztlich Wert auf solch extravagante Merkmale, die das Überleben eher behindern als fördern? Wohl weil ihre Mü�er schon dieselbe Vorliebe ha�en und weil sie damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Söhne zu produzieren, welche dieses in bezug auf die weibliche Vorliebe wichtige Merkmal ebenfalls in reichlichem Maße ausbilden, daher für Weibchen a�raktiv sind und daher wahrscheinlich die Väter vieler Enkel sein können. Ihre Töchter werden wiederum eine deutliche Vorliebe für dieses Merkmal aufweisen und so dafür sorgen, dass der Selektionsdruck auf die Männchen nicht nachlässt. Andererseits kann sich ein Weibchen darauf verlassen, dass der Auserwählte relativ »gute Gene« besitzt (denn mehr bekommt sie im Extremfall der Balzarenasysteme von den Männchen nicht); das Männchen muss wohl guten Zugang zu Ressourcen haben und kann nicht stark parasitiert sein, sonst würde das entscheidende Merkmal nicht in dieser prächtigen Form ausgebildet sein; das Männchen überlebte in ausgezeichnetem Zustand, trotz der Belastung durch dieses Merkmal, das ja im täglichen Überlebenskampf ein Handicap darstellt. Das Weibchen kann sich also einigermaßen darauf verlassen, dass der Auserwählte, welcher schließlich das kostspieligste Merkmal am Platz mit sich herumschleppt, »gute Gene« bezüglich Überlebenstüchtigkeit und Fitness aufweist. Amoz Zahavi (1984, 1997) ha�e diese erst auf den zweiten Blick a�raktive Idee vom »Handicap-Prinzip« in der sexuellen Selektion und wurde anfangs dafür nicht ernst genommen. Heute gilt dieses Prinzip in weiterem Rahmen; Signale beispielsweise gelten nur dann als verlässlich, wenn damit erhebliche Kosten verbunden sind. Wenig erfreulich, wenn auch höchst einsichtig ist der dri�e aktuelle Grund, warum man sich plötzlich wieder intensiver für Verhaltensmechanismen interessiert: Immer mehr Arten sterben durch direkte oder indirekte Einwirkung des Menschen aus, durch unsere Hände, vor unseren Augen. O� würden schon einfache Maßnahmen, etwa die konsequente Reduktion der nächtlichen Beleuchtung von Stränden mit schlüpfenden Meeresschildkröten, genügen, um eine Gefährdung von Populationen zu vermindern. Die praktische Nutzung von Verhaltenswissen gesta�ete es, wieder eine Kolonie der beinahe ausgestorbenen Waldrappe an der Konrad Lorenz Forschungsstelle im oberösterreichischen Almtal anzusiedeln, die erste in Europa übri- Konrad Lorenz und die Soziobiologie 91 gens seit 350 Jahren. Das Wissen um Verhalten ist unverzichtbar bei jeglichem Wiederansiedlungsprojekt oder bei der Begleitung von natürlichen Widerbesiedlungen, etwa der Alpen durch Bären und Wölfe. Man muss aber natürlich wissen, also vorhersagen können, wie Tiere auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren, um die richtigen Maßnahmen treffen zu können. Und das ist heute notwendig, denn die Natur einfach sich selber überlassen bedeutet auf einer von Menschen überfluteten Welt mit großer Wahrscheinlichkeit den Untergang von Lebensräumen und Organismengemeinscha�en. Hier stehen die Verhaltenswissenscha�en, vor allem aber steht die Politik auf dem Prüfstand; die Qualität der Erkenntnisse und der daraus abgeleiteten Maßnahmen wird am Erfolg direkt messbar, denn aussterbende Arten sind unerbi�liche Messinstrumente. Konrad Lorenz und die Soziobiologie Der Darwinist Konrad Lorenz blieb bis zuletzt Gruppenselektionist, zumindest nach außen hin. Was er wirklich dachte, ist aus den vorhandenen Quellen schwierig zu rekonstruieren, für plakative Schwarz-Weiß-Malerei war er aber sicherlich zu klug. Die Basis für Ökoethologie und Soziobiologie hingegen ist strikte Individualselektion. Diese Unterscheidung ist bedeutend, weil es hier schlicht um den Mechanismus von evolutionären Veränderungen, um die Einheit der Selektion geht; im Fall der Gruppenselektion, zuletzt etwa von Wynne-Edwards (1962) vertreten, ist diese Einheit die Gruppe, im anderen Fall das Individuum. Das ist keineswegs ein geringfügiger Auffassungsunterschied, sondern die Ursache für kontrastierende Weltbilder, was sofort klar wird, wenn man sich die Konsequenzen überlegt (Exkurs 3). Wohl am sichtbarsten kommen die Unterschiede zum Ausdruck, versucht man zu erklären, wem bestimmte Verhaltensweisen nützen (außer etwa den Ethologen selber, die damit ihr Brot verdienen). Bei Lorenz, bei vielen anderen und selbst noch in neueren Schul-Lehrbüchern kann man vom »Arterhaltungswert« des Verhaltens lesen. Es wird also angenommen, dass sich Individuen einer Art (Population) so verhielten, dass das Überleben der Art (Population) optimiert würde. Das mag eine uns genehme, weil letztlich humanistische Ansicht sein, nur hat sie sich durchwegs als nicht zutreffend erwiesen. Ein wenig Wissenscha�spsychologie: Lorenz und das Individuum Der Gerechtigkeit halber scheint es hier notwendig, doch etwas genauer auf das Evolutionsbild von Konrad Lorenz einzugehen. Trotz seiner Vorliebe für die Floskel vom »Arterhaltungswert« gibt es Hinweise dafür, dass auch er die Individualselektion sah (Lorenz 1978). Er verstand allerdings Gruppen- und Individualselektion nicht als zwei gegensätzliche Paradigmen, sondern eher als die zwei Seiten derselben evolutionären Medaille. Auf lange Sicht gesehen mag er damit recht behalten. Das lässt sich auch durch seinen Briefverkehr mit Fachkollegen belegen, wo er über das Tamtam von Wilson, Dawkins und anderen die Meinung vertrat, dass diese »angeblich neuen« Theorien nichts anderes seien als eine überspitzt-anthropomorphe Formulierung des Evolutionsbildes der Altvorderen einschließlich seiner selbst. Die 92 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie Grundeinsicht in die Richtigkeit der Individualselektion war jedenfalls bei Lorenz vorhanden, wie das letzte Interview vor seinem Tod, veröffentlicht im Magazin »Geo« (1989), belegt: »Wir neigen dazu, wenn wir ein kompliziertes Verhaltenssystem sehen, wie zum Beispiel Rangordnung oder Eifersucht, zu glauben, dass das einen Sinn hat, für die Art günstig ist. Das muss aber nicht sein. Es kann sein, dass das nur für die Fortpflanzungsquote günstig, für die Art ungünstig ist« (meine Hervorhebung). Das ist meines Wissens der klarste Beleg dafür, dass Lorenz zumindest mit einem Bein auch im Lager der Individualselektionisten stand. Die Annahme, dass Lorenz die individualselektionistischen Ideen wieder fallenließ, da er in seinem Buch über die Ethologie der Graugans (Lorenz 1988) nur vom »Arterhaltungswert« schrieb, tri� daher nicht zu. Der Wert dieses Buches als Originalquelle ist zudem zweifelha�, da der Text von Mitarbeitern überarbeitet und mitgestaltet wurde, es ist daher unklar, wieviel darin als »original Lorenz« gelten kann. Warum Lorenz den Schri� zum konsequenten Individualselektionisten nicht vollzogen hat, bleibt unklar. Es gab vermutlich eine Reihe von Gründen für die Ablehnung der Soziobiologie durch Konrad Lorenz. Fachliches ist nicht von Persönlichem zu trennen. Überdies trat der Hauptexponent der Soziobiologie, Edward O. Wilson (1975), mit viel unnötigem Gepolter an. Er machte damals mit seinem Anspruch, weite Bereiche der Sozialwissenseha�en inklusive Ethologie, Soziologie, Psychologie und Anthropologie zu assimilieren (»kannibalisieren« war sein Originalausdruck), eine Synthese recht schwierig und mögliche Verbündete kopfscheu, so auch Lorenz. Wichtige Gründe für die Zurückweisung der Soziobiologie und der damit verbundenen Individualselektion durch Konrad Lorenz sind in seiner Persönlichkeitsstruktur zu orten. Zum Glück für die folgenden Überlegungen war bereits Vater Adolf Lorenz als bahnbrechender Facharzt der Orthopädie ein berühmter Mann, und die Familie Lorenz bestand aus vielfältig begabten Leuten. So übte Bruder Albert nicht nur den Beruf eines Arztes und Assistenten seines Vaters aus, sondern hinterließ mit dem Buch »Wenn der Vater mit dem Sohne« (Albert Lorenz 1965) eine Sammlung von Geschichten, die nicht nur amüsant zu lesen sind, sondern vor allem einen Eindruck von der Atmosphäre in jener Familie vermi�eln, in welcher der junge Konrad aufwuchs. Geld war offenbar kein Thema, es war meist reichlich vorhanden, und man benutzte es, sich innerhalb eines großbürgerlichen Lebensstils auch Luxuswünsche zu erfüllen. Gerade der Nachzügler Konrad wurde materiell verwöhnt. Dazu kam eine recht große Toleranz gegenüber den Maro�en der Familienmitglieder. Konrads Eigenart war es, die Familie mit allen möglichen, meist aber mit ziemlich unmöglichen Haustieren zu nerven. Wen wundert’s, dass der unter solchen Bedingungen Aufgewachsene Gespräche über Geld zumindest als uninteressant, wahrscheinlich als peinlich empfand. »Finanzminister« im Hause von Konrad Lorenz war denn auch seine Frau Gretl, die es selbst in der schwierigen Kriegs- und Nachkriegszeit scha�e, die Familie irgendwie über Wasser zu halten. Während seiner langen Zeit als Direktor am Max-Planck-Institut war es nicht nötig, um Geld zu streiten, es gab genügend davon. Es ist überliefert, dass Konrad Lorenz und die Soziobiologie 93 Lorenz sogar dazu neigte, das Institutsbudget zu niedrig anzusetzen, und mehr als einmal soll der MPG-Vertreter in der jährlichen Budgetsitzung den Oberassistenten von Lorenz in Buldern und im frühen Seewiesen, Wolfgang Schleidt, zur Seite genommen haben, um ihn besorgt zu fragen: »Sagen Sie mal, mit den geringen Mi�eln kann das doch wohl nicht gehen?« Lorenz soll bei solchen Sitzungen wie auch bei anderen ihm unangenehmen Gelegenheiten und Gesprächsthemen dazu geneigt haben, blitzschnell abzuschweifen, um begeistert und ausführlich die neuesten Gänsegeschichten zu erzählen. Diese geringe Bereitscha�, um Geld zu kämpfen, sollte sich ab seiner Emeritierung im Jahre 1973 gelegentlich recht spürbar auswirken, als seine Forschungsstä�en in Grünau und Altenberg nach Versiegen des Geldstromes aus Deutschland fortan von österreichischer Seite finanziert wurden, und das nicht allzu üppig. Lorenz ha�e in diesen Dingen den Behörden gegenüber offenbar wenig Durchsetzungskra�, seine Mitarbeiter li�en all die Jahre nicht selten unter würgenden Finanzproblemen. Dass man in Grünau selbst aus dem Verkauf von Hühnereiern der Forschungskasse Geld zuzuführen versuchte, ist leider kein Witz (sicherlich auch kein Ruhmesbla� für Österreich). In besonders prekären Situationen, wie z. B. 1980 und wieder 1984, als Bestrebungen im Gange waren, seine Projekte nicht mehr weiter zu finanzieren, ging aber auch der Altmeister auf die Barrikaden, wie der entsprechende Briefverkehr belegt. Ein anderer Aspekt der Persönlichkeit von Konrad Lorenz war eine noble Einstellung den Mitmenschen gegenüber. Man kann nur darüber spekulieren, wieviel auf seine Frau Gretl zurückzuführen ist, dass die klassischen Werte des Bürgertums, etwa Großzügigkeit und Toleranz, Partnertreue und eine altruistische Sicht der Gesellscha�, bei ihm offenbar einen sehr hohen Stellenwert ha�en. Sein gegen diesen humanistisch-konservativen Hintergrund o� unkonventionelles Au�reten bis ins hohe Alter und seine Vorliebe für praktische Scherze, die er offenbar von seiner Mu�er mitbekommen ha�e, stellen dazu keinen Gegensatz dar. Was hat das alles mit unserem Thema, der Individualselektion, zu tun? So wird verständlich, warum Lorenz geradezu verurteilt war, die Ökoethologie und noch viel mehr die Soziobiologie aus seinem Herzen, seinem Bauch heraus abzulehnen. Es lag ihm gar nicht, wie ein Buchhalter Kosten und Nutzen von Verhalten zu berechnen. Beinahe stereotyp nahm er daher lieber an, Verhalten sei angepasst, und das zum Besten der Art (wozu ohnehin Offensichtliches in Frage stellen?). Die Individualselektion hä�e ihn gezwungen anzuerkennen, dass Tiere wie Menschen eben nicht zum Besten der Art handeln, sondern durchwegs stockegoistisch sind. Nun war aber gerade Lorenz einer der Hauptvertreter dafür, dass Verhalten, dass soziale Systeme evoluiert sind. Er vertrat überzeugt die Darwinsche Auffassung, dass tierisches und menschliches Verhalten ein Kontinuum bilden, was schließlich in die Evolutionäre Erkenntnistheorie mündete und in weitreichende und weitblickende Forderungen, die Vergleichende Verhaltensforschung als Grundlagenwissenscha� der Psychologie einzuführen (Lorenz 1992). Lorenz hä�e also logischerweise auch anerkennen müssen, dass der Egoismus als Triebfeder menschlichen Handelns nicht Resultat einer pathologischen Entwicklung ist, etwa der »Verhausschweinung« 94 Die Verhaltensforschung im Wandel der Zeit: Wissenscha� und Ideologie des ursprünglich edel-altruistischen »Wildtyp«-Menschen, sondern das natürliche Vermächtnis unserer evolutionären Geschichte darstellt. Diese Uneinsichtigkeit führte zu entsprechenden Konsequenzen in seinem Werk. So sind die – vielen Lorenz-Jüngern ans Herz gewachsenen – »Acht Todsünden« (Lorenz 1973) geprägt vom Denkunterschied zwischen altem Gruppenselektionismus und neuer Individualselektion (Exkurs 3). Gegen den Hintergrund seiner eigenen Persönlichkeit das Individuum, ja schlimmer noch, dessen Egoismus als die Triebfeder der Evolution anzuerkennen musste Konrad Lorenz als kultiviertem Humanisten daher zuwider gewesen sein. Und hä�e er selber den Wandel zustande gebracht, was hä�e seine engste Vertraute Gretl dazu gesagt? So waren es wahrscheinlich nur vordergründig fachliche Hemmnisse, die es Lorenz unmöglich machten, als Speerspitze die neuen Richtungen anführte. Sta� dessen führte er letztlich einen Kampf gegen Windmühlen. Tatsächlich haben wohl alle wissenscha�lichen Auseinandersetzungen eine psychologische, persönliche Komponente. Im Fall Lorenz findet man zu diesem Thema in seinen Biographien (Festetics 1983, Wuketits 1990) wenig. Da ist das Lesen zwischen den Zeilen der Familienbiographie (Lorenz 1965) und mancher seiner eigenen Schri�en (Lorenz 1985) schon ergiebiger. Mit Norbert Bischof (1991) trat schließlich einer an, den o� kitschigen Cocktail der Lorenz-Klischees auszukippen, um uns »reinen Wein« über die Psyche des Altmeisters einzuschenken. Bischof war Assistent von Lorenz am Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie im süddeutschen Seewiesen. Aus dieser Nähe ist ein in vieler Hinsicht faszinierendes, wenn auch nicht immer unproblematisches oder gar objektives »Psychogramm« von Konrad Lorenz entstanden. Wozu überhaupt Psychogramme berühmter Persönlichkeiten? Ist der Blick in die Kinderstube und ins Schlafzimmer wirklich nötig, muss man über die Maro�en eines Anton Bruckner Bescheid wissen, das Sexualleben von Wolfgang Amadeus Mozart ausloten, um deren Werke verstehen und schätzen zu können? Bischof begründet diese Notwendigkeit mit der Themenauswahl im Werk von Lorenz, die zu erklären die Wissenscha�stheorie nicht mehr ausreiche, es müsse ein wissenscha�spsychologischer Ansatz gefunden werden. Gemeint sind jene dunklen, eugenischen Flecken auf dem Vorkriegswerk des sonst so geschätzten Verhaltensforschers (Föger und Taschwer 2001, Kotrschal u. a. 2001, Lorenz 1940). Wenn Bischofs Analyse gültig ist, dann sollte sie auch auf die Kontroversen, etwa mit der Soziobiologie, anwendbar sein, die mit rationalen Argumenten ebenfalls nicht ganz durchleuchtbar ist. Bischof setzt bei der Kindheitsgeschichte an, findet einen überaus erfolgreichen Vater, der Konrad zeitlebens die von ihm so gesuchte Anerkennung verweigerte, und eine angeblich gefühlskalte Mu�er; Zuwendung wird durch materielles Verwöhnen ersetzt. Vieles im Werk von Konrad Lorenz wird als autobiographisch gesehen, die Lorenzschen A�acken werden als Autoaggression diagnostiziert; so erklärt der Autor vor allem die eugenischen Äußerungen des jungen Lorenz. Na klar, ist man zu denken geneigt, ist es nicht so, dass das Werk aller schöpferisch Tätigen deren Interessen, letztlich also deren Werden, ihren eigenen persönlichen Hintergrund widerspiegelt? Konrad Lorenz und die Soziobiologie 95 Es wird kaum mehr zu klären sein, ob Bischof ins Schwarze getroffen, oder aber überinterpretiert hat. Sein Buch enthält noch einen weiteren, wissenscha�spsychologisch durchaus faszinierenden Aspekt: Unüberhörbar ist der gekränkte Unterton des Verfassers, von der Vaterfigur Lorenz immer auf Distanz gehalten worden zu sein. Hier wiederholt sich sein eigentliches Thema in berührender Weise, spiegelt sich der Lorenzsche Vater-Sohn-Konflikt auf der Ebene des Autors wider. Der charismatische Lorenz war offenbar für viele aus seiner Umgebung eine Identifikationsfigur. Wen wundert‘s, dass er diese Rolle nicht immer spielen wollte oder konnte? Was bleibt, ist die Gewissheit, dass die Persönlichkeitsstruktur von Wissenscha�lern stark ihr Tätigkeitsfeld, ihre Themenauswahl und Theorienneigung beeinflussen kann. Beispiele gäbe es viele. So führt Jürg Willi (1975) an, dass viele Analytiker davor zurückschrecken, Paartherapie durchzuführen, weil sie selber Eheprobleme hä�en. Wenn notwendigerweise subjektiven Menschen das Substrat der Wissenscha� darstellen, dann kann es wohl von Haus aus nicht weit her sein mit der Objektivität. Strenge Denkdisziplin ist daher erforderlich; Wissensverzicht kann der Preis für Objektivität in den Naturwissenscha�en sein. Bedauerlich zwar, aber im Moment sind keine Alternativen zur strengen naturwissenscha�lichen Methode in Sicht (Exkurs 5). 96 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Wissenschaft zwischen Ratio und Emotion Auch die »verkop�e« Wissenscha� wird von ganz normalen Menschen betrieben, mit all ihren Stärken und Unzulänglichkeiten, ihren Gefühlen und Maro�en. Wissenscha� ist daher kein idealer Prozess im heeren Olymp des Geistes, sondern ist gesellscha�lich eingebe�et und entsteht in Kommunikation, Kooperation und Konkurrenz zwischen Menschen. Und genauso wie die Politik ist Wissenscha� wohl die Kunst des Möglichen. Besser als jede theoretische Abhandlung zeigen wohl Schlaglichter auf die Arbeit an der Konrad Lorenz Forschungsstelle und ihre Entwicklung seit 1990, wie sich Wissenscha� entwickeln kann. Das Beispiel dieses Westentaschenbetriebes ist in vieler Hinsicht nicht repräsentativ, da jede Institution ihr eigenes, unverwechselbares Profil entwickelt; Zielsetzungen, Traditionen, handelnde Personen und gesellscha�lich-finanzielle Randbedingungen bedingen unterschiedliche Forschungsrealitäten und auch -ergebnisse. Trotzdem, die grundlegenden Verfahrensregeln, aus Tieren Theorien zu raffinieren sind überall dieselben. Um Wissenscha� zu verstehen, braucht es sicherlich die Sicht »von oben«, um sie aber begreifen zu können, den Zugang »von unten«. Daher sind die folgenden Geschichten von der Grünauer Forschungsstelle nicht nur Selbstzweck, sondern auch ein »bo�om-up« Versuch, den Destillationsprozess in der Wissenscha� von der Idee über die Daten zur Verfeinerung der Idee begrei�ar zu machen. Morgendämmerung im Almtal. Fröstelnd warten wir vor dem Institutsgebäude auf die Ankun� unserer Graugänse. Noch strei� kein Sonnenstrahl das Grau der umliegenden Berge. Nur die rosa Gipfel des Toten Gebirges im Talschluss im Süden deuten den nahen Sonnenaufgang an. Endlich fernes, heiseres Geschna�er. Schon umkreisen laut rufend die ersten Trupps das Haus, inspirieren misstrauisch den Landeplatz. Unsere Antwortrufe beruhigen, die ersten Vögel formen ihre Schwingen zu bremsenden Glocken. So fahren sie steil herunter und setzen rü�elnd vor unseren Füßen auf. Von einem unserer Gäste höre ich während dieses Schauspiels eine wohlbekannte Frage: »Was gibt´s an den Gänsen eigentlich noch zu forschen? Wurde von Professor Lorenz nicht ohnehin schon alles ausgeforscht?« Konrad Lorenz selbst betonte bis zuletzt immer wieder, dass die Arbeit erst begonnen hä�e. Es war ihm nicht mehr vergönnt, sein Hauptanliegen einer »Längsschni�studie«, d. h. Langzeituntersuchungen zur Entwicklung sozialen Verhaltens über Generationen hinweg in der Gänseschar selber durchzuführen. Seit 1973 wurde in Grünau, vorher in Seewiesen am Starnberger See von allen Gänsen protokolliert, aus welchen Familien sie stammen, mit wem sie sich verpaarten, wann, wo und mit welchem Erfolg sie brüteten, wie viele der Schlüpflinge großgezogen wurden, usw. Diese Protokolle wurden und werden auch nach dem Tod von Konrad Lorenz im Jahre 1989 fortgesetzt. Wir werten die bereits vorhandenen Daten Wissenscha� zwischen Ratio und Emotion 97 aus, um daraus Grunderkenntnisse über die Dynamik und Funktion der Sozialstrukturen der Graugänse zu gewinnen (z. B. Hemetsberger 2001). Gerade diese genaue, langfristige Kenntnis der Schar macht die Grünauer Gänse zu einem einzigartigen Modell für die tiersoziologische Forschung. Diese Graugänse gehen letztlich auf die Tiere im westfälischen Buldern der frühen 1950er Jahre zurück. Mit ihren über 50 Jahren zählt diese Schar zu den am längsten kontinuierlich unter Beobachtung stehenden freilebenden Tiergruppen der Welt. Konrad Lorenz hinterließ daher mehr als nur ein lebendes Erbe. Er begründete mit dem »Modell Graugans« eine wissenscha�liche Kulturtradition, welche behutsam verwaltet werden muss. Er selbst verglich den wissenscha�lichen Wert dieser Schar wiederholt mit der Bedeutung der Schimpansen Jane Goodalls im afrikanischen Gombe. Immer noch interessiert uns im Kern die Lorenzsche Grundfrage nach den Mechanismen sozialen Zusammenlebens. Und das nicht nur bei Gänsen, sondern bei allen in der Evolution entstandenen Lebenwesen. Aber Arbeit and den Lorenzschen Tieren, entlang einer zutie�s Lorenz´schen Grundfrage bedeutet natürlich nicht, dass die Verhaltensbiologie in Grünau ein lebendes Wissenscha�smuseum wäre, im Gegenteil. Neue Problemstellungen und neue methodische Möglichkeiten lassen uns immer tiefer in die Zusammenhänge zwischen dem Verhalten und den Hormonen von Individuen, ihrer Einbe�ung ins soziale Netz und ihrem (Fortpflanzungs-) Erfolg eindringen. Unser Ziel ist es, den Ursachenzusammenhängen von Verhalten und Sozialsystemen näherzukommen. Die Arbeit ist recht experimentell geworden, denn Experimente sind die einzige Möglichkeit Hypothesen über vermutete Zusammenhänge zu testen. Letztlich geht es uns um die Ergründung jener Verhaltens- und sozialer Mechanismen, welche bedingen, dass es in sozialen Gruppen meist wenige Individuen mit vielen Nachkommen gibt, während viele Gruppenmitglieder wenige bis gar keine Kopien ihrer eigenen Genkombinationen in eine nachfolgende Generation weitergeben. Da davon auszugehen ist, dass Erfolg und Misserfolg nicht rein zufällig eintreten, sondern etwas mit genotypisch-phänotypischer Eignung im Zusammenhang mit einer konkreten ökologischen und sozialen Umwelt zu tun haben, verschieben sich so die Gen(Allel)frequenzen bei sexuell vermehrenden Organismen von Generation zu Generation. Dieser Selektionsprozess über effiziente Vermehrung führt mit den genetischen Veränderungen meist auch zur Veränderung von Merkmalen. So verändern sich in einem Prozess der »Mikroevolution« lokale Populationen und schließlich auch Arten meist langsam, unmerklich, von Generation zu Generation. Die moderne Ethologie auch in Grünau, kümmert sich daher um jene Verhaltensmechanismen, die den evolutionären Wandel verursachen. Die Grundprinzipien des Soziallebens sind auch bei sehr verschiedenen Tierarten, buchstäblich von Maus bis Mensch, recht ähnlich. Wir arbeiten daher an den Graugänsen nicht eigentlich, weil uns deren Biologie interessiert, sondern weil sie sich hervorragend für diese Art der Grundlagenforschung eignen. Wir wollen nicht direkt den Menschen über die Gans erklären. Das wollte auch Konrad Lorenz nie, trotz manch einschlägiger Unterstellungen 98 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau von seiten seiner Gegner. Gänse sind nicht nur ein ebenso gutes Modell für die Erforschung sozialer Gesetzmäßigkeiten, wie manche Affen. Sie sind aufgrund ihrer stammesgeschichtlich größeren Distanz zu uns Menschen besser geeignet, diese Gesetzmäßigkeiten unbeeinflusst von einem gemeinsamen evolutionären Erbe zu untersuchen. Immer noch ist es die gleiche Gänseschar. Dazu kamen weitere »Modelle«, etwa die Kolkraben (Corvus corax) zu Beginn der 1990er Jahre und Waldrappe (Geronticus eremita) ab 1997. Und gerade die Arbeit mit dem Waldrapp, einem in Europa vor 400 Jahren ausgestorbenen, heute höchst gefährdeten Ibisvogel, zeigt, dass ethologische Grundlagenforschung höchst relevant für den Artenschutz sein kann. Eine ähnliche Mischung aus Kontinuität und Dynamik zeigen auch die Menschen an der Forschungsstelle. Mit dem Neubeginn, 1990 wurde mit meiner Person ein neuer örtlicher Leiter bestellt und Sepp Hemetsberger wurde als Gänse-erfahrener technischer Assistent und Ornithologe eingesetzt. Soweit zur Kontinuität. Da man zu zweit neben der Aufrechterhaltung des Grundbetriebs der Forschungsstelle wohl kaum zum Forschen käme, sind es die wechselnden studentischen Mitarbeiter für unsere Produktivität höchst wichtig. Bei Studenten österreichischer Universitäten und darüber hinaus, aus ganz Europa ist die Forschungsstelle eine gute Adresse, um drei- bis vierwöchige Projektpraktika durchzuführen. Immer wieder rekrutieren sich aus diesen Student Diplomanden, welche nach einer Vorbereitungsphase etwa sechs Monate Daten erheben und gewöhnlich in einem weiteren halben Jahr Ihre Diplomarbeit abschließen. Dazu kommen noch einige wenige Dissertanten, die etwa drei Jahre benötigen, um ihr Projekt durchzuführen. Die meisten dieser 6 bis 12 Studenten, die ständig mit uns arbeiten, wohnen direkt an der Forschungsstelle und übernehmen auch wichtige Aufgaben in der Verwaltung, bei der Versorgung der Tiere, usw. Länger anwesenden Studenten werden gewöhnlich aus Forschungsprojektgeldern unterstützt. Seit Harry Essler als erster Dissertant einer kleinen, aber feinen Serie von Doktoranden 1991 begann, Schwimmpfade von Fischen zu untersuchen, arbeiteten mit uns viele Studenten, deren detaillierte Aufzählung diesen Rahmen sprengen würde. Der Standard unserer Arbeit widerspiegelt sich u. a. an den guten Post-doc Positionen (Anschlussforschung an ein Doktorat als Vorraussetzung, eine permanente Stelle zu bekommen), auf welche unsere promovierten Mitarbeiter wechselten, so sie es wollten. Nicht alle wollen. Ausgerechnet Dr. Essler, unser erster Dissertant, ist heute Bio-Bauer in Frankreich. Als Student ha�e ich Lorenz mehr verehrt denn verstanden und befand mich damit wohl in guter Gesellscha�. Denn Idole sitzen vor allem im Herzen. Ein bekennender Lorenzschüler und -verehrer flüsterte mir einst mit ehrfürchtigem Schaudern zu, es hä�e keinen Sinn, sich Konrad als Vorbild zu nehmen, denn dafür taugten eben nur Menschen und nicht geniale Halbgö�er wie, seiner Meinung nach, Lorenz wohl einer gewesen war. Obwohl ziemlich übertrieben steckt darin doch ein Körnchen Wahrheit. Natürlich war der Lorenzsche Rock anfangs um ein paar Nummern zu groß und entsprach wohl auch in seinem Schni� nicht mehr dem heutigen Geschmack. Wie sollte Wissenscha� zwischen Ratio und Emotion 99 man da je hineinwachsen? Doch die Zeit wirkt, man gewöhnt sich daran und ersetzt diesen Rock durch eigene, besser passende Kleidungsstücke. Nicht daran gewöhnen kann ich mich, von wohlmeinenden Zeitgenossen als ›Nachfolger von Konrad Lorenz‹ tituliert zu werden; wir entwickelten unser eigenes Profil, Lorenz ist Geschichte. Mit Ausnahme einiger Telefonate ha�e ich nie persönlichen Kontakt mit ihm. Darum bin ich auch von jenem VaterSohn-Verhältnis frei, in welchem der charismatische Lehrer und Mensch viele seiner Schüler zu prägen schien. Frei sowohl von einer übergroßen Verehrung und damit auch von den zugehörigen Konflikten (vgl. Bischof 1991). Die Grünauer Graugansschar ist quasi lebendes Erbe von Konrad Lorenz, ein sensibler Nachlass von großem wissenscha�lichen Potential. Von Anfang an galt es, die spezifischen Stärken dieses Modells optimal zu nutzen. So hä�e es etwa wenig Sinn, in Konkurrenz mit großangelegten Freilandstudien treten zu wollen (vgl. Cooke u. a. 1995). Dafür stehen uns zu wenige Individuen zur Verfügung. Unser großer Vorteil besteht darin, dass wir den sozialen Hintergrund jeder einzelnen Gans genau kennen und unsere Untersuchungen zu dem Mechanismen und Funktionen des Soziallebens auf der Ebene des Individuums durchführen können. Denn die Individuen sind die Akteure auf der Bühne der Evolution. Mit modernsten Methoden wurde und wird in miteinander vernetzten Projekten untersucht, welche Vor- und Nachteile etwa die für Graugänse typischen engen Paar-und Familienbindungen mit sich bringen, welche Bedeutung das Schar- und Familienleben für die Individuen hat. Die hormonalen Grundlagen für soziales und sexuelles Verhalten und die Rückwirkung von Sozialverhalten auf die Ausschü�ung von Hormonen, die Auswirkungen mü�erlicher Manipulation der Persönlichkeiten der Nachkommen über den Androgengehalt der Eido�er, die Auswirkungen früher Erfahrungen auf die spätere Partnerwahl, die Mechanismen der Partnerwahl, der Einfluss der Partner auf den Lebensfortpflanzungserfolg der Weibchen und anderes mehr stehen auf unserem Programm. Wissenscha�liche Arbeit lässt sich nur begrenzt planen. In vieler Hinsicht ist der Weg wichtiger ist als das Ziel, schon deswegen, weil der Zufall o� unerwartete Einsichten bringt. So war es, um eines von vielen Beispielen zu nennen, pures Spiel mit Daten, welches Katharina Hirschenhauser entdecken ließ, dass der Reproduktionserfolg eines Paares stark mit dessen Gleichklang im männlichen Geschlechtshormon, Testosteron, zusammenhängt (Hirschenhauser u. a. 1999b). Es ist also nicht immer vorhersagbar, auf welche interessanten Phänomene man stoßen wird, wenn man sich auf den Weg begibt. Vorhersagbar ist aber, dass uns die Fragen sicherlich nicht ausgehen werden. Natürlich wird methodisch ganz anders gearbeitet als früher. Verhalten muss quantifiziert werden, um reproduzierbare Ergebnisse zu bringen. Das war aber eigentlich auch schon zu Zeiten von Konrad Lorenz so. Woher also kam die ebenso wohlbekannte wie schrullige Lorenzsche Kritik an den »Quantifizierern«? Was ha�e er gegen jene Wissenscha�ler, die nicht nur ihrer Gestaltwahrnehmung vertrauen wollen, sondern so profane Instrumente wie Maßband, Stoppuhr und Zählgerät einsetzen? Dass Konrad Lorenz gene- 100 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau rell gegen das Quantifizieren gewesen wäre, ist nachweislich falsch. Wogegen er allerdings au�rat war Messen und Zählen ohne profunde Kenntnis der zu untersuchenden Tiere. Und im achten Jahrzehnt seines Lebens schrieb er, der wiederholt (beinahe stolz) erwähnt ha�e, in seinem Leben noch nie eine Arbeit mit einer Kurve publiziert zu haben, zwischen 1978 und 1980 in einigen Briefen an seinen Freund Niko Tinbergen in freudig-ironischem Unterton, dass er nun erstmals selber unter die »Quantifizierer« gegangen sei, indem er die Zahl der aggressiven Interaktionen zwischen seinen Hal�erfischen im Aquarium protokolliere (Lorenz u. a. 1998). Aber auch das stimmte nicht ganz, ha�e er doch bereits 20 Jahre vorher in Seewiesen Artinteraktionen von tropischen Rifffischen quantifiziert, wenn auch nie veröffentlicht. Und natürlich erschöpfen sich die methodischen Neuerungen seit Konrad Lorenz nicht im Quantifizieren. Der Einsatz von computergestützter Datenaufnahme und von Videotechnik ermöglicht genauere und dichtere Datennahme als bisher. Von unsere Kollegen vom Biochemischen Institut der Veterinärmedizinischen Universität Wien entwickelte Analysemethoden gesta�en es, selbst geringste Spuren von Hormonstoffwechselprodukten aus Kot oder Harn genau zu bestimmen. Dies ermöglicht uns seit Jahren, die Beziehung zwischen Verhalten und Hormonen »nicht invasiv«, zu bestimmen, also ohne Blutprobe auszukommen. Das schont nicht nur die Tiere und deren vertrauensvolle Beziehung zu uns, sondern schließt auch aus, dass der Stress des Gefangen-werdens die interessierenden Hormonwerte verändert. Andere methodische Errungenscha�en der letzten Jahre betreffen genetische Geschlechts- und Verwandtscha�sbestimmungen, Weiterentwicklungen bei vollautomatischen Beobachtungsmethoden, usw. In der Wissenscha� ist Stillstand Rückschri�. Die Gänse, Raben und Waldrappe mögen dieselben bleiben, die Blickwinkel und Fragestellungen aber entwickeln sich dynamisch weiter. Wie es zur Grünauer Konrad Lorenz Forschungsstelle kam und warum sie immer noch existiert Die Forschungsstelle für Ethologie in Grünau wäre im Jahre 1989, dem Todesjahr von Konrad Lorenz beinahe den Entropietod gestorben: Geldhahn zu und auslaufen lassen, so die klischeeha� typisch österreichische Strategie. Aber dazu kam es schließlich doch nicht. Die Fortführung der Arbeit über seinen Tod hinaus war war eines der dringendsten, testamentarisch festgelegten Anliegen von Konrad Lorenz: »Nun wünsche ich mit an allererster Stelle, dass die Longitudinalstudien an Gänsen fortgeführt werden. Die sind imstande, Antworten auf Fragen zu geben, die von vielen Leuten aufgeworfen wurden, …« (Zitat aus einer Tonbandaufnahme von Bernd Lötsch am 26. März 1988 in Altenberg, im Wohnhaus von Lorenz). Heute entsprechen wir diesem Lorenz´schen Wunsch schon allein deswegen, weil diese Daten wichtige Grundlage für alle unsere Forschungen an den Gänsen sind. Mehrfach verdankt die Konrad Lorenz Forschungsstelle für Ethologie in Grünau ihre Existenz dem Zusammenwirken glücklicher Umstände. Am Anfang stand ein Blitzstart. Als Lorenz 1973, zum Zeitpunkt der Nobelpreisverleihung auf dem Höhepunkt seines internationalen Ruhmes als Direktor des Seewiesner Wie es zur Grünauer Konrad Lorenz Forschungsstelle kam 101 Instituts für Verhaltensphysiologie der Max-Planck-Gesellscha� emeritierte, war er gerade 70 Jahre alt, also für einen notorisch Wissensdurstigen gerade im besten Forscheralter. Rasch ha�e er Wolfgang Wickler, seinem Nachfolger (nun ebenfalls bereits emeritiert) Platz zu machen. Die Max-Planck-Gesellscha� war aber bereit, ihn noch für einige Zeit zu unterstützen. Nun forschte Lorenz aber nicht an allerlei Labor-Allerweltsgetier, sondern an freilebenden Gänsen. Die Herbergssuche gestaltete sich daher zunächst schwierig. Es begab sich, dass der österreichische Autodidakt und Lorenz-Epigone O�o König 1973 als Gast der Herzog-vonCumberland Sti�ung im Almtal an Raufußhühnern forschte. Dieser erfuhr vom Lorenzschen Anliegen und schaltete den damaligen Forstverwalter der Sti�ung, Karl Hüthmayr ein, worauf es plötzlich wie »am Schnürchen« ging. Hüthmayr erlangte innerhalb von Stunden das Einverständnis des Eigentümers, Ernst August, Prinz von Hannover. Der Entschlusskra� dieser beiden Männer verdanken wir daher letztlich die Existenz der Forschungsstelle. Dass 1970 ebenfalls durch Hüthmayr der große Cumberland-Wildpark im Almtal errichtet wurde, mag ein gewichtiger Grund für die Einladung von Seiten der Sti�ung gewesen sein. Man erho�e sich zu Recht Öffentlichkeitswirksamkeit durch den Nobelpreisträger. Dieser Effekt hält weiter an. Immer noch ist für die mediale Vermi�lung unserer Arbeit der Name Konrad Lorenz ein hervorragender »Trade mark«. Grünau und das Almtal strahlen so vor allem via Bildschirm über ganz Europa, bis in die USA aus. Die Zeit drängte. Es wurde rasch ein schönes, geräumiges altes ForstMühlen- und Flößergebäude am Ufer der Alm gelegen, umgeben von gänsegerechten Wiesen adaptiert. Südlich des Wildparkgeländes und abseits vom Besucherstrom wurden Teichanlagen und drei kleine Hü�en zur Handaufzucht von Gänsen geschaffen. Bis heute trägt das Gebiet die zunächst scherzha�e Lorenzsche Bezeichnung »Oberganslbach«. Da für die freilebenden Gänse als jagdbares Wild die Möglichkeit bestand, relativ weit umherzustreifen, wurden Gespräche mit Jagdpächtern geführt, um sie zu bi�en, nicht auf die Gänse zu schießen. Dankenswerterweise wurde diese Abmachung nie gebrochen. Nach kurzer Zeit allerdings wählten die Gänse die Wasserfläche des Almsees zum Übernachten und als Ort für die Mauser und nicht, wie beabsichtigt, die näheren, aber kleineren Teichanlagen im Wildpark. Dies führte zu gelegentlichen Konflikten mit den Seepächtern, dem oberösterreichischen Landesfischereiverein, zumal die Zahl der Gänse bis 1990 auf 220 angestiegen war. Durch eine Abgabe von Tieren sank der Bestand bis 1992 auf 120 und schwankt seitdem um dieses absolut notwendige Minimum, um an der Gruppe weiterhin sinnvolle Sozialforschung betreiben zu können. Auch mit den Fischern gab es kollegiale Gespräche. Es setzte sich die Einsicht durch, dass Graugänse keine Fische fressen und auch Bedenken, dass die Tiere den blauen, keuschen Alpensee über Gebühr verschmutzen würden, konnten ausgeräumt werden. Dank der Einsicht der Fischer und Jäger herrscht Burgfriede im urigen Almtal. Im Sommer 1973 konnte die Übersiedlung der Gänse beginnen. Ganz einfach war es allerdings nicht, denn wie hindert man diese flugfähigen Gewohnheitstiere daran, sofort aus dem ungewohnten Amtal ins vertraute 102 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Seewiesen zurückzukehren? Um eine möglichst schonende Eingewöhnung zu ermöglichen, wurden die Schwungfedern nicht beschni�en, manche wurden allerdings mausernd und daher flugunfähig ins Almtal gebracht. Außerdem wurden sie als soziale Clans und in Begleitung vertrauter Menschen übersiedelt. Trotzdem blieben von den etwa 100 Übersiedlungskandidaten, die in ihren Transportkisten o� mehrmals nach Grünau gebracht wurden, nur etwa 70 Vögel. Und selbst die bildeten in den ersten Jahren eine recht instabile Schar. Manche Paare flogen weiterhin zum Brüten an die Bayrischen Voralpenseen. Zwei Paare, Schwarzkopf und Airotsohn, sowie Carola und Egelb taten dies bis ins hohe Alter von mehr als 20 Jahren bis in die späten 1990er Jahre und kamen regelmäßig im Herbst mit ihren flüggen Jungen ins Almtal zurück. Zumindest einige dieser Nachkommen integrierten sich in die Schar. Störungen (z. B. Drachenflieger) konnten in den ersten Jahren die Gänse aus dem Tal treiben und weit über das Land versprengen. Erst allmählich, durch regelmäßige Handaufzucht und intensive Betreuung entstand eine stabile Schar mit ihren angepassten Traditionen. Um den Konzeptrahmen seiner Fischarbeit einzugrenzen, begann ich im Februar 1992, die Lorenzsche Korrespondenz mit Fachkollegen aus den Jahren 1974 bis 1989 nach Stellen abzusuchen, in welchen er sich auf seine Arbeit im privaten Riff, seinem Altenberg Aquarium bezieht (Lorenz u. a. 1998). Dabei fiel auf, dass er in den meisten Briefen seine grünauer Forschungsstelle mit Begeisterung erwähnt, sogar noch häufiger als sein Altenberger Aquarium. Ohne Übertreibung kann man daher behaupten, dass Grünau mit seinen Gänsen, Bibern und Wildschweinen das wichtigste Anliegen von Konrad Lorenz war. Leider aber war das wohl konstanteste Merkmal dieser Forschungsstelle ihre wiederkehrenden Finanzierungskrisen. Dabei begann alles recht solide, solange immerhin bis 1980 die Max-Planck-Gesellscha� für einen Gu�eil der Kosten au�am. Danach sollten vereinbarungsgemäß österreichische Stellen übernehmen, womit ein unwürdiges Schlamassel begann. Eher lustlos übernahm die Österreichische Akademie der Wissenscha�en auf Bi�e des Wissenscha�sministeriums, bzw. der damaligen Ministerin Herta Firnberg. Halbjährliche Berichts- und Antragspflichten begleiteten fortan Konrad Lorenz und seine Mitarbeiter. Beschämend, dass man nicht imstande war, die Arbeit des insgesamt dri�en und vorläufig letzten Nobelpreisträger Österreichs für Medizin ohne viel Au�ebens mit einem ohnehin bescheidenen Betrag zu unterstützen. Am 26. Februar 1999 starb Konrad Lorenz. Das offizielle Österreich zog es vor, ihn zeitlebens außerhalb seiner Grenzen und auf Kosten anderer wirken zu lassen. So etwa war es ihm nicht vergönnt, 1950 eine Professur an der Universität Graz anzutreten. Erst im reifen Seniorenalter und nobelpreisbekränzt konnte Lorenz in Österreich Fuß fassen. Und dies nicht nur streng wissenscha�lich. Seine natürlich Autorität gepaart mit der Einsicht, es sei so einiges faul im Staate Österreich ließ den angeblich »notorisch unpolitischen« Lorenz (vgl. Föger und Taschwer 2001, Kotrschal u. a. 2001) zum öffentlichkeitswirksamen Umweltgewissen dieses Staates werden. Er ha�e maßgeblichen Anteil am negativen Ausgang der Volksabstimmung zur Ihr Sozialleben macht Gänse zu den Primaten unter den Vögeln 103 Inbetriebnahme des Kernkra�werkes Zwentendorf. Und er war auch daran beteiligt, die Zerstörung der letzten Reste der Donauauen in Österreich durch den Bau eines Kra�werks bei Hainburg hintanzuhalten. Ihr Sozialleben macht Gänse zu den Primaten unter den Vögeln Die Grünauer Graugänse waren bereits Hauptdarsteller in zwei, auch für Laien gut lesbare Bücher: Dem von Lorenz gemeinsam mit dem Ehepaar Kalas verfassten »Jahr der Graugans« (1979), sowie dem Verhaltensinventar der Graugans »Hier bin ich – wo bist du?«, dem letzten größeren Werk von Konrad Lorenz, entstanden unter Beteiligung von Michael Martys und Angelika Tipler (1988). Faszinierend ihr bisher wenig verstandenes, kompliziertes Zusammenleben, welches sogar uns Menschen als notorische »Sozialtiere« staunen lässt und so manche Ähnlichkeit mit Affengesellscha�en aufweist (Exkurs 9). Letztlich geht es darum, wie es manche Individuen schaffen, viele Nachkommen zu hinterlassen, viele andere dagegen nicht. Die ins Almtal übersiedelten Gänse lebten sich gut ein und bilden seitdem eine Schar von 120–150 Tieren. Die Schar enthält ständig etwa 45 Paare, deren Partnerscha� meist über Jahre besteht. Die etwa 50 Nichtverpaarten setzen sich aus unter zweijährigen Jungvögeln und aus verwitweten, älteren Gänsen zusammen. Einen Überblick über das komplexe Sozialleben gibt Exkurs 9. Unser bisher ältester Ganter verschwand mit 27 Jahren im Herbst 1993. Somit sind Längsschni�untersuchungen an diesen Tieren langfristige Unternehmen. Wie alt Graugänse maximal werden können, weiß niemand so genau. In Gefangenscha� erreichen zumindest Hausgänse 60 Jahre, aber unter den rauhen Almtaler Bedingungen sind 20 Jahre bereits ein stolzes Alter. Lorenz pflegte Fragen nach dem Maximalalter von Gänsen gelegentlich mit einer Geschichte zu beantworten. So hä�e er eine nachweislich über 30 jährige Gans übernommen und nach weiteren 30 Jahren in seiner Pflege hä�e sie der Fuchs gefressen. Nun sei er selbst schon so alt geworden, hä�e zeitlebens mit Gänsen gearbeitet und könne nicht einmal sagen, wie alt diese würden … Der Jahresgang der Graugänse Die Grünauer Graugansschar zeigt ein ausgeprägtes tägliches und saisonales Raum-Zeit-Muster (Lorenz u. a. 1979; Exkurs 9). Die Tiere übernachten auf der vor hungrigen Füchsen Schutz bietenden offenen Wasserflächen des Almsees. Nur im Winter ziehen Teile der Schar die nahen Wildpark-Teiche vor. In der Morgendämmerung streichen die Gänse etwa 8 km nördlich, zur Fu�erstelle am Auingerhof, dem Sitz der Forschungsstelle. Untertags wechselt die Schar meist in den nahen Cumberland-Wildpark und stellt sich dort recht bereitwillig den Besuchern, weil diese ihren Tribut in Form von Erdnüssen entrichten. Am späten Nachmi�ag geht´s an den Auinger, in der späten Abenddämmerung kehrt die Schar wieder an den Almsee zurück. Zur Zugzeit, im Spätherbst, werden die Gänse zuweilen unruhig. In Keilformation fliegen sie höher als sonst und verlassen gelegentlich auch für einen kurzen Ausflug das Tal, um sich am Abend doch wieder am Fu�erplatz einzufinden. Die saisonale Zugunruhe ist genetisch bedingt (Berthold 1993), 104 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau wird von einer inneren Jahreszeituhr gesteuert, welche das Fressverhalten der Gänse so steuert, dass sie Anfang November am fe�esten sind. Was evolutionär als Treibstoff für den Zug vorgesehen war, ließ Gänse bald zu einer kulinarischen Herbstspezialität werden. Die Zugrouten dagegen werden in Form sozialer Traditionen weitergegeben. Unsere Gänse lernten nie von ihren Eltern, wohin sie ziehen sollen und bleiben daher im Almtal. Die kurzen Wintertage verbringt die Schar ruhig und friedlich an der Forschungsstelle. Gelegentliche Angriffe überwinternder Adler halten sie allerdings auf Trab. Bereits im Februar bringen erste Föhntage Frühlingsahnen. Die Gänse geraten in Unruhe: Nun ist es Zeit, um Partner zu werben, mit Rivalen zu streiten und schließlich frühestens im zweiten Lebensjahr eine Paarbindung einzugehen, welche ein ganzes, langes Gänseleben anhalten kann. Aber nicht muss. Denn einem Partner kann etwas zustoßen und etwa 20% der Paare trennen sich durch »Scheidung«, im Schni� im dri�en Jahr der Partnerscha�. März-April fällt die Schar auseinander, die Paare sondern sich zum Brüten ab, denn Graugänse tun dies im Gegensatz zu anderen Gänsearbeiten einzeln, bzw. nur in sehr weitläufigen Gruppen, nicht aber in dichten Brutkolonien (Exkurs 9). Erst nach der Großgefiedermauser, wenn die erwachsenen Tiere und die Jungen des Jahres flügge sind, kommt es zur Wiedervereinigung der Schar, die dann bis zum nächsten Frühjahr zusammenhält. Gänse unter Erfolgsdruck Wie unsere Daten zeigen, ist der Fortpflanzungserfolg tatsächlich sehr ungleichmäßig über die Schar verteilt (Exkurs 9). Dies gilt auch für andere soziale Tiere. In komplexen Kastenstaaten mancher Insekten reproduziert gar nur mehr ein einziges Individuum. Aber es gibt auch bei den Säugetieren ähnliche Beispiele. Bei Wölfen oder afrikanischen Wildhunden etwa hat in einer Gruppe meist nur das ranghöchste Paar Nachwuchs. Noch komplizierter geht es bei den Nacktmullen zu, hochsozialen, ständig unterirdisch lebenden Nagern, deren Clans in Kasten, ähnlich wie Insektenstaaten, organisiert sind. Nur ein einziges Weibchen reproduziert, die anderen kümmern sich arbeitsteilig um Nachwuchs und Haushalt. Wer mehr Nachkommen als die anderen hinterlässt, ist damit erfolgreicher, Kopien der eigenen Genkombinationen in die nächste Generation zu bringen; quasi als Nebeneffekt beeinflusst solch ein Individuum auch stärker als andere den Gang der Evolution. Was Wunder also, dass sich die reproduktive Konkurrenz über hunderte von Millionen Jahren in allen sexuell reproduzierenden Populationen zu Individuen führte, die unter dem Diktat des »reproduktiven Imperativs« leben. Wenn also Individuen mehr oder weniger Nachkommen hinterlassen, als andere, dann ist es für Verhaltensbiologen deswegen eine Herausforderung, die Gründe dafür zu ergründen, weil sie sich damit letztlich den Mechanismen annähern, welche Evolution bewirken. Sinda war mit 30 flüggen Jungen unsere bislang erfolgreichste Gans (s. u.). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2002) folgten daraus immerhin 61 Enkel, davon 14 alleine vom Sohn Claro, 24 Urenkel und 44 Ururenkel. Aber die Zahl der Ur- und Ururenkel wird sicherlich noch steigen. Damit bestimmt Ihr Sozialleben macht Gänse zu den Primaten unter den Vögeln 105 der »Sinda-Clan« recht maßgeblich soziales Geschehen und Genbestand der Schar. Beinahe 50 % der gegenwärtig lebenden Scharmitglieder stammen von Sinda ab. Die Saga von Sinda und Blasius Eine wahrha� herzzerbrechende Geschichte im Stil einer TV »Soap opera« ist die von Sinda und Blasius. Gerade diese Beziehungsgeschichte aber zeigt die durchaus typischen Verwicklungen gänsischen Zusammenlebens. Sinda, deren leiblichen Eltern der Ganter Alfred und die Gans Blau-blau-grün waren, schlüp�e am 15. April 1974 in einem Grünauer Brutapparat und wurde von Sybille Schäfer handaufgezogen. Sinda war also Grünauerin der ersten Generation. Sie wuchs mit drei Schwestern, Jule, Alma und Alfra, auf, die aber alle bereits 1975 und 1976 durch Füchse umkamen. Blasius, dessen leibliche Eltern Adonis und Rosa-weiß-grün-grün waren, schlüp�e ein Jahr früher als Sinda im Frühjahr 1973 und wurde ebenfalls von Sybille, allerdings in Seewiesen, aufgezogen. Am 12. Juni 1973 übersiedelte diese HandaufzuchtFamilie nach Grünau. Ihr gehörten neben Blasius auch noch die gerade flügge gewordenen Greif, Nikita, Muck Yksy, Selma und als weiteres Männchen Rotblau-gelb an, das aber bereits kurz nach der Übersiedlung starb. Aus dieser Geschwisterrunde lebten Muck und Blasius bis 1995, Nikita verunglückte im Winter 1992. Alle der alten Brüder waren in ihren letzten Jahren ihres Lebens Witwer. Der junge Blasius verpaarte sich zunächst mit der Sinda-Schwester Jule, die aber bei ihrem ersten Brutversuch am Almsee am 1. April 1976 von einem Fuchs getötet wurde. Sinda und Blasius sind seit dem 28. Juni 1976 verpaart. Von 1977 bis 1991 gab es mit diesem Paar 14 Bruten, die insgesamt 24 flügge Junggänse erbrachten. Die kurzen Zwischenspiele der jungen Sinda mit den Gantern Florian und Ado, sowie die ständigen Abwehrkämpfe von Blasius, der zwar am Boden leicht zu besiegen war, aber doch eine gewisse Überlegenheit in Lu�kämpfen entwickelte, sind bei Lorenz (1988) nachzulesen. Hier nun die wahrha� tragische Fortsetzung dieser Geschichte. Bereits vor 1990 fiel auf, dass Blasius Sinda gegen die Avancen meist jüngerer Ganter nicht mehr erfolgreich abschirmen konnte. Sinda war offensichtlich eine recht a�raktive Gans, ebenso wie die der Anzahl ihrer Verehrer zeigte, andere erfahrene Gänse, wie etwa Dornröserl oder Lucia. Als Menschen wissen wir natürlich nicht, warum manche, aber bei weitem nicht alle Gänse für Ganter im besten Alter anziehender wirken als andere, aber alle der erwähnten Weibchen zeichneten sich durch einen überdurchschni�lich guten Bruterfolg in der Vergangenheit aus. Trotz der Unterlegenheit von Blasius ha�e die Partnerscha� Bestand. Es war Sinda, die jahrelang den Werbungen anderer Männchen widerstand und aktiv die Nähe zu Blasius suchte. Das Paar hielt sich viel am Rande der Schar auf und wich tage-bis wochenlang auf den Almsee aus, besonders im Frühjahr, wenn der Ansturm der Blasius-Rivalen stark wurde. So auch 1990, als Sinda mit Blasius von ihrem üblichen Neststandort auf einer Bülte am Almsee Gössel nach Oberganslbach ins Aufzuchtgebiet führte. Kurzfristig war die 106 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Welt wieder in Ordnung, denn nichts scheint einen Ganter mehr aufzuputschen und eine Gänsepartnerscha� mehr zu stabilisieren, als Nachwuchs. Die Familie erlebte ein normales Gänsejahr; die Kinder von 1990 (Selina, Samson und Silva) zeigten im Frühjahr 1991 eine normale »Verlobungsphase« (erste Kontaktaufnahmen mit zukün�igen Partnern). Es schien, als würde die Geschichte weiterlaufen wie bisher. Blasius zeigte seine übliche Verteidigungsschwäche, die aber dadurch kompensiert wurde, dass sich das Paar sehr früh, Anfang März, auf den Almsee zurückzog. Sinda baute ein Nest und legte vier Eier. Alles schien in Ordnung, bis das Gelege zerstört wurde. Raben oder Krähen ha�en die Eier zerhackt. Da Sinda bereits einige Tage gebrütet ha�e, bestand keine Möglichkeit mehr für ein Nachgelege; das Paar würde also in diesem Jahr keine Nachkommen großziehen. Sinda und Blasius blieben zunächst bis Mi�e Mai am Almsee, schlossen sich aber im Juni zum Mausern den anderen Familien in Oberganslbach an, sei es aus jahrelanger Gewohnheit, oder weil sie Gössel a�raktiv fanden (Graugänse neigen stark zur Adoption von Gössel, was manchmal sogar zu Auseinandersetzungen um die gerade geschlüp�en Gössel zwischen den Eltern und anderen, adoptierwilligen Gänsen führen kann). Als ich am 27. April 1991 ein schlüpfreifes Gänse-Ei aus dem Brüter auf die Wiese vor dem Haus legte, um es zu fotografieren, waren zufällig Sinda und Blasius anwesend (die Forschungsstelle liegt in gänsischer Gehdistanz zu Oberganslbach) und wurden von dem Ei offenbar sehr angezogen. Sinda ging darauf zu und fing an, es zu rollen, zeigte also jene Verhaltensweise, welche dem Zurückholen eines aus dem Nest gerollten Eies dient. Genau diese Verhaltensweise wurde von Lorenz und Tinbergen in ihrer klassischen Arbeit (1939) stellvertretend für andere Instinktbewegungen genau beschrieben. Sinda konnte einem in ihrer ins Leere gehenden Bereitscha�, Nachwuchs aufzuziehen, schon leid tun. An Ende Juni 1991 begann sich der Ganter Erot um Sinda zu bemühen. Er blieb zunächst ständig in der Nähe des Paares, drängte sich zwischen Sinda und Blasius, vertrieb den alten Ganter häufig um dann zu Sinda zurückzukehren und sein Triumphgeschrei gegen sie zu richten. Diese stimmte zunächst nicht mit ein, sondern versuchte wochenlang, den Kontakt mit Blasius zu halten. Obwohl sie ständig von Erot bedrängt wurde, gelang ihr das recht gut. Es sah also danach aus, als würde Sinda ihre Bindung zu Blasius aufrecherhalten, wie in den Jahren zuvor in ähnlichen Situationen. Was 1991 allerdings fehlte, waren gemeinsame Gössel, welche die Paarbindung stimuliert und Blasius´ Konkurrenzfähigkeit angeregt hä�en. So sah ich zu meinem Erstaunen am 8. Juli 1991 Sinda aktiv Erot nachfolgen. Innerhalb der nächsten Minuten folgte ein Angriff von Erot auf den nahen Blasius, mit anschließendem Triumphgeschrei auf Sinda, die prompt in sein abschließendes Schna�ern einfiel. Mit dieser Paarbindungszeremonie (Fischer 1965) war die Sache klar für Erot entschieden. Zu Mi�ag desselben Tages sah ich Erot mit Sinda kopulieren, was sich in den darauffolgenden Tagen regelmäßig wiederholte. Da sowohl beim Weibchen, als auch beim Ganter in dieser Zeit keine befruchtungsfähigen Geschlechtszellen mehr vorhanden waren (vier Monate nach der Fortpflanzungszeit!), sind diese Beobachtungen so neben- Ihr Sozialleben macht Gänse zu den Primaten unter den Vögeln 107 bei ein Beleg dafür, dass Kopulationen auch bei Gänsen nicht nur streng vermehrungsbezogen eingesetzt werden, sondern wahrscheinlich zusätzlich der Festigung der Paarbindung dienen. Ähnliches ist ja bereits länger von Affen und Menschenaffen bekannt (Wickler und Seibt 1984) und wurde als Paarbindungsmechanismus auch für monogame Vögel beschrieben (Black 1996, Hunter u. a. 1993). Eine 17 Jahre währende Partnerscha� war also zerbrochen, bzw. vom Weibchen aufgekündigt worden. Die eigentliche Ursache dafür war offensichtlich die sinkende Konkurrenzfähigkeit des alten Blasius, welche durch den Brutausfall noch verstärkt wurde. Im Lichte der Daten von Jürg Lamprecht von den ehemaligen Seewiesner Streifengänsen war die Entscheidung Sindas evolutionär »vernün�ig«. Lamprecht stellte zunächst keinen Zusammenhang zwischen dem Fortpflanzungserfolg und dem Alter des Paares fest. Allerdings fand er, dass der weibliche Fortpflanzungserfolg mit dem Alter zunimmt, was sich mit den Ergebnissen an den Grünauer Gänsen deckt. Mit dem Alter zunehmende Erfahrung könnte dafür der Grund sein. Der Erfolg der Männchen hingegen sinkt mit steigendem Alter, was auf eine sinkende Fertilität des Spermas zurückzuführen sein könnte. Und immerhin war Erot 8 Jahre jünger als Blasius. Damit ist es »sinnvoll«, dass Gänseweibchen eine erfolglose Brutsaison zum Wechsel des Langzeitpartners verwenden, zumal, wenn dieser, wie im Fall von Blasius, sich bereits ganzjährig im Dominanzgefüge der Schar nicht mehr so behaupten konnte, dass die Fortpflanzungsinteressen des Paares optimal gewahrt werden können. Sinda konnte also durch ihren Wechsel nur gewinnen, Blasius natürlich nur verlieren. Hinzu kommt, dass er als einziges Individuum in der Schar immer schon dazu neigte, neurotisch auf Spannungen zu reagieren. Er »kämp�e« gelegentlich mit sich selber, so auch unmi�elbar nach der Trennung. Er fasste sich dabei mit dem Schnabel am linken Flügelbug und versuchte, mit dem rechten auf sich selber einzudreschen, was zu einem wilden Ringelspiel um die eigene Achse führte. Bei diesen seltenen Spektakeln war Blasius gewöhnlich von aufgeregten, »hassenden« (wird gewöhnlich von Scharmitgliedern gegen Bodenfeinde gezeigt) Schargenossen umgeben. Blasius´ gemauserte Schwungfedern dieses Jahres waren weitgehend zerkaut – ein »fingernägelkauender« Ganter! Ältere Männchen werden beim Verlust ihrer Partnerin meist schlagartig zu den Parias in der Schar. An den Rand gedrängt und auf der untersten Sprosse der Dominanzhierarchie (Rang ist weniger eine Eigenscha� des Individuums als ein Ergebnis der sozialen Bindung) haben sie wenig Chancen, eine Bindung mit einem weiteren Weibchen einzugehen. So bleiben sie entweder alleine oder gehen Bindungsallianzen mit anderen Junggesellen ein. Blasius war also evolutionär gesehen »so gut wie tot«. Häufig zieht bei Lanzeitmonogamen ein Partnerwechsel einen zumindest einjährigen Ausfall der Fortpflanzung nach sich (Newton 1989, Black 1996). Weibchen sollten also nur in gut begründeten Fällen wechseln, denn »es kommt selten was besseres nach«. 108 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Obwohl die Verteidigungsleistung von Erot an die von Blasius vor nur einigen Jahren erinnerte (sollte es auch für Gänse gelten, dass sie immer wieder denselben Männchentyp bevorzugen?), gelang es dem Paar bereits 1992, also ohne ein Jahr Verzögerung, Junge großzuziehen. Sinda brütete wieder an derselben Stelle wie vorher, es wurden sechs Junge flügge, überdurchschni�lich viel für eine Brut. Es gab also nicht nur keinen Einbruch, mit dem neuen Ganter war der Erfolg dreimal so hoch wie in einem durchschni�lichen Jahr mit Blasius; aber das kann Zufall sein. Längerfristige Daten hä�en Klarheit schaffen können, aber dazu sollte es leider nicht mehr kommen. An allen unseren Gänsefamilien führen wir regelmäßig quantitative Verhaltenserhebungen durch. Dabei fiel auf, dass Erot weniger aggressiv als andere Familienganter in der Winterschar war, Sinda dagegen wesentlich aggressiver als andere Familiengänse. War das eine Kompensation des wenig engagierten Verhaltens des Männchens? Vielleicht war das männchenähnlichresolute Verhalten Sindas einfach eine individuelle Eigenscha�. Bereits in der Vergangenheit wurde berichtet, dass sie aggressiver als andere Weibchen war und sogar gelegentlich Rivalen von Blasius per Flügelbugangriff in die Flucht schlug. Blasius hielt sich übrigens im Winter 1992/93 immer wieder in unmittelbarer Nähe von Sinda und ihrer Familie auf, ohne sofort von ihr oder Erot vertrieben zu werden. Im Frühjahr 1993 warteten wir also gespannt auf die Fortsetzung unserer Gänse-Saga. Die Geschichte fand jedoch ein jähes Ende. Sinda wurde im April 1993 auf ihrem Nest mit 5 Eiern im flachen Wasser des Almsees von einem Fuchs erbeutet. Obwohl man sich als Beobachter emotional heraushalten sollte, waren wir en�äuscht. Einmal, weil man solchen Tieren gegenüber unweigerlich Gefühle entwickelt und zum anderen, weil ein paar Jahre mehr noch sehr erkenntnisträchtig gewesen wären. So war Sinda mit 34 flüggen Jungen, in 18 Jahren mit 2 Partnern unsere mit Abstand erfolgreichste Gans. Erot wurde zum Witwer. Erot war ein 1981 geschlüp�es Gössel von Elysia und Veith, verpaarte sich 1983 kurz mit Anastassja, dann von 1983 bis 1991 mit Isabelle, mit der er aber keine flüggen Jungen großzog. Die Verbindung mit Sinda währte 1991 bis 1993, daraus entstammten 6 flügge Junggänse. Nach einem kurzen Zwischenspiel mit Voyager, gelang es Erot noch 1993, sich mit Frau Nils zu verpaaren und mit ihr auch 3 Junge bis zum Flüggewerden großzuziehen. Erot verschwand im November 1994 und hinterließ aus seinen 13 Lebensjahren immerhin 9 flügge Junge aus 2 von insgesamt 5 Verpaarungen. Ohne seine hart erkämp�e Verpaarung mit Sinda wäre die Bilanz viel weniger gut ausgefallen. Blasius dagegen wurde von Sybille Schäfer 1973 handaufgezogen, verpaarte sich 1975 mit der im darauffolgenden Jahr bei der Brut verschwundenen Jule und 1976 mit deren Schwester Sinda, mit der er bis 1991 zusammenblieb und in diesen 15 Jahren 30 flügge Junge großzog. Von Erot aus der Bindung gedrängt, existierte der Ganter noch bis zu seinem Verschwinden im 22. Lebensjahr, im März 1995, alleine an der Peripherie der Schar. Dank Sinda war Blasius ein enorm erfolgreiches Männchen. Ihr Sozialleben macht Gänse zu den Primaten unter den Vögeln 109 Die lebenslange Einehe ist der »Grundtypus« der Partnerscha� bei Gänsen (s. Lorenz [1988] zur Frage: Was ist »normal«?). Dies zeigt nicht nur die Statistik, sondern auch das Verhalten. Ganter mögen zwar mit einem Sekundärweibchen (oder bei Gelegenheit mit einer beliebigen anderen Partnerin) kopulieren, die Bindungsrituale, wie das Triumphgeschrei, oder das Kopulationsnachspiel wird aber immer nur gegen die eigentliche Partnerin gerichtet, Gänse sind also durchaus monogam »eingestellt«. Dennoch, viele Fälle streuen um diesen »Normaltyp« (Exkurs 9). Tatsächlich gibt es in der Gänsegesellscha� fast keine sozialen Erscheinungen, die man nicht auch beim Menschen finden würde. Umgekehrt gilt das natürlich nicht. Diese Ähnlichkeit der Strukturen ist sicherlich auch ein Grund für die Faszination, welche die Gänse auf viele Beobachter ausüben. O� bricht spontaner »Gänsetratsch« aus, wenn passionierte Gänseforscher aufeinandertreffen. Was für Außenstehende wie indiskreter Gossip klingt, Affären, Beziehungen und Nebenbeziehungen innerhalb der Schar, die Vorlieben, Abneigungen und Maro�en Einzelner, ist tatsächlich wichtiger Hintergrund für unsere wissenscha�liche Arbeit. Bei näherem Hinschauen bilden Gänse eine komplex strukturierte Gesellscha� aus unverwechselbaren Individuen, mit manchen Anklängen an Primatensozietäten, aber auch mit vielen eigenständigen Zügen. (Exkurs 9). Längst ist die Sonne hinter den Bergflanken des Almtals verschwunden. Immer noch stehen wir in der Schar, betrachten nachdenklich unsere Gänse, jede mit ihrer eigenen Geschichte. Es ist dämmrig geworden, die herbstlichbunten Wälder leuchten nicht mehr, nur noch die höchsten Bergspitzen stehen im ma�en Rot. Wie am Morgen stehen wir bei unseren Gänsen und warten, diesmal auf ihren Abflug. Unruhe befällt die Schar. In den Familienclans richten sich die Gänse in Abflugrichtung aus, gehen zueinander in Startdistanz, etwa eine doppelte Flügellänge. Zunehmend hört man den »Fortgehlaut«, ein kurzes, hochfrequentes gan-gan-gan, durchsetzt mit hohen, einsilbig-quiekenden Warn- bzw. Mobbinglauten. Kopfschü�elnd und flügelnd bringen sie sich gegenseitig in Abflugstimmung. Ein sozialer Vogel vom Gewicht einer Gans fliegt nicht einfach alleine ab. Offenbar ist eine Schwelle zu überwinden und allgemeine Synchronisation durch Stimmungsübertragung nötig. Die Spannung ist den sichernden Gänsen deutlich anzusehen. In den letzten Sekunden steigern sich Fortgehlaut und Kopfschü�eln zu einem Verhaltensstakkato, gesta�en eine ziemlich genaue Vorhersage, wann der erste Vogel mit ein paar Schri�en Anlauf wegziehen wird, zögernd manchmal, um von anderen Gruppenmitgliedern mit krä�igen Flügelschlägen beim Start überholt, mitgerissen zu werden. Die letzten Nachzügler der Familiengruppe trachten, den Anschluss nicht zu verpassen. Knapp über dem Boden streichend, gibt die Flügelmuskulatur nun ihre volle Leistung, die Flächenbelastung der Flügel ist am größten. Bei jedem Aufschlag klatschen die Spitzen der Handschwingen über den Gänsen zusammen, bis sie nach einigen Dutzend Metern genügend Fahrt gewinnen, um vom Au�rieb getragen, in den ökonomischen GleitRuderflug überzugehen. Gruppe um Gruppe streicht laut schna�ernd in den dunklen Abend ab. Menschenaugen bräuchten schon Scheinwerfer, um zwischen den boden- 110 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau nahen Hindernissen zu manövrieren, die lichtstarken Gänseaugen funktionieren auch in sternenhellen Nächten. Die Gänse gleiten zunächst mit sparsamen Flügelschlägen dicht über dem Fluss, noch immer laut rufend. Beinahe berühren ihre Flügelspitzen das Wasser. Erst allmählich schwingen sie sich auf Baumwipfelhöhe, werden in wenigen Minuten ihren Schlafplatz auf der weiten Fläche des Almsees erreicht haben, 8 km südlich von uns. Weitab vom Ufer werden sie auf der nächtlichen Seefläche einfallen, bis zum Morgengrauen sicher vor Füchsen und neugierigen Forschern. Kaum mehr als Konturen sind noch gegen den nachtblauen Himmel auszumachen. Mit rauschenden Schwingen verlässt uns auch der letzte große Trupp. Je dunkler der Abend, desto eher neigt die Schar zum Massenau�ruch. Aufgewirbelte Federchen schweben langsam wieder zu Boden, geben die Gewissheit, dass sie wiederkommen werden, morgen früh. Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 18. Mai 1991, Oberganslbach: Nach der Morgenfü�erung der Gänsefamilien sitze ich knapp nach sechs Uhr früh wieder fröstelnd in meiner kleinen Hü�e. Die drei Gössel neben mir bilden ein sternförmiges Knäuel im Wärmekegel des Gasstrahlers. Die Hälse ineinandergeschlungen sind sie eben mit wohligem Trillern eingeschlafen. Sie haben ein leichteres Leben als ihre von Gänseeltern geführten Altersgenossen. Ein Blick durch die beschlagene Fensterscheibe ergibt die ungemütliche Gewissheit, dass draußen der Schneefall eben in Regen überging. Gasstrahler, Kochöfchen und Gaslampe brennen, die Temperatur in der Hü�e erreicht langsam angenehme 10 °C. Eine Stunde habe ich jetzt für mich, dann werden meine Gössel wieder auf die Weide wollen, und ich muss natürlich mit. Eine Stunde, um Tagebuch zu schreiben, zu frühstücken. Mir ist nicht nach wohligem Trillern zumute, die Füße und Finger eiszapfig, und daran wird sich wohl den ganzen Tag wenig ändern. Seit ihrem Schlupf vor drei Wochen, am 28. April, bin ich nun meinen Gänsschen Alleinerzieher und Begleitperson, eingespannt in einem engen Rhythmus von Weiden und Hudern. Dass es die ganze Zeit regnet und auch der Winter immer wiederkehrt, ist Pech. Trotz der widrigen Umstände ist es aber ein schönes, beglückendes Erlebnis, so gar nicht aus dieser Welt, ein Leben als Ganter unter Gänsen sozusagen. Mit zahmen Wildtieren zu leben war die Lorenzsche Arbeitsmethode schlechthin. Denn es hat viele Vorteile, mit sozial auf Menschen geprägten Tieren zu arbeiten (s. u.). Über zwei Monate dauert es vom Schlüpfen bis zum Flüggewerden, eine Zeit, die ganz den Gänsen gehört. Keine Minute wollen sie alleine bleiben; kaum ist man außer Sicht, ertönt das »Pfeifen des Verlassenseins«, ein durchdringender Weinlaut, wie bei Menschenbabys ein Signal für die Eltern, herbeizueilen. Wird das Signal ignoriert, so kann dieses Trauma zu späteren Verhaltensstörungen führen, bei Gänsen, wie bei Menschen. Der radikale Tempowechsel ist Teil des Erlebnisses. Der Schlupf meiner Gössel entriss mich urplötzlich den erfüllten, o� hektischen Tagen der wissenscha�lichen Arbeit und des Bürokrams, auferlegte mir tägliche 14 Stunden langsamsten Spazierengehens. Eine Entwöhnungskur für den reiz- Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 111 flutverwöhnten Menschen. Etwa zwei Kilometer sind in den ersten Wochen unsere Tagesleistung. Gänschen sind keine Hunde, sie lassen sich nicht kommandieren. Wenn sie rasten wollen, dann hat man das als Elter zu respektieren. Höchstens mit Warnrufen und raschem Weglaufen kann man sie dann noch zum Nachfolgen bewegen, aber auch das nicht allzu o�. Auch innerhalb von Gänsefamilien geht es bezüglich Au�ruch und Marschrichtung recht »demokratisch« zu. Eltern folgen zunächst o� ihren jungen Gösseln. Je älter diese allerdings werden, umso häufiger folgen sie ihren Eltern. Die Frage, was manche Gänse zu Führern, andere zu Nachfolgern macht, beschä�igt uns noch immer. Denn »Leadership« als Ausdruck von Kompetenz (Lamprecht 1991, 1992) und Persönlichkeit ist ein wichtiger Faktor zur Strukturierung von Gruppen, nicht nur bei Gänsen. Der ständige Regen macht meine Absicht zunichte, diese Zeit zum Lesen und Schreiben zu nutzen. Nichts als die eigenen Gedanken und o� nicht einmal die. Nur innere Ruhe, Leere. Feucht-klamme Kälte auf der Haut harmonisiert mit graublauer Seele. Die Zeit verliert an Bedeutung. Es berührt nicht mehr, dass man nichts »tun kann«, es ist gut so. Mangel an Ablenkung ermöglicht genaues Hinschaun. So sehe ich Tag für Tag meine Kleinen fressen, baden, schlafen, wachsen, usw. Zwar tragen sie Farbringe, aber zur persönlichen Identifizierung sind diese längst nicht mehr nötig. O� weiß ich schon vorher, wie jede einzelne meiner drei »Adoptivtöchter« in verschiedenen Situationen reagieren wird. Und genaueste Gänsekenntnis zu erwerben, war schließlich der Hauptzweck dieser seltsamen Übung. Vier waren es zu Beginn und die ersten Tage verliefen nach Plan. Vom ersten Anpicken der Eischale bis zum Schlupf vergingen eine Nacht und ein Tag. Bereits die schlüpfenden Gössel wurden intensiv betreut. So mag es ziemlich verrückt anmuten, wenn jemand mit Eiern spricht, aber bereits zwei Tage vor dem Schlupf atmet das Gössel Lu� aus der Blase am stumpfen Pol des Eies. Sie reagieren sie mit einem leisen wiwiwi auf meine Stimmfühlungslaute, sind schon in der Lage, sich mitzuteilen (Fischer 1965). Innerhalb weniger Stunden pickten alle vier die stumpfe Kappe des Eies kreisförmig an. Geschlüp� wurde synchronisiert innerhalb von 15 Minuten am 27. April 1991, um etwa 22 Uhr. Die Gössel sprengten die angepickte Eischale ab, fielen mit feuchten Daunen mi�en ins Leben. Da liegen sie nun, die trockenen Daunen noch in den Hornscheiden, eng am Körper anliegend. Es sollte bis zum Morgen dauern, bis sie auf eigenen Füßen standen. Aber sofort nach dem Schlupf streckten alle ihre Hälse mit krä�igem wiwiwi in meine Richtung vor, konnten noch nicht stehen, wohl aber im Sprint in meine Richtung laufen. Der darauffolgende Tag verging mit Hudern unterm Wollpullover und nur wenigen Ausflügen zu Fuß; noch ernährte sie ihr Do�ervorrat. Aus den feuchten, hilflosen Schlüpflingen wurden rasch flauschig-gelbe Daunenbällchen. Zwar noch wackelig auf den Beinen, können sie schon erstaunlich schnell laufen. Am nächsten Tag begann das Weiden. Vorerst wurde an allem gezup�, besonders intensiv an Pflanzen, an die der »elterliche« Finger (an Schnabels sta�) tippte. Eine halbe Stunde weiden, eine halbe Stunde hudern, das war der anfängliche Rhythmus. Darin 112 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau liegt die eigentliche Kunst jeder Gänsemu�er. Die Gössel müssen viel weiden, um wachsen zu können. Als Pflanzenfresser lässt ihnen ihre Energiebilanz, die vor allem durch den recht geringen Energiegehalt der Nahrung und die beschränkte Kapazität ihres Verdauungstraktes bestimmt wird, wenig Spielraum. Sie dürfen auch keinesfalls unterkühlen. Je kälter und nässer, desto enger ist diese Schere zwischen Fress- und Aufwärmzeit. Langsam nimmt die Bereitscha� der Gänsemü�er zum Hudern ab. Die nun drei- bis vierwöchigen Gössel wärmen dann einander, indem sie Gösselhaufen bilden. Dass Nachkommen Leistungen ihrer Eltern länger beanspruchen wollen, als diese bereit sind, ihnen zu gewähren, tri� auch auf das Hudern zu. So trillerten noch meine 6wöchigen, schon fast flüggen Gössel, wenn sie sich sa�geweidet ha�en. Da ich schließlich keine Gans bin, die auf ihren »Leben sfortpflanzungserfolg« zu achten hat, ließ ich sie auch noch als »Halbstarke« unter meinen Regenmantel kriechen, auch wenn die Kothäufchen, die sie in dessen Falten hinterließen, immer größer wurden. Was pflegte Konrad Lorenz in diesem Fall zu bemerken? »Wer mit Gänsen arbeitet, dem muss es Spaß machen, sich im Gänsekot zu suhlen« (seine tatsächliche Wortwahl soll de�iger gewesen sein). Wie bereits von Sybille Kalas gesehen (1977), gab es besonders zwischen Tag 4 und 6 nach dem Schlupfen ein paar mal handfesten Streit. Die Kleinen versuchten einander in Erwachsenenmanier zu verprügeln. Gegenseitig in den Halsansatz verbissen werden Schläge mit dem Flügelbug ausgeteilt, wobei die Flügel noch viel zu kurz sind, um den Kontrahenden auch nur zu erreichen. Die Verhaltensweisen sind also bereits angelegt, obwohl der zugehörige Körperbau noch nicht erreicht ist. Jedenfalls kommt es früh zur Ausbildung einer Rangordnung, deren Funktion innerhalb einer Geschwistergruppe allerdings noch reichlich unklar ist. Ähnliches passiert auch in jeder Familie mit echten Gänseeltern. Die klassisch-ethologische Interpretation einer Rangordnung, diese diene der Vermeidung von Aggression, darf bezweifelt werden. Denn generell profitieren die an der Spitze, Palastrevolutionen sind daher an der Tagesordnung. Dominanzhierarchien verursachen daher geradezu Aggressionen, denn dominante Tiere genießen Vorteile. Bei den Gösseln geht es vielleicht um gute Huderplätze im mü�erlichen Gefieder. Oder sie üben für »den Ernstfall«, also für ihr späteres Erwachsenendasein in der Schar. Da die Aggressionsbereitscha� eine wichtige Grundlage für Dominanz und Fortpflanzungserfolg des Paares darstellt (Lamprecht 1986a, b) könnte die frühkindliche Streitlust der Gänse hormonale Rückkopplungen auf die Entwicklung des Nervensystems bewirken, um damit die Bereitscha� für jenes rabiate Verhalten zu bahnen, das man besonders als erwachsener Ganter in einer Schar benötigt. Tatsächlich sind junge Männchen gewöhnlich aggressiver als ihre Schwestern und dominieren sie. Werden aus handaufgezogenen Tieren »normale« Gänse? Meine handaufgezogenen Gänse waren zumindestens während ihres ersten Winters noch auf mich bezogen. Unsere Begrüßungszeremonien nach dem Flüggewerden bis in den ersten Winter waren zunächst gänsisch laut. Wir Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 113 kannten einander an der Stimme und bis 1992 antworteten sie auf meinen Kontaktschrei (welcher bei nicht Vorgewarnten den Angstschweiß ausbrechen lässt). Auf Zuruf kippten sie aus vollem Flug aus dem Himmel und landeten vor meinen Füßen. Eine wechselseitige soziale Bindung war entstanden. Das wäre natürlich eine unzureichende Basis für wissenscha�liche Arbeit, aber diese muss auch nicht leiden, wenn positive Emotionen im Spiel sind, im Gegenteil. Ein positives soziales Umfeld ist Voraussetzung für gute kognitive Leistungen (Ciompi 1993). Etwa ein Dri�el unserer freifliegenden Schar ist handaufgezogen. Sie bleiben zeitlebens zahm und menschenfreundlich, verpaaren sich aber ganz normal mit anderen Gänsen und ziehen sehr »gänsisch« ihre Kinder groß. Das bedeutet nicht, dass es gar keine Unterschiede zwischen gansund menschenaufgezogenen Gössel gäbe. Eine Vergleichsuntersuchung zeigte, dass Handaufgezogene vor dem Flüggewerden mehr »grüßen«, als Gansaufgezogene, wohl weil ein Mensch eben doch keine Gans ist, die sozialen Erwartungen der Gössel nicht ganz befriedigen kann und daher einen höheren Bedarf an Rückversicherung zeigen, welche das Grüßen (nicht nur bei Gänsen) darstellt. Andererseits sichern Handaufgezogene weniger, wohl weil sich auch die Handaufzieher weniger vor dem Fuchs fürchten, als Gänseeltern. Noch bis ins zweite Lebensjahr bewirkt die Anwesenheit vertrauter Menschen bei Handaufgezogenen hohe Fressraten, Erfolg in Auseinandersetzungen mit anderen Gänsen und gedämp�e Stresshormonausschü�ungen (Frigerio und Weiss in Vorber.). Im ihrem Verhalten unterscheiden sie sich als Erwachsene aber nicht mehr von ihren gansaufgezogenen Schargenossen. Auch meine Gänse nabelten sich sozial von mir ähnlich wie von normalen Gänseeltern ab. Im gleichen Maß, wie sich Schwarzkopfrosa, ein sta�licher, fast 3jähriger Ganter für das Dreiganserlhaus interessierte (und umgekehrt), wurden ihre Antworten auf Kontaktversuche meinerseits schwächer, bis sie mich schließlich nicht mehr grüßten. Am 25 Februar 1992 beobachtete ich erstmals einen Kopulationsversuch des Ganters mit DAT. Im Sommer 1992 schlossen sich zwei meiner Zöglinge mit dem Ganter Marx zu einem lockeren Trio zusammen. Gelegentlich nahmen sie zwar noch Fu�er aus meiner Hand, vergrößerten aber aktiv den Abstand, wenn ich ihnen näher als 2 m kam. Nicht, weil sie vor mir Angst gehabt hä�en, es schien sich eher um ein soziales Meiden zu handeln, wie auch die abgenabelten Kinder ihren Eltern in der Schar nicht mehr zu nahe kommen. War eben noch der Elternkumpan gefragt, so veränderte wohl die jahreszeitliche Dynamik der Hormonspiegel (Hirschenhauser u. a. 1999a) ihre soziale Präferenz in Richtung zukün�iger Partner. In keinem unserer umfangreichen Datensätze zum Sozialverhalten waren die Handaufgezogenen in der Schar in irgend einer Weise auffällig. Menschen werden mit zunehmender Reifung vom Sozialkumpan zum Fu�erspender. Standardisiert handaufgezogene Gänse können also problemlos in die Schar eingegliedert werden. 114 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Wozu Handaufzucht? Die Schar zahm und damit für wissenscha�liche Arbeit zugänglich zu halten, ist sicherlich ein wichtiger Grund für gelegentliche Handaufzucht. Dies erlaubt aber auch Beobachtungen aus nächster Nähe. Mit zahmen (also sozial auf Menschen geprägten) Wildtieren zu arbeiten war zeitlebens der wichtigste Ansatz von Konrad Lorenz. Und ungeachtet aller möglicher Einwände verdanken wir dieser Methode die meisten Grundkonzepte der klassischen Ethologie, beispielsweise die Arbeit zur »Eirollbewegung« (Lorenz und Tinbergen 1939). Handaufzucht ist der beste Weg, Tiere genau kennenzulernen, denn es kann gefährlich irreführend sein, Hypothesen an Tieren zu testen, deren Biologie man nicht gut kennt. An meinen handaufgezogenen Gösseln führte ich zunächst eine Pilotuntersuchung zum Zusammenhang zwischen Steroidhormonen und Sozialverhalten durch. Es ging vor allem darum, Methoden zu testen, um herauszufinden, ob das Nachfolgeverhalten und die Interaktionen zwischen den Geschwistern bereits vor dem Flügge-werden unter dem Einfluss von Steroidhormonen stehen. Von den beiden Handaufzuchten 1991 und 1992 wurden systematisch Daten zum Sozialverhalten, sowie Kotproben genommen. Damit begann eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Erich Möstl und Rupert Palme, zwei Kollegen vom Institut für Biochemie der wiener Universität für Veterinärmedizin. Da regelmäßige Blutproben zur Hormonbestimmung bei unseren freilebenden Gänsen weder praktikabel, noch zielführend wären, setzten wir auf eine nicht-invasive Methode. Tatsächlich gelang es den beiden Kollegen seitdem, Enzymimmunoassays (EIA) auf Basis von gruppenspezifischen Antikörpern zu entwickeln, die es gesta�en, die Abbauprodukte einer Pale�e von Geschlechts- und Stresshormonen sicher und äußerst genau aus dem Kot zu bestimmen. Diese Methode ist keineswegs nur ein »Notnagel« im Vergleich zur Hormonbestimmung aus Blut. Aus Kot messen wir einen integrierten Hormonwert über die Dauer der Darmpassagezeit, bei Gänsen nur 2–4 Stunden. Jede Veränderung der Hormonwerte in diesem Zeitraum, etwa verursacht durch Reize aus der Umwelt, schlagen sich im Kot nieder. Da in der Regel alle 20 Minuten Kot abgegeben wird, ist eine häufige Probennahme gewährleistet. Unmöglich, von unseren Gänsen in so kurzen Abständen Blutproben zu nehmen. Auch würden durch Fangen und Bluten verursachte Aufregung genau jene Hormone verändert, die wir eigentlich messen wollen. So ist dieser nicht-invasive Ansatz über die Jahre zu einem wichtigen methodischen Standbein geworden, dem wir viele neue Einsichten in das Sozialleben von Gänsen und anderen Tieren verdanken. Tatsächlich ist es auch möglich, Hormone aus Urin oder Speichel genau zu bestimmen. Dies erlaubte u.a. unsere Forschungen auch auf Menschen auszudehnen. So untersuchten K. Hirschenhauser und andere (2002) die hormonalen Zyklen von Männern und V. Bromundt nahm die Handaufzieherinnen auf Korn, um die hormonalen Komponenten der Entstehung von sozialen Bindungen zu untersuchen. Aber das alles lag in jenem kalten Frühjahr 1991, als ich selber Graugänse aufzog, noch in weiter Ferne. Graugänse stehen in kleinen Gruppen an den Teichrändern, die Füße in dem im Vergleich zum Schnee noch relativ Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 115 warmen Wasser, den Kopf unter den Flügeln. Möglichst wenig Wärme verliere, lautet die Devise. Das Frühjahr 1991 sollte sich als das zweitkälteste des Jahrhunderts erweisen, die meisten Gössel der Schar kamen vor dem Flüggewerden um. Im Gegensatz dazu waren Frühjahr und Sommer 1992 zur Freude der Gänsebetreuerinnen unter den bislang wärmsten des Jahrhunderts. Nur wenige Gössel starben. Forschung in Kleingruppen Gunda, Nadja, Niki, Marianne, Nora, Kathi und Geri waren die ersten einer langen Reihe von Studenten, die seit dem Neubeginn 1990 im Rahmen von dreiwöchigen Praktika in Grünau arbeiten; anschließend untersuchten Gisi und Hans das Familienleben der Gänse und Gudrun, Renate und Robert beobachteten ihre Reaktion auf die winterlichen Angriffe von Stein- und Seeadlern. Mi�e der 1990er Jahre wurden zunehmend Fragestellungen an Kolkraben bearbeitet, ab 1997 kamen die Waldrappe dazu. Insgesamt waren es mehr als 200 Studenten in einem guten Jahrzehnt, davon etwa ein Dri�el aus dem meist europäischen Ausland. Ziel dieser Praktika ist es nicht, nobelpreisverdächtige Daten zu erheben, sondern methodisch sauber und relativ eigenständig eine ethologische Untersuchung vorzubereiten, durchzuführen und die ausgewerteten Daten in einem schri�lichen Bericht darzustellen. Als es klar war, dass auch nach dem Tod von Konrad Lorenz die Forschungsarbeit in Grünau weitergeführt werden sollte, stellte sich die Frage, wie jene wissenscha�liche Produktivität und Qualität zu erreichen wäre, die man von uns mit Recht erwartete. Und das mit nur zwei permanent Beschä�igten, denen alles obliegt, von der Forschungsplanung über die Hausbesorgerarbeiten, die nötige Verwaltungsbürokratie, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrveranstaltungen und natürlich das Lukrieren von Forschungsmi�el. Da bleibt wenig Zeit für Beobachtungen, Versuche, Datennahme und -auswertung, für das Schreiben von Publikationen, der Pflege internationaler Kontakte und Kongressbesuche. Und dazu noch die Ausbildung der Studenten! An den Universitäten können sie für überlastete Hochschullehrer zum Alptraum werden, im Verein mit der dort herrschenden Bürokratur »Sargnägel« für die eigene Forschung. Für den Betrieb in Grünau sind die betreuten Praktikums- Diplom- und Doktoratsstudenten unverzichtbar, sind wertvolle Mitarbeiter ohne die Forschung kaum möglich, unsere Produktivität nicht haltbar wäre. Das gilt selbst für die Praktika, die o� wichtige Pilotprojekte darstellen und wertvolle Datenpunkte liefern. Vorwiegend aus dem Kreis dieser Praktikumsstudenten rekrutieren sich unsere Diplomanden und Dissertanten. Seit 1993 sind im Jahresschni� etwa 10 dieser Studenten mit der Konrad Lorenz Forschungsstelle assoziiert, davon sind etwa 6–8 anwesend, meist 2–3 Dissertanten, der Rest Diplomanden. Besonders stolz sind wir darauf, dass es sich dabei um ausgezeichnete Studenten nicht nur österreichischer Universitäten. Etwa zwei Dri�el dieser Studenten rekrutieren sich aus dem europäischen Ausland. Auch das sorgt für eine gute Arbeitsatmosphäre im Hause und manchmal auch für babylonische Sprachverhältnisse. Fliegende Wechsel in der Umgangssprache zwi- 116 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau schen deutsch, englisch und italienisch kommen vor. Schon die Bedingungen der Arbeit im Almtal sorgen dafür, dass nur wirklich Motivierte bei uns landen. Aus den warmen Hörsälen der Universitäten in die spartanische Klausur ländlicher Abgeschiedenheit. Rasch wird klar, warum wir das romantische innere Almtal zuweilen auch »Ostsibirien« nennen. Und tatsächlich finden sich unter unseren Studenten viele initiative und kreative Persönlichkeiten mit Organisationstalent. Tatsächlich sind Hirn und Hand gefordert an unserer Feldstation, weit weg von städtischer Infrastruktur. Maximal vier Praktikumsstudenten nehmen wir für jeweils drei bis vier Wochen bei uns auf. Innerhalb der ersten Tage lernen sie zunächst im Zuge eines »Ethogramms« die grundlegenden Verhaltensweise der zu untersuchenden Tiere kennen und beginnen bereits die sozialen Beziehungen zu erahnen. In kurzer Zeit ist man motiviert, mehr darüber zu erfahren, begrei� die Notwendigkeit objektivierter Datennahme mi�els quantitativer Methoden (Martin und Bateson 1993). Als nächster Schri� wird eine genaue Fragestellung erarbeitet, die sich meist aus unserer laufenden Forschungsarbeit ergibt. Zum Konzept muss das »Handwerk« abgestimmt werden, also die zugehörigem Versuchs- und Beobachtungsprotokolle erstellt und getestet werden. Diese Vorbereitungsarbeiten dauern gewöhnlich eine Woche, gefolgt von einer Woche Datennahme und einer weiteren Woche Datenauswertung und Schreiben des Berichtes. Wochenenden fallen meist aus und in der letzten Woche werden auch meist die Nächte zu kurz. Natürlich werden diese Projekte entsprechend intensiv betreut; permanente Diskussionen stellen sicher, dass die Studenten nicht zu unbeteiligten Wasserträgern unserer wissenscha�lichen Arbeit geraten und dass der theoretische Hintergrund der Arbeit völlig klar wird. Denn Empirie ohne klaren Theoriebezug wäre Pseudowissenscha�. Letztlich soll also unser Praktikum begreif- und erfahrbar machen, wie Naturwissenscha� im Grunde funktioniert. Die Aufenthaltsdauer an der Forschungsstelle ist kurz genug, um keinen »Inselkoller« au�ommen zu lassen, denn schließlich wohnen fast alle Mitarbeiter auch im Hause. Auch auf uns ständig dort Anwesenden wirkt sich die gelegentliche Veränderung des sozialen Umfeldes, die Notwendigkeit, sich immer wieder mit neuen Mitarbeitern auseinander setzen zu müssen, positiv aus. Und eine dreiwöchige Kontaktzeit gewährleistet auch gutes gegenseitiges Kennenlernen, was besonders wichtig wird, wenn Studenten beabsichtigen, als Diplomanden oder Dissertanten einzusteigen. Dann müssen nicht nur Herz und Hand stimmen, sondern auch die soziale Verträglichkeit gewährleistet sein. Denn für das Funktionieren einer Arbeitsgruppe ist ein gutes menschliches Klima sogar noch wichtiger, als noch so hervorragende geistige Qualitäten. Gerade in den Wissenscha�en scheint man nur langsam zu begreifen, dass Teamarbeit gefragt ist und das noch immer weit verbreitete Einzelkämpfertum beinahe einer Selbstverstümmelung gleichkommt. Leider wird auch bei der Besetzung von Lehrstühlen auf Universitäten immer noch vor allem auf die wissenscha�liche Qualifikation Wert gelegt, Team- und Managementfähigkeiten spielen wenig Rolle. Was sich natürlich an den Universitäten entsprechend verheerend auswirkt. Wie sagte doch Jelle Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 117 Atema, der Direktor des Boston University Marine Program in Woods Hole, als ihm ein niederländischer Kollege einen Jungassistenten aus eigenem Stall schmackha� machen wollte: »Don´t tell me how good he is, is he nice?«. Es gibt an der Konrad Lorenz Forschungsstelle kaum Trennung von Beruf und Privat. Man arbeitet, wohnt und lebt im Haus. Entsprechend konzentriert kann das fachliche Klima werden, so das soziale Klima und die Mentalitäten im Hause stimmen. Es sehnt sich tatsächlich niemand am Montag schon wieder nach dem Freitag. Bürgerliche Wochenenden und 40-Stundenwochen gibt es am Auinger, so der alte Hausname unseres Gebäudes kaum. Das Leben orientiert sich am Rhythmus der Gänse, der anderen Tiere und an den Notwendigkeiten einer zielorientierten Forschungsarbeit. Jeder weiß hier, worauf er sich einlässt, und die Studenten haben selber großes Interesse daran, ihre Praktikums- Diplom- und Dissertationsprojekte abzuschließen. Dass diese eigenartige Mischung aus moderner organismischer Forschung, internationalem Pfadfinderlager und Diskussionsklub erfolgreich ist, zeigt ein Blick auf unsere Publikationsleistung. Für die etwa 200 000 € jährlichen Gesamtaufwand sind Quantität und Qualität der Ergebnisse nicht nur im Rahmen des Wiener Zoologischen Institutes, bzw. österreichweit, sondern auch nach internationalen Maßstäben beachtlich (Exkurs 10). Exkurs 9: Soziale Strukturen bei Graugänsen Dominanz Auf den ersten Blick erweckt eine Gänseschar den Eindruck eines Heringsschwarms: eine Ansammlung beliebig austauschbarer, identischer Individuen. Aber bereits ein zweiter Blick zeigt, dass manche Individuen eng zusammenhalten, dass man zu zweit oder in größeren Gruppen gemeinsam umherzieht. Solch räumliche Nähe lässt die Gliederung in soziale Untereinheiten sichtbar werden. Durch das Band des Triumphgeschreis gebunden (Lorenz 1988), ist man untereinander, im Paar, der Familie oder innerhalb des Clans friedlich, grenzt sich aber betont aggressiv gegen den Rest der Schar ab. Die Grundeinheit der Schar ist das heterosexuelle Paar, welches ganzjährig, also auch außerhalb der Vermehrungszeit im Frühling zusammenbleibt, unabhängig davon, ob in Begleitung von Nachkommen oder nicht. Nur wenigen Paaren pro Jahr gelingt es, Junge bis zum Flüggewerden aufzuziehen (s. unten). Wenn aber der Nachwuchs bis zum Flüggewerden, etwa 10 Wochen nach dem Schlupf überlebt, dann bleiben diese Junggänse den gesamten Herbst und Winter bis zum erneuten Beginn der Balz, im darauffolgenden Februar, mit den Eltern zusammen. Diese Familien bilden neben den Geschwistergruppen der 1–2jährigen, die nicht mehr in Begleitung ihrer Eltern, aber noch unverpaart zusammenhalten, die größten klar erkennbaren Untereinheiten der Schar. In seltener Regelmäßigkeit treten neben Paaren auch Trios auf, welche meist dadurch entstehen, dass sich entweder ein Weibchen einem Männchenpaar anschließt, oder ein meist jüngeres Weibchen Anschluss an ein heterosexuelles Paar sucht. Bei einem weibchenverschobenen Geschlechterverhältnis in der 118 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Schar bilden sich vermehrt diese Harems, wobei die soziale Bindung exklusiv zwischen dem zentralen Paar bestehen bleibt, das zweite Weibchen ist »Drittes Rad am Wagen«, mit dem der Ganter zwar kopuliert, sich aber nicht weiter um sie kümmert. Diese Haremsbildung ist also, im Gegensatz zu den meisten anderen Haremssystemen, nicht Ergebnis einer aktiven Rekrutierung zusätzlicher Weibchen durch ein Männchen. Im Falle einer männchenverschobenen Geschlechterverteilung in der Schar treten dagegen vermehrt sogenannte »homosexuelle« Männchenpaare auf. Dies hat allerdings weniger mit Sexualität zu tun. Vielmehr scheint es bei diesen gleichgeschlechtlichen Männchenpaaren darum zu gehen, eine ranghohe Warteposition auf eine heterosexuelle Verpaarung einzunehmen. Dies bestätigt sich durch den gelegentlichen spontanen Zerfall eines solchen Paares beim Auftauchen eines verfügbaren Weibchens. Weibchenpaare sind bei Gänsen noch niemals beobachtet worden, sie sind auch durch unterschiedliche Geschlechterverhältnisse in der Schar nicht induzierbar. Genaue Untersuchungen der räumlichen Nähe zwischen ruhenden Individuen konnten erst durchgeführt werden, als zwei Personen zur Verfügung standen, welche die etwa 130 Gänse in der Schar »am Gesicht« erkennen konnten. So fanden Didone Frigerio und Brigitte Weiss heraus, dass Töchter auch nach Jahre und selbst wenn sie selber schon verpaart sind, sich näher bei ihren Müttern aufhalten, als dies aufgrund einer Zufallserwartung der Fall wäre (Frigerio u. a. 2001a). Dies war für Söhne nicht der Fall. Wie bei vielen sozialen Wirbeltieren leben also auch Graugänse offenbar in einer »weibchengebundenen Gesellschaft«. Es ergeben sich weibchenzentrierte Clanstrukturen also dadurch, dass Töchter in der Nähe ihrer Mütter, Männchen aber in der Nähe ihrer Partnerinnen bleiben. Stellt sich die Frage, warum die ohnehin in der Schar lebenden Individuen so erpicht auf engeren sozialen Anschluss sind. Das ist für die heterosexuellen Paare für die Fortpflanzungszeit einfach zu beantworten, denn für Reproduktion braucht man einen heterosexuellen Partner. Aber warum werden Paarbindungen ganzjährig aufrechterhalten, warum bleiben die Familien und dann die Geschwistergruppen so lange zusammen, warum schließen sich gar zwei Männchen bei Weibchenmangel zu einem Paare zusammen? Unter den vielen Gründen (Lamprecht 1987) sind solche Zusammenschlüsse, die Lorenzschen Triumphgeschreigemeinschaften (Fischer 1965), vor allem soziale Allianzen. So erreichen Gänse eine wesentlich höhere Stellung in der ScharRangordnung, als sie es alleinstehend jemals erlangen könnten. Die »Singles«, meist ältere Männchen, die ihre Partnerin verloren, sind tatsächlich die »underdogs« in der Schar. An den Rand gedrängt, fallen sie häufig einem Fressfeind zum Opfer. Ist die Erregung in der Schar hoch, etwa vor einer Fütterung, bilden sich oft Fronten zwischen Gänsegruppen, die einander mit vorgestreckten Hälsen androhen. Dabei handelt es sich um Auseinandersetzungen zwischen den oben erwähnten, weibchenzentrierten Clans. Mit dem strukturellen Muster gaben wir uns nicht zufrieden. Wir fragten vielmehr nach der Funktion solcher Clanstrukturen. Welchen Vorteil bringt es für eine Tochter, in der Nähe der Mutter zu bleiben. Es zeigte sich, dass »sozial unterstützte« Individuen, also solche, die sich im Scharverband in der Nähe ihrer sozialen Alliierten aufhalten, mehr Auseinandersetzungen gewinnen, länger fressen und gerin- Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 119 gere Stresshormonwerte zeigen als nicht-unterstützte (Frigerio und Weiss in Vorber.). Gerade die Weibchen müssen übers Jahr sehr auf ihre Energiebilanz achten, um ihre Fortpflanzungschancen zu wahren, die Qualität der »sozialen Unterstützung« kann daher entscheidend sein. Am höchsten in der Scharhierarchie stehen die Junge führenden Paare, gefolgt von ebendiesen Jungen. Es folgen in Reihenfolge absteigender Ranghöhe die homosexuell verpaarten Ganter, die heterosexuell verpaarten Ganter, verpaarten Gänse und Mitglieder von Geschwistergruppen. Ranghöhe ist nicht von Körperkraft abhängig, sondern von Motivation und sozialer Unterstützung durch die Sozialpartner (Lamprecht 1986a, Frigerio u. a. ). Ranghöhe bestimmt die Verfügbarkeit von Partnern und anderen Ressourcen, wie etwa (geklumpter) Nahrung, aber auch vorteilhafter Positionen innerhalb der Schar, ist also recht unmittelbar relevant für die Fitness eines Individuums. Die Untergruppen einer Graugansschar können daher teils als kooperative Einheiten unter Verwandten, teils als »machiavellische Allianzen« zwischen nicht-Verwandten gesehen werden. Gänse leben in einer Schar, weil sie durch Freßfeinde dazu gezwungen werden. Die erwähnten sozialen Allianzen sind erforderlich, die individuellen Interessen im Konkurrenzfeld der Schar zu wahren. Trotz großer individueller Variation findet man je nach Geschlecht und sozialer Stellung typische Verhaltensausprägungen, die durch unterschiedliche Aggressionsbereitschaft, und Sicherverhalten gekennzeichnet sind. So sind Familienganter die aggressivsten Individuen in der Schar. Sie stehen ständig »unter Strom«, sichern viel und fressen relativ wenig. Sie bestimmen maßgeblich die Rangstellung einer Familie (Lamprecht 1986 a,b). Je jünger und zahlreicher die Gössel, desto stimulierter sind die Ganter. Die Familienweibchen sind wesentlich weniger aggressiv und außenorientiert, sie sichern und fressen viel. Der Nachwuchs ist natürlich verfressen, müssen die vegetarischen Gössel von einem Schlupfgewicht von etwa 120 g ausgehend, innerhalb von 10 Wochen ihr Fluggewicht von etwa 2 500 g erreichen. Und immerhin sichern und drohen vier dreiwöchige Junge zusammen etwa so viel wie der Ganter. Gantern in Ganterpaaren sind noch aggressiver und »aufgedrehter« als heterosexuell gebundener Männchen. Graugänse leben im Rhythmus der Jahreszeiten. Im Frühling sind die Testosteronspiegel der Ganter am höchsten (Hirschenhauser u. a. 1999a), folgerichtig sind sie am aggressivsten. In der Winterschar, bei minimalen männlichen Geschlechtshormonwerten sind Ganter dagegen am friedlichsten. Wetterverhältnisse modulieren das Verhalten recht direkt: Je tiefer Temperatur und Luftdruck, desto friedlicher. Lebensgeschichten Von Anbeginn herrschen ungleiche Startbedingungen für individuelle soziale Karrieren: Schon die Eier eines Geleges sind unterschiedlich groß. Da Überleben in den ersten Tagen mit dem Schlupfgewicht zusammenhängt, haben aus den größeren Eiern schlüpfende Gössel einen Startvorteil – ein klarer Fall von »mütterlicher Manipulation«. Da Mütter nur über eine begrenzte Kapazität verfügen, Energie in Nachkommen zu übertragen, streuen sie ihre Gunst ungleichmäßig. Anstatt viele kleine (mit geringer Überlebenschance) oder wenige große (mit hoher Überlebenswahrscheinlichkeit) Eier zu produzieren, legen sie eine mittlere Anzahl ungleichmäßig großer Eier. In guten Jahren kommen alle 120 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Nachkommen daraus durch, in schlechten Jahren vielleicht immerhin noch die Tiere aus den großen Eiern. Aber das ist noch lange nicht alles. Mütter manipulieren auch massiv und am Genom vorbei die Persönlichkeit ihrer Nachkommen. So variieren Mütter auch die Menge an Hormonen in den Dottern ihrer Eier. Und aus einem Ei mit viel Androgen (z. B. Testosteron) schlüpfen aggressiv-forsche Gössel, aus den Eiern mit wenig Androgenen dagegen zurückhaltend-scheue Individuen. Bereits nach wenigen Tagen brechen kurze aber heftige Kämpfe zwischen den Gösseln aus, eine Rangordnung wird etabliert. Die jungen Männchen sind bereits erheblich aggressiver und in der Regel dominant über ihre weiblichen Geschwister. Die erfochtene Rangordnung zwischen den Geschwistern kann, muß aber nicht stabil bleiben. Wenn etwa ein Gössel erkrankt, rutscht es automatisch ans Ende der Hierarchie. Nach etwa zwei Monaten sind die Gössel flügge und verbleiben noch bis ins darauffolgende Frühjahr im Familienverband. Wenn die Eltern wieder in Balzstimmung kommen und wohl auch beim Nachwuchs erstmals »Frühlingsgefühle« erwachen, trennt sich die Familie. Die Jungen beginnen, erste Beziehungen zu künftigen Partnern zu knüpfen, was sich darin äußert, dass man mit »Winkelhals« Interesse bekundend nebeneinander her läuft, bzw. sich wie beiläufig stets in der Nähe aufhält. Diese »Verlobungen« zerfallen im Frühsommer wieder, bilden aber oft den Grundstein für langanhaltende Partnerschaften. Die einjährigen Geschwister schließen sich wieder zusammen und verbringen manchmal sogar ein zweites Jahr mit ihren Eltern, wenn diesen keine neuerliche Aufzucht gelang. Im zweiten Frühjahr des Lebens wird es schließlich ernst. Es kommt zur Paarbildung, oft zwischen einem dreijähriger Ganter und einer zweijährigen Gans. Meist handelt es sich dabei um die vorjährigen »Verlobungspartner«. Eine erfolgreiche Brut und Jungenaufzucht kann aber noch auf sich warten lassen und gelingt in der Regel erst älteren, erfahrenen Weibchen, bzw. Paaren. Im langzeitmonogamen »Typus-Fall« bleiben die Paarpartner über ein Jahrzehnt zusammen. Unsere ältesten stabilen Paare waren 17, bzw. 19 Jahre verpaart. Nach Auswertung der Daten von 112 Weibchen, die 171 Paarungen, bzw. 566 Verpaarungsjahren entsprechen, beträgt die durchschnittliche Verpaarungsdauer etwas über 3 Jahre. Die Bindungsdauer vor einer »Scheidung«, also einer Trennung ohne dass ein Partner stirbt oder verschwindet (immerhin bei 20 % aller Paare der Fall), beträgt nur etwa 2,9 Jahre, während Paarungen, die durch Unfall oder Tod des Partners beendet werden (etwa 80 % der Partnerschaften), im Schnitt 3,4 Jahre bestehen. Weil Gänse relativ häufig am Nest Fuchs oder Adler zum Opfer fallen, beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der Weibchen 7, jenes der Männchen dagegen 8 Jahre. Über 10jährige Ganter haben nach Verlust ihrer Partnerin in der Regel wenig Chance, sich wieder zu verpaaren. Oft existieren sie als Einzelgänger noch einige Jahre am Rand der Schar, bis sie, psychosomatisch geschwächt, Parasiten oder Freßfeinden zum Opfer fallen. Andere wiederum gehen »Männerfreundschaften« ein und können dermaßen sozial stabilisiert, ein hohes Alter erreichen, wie etwa beim im Herbst 1993 mit 27 Jahren verschwundenen »Herrn Viel« der Fall. Beziehungsprobleme treffen vor allem Männchen, die es jahrelang trotz vieler Versuche es nicht schaffen, eine Partnerin stabil an sich zu binden. »Beziehungslose« Weibchen treten dagegen relativ selten auf, kommen aber ebenfalls vor; sie zeichnen sich durch Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 121 immer häufigere Umverpaarungen aus. In beiden Fällen liegen die Ursachen dieser recht fitnessdämpfenden »sozialen Inkompetenz« wahrscheinlich in sozialen Störungen während der Jugendentwicklung. Nur etwa 14 % der Weibchen wurden älter als 10 Jahre, darunter die erfolgreichsten. Gerade im Alter, oft nach mehr als einem Jahrzehnt stabiler Partnerschaft, werden Trennungen wieder häufiger, wobei meist die Weibchen ihren alten Partner zugunsten eines jüngeren aufgeben, wie die Paargeschichte von Blasius und Sinda illustriert (Exkurs 8). Der Jahresgang des Scharlebens Eine Gänseschar hält keineswegs das ganze Jahr über gleichmäßig eng zusammen. Das Jahr ist voller sich regelmäßig wiederholender Ereignisse, welche die Notwendigkeiten des Soziallebens widerspiegeln (Abb. 4). Anfang März steigt bereits die Aggressionsbereitschaft der Männchen, Rivalen kämpfen um die Gunst von Weibchen, die Familien zerfallen, Paare sondern sich ab, sie suchen nach einem Nistplatz nicht zu nahe an den anderen, wo das Weibchen, gut getarnt, durch Ausmulden im dürren Gras ein Nest anlegen kann. Abbildung 4: Saisonale Wechsel im Leben von Graugänsen: Balz, Brut, bzw. Jungenaufzucht erfolgen außerhalb des engen Scharverbandes. Nach Beendigung der Großgefiedermauser, während der Gänse flugunfähig sind, schließen sich Brüter und die Mehrheit der Nichtbrüter zur Sommerschar zusammen. Ein Wintereinbruch gibt das Signal für den Zug ins Winterquartier. Kurz nach der Ankun� vom Frühjahrszug im Brutrevier zerfallen die Familien vom Vorjahr und schließlich auch der Scharverband. Nach Rutschke (1997), Hirschenhauser u.a. (1999a). 122 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Anschließend legt die Gans alle 2 Tage ein etwa 150–200 g schweres Ei in ihr einfaches, gut getarntes Nest. Nach jeder Eiablage wird es wieder sorgsam zugedeckt. Gebrütet wird erst, wenn das Gelege komplett ist. Während dieser Zeit kopulieren die Paarpartner täglich einige male, sie halten eng zusammen, meist weniger als einen halben Meter. Erst wenn das letzte ihrer 3–6 Eier gelegt ist, beginnt die Gans mit der Brut. Eine 3 kg schwere Gans legt also innerhalb von 12 Tagen etwa ein Kilogramm an Eiern, zu deren Bildung hauptsächlich ihre Fettreserven herhalten müssen. Während das Weibchen 28 Tage lang alleine brütet und dabei täglich nur 2 bis 3 mal je 10 Minuten Pause einlegt, hält sich das Männchen entweder unauffällig in der weiteren Umgebung des Nestes auf, wohl, um den Neststandort nicht zu verraten. Oder er gesellt sich zur Restschar, um etwa noch weitere Kopulationen mit jüngeren und daher später brütenden Weibchen zu ergattern. Die kurzen, seltenen Brutpausen verbringt das Paar gemeinsam. Nur diese wenigen Minuten pro Tag stehen der während dieser Zeit stark abgemagerten Gans zur Nahrungsaufnahme zur Verfügung. Es kommt sogar vor, dass ihre Gans alle ihre Reserven zu früh aufbraucht und nur wenige Tage vor dem Schlüpfen ihre Brut aufgeben muss. Die Gössel schlüpfen synchronisiert, meist innerhalb von weniger als einer Stunde. Dazu verständigen sie sich bereits Tage vor dem Schlüpfen durch drei verschiedene Laute, die auch zur Kommunikation mit der Mutter dienen: Ein sozialer Kontaktlaut (ein melodische wi-wi-wi), ein Protestlaut, der anzeigt, dass sich das Gössel im Ei nicht wohl fühlt (ein hohes, einsilbiges Fiepen, das Konrad Lorenz auch das »Pfeifen des Verlassenseins« nannte), und schließlich ein angenehmes Trillern, welches anzeigt, dass es dem Gössel im Ei gut geht und es gleich einschlafen wird. Die brütende Mutter reagiert recht spezifisch auf diese Laute und hält auch selber akustisch Kontakt mit den Jungen in den Eiern. Wenn für Handaufzucht Gössel im Brutschrank schlüpfen, ahmen die Aufzieher bereits vor dem Schlupf diese akustische Kommunikation nach, was zum frühen gegenseitigen Kennenlernen wichtig ist. Zugegeben, besonders intelligent sieht es natürlich nicht aus, wenn erwachsene Leute ihren Kopf in einen Brutschrank stecken und mit Eiern sprechen. Mit dem Schlüpfen der Jungen, März oder April, schließt sich der Ganter wieder eng dem Weibchen und seinen Gösseln an, die Junge führenden Paare bilden lockeren Gruppen. Etwa zwei Wochen nach dem Schlupf setzt die Großgefiedermauser ein, was die Gänse flugunfähig und recht scheu macht. Die erfolgreichen Paare werden gleichzeitig mit ihrem Nachwuchs im Juli flügge. Sollten bis etwa 10 Tage nach dem Schlüpfen die Jungen sterben, was nicht ungewöhnlich ist, können die zunächst erfolglosen Eltern ihre Großgefiedermauser verzögern. Gelegentlich wird so spät noch ein Nachgelege produziert, die zweiten Jungen schlüpfen daher mit einer Verzögerung von gut 40 Tagen und die Eltern gehen etwa 14 Tage nach dem Schlupf des Zweitgeleges in die Großgefiedermauser und synchronisieren so die eigene Flugunfähigkeit mit jener der Jungen. Gesteuert wird dieses exakte Timing über ein Wechselspiel von Steroid- und Schilddrüsenhormonen. Die Federn können nur abgestoßen werden, wenn die Geschlechtssteroide, Testosteron und Östrogen, am Minimum liegen. Alle Umweltreize, die diese Geschlechtshormone hoch halten, so auch eine zweite sexuell-reproduktive Phase, verhindern die Mauser. Die Gössel eines Zweitgeleges haben übrigens so spät im Jahr noch schlechtere Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 123 Chancen, als die ersten. Obwohl scheinbar bei warmen Wetter im üppigen Grün stehend, sterben sie buchstäblich wie die Fliegen. Gründe dafür sind der geringere Proteingehalt der bereits voll ausgebildeten Vegetation und offenbar ein erhöhtes Infektionsrisiko mit diversen Parasiten. Mit der erneuten Flugtüchtigkeit findet sich die Schar mit anfänglichen Reiberein wieder zusammen. Die neuen Familien pochen auf ihren hohen Rang, jeder muss wieder einigermaßen seinen Platz in der Gesellschaft finden. Die Sommerschar unternimmt oft in Untergruppen gespalten, tägliche Weidezüge, um abends wieder gemeinsam auf einer sicheren Wasserfläche zum Übernachten einzufallen. Im Spätherbst steigen die Gruppengrößen und die Stabilität der Schar. Im November sammeln sich Scharen zu riesigen Gruppen vor ihrem gemeinsamen Abflug ins Winterquartier. So etwa versammeln sich zehntausende Graugänse im burgenländisch-ungarischen Grenzgebiet, dem Hanzag, und weiden dort auf den abgeernteten Feldern. (wo sie auch zu tausenden jährlich sinnlos abgeknallt werden). Sie warten auf das Signal zum Aufbruch in Form eines Wintereinbruchs. Nun sind die Gänse am schwersten, die Fett-Tanks sind gefüllt, genügend Energie für einen langen Flug. So liegt das Normalgewicht einer Graugans übers Jahr bei etwa 22 kg. Im November kann dieselbe Gans weit über 3 kg wiegen. Ein solcher Ballast verzögert zwar eine schnelle Flucht, wirkt sich aber im Gleitruderflug, bei etwa 60 km »Ground speed« kaum mehr aus. Nur wenn Eis und Schnee die nahrungsspendenden Flächen versiegeln, brechen die Gänse zum mehrere tausend Kilometer weiten Zug nach Nordafrika auf, um oft nur wenige Wochen später zurückzukommen und nach dem Zerfallen der Scharen erneut mit dem Brutgeschäft zu beginnen. Immer öfters passiert es, dass kein Winteraufbruch die Gänse in Ostösterreich zum Abflug zwingt. Sie verwenden dann einfach ihren eigentlich für den Zug vorgesehenen Winterspeck, um das über den Winter magerer werdende Nahrungsangebot auszugleichen und sind dann im Frühjahr bereits vor Ort, wie im Falle jener Gänse, die am Neusiedlersee brüten, oder haben nur noch eine vergleichsweise geringe Distanz in ihre Brutgebiete in Nordosteuropa zu überwinden. Sollten im Gefolge der globalen Erwärmung die Winter in Ostösterreich milder, bzw. schneeärmer werden (was keineswegs sicher ist), werden die mitteleuropäischen Wildgänse immer öfter auf ihren Zug verzichten. Die Grünauer Schar ist nie fortgezogen. Die Gründerindividuen wurden handaufgezogen, es standen also keine zugerfahrenen Eltern zur Verfügung. Und da die Zugrouten in Form von Familientraditionen weitergegeben werden, wurde die Schar sesshaft. Bei Eis und Schnee werden die Gänse von uns genügend gefüttert. Die Kälte ist kein Problem, wer schon je in das Brustgefieder einer Gans gegriffen hat, kennt die Qualität ihres körpereigenen Daunenschlafsacks. Bei großer Kälte werden sogar die Beine eingezogen, der Schnabel unter den Flügel gesteckt und ausgeharrt. Aber auch unsere grünauer Gänse bauen ihren Winterspeck bis ins Frühjahr wieder auf ein normales Maß ab, auch unsere Weibchen geraten im Gefolge der Brut regelmäßig in ähnliche energetische Probleme, wie ihre völlig wild lebenden Kolleginnen, unserer Fütterung zum Trotz. Die über Jahrmillionen evolutionär entwickelten Regelmechanismen sind eben nicht durch unsere läppische menschliche Fürsorge außer Kraft zu setzen. 124 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Jede Menge Misserfolg: Wie schafft es eine Gans, erfolgreich Nachwuchs aufzuziehen? Sinda, die erfolgreichste Gans in der Grünauer Schar zog mit 2 Männchen in 17 Brutsaisonen insgesamt 30 flügge Junge groß. Das ist Allzeit-Scharrekord. Wie bei sozialen Tieren die Regel, verteilt sich der Fortpflanzungserfolg sehr ungleichmäßig über die Schar. Wenige Individuen hinterlassen viele Nachkommen, viele Brüterinnen dagegen wenige oder gar keine. Wie aus den abgeschlossenen Lebensgeschichtedaten von 192 Weibchen der Grünauer Schar der vergangenen 20 Jahre hervorgeht, haben nur etwa ein Drittel je erfolgreiche Brutversuche unternommen, also überhaupt Nester gebaut und Eier erbrütet. Nur 47 dieser 192 Gänse (25 %) schafften es, flügge Junge aufzuziehen, und nur 10 Weibchen (5 %) schafften es, mehr als 10 flügge Junge aufzuziehen. Junge, unerfahrene Weibchen, die selber meist noch kein Nest anlegen, »verlieren« ihre Eier auf der grünen Wiese. Häufiger allerdings versuchen sie, diese in die Nester anderer Weibchen dazuzulegen. Sie werden damit zu innerartlichen Brutparasiten (Petrie und Møller 1991). Weigmann und Lamprecht (1991) zeigten bei koloniebrütenden Streifengänsen, dass dieses Dazulegen nicht zufällig geschieht, sondern dass die parasitierenden Weibchen ältere, erfolgreiche Weibchen bevorzugen. Falls die Parasitinnen entdeckt werden, vertreiben die Nestbesitzerinnen diese auch gewaltsam. Gelegegrößen, die solchermaßen auf über 10 anwachsen, werden meist verlassen. Es ist gerechtfertigt von »Parasitismus« zu sprechen, da die Schlupfraten der Eier der Nestbesitzerinnen signifikant sinken, wenn dazugelegt wird. Die Schlupfraten der parasitischen Eier sind noch geringer, aber größer als Null. Daher ist der Brutparasitismus besonders für junge, unerfahrene Gänse eine Strategie, zumindest auf Kosten anderer ein Minimum an eigenen Nachkommen zu erzielen. Sie machen eben das beste aus einer schlechten Situation. Drei unterschiedliche Mechanismen können dazu führen, dass die sozialen Geschwister in einer Familie nicht, oder nur teilweise die Nachkommen des Paares sind: Seitensprünge, Brutparasitismus, sowie das Durchmischen von Gösselgruppen wenige Tage nach dem Schlüpfen. Da Eltern und Junge einander kurz danach noch nicht individuell kennen, zieht gewöhnlich das dominante Paar nach einer zu engen Annäherung und einer Durchmischung der beiden Geschwistergruppen mit allen Gösseln davon. Dem unterlegenen Paar könnte das eigentlich recht sein, da nun schließlich andere die Mühen der Kinderaufzucht übernehmen. Dem ist aber nicht so. Sind mehr als 6 Schlüpflinge in einer Geschwistergruppe, dann wird der Huderplatz im Gefieder einer Gans knapp. Und schlecht gehuderte Gössel erwischen in den ersten paar Wochen recht leicht eine Infektionskrankheit und sterben. Zudem scheint es wichtig für den Paarbestand und den weiteren Fortpflanzungserfolg eines Paares zu sein, den Winter in Begleitung von Nachwuchs zu verbringen. Gänse brauchen meist einige Anlaufzeit, um wirklich reproduktiv erfolgreich zu werden. Die älteren, 10 bis über 20jährigen Gänse produzieren im Schnitt zwei flügge Junge pro Jahr, die jüngeren, 2 bis 9jährigen dagegen nur 0,5. Tatsächlich ist die signifikant positive Beziehung zwischen Alter und Erfolg nur bei den älteren Gänsen festzustellen. Dies bedeutet nicht, dass nicht auch Jüngere gelegentlich erfolgreich sein können. In zwei Fällen seit 1990 zogen Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 125 sogar zweijährige Gänse, noch ohne Begleitung eines Ganters im Alleingang erfolgreich Junge auf, aber das sind Ausnahmen. Zumindest die grünauer Gänse werden also erst wirklich erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, älter als 10 Jahre zu werden. Nur 25 von 192 Weibchen (13 %) schafften dies, obwohl kein menschlicher Jagddruck auf der Schar liegt. Haupttodesursache sind Raubfeinde, wie Fuchs, Adler, aber auch Unfälle und Parasiten. Da Parasiten eine wichtige Rolle bei Partnerwahl, bzw. allgemein, im Zusammenhang mit den Verhaltensmechanismen spielen, welche Evolution bewirken, werden unsere Gänse, oft zum großen Unverständnis mancher Besucher, nicht veterinärmedizinisch betreut. Das wäre ein wesentlich stärkerer Eingriff in die Schar, als die tägliche Zufütterung. Denn Parasiten und Parasitenresistenz sind in Partnerwahl und daher als Triebfedern für Evolution von größter Wichtigkeit. Gute Partnerschaften wiederum scheinen sich fördernd auf das Immunsystem und daher auf Parasitenresistenz auszuwirken. Wenn der Fortpflanzungserfolg in einer Gruppe derart ungleichmäßig verteilt ist, und anscheinend sehr von der sozialen Kompetenz und Erfahrung eines Individuums abhängt, liegt wohl die große evolutionäre Bedeutung dieses Themas klar auf der Hand. Exkurs 10: Projekte an der Konrad Lorenz Forschungsstelle Wie für alle Forschungsinstitutionen der Fall, ist die aktuelle fachliche Ausrichtung der Konrad Lorenz Forschungsstelle ein Produkt ihrer Geschichte, der internationalen Entwicklungen und der vorhandenen Möglichkeiten. Das nach wie vor wichtigste »Forschungsmodell«, die freilebende Graugansschar, hinterließ uns Konrad Lorenz. Nach seinem Tod begann nach der Neugründung der Forschungsstelle im Jahre 1990 die Arbeit quasi bei Null. Eine anfängliche Orientierungsphase fokussierte unsere Arbeit auf Schnittstellen zwischen der mechanistischen Ebene (Verhaltensphysiologie) und evolutionären Funktionen (Ökoethologie; s. Exkurs 1). Denn dafür eignen sich die halbzahmen, aber freilebenden Tiere am besten. Damit stehen wir, ohne dass dies unser eigentliches Ziel gewesen wäre, direkt in der Lorenzschen Forschungstradition. So ist der Einfluss von Steroidhormonen auf Verhalten und der modulierenden Rückkopplung von Verhalten und äußeren Reizen auf diese Hormone ein zentrales Thema. Steroidhormone (Geschlechtshormone: Androgene und Östrogene, sowie Stresshormone: Glukocorticoide) sind Schlüssel der Verhaltensanpassung an Umweltbedingungen. Sie vermitteln die grundsätzlichen Entscheidungen, in Reproduktion zu investieren und sie steuern, wofür die zur Verfügung stehende Energie verwendet wird, Verhalten, Wachstum oder Vermehrung. Graugänse sind daher Modelle zur Erforschung grundlegender Fragestellungen. Dennoch sind natürlich diese Ergebnisse auch in Hinblick auf »die Biologie der Graugans« relevant. Das gilt für alle unsere Tiermodelle. Weitere Modellsysteme neben den Gänsen sind seit etwa 1993 die Kolkraben und seit 1997 die Waldrappe. Bestrebungen, das Spektrum unserer Tätigkeit auf Fische, Kleinsäuger- und Vogelgesellschaften auszuweiten, wurden wieder eingestellt. Mit begrenzten Mitarbeitern und Ressourcen auf zu vielen »Hochzeiten 126 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau zu tanzen« wäre nicht zielführend. Es bleibt eine hinreichende Breite, die auch in den Natur- Arten- und Umweltschutzbereich ausstrahlt. In der Folge findet sich eine knappe Zusammenfassung unserer Arbeit im vergangenen Dutzend von Jahren. Die Zitate sollen als exemplarische Belege dienen. Eine aktuelle und vollständige Darstellung der Forschung findet sich auf unserer Homepage: http://www.univie.ac.at/zoology/nbs/gruenau Graugänse (Anser anser) Während einer anfänglichen Orientierungsphase von einigen Jahren beobachteten wir die Auswirkungen der Differenzierung der Geschlechter und sozialen Kategorien von Gänsen, unverpaart, verpaart mit und ohne Nachwuchs, verwitwet, etc. auf deren Verhalten. Wir interessierten uns für Interaktionen der Tiere mit ihren natürlichen Fressfeinden, insbesondere Stein- und Seeadler (Kotrschal u. a. 1992). Und wir forschten experimentell am Zusammenhang zwischen Nahrungsdichte, -qualität und -verteilung , Dominanz und Konkurrenz (Kotrschal u. a. 1993). Die Scharentwicklung wurde von Hemetsberger (2001) zusammengefasst. Die soziale Organisation der Schar bleibt Forschungsthema. Allein die Fähigkeit, zweier Mitarbeiterinnen, die Gänse der Schar an ihrem Gesicht zu unterscheiden, gestattete es, die räumliche Verteilung der Individuen in der Schar zu erfassen (Frigerio u.a. 2001a). Dabei zeigte sich, dass sich Töchter auch nach Jahren noch näher bei ihren Müttern aufhalten, als durch Zufall zu erwarten. Die Männchen dagegen orientieren sich in an ihren Weibchen. Warum diese weibchenzentrierte Klanstrukturierung? Weiterführende Untersuchungen zeigten, dass »soziale Unterstützung« offenbar ganz wichtig für die Scharindividuen ist. So gewinnen Gänse in Nähe ihrer Verbündeten mehr Auseinandersetzungen, scheiden dabei weniger Stresshormone aus und gewinnen Zeit zur Nahrungsaufnahme, selbst wenn diese Verbündeten einfach anwesend sind, sich also nicht einmischen (in Vorbereitung). Schon bald war klar, dass die freilebende, aber gut zugängliche Schar am besten für experimentelle Fragestellungen am Schnittpunkt zwischen physiologischen Mechanismen und evolutionären Funktionen geeignet ist. Angeregt durch den Ordinarius für Ethologie an der Universität Wien, den Verhaltensendokrinologen John Dittami, interessierten wir uns schon um 1993 für Steroidhormone als Motivationsfaktoren für Verhalten. Anfängliche Versuche, mit Blutproben zu arbeiten, stellten sich als wenig zielführend heraus. Obwohl es weder für die Tiere sonderlich belastend, noch technisch schwierig ist, ein paar Tropfen Blut aus der Bein- oder Flügelvene zu zapfen, waren doch unsere Gänse wenig begeistert. Sie wurden scheuer, konnten daher für wiederholte Probennahme kaum gefangen werden. Zudem beeinflusste solch eine invasive Prozedur die zu messenden Parameter, etwa das Stresshormon Kortikosteron. Eine seitdem anhaltende, intensive und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Institut für Biochemie (Leitung Prof. Bamberg) an der Wiener Veterinärmedizinischen Universität, insbesondere mit Erich Möstl und Rupert Palme, schuf Abhilfe. Unsere Kollegen entwickelten hochempfindliche Enzymimmunoassays zur Bestimmung von Abbauprodukten der Steroidhormone aus Kot oder Urin. Der geniale Trick bestand in der Anwendung Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 127 »gruppenspezifischer« Antikörper. Diese Moleküle binden nicht hochspezifisch, sondern an stabilen Seitenketten, welche den meisten Abbauprodukte eines bestimmten Steroidhormons gemeinsam ist. Dadurch wird die Bestimmung wesentlich genauer, als würde man versuchen, die im Vergleich recht geringen ausgeschiedenen Mengen des Original-Hormons zu erfassen. Es geht dabei weniger um die absoluten Mengen im Kot, sondern über ihre zeitliche Veränderung im Zusammenhang mit Verhalten. Gänse sind dafür hervorragende Modelltiere, denn die Darmpassagezeit liegt im Mittel bei etwa 3 Stunden und es wird alle 20 bis 30 Minuten Kot abgesetzt. Modulieren Ereignisse in diesen Zeiträumen die entsprechenden Hormontiter im Blut, so wird dies im Kot messbar. Geduldige Studenten sammeln also Kotproben und gewinnen dadurch ein gutes, zeitlich hochauflösendes Fenster in den Hormonaushalt der interessierenden Individuen, deren Verhalten man ja vorher beobachten oder auch experimentell manipulieren kann. Es zeigte sich zunächst, dass die Methode biologisch sinnvolle Ergebnisse erbringt. Versuche mit Hausgänsen bei Professor Peter Peczely, an der Landwirtschaftsuniversität im ungarischen Gödöllö bestätigten schließlich, dass Ereignisse im Plasma sich tatsächlich im Kot niederschlagen (Hirschenhauser u. a. 2000, Kotrschal u.a. 2000). Die Methode zeigte, dass nicht einfach die niederrangigen Ganter in der Schar zu den Gestressten zählen (Kotrschal u.a. 1998). Auf diese Weise konnten genau die Jahresgänge der Steroidhormone bei Männchen und Weibchen ermittelt (Hirschenhauser u. a. 1999a) und gezeigt werden, dass sich die Qualität einer Paarbindung im hormonellen Gleichklang niederschlägt (Hirschenhauser u.a. 1999b ). Zudem untersuchten wir die Entwicklung der Hormonprofile vom Schlüpfen bis zum Flüggewerden (Frigerio u.a. 2001b) und die engen Beziehungen zwischen Stresshormonen und Wetterlage (Dorn in Vorb.). Im Moment interessieren uns ganz besonders die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und individuellem Stressmanagement (Daisley u. a. 2003). Und es zeigte sich, dass Individuen, die generell stark auf Umweltreize reagieren auch besonders geneigte Innovatoren sind (Pfeffer u. a. 2002). Damit ergab sich eine starke Verbindung zu unserem zweiten Standbein, der Kognitionsforschung. So zeigte sich, dass einfache Mechanismen des sozialen Lernens zur Traditionsbildung bei Gänsen und wahrscheinlich bei Wirbeltieren generell führen können (Fritz u. a. 2000, Fritz und Kotrschal 2000). Kolkraben (Corvus corax) Ein ständig im Tal, in Nähe des Wildparks anwesende Gruppe von Raben war Anlass genug, mit ihnen zu arbeiten. Diese großen, schwarzen Vögel faszinierten Menschen immer schon. Ob Götterbote oder lästiger Konkurrent, unzählige Anekdoten belegen, dass Raben kluge, aber auch vorsichtige Tiere sind. Nachdem wir uns anfangs über die Grundmuster von Ökologie und Verhalten Übersicht verschafft hatten (Drack und Kotrschal 1995), nahmen wir uns vor, die Stärken, aber auch die Grenzen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit zu untersuchen. Es interessierte relativ wenig, ob Raben bis 5 oder gar bis 9 zählen können. Vielmehr geht es um die Frage, wozu Individuen ihre Fähigkeiten nutzen, in welchem biologischen Zusammenhang sich die »Rabenintelligenz« also entwickelte. 128 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau Wenig überraschend zeigte sich, dass Raben voneinander durch Imitation lernen können (Fritz und Kotrschal 1999). Die freilebenden Raben koordinieren sich, um Zugang zu Nahrung zu erlangen (Bugnyar und Kotrschal 2001) und sie tauschen Informationen über Rufe aus (Bugnyar u.a. 2001). Selbst uns beeindruckte die Fähigkeit von Raben, etwa im Zusammenhang mit Futterverstecken, einender Informationen vorzuenthalten, bzw. ihre Absichten voreinander zu verschleiern (Bugnyar und Kotrschal 2002b). Diese Fähigkeit zu »taktischem Betrug« wurde bislang nur für Schimpansen nachgewiesen und gilt als eine der Hauptkomponenten für die Entwicklung der menschlichen Intelligenz. Wohl im Zusammenhang der Notwendigkeit, im Zusammenleben mit gefährlichen Tieren, wie Wölfen, Füchsen und Menschen zu überleben, sind Raben allerdings äußerst vorsichtig Neuem gegenüber. Diese »Neophobie« könnte Raben daran hindern, ihre geistigen Fähigkeiten optimal zu nutzen. Andererseits zeigte sich, dass es an den Aufzuchtbedingungen liegt, wie stark die Neophobie zur Ausprägung kommt. Wir interessieren uns daher für die Möglichkeit, dass die Manipulation der Neophobie der Nachkommen durch die Eltern die Bildung konservativer sozialer Traditionen (etwa wo man brütet, etc.) stark beeinflussen könnte (Kotrschal u. a. 2001a). In diesem Zusammenhang wird auch der Einfluss der Persönlichkeitsstruktur untersucht. Waldrappe (Geronticus eremita) Nachdem wir bei den Gänsen und Raben unsere Linie gefunden hatten, begannen wir über die Ansiedlung einer dritten Modellgruppe zu Vergleichszwecken nachzudenken. Dohlen und sogar Sperlinge waren im Gespräch. Unsere Wahl fiel auf einen beinahe ausgestorbenen, weder mit Gänsen, noch mit Raben besonders verwandten Vogel, einen koloniebrütenden Ibis, den Waldrapp. Gerade noch 200 Tiere gibt es davon an der marokkanischen Atlantikküste und eine Handvoll im türkischen Birecik. In den Zoos der Welt vermehren sich die Tiere allerdings so gut, dass bereits »Geburtenkontrolle« betrieben werden musste. Erste Versuche, die Vögel wieder in freifliegenden Kolonien zu halten, waren aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Wir begannen also 1997 mit maßgeblicher Unterstützung unseres Vermieters, Ernst August, Prinz von Hannover und des Schönbrunner Tiergartens mit der Ansiedlung einer freifliegenden Gruppe an der Forschungsstelle. Anfangs war es ein Weg von Blut, Schweiß und Tränen. Wir lernten teuer durch Versuch und Irrtum. Heute allerdings fliegt eine Gruppe von 20–30 (je nach Zuwachs und Verlusten) Waldrappen durchs Almtal. 2001 und verstärkt das Jahr darauf brüteten die Vögel erstmals als Kolonie im Freiflug. Das Füttern wird im Sommerhalbjahr beinahe eingestellt, vier Fünftel der Nahrung finden die Vögel auf den Wiesen um Grünau, wo sie genügend Regenwürmer, Engerlinge, Schnecken, etc. erbeuten. Schritt für Schritt sollen sie immer mehr Unabhängigkeit erlangen. Damit gibt es erstmals seit 350 Jahren wieder eine freifliegende Brutkolonie von Waldrappen in Mitteleuropa. Um den Tieren eine neue Zugroute zu lehren, zog eine Gruppe von Studenten der Forschungsstelle um Johannes Fritz und Angelika Reiter 2002 erstmals Waldrappe am Scharnsteiner Flugfeld auf. Tatsächlich folgten die Vögel den Ultraleichtflugzeugen kreuz und quer durchs Salzkammergut. 2003 soll die Alpenüberquerung folgen, zunächst in die toskanische Maremma, die ein geeignetes Überwinterungsgebiet zu sein Ein prägendes Erlebnis: Mit Gösseln leben 129 scheint. Damit könnte der Grundstein für eine tatsächliche Wiederansiedlung des Waldrapps in Mitteleuropa gelegt sein. Weitere Informationen zu diesem spannenden Flugprojekt sind unter www,waldrappteam.at zu finden. Schrittweise beginnen wir an den Rappen zu forschen. Die Handaufzucht wurde als experimenteller Ansatz genutzt, etwa um den frühen Einfluss von Geschwistern auf die Entwicklung zu untersuchen (Tintner und Kotrschal 2002). Von Praktikumsstudenten 2002 durchgeführte Pilotprojekte zeigten die Linien der Forschung an den Waldrappen in den nächsten Jahren auf. So etwa fanden wir, dass sich Männchen bei der Nahrung teilweise darauf spezialisieren, Weibchen als »Suchmaschinen« zu benutzen, um ihnen dann die gefundenen Nahrung abzunehmen. Zudem zeigte sich, dass Paarpartner sehr um Brut und Brutpflege recht symmetrisch kooperieren, Männchen und Weibchen also ganz ähnlich investieren. Sogar das Testosteron, das männliche Geschlechtshormon wird bei beiden Geschlechtern in gleichen Konzentrationen ausgeschieden (in Vorbereitung). Dies könnte daran liegen, dass die Männchen ihre Spiegel an Testosteron wegen ihrer Beteiligung an der Brutpflege niedrig halten. Für Forschungsthemen in den nächsten Jahren ist also gesorgt. Sozusagen »nebenbei« sammelten wir über diese letzten Jahre auch eine ganze Menge Know-how zur Wiederansiedlung der Waldrappe, nicht nur in Randbereichen ihres ehemaligen Lebensraumes, den Steinsteppen Nordafrikas und Kleinasiens, sondern in ihrem ursprünglichen Zentralgebiet, Mittel- und Südeuropa. Eine kurze Chronologie des Waldrapps: ■ Um Christi Geburt: Waldrappe sind weit um das Mittelmeer verbreitet, mit ersten, vom Menschen begünstigten Brutkolonien nördlich der Alpen. ■ 1555: Der schweizer Naturgeschichtler Gessner beschreibt ausführlich die Waldrappe und ihre Beziehung zum Menschen. ■ um 1650: Waldrappe verschwinden mit Ende des 30-jährigen Krieges aus Europa. ■ Ende 19. Jhdt.: Waldrappe werden auf der arabischen Halbinsel wiederentdeckt, die »östliche Population« (arabische Halbinsel, Kleinasien) ist bereits von der »westlichen Population« (Nordafrika, besonders Marokko, Atlas-Gebirge) getrennt. ■ Um 1920: Die großen Kolonien in Jordanien und anderen Gebieten der arabischen Halbinsel dienen als Zielscheiben für Schießübungen und verschwinden. ■ Bis 1990: Die große Kolonie im türkischen Birecik erlischt durch Missmanagement; einige Vögel überleben bis heute im zeitweisen Freiflug. Heute zunehmend Bestrebungen, eine Nachzuchtgruppe der östlichen Waldrappe in Gefangenschaft zu etablieren. ■ 1960–1990: Die Zahl der Kolonien in Marokko geht von 36 (um die 8000 Tiere) auf 1 (200 Vögel) zurück, vor allem durch direkte Verfolgung. Der Nationalpark Sous Massa wird eingerichtet. 130 Tradition und Gegenwart an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau ■ 1960–1980: Es werden immer wieder Vögel aus N-Afrika in Zoohaltung genommen und unter Leitung von schweizer Zoos und unter maßgeblicher Beteiligung des Innsbrucker Alpenzoos (Zuchtbuchführerin des internationalen Erhaltungszuchtprogramms ist Dr. Christiane Böhm) eine Zoopopulation erfolgreich aufgebaut, die heute etwa 2000 Tiere umfasst. ■ 1987: Ein erster Versuch des Innsbrucker Alpenzoos, handaufgezogenen Waldrappe im Freiflug zu halten (Leitung: Dr. Ellen Thaler) ist teilweise erfolgreich, wird aber nach einem halben Jahr abgebrochen. ■ 1997: Nach Innsbrucker Muster wird an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau begonnen, eine freifliegende Kolonie anzusiedeln (als Modell für Grundlagenforschung und um Daten für die Erhaltung der Art zu gewinnen). Von 11 Handaufgezogenen Jungvögeln überleben 5 den ersten Winter, die meisten kamen bei Langstreckenflügen im Herbst ums Leben. Zwei Vögel kommen aus großer Distanz (Frankfurt an der Oder) in wenigen Tagen wieder selber zurück. Wir lernen, dass handaufgezogene Waldrappe aus Zoonachzucht selbständig Nahrung finden und orientiert über weite Distanzen fliegen können. ■ 1998: 16 Vögel werden handaufgezogen, es überleben nur 6 Waldrappe aus 1997 und 1998 bis ins Frühjahr 1999. Wir überlegen, aufzugeben, ändern aber dann das Management und schließen ab 1999 die Vögel zur Zugzeit und in der Nacht in der Voliere ein. ■ 1999: 12 Nestlinge werden handaufgezogen, keine Verluste mehr im Freiflug. ■ 2000: 5 Nestlinge werden handaufgezogen. Wir haben seit 1999 keine Verlusten mehr, es fliegen 22 Vögel (4 Jahrgänge) frei. Bau einer großen Waldrapp-Voliere mit Brutwand im Cumberland-Wildpark, Übersiedlung im Herbst, wird von den Vögeln sofort gut angenommen. ■ 2001: Es werden keine Vögel per Hand aufgezogen, aber erste Brutversuche ergeben 2 flügge Jungvögel, die zunächst problemlos mit den anderen fliegen. Allerdings stirbt ein Jungvogel im Winter, der andere ist nach Flügelbruch in Frühjahr nur mehr bedingt flugfähig. ■ Sommer 2002: In Syrien werden wenige Brutpaare, wahrscheinlich ein Rest einer ehemals viel größeren Kolonie entdeckt. ■ 2002 in Grünau: Erstmals gibt es massiv Nachzucht, 22 Eier in 9 Nestern. Die Vögel sind nun in dauerndem Freiflug (werden in der Nacht nicht mehr eingeschlossen) und füttern ihre Jungen vorwiegend mit Nahrung, die sie selber finden. Ein Weibchen verschwindet während des JungeFütterns, möglicherweise als Tribut an den Wanderfalken. Es werden schließlich 4 Junge Flügge und gehen gut in den Winter. Die Brutvögel waren noch unerfahren, wir erwarten für die nächsten Jahre steigenden Bruterfolg. Gleichzeitig begannen die Vorarbeiten für eine Alpenüberquerung der Waldrappe hinter Leichtflugzeugen (www.waldrappteam.at). Sollte es gelingen, den Der »Fortschri�« in der Wissenscha� 131 Vögeln wieder eine neue Zugroute beizubringen, steht der Wiederbesiedlung Mitteleuropas durch den alten europäischen Kulturfolger nichts mehr im Wege. Fische Fische, die Vielfalt ihrer Gehirne und Lebensweisen, ihre leistungsfähigen Chemosinne lagen im Zentrum meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit vor 1990 und war auch danach noch von Bedeutung (Kotrschal 1991, 1995, 1996, Kotrschal u. a. 1990, 1998, Kotrschal und Palzenberger 1992). Diese Linie sollte auch an der Konrad Lorenz Forschungsstelle verstärkt in Richtung Verhalten fortgeführt werden. Die Bäche um Grünau boten eine einfache Lebensgemeinschaft von Forellen, Koppen und Elritzen, mit denen man arbeiten konnte. So konnten wir mittels vollautomatischer Beobachtung über Video und Computer nachweisen, dass selbst geringste Mengen von chemischen Reizen möglicher Raubfeinde, der Forellen das Verhalten von Koppen, bzw. die Schwimmpfade von Elritzen stark beeinflussen kann (Essler und Kotrschal 1994, 1995). Konrad Lorenz selbst hatte viel mit Fischen gearbeitet, aber nur relativ wenig darüber geschrieben (z. B. in seinem »Aggressionsbuch« 1963). Ich verbrachte daher geraume Zeit im Archiv des Altenberger Konrad Lorenz Institutes, um zumindest die Arbeit des alten Konrad Lorenz an seinen Halfterfischen (Zanclus cornutus) in seinem großen Riffaquarium zusammenzufassen (Lorenz u. a. 1998). Da es leider nicht möglich war, an der KLF die Laborsituation zu verbessern und da wir mit unseren freilebend Vogelmodellen ohnehin ausgelastet waren, wurde die Arbeit mit Fischen an der Forschungsstelle Mitte der 1990er Jahre aufgegeben. Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Die Entwicklung der Arbeit an der kleinen Konrad Lorenz Forschungsstelle kann als Spiegel der Entwicklung des Faches gelten – Ethologie in einer Nussschale sozusagen. Eine Themenauswahl der modernen Brennpunkte der Verhaltensbiologie muss notwendigerweise unvollständig und subjektiv bleiben. Sich mit tierischem Verhalten zu beschä�igen mag ja gut und schön sein, aber sind nicht aller wesentlichen Fragen in der Verhaltensbiologie bereits erforscht? Liegen nicht die »Brennpunkte« der Biologie, also jene Gebiete in denen die bedeutendsten Wissenszuwächse geschehen, längst anderswo, etwa in der Molekularbiologie und Genetik? Selbst für Profis ist es schwierig, den breiten Überblick und damit eine abwägende Urteilsfähigkeit zu bewahren. Der Einwand des Überholtseins ist schon deswegen zu entkrä�en, weil die Binsenweisheit, dass sich für jede gefundene Antwort mehrere neue Fragen au�un, auch für die Verhaltenswissenscha�en gilt. Und dabei geht es keineswegs nur darum, detailverliebt immer weiter in die Tiefe zu bohren, es bahnen sich auch immer wieder neue Entwicklungen, »große Würfe« an. 132 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Der »Fortschritt« in der Wissenschaft Disziplinen in den Naturwissenscha�en rutschen nicht einfach ins »Out«, weil irgendwann einmal alles »ausgeforscht« wäre, im Gegenteil. Ihr Glanz verblasst meist, weil anderswo Speerspitzen rascher ins wissenscha�liche Neuland vorstoßen, diese daher meist zu Recht als aktueller eingestu� werden (Kuhn 1981). Junge, begabte und karrierebewusste Naturwissenscha�ler versuchen, ganz vorne mit dabei zu sein. Auch die geldgebenden Institutionen investieren ihre begrenzten Ressourcen am liebsten in glänzende, neue Entwicklungen und jung-dynamische Forscherpersönlichkeiten. Denn Mi�elmaß lohnt in keiner Beziehung. So hat auch die Wissenscha� und ihre Finanzierung – wie so vieles in der menschlichen Kultur – nicht nur mit rationaler Kosten-Nutzenrechnung, sondern vor allem mit Prestige zu tun. Wissenscha�sentwicklung und -steuerung ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess. Für bereits etablierte Richtungen trocknen allmählich die Ressourcen aus. Wissenscha�liche Entwicklungen finden also durchaus auf einem Markt sta�. Die Effekte staatlicher Lenkungsversuche bleiben gering, verglichen mit der durch den freien We�bewerb zwischen den Wissenscha�lern produzierten Eigendynamik. Neuerungen kommen nur aus der Wissenscha� selber, durch Individuen, die im Forum der internationalen Wissenscha�lergemeinscha� wirken. Dieses Forum ist denn auch die einzige qualitätssichernde Instanz. Die effizientesten Wissenscha�sförderungsmaßnahmen der Politik besteht darin geeigneten Individuen optimale Arbeitsbedingungen zu bieten. Hilflos, konterproduktiv und ärgerlich dagegen sind staatlich-politische Versuche, auf Inhalte Einfluss nehmen zu wollen. Was für die Kunst gilt, tri� gleicherweise auch auf die Wissenscha� zu: Beide gedeihen definitionsgemäß nur in völliger Freiheit. Dass staatlich-politisch-bürokratische Gängelungsversuche unter Verschwendung von Mi�eln in die falsche Richtung führt, zeigt die Wissenscha�spolitik der EU in bedrückender Weise. Durch Bestrebungen »von oben« Forschung zu lenken, die Förderung der »angewandten« bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Grundlagenforschung wollte man Europa gegenüber den USA und Asien auf die technologische Überholspur bringen. Es ist nicht gelungen. Heute haben, wie vorherzusehen, Staaten und Wirtscha�sräume die Nase vorne, die auf die Förderung des Individuums und der Grundlagenforschung setzten. Im Biologie-internem We�kampf katalysierten die gewaltigen Fortschri�e der Molekularbiologie den Abstieg anderer Fachgebiete. So ist die Morphologie, die Lehre von den Bauplänen und Strukturen die älteste aller biologischen Disziplinen. Sie blühte unter dem Dach der idealistischen Philosophie, rutschte aber Mi�e des 20. Jahrhunderts, obwohl immer noch wichtige Basisdisziplin für jegliche Biologie, in ihrer Bedeutung in den Keller. Und dies, obwohl auch hier noch längst nicht alles »ausgeforscht« ist. Andererseits führten gerade molekularbiologische Techniken wieder zu einer Renaissance der Entwicklungsbiologie. Der in die Forschung investierte Aufwand konzentriert sich an den »Brennpunkten«. Dazu zählten etwa die Anstrengungen zur Entschlüsselung Die Zukun� der Verhaltenswissenscha�en 133 des menschlichen Genoms, im Bereich der Immunologie oder der zunehmende Fokus auf die Frage wie sich während der Individualentwicklung der genetische Code in Merkmalsausbildung überträgt. Viel kostengünstigere, aber deswegen nicht weniger wichtige Brennpunkte in der Verhaltensbiologie sind die Mechanismen der Partnerwahl, die »mü�erliche Investition«, die Konflikte zwischen den Geschlechtspartnern oder zwischen Eltern und Nachkommen, die Steuerung des individuellen Energiebudgets, usw. Als Brennpunkte könnte man Gebiete definieren, in denen Konzeptentwicklung und das Sammeln empirischer Daten rasch und parallel erfolgen, o� katalysiert von methodischen Fortschri�en. Was als neuer Durchbruch gilt, hängt von der Einschätzung der wissenscha�lichen Gemeinscha� ab, aber auch von Eloquenz und A�raktivität der Proponenten. Dieses Muster des mosaikartigen Fortschri�s in der Wissenscha� erklärt, warum hinter den Durchbrüchen und Brennpunkten stets viele weiße Flecken im Wissenscha�spuzzle zurückbleiben. Die grundlegenden Erkenntnisse aller Naturwissenscha�en beruhen auf exemplarischer Arbeit. So etwa wurden von Verhaltensbiologen nur von einem geringen Promillsatz der auf der Erde vorhandenen Tierarten sogenannte Ethogramme, also Verhaltensinventare von Arten erstellt. Diese Art der Erhebung von Mustern war im Prinzip nur so lange sinnvoll, bis im Artvergleich die zugrundeliegenden Fragen, etwa nach Herkun� und Funktion von Verhaltensweisen, oder über die stammesgeschichtlichen Beziehungen heute lebender Arten beantwortet waren. Ein Beispiel wäre die klassisch-vergleichende Lorenzsche Arbeit über Anatiden (Schwäne, Enten, Gänse). Es wäre ohne zugrundeliegende Fragestellung völlig sinnlos, in der Liste der Artnamen bei A zu beginnen und lückenlos die Verhaltensinventare der Arten bis Z zu katalogisieren, mit dem Hintergedanken, dass sich schon interessante Fragen finden würden, wenn nur mal die vollständigen Daten vorlägen. Wissenscha� besteht immer im Herstellen von (ursächlichen) Zusammenhängen. Die Anhäufung von Faktenmengen um ihrer selbst willen ist immer sinnlos. Die Struktur des wissenscha�lichen Fortschri�s ist analog zum Au�au und den Eigenscha�en etwa des menschlichen Oberschenkelhalsknochens: Um seine Tragfähigkeit zu erreichen, wäre es unnötig und unökonomisch, dass unser Körper diesen Knochen aus massivem Material au�aut; es genügen Knochenspangen in Richtung der Beanspruchung. Der Großteil des Volumens des Knochens kann daher leer bleiben. Damit wird hohe Beanspruchbarkeit bei geringem Materialverbrauch und Gewicht erreicht. Ganz ähnlich muss in der Wissenscha� der Unterbau an Daten die neuen Brennpunkte tragen können. Es ist daher weder nötig, noch sinnvoll (es sei denn unter dem Blickwinkel des Sammlers), alle Wissenslücken im Unterbau schließen zu wollen. Die Zukunft der Verhaltenswissenschaften Zur Rechtfertigung der zukün�igen Verhaltenswissenscha�en reicht es daher nicht aus, auf die vielen weißen Flecken unseres Wissens über das Verhalten der Tiere hinzuweisen, es müssen neue Brennpunkte identifiziert werden. Das ist zum Glück nicht schwierig. Gerade deswegen hat die fol- 134 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? gende Themenwahl viel mit einer Lo�erie gemeinsam, denn im Sack der Verhaltenswissenscha�en stecken viele Gewinnlose. Verhalten ist und bleibt eben die Grenzfläche zwischen Individuen und ihrer Umwelt. Dass das Geschehen in zehn oder zwanzig Jahren bereits wieder ganz woanders liegen kann, versteht sich aus der Dynamik unserer Wissenscha� von selbst. Zu den aktuell bleibenden Frontgebieten der Ethologie zählt sicherlich die weitere Erforschung der evolutionären Bedingtheit des Menschen. Es geht um Themen wie Eigennutz und Altruismus, Kooperation und Konflikt, Sexualität und Beziehung zwischen den Generationen. Sogar zur Biologie der Kultur oder menschlicher Religiosität wird heute geforscht. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Ethologie einen Alleinvertretungsanspruch erhebt. Aber es bedeutet doch, dass der Mensch als Ganzes, bis in die tiefsten Winkel seiner Seele, evolutionär entstanden ist und dass daher alle menschenbezogenen Erscheinungen eine biologisch-evolutionäre Komponente haben müssen. Hier ist und war die gesellscha�spolitische Relevanz und auch Verantwortung und Missbrauchsgefahr am größten. In engem Zusammenhang mit dem evolutionären Konkurrenzspiel der Menschen (und jeder anderen sexuell reproduzierenden Art) um Fortpflanzungserfolg muss die Bedeutung des Informationsflusses gesehen werden. Die unterschiedliche Fähigkeit, Information in eigenem Interesse zu manipulieren, stellt wahrscheinlich einen wichtigen Hebel dar, den nur scheinbar unüberbrückbaren Widerspruch zwischen dem Konzept der biologischen Fitness und dem Kulturwesen Mensch aufzulösen. Besondere Beachtung verdienen die Wechselwirkungen zwischen Verhalten und dem Gehirn als Steuerzentrum und seinen untergeordneten Instanzen, wie etwa die hormonproduzierenden Gewebe. Man beginnt zu verstehen, dass nicht nur die Kommandoke�e über nerven- und hormonelle Signale in die Peripherie wichtig ist, sondern dass auch das Zentrum ständig durch die einlangenden Sinneseindrücke und die Rückkopplungen aus dem Verhalten in gewissen Grenzen plastisch reagiert. Kurz: Statische »Dinosaurierkonzepte«, wie der frühere enge genetische Determinismus (der Glaube an die Allmacht der Gene und ihre 1:1 Entsprechung in den Merkmalen) sind Vergangenheit. Warum das Verhaltenswissenscha�ler spannend finden? Konrad Lorenz und Erich von Holst konnten zeigen, dass Tiere nicht bloß reaktive Automaten sind, also nur auf Außenreize hin aktiv werden, sondern auch »spontan« agieren. Dahinter versteckt sich allerdings nichts Metaphysisches. Gemeint ist, dass nicht nur Reize von außen, sondern auch innere Reizzustände Verhalten steuern, beispielsweise Emotionen und andere motivierende Faktoren, wie etwa Steroidhormone. So verrechnet das Nervensystem ständig die innere und äußere Reizlage, berücksichtigt individuelle (über Lernen) und in der Stammesgeschichte (über Selektion) gemachte Erfahrungen und produziert so Verhalten. Wobei der emotional-triebha�e bzw. rationale Ursachenanteil natürlich variieren kann. Während im Fall von Verhalten im Zusammenhang von Sexualität und Liebe sicherlich die instinktiven Anteile überwiegen, wird Die Zukun� der Verhaltenswissenscha�en 135 die Entscheidung, das Auto am Abend in die Garage zu fahren oder nicht vorwiegend rational zustandekommen. Solch rational bedingtes Verhalten ist kein Monopol des Menschen. Es darf angenommen werden, dass viel mehr Tiere kognitiv zu viel mehr fähig sind, als wir ihnen zugestehen wollen (Kamil 1998, Marler 1984b, She�leworth 1998). Schließlich sind hoch entwickelte kognitive Leistungen ein sehr effizienter Weg der Anpassung von Individuen an eine variable Umwelt (Griffin 1991, 1992). Der Nachweis komplexer kognitiver Mechanismen, also auszuschließen, dass einfachere Mechanismen zur ursächlichen Erklärung bestimmter Verhaltensweisen ausreichen, ist aber meist sehr schwierig. Dies ist einer der Gründe für den generellen Nachholbedarf bei der Erforschung der ökologischen und sozialen Relevanz von Tieren. Dazu kommen konzeptionelle und historische Hürden. Obwohl ein »Langzeit-Brennpunkt« der Verhaltenswissenscha�en, war die Kognition lange Zeit im 20. Jahrhundert ein »Unwort«. Konrad Lorenz und andere traten zu dessen Beginn auch gegen allzu vermenschlichende Interpretationen tierischen Verhaltens im Gefolge des Naturbildes der Au�lärung an. So entstand durch die frühe Ethologie der Eindruck, Tiere seien triebgesteuerte Verhaltensautomaten. Diese Pendelbetrachtung von Verhalten, zwischen triebha�er bzw. rationaler Steuerung belebt letztlich seit Aristoteles die Literatur. Ob gerade die Triebe oder der Verstand als Verhaltensverursacher in Mode war, bestimmte der gesellscha�lich-zeitgeistige Hintergrund. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts waren es ausgerechnet die ursprünglich an Mechanismen ursprünglich nicht interessierten Öko-Ethologen, die eine Renaissance der biologischen Kognitionsforschung bewirkten. John Krebs und seine Gruppe in Oxford etwa richteten ihre Aufmerksamkeit auf jene Gehirngebiete verschiedener Singvögel, die mit dem Verstecken und Wiederfinden von Nahrung zu tun haben (Clayton 1994). Heute ist Kognitionsforschung unter evolutionärem Blickwinkel verbreitet und erfolgreich. Der gesellscha�liche Hintergrund mag zwar immer noch Moden bewirken, welche die interessierenden Fragestellungen beeinflussen, die Ergebnisse dagegen sind Kinder der streng hypothetico-deduktiven Methodik der modernen Naturwissenscha�en. Das seit mehr als zwei Jahrtausenden aktuelle Gegensatzpaar rational-instinktiv löst sich im Wohlgefallen evolutionärer Erklärungen auf. Schließlich gilt es, immer wieder Brücken zwischen Psychologie und Ethologie zu schlagen. Während die biologische Seite ein sehr tragfähiges, einheitlichevolutionäres Theoriengebäude besitzt, ist der Versuch beinahe hoffnungslos, die vielen Richtungen der Psychologie unter einen Theorie-Hut zu bringen. Es wäre schon viel gewonnen, bekäme man die Hauptströmungen sozusagen ins gleiche Hutgeschä�. Dabei geht es nicht darum, reizvolle Vielfalt zu beseitigen. Sehr wohl aber geht es gegen Beliebigkeit. Niemand kann heute leugnen, dass der Mensch als biologisches Wesen seine Wurzeln tief in der Evolution hat. Es folgt daraus, dass menschliches Verhalten in seiner komplexen Gesamtheit naturwissenscha�lich erklärbar sein muss. Somit haben sicherlich nicht alle Theoriesysteme gleichermaßen recht. Entscheidend ist die Widerspruchsfreiheit mit evolutionsbiologischen Erkenntnissen, mit 136 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? einem »natürlichen«, also induktiv-empirisch gewonnenen, evolutionären Menschenmodell. Damit und nicht mit doktrinärer Intoleranz hat zu tun, dass man rein spekulative Systeme menschlicher Nabelschau heute getrost als »falsch« ablehnen darf. Eine Synthese zwischen Psychologie und der Verhaltensbiologie auf Basis des evolutionären Theoriengebäudes scheint möglich und wird auch seit dem 19. Jahrhundert immer wieder versucht (z. B. Jü�emann 1992). Ein besonders vielversprechendes Gebiet der Synthese bietet sich mit der zunehmend biologischen Erklärung individueller Unterschiede in Temperament und Persönlichkeit. Es zeigt sich, dass quer durch die Wirbeltiere Individuen in Gruppen in ihrem Umgang mit den Herausforderungen des Lebens recht gleichartig umgehen. Von den Mäusen über die Gänse bis zum Menschen gibt es forsch-zupackende und scheu-zurückhaltende Individuen. Auch ein neuer Brennpunkt der Verhaltensbiologie. Brennpunkt Konflikte, z. B. zwischen Eltern und Nachkommen Der evolutionäre Mechanismus bedingt Konkurrenz innerhalb von Gruppen, daher sind Konflikte vorprogrammiert. In allen Systemen gilt für Individuen der »reproduktive Imperativ«, also die eigene Vermehrung zu optimieren. Die Grundkonflikte sind evolutionäres Erbe, sozusagen die »Erbsünden«. Die Form der Konfliktaustragung variiert zwischen Kulturen und Individuen. Nach dem Paradigmenwechsel zur Individualselektion gehören Konflikte zu den aktuellesten Themen der modernen Verhaltensbiologie. Konflikte sind allgegenwärtig, zwischen den Geschlechtern etwa, weil das reproduktive Potential der Geschlechter unterschiedlich ist und daher männlichen und weiblichen Strategien optimal zu reproduzieren voneinander abweichen müssen. Auf der weiblichen Seite ist der Fortpflanzungserfolg gewöhnlich durch die Effizienz bestimmt, Energie in Nachkommen umzuwandeln, während das Potential der Männchen einerseits von den väterlichen Fähigkeiten, andererseits vom Kontakt mit fertilen Weibchen abhängt. Zwischen Eltern und Nachkommen kommt es zu Konflikten, weil erstere selten so viel zu geben bereit sind, wie letztere fordern. Für die Eltern geht eine Überinvestition in einzelne Nachkommen zu Lasten ihrer zukün�igen Vermehrung, vermindert also ihren Lebensreproduktionserfolg. Dagegen bedeutet für den Nachwuchs jede zusätzlich von den Eltern erreichte Zuwendung eine Fitnesserhöhung. Konfliktfreie Gesellscha�en oder Partnerscha�en sind daher ein unerreichbares Ideal. Es geht nicht darum, sie völlig zu vermeiden, sondern auszutragen. Die damit zusammenhängenden Auseinandersetzungen sind auch nicht bloß als als Nebeneffekt evolutionär bedingter Interessensgegensätze zu sehen, sondern können funktionell wichtig sein. So etwa dienen die ständig wiederkehrenden Zyklen von Konflikt und Versöhnung in Primatengesellscha�en der Standortbestimmung des Einzelnen. Ähnliches gilt wohl auch für menschliche Zweisamkeit. Letztlich sind Individuen dazu »verdammt«, das eigene Wohlergehen immer auch bis zu einem gewissen Grad auf Kosten anderer erreichen und gegen andere verteidigen zu müssen. Brennpunkt Konflikte, z. B. zwischen Eltern und Nachkommen 137 Intensität und Art der Konflikte sind innerartlich keine Konstanten. So ist davon auszugehen, dass ursprüngliche, recht egalitäre Jäger und Sammlergesellscha� parallel mit der Erfindung der Vorratshaltung (also kontrollierbarer Ressourcen) zu hierarchischen Sozietäten mutierten, mit einer entsprechenden Zunahme und Verschiebung der Konflikte (Power 1988). Konflikte sind daher weder unnatürlich, noch pathologisch, sie gehören untrennbar zum Alltag sozialer Tiere. Die Zukun� der Biosphäre wird maßgeblich davon abhängen, weltweit vernetzt, nachhaltige Formen der Austragung von Konflikten in und zwischen menschlichen Gesellscha�en zu finden. Letztlich hängt die Lösung der brennendsten Probleme der Menschheit, Bevölkerungsexplosion, Überkonsum in den Industriestaaten, Erderwärmung, etc. ursächlich mit intelligenter Konfliktlösung zusammen. Töchter oder Söhne? Eine besondere Form des Eltern-Kind-Konfliktes stellt die Geschlechterbevorzugung durch Eltern dar: Dass verschiedene Kinder ihren Eltern nicht gleich viel wert sind, ist eine Tatsache, gegen die sich unser Moralempfinden zu Recht wehrt. Man wurde auf die evolutionäre Dimension dieses Problems durch vergleichende Untersuchungen aufmerksam und postulierte auf theoretischer Basis eine geschlechtsabhängig differenzierte elterliche Investition: Es sollte so viel in weibliche versus männliche Nachkommen investiert werden, dass sich die »Produktionskosten« für die Nachkommen unterschiedlichen Geschlechts und der zu erwartende Fitnessgewinn (für die Eltern) aus der zukün�igen Reproduktionskapazität von Töchtern gegenüber Söhnen die Waage halten. Die Sache kann noch komplizierter werden, wenn man den immer vorhandenen Interessenskonflikt zwischen weiblichem und männlichem Elter berücksichtigt. Die optimale Strategie für die Mu�er muss sich nicht mit der des männlichen Partner decken – eine der vielen Quellen von Konflikten zwischen den Geschlechtern (Voland 2000). Auch Menschen scheinen diese evolutionären Strategiespiele unbewusst und unter dem Deckmantel des »kulturellen Überbaus« weiterzutreiben. In einer Reihe von Gesellscha�en etwa werden Knaben höher geschätzt, was sich in einer geringeren Fürsorge für weibliche Nachkommen und in einer höheren Sterblichkeit der Mädchen niederschlägt. Die moderne Möglichkeit, aus dem Fruchtwasser das Geschlecht des noch ungeborenen Kindes zu bestimmen, wird in manchen Kulturen v. a. Ostasiens als Entscheidungsgrundlage für geschlechtsspezifische Abtreibungen missbraucht. Lautet der Befund auf Mädchen, wird gewöhnlich abgetrieben. Dies führte bereits zu einem deutlichen Überhang von jungen Männern in China, mit noch nicht absehbaren Folgen für die Gesellscha�. Eine uralte, durch Kulturtradition gefestigte Reproduktionsstrategie tri� plötzlich auf eine neue technische Möglichkeit und eröffnet den Eltern Manipulationsmöglichkeiten, die es über die bisherige, lange Menschheitsgeschichte nicht gab. Das ist zwar, wie viele evolutionäre Strategien, kaum mit einer universellen menschlichen Ethik vereinbar, war aber in den ursprünglichen Kulturen für Eltern fitnessfördernd. Dass sich solche Vorlieben auch in wandelnden sozioökonomischen Umfeldern halten, 138 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? deutet auf die Trägheit mancher in evolutionären Strategien begründeten Kulturtraditionen hin. Dass bei den Menschen nicht einfach Mädchen benachteiligt werden, sondern es tatsächlich auf den Wert von Nachkommen für die Eltern ankommt, zeigt das Beispiel der ungarischen Roma. Dort werden eher Knaben vernachlässigt, mit dem Ergebnis, dass es bei den Kindern ein mädchenverschobenes Geschlechterverhältnis gibt. Der Grund scheint zu sein, dass Knaben in ihrem Leben kaum Berufschancen vorfinden und daher als Unterstützer für ihre Eltern von geringem Wert sind. Mädchen dagegen haben gute Chancen, ethnische Ungarn zu heiraten und damit erheblich zum Klaneinkommen beizutragen (Voland 2000). Eltern töten (ihre) Kinder Im Extremfall kann der Konflikt zwischen Eltern und Kindern sogar zum Kindesmord führen, wenn dadurch der Lebens-Reproduktionserfolg der Eltern verbessert werden kann (Alcock 1996). Was zunächst paradox klingt, ist durchaus weit verbreitet. Bei vielen Tieren werden Gelege aufgefressen oder verlassen, wenn sie nicht groß genug sind, um den Brutpflegeaufwand zu rechtfertigen und damit Zeit und Ressourcen blockieren, die besser ein ein lohnenderes Reproduktionsereignis investiert werden. Bei Schweinen etwa werden Föten resorbiert, wenn nicht genügend davon vorhanden sind. Verständlich, denn das zeitlich-energetische Engagement wäre ähnlich, wie in einen größeren Wurf, das Ergebnis aber entsprechend mager. Es ist daher effizienter, gleich neu zu beginnen. Auch ein Blick auf menschliche Gesellscha�en zeigt, dass gezielte Abtreibungen, bzw. Kindestötungen wahrscheinlich immer schon eingesetzt wurden, um den Reproduktionserfolg der Eltern zu optimieren. Denn Kinder werden bei den untersuchten Jäger-Sammler-Gesellscha�en häufig dann getötet, wenn der zeitliche Abstand zum vorhergehenden Kind zu gering war, der Mu�er also nicht genügend Ressourcen zur Versorgung zweier Kinder gleichzeitig zur Verfügung stehen. Eine weitere Standardsituation ist der Tod eines Elternteiles (Daly und Wilson 1987); nicht immer sind andere Gruppenmitglieder bereit, für Halbwaisen (potentiell auf Kosten der eigenen Reproduktion) zu sorgen, mit denen sie kaum verwandt sind. Die Wahrscheinlichkeit dieser unglücklichen Kinder, an Unterversorgung zu sterben, steigt daher sprungha� an. Solche Kindestötungen werden von der Mu�er oder den nahen Angehörigen offenbar als sachliche Notwendigkeit vollzogen, nie aber aus Mordlust. Es sind genügend Fälle beschrieben, in denen die Mu�er oder nahe Verwandte ihren tiefen Schmerz über ihre Handlungen ausdrücken (Eibl-Eibesfeldt 1995). Natürlich haben wir unser Kainsblut nicht beim Eintri� in die moderne Gesellscha� abgegeben. Abtreibungsraten etwa sprechen eine klare Sprache. Und Kriminalstatistiken belegen eindeutig, dass die größte Gefahr für ein noch abhängiges Kind vom neuen Freund der Mu�er ausgeht. Sollte das evolutionäre Erbe bei Kindesmissbrauch und -tötung immer noch im Spiel sein, so ist auf Basis soziobiologischer Theorie vorhersagbar, dass sich gene- Brennpunkt Konflikte, z. B. zwischen Eltern und Nachkommen 139 tische Verwandtscha� in diesem Bereich stark niederschlagen sollte. Das ist tatsächlich der Fall. Daly und Wilson (1999) zeigten an sozial abgeglichenen Gruppen (Kriminalstatistik aus Kanada), dass das Risiko von unter zweijährigen Kindern etwa 70 mal (!) größer ist, in Obhut von Stiefeltern ums Leben zu kommen (635 Kinder pro Million Eltern-Kind Dyaden und Jahr), als bei ihren leiblichen Eltern (9 pro Million Eltern-Kind Dyaden und Jahr). Immerhin 20 mal größer ist dieses Risiko noch bei den 3–5jährigen. Die Zahl der Tötungen geht mit dem Alter zwar stark zurück, es werden aber in allen untersuchten Altersklassen mehr Kinder durch Stiefeltern als durch ihre leiblichen Eltern zu Tode gebracht. Natürlich ist der evolutionäre Hintergrund nicht bewusst. Sehr o� ist die unmi�elbare Ursache eine niedrige Toleranzschwelle Stie�indern gegenüber, eine erhöhte Bereitscha�, Gewalt anzuwenden. Es gibt offenbar eine starke Voreinstellung, zwar die genetisch eigenen, nicht aber fremde Kinder aufzuziehen. Natürlich bedeutet das nicht, dass alle Zieheltern Monster sind, aber die Zahlen sprechen für sich. Tötungen sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Es ist anzunehmen, dass ähnliche Zahlenverhältnisse auch für körperliche und seelische Misshandlungen, sowie sexuellen Missbrauch gelten, wie die täglichen Meldungen im Chronik-Teil der Tageszeitungen andeuten. Diesbezügliche Zahlen sind aber wesentlich schwieriger zu erheben, die Dunkelziffern sind wahrscheinlich sehr hoch. Kindesmisshandlungen bis hin zur Tötung häufen sich auch bei gestörten elterlichen Beziehungen und gesellscha�lich und/oder materiell bedingtem Stress der Eltern. Und immer noch scheint auch die Behinderung eines Kindes ein Faktor zu sein. Die Wahrscheinlichkeit von Kindesmisshandlung steigt also überall dort, wo die Chancen des Kindes auf Erlangen einer kompetitiven Stellung bezüglich seiner Reproduktions- und Informationstr ansferkapazität (s. unten) gering sind. Es ist ein unbequemer Schluss: Trotz aller sozialer Einrichtung scheint die Macht der einst adaptiven evolutionären Mechanismen ungebrochen. Gegensteuern kann man, wenn überhaupt, nur über Bildung, Bewusstmachen und Vernun�, über die Akzeptanz von Randgruppen, die Erhaltung der sozialen, auch staatlichen Solidarität, um Eltern nicht in für Kinder gefährliche Notlagen kommen zu lassen. Und Unterstützung der besonders gefährdeten Gruppen, etwa von Stief- und Adoptiveltern. Grundvoraussetzung für erfolgreiches Gegensteuern ist eine richtige, also evolutionäre Diagnose zu stellen. Weil gerade auf diesem Gebiet viele Zusammenhänge immer noch hypothetisch sind, wird die Soziobiologie, insbesondere des Menschen, noch lange ein Brennpunkt der ethologischen Forschung bleiben. Wieviel soll in einen Nachkommen investiert werden? Weniger dramatisch, aber nicht minder verbreitet und unsere Idealvorstellungen von Gerechtigkeit ebenso verletzend ist die Tatsache, dass Eltern nicht in alle ihre Nachkommen gleichmäßig investieren. Beispiele für die Manipulation der Nachkommen durch ihre Eltern sind buchstäblich allgegenwärtig, inner- und zwischenartlich. Das beginnt bereits bei der un- 140 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? gleichmäßigen Investition in die Eier eines Geleges, weswegen das »mü�erliche Investment« (Stamps 1991) ein zentraler Aspekt der Manipulation von Nachkommen darstellt. So wirkt sich die Eigröße und damit die Größe des Schlüpflings stark auf dessen Überlebenswahrscheinlichkeit aus. So legen Graugänse nur in Ausnahmefällen mehr als sechs Eier. Theoretisch bestünde die Möglichkeit, alle Ressourcen des Geleges in einem einzigen Ei zu konzentrieren. Aus diesem Super-Ei schlüp� ein Super-Gössel, welches ziemlich sicher überlebte und ein entsprechend erfolgreicher Reproduzent werden würde. Warum aber mehr in einen Nachkommen stecken, als unbedingt erforderlich? Warum andererseits nicht 12 halb so große Eier legen? Wie einfach einsehbar, ist die Investition in einzelne Nachkommen nicht beliebig verringerbar. So sollte sich das Verhältnis zwischen Zahl und Investition in den einzelnen Nachkommen nach »evolutionären Erfahrungswerten« richten und insgesamt von der Warte des Elter daraus ausgerichtet sein, dessen Lebensreproduktionserfolg zu optimieren. Ein bestimmter Nachkomme sollte also nicht sicher überleben und reproduzieren, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Letztlich ist auch die Entscheidung der Investition in Nachkommen mit einer Grenzwertkurve zu beschreiben (Exkurs 7). Nun sind aber auch innerhalb eines Geleges die Eier ungleich groß, bei Gänsen und bei den meisten anderen Vögeln. Das erste Ei ist immer etwas leichter als das zweitgelegte, welches immer das Größte ist. Dann nimmt die Größe mit jedem weiteren Ei regelmäßig ab und das letztgelegte ist immer das leichteste. Es scheint also, als ob jede Gans mit ihrem Gelege dasselbe Lo�eriespiel betriebe, denn die Überlebenswahrscheinlichkeit von Gösseln nach dem Schlupf hängt direkt mit dem Körpergewicht, und das wiederum mit dem Eigewicht zusammen. Bei sehr günstigen Umweltbedingungen (bezüglich Parasiten, We�er, soziale Situation, etc.) wird es daher gelingen, alle Nachkommen großzuziehen, bei weniger günstigen entsprechend weniger. Mit einer Differenzierung der Größe der Nachkommen wird erreicht, dass von schlechteren Bedingungen nicht alle gleichmäßig betroffen sind, sondern die kleinsten die »Sollbruchstellen« darstellen, welche zuerst sterben. Die Option, gleich sechs große Eier zu legen, besteht für eine Gans wegen der begrenzten Ressourcen, bzw, der begrenzten Kapazität ihres Reproduktionsapparates nicht. Sie könnte vielleicht vier große legen, was natürlich in einem Jahr mit günstigen Bedingungen suboptimal wäre, sie würde dann auf Nachkommen verzichten. Aber auch die Variabilität in der durchschni�lichen Eigröße zwischen Individuen ist bemerkenswert. Sie kann bei den Graugänsen zwischen 150 g und 200 g variieren. Dabei halten Individuen über die Jahre ihre durchschni�lichen Eigewichte recht konstant (Hemetsberger 2001). Genetische Faktoren, aber auch die Bedingungen während des Heranwachsens bestimmen dieses weibchenspezifische Eigewicht. So fällt etwa auf, dass handaufgezogene Gössel, die, weil besser ernährt und versorgt, meist etwas größer werden, als gansaufgezogene, im Schni� auch etwas größere Eier legen. So können bereits die ersten Wochen nach dem Schlupf die Lebensfortpflanzung schancen eines Individuums beeinflussen. Brennpunkt Konflikte, z. B. zwischen Eltern und Nachkommen 141 Die Möglichkeiten der Eltern, ihre Nachkommen zu manipulieren, sind mannigfaltig. Genaugenommen beginnt es bereits bei der Partnerwahl und der damit zusammenhängenden Festlegung der genetischen Konstitution. Auch das Geschlecht der Nachkommen kann manipuliert werden. Am einfachsten funktioniert das bei manchen Reptilien, beispielsweise Schildkröten oder Alligatoren, über die Bru�emperatur. Die Eier werden in verro�ende Pflanzenhaufen oder Sand abgelegt. Sorgen auf diese Weise die Mü�er durch ihre Ortswahl für tiefere Temperaturen, schlüpfen Weibchen, bei höheren dagegen Männchen. Nur innerhalb eines engen Temperaturbereiches ist das Geschlecht der Schlüpflinge ausgeglichen. Bei Vögeln oder Säugetieren, dagegen, bei denen das Geschlecht genetisch festgelegt ist, sollte man eigentlich keine Einflussmöglichkeiten der Mü�er auf das Geschlecht der Nachkommen erwarten. So etwa wird bei den Säugetieren das Geschlecht eines Nachkommen durch die befruchtende Spermazelle festgelegt. Durch die Reifeteilung, entstehen aus männlichen Keimzellenvorläufern mit doppeltem Chromosomensatz (xy) Spermien entweder mit einem x- oder y-Geschlechtschromosom. Und das annähernd in gleichen Anteilen. Wenn also der Zufall bestimmt, welches Spermium eine Eizelle (die alle das x-Chromosom besitzen) befruchtet, sollte man statistisch ziemlich genau 50 % weibliche, bzw. männliche Nachkommen erwarten. Die tatsächlichen Geschlechterraten der Nachkommen weichen o� erheblich davon, ab, etwa bei Rothirschen, bei denen rangtiefe Weibchen vorwiegend Töchter gebären, ranghohe dagegen Söhne (Clu�on-Brock u. a. 1982). Über welchen Mechanismus Mü�er dies bewerkstelligen, ist unbekannt. Weiters können Mü�er über Hormone erheblich die Frühentwicklung ihrer Nachkommen beeinflussen. Aus Vogeleiern etwa, die etwas mehr Androgene (männliche Geschlechtshormone) enthalten als andere, entstehen aggressivere, durchsetzungsfähigere, aber auch unvorsichtigere Individuen schlüpfen, als etwa aus Eiern desselben Geleges, die mit etwas weniger Hormon ausgesta�et wurden (Schwabl u. a. 1997 , Daisley u. a. 2003). Ähnliches ist auch für Säugetiere anzunehmen (Nelson 2000, vom Saal 1979, Whalen 1982), was allerdings aufgrund der komplizierten Verhältnisse um den Stoffaustausch über die Plazenta viel schwieriger zu untersuchen ist, als bei Vögeln. Vogelmü�er gleichen so den Nachteil Spätgeschlüp�er aus (Schwabl u. a. 1997), oder aber, sie unterstützen, wie bei den Reihern, ihre Erstgeschlüp�en (Sockman und Schwabl 2000). Zudem reagieren die Mü�er auf ihre soziale Situation und können so mehr Androgene ins Ei packen, um damit konkurrenzfähigere Nachkommen zu erzielen, sollte dies nötig sein. Schließlich besteht besonders bei hochsozialen Organismen die Möglichkeit durch die Art der Informationsweitergabe, über Familienklima und »Erziehungsstil« die Persönlichkeitsstruktur und das spätere Verhalten der Nachkommen beeinflussen. Menschen sind beileibe nicht die einzige Art auf der Welt mit der Möglichkeit, Ihre Nachkommen durch sozialen Informationstransfer zu beeinflussen. Dies tun sogar Graugänse oder ganz allgemein, alle sozialen Tiere mit einer längeren Bindungsphase zwischen Elter(n) und Nachkommen. Von Mu�erlinien bei Rhesusaffen oder Japanmakaken ist bekannt, dass sich 142 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? die Persönlichkeit der Nachkommen am mü�erlichen Verhalten formt. Selbstsichere Mü�er ziehen selbstsichere Kinder groß, nervöse Kinder nervösen Nachwuchs (Hinde und Stevenson-Hinde 1986). Schon unterschiedliches Hantieren von Säuglingen kann zu weitreichenden Unterschieden im Verhalten Erwachsener führen, wie vor allem an Mäusen und Ra�en gezeigt wurde (Carlier u. a. 1983, Hennessy u. a. 1982). Somit können individuelle Eigenscha�en generationenlang, am Genom vorbei weitergegeben werden. Da auf diese Weise wesentliche Komponenten des Verhaltens, wie z. B. die Vorliebe für bestimmte Nahrung, für Partner, der Stil, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen erlernt sein können (natürlich nur im Rahmen der genetischen Gegebenheiten), wirken Kulturtraditionen solchermaßen wieder maßgeblich auf die genetische Entwicklung von Populationen zurück. So stehen biologische und kulturelle Information in beständiger, inniger Beziehung. Das evolutionär begründete Verhältnis zwischen Eltern und Kindern muss notwendigerweise asymmetrisch sein. Kinder sind die Interessensträger ihrer Eltern (strenggenommen: die For�räger der genetischen und kulturellen Information, welche sie von ihren Eltern mitbekommen, nicht umgekehrt). Nachkommen benötigen die Eltern als Lieferanten für Ressourcen und verlangen dies gewöhnlich auch länger und intensiver, als die Eltern sie zu unterstützen gewillt sind. Denn elterliche Investition in einzelne Nachkommen hat Grenzen. Die Eltern ermöglichen ihren Nachkommen im eigenen Interesse einen möglichst sicheren Start ins Leben, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gewährleistet, dass diese Nachkommen wiederum ihre eigenen Fortpflanzungschancen wahren können. Mehr nicht, den das würde auf Kosten des Lebensfortpflanzungserfolges der Eltern gehen. Nachkommen sind ihren Eltern selten »dankbar«, etwa indem sie diese später unterstützen. Dies geschieht in manchen Helfersystemen, wenn Fische oder Vögel mithelfen, ihre eigenen Geschwister aufzuziehen. Aber diese Helfer tun dies auch nur im eigenen Interesse, der Fitnessgewinn für die Eltern ist sozusagen Nebeneffekt. Dass Kinder ihre Eltern ehren und erhalten sollten ist eine moralisch noble Forderung und ist auch funktionell in Gesellscha�en zu begründen, die stark auf der Erfahrung der Alten beruhen. In der globalisierten Informationsgesellscha� ist dies nicht mehr der Fall. Daher erleben wir es gerade in unseren modernen Gesellscha�en, dass Eltern nicht nur die Helferrollen beim Aufziehen ihrer Enkelkinder übernehmen, sondern sich durch handfeste materielle Zuwendungen die Aufmerksamkeit und Achtung ihrer Nachkommen sichern. Evolution läu� mit der Zeit, nicht in Gegenrichtung. Das erklärt – entschuldigt es aber natürlich nicht – dass es immer mehr von ihren Kindern vernachlässigte Alte geben wird, als umgekehrt. Heute verfügen die älteren Generationen (es werden aufgrund der steigenden Lebenserwartung immer mehr) über eine Reihe von Alternativen: Entweder sie emanzipieren sich von der traditionellen Rolle der investierenden Großeltern und führen auch postreproduktiv ihr eigenes Leben, oder sie erkaufen sich weiterhin durch Betreuung und materielle Zuwendung für Kinder und Enkel Aufmerksamkeit. Der momentane Wohlstand erlaubt Brennpunkt Konflikte, z. B. zwischen Eltern und Nachkommen 143 meist beides. Mit zunehmender Pflegebedür�igkeit steigt aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass Alte in eine Institution abgeschoben werden. Begehrlichkeit und das Anzeigen von Status Habenwollen und Raffgier ist mit der stetig zunehmenden Erdbevölkerung eines der Schlüsselprobleme der modernen Menschheit. Beides zusammen führt zu einem schwindelerregend kurzsichtigem Umgang mit Ressourcen. Die »Falle des Kurzzeitdenkens« (Eibl-Eibesfeldt 1999) ist tatsächlich die bedrohlichste Gefährdung der Menschheit, weit gefährlicher noch, weil universeller als Massenvernichtungswaffen. Selbst Ökonomen entdeckten in den letzten Jahrzehnten, dass die Akteure in der Wirtscha� keine rationalen Spieler sind. Die Verhaltensbiologen können erklären warum. Begehrlichkeit ist keine typisch menschlich-pathologische Erscheinung. Um einigen ebenso verbreiteten, wie falschen Klischees entgegenzutreten: Auch Tiere sind von sich aus weder altruistisch noch bescheiden. Auch Tiere töten nicht immer nur, um zu überleben und wissen nicht immer »was gut für sie ist«. Und schon gar nicht schonen sie von sich aus ihre Lebensgrundlagen. Ein offenbar irrationaler Umgang mit Ressourcen tri� unter bestimmten Bedingungen auch für Tiere zu. Beispielsweise dann, wenn ein Marder in einen Hühnerstall, ein Wolf oder Hund in eine Schafweide eindringt und dann weit mehr Tiere tötet, als er fressen kann. Hier werden offenbar von Beutekonzentrationen, die evolutionär nicht vorgesehen war, Auslösemechanismen angesprochen. Die auf Beutemachen gedrillten Instinkte dieser Tiere lassen ihnen unter diesen Bedingungen offenbar keine Wahl. Jeder Aquarianer, bzw. Hundebesitzer weiß, dass ein wenig soziale Konkurrenz o� Wunder wirken kann, schlecht fressende Lieblinge and Fu�er zu bringen. Kritisch wird es dann, wenn soziale Konkurrenz dazu führt, dass ein Bruchteil der Menschheit den Großteil der Ressourcen beansprucht und damit nebenbei auch noch gigantische Umweltprobleme verursacht, die dann aber schließlich alle treffen. Und das nicht, weil in unserer Industriegesellscha� diese Ressourcen zum (bequemen) Überleben benötigt würden, sondern weil es sich dabei letztlich um Einsätze im sozialen Spiel um Status handelt. Außerirdische würden wahrscheinlich manche unserer Gewohnheiten recht amüsant finden: Warum ist etwa ein gelbes Metall namens Gold wertvoll? Und warum investieren manche Leute Unsummen in Picasso (aber nur, wenn auch Picasso draufsteht)? Im Chefzimmer repräsentiert dann eine Kopie, die zeigt, was irgendwo im Safe liegt. Nichts ist vor der menschlichen Sammelwut sicher, nicht einmal so offensichtlich Nutzloses, wie gebrauchte Bierdeckel oder Briefmarken. Abgesehen von solchen offensichtlichen Skurrilitäten würde den Marsbewohnern wahrscheinlich der weitgehend uniforme Lebensstil über weite Landstrich merkwürdig auffallen. Über Quadratkilometer gleiche Einfamilienhäuschen auf den gleichen Normgrundstücken, umgeben von Normhecken, bewohnt von den gleichen Normfamilien mit zwei adre�en Kindern, mit recht ähnlichen Mi�elklasseautos in den sauberen Garagen. Genormter Urlaub, zweimal im Jahr, ob man sich den nun leisten kann oder 144 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? nicht. Woher kommt dieser Normierungsdruck? Können oder wollen die Menschen nicht anders? Was die Marsbewohner da beobachten, ist letztlich eine Folge der sozialen Konkurrenz, des Ringens um Prestige, wie Amoz Zahavi es ausdrücken würde. Objekte werden vor allem dann begehrenwert, wenn sie auch für andere wertvoll sind, ganz unabhängig davon, ob dieser Gegenstand nun irgendeinen praktischen Nutzen für den Besitzer hat oder nicht. Verhaltensbiologen werden freilich darauf hinweisen, dass das Anhäufen begehrter, aber an sich nutzloser Objekte das Ansehen und letztlich den Partnermarktwert des Betreffenden erhöht. Sind Menschen also doch nur Laubenvögel? Schmücken Sie sich mit Besitz und allerlei ungenießbaren Schnickschnack nur deswegen um anderen zu gefallen? Die Wertschätzung für Gold und Edelsteine scheint Beleg genug dafür. Krabbelkinder finden prinzipiell jenes Spielzeug am interessantesten, mit dem sich gerade der andere beschä�igt. Wahrscheinlich, um den eigenen Stellenwert zu testen und die Präferenz des anwesenden Erwachsenen, aber das ist eine andere Geschichte … Herrschende führen ihre Kriege um Ressourcen, die auch von anderen beansprucht werden, oder gar nur wegen der Prestigesucht der Feldherren. Und Fußballvereine konkurrieren lieber um den Europacup, als um den Entenhausener Wanderpokal, sogar wenn gar kein finanzieller Anreiz damit verbunden wäre. Es geht also letztlich nicht nur ums Fußballspiel, denn diese Neigung könnte man ja auch in Entenhausen befriedigen, sondern um den Besitz einer Auszeichnung, den auch andere große Vereine haben wollen. Natürlich, es ist das Gesetz des Marktes. Wert definiert sich über Nachfrage. Verwundert hören wir von den Potlatch-Festen mancher nordwestamerikanischer Indianer, in deren Verlauf die Clanchefs einander zu beeindrucken suchen, indem sie wertvolles Clanvermögen verschenken, vernichten, bis hin zum Abbrennen der eigenen Häuser. Verhalten wir uns nicht generell ganz ähnlich in unserer Jagd nach dem Götzen »Status«? Wenn es in vielen Gegenden der Erde immer noch Ansehen bringt, viele Kinder zu haben, oder zumindest zu zeugen, dann verknüp� sich Begehrlichkeit harmonisch mit dem Problem der Überbevölkerung, und das alles unter der Decke des »biologischen Imperativs«, also der Optimierung der eigenen Vermehrung. Kommunikationsbarrieren beschränkten immer die geographische Ausdehnung jener Konkurrenzsysteme, die wir Kulturen nennen. Diese Barrieren sind mi�lerweile großteils weggefallen. Nun flimmert täglich weltweit normiert über die Bildschirme, was wir als begehrenswert erachten sollten. Dieser uneingeschränkte Informationsfluss führt auch zu einer Nivellierung der Kulturen, vor allem über die Vereinheitlichung der Zielobjekte der Begehrlichkeit und über eine Normierung der statusrelevanten Verhaltensweisen. Coke, Chesterfield und Mickey Mouse eroberten Europa nach den Zweiten Weltkrieg als Symbole einer (zumindest materiell) überlegenen Lebenskultur, waren fesch, gut für den Partnermarktwert. Man investierte und konkurrierte, um sich mit diesen begehrten Symbolen auszusta�en. Ihr Glanz verblasste über die Jahre, ihr Einfluss auf die Lebenskultur in Europa aber ist dauerha�. Brennpunkt Konflikte, z. B. zwischen Eltern und Nachkommen 145 Der Malinchilismo, also die Bevorzugung fremden Kulturgutes über das eigene ist nicht nur in Mexiko und Österreich, sondern weltweit verbreitet. Bestimmte Formen des Anders-Seins machen offenbar interessant. Diese Begehrlichkeit nach dem Appeal des Neuen war es offenbar auch, welche in den letzten Jahrtausenden zu einer Überschichtung zuerst der süd- und dann der zentraleuropäischen Völker durch den Lebensstil der Ackerbauern aus Nah-Ost führte. Funde, sowie sprachwissenscha�liche und genetische Daten (Barbujani 1991) deuten an, dass dieser alteuropäische Kulturenwandel nicht in kriegerischen Wellen, sondern relativ friedlich und kontinuierlich mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von knapp 100 km pro Generation erfolgte. Andererseits kann das Gefühl der Überlegenheit eine Kultur auch auslöschen. So geschehen wahrscheinlich in West-Grönland, wo um das Jahr 1000 nach Christus Wikingersiedler Viehzucht nach Muster ihrer angestammten Heimat betrieben. Als nach kalten Sommern die Heuernte nicht mehr ausreichte, das Vieh über den Winter zu bringen, verschwanden diese Siedlungen wieder. Die benachbarten Inuit lebten und leben von Fischfang und Jagd. Man fand zwar Wikingergegenstände in Ausgrabungen von Inuitsiedlungen, nie aber umgekehrt. Die Wikinger gingen in Glorie unter, weil sie offenbar von einer »minderen« Kultur nichts annehmen wollten. Moden als ritualisiertes Sich-Unterscheiden von anderen sind Fundamente der Kulturen, schaffen Kleingruppenidentität und begünstigen den Kulturenwandel. Wie es in den Salons des vorletzten Jahrhunderts »chic« war, sich französisch zu geben, ha�e man im alten Rom einen Hang zum Griechischen, also zu einer Kultur, die der eigenen militärisch unterlegen war. Das o� aufwendige Mitmachen von Moden kann als Konkurrenzverhalten gesehen werden, welches den eigenen Partnermarktwert steigert. Wenn in der österreichischen Industriestadt Linz etwa, die Leute in den Straßen die neueste Mode schon vor den Schaufensterpuppen einschlägiger Geschä�e tragen, so zeigt dies eindeutig, welche Werte dort gelten. Man trägt die Abzeichen des eigenen Einkommens auf der Haut. Nur arme Irre werden glauben, dass man in solchen Gemeinscha�en mit geistigen Qualitäten punkten kann. Wir leisten uns täglich unsere kleinen Potlatch-Feste, denn der Marktwert ist wiederum die Basis für die Entscheidungen in der Partnerwahl. Kultur wurzelt also ganz direkt in der Biologie. Das muss weiland wohl auch schon Arnold Gehlen bewusst gewesen sein, als er meinte, dass Menschen von Natur aus Kulturwesen wären. Menschen sind Konkurrenzmodelle. Eine Hauptgefahr für andere Menschen und die Biosphäre liegt darin, dass es diese Konkurrenz um Status an sich hat, inhaltlich sehr rasch abstrakt zu werden und sich von der ökologischen Basis abzuheben. Denn es geht letztlich darum, das zu besitzen, was auch dem anderen Ansehen bringt, ganz gleich was. So kamen die südamerikanischen Kulturen unter die Räder, aus diesem Grund werden heute Nashörner oder Tiger ausgero�et, wurden im letzten Jahrhundert die letzten Dronten, die letzten tasmanischen Beutelwölfe gefangen, weil es das Ego der Museumsdirektoren so wollte. Die skurrilen Auswirkungen dieses eskalierenden Prozesses kann man überall beobachten, wo es Menschen gibt. 146 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Repräsentiert wird bei der Kleidung, der Wohnung, mit der A�raktivität des Autos und des Partners, mit den wunderbaren Fähigkeiten der Kinder und schließlich mit der gut gepflegten Grabstä�e. Weit über die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse hinaus werden Menschen danach trachten, Eigentum anzuhäufen, weil damit eben Prestige und Kontrolle über andere, besonders über die Reproduktion, verbunden ist. Es bleibt eine enorme Herausforderung für alle Sparten der Verhaltensforschung, die Mechanismen, die evolutionären Wurzeln dieser Prozesse um die soziale Konkurrenz zu durchleuchten und Möglichkeiten zur Individualisierung, zu einer De-Eskalation der Konkurrenz um Ansehen aufzuzeigen. Brennpunkt Informationsfluss Er freue sich über mein Geschenk, aber die Botscha� seiner Worte widerspricht dem Ausdruck in seinem Augen. Ein Pfau schlägt ein Rad, die Henne lässt sich besteigen. Ein Wahlplakat wirbt für XY, zeigt strahlende Menschen auf grasgrüner Wiese, meint also: Wir haben ein Herz für Menschen und Umwelt. Weidende Gänse locken andere Gänse an, weil bodenpickende Artgenossen bedeuten, dass es dort was zu fressen gibt, also nichts wie hin. Dieselben Gänse werden von einem Fuchs umschlichen; sie nähern sich vorsichtig, mit hoch erhobenen Hälsen und seltsam quiekenden Lauten, worauf der hungrige Räuber aufgibt. Eine Meise ru� Alarm, die anderen Vögel in der Gruppe stürzen in Deckung, der Warner dagegen bleibt und verzehrt in Ruhe einen dicken Nachtfalter – als einziger weiß er, dass der Warnruf eine »Lüge« war. Eine junge Frau plaudert mit einem Zufallsbekannten, wir� den Kopf zurück, lacht, findet die Augen des Armani-Jeansträgers faszinierend; der junge Mann verschränkt die Arme hinter seinem Kopf, lehnt sich zurück, lacht, spricht seltsam angeregt und wundert sich, warum er ihr die dumme Geschichte seines Autofahrersieges gegen den Protz in der dicken Limousine erzählt. Weit über ein Jahr hat es im Süden Äthiopiens nicht mehr geregnet, eine schlimme Zeit für einen Trupp von Pavianen, die trotz mehr als 12 Stunden Nahrungssuche beinahe verhungern; alle Wasserlöcher im Streifgebiet waren versiegt. Ein altes Männchen, einst Klanherr über viele Weibchen, nun aber, in seinem 16. Lebensjahr längst von jüngeren Paschas abgelöst, mit fadenscheinigem Fell, wackeligen Zähnen, Altersflecken im Gesicht, wieder kindisch geworden, zu nichts mehr nütze denn als Spielpartner für Kinder, erinnert sich: In einem langen Tagesmarsch führt er seine Gruppe in eine Höhle, deren Wasser seinem Klan das Leben gere�et ha�e, als er selbst noch ein junges Männchen war. Die Trockenheit fordert ihren Tribut unter den Pavianklans. Die Familie des Alten überlebt fast vollzählig (Kummer 1992a). In allen diesen Kurzgeschichten geht es um den Informationsfluss. So kann man etwa nur konkurrieren, wenn man über Konkurrenten und Ressourcen informiert ist und ob es einem gut geht, weiß man nur, wenn man suboptimale Bedingungen erfährt. Tiere wie Menschen nehmen ständig relevante Information auf, informieren sich selber und einander, ob sie wollen oder nicht. Verhalten ist die Grenzfläche zwischen Individuum und Umwelt, Verhalten entsteht in Reaktion auf Information, Verrechnung mit bereits ge- Brennpunkt Informationsfluss 147 speicherter Information (evolutionär oder individuell) und erzeugt unablässig Information. Alle Organismen nehmen ständig Information auf und geben solche ab. Sehr o� versuchen Lebewesen, diesen Informationsfluss zu minimieren. So etwa hat der regungslose Tiger kein Interesse daran, dem belauerten Hirsch seine Anwesenheit spüren zu lassen. Und die Kunst überzeugender Lügner besteht darin, sich nicht durch widersprüchliche Körpersprache zu verraten. Andererseits kann es nötig sein, den Informationsfluss zu optimieren. So etwa sollten balzende Männchen die Weibchen keinesfalls über ihre Top-Kondition im Unklaren lassen; quer durchs Tierreich werden dazu »ehrliche«, weil kostspielige und daher fälschungssichere Signale verwendet, die eindeutig, stereotyp und redundant in ihrer Struktur sind. Auch für beschlichene Beutetiere wäre es fatal, dem Räuber nicht eindeutig klarzumachen, dass sie entdeckt sind. Verständlich im Zusammenhang mit der Vielfalt an Funktionen des Informationstransfer, dass dem eine mindestens ebenso große Vielfalt an Verhaltensweisen dienen, die direkt dem Informationstransfer dienen (Signale), bzw. Information über Zustand oder Absichten eines Individuums enthalten. Information und der Umgang mit ihr ist geradezu ein Grundmerkmal lebender Systeme. Information entsteht zwischen Sender und Empfänger, sie existiert ohne die beiden nicht. So etwa ist der Kot, den ein Fuchs auf einem Stein absetzt so lange nur eben Kot, bis ein anderer Fuchs vorbeikommt, der aus dieser Hinterlassenscha� mi�els seiner Nase Informationen über Individuum, Geschlecht, Status und Zustand des Markierenden entnehmen kann. Und eine Tageszeitung ohne Leser ist bestenfalls Verpackungsmaterial. Strukturen gewinnen Bedeutung, also einen spezifischen Informationsgehalt erst durch Interpretation. So etwa bedeutet eine knorrige Eiche, wie Jakob von Uexküll (1934) bemerkte, für den Forstmann Kapital und potentielle Arbeit, für das Käuzchen einen geeigneten Nistplatz, für das phantasievolle Kind einen düsteren Riesen mit weit ausladenden Armen, für den Straßenbauer bedeuten Baum samt zugehöriger Bürgerinitiative ein lästiges Hindernis, usw. Der Informationsaustausch als universelle Eigenscha� lebender Systeme ist als wissenscha�liches Thema ebenso bedeutend wie schwierig zu bearbeiten. Um Kommunikation tatsächlich nachzuweisen, müssen nicht nur Sender und Signal gefunden werden, es ist vor allem die Wirkung der Information auf den Empfänger zu zeigen. Da zudem nicht immer klar ist, ob Verhaltensweisen, Strukturen, chemische Substanzen usw. tatsächlich im Dienste der Kommunikation entwickelt wurden oder von der Umgebung eines Individuums bloß informell genutzt werden, ist es gar nicht einfach, naturwissenscha�lich an diesem Komplex von Phänomenen zu arbeiten. Relativ klar ist die Sache bei Signalen, wo Sender und Empfänger zweifelsfrei feststehen. O� handelt es sich dabei um ritualisierte Strukturen, bzw. Verhaltensweisen, also um solche, die aus einem anderen Funktionskreis rekrutiert und meist extrem stereotypisiert wurden. Dies war immer schon eine der Kernzonen der Verhaltensforschung. Klassisch etwa die Arbeiten von Julian Huxley zur Balz des Haubentauchers (1914). Und Konrad Lorenz (1941) erstellte aufgrund homologer Balzbewegungen bei den Anatiden 148 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? (Gänse, Enten und Schwäne) in den Grundzügen bis heute gültige Verwandtscha�sbeziehungen. Die meisten dieser Balzbewegung leiten sich übrigens vom Putzen oder der Nahrungsaufnahme ab. Weit weniger einfach ist die Beurteilung ob, und in welchem Ausmaß Verhaltensweisen, die nicht direkt den Signalen zugerechnet werden können, auch eine Signalkomponente enthalten, bzw. von Anwesenden benutzt werden, um Information über das handelnde Individuum zu beziehen. Was ist etwa von einem gänsischen »Triumphgeschrei« zu halten, bei dem ein Ganter zunächst einen Scharnachbarn angrei�, dann mit geschwellter Brust zu seinem Weibchen zurückkehrt und mit ihr ein Grußritual vollzieht. Die Funktion als Signal an das Weibchen scheint jene des Vertreibens konkreter Rivalen weitaus zu überwiegen. Aber es ist schwierig, dies auch experimentell zu zeigen. Anzunehmen, aber noch schwieriger nachweisbar wäre die Signalfunktion dieser extrovertiert-lauten Zeremonie an die Schargenossen. In Folge sollen einige Aspekte von Kommunikation diskutiert werden, wie etwa Ritualisierung, Körpersprache und Mimik, aber auch das sogenannte »Gedankenlesen« und »Lüge und Betrug«, also das Streuen von Falschinformation oder auch das Zurückhalten von Information. Ritualisierung – Signalbildung Balzende Vögel hängen kopfüber, entblößen zi�ernd bunte Federpartien, geben seltsame Laute von sich, bringen den Weibchen (meist symbolische) Geschenke, die Vielfalt ist enorm. Signale vermi�eln eindeutige Botscha�en, meist durch wiederholte Darbietung. Ritualisiertes Verhalten ist meist auffällig, sieht »übertrieben« aus. Es soll die »Sales resistance« also auf Seiten des Empfängers den Widerstand überwinden, auf eine Botscha� zu reagieren. Ritualisierte Signale findet man praktisch bei allen Tieren. Sie sind »ehrlich«, weil Fälschung entweder nicht möglich ist oder gefährlich wäre. Natürlich »möchten« letztlich alle Männchen einer Art den Weibchen gefallen und dermaßen möglichst viele Nachkommen zeugen. So sind Gecken ein evolutionäres Resultat weiblicher Zuchtwahl. Die Weibchen zwingen die Männchen damit, durch Ausbildung teurer Merkmale Flagge bezüglich ihrer Qualität zu zeigen. Eine Pfauenschleppe ist nicht nur energetisch teuer herzustellen, sie ist auffällig, verringert die Fluchtgeschwindigkeit und erhöht so das Risiko des Männchens, einem Fressfeind zum Opfer zu fallen. Prunkmerkmale können nicht gefälscht werden. Ein schlecht ernährter, parasitenbeladener Pfau kann einfach nicht prächtig aussehen. So signalisiert das Pfauenmännchen, dass es trotz des Handicaps der Schleppe gut aussieht, daher für die gegebene Umwelt gute, parasitenresistente Gene haben muss (Zahavi 1984, 1997). Nur ein starker Hirsch kann über einen entsprechenden Zeitraum eine entsprechende Röhrfrequenz halten, nur ein großes Erdkrötenmännchen kann tief quaken, usw. Die von den Weibchen angezüchteten Handicaps können sehr unterschiedlich sein. Es sind ursächlich die hohen Testosteronspiegel, die Menschenmänner aller Kulturen Jahre vor ihren Frauen sterben lassen. Denn dieses Hormon vermi�elt jene sekundären Geschlechtsmerkmale, wie breites Kinn, dominantes, konkurrenzorientiertes Verhalten, kurz: Jenen Machismo, den Frauen an Männern schätzen, von dem sie aber zumeist behaupten, dass Brennpunkt Informationsfluss 149 sie es nicht tun. Männer, die sich nicht an diesem Hormonwe�lauf beteiligen, hinterlassen statistisch weniger Nachkommen, die Selektion begünstigt also die Testosteron-Konkurrenztypen. Dass die Männchen haremshaltender Arten, wie etwa See-Elefanten, Hirsche, Rinder, Gorillas, auch Menschen, meist viel größer als ihre Weibchen sind, hat mit der Konkurrenz zwischen Männchen, bzw. mit Vaterscha�ssicherung zu tun, die dadurch erreicht wird, dass man »seine« Weibchen gegen die Avancen von Rivalen abschirmen kann. Letztere sind übrigens auch nicht die rein passiven Objekte männlicher Politik, sie haben (in Grenzen) Haremswahl und wehren sich meist aktiv gegen Kopulationsversuche subdominanter Männchen. Kämpfe zwischen Rivalen beginnen zunächst immer mit Drohen und mit ritualisiertem Vergleichen der Körpergröße, sei es bei Buntbarschen, Hirschen oder Sumo-Ringern. Die Rivalen machen sich groß, umkreisen einander gespreizt. Damit ist der Kampf meist schon zu Ende, bevor er begann. Und kommt es zum Kampf, dann meist ebenfalls ritualisiert, was die Verletzungsgefahr in Grenzen hält. Beschädigungskämpfe sind selten. Sie treten eigentlich nur auf, wenn es um einen sehr hohen Einsatz geht, etwa das Reproduktionsmonopol in der Gruppe. Bluffen, also stärker scheinen, als man wirklich ist, würde die Gefahr erhöhen, selber verletzt zu werden, käme es zum Kampf. Darin liegt auch schon die Antwort auf die Frage, wem ritualisiertes Kämpfen eigentlich nützt. Vor nicht allzu langer Zeit wäre der »Überlebenswert für die Art« noch die allgemein akzeptierte Erklärung gewesen. Heute wissen wir, dass Gruppenselektion wenig Rolle spielt, es daher kein Naturgesetz ist, den Gegner nicht zu töten. Ritualisiertes Kämpfen senkt das Verletzungsrisiko, nicht nur des Gegners und wahrt damit zukün�ige Reproduktionschancen. Es wäre zudem für das Überleben der meisten Arten nicht unerheblich, Männchen durch Beschädigungskämpfe einzubüßen; für die Erhaltung der Reproduktionsleistung wären auch wenige Männchen ausreichend. Ritualisierte Verhaltensweisen werden aus bereits vorhandenen selektioniert, die meist in einem ganz anderen Funktionszusammenhang entstanden, was so nebenbei einen schönen Beleg für die Realität des Lorenz`schen Erbkoordinationskonzeptes darstellt (Exkurs 3). Wie die Vergleichende Verhaltensforschung zeigt, entsteht etwa das Bodenpicken oder -zeigen balzender Hühnervögel aus Nahrungspicken. Die Drohbewegungen von Möwen und vielen anderen Arten entstehen aus Komfortverhalten, bzw. aus dem noch immer rätselha�en »Konfliktverhalten«, das Grinsen der Menschen und Schimpansen aus defensivem Zähnezeigen. Körpersprache und Mimik Kampf und Balz sind recht eindeutige Bereiche der Kommunikation. Sender und Empfänger, Kosten und Nutzen sind relativ klar zu ermi�eln. Wie steht´s aber mit Körpersprache und Mimik? Wie ein einfacher Artvergleich zeigt, dienen Gestik und Mimik wahrscheinlich der innerartlichen Kommunikation. Die Bedeutung der Mimik im aggressiv-defensivem Bereich bei hochsozialen Tieren, etwa Affen oder Hunden, ist einfach verständlich. Ein zähneflet- 150 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? schender Hund wirkt wohl auf alle Menschen bedrohlich. Die Interpretation der Mimik der weniger sozialen Katzen (Leyhausen 1965) kann schon viel schwieriger sein und die wenig ausgeprägte Mimik der eher einzellebenden Bären zu deuten, ist Fachleuten, bzw. anderen Bären vorbehalten. Es scheint, als ob Mimik und Körpersprache notwendige Mi�el des Informationsflusses zum gegenseitigen Nutzen zwischen den Individuen einer Gruppe wären, etwa um gegenseitiges Einschätzen und die eigene Einordnung zu ermöglichen. Durch dieses Ausdruckverhalten beeinflussen die Mitglieder einer Gruppe einander, stimmen ihre Handlungen aufeinander ab. Mehr als 70 % der Information fließen sogar beim Dauerredner Mensch nichtverbal. Es ist daher klar, dass diese Kommunikation auf gemeinsamen (evolutionären) Konventionen beruhen muss (Eibl Eibesfeldt 1995). Dies sind die eigentlichen Bindungsmechanismen in sozialen Gruppen. Es sollte daher auch Körpersprache und Mimik »ehrlich« sein. Evolutionäre Voreinstellungen für körpersprachliches »Lügen« wäre evolutionär wohl nicht stabil. Tatsächlich schaffen es Menschen gewöhnlich nur nach Training, auch ihre Körpersprache überzeugend mit verbalem Lügen überzeugend abzustimmen. Humanethologen (z. B. Grammer 1988, 1993) berücksichtigen vor allem den nichtverbalen Ausdruck und leisten damit einen wichtigen Beitrag, von einer vorwiegend kopflastigen Beurteilung menschlichen Verhaltens wegzukommen und die tatsächlichen Mechanismen unseres Zusammenlebens zu erforschen. Mimik und Körpersprache sind die Basis für alle Gemeinscha�saktivitäten in unserer menschlichen Kultur, selbst (oder gerade) in Wirtscha� und Politik. Darum sind auch Banke�e zwischen Staatsoberhäupter (neben ihrer Funktion des gegenseitigen Beeindruckens) ganz konkrete, friedenserhaltende Maßnahmen. Und Körpersprache und Mimik drängen im Zusammenhang mit Flirt und A�raktivität zwischen Partnern die verbale Sprache in eine Statistenrolle. Auch deswegen wird auf diesem Gebiet he�ig geforscht. »Gedankenlesen« Wenn nun aber Räuber ihrer Beute gegenüber oder Mitglieder von sozialen Gruppen ihren Rivalen gegenüber ihre Absichten so gut wie möglich zu verschleiern suchen, dann wird es natürlich auch schwierig für den menschlichen Beobachter. Dieser Bereich wurde von dem gar nicht metaphysisch angehauchen John Krebs mit »Gedankenlesen« betitelt. Dies bezieht sich darauf, dass empfindsame Tiere und Menschen die Absichten anderer vorhersagen können, ohne dass rationalisierbar wäre, auf welchen Kanälen bzw. wie diese Information fließt. Mit Übernatürlichem oder irgendwelchen, noch unentdeckten »Gehirnschwingungen« hat das nichts zu tun, eher damit, dass Teile unserer Wahrnehmung aus dem Unbewussten heraus besser funktionieren, als über den Umweg des Bewusstseins. Ein anderer englischer Ethologe, der längere Zeit über Räuber-Beute-Beziehungen vor allem zwischen Elritzen und Hechten arbeitete, lieferte eine für das »Gedankenlesen« bezeichnende Anekdote: Elritzen inspizieren gelegentlich einen Hecht in der Nachbarscha�, indem sich einige Tiere in gefährliche Nähe begeben, um dann wieder zum Schwarm zurückzukehren. Minuten vor einem Angriff des Brennpunkt Informationsfluss 151 Hechtes aber wird dieses Verhalten eingestellt, obwohl für den Beobachter keinerlei Zustandsänderung am ohnehin sehr bewegungsarmen Hecht erkennbar war. Gut, also doch irgendwelche »Schwingungen«? Wohl kaum, denn Studenten waren fähig, von Videoaufnahmen solcher Hechte ebenfalls richtig vorherzusagen, wann dieser Hecht angreifen würde, wiederum ohne erkennen zu können, auf welchen Verhaltensänderungen ihre Vorhersage beruht. Diese Geschichte belegt, dass zumindest in diesem Fall unbewusste visuelle Wahrnehmung im Spiel gewesen sein muss, Reize also, die unser Gehirn sehr wohl registriert, die aber die Schwelle ins Bewusstsein nicht überschreiten. Verständlich, denn das »Gedankenlesen« scheint speziell in der Kommunikation zwischen Räuber und Beute wichtig zu sein. Dabei geht es um Geschwindigkeit, langsames bewusstes Nachfragen ist dabei hinderlich. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese Art der unterschwelligen Kommunikation inner- und zwischenartlich eine wichtige Rolle spielt, und zwar überall dort, wo eine Seite daran interessiert ist, »dichtzumachen«, die andere Seite dagegen auf diese Information angewiesen ist. Das tri� vor allem auf Räuber - Beutebeziehungen zu, in denen die Beute definitionsgemäß dem Räuber immer einen Schri� voraus sein muss, wahrscheinlich auch in der Abschätzung der Eigenscha�en, sonst wäre sie bereits ausgestorben. Potentiell betri� diese subtile Kommunikation auch alle Konflikte, an denen das Sozialleben der Tiere ja ziemlich reich ist. Es wird daher eine wichtige, wenn auch schwierige Aufgabe für die Zukun� das »Gedankenlesen« naturwissenscha�lich zu erschließen. »Lügen« Wenn Menschen zu ihrem eigenen Vorteil schwindeln können, Information verbergen, bzw. Falschinformation streuen, warum nicht auch soziale Tiere? Lügen können wird sogar als Merkmal für hochentwickelte geistige Fähigkeiten von Tieren angesehen (Griffin 1992). Selbst Sperlinge können selektiv verheimlichen: Sie rekrutieren, rufen also ihre Artgenossen heran, wenn sie Brotbrösel finden, die sie an Ort und Stelle, unter möglichem Raubfeinddruck aufpicken müssen. Dieselbe Menge Brot in Form eines einzigen Stückchens wird dagegen still in ein Versteck getragen und dort alleine verzehrt. Dass Hunde lügen können, ist zwar im streng naturwissenscha�lichen Sinn nicht nachgewiesen, wohl aber jedem Hundehalter bekannt. Aber es wird im Tierreich auch nachweislich gelogen: Relativ häufig ist die missbräuchliche Verwendung von Alarmrufen bei Vögeln, die damit erreichen, dass sie nach der Flucht der anderen in Ruhe die vorhandene Nahrung nutzen können. Der einzige, der »weiß«, dass keine Gefahr droht, ist der Alarmrufer selber, die anderen müssen flüchten, denn es könnte ja ernst sein. In einer südamerikanischen Fressgemeinscha� verschiedenere Arten von Kleinvögeln, von denen die meisten relativ weit unten im Gebüsch oder am Boden nach Nahrung suchen, fungiert ein zuoberst fliegender Insektenfresser als Warner, vertri� aber als solcher meist seine eigenen Interessen. Nur etwa jedes zehnte Mal entspricht dem Alarmruf eine reale Gefahr, in der Mehrzahl der Fälle schreit er Alarm, 152 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? wenn von den unter ihm Jagenden ein besonders fe�es Insekt aufgestöbert wurde. Die Betrogenen gehen in Deckung, der Lügner frisst das Insekt (Munn 1986). Denn schließlich bedeutet Hereinfallen auf den Betrug eine versäumte Mahlzeit, aber es wäre lebensgefährlich, diese Warnung zu ignorieren. Von Whiten und Byrne (1997) wurden 253 Fälle von »taktischem Betrug« bei Affen zusammengetragen. Fast alle diese Fälle betreffen Menschenaffen (vgl. Byrne 1995). Ob Lemuren und Affen »zu dumm« zum Schwindeln sind, oder ob das daran liegt, dass vorwiegend Menschenaffen beobachtet wurden, bleibt offen (Hauser 2001). Jedenfalls sollte, um erfolgreich tricksen und bluffen zu können, eine gewisse Fähigkeit vorhanden sein, aus der Perspektive der Absichten und Gedanken anderer zu operieren. Diese Fähigkeit konnte bislang nur an Schimpansen nachgewiesen werden (Hare u. a. 2001). Allerdings wäre es ein Fehler, nach hochentwickelten macciavellischen Fähigkeiten (Whiten und Byrne 1997) nur bei Affen, Menschenaffen und Menschen zu suchen. So konnte gezeigt werden, dass auch Raben begnadete Schwindler sein können (Bugnyar und Kotrschal 2002 a,b). Beim Verstecken von Fu�er versuchen die Verstecker dies außer Sichtweite von Beobachtern zu tun. Denn nur wenn (selbst aus größerer Distanz) ein Konkurrent es scha�, direkt zuzusehen, wird er das Versteck auch finden. Beobachter tun daher so, als würden sie gar nicht hinsehen und steuern das Versteck erst an, wenn der Verstecker bereits wieder weg ist. Ob diese scheinbaren Strategiespiele allerdings das Ergebnis eines einfachen Lernprozesses sind, beispielsweise einfach durch die Erfahrung, dass Verstecken in Sichtweite eines Artgenossen den Verlust des Leckerbissens bedeutet, oder ob sie wirklich, wie etwa bei Schimpansen, auf der Fähigkeit beruhen, darauf zu reagieren, was der andere weiß, ist noch abzuklären. Dass allerdings Raben geradezu sagenha�e geistige Fähigkeiten haben, wissen alle, die mit ihnen arbeiten. Gerade weil der Informationsfluss (über Genom und über geistige Fähigkeiten) und dessen Manipulation eine Schlüsselposition beim Verständnis der Evolution einnimmt, wird die Kognitionsforschung wohl noch lange ein höchst interessanter Brennpunkt der Verhaltensbiologie bleiben. Ist der Mensch ein Tier? Durch Darwin wurde die Menschheit ihrer Sonderstellung beraubt und in die zoologische Stammesgeschichte integriert, auch was ihr Verhalten betri�. Trotzdem war die Psychologie des letzten Jahrhunderts nicht gerade evolutionär orientiert. Erst mit der rasanten Entwicklung der Soziobiologie in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gewannen biologische Erklärungen für menschliches Verhalten zunehmend an Bedeutung. In der Verkleidung der »Evolutionary psychology« erlebt die Humanethologie in den USA gerade einen Höhenflug. Die traditionellen, ethisch und politisch motivierten Widerstände gegen welche die Humanethologie beständig anzukämpfen ha�e, sind auch heute noch spürbar. Dass eine biologische Diagnose, etwa zur Grundlage der Geschlechterrollen, nicht deren Zementierung bedeutet, sollte klar sein. Ist der Mensch ein Tier? 153 Verhaltenswissenscha�ler haben sich zunächst um das Sein, nicht um das Sollen zu kümmern und korrekte Diagnosen sind die Voraussetzung für Veränderung. Es wird ja auch der Meteorologe nicht für die We�erprognose geprügelt, warum also der Biologe für die von ihm überbrachte Botscha� von den triebha�en Komponenten menschlichen Verhaltens? Der Mensch sei vom Natur- zum Kulturwesen geworden, kann man o� hören. Der komplexe »kulturelle Überbau« überdecke alles, was möglicherweise an stammesgeschichtlichem Erbe noch in uns steckt, so die Distanzierung vom Tier in uns. Natürlich erleichtert die kulturelle Vielfalt die Analyse nicht gerade, aber letztlich ist das Denken im Gegensatz Natur - Kultur wegen der innigen Verzahnung der Ebenen nutzlos. Natürlich gibt es Erscheinungen in modernen Gesellscha�en, die nicht auf Anhieb in unsere evolutionären Schemata zu passen scheinen. Wenn Organismen wirklich darauf getrimmt sind, die Zahl ihrer reproduktiven Nachkommen zu optimieren, ist die demographische Wender, der Trend zur Zwei- Ein- oder sogar Kein-Kind-Familie soziobiologisch nicht zu erklären, oder doch (s. Exkurs 11)? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann steckt die Theorie in ernsten Problemen. Und wie ist Homosexualität zu erklären, die ja nicht reproduktiv sein kann? Kann eine Synthese zwischen den scheinbaren Gegensätzen biologisches Erbe - kultureller Überbau erreicht werden? Ich behaupte: ja! Zur Erläuterung muss allerdings etwas ausgeholt werden, um erst anschließend menschliche Sozial- und Reproduktionssysteme in biologischen Zusammenhang zu stellen. Natur und Kultur: Bindeglied Informationsfluss? Exkurs 11: Bevölkerungsexplosion und -stagnation Um global nachhaltig zu wirtschaften fehlen nicht nur Einsicht und Know how, ist nicht nur die Vorherrschaft des Kurzzeitvorteils hinderlich, dafür gebt es schlicht auch schon zu viele Menschen auf der Welt. Dafür sind aber weniger die stark reproduzierenden Massen in den Entwicklungsländern, sondern vor allem die auf Basis von fossilen Energien und Ressourcenverschwendung zu Reichtum gekommenen Bewohner der entwickelten Länder verantwortlich. Dies führt direkt zu den bekannten ökologischen Problemen wie Ozonloch und globale Erwärmung. Die Übervölkerung vieler wenig entwickelter Länder des Südens bedingt eine Natur- und Lebensraumzerstörung und eine damit einhergehende Verwüstung und Verödung bislang unbekannten Ausmaßes. Alle diese miteinander vernetzten Erscheinungen beschneiden die Lebensgrundlage künftiger Generationen. Wie kommt es zu diesem reproduktiven Ungleichgewicht? Es liegt neben vielen anderen Gründen letztlich am »biologischen Imperativ«: Menschen sind wie alle anderen Lebewesen auf der Welt evolutionär darauf getrimmt, ihren Fortpflanzungserfolg zu optimieren. Über den längsten Zeitraum menschlicher Evolution sorgten funktionierende Gruppenstrukturen und energetische Beschränkungen (was nicht Mangelernährung bedeuten muss) dafür, dass die Populationsdichten nicht explodierten. Dass es immer schon eine Eigenschaft 154 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? menschlicher Gruppen war, die Nachbarn zu massakrieren, mag dazu beigetragen haben. Bereits seit einiger Zeit sind offenbar diese einfachen alten Mechanismen in unserer weltweiten Vermischung der Kulturelemente mit den Segnungen unserer Industrie- und Informationsgesellschaft nicht mehr wirksam; massakriert wird zwar weiterhin, das hat aber wesentlich weniger Einfluss auf die Populationsdichten wie die weltweite Renaissance der Infektionskrankheiten. Gerade in Schwellenländern reichen trotz Armut die vorhandenen Ressourcen aus, mehr Kinder aufzuziehen, als früher. Der zugrundeliegende evolutionäre Imperativ der Reproduktion ist mit anderen evolutionären Strategien quervernetzt. So ist es in vielen Kulturkreisen für Männer immer noch sehr prestigeträchtig, viele (vor allem männliche) Kinder zu zeugen. Diese evolutionären Erbstrategien im Gemenge mit geringer Bildung, Aufklärung, Rechtlosigkeit der Frauen, kontraproduktiven Traditionen, zerbröselnden Staatlichkeiten, konservativ-katholischen Positionen, etc. bilden sehr ungünstige Randbedingungen für erfolgreiche Empfängnisverhütung. Die ungebrochene Bevölkerungsexplosion in den Ländern des Südens führte in den letzten Jahrzehnten ungebremst zu einem immer weiteren Auseinanderdriften der Wohlhabenden und Armen, der hegemonialen Wirtschaft der Privilegierten und den neokolonial von dieser Wirtschaft beherrschten recht- und machtlosen Zulieferern und Abnehmern für Überschüsse und Ramsch. Die Welt insgesamt ist vergleichbar mit dem zynischen Zustand Indiens, wo 10 % Mittelstand Wirtschaft und Demokratie tragen, die restlichen 90 % der Bevölkerung sind menschlicher »Füllstoff«, politischwirtschaftlich unbedeutend und abgeschrieben. Die Dämme zwischen den zwei Welten werden wohl nicht auf Dauer zu halten sein. Evolutionär schwierig zu erklären ist dagegen das starke Absinken der Geburten in den industrialisierten Ländern, der »Pillenknick«, die »demographische Wende«. Man sollte eigentlich annehmen, dass die alten evolutionären Strategien in Verbindung mit der Verfügbarkeit von Ressourcen zu sehr hohen Reproduktionsraten führen sollten. Das Gegenteil ist der Fall, die Null- bis Zweikindfamilie dominiert. Ist es die Einsicht in die Notwendigkeit der Geburtenbeschränkung, haben wir als moderne Arbeitssklaven keine Zeit mehr für Kinder, sind wir zu materialistisch-egoistisch geworden? Alle diese Argumente mögen stimmen, nur eines ist nicht möglich: Wir können innerhalb weniger Generationen nicht zu »neuen Menschen« geworden sein, die ihre evolutionäre Bürde über Bord warfen. Sind wir tatsächlich nicht, denn auch Menschen in den Industriestaaten zeigen sozio-sexuelles Verhalten, als ob es noch immer höchste Priorität wäre, Nachkommen zu produzieren. Wenn im Verlauf der Evolution vor allem Strategien selektioniert wurden, welche die individuelle Weitergabe von Information (zunächst über Genom, dann zunächst zunehmend, über Kulturtraditionen) optimieren, dann könnte die letztliche Erklärung für die demographische Wende im sich verschiebenden Verhältnis und Wertigkeit genetischer gegenüber kultureller Information zu finden sein. Über lange evolutionäre Zeiträume stach das Gen das Mem, im Industriezeitalter kam es zur Wende und im Informationszeitalter (oder in den Informationskulturen) sticht das Mem eindeutig das Gen. Wenn der Prestigegewinn für Individuen von der Menge gesellschaftlich relevanter Information abhängt, dann wäre erklärbar, warum die demographische Wende in unterschiedlichsten Ländern, Ist der Mensch ein Tier? 155 bzw. gesellschaftlichen Schichten immer mit einem bestimmten industriellen Entwicklungsstand eintritt. Mit einer bestimmten Schwelle beginnen offenbar die kulturellen Informationsinhalte mit den genomischen gleichzuziehen. Diese Hypothese wird im Abschnitt »Natur und Kultur: Bindeglied Informationsfluss« (s. unten) diskutiert. Selbstverständlich werden monokausale Ansätze der demographischen Wende nicht gerecht – das Phänomen verlangt nach vielschichtigen Erklärungen. Eine grundlegende Erklärung entsteht aus der Zusammenführung von Biologie und Kultur. Die Kernaussage des Darwinismus vom »survival of the fi�est«, also den »Überleben des Tüchtigsten« ist euphemistisch, denn wer sonst als »der Tüchtigste« sollte überleben? Damit ist allerdings heute kein Kampf mit Zähnen und Klauen gemeint, nicht einmal individuelles Überleben, sondern subtile Unterschiede zwischen den Individuen in ihrer Anpassung an die Umwelt, ihrer Konkurrenzfähigkeit und sozialer Kompetenz. Ökonomische Individuen können mehr Nachkommen produziere, deren Gene setzen sich letzlich in einer stabilen Umwelt über die Generationen durch. Das evolutionäre Maß für Fitness ist daher die Anzahl der wieder reproduktiv aktiven Nachkommen, weshalb man besser vom »Vorteil der tüchtigsten Erbanlage über die Generationen« sprechen sollte. Warum aber sollte es für einen hier und heute lebenden Organismus erstrebenswert sein, möglichst viele Nachkommen zu hinterlassen, wenn er zum Zeitpunkt, da er die Früchte seiner Bemühungen bewundern könnte, also den Klan der Ur- und Ur-urenkel, schon tot ist? Mit anderen Worten, was ist der Lohn aller Reproduktionsanstrengungen? Warum sollte es eigentlich einziges Ziel im Leben jedes Organismus sein, mehr Nachkommen als andere zu hinterlassen, die wiederum mehr Nachkommen als andere hinterlassen, die wiederum … ? Diese Frage ist falsch gestellt. Hier geht es nicht um das Sollen, sondern um das Sein. Es scheint übrigens eine typisch menschliche Geistessucht zu sein, dass alles einen letzten »Sinn« haben muss, als von Haus aus plan- und zweckmäßig so geplant war. Das eben ist der »reproduktive Imperativ« sicherlich nicht. Die Zufälligkeit auch der menschlichen Existenz wirkt bedrohlich, erzeugt Angst, doch nur ein Staubkorn im Weltall zu sein, nicht gewollt von einem allmächtigen Go�, auf alle Ewigkeit geborgen in seinen Armen. Aber diese Sinnfragen zu diskutieren, ist nicht Sache der Biologie, der notwendigerweise reduktionistischen und materialistischen Naturwissenscha�en, das ist eine Frage des Glaubens. Es scheint ungeheuer schwierig, zu akzeptieren, dass die Evolution weder in geplante Richtungen läu�, weder gut noch böse ist, sie ist einfach. Daher sind auch evolutionäre Verhaltensantriebe des Menschen, die etwa zu Seitensprung oder sogar Kindstötung führen können, von ihrer Entstehung her weder gut noch böse – es gibt sie einfach. »Gut und Böse« sind mit dem ethisch-reflektierenden Menschen verknüp�e Bewertungen. Die evolutionär fundierte menschliche Moral entstand im sozialen Zusammenhang, zur Sicherung jener Gruppen, welche Individuen zur Wahrung der eigenen Interessen benötigen. Somit lautet die Antwort auf die Frage, warum für alle heute lebenden Organismen der 156 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? »reproduktive Imperativ« gilt, dass über eine stetige Konkurrenz innerhalb von Populationen und Arten eben nur in Hinblick auf Reproduktion optimierte Genotypen übrig blieben. Was ist das eigentlich Ergebnis dieser Fortpflanzerei? Die Körper von Individuen sind vergänglich, zerfallen wieder in ihre Ausgangsstoffe. Diese mögen schließlich am Wege des Sto�reislaufs und über Pflanzen als Bestandteil eines Organismus fungieren, oder über Abbau, Sedimentation, etz. wieder ein Teil der anorganischen Natur werden. Wir sind aus geborgtem kosmischen Material aufgebaut. Welch hübsches Thema für philosophische Diskussionen! Hier geht es aber am Thema vorbei, lautet die Frage doch schließlich, wie es kommt, dass aus einer beschränkten Anzahl dieser kosmischen Elemente die ungeheuere Fülle und Komplexität des Lebens entsteht und erhalten wird. Es geht um die Natur des individualisierenden Prinzips, welches über Generationen perpetuiert, die Seele der Evolution bildet. Vergänglich sind selbst jene an sich recht stabilen Moleküle, welche den zellulären Informationsspeicher der Organismen, die Desoxyribonukleinsäure, die DNS, au�auen. Auch sie wird nach dem Tod des Individuums in ihre Ausgangsbestandteile zerfallen. Sie wird auch bei jeder Zellteilung zunächst um die Häl�e ausgedünnt. Ihre beiden Stränge, die wir als diploide (doppelter Chromosomensatz) Organismen in unseren Zellkernen enthalten, wird im Zuge der Reifeteilung haploid. Das heißt, dass Eier und Spermien je einen einfachen Chromosomensatz enthalten, wobei es Zufallselemente bei der Trennung der DNS-Stränge gibt, was dafür sorgt, dass nicht nur jede Keimzelle genetisch einzigartig ist, sondern auch Nachkommen niemals exakte 50/50-Kopien ihrer Eltern sind. Aber auch diese Details bringen uns hier nicht weiter. Das einzige, was relativ konservativ, wenn auch, wie diskutiert, nicht gänzlich unverändert über die Generationen weitergegeben wird, ist die Sequenz der DNS-Basenpaare. Diese kodiert die Baupläne für alle Proteine und auch das An-und Abschaltens der Gene, die unseren Körper au�auen und funktionieren lassen. Tatsächlich wird also nicht die Materie über Generationen weitergegeben, sondern Information. Was treibt also Organismen, als Informationsvermi�ler zwischen den Generationen zu fungieren? Das Argument, dass es schließlich keine Organismen in der heutigen Form gäbe, würde dieser Mechanismus nicht existieren, ist natürlich nicht stichhaltig, weil Evolution eben nicht vorausschauend funktioniert und Individuen naheliegendere Interessen haben, als ein komplexes geistiges Konzept, wie die »evolutionäre Entwicklung« voranzutreiben. Aus naturwissenscha�licher Sicht gibt es keinen »Sinn« in der Evolution, will man nicht transzendentale Erklärungen bemühen. Die Frage nach der treibenden Kra� dieses tatsächlich »sinnlosen« Reproduzierens im Lichte neuerer Erkenntnisse der molekularen Genetik mag wohl Richard Dawkins (1977) dazu gebracht haben, die zunächst irrwitzig scheinende Hypothese zu entwickeln, dass es die Gene sind (oder genauer: Der Informationsgehalt derselben), welche die Organismen zur eigenen Reproduktion benutzen; das Individuum als Kopierapparat, manipuliert von den Kopien, die er eigentlich Ist der Mensch ein Tier? 157 glaubt, autonom zu produzieren. All unser Tun und Wollen werde durch unsere Gene so manipuliert, dass möglichst viele Kopien derselben perpetuiert werden. Direkte Belege dafür lieferten übrigens Molekularbiologen, die zeigten, dass der Konkurrenzkampf zwischen den Genen sogar noch im Individuum weitergehen kann (Hurst 1992). Letztlich schaltet dieses despotische Informationsmoloch sein temporäres Vehikel, das Individuum, zu einem für ihn günstigen Zeitpunkt wieder ab, leitet den Vorgang des Sterbens ein. Dieser mächtige Informationsinhalt ist mehr als ein Gleichnis, er beherrscht uns tatsächlich und ist trotzdem für unsere Vorstellungskra� kaum grei�ar; auch ein Prinzip, das allen evolutionären Strategien gemeinsam ist. Sie offenbaren sich unserem Bewusstsein erst auf hartnäckiges Nachfragen, wir funktionieren nur als unaufgeklärte Individuen »gut« im Sinne der Evolution. Für den beherrschenden »Paten« Information ist es offenbar wichtig, sich nicht durchschauen zu lassen, zu viel Einsicht lässt Sklaven aufmümpfig werden. Die Fernsteuerung durch unsere Gene, bzw. deren Informationsgehalte, scheint perfekt. So gesehen ist Orwells »großer Bruder« tiefe Realität, seit es Menschen, ja sexuell reproduzierende Organismen überhaupt gibt. War es Menschen bislang selbstverständlich, die Gene als (ihrer Individualität untergeordnete) Teile ihrer selbst zu betrachten, so verursachte die Dawkinsche Umkehrung der Welt – die Denkmöglichkeit, dass wir weit davon entfernt sind, die freien Träger unserer Gene zu sein, sondern vielmehr von diesen subtil versklavt werden – einen Schock und verursachte vielfache Proteste, auch von Seiten namha�er Biologen. So wie Kontroll- und Bedeutungsverlust für Menschen immer einen Schock verursacht, sei es die Einsicht, dass etwa der Wolf in Gestalt des Hundes über den Vektor Mensch zu einem der erfolgreichsten Wirbeltiere aller Zeiten wurde (wer benutzt da wen?) oder dass sich eben die Erde um die Sonne dreht, nicht umgekehrt. Es ist unerheblich, ob die wild anmutende Dawkinsche Theorie gefällt oder nicht – sie blieb über die letzten Jahrzehnte sehr plausibel. Das eigentliche Thema des evolutionären Reproduktionsspieles lautet also Informationstransfer. Die Menschwerdung spielte sich im Zusammenhang mit der Konkurrenz zwischen Mitmenschen ab, die eigenen Gene möglichst effizient in die nächste Generation zu bringen. Dass die Erbinformation ausgerechnet in Basentriplets verschlüsselt im Doppelstrang der DNA vorliegt, ist dabei unbedeutend, ist prinzipiell nicht anders oder geheimnisvoller als die Abfolge der Bits und Bites in den verschiedenen elektronischen Speichermedien. Die vor einer Milliarde Jahre oder mehr in der Ursuppe schwimmenden Ribonukleinsäuren standen für ein informationsspeicherndes und -vermehrendes System zur Verfügung, waren dafür offenbar besser geeignet als andere organische Urverbindungen. Information braucht ein Vehikel, sonst, welches sie nicht nur perpetuiert, sondern auch ein Auslesen der Informationsinhalte erlaubt. Der perpetuierende Moloch Information erlangte seine kreative Dominanz in der Evolution nur durch die DNS. »Information« ist daher kein metaphysisches Prinzip; Speicherung und Wandel durch Mutation und Selektion, sowie die Art ihre Übertragung in Proteinstrukturen sind durch das übertragende Medium bestimmt. 158 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Es sind die Emotionen als eingebaute Verhaltensantriebe, die uns durch die Gassen der evolutionären Strategien treiben, Schlafwandlern gleich, denn das Wissen über diese Zusammenhänge ist nicht einmal im Unterbewusstsein präsent. Dienen wir der evolutionären Informationstransferpflicht, dann werden wir mit Lust, bzw. Befriedigung belohnt. Emotionen sind Zuckerbrote und Peitschen evolutionärer Strategien. Die Art der Informationsspeicherung und -vervielfältigung diktiert den Organismen die Randbedingungen ihres Lebens. Alles, was Verhaltenswissenscha�ler interessiert, Partnerwahl, Konkurrenz, Kommunikation, usw. steht letztlich im Dienste der Optimierung der individuellen Informationsweitergabe, zunächst in Form von Nachkommen. Damit gibt es von der Ausrichtung des Verhaltens her kaum eine Trennlinie zwischen unserem biologischen Erbe und dem »kulturellen Überbau«. Die Entwicklung und die Weitergabe von Memen, also kulturellen, den Genen analogen Informationseinheiten geschieht analog, also funktionsgleich zur genetischen Information (Dawkins 1977, Lorenz 1967). Konsequent betrachtet, ist die Weitergabe kultureller, oder aber genetischer Information ein funktionell identischer (analoger), wenn auch nicht herkun�sgleicher (homologer) Prozess. Die Spielregeln sind dieselben, der Effekt auf die Fitness ebenfalls, so diese nicht als Verpackungseinheiten, also als Zahl der wieder reproduktionsaktiven Nachkommen, sondern als deren Informationsgehalt definiert wird. Im evolutionären Geschehen wurden unsere Vorfahren zunächst darauf getrimmt, effizient Pakete von Erbinformation in Konkurrenz mit anderen weiterzugeben. Heute sind es innerhalb der Eliten der High-TechInformationsgesellscha� (weltweit gesehen eine kleine, aber regierende Minderheit) eher Meme (Dawkins 1977), also Pakete kulturellen Inhalts, die in Konkurrenz mit anderen um die Aufmerksamkeit anderer weitergegeben werden. Dies wirkt auch direkt auf die genetische Fitness zurück, welche allerdings zunehmend zur Nebenfront wird. Unser modernes Leben ist dicht mit Konkurrenzentscheidungen um Meme durchzogen: Welchen (möglichst »intelligenten«, daher ausbildungsintensiven) Beruf sollte unser Kind ergreifen, in welchem Supermarkt wird eingekau�, welche Wohnung gewählt, in welchen Vereinen sozialisiert man sich, welches Buch sollte man lesen, welche TV-Sendung sehen ... ? Konkurrierende Informationspakete, wohin man schaut – die vielen Sendekanäle der Fernsehsatelliten, die fast unendliche Fülle im Internet, all das zeigt das Grunddilemma der Informationsgesellscha� schlechthin: Menschen verfügen nur über einen erstaunlich engen Zugang ins Bewusstsein, können also etwa nur einen Sendekanal gleichzeitig beobachten, müssen sich daher entscheiden. Die konkurrierenden Stationen und Medien wiederum versuchen, auf diese Entscheidungen Einfluss zu nehmen, denn Einschaltquoten bestimmen über Gedeih oder Verderb von Sendungen und Stationen, genauso, wie der Gentransfer über Fortbestand oder Konkurs »genetischer Unternehmen«, also von Individuen und deren Verwandtscha�sklans bestimmt. Ein zunächst seltsames, aber dann doch recht erhellendes Phänomen sind die Nachrichtenstationen, etwa CNN, von denen es weltweit immer mehr gibt, die untereinander darum konkurrieren, uns »Information« zu verkau- Ist der Mensch ein Tier? 159 fen, also mehr oder weniger interpretierte Berichte von Ereignissen. Der Konsum dieser Informationen hat offenbar Unterhaltungswert, verdeutlicht die Informationssucht der Menschen. Wie sonst wäre es erklärbar, dass viele Menschen freiwillig und tagtäglich großteils grauenha�e Nachrichten über Katastrophen und Gewalt über sich ergehen lassen, die überwiegend für ihr gegenwärtiges Leben völlig irrelevant sind, sich also über etwas informieren, das zu wissen eigentlich mit keinerlei Nutzen verbunden ist? Ob es nun im australischen Busch brennt, oder Züge in Indien entgleisen – was haben wir von diesen Informationen? Eine grundlegende Antwort scheint zu sein, dass Menschen eben notorisch informationssüchtig sind, ein williges Publikum für Märchenerzähler, Dor�ratsch, oder die TV-Nachrichtenkanäle. Menschen suchen und assimilieren Information und es bereitet ihnen offenbar Schwierigkeiten, sie auf spezifische Relevanz zu filtern. Die Verhaltensstrategien, welche die für Effizienz in diesen Informationstransferspielen sorgen, sind uralt: Kommunikation und Manipulation von Konkurrenten und sozialen Partnern, damit diese im eigenen Interesse handeln sind Eigenscha�en, die vielen sozialen Tieren zueigen sind und finden sich besonders ausgeprägt bei Raben, Schimpansen und Menschen. Diese Strategien wurden im Zusammenhang mit dem genetischen Fitness-Spiel entwickelt. Auch ursächlich verschmolzen Gen- und Mempropagierung immer mehr. Mem-Handling-Kapazität wurde im Bereich der menschlichen Partnerwahl immer wichtiger. Der Turbo wurde wahrscheinlich mit der rasanten Entwicklung der menschlichen Sprache, vor etwa 700 000 Jahren eingebaut. Die Kapazität, mit Memen umzugehen, die für die anderen Mitglieder der eigenen Gesellscha� von Bedeutung sind, wirkt direkt auf den Informationsfluss über Gene zurück. Ressourcenreiche Männer wirken auf Frauen aus gutem Grund immer schon anziehend: Reichtum wirkt zeitlos sexy. Heute spielt aber vielfach die Informationstransfer-Kapazität dieselbe Rolle, welche zudem zur Kontrolle der materiellen Ressourcen immer wichtiger wird. Wirtscha�bosse, Techniker, Computerwissenscha�ler usw. sind darauf angewiesen, ihre kognitiven Fähigkeiten anders einzusetzen als etwa der klassische Fließbandarbeiter. Kopfarbeiter verdienen gewöhnlich mehr als Handarbeiter und haben daher auch einen höheren Marktwert auf der Partnerbörse. Berufe mit hohem gesellscha�lichem Ansehen sind ausnahmslos informationsintensiv. Sie können, müssen aber nicht mit hohem Einkommen einhergehen, wie das Beispiel der jungen Wissenscha�ler an den Universitäten zeigt. Aber auch deren Zukun�spotential ist hoch. Die Essenz sowohl der biologischen, als auch der kulturellen Reproduktion ist die Weitergabe relevanter »Selbst«-Information; die Spielregeln der biologischen Evolution sind weitgehend mit jenen der Kulturevolution identisch. Dabei ist »Selbst«-Information als jene zu definieren, welche die eigene Fitness (nun in einem breiteren, auch gesellscha�lichen Sinn) fördert und somit die Chancen auf ihre eigene Perpetuierung verbessert. Der Kulturevolution zugrundeliegende Mechanismen sind alle mit Informationsfluss verbunden: 1. die differentielle Vererbung der Gene, 2. individuelles Lernen und 3. kulturelle Übertragung durch soziales Lernen und 160 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Traditionsbildung. Von der Warte der Informationsausbreitung und der Konkurrenz zwischen Informationsinhalten sind 1 und 3 beinahe identisch, während das Ergebnis von 2 mit dem Tod eines Individuums verlorengeht, so es dieses nicht scha�, seine akkumulierte Weisheit in die Kulturtradition eingehen zu lassen. Es scheint kein Zufall, dass sich die demographische Wende in unterschiedlichen Teilen der Welt immer wieder parallel zum Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellscha� vollzog. Es sollte unmaßgeblich sein, ob die fitnessrelevante »Selbst«-Information aus dem alten biologischen Speicher DNS oder aus unseren modernen Archiven der Kultur kommt. Die kulturelle Information wird proportional zu ihrer Menge und zur Relevanz und Fitness-steigernden Bedeutung ihres Inhalts im Verhältnis zur genomischen Information an Bedeutung gewinnen. In den technisierten Gesellscha�en des 20. und 21. Jahrhunderts gesta�en uns Hochtechnologie-Hilfsmi�el immer mehr an gesellscha�lich relevanter Information zu speichern und zu verarbeiten, sogar mehr, als in unseren Genomen enthalten ist. Somit verschiebt sich in der Konkurrenz zwischen Erbinformation und kulturellen Inhalten das Gleichgewicht rasch zugunsten letzterer. So ist es in einer Bildungs- und Informationsgesellscha� aus »Sicht des Informationsgehalts« vernün�iger, wenn wir als ihre Perpetuenten uns nicht einfach physisch »auf Teufel-komm-raus« vermehren. In der Regel, und zwar abhängig vom Einkommen, können Eltern vieler Kinder weniger in die Bildung (und damit in die Zukün�ige Kapazität, mit Information umzugehen) einzelner Nachkommen investieren, als Eltern weniger Kinder. Und diese wenigen, gut gebildeten Kinder werden individuell mit einer größeren Wahrscheinlichkeit das Potential aufweisen, mit einer großen Menge relevanter Information (= Bits × Fitnessrelevanz) umzugehen, als viele nur mäßig gebildete. So verschwimmen der Grenzen zwischen Analogie (Funktionsgleichheit) und Homologie (Herkun�sgleichheit) bei der Betrachtung evolutionärer und kultureller Vorgänge. Es gilt, die Entwicklung von einer physischen Reproduzentengesellscha�, die wir bislang waren, in die Informationsgesellscha� auf evolutionärer Basis durch testbare Arbeitshypothesen zu vernetzen. Wenn dieselben Verhaltensanlagen und psychologischen Mechanismen sowohl für die Propagierung genetischer, als auch kultureller Information taugt, mehr noch: Wenn es eine innige Beziehung zwischen kulturellen Fähigkeiten und A�raktivität von Partnern gibt, wir also (in Konkurrenz mit unseren Mitmenschen entstandene) Hochleistungs-Informationsüberträger sind, wird die Diskussion über Kultur einfacher und komplexer zugleich. Für Konrad Lorenz (1967) waren Kulturen »Pseudoarten«, die Ähnlichkeiten zur biologischen Artbildung lagen für ihn auf der Hand. Es scheint, als wäre das Informationsfluss-spezialisierte Wesen Mensch über eine Art »Runaway-Selektionsprozess« zustandegekommen, ähnlich wie man sich die Evolution von durch »Fishersche Prozesse« entstandenen sekundären Geschlechtsmerkmale vorstellt: Je besser unsere Fähigkeiten zum Informationstransfer sind, desto schneller dreht sich die Entwicklung. Antrieb ist die Konkurrenz um begrenzte Ressourcen durch geistige Fähigkeiten, um Ist der Mensch ein Tier? 161 letztlich Status und Partnermarktwert. Immer schon und vermehrt heute sind Wissen, soziale Kompetenz und hohe Kulturfähigkeit sexy. Es dauerte einige Millionen Jahre, bis aus der Verzahnung der Leistungsfähigkeit der Hirnrinde mit kulturell tradierten Informationen die Menschen auch dank technischer Hilfsmi�el die Fähigkeit entwickelten, als Individuen extragenomische Dichten des Informationsflusses zu erreichen, die mit jenen des Genoms und der sexuellen Vermehrung vergleichbar sind. Es ist vielleicht kein Zufall, dass gleichzeitig, oder kurz vor dem Erreichen dieser »kritischen individuellen Informationskapazität« in den betroffenen Gesellscha�en die demographische Wende eintrat, also eigentlich die Entkopplung der Fitness von der Reproduktion. Mit herkömmlichen evolutionär-soziobiologischen Argumenten ist dies kaum erklärbar, wohl jedoch, wenn man die vom Individuum propagierte genomische und extragenomische Information gleichsetzt. Artvergleiche stehen für den Test dieser Hypothese nicht zur Verfügung, da es nur Menschen bislang scha�en, eine mit dem Genom im Ausmaß konkurrierende kulturelle Informationsinhalte aufzubauen. Da aber menschliche Gesellscha�en in Hinblick auf die kulturelle Informationskapazität recht unterschiedlich entwickelt sind, sollten Vergleiche zwischen Kulturen geeignet sein, Vorraussagen dieses Gedankenmodells zu überprüfen. Anfänglich mag die Zunahme unserer Hirnrinde an Volumen und Komplexität durch den aufrechten Gang, das damit verbundenen Freiwerden der Hand, durch die langsam einsetzende Sprachfähigkeit, durch soziale und viele andere Faktoren und eine Kombination derselben katalysiert worden sein. Hypothesen zu den Ursachen für diesen Prozess der Menschwerdung gibt es sehr viele. Die meisten von ihnen mögen etwas zur Erklärung des Phänomens beitragen. Eine gewisse Entwicklungshöhe bezüglich Kommunikationsfähigkeit war dann die Eintri�skarte in den RunawaySelektionsprozess, aus dem sich, ausgehend von mündlicher Überlieferung, unsere Fähigkeit zum aktiven Umgang mit großen und relevanten Mengen an extrakorporaler Information ergab. Somit ist die Informationsgesellscha� ein ebenso zwangsläufiger wie vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung. Analog zur Selektion am Informationsträger Individuum, welche in der biologischen Evolution zuweilen über eskalierende Prozesse zu funktionieren scheint, gab es ähnliche Entwicklungen im Verlauf der Kulturevolution. Sie bilden die eigentliche Basis dafür, dass kulturelle Information in ernstha�e Konkurrenz zur genomischen treten konnte. Allein die parallel zur kulturell relevanten Informationsmenge gestiegene Speicherkapazität für solche Information explodierte nach einem gemächlichen Anstieg von der Antike in die Neuzeit während der letzten Jahrzehnte. Vermutlich würde heute der gesamte Inhalt der antiken Bibliothek von Alexandria auf ganz wenigen CDs Platz finden. Das it aber noch recht wenig beeindruckend, verglichen mit unserem Zellkern, welcher die gesamte Information zum Au�au unseres Körpers enthält. Und jeder von uns trägt diese gewaltige Informationsmenge in mehreren Milliarden Kopien im Körper. Die kulturellen Informationsspeicher sind auf dem Weg, sich der Effizienz des biologischen Speichers anzunähern, 162 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? bzw. übertreffen diese bereits, beispielsweise was die Wandelbarkeit der Informationsinhalte betri�. Sollte diese Hypothese des Fitnessgewinns durch Transfer von relevanter »Selbst«-Information, gleich, ob aus dem Bio- oder Kulturspeicher zutreffen, dann ergeben sich daraus eine Reihe von Zukun�sperspektiven. So etwa wäre der in allen möglichen wirtscha�lichen oder religiösen Gewändern daherkommende Nord-Südkonflikt auch ein Konflikt zwischen Informationsüber tragungssystemen. Die westlichen Informationsgesellscha�en verzichten auf biologische Reproduktion, die vorindustriellen Gesellscha�en haben keinen Zugang zu den Kulturtechniken des Informationsmanagements. Dies würde sich höchstens durch größte Bildungs-und Entwicklungsanstrengungen, nicht aber durch Almosen vom Tisch der Reichen ausgleichen lassen. Auch innerhalb unserer westlichen Informationsgesellscha� kommt es ebenso klar, wie gefährlich zur Kastenbildung: Die Eliten herrschen durch ihre Fähigkeit, mit kultureller Information umzugehen. War für Karl Marx die Kontrolle über das Kapitals und die Produktionsmi�el das Machinstrument der Industriegesellscha�, so ist es in der Informationsgesellscha� die Kontrolle über die Informationsflüsse. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung wird darin nicht voll eingebunden sein und eine Art »Arbeiterkaste« bilden, deren politisches Wohlverhalten durch Indoktrination sichergestellt wird, die einen Markt für die von der Info-Oberschicht hergestellten Produkte bildet, sonst aber herzlich wenig Bedeutung hat. Schon heute werden ganz offensichtlich die Informationstechnologien TV und Internet genau dafür genutzt. Die Medien »demokratisieren« die Gesellscha� nicht, im Gegenteil sie polarisieren. Aus einer radikal-evolutionären Sicht des Informationstransfers wären Gegenmaßnahmen weder nötig noch »erwünscht«. Jene Informationsinhalte, bzw. ihre Träger, die mit dem höchsten Fitnessgewinn verknüp� sind, würden sich in darwinistischer Verdrängungskonkurrenz ohnehin am Markt durchsetzen. Das kann aber wohl nicht im Interesse einer nachhaltigen Stabilität unserer Gesellscha�en liegen. Maßnahmen zum Informationsmanagement sind gefordert. Diese Skizze möglicher Vernetzungen zwischen biologischer und kultureller Information sollte auch dazu dienen, die Künstlichkeit der Dichotomie zwischen biologischen und kulturellen Prozessen aufzuzeigen und im Ansatz eine radikale Synthese zwischen Natur- und Kulturevolution vorzuschlagen. Damit sollen die gesellscha�lichen Phänomene evolutionär erklärbar und über ein daraus ableitbares Set von Hypothesen auch naturwissenscha�lich testbar werden. Sexualität: Motor und Ergebnis der Evolution Dass wir Menschen zoologische Wesen sind, deren im Genom verankerte Prozessstrukturen maßgeblich Verhalten bestimmt, ist besonders am elementaren Kommunikations- und Sozialverhalten ersichtlich (Grammer 1988). Noch wird allgemein bezweifelt, dass sogar unser Kulturverhalten in Rückkopplung mit den evolutionären Wurzeln abläu�. Sexualität und Vermehrung dagegen werden bereitwilliger, als anderes menschliches Ist der Mensch ein Tier? 163 Verhalten der Biologie zugeschlagen. Es kann ja tatsächlich schön und lustbringend sein, auf diesem Gebiet das »Tier im Menschen« gewähren zu lassen. Das gilt für den ersten Flirt mit einem Partner, bei dem offenbar »etwas« mit uns durchgeht, bis zum Geschlechtsverkehr (Grammer 1993). Aber wer schließlich wann mit wem, wie und warum, das wird maßgeblich von den kulturellen Randbedingungen geprägt, die wiederum mit evoluierten Strategien verwoben, bzw. selber Produkte derselben sind. Entsprechend flexibel fallen die sozio-sexuellen Systeme des Menschen aus, aber das gibt es auch bei anderen sozialen Tieren (Daly und Wilson 1983, Lo� 1991). Die persönliche Einstellung zu Liebe, Sexualität und Partnerbindung wird unterschiedlich sein, es mag Lust- oder Problembetonung überwiegen, die grundlegenden Strukturen menschlicher Sexualität werden aber selten hinterfragt. In unserer Kultur gilt es offenbar als schicklich, sich nur an einen einzigen Partner gleichzeitig zu binden, manchmal ein Leben lang; man pflegt einander mehr oder weniger sexuell treu zu sein und Kinder miteinander aufzuziehen. Männern anderer Kulturen wiederum ist es erlaubt, mehrere Frauen gleichzeitig zu heiraten, so sie es sich leisten können. Tatsächlich überwiegen im Kulturenvergleich diese polygynen Systeme und nur in etwa 20% der Kulturen herrscht soziale Monogamie. Geht man allerdings vom realen Sexualverhalten aus, dann sind auch die westlichen Kulturen in einem erheblichen Ausmaß polygyn (Daly und Wilson 1983, Voland 2000). Im Tierreich existieren alle denkbaren Systeme, von der strikten monogamen Einehe, z. B. bei Gibbons und – mit Einschränkungen – bei vielen Vögeln, bis zur Promiskuität, wie etwa bei Schimpansen oder Ra�en; gelegentlich sind sogar die Nachkommen in einem einzigen Wurf von mehreren Vätern gezeugt. Es gilt, dass das soziale System, also wer mit wem zusammenlebt, bzw. Nachkommen aufzieht, sich nicht unbedingt mit den sexuellen Mustern decken muss. So etwa sind »alternative Paarungssysteme«, etwa Seitensprünge bei sonst monogamen Paaren, weit verbreitet. Es gibt jenes Geschlecht bei der Partnerwahl den Ton an, das mehr in die individuellen Nachkommen investiert, also meistens die Weibchen. Im Extremfall steuern die Männchen nur das Sperma zu den Nachkommen bei, wie etwa beim Balzarenasystem der Birkhühner. Es kann aber auch vorkommen, dass der weibliche Einfluss auf die Partnerwahl weniger offensichtlich ist, wie etwa bei den Haremssystemen der See-Elefanten, bei den Rothirschen oder den Pavianen. Männchen konkurrieren um diese Harems und die Weibchen müssen sich fügen, so scheint es. In den meisten Fällen bevorzugen die Weibchen allerdings die dominanten Haremshalter und wehren sich gegen Kopulationen mit anderen Männchen. Männchen können sich an der Jungenaufzucht beteiligen, wie etwa bei den Menschen, der damit unter den Säugetieren eher eine Ausnahme darstellt. Väterliche Jungenfürsorge gibt es vor allem bei den Vögeln. Gelegentlich können sich die traditionellen Geschlechterrollen sogar umkehren: Die Männchen investieren mehr in den Nachwuchs, als die Weibchen. So besorgen bei manchen Rallen (Teichhühner), beim Odinshühnchen oder den Straußen die Männchen das Brutgeschä�, bei den Fischen tun dies etwa Seenadeln und Seepferdchen. Diese Vielfalt der Systeme entlockt uns Menschen meist 164 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? kaum mehr als erbautes Staunen. Mit unserem eigenen, von Zoologie und Evolution scheinbar so abgehobenem Geschlechts- und Familienleben hat das natürlich nichts zu tun, oder doch? Um menschliches Verhalten verstehen zu können, ist es nötig, dieses in Perspektive mit der restlichen Zoologie zu setzen (Borgerhoff-Mulder und Judge 1993). Die Grundregel des evolutionären Spieles ist für alle Organismen auf der Welt dieselbe und lautet, mehr Nachkommen zu hinterlassen, als die Artgenossen. Diesem Ziel wird alles andere untergeordnet, darum drehen sich letztlich alle Strategiespiele, auch jene der Menschen. Wir tun immer noch so, »als ob«. Die Antriebe dafür sind in uns, aber es ist uns natürlich nicht bewusst. Brennpunkt Konflikte zwischen den Geschlechtern Für das Verständnis von Fortpflanzungsstrategien ist es nötig, die von der sexuellen Vermehrung geschaffenen Randbedingungen zu erörtern. Bereits in die Geschlechtszellen wird geschlechtsspezifisch asymmetrisch investiert. Während Männchen bloß die Erbinformation zum späteren Nachkommen beisteuern, stellt das Weibchen ein Ei bereit, welches neben der Erbinformation auch noch die gesamten Ressourcen für den Start der Embryonalentwicklung enthält. Tatsächlich hat das männliche Genom während der ersten Zellteilungen nichts mitzureden und alle unsere Mitochondrien (die Kra�werke der Zellen), sowie deren Erbinformation wird ausschließlich über die Weibchen weitergegeben. Diese anfängliche Asymmetrie kann noch verstärkt werden, wenn die Weibchen die Eier in ihrem Körper »erbrüten«, Embryonen als »Parasiten« in sich tragen, über eine Gebärmu�er ernähren und schließlich die geborenen Jungen mit einem körpereigenen Sekret, der Milch, ernähren. Diese extreme Form der Asymmetrie in der elterlichen Investition findet sich bei den Säugetieren. Säugermännchen können allenfalls Ressourcen für Weibchen und Nachkommen bereitstellen, ziehen es aber meist vor, sich nicht an der Aufzucht zu beteiligen. Anders bei den meisten Vögeln. Dort werden relativ große Eier gelegt und in einem Nest bebrütet. Dies bietet den Männchen Gelegenheit, sich im Vergleich zu Säugetieren bereits frühzeitig direkt an der Aufzucht der Jungen zu beteiligen, was bei den meisten Vogelarten auch der Fall ist. Diese asymmetrische Grundinvestition der Geschlechter in die Nachkommen führt recht direkt zu asymmetrischen Strategien im Fortpflanzungsverhalten und zu Konflikten zwischen den Geschlechtern. Jenes Geschlecht, welches mehr investiert, meist das weibliche, ist in seinem Fortpflanzungspotential durch die eigene Effizienz limitiert, Ressourcen in lebensfähige Nachkommen umzuwandeln. Dies begrenzt die mögliche Anzahl der Nachkommen. Die Streubreite des Fortpflanzungserfolges ist meist geringer als bei den Männchen. Bei letzteren dagegen kann die Nachkommenzahl proportional zu ihrem Zugang zu fertilen Weibchen steigen. Das männliche Fortpflanzungspotential ist daher gewöhnlich durch die Paarungsmöglichkeiten begrenzt. Dies erklärt auch die wesentlich höhere Variabilität im Fortpflanzungserfolg der Männchen im Vergleich zu den Weibchen: Bedingt durch die Konkurrenz Brennpunkt Konflikte zwischen den Geschlechtern 165 um fruchtbare Weibchen, zeugen gewöhnlich wenige Männchen relativ viele Nachkommen, viel mehr, als etwa ein einzelnes Weibchen je produzieren könnte. Viele Männchen dagegen hinterlassen wenige bis gar keine Nachkommen. Das ist bei Hirschen oder Seelöwen nicht viel anders als beim Menschen. Die Rekorde zeigen die Unterschiede im Potential besser, als die Durchschni�e: Während es Molay Ismail (»der Blutdürstige«), ein marokkanischer Herrscher des letzten Jahrhunderts laut »Guiness Buch der Rekorde« auf 888 selbstgezeugte Nachkommen brachte (er war also nicht nur »blutdürstig«), gebar die Rekordfrau, eine Russin, in 27 Schwangerscha�en »nur« 69 Kinder (Serien-Mehrlingsgeburten). Diese Asymmetrie führt dazu, dass Weibchen durch falsche Partnerwahl viel zu verlieren haben, also bei Paarungs- und Bindungsentscheidungen recht wählerisch sein sollten. Die konkurrierenden Männchen dagegen verlieren durch eine ungünstige Paarung in der Regel bloß ein wenig Sperma. Sie sollten daher stets konkurrenz- und kopulationsbereite Draufgänger sein, denn die Anzahl möglicher Partnerinnen ist stark durch die Tatsache eingeschränkt, dass die weiblichen 50 % der Populationen meist zum Großteil mit dem Aufziehen von Nachwuchs beschä�igt und daher nicht empfängnisbereit sind. Die Einbe�ung in die aktuelle Ökologie und in soziale Netzwerke, der genetische Hintergrund und die individuelle Entwicklung beeinflussen schließlich die Feinabstimmungen im sozialen und sexuellen Bereich. Weibliche und männliche Strategien Die weiblichen Beziehungen zum männlichen Geschlecht spannt sich zwischen zwei Polen. In Arenabalzsystemen bemühen sich mehrere bis viele Männchen um die Gunst des Weibchens, welches seine Wahl tri�, sich das Sperma zur Befruchtung ihrer Eier abholt und gleich wieder von dannen zieht. Die gesamte Investition von Ressourcen in die Nachkommen trägt ausschließlich das Weibchen. Im anderen Extrem übergeben Weibchen ihre Eier möglichst früh den Männchen zur Betreuung. Daher können Männchen in diesen Systemen auch mehr in Nachkommen investieren, als Weibchen, werden also für die Weibchen zur gesuchten Ressource und zum Konkurrenzobjekt. Es kommt zur Umkehr der Geschlechterrollen. Beispiele dafür sind manche Watvögel und Rallen: Weibchen verteilen ihre Eier meist auf die Nester mehrerer Männchen und verteidigen diesen ihren »Harem« von Dienstleistern auch gegen andere Weibchen. Obwohl damit eigentlich auch die Männchen abgehandelt wären, fehlen doch noch wesentliche Elemente der Männchenstrategien zur Optimierung des männlichen Fortpflanzungserfolges. Es geht vor allem um die Sicherung der eigenen Vaterscha�, entweder durch Monopolisieren der Weibchen oder durch Spermakonkurrenz, mit allen denkbaren Übergängen. So gewährleisten Haremssysteme, etwa bei See-Elefanten, Löwen oder Gorillas, dass eines der meist sehr viel größeren Männchen seine Weibchenschar recht effektiv gegen Kopulationsversuche von Konkurrenten abschirmen kann. Wenn auch immer wieder verschiedene »Beimännchen« in diesen Systemen recht erfolgreich Kopulationen erschleichen. Wenn die Abschirmung »per Bizeps« funktio- 166 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? niert, reicht es aus, dass Geschlechtsorgane und Hoden der Haremshalter gerade eben groß genug ausgebildet sind, um Nachkommen zu zeugen. Die Hauptinvestition auf der männlichen Seite liegt in einem kampfstarken Körper, entstanden in der Konkurrenz zwischen Männchen um Weibchen. Eine Differenzierung in sehr große Männchen und kleine Weibchen ist die Folge. Das andere Extrem ist die in promisken Systemen ausgeprägte Spermakonkurrenz, etwa bei den Schimpansen. Spermakonkurrenz spielt aber auch in monogamen Systemen eine Rolle, bei denen Seitensprünge als alternative Strategie vorkommen. In diesen Fällen gelingt es den Männchen nicht, die sexuelle Aktivität der Weibchen zu kontrollieren. Fertile Weibchen kopulieren o� in rascher Folge mit mehreren Männchen, deren Sperma dann innerhalb des Weibchens um die Befruchtung ihrer Eier konkurriert. Neben der vom Weibchen kontrollierten Zeitpunkt einer Kopulation ist daher auch die Menge des abgegebenen Spermas ein Faktor in der Konkurrenz um Fortpflanzungserfolg. Daher zeigen die Männchen in solchen Sperma-Konkurrenzsystemen relativ große Hoden, während der Geschlechtsdimorphismus in der Körpergröße eher gering bleibt. Vergewaltigung ist als alternative männliche Reproduktionsstrategie im Tierreich weit verbreitet. So versuchen, Männchen von geringem sozialen Status (und daher geringer A�raktivität für die Weibchen) Kopulationen zu erzwingen. Die gerade beim Menschen recht häufigen Vergewaltigungen haben sicherlich vielschichtige Ursachen. Es geht um Dominanzausübung gegenüber Frauen, Minderheiten oder unterlegenen Kriegsparteien. Diese Ursachen und Funktionen sind aber nie ganz von Vergewaltigung als alternative männliche Reproduktionsstrategie getrennt zu sehen (Thornhill und Thornhill 1992), zumal menschliche Sexualität sehr o� mit Dominanz- und Gewaltausübung einhergeht. Vergewaltigt wird zwar von Männern aller Altersgruppen und sozialen Schichten, gehäu� aber durch jüngere Männer mit geringem sozioökonomischen Status, denen es gewöhnlich schwer fällt, eine Partnerin zu finden. Dass die Neigung zu vergewaltigen u. U. evolutionäre Wurzeln aufweist, entschuldigt allerdings nichts, denn wir müssen keine »Sklaven unserer Gene« sein. Variable Sozialsysteme Exkurs 12: Quellen und Bedeutung der individuellen Variabilität des Verhaltens Das Verständnis des Selektionsprozesses beruht seit Darwin auf der individuellen Variabilität von Merkmalen und den zugrundeliegenden Genen. Denn Individuen sind die Einheiten, an denen Selektion über unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg wohl am stärksten wirkt. Bestimmte Zusammensetzungen von Allelen (die unterschiedlich ausgeformten, homologen Gene) bewähren sich in konkreten Umwelten besser und setzen sich über erhöhten Fortpflanzungserfolg durch. Individualität ist daher das Substrat für die Mikroevolution. Individualität Brennpunkt Konflikte zwischen den Geschlechtern 167 ist für die moderne Verhaltensbiologie nicht einfach lästiges Rauschen in den Populationsdaten, sondern Untersuchungsgegenstand. Öko-Ethologen und Soziobiologen untersuchen die Zusammenhänge zwischen der individuellen Variabilität im Verhalten und der Fitness (= Zahl der wieder reproduktiv aktiven Nachkommen). Individualität entsteht zwischen Genen und Umwelt (Exkurs 8). Und auch Hormoneinflüsse in der Frühentwicklung können sehr wichtig werden. So ist schon länger bekannt, dass die Positionierung eines Fötus im Gebärmutterhorn, etwa bei Mäusen individuelles Verhalten nach der Geburt stark beeinflussen kann (vom Saal 1979). Weibchen, die zwischen zwei Brüder zu liegen kamen, sind als Erwachsene aggressiver und entfernen sich weiter vom Nest, als Weibchen, die in utero zwischen Schwestern lagen. Weil Steroidhormone Membranen passieren, können geringe Mengen des von den Brüdern produzierten Testosterons die Entwicklung der Weibchen beeinflussen; ähnliches gilt für das von den Schwestern produzierte Östrogen, welches entsprechend auf die Männchen wirkt. Ganz ähnlich können Mütter direkt in die Frühentwicklung ihrer Nachkommen eingreifen. So wurde bei Vögeln gezeigt, dass die von der Mutter in die Eidotter eingelagerten Androgene den Verhaltensphänotyp (die »Persönlichkeit«, das »Temperament«) der Nachkommen beeinflussen kann. So lagern etwa Singvogelweibchen in der Legereihenfolge zunehmend mehr Testosteron in ihre Eier ein. Bei den Schlüpflingen bewirkt dies verstärktes Betteln und Konkurrenzfähigkeit. Als Effekt dieser ungleichmäßigen Verteilung der mütterlichen Gunst betteln die aus den letzten Eiern des Geleges später schlüpfenden und daher kleineren Jungen intensiver als ihre Tage vorher geschlüpften Geschwister und können so ihren Startnachteil zumindest teilweise wieder wettmachen (Schwabl u. a. 1997). Anders etwa bei Reihern, bei denen das erstgeschlüpfte Junge fast immer das zweitgeschlüpfte tötet. In diesem Fall »unterstützt« die Mutter den Brudermörder durch Einlagerung von mehr Testosteron im ersten Ei (Sockman und Schwabl 2000). Versuche mit zusätzlich mit Testosteron versehenen Eiern ergaben eine profunde, wahrscheinlich lebenslange Beeinflussung der Persönlichkeit (Daisley u. a. 2003). Tiere aus Eiern mit viel Testosteron gehen aktiver mit den Herausforderungen des Lebens um, als Individuen aus Eiern mit wenig Hormon, sie sind aggressiver, packen neue Situationen rascher an, erforschen neue Objekte schneller, aber oberflächlicher, sind sozial weniger stark bezogen, neigen eher zur Bildung von Routinen und sind weniger geneigt, umzulernen, als die sanfteren, zurückhaltenderen Tiere aus Eiern mit wenig Testosteron (Koolhaas u. a. 1999). Zudem zeigte sich, dass diese Unterschiede in den Temperamenten maßgeblich beeinflussen, welche Rollen Individuen in sozialen Gruppen übernehmen (Pfeffer u. a. 2002). Ob und wie Mütter diesen einfachen Mechanismus nutzen, um ihre Nachkommen zu »manipulieren«, ist gegenwärtig einer der Brennpunkte der internationalen Verhaltensforschung. Schon lange stehen im Zusammenhang mit der Partnerwahl individuelle Unterschiede im Mittelpunkt des Interesses. Dies gilt etwa für die sogenannte fluktuierende Asymmetrie (Watson und Thornhill 1994). In allen Populationen weichen Individuen in ihren körperlichen Merkmalen scheinbar zufällig von der 168 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? idealen Bilateralsymmetrie ab. Dies wird durch geringe Störungen während der Individualentwicklung verursacht, ausgelöst etwa durch schlecht verträgliche mütterliche und väterliche Genome, durch Inzucht, Infektionen und Parasiten. Die Weibchen vieler Arten wählen Paarungspartner oft aufgrund der Ausformung »extravaganter« Merkmale. Dazu gehört das Prachtgefieder der Pfauen ebenso, wie das der männlichen Paradiesvögel, gepaart mit reichlich seltsamen Balzverhalten. Über sexuelle Selektion haben die Weibchen den Männchen diese Merkmale oft in einem Ausmaß angezüchtet, dass diese hart an die Grenze der Überlebensfähigkeit gedrängt werden. Dabei scheuen die Weibchen nicht nur auf die Größe, sondern auch auf die Symmetrie der Merkmale (Møller 1994). Dabei fand man auch eine zunächst überraschende, positive Beziehung zwischen der Größe des relevanten Merkmals und seiner Symmetrie. Wahrscheinlich wird beides durch eine eine relativ störungsfreie Entwicklung positiv beeinflusst. Tatsächlich fand man, dass Symmetrie ofenbar ein Schlüsselkriterium für die Partnerwahl einer Reihe von Tieren darstellt, von Insekten bis Vögel und sogar Mensch. Warum aber soll gerade die Symmetrie ein für die Partnerwahl wichtiges Merkmal darstellen? Geht man davon aus, dass Partner nach Qualität gewählt werden, dann braucht es entsprechende Kriterien. Dafür eignet sich die Symmetrie ganz hervorragend. Asymmetrie ist ein Zeichen für instabile Entwicklung, welche eine Reihe von Ursachen haben kann, welche aber letztlich alle auf genetische Eigenschaften zurückzuführen sind. Ganz egal, ob durch erhöhte Parasitenanfälligkeit, genetische Inkompatibilität oder Inzucht hervorgerufen: Ein asymmetrischer Bewerber demonstriert augenscheinlich, dass seine Fitness, und daher auch die Fitness der von ihm gezeugten Nachkommen bezogen auf die aktuelle Umwelt nicht gerade optimal ist. Individuelle Unterschiede können aber auch auf Basis vorhandener Lernbereitschaften erlernt sein. Dazu zählen etwa durch Prägung erworbene Vorlieben bezüglich Sozial- oder Sexualpartner oder sogar Präferenzen für Lebensraum oder Nahrung. Da solche früh erlernten Vorlieben meist lebenslang stabil bleiben, sind sie ebenfalls Merkmale der Persönlichkeit. Die Sozial- bzw. Nachfolgeprägung bei nestflüchtenden Jungvögeln wurde durch Konrad Lorenz hinlänglich bekannt. Es handelt sich dabei um einen sehr raschen Lernprozess. Kommt etwa das gerade geschlüpfte Gössel nur wenige Minuten in Kontakt mit Menschen, bevor es Gänse sah, wird es bis zu seiner natürlichen Ablösung von den Elter, mit etwa einem Jahr Menschen Gänsen als Sozialpartner bevorzugen. Die Vorbilder für die später einsetzende sexuelle Prägung sind zumindest bei manchen Vögeln oft die eigenen Geschwister. Wäre der Mechanismus zu eng angelegt, würde dies zur Bevorzugung von Geschwistern und damit zu Inzucht führen. Darum ist bei den meisten Wildtieren Inzestvermeidung meist stark ausgeprägt. Nestflüchtende Vögel vermeiden es in der Regel, sich mit jenen Individuen zu verpaaren, mit denen sie aufwuchsen. Bateson (1983) testete die Partnerinteressen von Wachteln und kam zum Schluss, dass Cousinen zweiten und dritten Grades gegenüber engeren Verwandten, bzw. gänzlich Nicht-Verwandten am meisten interessieren. Die Tiere verfügen also über die erstaunliche Fähigkeit des »Phenotype matching«, ihre eigene Erscheinung mit dem anderer zu vergleichen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Die Regel Brennpunkt Konflikte zwischen den Geschlechtern 169 scheint also zu lauten, einen Partner zu bevorzugen, der (die) eine gewisse Ähnlichkeit zum Vorbild aufweist. Diese wenigen Schlaglichter auf das Phänomen der Individualität sollten zeigen, dass nicht nur Menschen davon betroffen sind und dass individuelle Variabilität nicht nur als eine für Forscher lästige Begleiterscheinung zu sehen ist, es ist der springende Punkt im Mechanismus der Evolution und daher natürlich von höchster Relevanz für die Evolutionsforschung. Lässt sich angesichts der vielfältigen Formen des Zusammenlebens zwischen den Geschlechtern – Dauerehe, Ehe auf Zeit, sukzessive Polygynandrie, homosexuelle Gemeinscha�en, Seitensprünge, usw. – eine verhaltenswirksame Rolle traditioneller evolutionärer Strategien überhaupt noch vertreten? Wie es aussieht, durchaus! Gerade weil evolutionär entstanden, sind sexuelle und soziale Systeme in Grenzen plastisch. »Sexuell« und »sozial« sind dabei keine Synonyme. Soziale Systeme definieren sich über das Gesellscha�ssystem, über das Wie des gemeinsamen Aufziehen des Nachwuchses. Sexuelle Systeme dagegen sind dadurch definiert, wer mit wem Nachkommen zeugt. Erzeuger und Aufzieher müssen zumindest auf der männlichen Seite nicht identisch sein. Genausowenig wie ein starres System beim Menschen existiert, gibt es »das« Sozialsystem des Schimpansen, des Löwen oder der Heckenbraunelle. Soziale Systeme sind entsprechend den geschichtlichen, ökonomischen und damit ökologischen Randbedingungen innerhalb gewisser Grenzen variabel (Lo� 1991). Evolutionäre Strategien steuern im Hintergrund. Dass in der Regel das Sozialsystem kein gutes Artmerkmal darstellt, zeigt das Beispiel der Heckenbraunelle. Dieser eher unscheinbare europäische Singvogel verändert sein Sozialsystem ganz nach Bedarf, selbst innerhalb einer Saison, von einer Brut zur nächsten. So treten, abhängig von Nahrung und Populationsdichten neben der Monogamie auch Polygynie (meist ein Männchen, zwei Weibchen), Polyandrie (zwei Männchen, ein Weibchen) und Polygynandrie (meist zwei Männchen und zwei Weibchen) auf (Davies 1992). Ähnlich vielfältig wie bei der Heckenbraunelle sind die Partnersysteme beim Menschen. Mit oder ohne gesellscha�liche Billigung findet man Monogamie, meist mit Seitensprüngen, Polygynie, selten Polyandrie und ein wenig Promiskuität. Beziehungen bestehen entweder zwischen mehreren Partnern simultan, oder die Partner sind sukzessiv monogam, wechseln also in mehr oder weniger rascher Folge. Trotz dieser offensichtlichen Vielfalt fand man mit Hilfe der vergleichenden Öko-Ethologie und durch den Kulturenvergleich evolutionär bestimmte Muster. Es besteht kein Zweifel, dass Menschen zu den hominiden Primaten, also zu den Menschenaffen zählen. Immerhin teilen wir mehr als 98 % der genetischen Information mit Schimpanse und Bonobo, etwas weniger mit Gorilla und Orang Utan. Damit ist es möglich, Menschen mit ihren nächsten 170 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Verwandten zu vergleichen, etwa bezüglich des sozio-sexuellen Systems. Menschenmänner stehen zwischen den relativ zum Körper großhodigen Schimpansen und den sehr kleinhodigen Orangs, Gorillas und Gibbons, wobei Schimpansen promiskuitiv sind, letztere dagegen entweder monogam oder bilden Harems. Bei den Haremshaltern sind die Männchen sehr groß, Weibchen dagegen recht klein, bei den Monogamen oder auch beim promisken Schimpansen ist der Geschlechterdimorphismus in der Körpergröße beinahe ausgeglichen. Menschen stehen wiederum in der Mi�e. Daraus wäre ableitbar, dass Menschen monogam bis polygyn (ein Mann, mehrere Frauen) leben und dass Männer bis zu einem gewissen Grad Frauen für sich monopolisieren. Dass dies so ist, zeigt recht drastisch ein täglicher Blick auf die Chronikseiten der Tageszeitungen: Ständig werden Frauen zu Opfern ihrer gewal�ätig-eifersüchtigen Männer, selten dagegen umgekehrt. Die relative Hodengröße deutet übrigens auch an, dass auch Spermakonkurrenz eine Rolle spielen könnte. In einem breiten Kulturenvergleich waren von 849 menschlichen Gesellscha�en weltweit mehr als ein Dri�el gesellscha�lich polygyn, ein weiteres Dri�el monogam bis gelegentlich polygyn (nach Daly und Wilson 1983); insgesamt lag der Anteil polygyner Gesellscha�en bei 83%. Nur 16% waren monogam (ein Mann und eine Frau), gar nur 0,5% polyandrisch (einen Frau heiratet mehrere Männer gleichzeitig). Die Ergebnisse der Öko-Ethologie und der Anthropologie stimmen also überein, die Wurzeln des Menschen in die evolutionäre Vergangenheit sind offenbar recht stark. Menschenmänner steuern meist Ressourcen für ihren heranwachsenden Nachwuchs bei. Und Frauen beanspruchen Männer nicht nur zum Kopulieren, sondern versuchen sie über diverse Mechanismen langfristig zu binden. Männliche Strategien zur Sicherung ihrer Vaterscha� bewegen sich zwischen eifersüchtigem Hüten und Monopolisieren, wie bei Gorillas üblich, und Spermakonkurrenz, wie bei den Schimpansen (s. unten). Frauen »schufen« sich die Männer Aufgrund der asymmetrischen Investition in die Nachkommen stehen die reproduktiven Strategiespiele in der gesamten Zoologie, besonders aber beim Menschen, unter weiblicher Kontrolle. Auf den Punkt gebracht, sind beinahe alle männlichen Merkmale evolutionär Produkte der weiblichen Wahl. Die o� laute, auffällige Selbstdarstellung der Männer, beginnend im Kindergartenalter, ihr Konkurrenzgehabe, auch ihr Hang zur Macht, ist letztlich vom weiblichen Geschlecht verursachtes Substrat für weibliche Wahl. Dass Eva aus einer männlichen Rippe geschaffen worden sein sollen, ist daher im Lichte der Erkenntnisse der modernen Biologie eine typisch männliche Erfindung. Frauen waren weitgehend erfolgreich, sich Männer nach ihren Ansprüchen zu formen. Etwas weniger extrem formuliert: Weibchen und Männchen, Frauen und Männer, sind das Ergebnis von Koevolution, eines evolutionären Rüstungswe�laufes im zwischengeschlechtlichen Interessenskonflikt um optimale Reproduktion. Die Ausbildung des einen Geschlechts wäre ohne das andere nicht vorstellbar. Brennpunkt Konflikte zwischen den Geschlechtern 171 Konflik�rächtiges Mi�el zum Zweck: der Seitensprung Der Seitensprung als scheinbar widersinnige Begleiterscheinung nahezu aller monogamer Systeme verdient hier eine detaillierte Betrachtung. Er gilt als »Alternative Paarungsstrategie« und wir� erhellende Schlaglichter auf die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Grundstrategien zur Optimierung der Fortpflanzung. Quer durch die Zoologie existieren, wie erwähnt zwei gegensätzliche Männchenstrategien zur Vaterscha�ssicherung: Entweder gelingt es, Weibchen zu monopolisieren, sie vor den Avancen anderer Männchen abzuschirmen, oder es herrscht Konkurrenz zwischen den Männchen auf der Ebene des Spermas. Die Vorhersage aus dem oben diskutierten Artenvergleich wäre daher, dass Menschenmänner sowohl versuchen, ihre Partnerinnen zu monopolisieren, als auch einen Hang zum Seitensprung entwickeln sollten und daher in Spermakonkurrenz involviert sind (Smith 1984, Voland 2000). Seitensprünge erhöhen direkt die Chancen der Männer um mehr Nachwuchs (den dann andere großziehen). Beides tri� zu: Seitensprünge sind relativ häufig, etwa 50 % der paargebundenen Menschen in unseren Breiten geben zu, dass sie gelegentlich oder regelmäßig seitenspringen. Zudem zeigen die Kriminalstatistiken, dass Männer häufig gewal�ätig eifersüchtig sind und ihre Kopulationsziele mitunter mit äußerster Brutalität verfolgen; die Schwelle zur Vergewaltigung ist auch bei »ganz normalen Männern« sehr niedrig (Thornhill und Thornhill 1992). Die weiblichen Strategien verlaufen etwas komplizierter, wenn auch weniger offensichtlich als die männliche, sie ist daher auch noch weniger gut erforscht. Da die Grundfunktion der Monogamie, evolutionär gesehen, vor allem die Bereitstellung von Ressourcen durch Männer für Frauen und die gemeinsamen Kinder ist, sollten Frauen zunächst versuchen, einen Mann mit gutem »Ressource holding potential« (also möglichst keinen armen Schlucker) an sich zu binden. Beim Langzeitpartner spielt übrigens der männliche Status für die weibliche Wahl eine erhebliche Rolle. Zwei miteinander zusammenhängende Merkmale bei Menschenfrauen, welche innerhalb der Menschenaffen einzigartig sind, werden im Zusammenhang mit dem für die erfolgreiche Aufzucht der Kinder notwendigen An-sich-binden des Mannes diskutiert: Die permanent, also auch außerhalb der Stillperioden vorhandenen Brüste, die als Schauapparat ständig den hohen reproduktiven Wert der Frau signalisieren, sowie die »Verheimlichung« des Zeitpunktes des Eisprungs, also der höchsten Empfängnisbereitscha�, vor dem Paarpartner. Bei allen anderen Menschenaffen verkünden die Weibchen durch Brunstschwellungen und geruchlich den Östrus an, nicht so beim Menschen. Um also sicherzugehen, die Väter ihrer zukün�igen Kinder zu sein, müssen die männlichen Partner ständig ihre Frauen vor Rivalen abschirmen. Da sie den richtigen Zeitpunkt im Gegensatz zu den im Östrus sexueller als sonst gestimmten Frauen nicht kennen, müssen Männer o� mit ihren Frauen kopulieren, was zu einer zusätzlichen Verstärkung der Bindung (über Oxytocin im Gehirn), der Liebe, führen kann. Denn Geschlechtsverkehr dient bei Monogamen nicht nur der unmi�elbaren Zeugung von Nachkommen, er verstärkt auch die Bindung 172 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? zwischen Individuen, nicht nur beim Menschen, sondern auch bei anderen Dauerpartnerscha�en bei den Primaten, ja sogar bei Gänsen. Auch innerhalb der Ehe wird in der Regel wesentlich häufiger kopuliert, als zum Zeugen des Nachwuchses erforderlich wäre. Frauen binden dadurch Männer samt deren Ressourcen an sich (Hunter u. a. 1993). Ein Hauch von »Prostitution« (Gegenleistung für Sex) gehört daher zu jeder Zweierbeziehung und das nicht nur beim Menschen, sondern bei allen Tieren, bei denen sich die Weibchen von den Männchen nicht nur die Gene, sondern auch Ressourcen holen. Was aber sind die evolutionären Ursachen für die weibliche Bereitscha� zum Seitensprung? Nochmals: Die eigentliche evolutionäre Funktion des Mannes in der Partnerscha� ist es, die Kinder der Frau(en) zu versorgen. Der Frau bleibt es daher unbenommen, sich die Gene für ihre Kinder von anderen Männern zu holen, solange der eigene »Versorger« nichts davon merkt. Denn der würde seine Investition in die Kinder der Frau in dem Maße verringern, wie es unwahrscheinlich ist, dass er selber Erzeuger dieser Kinder war. Wie aktuell dieses Thema ist, zeigt der Boom bei den o� heimlich vor allem von Männern in Au�rag gegebenen Vaterscha�stests. So unterstützen Männer einer besonders promisken westafrikanischen Gesellscha� die Kinder ihrer Schwestern wesentlich intensiver (mit denen sind sie ja auf alle Fälle verwandt), als die Kinder ihrer eigenen Frau, bei denen seine Vaterscha� recht unsicher ist (Daly und Wilson 1983, Voland 2000). Was haben Frauen davon, Kinder nicht nur vom eigenen, sondern auch von anderen Männern zu bekommen? Die Anzahl der Nachkommen ist durch Fremdkopulationen meist nicht zu steigern, denn die hängt ja von der weiblichen Effizienz ab, Nachkommen großzuziehen. Sicherlich resultieren daraus eine genetisch reichhaltigere Kinderschar. Außerdem soll es vorkommen, dass der eigene Mann nicht sonderlich a�raktiv ist. Daher ist es evolutionär stimmig, im Zuge von Seitensprüngen a�raktive Männer zu bevorzugen, da diese wiederum a�raktive Söhne erwarten lassen, die in der Gunst um Frauenherzen, als »Philander« erfolgreicher sein könnten, als die vom Langzeitpartner gezeugten Söhne, ebendiese Frau zur Großmu�er zu machen. Tatsächlich ist bekannt, dass die weibliche Libido rund um den Eisprung – hormonbedingt – ansteigt, insbesondere die Bereitscha� zum Seitensprung. Zudem zeigte sich in Bewertungsversuchen, dass Frauen einen männlichen Sexual»du�«stoff, des Andostenons, durchwegs als unangenehm empfinden, ausgenommen rund um den Eisprung. Ein Mechanismus also, der dazu beiträgt, dass vor allem empfängnisbereite Frauen die Gegenwart von Männern tolerieren, bzw. schätzen. Frauen also »wissen« (bewusst oder unbewusst) über ihren Zustand Bescheid und handeln auch danach. Den Männern dagegen ist dieser evolutionär-strategische Zeitplan unbekannt, was den Frauen einen recht beachtlichen, taktischen Vorsprung verscha�. Sowohl Frauen, als auch Männer sind also evolutionär auf Seitensprünge eingestellt, aber aus völlig verschiedenen Gründen: Erlaubt diese Alternativstrategie der Frau, die Qualität ihrer Nachkommen zu steigern, so liegt der Effekt von Seitensprüngen beim Mann in der Steigerung der Zahl möglicher Nachkommen. Frauen bemühen sich also darum, möglichst »fi�en« Brennpunkt Konflikte zwischen den Geschlechtern 173 Nachwuchs aufzuziehen, während sich die Strategiespiele der Männer darum drehen, tatsächlich die leiblichen Väter ihrer Kinder, und, wenn möglich, noch vieler anderer Kinder zu sein. Das Prinzip Spermakonkurrenz Diese Zusammenfassung weiblicher und männlicher Grundstrategien, des fein gesponnenen Gefüges von Kooperation und Konflikten zwischen den Partnern, mag theoretisch-abgehoben anmuten, reichlich irrelevant für moderne Zivilisationsmenschen. Das ist aber nicht der Fall, wie etwa die Untersuchungen von Baker und Bellis (1993 a,b) von der Universität Manchester zeigen. Sie scha�en tatsächlich das Kunststück, Daten über das Ejakulationsverhalten von Männern und über Spermaretention, das Zurückhalten oder Ausstoßen des Spermas unterschiedlicher Partner von Frauen, zu sammeln. Die Auswertung zeigte, dass die evolutionären Spiele im Zusammenhang mit der Spermakonkurrenz beim Menschen noch wesentlich face�enreicher verlaufen, als zunächst angenommen. Es gelang dieser Forschergruppe, Material von 35 Menschenpaaren, sowie Daten über das Kopulationsverhalten von beinahe 3600 Frauen zusammenzutragen. Da schließlich auch Sperma eine begrenzte Ressource ist, sollten Männer ihre abgegebenen Mengen je nach Wahrscheinlichkeit der möglichen Spermakonkurrenz und dem »reproduktiven Wert« der Partnerin dosieren. Sperma bleibt bis zu acht Tage in den Krypten des Zervikalbereiches der Gebärmu�er befruchtungsfähig und ein bereits aufgenommener Spermavorrat limitiert die Fähigkeit, neues Sperma aufzunehmen. Tatsächlich war die abgegebene Spermamenge bei nicht ständig zusammenlebenden Paaren größer. Zudem gaben Männer im Verkehr mit »gut gepolsterten« Frauen größere Mengen ab, als bei schlankeren Partnerinnen. Über die längste Zeit evoluierten unsere Verhaltensdispositionen in einer Welt beschränkter Nahrungsressourcen. Sichtbare Fe�polster an den richtigen Stellen bei der Frau (nich unbedingt abdominales Fe�, welches auf Kosten der Taille geht und o� Parasitenbelastung, chronische Infektionen oder andere widrige Lebensumstände anzeigt; Pond, mündl. Mi�.), einhergehend mit der typischen »Uhrglasform« zeigten einem Mann daher ihren guten Ernährungszustand, Gesundheit und Fähigkeit an, ein Kind auszutragen und aufzuziehen. Das mag so nebenbei als Erklärung für die Erfahrung mancher »vollschlanker« Frauen dienen, dass sie wohl als Sexualpartnerinnen, weniger aber als auch gesellscha�lich angesehene Sozialpartnerinnen gefragt sind. Etwas despektierlich ausgedrückt, mögen die Ursachen der sexuelle Vorliebe mancher Männer für beleibte Damen vergleichbar sein, mit den Vorlieben der Zivilisationsmenschen für süße, fe�e Nahrung: Was über längste Zeiträume nur limitiert verfügbar war, gibt es heute in Fülle. Aber zurück zu Baker und Bellis: Als paradoxe Verschwendung erscheint zunächst das Masturbationsverhalten der Männer. Masturbiert wird vor allem von jüngeren Männern mit steigender Frequenz bereits drei Tage nach dem letzten Kontakt. Es werden offensichtlich große Mengen an Sperma vergeudet, die wohl in einer Spermakonkurrenzgesellscha� besser für den nächsten 174 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? sexuellen Kontakt gespart werden sollte. Damit wird allerdings nach dem Mo�o »Klasse sta� Masse« die Konkurrenzfähigkeit des Spermas erhöht. Werden nur neu gebildete Geschlechtszellen an die Frau weitergegeben, so ist eine möglichst lange Überlebenszeit im weiblichen Reproduktionstrakt gewährleistet. Es mag der Eindruck entstanden sein, als wären Frauen in der Evolution nur als passive Spermaempfängerinnen entstanden, dass Vaterscha� via Spermamenge und -qualität allein in Konkurrenz zwischen den Männern entschieden würde. Das Gegenteil ist der Fall. Bereits über die Wahl des Zeitpunktes der Kopulation und natürlich des Partners entscheiden eigentlich die Frauen, wer ihre Kinder zeugt. Nicht nur, dass die Bereitscha� zum Geschlechtsverkehr vor allem mit Nicht-Paarpartnern bei Frauen um den Eisprung am größten ist, Baker und Bellis konnten auch zeigen, dass weibliche Orgasmen die Spermaretention entscheidend steuern. Am meisten Sperma wird zurückgehalten, wenn der weibliche Orgasmus im Zeitraum bis etwa 40 Minuten nach der Ejakulation erfolgt. Es scheint, als wäre eine Art Saug-Pump-Mechanismus im Spiel, der Sperma in die Speicher im Gebärmu�erhals transportiert. Frühe Orgasmen haben darauf kaum Einfluss, was zählt ist offenbar der gemeinsame Höhepunkt liebender Paare. Das solchermaßen aufgenommene Sperma blockiert die nennenswerte Aufnahme weiteren Spermas für etwa 8 Tage. Die Effizienz dieser Blockade nimmt zwar mit dem zeitlichen Abstand von der Kopulation ab, kann aber durch zwischenzeitliche Orgasmen (im Schlaf oder durch Masturbation) wiederhergestellt werden. Das bedeutet, dass Frauen naben ihrer Partnerwahl mi�els ihrer Orgasmen einen großen Einfluss auf die Vaterscha� ausüben können, was etwa im Zusammenhang mit erzwungenen Kopulation durchaus von Bedeutung sein kann. Tatsächlich scheinen die Orgasmenmuster von Frauen bei Seitensprüngen dem Sperma des Konkurrenten des Paarpartners einen numerischen Vorteil zu verschaffen. Folgen dieser weiblichen Strategiespiele wären, dass etwa relativ viele Kinder durch relativ wenige Seitensprünge gezeugt werden können, während erzwungener Geschlechtsverkehr gewöhnlich relativ selten zu Schwangerscha�en führt. Der Nachwuchs von Frauen kann dadurch genetisch vielfältiger werden, als wären alle Kinder allein vom Paarpartner gezeugt. Der männliche Paarpartner sollte natürlich von den »Extra-pair copulations«, den Seitensprüngen seiner Partnerin nichts mitbekommen und schon gar nicht, falls eines »seiner« Kinder fremdgezeugt wurde, sonst würde seine Bereitscha� sinken, weiter in die Kinder dieser Frau zu investieren. Die tatsächlichen menschlichen Verhaltensmuster, sowie das offensichtliche Bedürfnis nach Vaterscha�ssicherheit über einschlägige Tests unterstützt die Relevanz dieser evolutionären Zusammenhänge. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle paargebundenen Männer und Frauen ständig seitenspringen müssen, weil sie von ihrer evolutionären Vergangenheit dazu gezwungen werden. Mündige Menschen müssen nicht allen ihren Impulsen folgen. Trotzdem, etwa 50 % der paargebundenen Männer und Frauen in unserem Kulturkreis begehen gelegentlich Seitensprünge und quer durch die Kulturen werden 5–10 % der Kinder durch außerpartnerscha�liche Brennpunkt Konflikte zwischen den Geschlechtern 175 Kopulationen gezeugt, was die evolutionäre Relevanz dieser alternativen Paarungsstrategie auch bei den »modernen Kulturmenschen« belegt. Menschliches Verhalten: evolutionäres Erbe Überzeugende Belege, dass menschliches Verhalten nicht beliebig kulturell formbar ist, liefert auch der Vergleich einfacher Verhaltensweisen über die Kulturen. Irenäus Eibl-Eibesfeldt konnte in seinem beeindruckendem Lebenswerk zeigen, dass Menschen überall auf der Welt einander auf sehr ähnliche Weise die Zuneigung ausdrücken, grüßen, einander verspo�en, prahlen, Knaben spielen lieber rauhe Spiele, als Mädchen, usw. (Eibl Eibesfeldt 1995, 1999, Grammer 1988). Dass sich diese Ähnlichkeiten in den Verhaltensweisen, diese »menschlichen Universalien« unabhängig voneinander so parallel entwickelt hä�en, ist genauso unwahrscheinlich, wie die Annahme, dass die früheren Kolonialherren die Welt lückenlos mit ihren Verhaltensmustern angesteckt hä�en (zumal die meisten der von Eibl Eibesfeldt kontaktierten Völker mit diesen noch keinen Kontakt ha�en). Es drängt sich daher der Schluss auf, dass es Verhaltensdispositionen gibt, die allen Menschen zu eigen sind. Zahlreiche Untersuchungen zur Nahrungssuche, zum Sozial- und Sexualsystem in Abhängigkeit von den ökologischen Randbedingungen, zur elterlichen Investition und Verwandtenförderung wurden an den rasant verschwindenden, ursprünglichen Jäger- und Sammlerkulturen durchgeführt, beispielsweise an den !Kung-Buschleuten der Kalahari oder den Yanomami-Indianern des Amazonas-Tieflands. Bei diesen Kulturen war der Bezug zwischen ökologischen Bedingungen und Lebensform noch recht unmi�elbar und wenig durch einen komplexen kulturellen Überbau, durch Vorratshaltung, Erbformen, usw., verschleiert, wie bei Hirten- und Bauerngesellscha�en (Schiefenhövel u. a. 1993). Diese Untersuchungen zeigten, wie unmi�elbar das Zusammenleben in menschlichen Gruppen mit der Ökologie zusammenhängt. Sind wir »Sklaven unserer Gene« ? Als Regel kann gelten, dass die in uns wirkenden evolutionär angelegten Verhaltensgründe nicht bewusst werden. So ist einem vom Sammler- ins Bauerndasein umsteigenden !Kung-Buschmann nicht bewusst, warum er in der Methode des Umgangs mit Gruppenmitgliedern vom sozial kompetenten Gespräch in Despotismus umschwenkt. Und nur selten verkehren Mann/Frau, um Nachwuchs zu zeugen, sie steigen wohl kaum mit den festen Vorsatz ins Be�, ihre »Fitness« zu erhöhen. Es treiben uns die unmi�elbaren Motivationen. Natürlich tut man´s weil es Lust bereitet, sonst wäre die Menschheit (oder jegliche andere sexuell reproduzierende Tierart) längst ausgestorben. Ein Cocktail von Opiaten und Hormonen im Gehirn bietet einen starken Belohnungsanreiz. Das ist aber eine Erklärung auf physiologisch-psychologischer Ebene, welche eine zusätzliche Erklärung auf letztlicher, evolutionärer Ebene nicht nur nicht ausschließt, sondern sie geradezu erfordert. Und natürlich bedeutet eine evolutionäre Disponiertheit nicht, dass wir nach diesen Voreinstellungen handeln müssen. Es entschuldige niemand 176 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? eheliche Untreue mit dem von Öko-Ethologen schließlich a�estierten Drang zum Seitensprung! Entscheidungsfreiheit wird durch die Erkenntnisse der evolutionären Verhaltensbiologie nicht aufgehoben, sondern im Gegenteil, verbessert. Aber wenn so ziemlich alles an unseren Handlungsmotivationen aus evolutionärem Erbe besteht, wie sollte man dann überhaupt in der Lage sein, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen? Ist dann nicht ohnehin alles (genetisch) vorbestimmt? Es ist beinahe schon ein Gemeinplatz, zu betonen, dass wir trotzdem nicht völlig von unseren Genen beherrscht werden. Wir sind aber auch nicht völlig frei. Deshalb die Allgegenwart der Gewalt gegen Kinder und Frauen, Vergewaltigung, Fremdenangst, usw. Menschliches Handeln hängt immer noch an den Fäden des unpersönlichen, richtungs- und »sinnlosen« Puppenspielers Evolution. Wie stark, das hängt von uns selber ab. Wir sind uns selber und den anderen schuldig, nicht wegzuschauen, uns nicht selber zu belügen, die richtige Diagnose zu den grundlegenden Funktionen menschlichen Verhaltens zu stellen, die ewige Vermischung des Sollen mit dem Sein, der moralischen Forderung mit dem Ist-Zustand, die Spekulation zur Seite zu schieben und die Basis menschlichen Verhaltens naturwissenscha�lich zu erforschen. Das evolutionäre Menschenbild zu ignorieren und durch ein idealistisches Wunschbild zu ersetzen, wäre angesichts der Probleme in der heutigen Welt genauso verbrecherisch, wie das Verhalten eines Arztes, der zwar den Krebs sieht, diesen aber, weil unangenehm nicht diagnostiziert und den Patienten mit guten Wünschen und Vitaminpillen wegschickt. Nun sind evolutionäre Strategien keine Krankheit. Und weil sie in ihren Wirkungen und Auswirkungen berechenbar sind, grei� auch die Krebsanalogie nicht. Aber dass unser für das Leben in Kleingruppen evoluiertes Verhalten unter den Bedingungen unserer Zivilisation und in einer globalisierten Welt nicht immer optimal ist, liegt auf der Hand. Bezüge menschlichen Verhaltens zu Genen und Evolution herzustellen, dies klingt wieder einmal, denkt man an Sozialdarwinismus, Dri�es Reich, Rassismus und Sexismus, nach einer reichlich verstaubt-anrüchigen Menschensicht. Aber diese Bezüge sind Realität, der wir uns zu stellen haben, genau wie aus der negativen geschichtlichen Erfahrung heraus extreme Wachsamkeit gegenüber jeglichem ideologischen Missbrauchsversuch angesagt ist. Unsere Dispositionen sind keine Krankheiten. Sie sind aber auch nicht einfach gut, weil natürlich, weil evolutionär entstanden. Als ein Stück Natur sind die evolutionär entstandenen Dispositionen des Menschen a priori weder gut, noch schlecht, sie sind einfach. Oder anders ausgedrückt: Moral ist zunächst keine evolutionäre Kategorie. Gut und Böse, Ethik und Moral, kommen erst durch menschliche Wertung in die Welt (vgl. de Waal 1997), die selber wiederum ein Produkt einer engen Kopplung zwischen evolutionären Dispositionen, kulturellen Elementen und gesellscha�lichen Konventionen darstellt. Es besteht die Notwendigkeit, unser Kostüm an sozialen Reaktionsnormen ständig an die aktuellen gesellscha�lichen und Lebensumstände anzupassen. Eine Diagnose ist gewöhnlich der erste Schri� einer Therapie. Dem »biologischen Imperativ« der Fitnessmaximierung ist nur durch Bewusstseinsbildung Brennpunkt Biologie des Subjektiven: Emotionen 177 zu begegnen. Tatsächlich wird niemand gezwungen, zum weiteren Schaden der Menschheit egoistisch zu handeln. Eine der Wurzeln für die objektiv dumme und gesellscha�lich schädliche Fremdenfeindlichkeit ist sicherlich die evolutionär begründete Distanz gegenüber Nicht-Gruppenmitgliedern, so die Arbeitshypothese. Obwohl daher dieses skeptischen Gefühl Fremden gegenüber als natürlich anzusehen ist, ist es deswegen nicht auch schon automatisch gut und akzeptabel, wir sind auch nicht daran gebunden. Es ist im Prinzip relativ einfach, wenn auch bildungsaufwändig, durch den Einsatz unserer Großhirnrinde den evolutionären Einflüsterungen erfolgreich Widerstand entgegenzusetzen und einem anderen alten evolutionären Erbe, unserer Sozialisierungsfähigkeit (Chance 1988), unseren freundlichen Kontaktmechanismen (Eibl Eibesfeldt 1995, 1999) die Bahn freizumachen. Die evolutionären Dispositionen sind immer auch eine Grundaussta�ung für die Janusrollen des Dr. Jekyll und des Mr. Hyde. Nicht Flucht in Mystik und Irrationalität, sondern nur die kompromisslose Förderung einer humanen, pluralistischen und liberal-weltoffenen Bildung kann Menschen und menschliche Gesellscha�en gegen die gefährlichen Seiten ihres evolutionären Erbes schützen. Unser enormes, ebenfalls evolutionär entstandenes Gehirn (Riedl 1981a) gibt uns – so es nicht in die von ihm selber aufgestellten Fallen der deduktionistischen Spekulation und des Dogmatismus tappt (Lorenz 1992) – die Möglichkeit, uns über die eigene Existenz bewusstzuwerden und damit mit unserer evolutionären Bedingtheit, nicht gegen sie, nie vorher in der Stammesgeschichte gekannte Freiheit zu erlangen. Ideologien, Glaube und menschenzentrierte Weltsichten helfen nicht weiter, sind o� aus Gruppenzwängen resultierende Hindernisse, welche u. a. den Herrschenden ihre Machtausübung erleichtern. Unsere respektable Hirnrinde ist offenbar als einziges, zur Rationalität befähigtes Instrument geeignet, uns in ein möglichst relevantes Bild dieser Welt bewusst einzuordnen. Natürlich entsteht Wirklichkeit erst in unseren Gehirnen (Maturana und Varela 1987), der evolutionäre Bezug von Wahrnehmung und Gehirn sichert allerdings gegen die Ansicht, dass die Welt nur ein subjektives, bzw. gesellscha�liches Konstrukt darstellt. Allein die Tatsache, dass Individuen erfolgreich kommunizieren können, stellt den Bezug zu einer real existierenden Welt her, wenn wir auch nie in der Lage sein werden, eine (für uns gar nicht relevante) »Wirklichkeit« außerhalb unserer Wahrnehmung zu erkennen. Die Naturwissenscha�en stellen die Werkzeuge bereit, uns weitgehend vor Selbstbetrug zu schützen (Exkurse 5,6). Der Geist der Au�lärung ist gefordert. Brennpunkt Biologie des Subjektiven: Emotionen Emotionen sind die Antriebssysteme der Evolution: Liebe, Hass, Interesse, Lust, usw. sind zumindest theoretisch ein weites, lohnendes Forschungsgebiet der Ethologen, Physiologen und natürlich der Psychologen. »Theoretisch« bezieht sich hier auf die angeführten biologischen Disziplinen, für welche die Grundstimmungen der Tiere ein äußerst schwieriges Terrain darstellen. Das führte sogar zum obskuren Auswuchs, ihre Verhaltensrelevanz, ja ihr 178 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Vorhandensein gänzlich zu leugnen (Skinner 1938, 1971). Anders als unsere Kollegen aus der Humanpsychologie können wir meist die von uns untersuchten Individuen nicht direkt nach ihren Gefühlen befragen. Ansetzen kann man nur am beobachtbaren Verhalten, wie schon Darwin (1872) in seinem Buchtitel festhielt. Körpersprache und Mimik verraten, in welcher Stimmung sich Tiere befinden (Lamprecht 1972, Lorenz 1982). Wie real Emotionen sind, zeigt die Selbsterfahrung und der tägliche Kontakt mit Mitmenschen und Haustieren. Trotzdem sind sie wissenscha�lich nur sehr schwer zu fassen. Gänzlich unmöglich wird es auf der Ebene der »Qualia«, des subjektiven, bewussten Erlebens dieser Emotionen. Wenn ein Hund nach Wasser sucht, ist er wahrscheinlich durstig. Der physiologisch, von einem spezialisierten hypothalamischen Hirnzentrum ausgelöste Suchvorgang ist also wahrscheinlich durch die Empfindung von Durst bei diesem Hund motiviert, samt zugehörigem Unlustgefühl, das nach den Trinken in eine gewisse Befriedigung umschlägt. Aber wissen werden wir es natürlich nie, wie bzw. ob dies der Hund subjektiv und bewusst empfindet. Lorenz selbst (1992) betonte die letztliche Unerforschbarkeit der subjektiven Seite der Emotionen. Deshalb plädierte er für eine strikte Trennung der physiologischen, objektivierbaren Grundlagen und deren subjektiven Wirkungen der Emotionen. Solipsisten betonen formal richtig, dass wir nur unsere eigenen Emotionen und Gedanken erfahren und erleben können, dass es uns aber nicht möglich sei, die Qualität dieser psychologischen Kategorien bei anderen Menschen, geschweige denn Tieren (vgl. Griffin 1991) nachzuvollziehen. Dass sich Lorenz (1963) intensiv mit der Aggression beschä�igte, steht dazu nicht im Widerspruch, führt sie doch zu beobachtbaren Verhaltensweisen. Daher wird echtes Einfühlen in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Menschen oder Tiere immer ein Wunschtraum bleiben. Es ist keine Frage der noch nicht zur Verfügung stehenden Werkzeuge, sondern eine logische Schranke, die diesen Zugang für alle Zeiten verwehren wird. Es ist zwar gefährlich, aber nicht verboten, von sich auf andere zu schließen. Ist das Einfühlen in die subjektive Welt der uns so nahestehenden Schimpansen und Gorillas schon gewagt, so ist dies etwa im Falle der vorwiegend geschmacksorientierten Welse oder der elektro-orientierten Nilhechte schlicht unvorstellbar. Die vielen Versuche der Vergangenheit und Gegenwart, die Barrieren zwischen den Artenwelten zu überwinden (z. B. Uexküll 1934) müssen schon deswegen fruchtlos bleiben, weil wir nicht wissen, was das Gehirn dieser Tiere mit der einkommenden Sinnesinformation macht. Haben Sie schon mal versucht, einem Farbenblinden die subjektive Qualität der Farbe Rot zu erklären? Einen besonders geniales Fenster ins Gehirn eines Tieres fand Irene Pepperberg (1991, 1999). Sie nutzte dabei die Fähigkeit von Papageien, Laute zu imitieren und trainierte einen handaufgezogenen Graupapagei mit Hilfe von sozialen Konkurrenten, Gegenstände mit Worten zu benennen. Nach jahrelanger Arbeit verfügte »Alex« über ein Repertoire von mehreren hundert Begriffen, kann Konzepte und Kategorien bilden, Farben und Materialien benennen und kann mit Hilfe einfachster Sätze ausdrücken, was er will (Pepperberg 1999). Brennpunkt Biologie des Subjektiven: Emotionen 179 Gegen den Hintergrund der Tatsache, dass Menschen evolutionär entstanden und in stammesgeschichtlich abgestu�er Form mit allen Tieren genetisch verwandt sind, wäre die Annahme unrealistisch, bei anderen Menschen oder auch nahe verwandten Tierarten wäre alles ganz anders. Größte Vorsicht vorausgesetzt, ist der »stammesgeschichtliche Plausibilitätsschluss« eine Denkmöglichkeit, zumindest für die Erstellung testbarer Hypothesen (Qualia bleiben natürlich ausgeklammert). Schlüsse auf Plausibilitätsbasis sind vor allem innerhalb der Art berechtigt. So funktionieren die sozialen Systeme der Menschen, ähnlich dem Straßenverkehr, auf Basis des Vertrauensgrundsatzes: Der Annahme also, dass die Reaktionen anderer (auf die eigenen Handlungen bzw. Emotionsäußerungen hin) mit hoher Wahrscheinlichkeit berechenbar sind. Das funktioniert nur auf Basis einer gemeinsamen Normenwelt, im Falle des Straßenverkehrs und anderer kultureller Bereiche, einer gesetzlichen Norm, im Fall der Sozialsysteme die Gesamtheit unserer evolutionären Verhaltensnormen, angetrieben von unseren Gefühlen und Gedanken. Da also anzunehmen ist, dass Menschen durch ihre gleichartigen Emotionen verbunden sind, gibt es wenig Grund, Tieren ähnliche Emotionen, das zugehörige Denken und Bewusstsein generell abzusprechen. Graduelle Unterschiede zwischen den Arten sind wahrscheinlich. Wenn Emotionen als Verhaltensantriebe für Menschen wichtig sind, dann kommen diese stammesgeschichtlich (ähnlich unserer Sprachfähigkeit) sicherlich nicht aus dem Nichts, sondern aus der evolutionären Entwicklungsreihe. Verliebte Affen, deprimierte Gänse? Lorenz sprach im privaten Kreis dem Vernehmen nach durchaus augenzwinkernd über verliebte Gänse und deprimierte Fische. In seiner Schreibe standen diese Begriffe, so er sie überhaupt verwendete, in Anführungszeichen. Dies sollte ihren Gebrauch im analogen Sinne bedeuten. Oder er vermied diese Begriffe gänzlich, wie in seinem »Lehrbuch der vergleichenden Verhaltensforschung«. Selbst der Begriff »Emotion« fehlt in diesem Werk. Diese große Vorsicht erscheint aus der Entwicklung der Ethologie verständlich. Gerade Lorenz und die anderen Gründerväter der Ethologie widmeten ihre besten Jahre dem Kampf gegen vermenschlichende Interpretation tierischen Verhaltens. Emotionen sind in diesem Zusammen besonders heikel, und jede Verwendung humanpsychologischer Terminologie macht einen immer noch zur leichten Beute nicht immer ganz kollegialer Kritik. Dazu kommt, um es zu wiederholen, dass Emotionen, wenn überhaupt, nur an ihren Verhaltensäußerungen zu erkennen sind. Die zugehörigen Mechanismen im Gehirn blieben bis in jüngste Zeit einer direkten Erforschung recht unzugänglich. Die komplexen hierarchischen Beziehungen zwischen den Emotionen wurden auch von Konrad Lorenz wiederholt behandelt, beispielsweise in Kapitel VII (über mehrfach motiviertes Verhalten) seines Lehrbuches (1978). So vertragen sich Liebe und Aggression recht gut und es kann zu einem raschen Wechsel zwischen derart motiviertem Verhalten kommen; hingegen werden verängstigte Tiere weder fressen, noch balzen oder einander angreifen. Sind Bezeichnungen für menschliche Emotionen auch bei Tieren verwendbar? Ein Ganter, der seine Partnerin verlor, geht mit eingezogenem Hals 180 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? umher, er fällt in der sozialen Rangordnung zurück und bringt seiner Umwelt nur noch mäßige Aufmerksamkeit entgegen. Sein Erscheinungsbild spricht für eine Depression. Aber genau hier beginnt das Dilemma. Bereits die Bezeichnung »Depression« für den seelischen Zustand unseres Ganters ist eine Vermenschlichung, impliziert sie doch, dass der Zustand des Ganters dem eines Menschen in einer ähnlichen Situation gleichkommt. Eine recht gewagte Annahme. Mehr noch: Um die gemeinsame Bezeichnung zu rechtfertigen, sollte die Depression beim Ganter nicht nur funktionell gleich zum Menschen sein, sondern auch homolog, also herkun�sgleich zur menschlichen Depression, sie sollte also beim Gans und Mensch über Hirngebiete stammesgeschichtlich gleicher Herkun� und möglichst auch noch über dieselben Hirnmechanismen entstehen. Ob gespannte Aufmerksamkeit, Liebe, soziale Aggression, oder Depression, die Symptome sind bei Vögeln, Fischen oder Säugetieren weitgehend ähnlich. Sogar Menschenkinder, die noch nie vorher eine lebende Gans sahen, interpretieren gewöhnlich intuitiv einen angreifenden Ganter als »zornig«. Dass so universelle Gemeinsamkeiten der Wirbeltiere immer wieder parallel zueinander entstanden sein sollen – etwa als Einstimmung des Organismus auf ökologisch-soziale Notwendigkeiten, wie Partner- und Nahrungswahl, Feindvermeidung, usf. – daran ha�e mit Sicherheit auch Konrad Lorenz seine Zweifel, was sein salopper Sprachgebrauch verdeutlichen mag. Aber ein universelles (herkun�sgleiches) System der Emotionen anzunehmen, dafür fehlten bis vor kurzem die Daten, wenn es auch, wei erwähnt, aus der Logik der evolutionären Entwicklung wahrscheinlich war. Homologie der Emotionen? Emotionen waren immer schon das tägliche Brot der Humanpsychologen. Ihre intensive Beschä�igung mit den menschlichen Grundstimmungen begründete ein starkes Interesse an den zugrundeliegenden Hirnstrukturen und -mechanismen (Panksepp 1998). Tiermodelle wurden entwickelt, um Experimente durchführen zu können, die sich am Menschen aus naheliegenden Gründen verbieten. So werden an Ra�enmodellen Psychopharmaka in Richtung menschliche Depression erprobt. Aufgrund der weitgehenden Wirkgleichheit dieser Drogen innerhalb der Säugetiere kam man auf die Idee, es handle sich bei der Depression und anderen Emotionen von Ra�en nicht bloß um zum Menschen analoge Systeme, sondern möglicherweise tatsächlich um stammesgeschichtlich identische Hirngebiete, also um homologe Schaltkreise. Fortschri�e in Histo- und Neurochemie, in der Neuroanatomie und bei der Au�lärung der Aktivitätszustände von Wirbeltiergehirnen ließen diese zunächst kühne Annahme wahrscheinlicher werden. So entwarf eine neue Generation vor allem US-amerikanischer Experimentalpsychologen, unter ihnen Jaak Panksepp (1989, 1998), die Theorie der über ihre Substrate und Funktionen definierten Grundemotionen. Es könnten fünf Grund-Emotionssysteme sein: Ein Appetenz-System bewirkt allgemeine Aufmerksamkeit und Verhaltensbereitscha�. So etwa ist eine Katze, die auf eine Maus lauert, nicht etwa aggressiv, sondern schlicht auf Brennpunkt Biologie des Subjektiven: Emotionen 181 Beute-machen konzentriert (Leyhausen 1965). Das Ärger-Zorn-System dagegen bereitet innerartlich aggressive Interaktionen vor. Letzteres wird etwa in Konkurrenz um Ressourcen aktiviert, auch zwischenartlich und nach Maßgabe des zu erwartenden Gewinns. So etwa ist bei einem Jäger, der auf einen Hirsch pirscht, das Appetenzsystem, nicht aber das Aggressionssystem aktiviert, während die Bekämpfung von potentiellen Konkurrenten, wie etwa Fuchs, Luchs oder Wolf beim gleichen Jäger durchaus aggressiv motiviert sein kann. Für Fluchtbereitscha� ist ein Furcht-Angstsystem zuständig. Und vor allem bei sozialen Wirbeltieren sind zwei weitere Emotionskreise ausgebildet, das Depressionssystem, welches bei Trennung vom Sozialkumpan aktiviert wird, sowie das System soziales Spiel, welches aber tatsächlich nur bei einigen sozial hochentwickelten Säugetieren und Vögeln nachzuweisen ist und möglicherweise kein selbständiges System darstellt, sondern einfach als besonders lustbetontes Verhalten zu sehen ist. Sollte diese Hypothese zutreffen, dann wäre eine breite Synthese erreicht. Gerade deswegen ist aber besonderes Misstrauen geboten. Zu behaupten, es sei alles schon bewiesen, wäre vermessen. Längst sind nicht alle Nervenverbindungen der Emotionen identifiziert und in schöner Regelmäßigkeit werden neue Substanzen entdeckt, die als Neurotransmi�er oder -modulatoren im Gehirn wirken. Die Kunde von der Universalität der Emotionssysteme bleibt daher eine zwar verlockende, aber noch ungenügend untermauerte Hypothese. Die Herausforderung wiegt umso schwerer, da heute ein enger Zusammenhang zwischen rationalem Denken (oder kognitiven Vorgängen allgemein) und Emotionen gesehen wird. Es war der Schweizer Psychologe J. L. Ciompi (1993), der auf diesen Zusammenhang hinwies. Die Inhalte mit denen sich unsere ach so rationale Hirnrinde beschä�igt, müssen alle durch ein Zentrum für Emotionalität, das limbische System. Inhalte werden also immer emotional eingefärbt. Und diese Einfärbung bestimmt auch die Abru�arkeit von Gedächtnisinhalten. Emotionalität und Individualität Schließlich steht Emotionalität auch in engem Zusammenhang mit einem weiteren Brennpunkt der modernen Verhaltensbiologie, der Erforschung der biologischen Mechanismen und Funktionen von Persönlichkeit. Bei Tieren wie Menschen findet man in sozialen Gruppen zurückhaltende und forsche Individuen. Entlang dieser Achse, beim Menschen als introvertiert-extrovertiert bezeichnet, unterscheiden sich Individuen in Gruppen am meisten voneinander. Oder anders ausgedrückt: Individuen unterscheiden sich ihrer Art, mit die Herausforderungen des Lebens umzugehen (Koolhaas u. a. 1999). Bei allen bislang untersuchten Wirbeltieren, Mäuse, Meisen, Gänse, Wachteln, Menschen, usw. gibt es sogenannte »proaktive« Individuen, die mit Situationen aktiv umgehen; sie sind forscher, aggressiver, konkurrenzstärker, aber auch oberflächlicher, achten generell weniger auf die Reize aus der Umwelt und sind anfälliger gegenüber Fressfeinden, als die sogenannten »Reaktiven« (vgl. Exkurs 12). Diese innerhalb der Wirbeltiere, vielleicht sogar aller Tiere so einheitlicher Differenzierung der Persönlichkeit, entspricht der Differenzierung der Temperamente, also der Emotionalität. Den aggres- 182 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? siven, extrovertierten, forsch-unerschrockenen, aber auch leichtsinnigen »Proaktiven« stehen die zurückhalten, scheu-introvertierten, vorsichtigen »Reaktiven« gegenüber. Dazwischen gibt es alle Übergänge. Diese Differenzierung der Persönlichkeiten, bzw. Temperamente zeigt sich auch in der zugrundeliegenden physiologischen Mechanismen, insbesondere was den Umgang mit Stress betri�. Proaktive aktivieren besonders stark ihre »rasche« Stressreaktion, sie schü�en intensiv Adrenalin aus dem Nebennierenmark aus, während die Reaktiven eher dazu neigen, die »langsame« Stressachse in Schwung zu bringen, also Glukokortikoide, etwa das Kortisol, aus der Nebennierenrinde auszuschü�en (Koolhaas u. a. 1999). Dies kann sogar zu stressbedingten Erkrankungen, bis zum Tod von Individuen führen, die sozialen Stressoren nicht ausweichen können (von Holst 1998). Diese Differenzierung der Emotionalität zwischen Individuen ist teils genetisch determiniert, teils nehmen darauf Steroidhormone während der Frühentwicklung einen starken Einfluss (Exkurs 12). Und auch soziale Einflüsse können sehr bedeutend sein. So fand Sulloway (1996) auf seiner Suche nach den Quellen menschlicher Kreativität, dass sich Erst- und Zweitgeborene wesentlich stärker voneinander unterscheiden, als dies durch den ähnlichen genetischen Hintergrund zu erwarten wäre. Während Erstgeborene gewöhnlich die loyalen Verbündeten ihrer Eltern spielen, neigen Zweitgeborene zu Aufmümpfigkeit und Rebellion. So sind Neuerer und Revolutionäre der Weltgeschichte 16 mal häufiger Zweit- als Erstgeborene. Zweitgeborene scheinen bereits früh im Buhlen um die Zuwendung der Eltern eine andere soziale Nische zu besetzen als die Erstgeborenen, was ihre Persönlichkeit lebenslang beeinflusst. Die Persönlichkeit bestimmt nicht nur beim Menschen maßgeblich die Rollen der Individuen in der Gesellscha� mit. So neigen Proaktive eher dazu, dominant zu werden und so auch von den Fertigkeiten anderer zu profitieren. Dagegen finden sich unter den Reaktiven eher die findigen Neuerer, die es etwa durch geduldiges Probieren schaffen, einen neue Nahrungsquelle zu erschließen (Pfeffer u. a. 2002). Die Proaktiven nähern sich zwar rascher unbekannten Objekten an, als die Reaktiven, sie explorieren aber auch oberflächlicher und sind daher weniger gut geeignet, komplexe Aufgaben zu lösen. Es stellt sich natürlich die Frage, ob es evolutionär vorteilha� ist, entweder Proaktiv oder Reaktiv zu sein. Wenn dem so wäre, sollte man eigentlich erwarten, dass man in natürlichen Populationen kaum Mischformen findet. Das ist aber nicht der Fall, die meisten Individuen stehen in ihrer Persönlichkeit zwischen den Extremen, was aber noch nicht bedeuten muss, dass keinen einschlägigen Selektionsdruck gibt. Ob es besser ist, forsch (proaktiv) oder zurückhaltend (reaktiv) zu sein, hängt u. a. von der Variabilität der Umwelt ab und davon, was die anderen in der Gruppe tun. So nimmt man an, dass Proaktive eher in stabilen Umwelten und mit reaktiven Gruppengenossen Vorteile genießen und umgekehrt. Und möglicherweise sind die vorsichtigeren Reaktiven bessere, weil länger überlebende Erstbesiedler, als die allzu forschen und daher unvorsichtigen Proaktiven. Man beginnt, die Mechanismen Brennpunkt Biologie der Erkenntnis 183 der Ausbildung von Persönlichkeiten zu verstehen, ist aber noch weit davon entfernt, die evolutionären Funktionen einigermaßen stimmig interpretieren zu können. Dieses Gebiet wird daher noch lange ein Brennpunkt verhaltensbiologischer Forschung bleiben. Brennpunkt Biologie der Erkenntnis: Was Tiere denken und was wir darüber zu wissen glauben »Kognition, Denken und Bewusstsein« sind ebenso wie die »Emotion« Begriffe, die einerseits schwierig zu definieren, andererseits mit dem methodischen Inventarium der Naturwissenscha�en kaum zugänglich waren. Darum mieden die meisten der »klassischen Ethologen« diese Bereiche wie der Teufel das Weihwasser. Dies auch deswegen, weil sie selber zu Beginn des 20. Jahrhunderts antraten, um vermenschlichen Interpretationen tierischen Verhaltens einen Riegel vorzuschieben. Die feige Hyäne, den stolzen Stier, den kühnen Adler oder den mutigen Löwen, sie finden wir noch bei Brehms Tierleben; die Gründer der Ethologie wollten damit nichts mehr zu tun haben und schoben für lange Zeit diesen Ball an die Psychologen. Gebrochen wurde der Bann paradoxerweise nicht durch die mechanistisch orientierten Ethologen, sondern in den 1980er Jahren ausgerechnet von jenen Öko-Ethologen, welche den Organismus zunächst nur als »Blackbox« betrachteten. Da die Öko-Ethologie aber im Grunde daran interessiert ist, individuelle Entscheidungen zu erklären und sich zeigte, dass Tiere nicht immer nach den Grundsätzen der Optimalitätstheorie handeln, entstand das Bedürfnis, die kognitiven Mechanismen zu verstehen. Auch die Primatologie, die Erforschung der Affenartigen einschließlich Mensch, trug das Ihre dazu bei, das Feld zu beleben. So regten Anekdoten vor allem zur sozialen Intelligenz von Affen die Forschung an. Ist es etwa wirklich ein Zeichen von großer Intelligenz, wenn Niederrangige versteckte Nahrung erst bergen, wenn die Hochrangigen außer Sicht sind, dass letztere Desinteresse mimen, um die Niederrangigen in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Im Extremfall könnte man es dabei mit Triebhandlungen zu tun haben, oder aber mit einfachen Lernprozessen. Ob sich Individuen gar vorstellen können, was die anderen denken, welche Absichten sie haben oder verbergen könnten, ist schwierig nachzuweisen. Trotzdem belebten diese Themen auch die Konjunktur der Kognitionsforschung an anderen Tieren. Dasselbe gilt für die Fähigkeit, mi�els Symbole zu kommunizieren, für die Mechanismen des sozialen Lernens, usw. Zudem entspricht es einem menschlichen Grundbedürfnis, zu wissen, wie andere Lebewesen mit der Welt zurechtkommen, wie sie die Welt sehen, sie erleben. Da uns die subjektive Seite, also das was die Gehirne anderer Arten aus der Welt machen, nie zugänglich sein wird stoßen wir hier allerdings auf eine der Grenzen der naturwissenscha�lichen Methodik. Menschen scheinen übrigens die einzige Tierart zu sein, die sich auch jenseits des Räuber-Beute oder Konkurrenzzusammenhang für andere Arten interessiert, sieht man von Anzeichen solchen Interesses bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen ab (de Waal 1982, 1997, Wilson 1986). Die derart motivierten Ergebnisse der Kognitionsforschung der letzten 25 Jahre 184 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? ließen weitere Bastionen menschlicher Einzigartigkeit bröckeln. Und gegenwärtig beschä�igt man sich schon mit dem notorisch schwierig zu fassenden Bewusstsein (Stamp-Dawkins 1994). Worum es in der Kognitionsforschung eigentlich geht, ist zunächst schwierig zu fassen, da es meist keine eindeutigen, allumfassende Definitionen von geistigen Fähigkeiten gibt und da es nahezu unmöglich ist, unser eigenes, bewusstes Erleben draußen zu lassen, dass also die Selbsterkenntnis beinahe unvermeidliche Quelle wissenscha�licher Erkenntnisse ist, was natürlich zu vermeiden wäre. Das mag seltsam anmuten, denn wie soll man auf einem Gebiet wissenscha�lich arbeiten, wenn man die Inhalte nicht einmal eindeutig definieren kann? Dazu meinte Griffin (1991), dass auch andere Begriffe in der Biologie, wie etwa der Stoffwechsel, nicht eindeutig definierbar sind und dennoch Physiologen fruchtbare Arbeit leisten. Zudem sei von einer möglichen Einengung durch Definitionen zu warnen. Operational könnte man Denken als Fähigkeit sehen, mögliche Resultate verschiedener Handlungen gegeneinander abzuwägen und dann das zu tun, was am wahrscheinlichsten das angestrebte Resultat bringt. Dazu ist Bewusstsein übrigens nicht nötig (Ristau 1991). Der erweiterte Denkbegriff umfasst letztlich alle Verrechnungsvorgänge im Gehirn, sodass es unter diese Definition fällt, wenn Entscheidungen »aus dem Bauch heraus« getroffen werden, also unter Umgehung bewussten, oder zumindest rationalen Denkens. Trotzdem verlangt dies natürlich die Bildung interner Repräsentationen dieser Welt, Bilder und Annahmen über die Umwelt, wenn-dann-Beziehungen, Kategorien. Für Konrad Lorenz waren die kognitiven Fähigkeiten der Tiere offenbar ein Aspekt des alten Leib-Seele Problems. Nirgends sprach er dies so klar an, wie in seinem »Russischen Manuskript« (Lorenz 1992). Dort schrieb er sinngemäß, dass eine restlose Einsicht in die materielle Seite eines physiologischen Vorganges uns nicht um Haaresbreite dem Verständnis der Frage näherbringt, welche Beziehung zu den parallel laufenden psychischen Erscheinungen besteht. Er unterschied also klar eine objektiv mess- und beobachtbare Seite des psychischen Geschehens und eine subjektive, prinzipiell naturwissenscha�lich nicht erforschbare Seite. Dies stellt sich selbst in einer Zeit als haltbar heraus, in der nicht-invasive Verfahren räumlich gut auflösende Einblicke in die Funktion des menschlichen Gehirns gesta�en. Die mit diesen Funktionen einhergehenden Empfindungsqualitäten, die »Qualia« werden allerdings immer Gegenstand der Kommunikation bleiben müssen, ein direkter Zugang dazu ist nicht möglich. Lorenz meint dazu, dass zwischen den beiden apriorischen Anschauungsformen der subjektiven Betrachtung der beseelten organischen Ganzheit jede denkmögliche Brücke fehle. Das Verhältnis der subjektiven und der objektiven Seite beseelten Lebensgeschehen sei grundsätzlich »a-logisch« (S. 247). Daran hat sich nichts geändert. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Plausibilitätsschlüsse gänzlich verboten wären. Denn wenn unser Erkenntnisapparat adaptiv entstanden ist, dann sollte das auch für jenen Teil gelten, der subjektives Erleben vermi�elt. Schließlich können wir über Emotionen und ihre Ausdrücke in Körpersprache Brennpunkt Biologie der Erkenntnis 185 und Mimik kommunizieren, wir können diese zum Abschätzen der Absichten anderer und zur Synchronisation von Gruppenaktivitäten benutzen. Daher ist natürlich die Annahme berechtigt, dass das zugehörige Erleben zwischen den Individuen einer Art, oder sogar zwischen nahe verwandten Arten, zumindest ähnlich sein wird, aber wissen können wir es nicht. Kognition und die Ökonomie von Entscheidungen Diese Art evolutionärer »Common sense psychology« darf natürlich nicht in die reine Spekulation führen. Sie bewegt sich auf dem Boden der Naturwissenscha�en, solange daraus testbare Hypothesen abgeleitet werden können. Eine Sicherheitsleine wissenscha�licher Vorsicht stellt der immer noch allseits akzeptierte Grundsatz von Lloyd Morgan (1894) dar, dass wir auf keinen Fall ein Element des Verhaltens als Ergebnis einer »höheren« psychischen Ebene interpretiert werden dürfen, wenn sie auch als Resultate einer »tieferen« Ebene erklärt werden kann. Das Prinzip der einfachsten Erklärung also. Wenn es genügt, den Donner als Kavitationseffekt des Blitzes zu erklären, sind dazu höhere Erklärungsebenen, etwa der Zorn Go�es unnötig; ob man sie als falsch ansieht, hängt natürlich vom Glauben des Einzelnen ab und ist damit nicht Gegenstand der Naturwissenscha�. Es stellt sich allerdings die Frage, ob im Zusammenhang mit Kognition dieses Prinzip der einfachsten Erklärung wirklich so gut geeignet ist. Denn wie beurteilt man, was »höher« ist, und was bedeutet dies im Zusammenhang mit der Kognition? Was sind die Kriterien für »hoch« oder »nieder«, welche psychischen Prozesse sind einfacher, bzw. komplizierter als andere? Hier geht man offenbar von einem dem menschlichen Geist entsprungenem Konzept aus, von der angenommenen scala naturae – Abfolge der Handlungsantriebe in der stammesgeschichtlichen Entwicklung: Von »niederen« Reflexke�en über Erbkoordinationen mit Taxiskomponenten bis zu »höheren«, mehr oder weniger rational gesteuerten Willkürhandlungen. Auf der Ebene des Lernens betrachtet lautet die Abfolge »von unten nach oben« wohl: Habituation, bedingter Reflex, Versuch-und-Irrtum-Lernen, Einsicht und andere »höhere« Lernformen. Fraglich, ob dieses immer das fruchtbarste Modell für die Kognitionsforschung sein muss. Der Hauptantrieb für die evolutionäre Entwicklung vom einfacheren zum komplexeren war sicherlich die Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Nervensystemen, um Ressourcen, im We�lauf zwischen Räuber und Beute, usw. Entscheidende Vorteile ha�en meist diejenigen, die auch nur ein klein wenig flexibler waren, als ihre unmi�elbaren Konkurrenten. Und kaum etwas ist in dieser Hinsicht effizienter, als gut entwickelte Denkfähigkeit. Daher ist anzunehmen, dass in den meisten Großgruppen ein starker Druck auf der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten lag. In dieser Logik gilt Lloyd Morgans Grundsatz nicht mehr automatisch. Vielmehr sollten Tiere dann kognitiv (bis rational) handeln, wenn sie damit schneller sind und im Vergleich zu Triebhandlungen kostengünstiger aussteigen, als ihre Konkurrenten – wenn sie es können, also die Fähigkeit dazu evolutionär entwickelt wurde. Und herauszufinden, ob, und was genau sie können und lernen können, ist eine der zukün�igen Aufgaben der evolutionären Kognitionsforschung. Ansta� automatisch das Prinzip der ein- 186 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? fachsten Erklärung anzunehmen, sollte überlegt werden, welche kognitiven Mechanismen im Zusammenhang mit den zu bewältigenden ökologischen und sozialen Aufgaben am günstigsten, bzw. zweckmäßigsten wären. Dabei muss die Entscheidung nicht immer klar zugunsten der Ratio ausfallen, sonst hä�en etwa Menschen ihre evolutionären Wurzeln längst abgestrei� und würden sich im sozio-sexuellen Bereich nicht immer noch so verhalten, als käme es auf Reproduktionsoptimierung an. »Instinkte« haben ihre Berechtigung, wenn Verhaltensautomatismen abwägendem Denken überlegen sind. Soziale Kommunikation und Sex sind gute Beispiele für solche Verhaltensbereiche. Und im Zusammenhang mit Flucht könnten etwa »höhere« kognitive Mechanismen schlicht zu langsam sein, es könnte zu gefährlich sein, auf die stammesgeschichtliche Erfahrung zu verzichten und auf individuelles Lernen zu setzen. Auf Basis der Ökonomie in der Natur argumentiert beispielsweise Don Griffin dafür, dass gerade Tiere mit kleinen Nervensystemen und begrenzter Speicherkapazität, wie Insekten »höhere« kognitive Fähigkeiten benötigen. Auf die Spitze getrieben werden könnte dieses Umkehr-Argument wohl bei den mit freiem Auge gar nicht mehr sichtbaren Milben. Als Alternative dazu weiß man heute, dass Insektenund andere kleine Nervensysteme aufgrund der Vernetzung einfacher ReizRektionsregeln zu erstaunlichen Leistungen befähigt sind, auch wenn sie nicht über komplexe kognitive Mechanismen verfügen. Vergangenheit und Zukun� der ethologischen Kognitionsforschung Vor allem Psychologen beschä�igten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den kognitiven Fähigkeiten von Tieren. Man wollte über das Tiermodell die psychischen Phänomene bei den Menschen besser verstehen. Die Einsicht, dass kognitive Module in Anpassung stammesgeschichtlich tradierter Strukturen an die spezifischen Lebensumstände einer Art zu interpretieren sind, basiert auf der Pionierarbeit von Konrad Lorenz und sollte sich erst gegen Ende dieses Jahrhunderts durchsetzen. So dominierten sehr menschenzentrierte Fragestellungen, etwa welche Tiere bis 3, 5 oder 7 zählen könnten. Oder es tauchte im Zusammenhang mit dem Erlernen komplizierter Labyrinthe durch Ra�en die Frage auf, ob dies etwas mit Einsicht zu tun hä�e. Schausteller zogen mit rechnenden Pferden und Hunden durch die Lande, etwa dem »klugen Hans«. Dieser Gaul konnte durch Klopfen mit den Hufen das Ergebnis komplizierter Rechenoperationen richtig anzeigen. Diese Fähigkeit verschwand allerdings schlagartig, wenn er seinen Besitzer, bzw. das Publikum nicht mehr sehen konnte und so auch nicht mehr auf dessen unbewusst gegebene Signale reagieren konnte. Das Pferd war also zwar nicht übermäßig mathematisch begabt, zeigte aber auf seine Weise unglaublich genaue Beobachtungsgabe. Warum aber sollte ein Pferd zählen können? Es benötigt genügend Instinkte und soziale Intelligenz, um seine Herdenmitglieder zu erkennen und richtig mit ihnen umzugehen, oder als Hengst mit einer Mischung aus Kra� und Köpfchen zum Pascha einer Stutenherde zu werden. Daneben können Wildpferde über erstaunliche Ortskenntnisse verfügen, etwa um über hunderte Brennpunkt Biologie der Erkenntnis 187 von Quadratkilometern Nahrung und Wasser zu finden und ihren Fressfeinden auszuweichen. Mathematik gehört nicht zu den für Pferde überlebenswichtigen Fähigkeiten, es wurde daher auch keine Lernfähigkeit für Rechenkunststücke angelegt, den diese hä�en Pferden weder dazu verholfen, den Wölfen zu entkommen, noch mehr Nachkommen als andere großzuziehen. Der Anpassungswert von »Intelligenz« Damit sind wir am Kern der modernen, ethologischen Kognitionsforschung: Es geht nicht darum, andere Tiere nach ihren Fähigkeiten im Vergleich zum Menschen als »klug« oder »dumm« einzuschätzen, es geht letztlich nicht einmal darum, ob, und in welchem Ausmaß Tiere »Intelligenz« zeigen. Denn solch eine Fragestellung wäre unsinnig (s. unten). Es geht vielmehr darum, die artspezifischen und individuellen Leistungs-und Lernfähigkeiten zu erforschen. Geistige Fähigkeiten sind genau wie körperliche Merkmale als Anpassungen zum Überleben und zur Maximierung von Fitness evoluiert. So verraten die heutigen kognitiven Fähigkeiten von Arten, welche Selektionsdrucke während der Evolution der zugehörigen Nervensysteme geherrscht haben müssen. Und natürlich auch, welches »Rohmaterial« die Selektion zur Verfügung stand. Daher ist es verwunderlich, dass Kopffüßer (Oktopus und Co.) mit ihren Schneckengehirnen und Wirbeltiere auf Basis ihrer Fischgehirne offenbar ähnliche Leistungsfähigkeiten erreichten. Möglicherweise ist es uns Wirbeltieren aber auch noch nicht möglich, wirklich tief in die kognitive Welt der Kopffüßer einzudringen. Da es sich bei kognitiven Fähigkeiten um evoluierte Strukturen handelt kann sich die Kognitionsforschung des grundlegenden Arbeitsprogrammes der evolutionären Biologie, der »vier Tinbergenschen Ebenen« (1963) bedienen, es geht also um die Fitnessrelevanz bestimmte geistiger Fähigkeiten, um die zugrundeliegenden Vorgänge im Nervensystem, um ihre Entstehung in der Individualgeschichte und schließlich um deren Herleitung aus der evolutionären Geschichte. Aber unter welchen Bedingungen kam es zur Entwicklung »höherer« geistiger Fähigkeiten? Aus den unterschiedlichsten Gruppen gelten bestimmte Arten als »intelligent«. Man meint damit gewöhnlich, dass das Gesamtverhalten dieser Tiere den Schluss erlaubt, dass sie recht differenzierte und flexible Beziehungen zu ihrer Umwelt unterhalten. So ist Oktopussen, Delfinen, Seelöwen, Hunde, Raben, Schimpansen und Menschen gemeinsam, dass sie spielen, offenbar gute Problemlöser sind, neugierig ihre Umgebung erforschen, findig und kreativ Nahrung suchen und, sieht man von achtarmigen Tintenfischen ab, komplexe soziale Beziehungen unterhalten, einschließlich der Fähigkeit Information nur kontrolliert weiterzugeben, also einander übers Ohr zu hauen, zu manipulieren. Gerade weil hier die große Gefahr besteht, dass wir bloß unsere eigenen Fähigkeiten und Vorstellungen in andere Tiere hineinprojizieren, ist es nötig, diese Fähigkeiten zu testen. Meist aber untermauern die Ergebnisse solcher Test eigentlich nur, was gute Beobachter ohnehin schon wissen. So stimmt es etwa, dass Raben verglichen mit ihrer Singvogelverwandtscha� und innerhalb der gesamten Zoologie recht »kluge Bürschchen« sind. Und Schimpansen gehen koordiniert auf die Jagd und 188 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? schmieden über lange Zeiträume strategische Allianzen. Der eigentliche Wert der vergleichenden, ethologischen Kognitionsforschung liegt in der Chance, stimmige Erklärungen zu finden, warum gerade die erwähnten Tiere innerhalb ihrer Verwandtscha�srunden auf Klugheit setzen. Warum etwa ist innerhalb der drei Schimpansenarten auf der Welt, Schimpanse, Bonobo und Mensch das Gehirn ausgerechnet beim Menschen innerhalb der letzten 700 000 Jahre regelrecht explodiert? Warum bauen wir Kathedralen und philosophische Systeme, spielen mit Computern, verfügen über Sprachen und Zivilisationent, während unsere nächsten Verwandten immer noch als »Tiere« die afrikanischen Savannen und Wälder, bzw. unsere Zoos bevölkern? Der englische Primatologe Robin Dunbar (1993) zeigte, dass die relative Größe der Großhirnrinde innerhalb der Primaten (Affen) positiv mit der Gruppengröße zusammenhängt, was andeutet, dass die Intelligenz von Affen und Menschen im sozialen Zusammenhang entstanden sein könnte. Auch die Sprache passt ins Bild: Sie gesta�et es, mit viel mehr Individuen Kontakt zu halten als ohne, sogar über Distanz und über die Gegenwart hinaus. Die »soziale Intelligenzhypothese« ist heute sicherlich eine der stimmigsten, wenn auch natürlich nicht die einzige Erklärung für die menschliche Kultur- und Sprachfähigkeit und damit für die Menschwerdung. Ähnliches zeigte sich auch bei den Kolkraben. Ihr Leben als Generalisten, die auf der Hut sein müssen, von jenen Räubern, denen sie einen Teil der Beute abnehmen, Wolf, Bär, Fuchs, Mensch, usw. nicht selber getötet zu werden, erfordert Aufmerksamkeit und Übersicht. Darüber hinaus zeigte sich, dass Raben kurzund längerfristige Allianzen bilden und innerhalb ihrer Gruppen »taktisch betrügen« können. So zeigt die vergleichende Kognitionsforschung, dass bei unterschiedlichen Wirbeltieren ein starker Selektionsdruck auf geistige Leistungsfähigkeit besonders dem sozialen Umfeld und der Konkurrenz innerhalb der Gruppe entspringt. Raben etwa verbringen die ersten Monate nach dem Schlüpfen mit ihren Eltern und schließen sich die nächsten 3–6 Jahre einer Nichtbrütergruppe an, die der gemeinsamen Nahrungssuche, als Informations- und Partnerbörse dient (Heinrich 1989). Und schließlich erobern sie in trauter Einehe ein Territorium und halten es ein ganzes, o� mehrere Jahrzehnte langes Leben. Im Sommer besteht die Nahrung aus einem breiten Spektrum von Insekten, Würmern und anderem Kleingetier. Der Winter aber stellt einen energetischen Flaschenhals dar. Und auch bald im Frühling, wenn die Paare ihre Jungen aufziehen, liefern Fallwild oder auch Wolfsrisse, Au�rüche von Jägern oder Mülldeponien und Wildparks die Nahrung. Befindet sich ein wertvoller Kadaver im Revier eines Rabenpärchens, so wird es von diesen verteidigt. Wenn nun ein Nichtbrüter diese tolle Nahrungsquelle entdeckt, ru� er Verstärkung herbei (Heinrich 1989, Bugnyar und Kotrschal 2001, Bugnyar u. a. 2001), denn gegen mehr als 10 Eindringlinge ist die Nahrungsverteidigung der Revierraben wirkungslos. Damit rekrutiert der Jungrabe aber nicht nur Verbündete, sondern natürlich gleichzeitig auch Konkurrenten, es entspannt sich ein komplexes Versteckund Überlistespiel. Die Raben hacken je etwa 100 g Fleisch vom Kadaver, fliegen damit weg, verstecken es, kehren zurück, usw. Das Spiel besteht also Brennpunkt Biologie der Erkenntnis 189 zunächst darin, mehr als die anderen für sich selber in Verstecken unterzubringen, um damit ein paar Tage oder sogar Wochen über genügend Nahrung zu verfügen. Man muss gerade weit genug wegfliegen, um unbehelligt zu verstecken, aber wiederum nicht zu weit, denn das kostet Zeit, könnte die Zahl der Versteckflüge einschränken, da die Fleischmenge begrenzt ist. Die Entscheidung zwischen Distanz vom Kadaver, Verstecksicherheit und Flugkosten ist aber nur eines der relevanten Entscheidungsfelder. Denn die Raben können nun drei verschiedene Strategien spielen: Selber Fleisch holen und verstecken, denen die mit Fleisch wegfliegen dieses abnehmen oder aber die Verstecke anderer ausräumen (Bugnyar und Kotrschal 2002a). Es sind die dominanten Individuen, die sich besonders in gefährlichen Situationen, etwa wenn Wölfe anwesend sind, aufs Wegnehmen verlegen. Zwischen den Versteckern und den Plünderern entspinnt sich ein Spiel um Bluffen und Täuschen (Bugnyar und Kotrschal 2002b). Verstecke werden nur gefunden, wenn die Plünderer genau zusehen können, wo versteckt wurde. Folgerichtig wird hinter Bäumen oder Felsen versteckt, was den potentiellen Plünderern die direkte Sicht nimmt. Diese wiederum »tun so, als ob« sie gar nicht interessiert wären. Denn bemerkt ein Verstecker, dass er offensichtlich beobachtet wird, bricht er ab und versteckt anderswo, ebenso, wenn sich der Plünderer zu früh dem Versteck nähert. Letztere müssen also 1–2 Minuten Geduld aufbringen. Auch das ist übrigens eine große geistige Leistung, wurde doch die Fähigkeit, zeitverzögert zu plündern unter den Vögeln nur bei Rabenvögel nachgewiesen. Meisen etwa können dies nicht. Der versteckende Rabe versucht also, den Ort des Verstecks nicht zu verraten, während dem Plünderer daran gelegen ist, seine Absichten zu verschleiern. Dies kann über drei verschiedene Mechanismen erklärt werden. Aktionen und Reaktionen in diesem Spiel könnten triebha� angelegt sein, also aus Schlüsselreizen und Erbkoordinationen bestehen. Dies ist angesichts der Komplexität des Spiels unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher schon, dass ein einfacher Lernprozess dahintersteckt. Der Verstecker lernt, dass er seinen Vorrat verliert, wenn er in Sicht eines anderen Raben versteckt, der Plünderer lernt, dass er nicht zum Ziel kommt, wenn er zu nahe kommt oder nicht lange genug abwartet. Dazu ist noch keine Einsicht in die Gedanken und Absichten des jeweils anderen erforderlich, die Vögel wüssten über ihre Umwelt Bescheid, hä�en also in ihren Gehirnen Repräsentationen erster Ordnung gebildet. Der komplexeste, aber dennoch in diesem Zusammenhang wahrscheinlichste Mechanismus wären allerdings sogenannte Repräsentationen zweiter Ordnung: Die Vögel wissen nicht nur über ihre direkte Umwelt Bescheid, sondern auch darüber was die jeweils anderen darüber wissen und können dies zu ihrem Vorteil nutzen. Das würde sie befähigen, nicht nur nach Regeln zu spielen, sondern wie Profi-Pokerspieler zu agieren. Denn auch beim Poker gewinnen die besten Bluffer (die ihre Absichten am besten verbergen, bzw. darüber täuschen können). Dadurch käme automatisch ein Selektionsdruck zustande, einerseits besser als die anderen zu bluffen, andererseits den Bluff der anderen zu durchschauen. Dieses Gebiet ist gerade ein Fokus der biologischen Kognitionsforschung. Gezeigt wurde das Wissen um das Wissen 190 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? anderer zweifelsfrei erst bei Schimpansen (Hare u. a. 2001). Entsprechende Versuche bei Raben laufen gerade (Bugnyar). Wie spezialisiert ist »Intelligenz«? Somit zeigt die vergleichende Kognitionsforschung, dass der Selektionsdruck auf die Entwicklung von »Intelligenz« vor allem dem sozialen Zusammenhang entspringt. Aber was bedeutet der Begriff »Intelligenz« eigentlich? Sind Raben »klüger« als Gänse, weil sie schneller als letztere Schachtel und Dosen öffnen können? Ganz so »dumm« können Gänse nicht sein, wenn sie sich über hundert Schargenossen individuell merken können und ihr Verhalten entsprechend abstimmen, wenn sie über Jahrzehnte in Clans zusammenhalten. Aber es stimmt, dass Gänse den Raben in technischer Hinsicht unterlegen sind, wahrscheinlich weil Raben aufgrund der anderen Ökologie und Nahrungsaufnahme dazu gezwungen wurden, innovativer und manipulativer als Gänse vorzugehen. Jede Art ist eben so technisch oder sozial »klug« wie nötig. Und ein wenig besser in technischer oder sozialer Hinsicht zu sein, wie die anderen scha� entsprechende individuelle Vorteile und Selektionsdrucke. Immer noch ist es ein Streitpunkt in der Kognitionsforschung, ob »Intelligenz« nun generalisiert oder in Modulen entstünde und entsprechend nur in definierten Bereichen oder breit anwendbar sei. Im Falle der »generalisierten Intelligenz« könnten geistige Fähigkeiten, die etwa im Zusammenhang mit Raubfeindvermeidung oder der Au�ereitung von Nahrung entstanden, auch im sozialen Bereich eingesetzt werde, und vice versa. Jede Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit in einem bestimmten ökologischen oder sozialen Zusammenhang würde deren Anwendung in anderen Zusammenhängen ermöglichen. Wenn ein Individuum etwa besser als andere wäre, die Absichten von Fressfeinden zu erkennen, könnte es diese Fähigkeit zu seinem Vorteil auch im sozialen Bereich einsetzen. Dies mag in eher generalisierten Bereichen durchaus der Fall sein, bzw. ökologisch generalisierte Arten könnten über mehr von dieser »breiten« Intelligenz verfügen, als ökologische Spezialisten. So verstecken manche Meisen etwa tausende, Eichelhäher zehntausende Samen, bzw. Nüsse für den Winter und finden diese später auch wieder. Sie tun dies nicht nach irgend einer einfachen Regel, sondern merken sich in Form kognitiver Karten jedes einzelne dieser Verstecke. Damit ist der Eichelhäher sicher ein Memory-Weltmeister, aber ist er deswegen auch besonders »intelligent«? Tauben und andere Vögel etwa sind ganz besonders gut, rotierte Objekte rasch richtig zuzuordnen. Man erklärt sich dies über die Notwendigkeit, trotz der Rotation von Objekten, die überflogen werden, diese wiederzuerkennen. Menschen sind im direkten Vergleich zu Tauben darin lausig schlecht. Aber sind wir darum weniger intelligent, als Tauben? Einer der Brennpunkte der zukün�igen Kognitionsforschung wird die Frage sein, wie »transferfähig« kognitive Fähigkeiten sind. Die Erfahrung lehrt, dass auch innerartlich, etwa innerhalb der Menschen die Begabungen recht unterschiedlich gestreut vorkommen. Wer kennt nicht Mathematikgenies mit Problemen im sprachlichen Bereich und um- Brennpunkt Biologie der Erkenntnis 191 gekehrt. Und so manch ein »Hochbegabter« zeigt Defizite im Bereich der »sozialen Intelligenz«, also der Kompetenz mit anderen umzugehen. Der Umkehrschluss ist natürlich nicht erlaubt: Wer sozial kompetent ist, kann durchaus auch in den Kulturtechniken hochbegabt sein und es kann auch vorkommen, dass soziale und kulturelle Minderbegabung sich in derselben Person treffen. Das Eichelhäherbeispiel als eines von vielen Beispiele von Spezialbegabungen bei den Tieren und die Überlegungen zu den unterschiedlichen Mischungen von Begabungen bei den Menschen zeigen zweierlei: Ersten gibt es eine gewisse modulare Organisation für »Intelligenz«; dafür sprechen auch klar zuordenbare und zuständige Hirnbereiche, etwa für Sprache oder für soziale Verantwortlichkeit. Und zweitens ist es nicht besonders sinnvoll, die »Intelligenz« von Raben, Gänsen oder Menschen direkt vergleichen zu wollen, oder innerhalb der Menschen sogenannte »Intelligenzquotienten« (IQ) zu bilden. Denn dazu wird ein breites Spektrum an geistiger Leistungsfähigkeit mit Hilfe standardisierter psychologischer Tests untersucht. Das Ergebnis anschließend in einer einzigen Zahl zusammenzufassen ist nahezu unsinnig. Denn die Aussage, dass jemand einen IQ von 130 aufweist sagt noch nichts über die Art der Leistungsfähigkeit im sozialen, mathematischen oder sprachlichen Bereich, usw. aus. Der »Lerninstinkt« Ähnlich steht es übrigens mit Lernfähigkeit. Der alte Streit, ob und in welchem Ausmaß Verhalten »angeboren oder erlernt« sei, ist auch deswegen sinnlos, weil nur gelernt werden kann, wofür Lernfähigkeit evolutionär ausgebildet wurde. Auch die »intelligentesten« Arten können nicht alles lernen. Bereits Konrad Lorenz stellte in seiner Auseinandersetzung mit den Behavioristen die Frage, warum Lernen denn adaptiv sei, also die Eignung eines Individuums bezüglich einer bestimmten Umwelt zu erhöhen vermag. Die Berechtigung dieser Frage wird sofort einsichtig, wenn man sich vorstellt, welche Unzahl von Umweltreizen ständig auf uns und auf jedes naive Tier einströmen. Würde einfach alles gleichermaßen Aufmerksamkeit erregen und gelernt, wäre das sicherlich nicht adaptiv, sondern ganz im Gegenteil. Es muss also bereits evolutionär angelegte Aufmerksamkeitsstrukturen geben, welche das Lernen in die relevanten Bahnen lenkt und zudem Substrate, bzw. Bereitscha�en für die zu lernenden Inhalte. Genauso, wie es nicht möglich ist, Milch mit einem Vogelkäfig zu transportieren, ist es unmöglich, bei einer Schädigung der entsprechenden Hirnzentren zu lernen. So wird Sprachlernen nahezu unmöglich, wenn die Sprachzentren geschädigt sind und sozial verantwortliches Handeln kann nie und nimmer gelernt werden wenn der präfrontale Kortex geschädigt oder unterentwickelt ist, wie Antonio Damasio nachweisen konnte. Lorenz nannte dies den »angeborenen Lehrmeister«, dem er die »tabula rasa« der Lerntheoretiker gegenüberstellte und Peter Marler prägte den schönen Begriff »Lerninstinkt« (instinct to learn). Heute wissen wir, dass Lorenz und die ethologische Kognitionsforschung von Anfang an recht ha�en. Die genauen Interaktionen dieser evolutionär angelegten Fähigkeiten mit den Reizen aus der Umwelt sind und bleiben al- 192 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? lerdings ein Brennpunkt der modernen Ethologie und Kognitionsforschung (Kamil 1998). Aber auch Behaviorismus und Lerntheorie steuerten das Ihre zur neuen Synthese bei. So ist heute klar, dass nicht, wie Konrad Lorenz noch meinte, Lernmechanismen generell artspezifisch sind. Nervensysteme sind evolutionär äußerst konservativ. Das zeigt sich u. a. in der eher geringen Modifikation von Wirbeltier- und Arthropodengehirnen über die hunderte Millionen Jahre der Evolution. Ist auch verständlich, denn man kann nicht lebensnotwendige Steuerteile »wegen Umbau« einfach stillegen. So kommt es nur zu einer äußerst geringen Veränderung vor allem der alten Hirnteile, weil dies deren lebenserhaltende Funktionstüchtigkeit gefährden würde. »Anbauen« dagegen ist weniger problematisch und neue kognitive Fähigkeiten entstehen in der Regel durch Bildung neuer Module. Strenggenommen werden solche neuen Module, etwa die Sprachzentren des Menschen, so gut wie nie neu gebildet, sondern entstehen durch Abspaltung aus bestehenden Gebieten, bzw. durch deren Umwidmung und Aufgabenerweiterung. So sind ist etwa ein Teil der menschlichen Sprachzentren aus jenem Großhirnzentrum hervorgegangen, das bei Schimpansen für Gestik zuständig ist. Das erklärt auch die geringe Zahl der grundlegenden Lernmechanismen. Buchstäblich von den Fischen bis zum Menschen sorgt die Habituation dafür, dass wir uns an ständig wiederkehrende, ungefährliche Reize gewöhnen, die Pawlowsche Konditionierung führt dazu, dass wir grundsätzlich irrelevanten Reizen neue Bedeutung beimessen können und die Operante Konditionierung gesta�etes, selbs�ätig durch Versuch und Irrtum neue Fähigkeiten zu Lernen und Einsichten zu gewinnen. Dies ist das Grundrepertoire und auch im sozialen Zusammenhang werden Au fmerksamkeitsstrukturen, nicht aber diese grundlegenden Lernmechanismen beeinflusst. Art- und individuenspezifische Modifikationen bestehen vor allem in ihrem quantitativen Verhältnis und wie der »angeborene Lehrmeister« diese Lerninstrumente einsetzt. Trotz über 100 Jahren Kognitionsforschung fehlen genauere vergleichende Untersuchungen zu geistigen Fähigkeiten beinahe ganz. Das Gebiet ist daher trotz seiner Tradition einer der immer aktuellen Brennpunkte der Ethologie. Zur Artspezifität kognitiver Leistungen tragen auch die einschränkenden Randbedingungen für kognitive Leistungsfähigkeit bei. So etwa wäre es u. U. ein Vorteil für eine fressende Gans, genau nachzusehen und zu überlegen, ob denn der Scha�en am Himmel wirklich ein anfliegender Adler ist. Wenn nicht, könnte man ja in Ruhe weiterfressen. Allerdings verbietet sich in diesem Zusammenhang zu viel an langsamer Kognition. Einmal zu lange nachgedacht, bedeutet für immer tot. Daher hat kühle Überlegung keine Chance gegen Panik und Flucht. Dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, zeigen in beinahe paradoxer Weise auch die Kolkraben. Obwohl hoch explorativ und sehr begabt, Probleme zu lösen, beginnen sie sich Monate nach dem Flüggewerden vor allen neuen Gegenständen und Situationen panisch zu fürchten, obwohl sie daran interessiert bleiben. Ihre ökologischen »Antipoden« die Bergpapageien (Keas) Neuseelands zeigen dies kaum. Dies lässt zunächst den Schluss zu, dass sich die Neophobie der Raben als überlebenswichtiges Ethologie und Psychologie: »Es gibt nur eine Psychologie« 193 Modul im Zusammenleben mit gefährlichen Fressfeinden und Konkurrenten entwickelte, denn solche gab es in Neuseeland vor der Ankun� des Menschen nicht. Man könnte daher die Neophobie als notwendiges Übel, als einschränkende Randbedingung für die volle Nutzung der geistigen Fähigkeiten ansehen. Allerdings scheinen Rabeneltern durch Konfrontation ihrer Jungen mit Situationen und Objekte in den ersten Wochen nach dem Verlassen des Nestes steuern zu können, wovor sich ihre Nachkommen fürderhin fürchten. So wäre die Neophobie ein Instrument, das Eltern nutzen könnten, um konservative Familientraditionen zu bilden. Auch auf diesem Gebiet wird intensiv geforscht, so auch an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau. Ethologie und Psychologie: »Es gibt nur eine Psychologie« Als die Ethologie mit Konrad Lorenz und den anderen Großen seiner Zeit laufen lernte, war es zumindest diesen Gründervätern selbstverständlich, dass sie ein universelles, natürliches System anstrebten, das sich auch für die Analyse des menschlichen Verhaltens eignete. Die Basis dafür bildete das Darwinsche Tier-Mensch-Kontinuum. Eine Trennung der Tier- von der Humanpsychologie wurde weder für notwendig noch zweckmäßig erachtet: »Junger Mann, es gibt nur eine Psychologie«, erwiderte Konrad Lorenz auf die Feststellung des jungen Paul Leyhausen in Königsberg, er interessiere sich für Tierpsychologie. Daran hat sich wohl auch 60 Jahre später nichts geändert. Wegen der gemeinsamen Wurzeln von Menschen und Tieren in der Evolution ist dasselbe Set an Theorien und Methoden für beide anwendbar. Es war ein langer, bis heute andauernder Kampf, diese Einsicht in die Psychologie zu tragen. Tatsächlich war die vor allem durch Irenäus EiblEibesfeldt etablierte Humanethologie lange Zeit allein auf weiter Flur (da es eigentlich nur eine Ethologie gibt, wäre die Vorsilbe »Human« vor der »Ethologie« auch gar nicht nötig gewesen). Dann kam Edward O. Wilson mit seiner Synthese der Soziobiologie (1975). Sein provokanter Alleinvertretungsanspruch durch die Soziobiologie gipfelte in der Feststellung, diese Disziplin würde alle anderen Disziplinen, einschließlich Ethologie und Psychologie »kannibalisieren«. Der laute Aufschrei ist wissenscha�spsychologisch verständlich, wenn auch Wilson in anderen Worten nicht anderes wiederholte, als das alte »es gibt nur eine Psychologie«. Auf dem Umweg über die Soziobiologie und die USA und unter dem politisch korrektem Namen »evolutionäre Psychologie« grei� die lange geforderte evolutionäre Synthese der Psychologie nun sehr rasch um sich. Gründe dafür mag es viel geben, es war wohl vor allem die größere Innovationsfreude jenseits des großen Teiches, gepaart mit der ernüchternden Einsicht, dass die lange gehegten Theorierahmen der US-amerikanischen Psychologie, milieutheoretischer Konstruktivismus gepaart mit Behaviorismus (Skinnersche Lerntheorie) schlicht falsch und für die Praxis wenig brauchbar sind. Der Sieg für Lorenz und Co. über Skinner und Co. kam spät, dafür umso vollständiger. Trotzdem wird Lorenz von den US-amerikanischen »evolutionären Psychologen« nicht mehr zitiert, denn das gilt wegen der braunen Flecken auf der Lorenz-Biographie als politisch unkorrekt (Föger und Taschwer 2001, Grammer 2001, Kotrschal u. a. 2001). 194 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? Zudem könnte es sein, dass manche junge KollegInnen ihre Wurzeln nicht mehr kennen. Dennoch ist es für Ethologen durchaus ratsam, über den Zaun zu den Psychologen zu schauen. Das tun Verhaltensbiologen auch zunehmend, u. a., weil es wenig erkenntnisträchtig ist, Individuen nur als Input-OutputMaschinen zu betrachten. So etwa ist es eine zentrale Fragestellung der Forschung an der Konrad Lorenz Forschungsstelle, warum manche Individuen/Paare von Graugänsen und anderer Tiermodelle erfolgreich Nachkommen großziehen und andere nicht. Dazu kann man sich einfacher Beobachtungen bedienen, um etwa zu überprüfen, ob bestimmte Verhaltensprofile der Individuen mit ihrem späteren Erfolg oder Misserfolg zusammenhängen (Hemetsberger 2001). Oder man kann Hormone als Fenster ins Individuum/Paar verwenden. So etwa zeigte sich, dass vor allem Paare mit im Jahresgang parallelen Testosteronschwankungen erfolgreich sind (Hirschenhauser u. a. 1999b). Aber wir brauchen es »noch psychologischer«. Denn mit der Analyse der aktuellen Paarsituation ist die Sache noch nicht getan. So müssen auch die individuellen Vorgeschichten der Paarpartner für die Erklärung herangezogen werden, der soziale Status ihrer Elternfamilien, ihre Persönlichkeiten, das Ausmaß der mü�erlichen Manipulation, etwa über die Steroidhormone in den Eiern, Schartraditionen usw. Vor allem aber scheint es, dass das Verhalten des Paare nicht ausreichend aus der Qualität der Paarpartner erklärt werden kann. Wie auch beim Menschen (Willi 1975) scha� Paarbildung neue Systemeigenscha�en. Wir betreiben also zunehmend »Gänsepsychologie« für die Erklärung unserer ureigensten, evolutionären Fragen. Gerade von einer evolutionär orientierten Psychologie sind auch viele Impulse zurück, in Richtung der Ethologie zu erwarten, sodass die Grenzen zwischen den Disziplinen zunehmend verschwimmen und in der Ethologie gesehen wird, was sie von Anfang an ohnehin ist, eine artvergleichende, evolutionäre Psychologie. Während es aufgrund des gemeinsamen Daches der Darwinschen Theorie immer nur eine Biologie gab, waren (und sind) es eigentlich hunderte Psychologien. Die Mehrzahl der Menschenmodelle in der Psychologie waren und sind, vor allem in der Alten Welt, von ihrer Herkun� her, idealistischdeduktiv. Beginnend bei Sigmund Freud begründete jeder Psychologe, der etwas auf sich hielt, seine eigene Schule. Und erst langsam und aus der Praxis kommend fanden Empirie und der zunächst eher abfällig kommentierter Eklektizismus (die Auswahl der für die Therapie brauchbaren Elemente aus den unterschiedlichen Theorien und Ansätzen) ihren Weg in die Psychologie. Die zerspli�erten Systeme der Psychologie wurden immer wieder kritisiert, so etwa von Lorenz (1954, 1992), oder auch von Psychologen selber. Jü�emann (1992) etwa, kritisiert vor allem die klassische Deduktions-Lastigkeit in der Psychologie. Dies bedeutet, dass gewöhnlich am Anfang ein recht »ausgedachtes« Theoriegebäude steht, das man dann durch Erkenntnisse zu stützen versucht, ansta� umgekehrt, die Theorieentwicklung auf Basis empirisch erhobener Daten zu betreiben. Ethologie und Psychologie: »Es gibt nur eine Psychologie« 195 Daraus, so Jü�emann, entstehen zwangsläufig miteinander verknüp�e Probleme, die Systemimmanenz, Dogmatismus, Reduktionismus, sowie ein Basisproblem. Als »Systemimmanenz« bezeichnet man die Bildung geschlossener Systeme mit genehmen und unerwünschten Sichtweisen. Dass dies zur Bildung von »Dogmen« und Wissensverzicht führen muss, liegt auf der Hand. Unter »Reduktionismus« versteht man nicht nur die daraus hervorgehende Verkürzung des Gegenstandes, sondern auch ein damit einhergehendes Methodendiktat. Und unter dem »Basisproblem« versteht man die mit einem deduktionistischen Ansatz einhergehende Notwendigkeit, den Untersuchungsgegenstand vorher zu umreißen, was beinahe zwangsläufig zur Theoriebildung vor der Datensammlung führt. Wie der Patient Psychologie zu behandeln wäre, ist damit auch klar: An Stelle der Systemvielfalt hat die Vielfalt der Methoden und Themen zu treten, an Stelle der deduzierenden Arbeitsweise induktiv-empirische Ansätze, aber das ist an den Universitäten seit Jahrzehnten ohnehin immer stärker der Fall. So ist zuviel Lamento über die historische Diagnose der Beziehung zwischen Ethologie und Psychologie nicht mehr angebracht. Denn das evolutionäre Menschenmodell setzte sich, von der Biologie ausgehend, zunächst in der Öffentlichkeit und zunehmend auch in den Humanwissenscha�en durch, so auch in der Psychologie. Das evolutionäre Gewordensein des Menschen »liegt so stark in der Lu�«, ist derart »zeitgeistig«, die Ergebnisse der Ethologie und Soziobiologie (bzw. der »evolutionären Psychologie«) sind so dominant, dass sich die akademischen Repräsentation der Anthropologie, der Ethnologie, Soziologie, natürlich der Psychologie und schließlich auch der Philosophie dem nicht mehr länger verschließen können. Traurig eigentlich, dass letztere als »Mu�er aller Wissenscha�en« die Themenführerscha� großteils verlor, weil sie die Entwicklungen über die vergangenen Jahrzehnten in den Naturwissenscha�en unterschätzte, bzw. verschlief. Tatsächlich ist die Synthese der Natur- und Humanwissenscha�en unter dem Dach der evolutionären Theorie in vollem Gang. Dass nun Psychologen so tun, als hä�en sie die evolutionäre Betrachtung des Menschen selber erfunden, ist wohl zum Teil unvermeidlich, ist wissenscha�spsychologisch erklärbar. Wieder einmal frisst eine Revolution ihre Kinder. Das Primat der evolutionären Theorie Die oben erwähnten, Jü�emannschen Gefahren gelten natürlich nicht nur für die Psychologie, sondern für alle dogmatisch betriebenen naturwissenscha�lichen Disziplinen, daher auch für Soziobiologie und Öko-Ethologie. Es ist immanent gefährlich, Untersuchungen durchzuführen, um ein bestimmtes Konzept zu testen. Natürlich bleibt zum Nachweis von Ursachenbeziehungen gar nichts anderes übrig. Die Dogmatismusgefahr besteht. Die Ethologie fußt, wie alle anderen biologischen Wissenscha�en, auf der Darwinschen Evolutionstheorie. Nur Hypothesen und Ansätze, die mit den grundlegenden Thesen und Postulaten dieser Theorie im Einklang stehen, haben eine Chance, ernstgenommen zu werden. Es scheint, als präsentiere sich die Ethologie mit ihrem neodarwinistischen Weltbild als monolithischer Saurier, als Gemeinscha� der Rechtgläubigen der Kirche Darwins. Und wer draußen 196 Die »Brennpunkte« der modernen Ethologie: Gibt es noch was zu forschen? steht, hat eben keine Chancen, seine Ideen in den vielen wissenscha�lichen Journalen, den »Kirchenzeitungen« des Systems zu publizieren. Ist die Evolutionstheorie trotz ihrer Plausibilität nur eine der vielen, ideologischen »Heilslehren« welche die kulturfähigen Menschen immer schon heimsuchten? Das ist einfach zu entkrä�en. Und es ist äußerst notwendig, das zu tu. Denn wir leben in einem Zeitalter zunehmender wissenscha�licher Beliebigkeit. Mit dem Anstrich der Wissenscha�lichkeit (oder nicht mal das) versehene Aussagen werden von Medien und Öffentlichkeit zunehmend als gleichwertig betrachtet, gleich, ob kohärente Naturwissenscha� oder metaphysischer Hokus-Pokus. Dieser Beliebigkeit ist entgegenzutreten. Denn der Anspruch der evolutionären Biologie beruht im Gegensatz zu den Absolutheitsansprüchen mancher Religionen und Ideologien auf empirisch erhobenen Daten. Der Kampf mancher fundamentalistischer katholischer Bischöfe gegen die »Beliebigkeit« sollte daher mit dem gleichermaßen bezeichneten Kampf der Naturwissenscha�en nicht verwechselt werden. Als einzige Basistheorie entspringt die Evolutionstheorie einer Unzahl von Forschungsergebnissen, die bereits vor ihrer Erstformulierung durch Charles Darwin existierten; sie entstand also nicht vorwiegend deduktionistisch, sondern induktionistisch gewonnen. Besonders das Scheitern aller Falsifikationsversuche ist hoch zu bewerten, da auf kaum einem anderen Gebiet der Naturwissenscha�en so viel und so beständig von einem derart breiten Kreis von Wissenscha�lern geforscht wurde, wie zur Evolutionstheorie. Sie darf daher mit den klassischen philosophischen Konstrukten der Psychologie, die ebenfalls den Namen »Theorie« tragen, aber im naturwissenscha�lichen Sinne untestbar und daher Mythen sind, nicht in einen Topf geworfen werden. Die Evolutionstheorie ist das einzige natürliche System, das nicht nur unser evolutionäres Gewordensein, sondern auch unsere Individualentwicklung aus Ei- und Samenzelle, und unser Verhalten im Lichte der Funktionen des Körpers widerspruchsfrei erklärt (Tinbergen 1963). Trotzdem muss die Evolutionstheorie in allen ihren Verästelungen ständig kritisch hinterfragt werden. Sie ist kein Glaubenssatz, sondern lebendige, naturwissenscha�liche Theorie. So sind nicht nur unser Körperbau, sondern auch unsere geistig-seelischen Äußerungen, bis hin zur Kulturfähigkeit und Religiosität genauso evolutionär-biologisch zu sehen, wie Körpersprache und Mimik. Dass es im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation »menschliche Universalien« gibt, also »arteigene Verhaltensweisen«, die aus der evolutionären Geschichte kommen, war schon Sigmund Freud klar, wurde von Konrad Lorenz konkretisiert und von seinem Schüler Irenäus Eibl Eibesfeldt nachgewiesen (1986). Und selbst unsere Persönlichkeitseigenscha�en sind, wie umfangreiche Zwillingsstudien belegen, hochgradig genetisch bedingt (Bouchard u. a. 1990). Wenn auch die evolutionär-genetische Bedingtheit der menschlichen Denk- und Freiheitsfähigeit deutliche Grenzen setzt, so sollten andererseits diese allen gemeinsame Konstruktion ein Gemeinscha�sgefühl schaffen, welches geeignet ist, allzu große Egoismen und Abgrenzungstendenzen gegen andere zu überwinden (Schiefenhövel u. a. 1993). Ethologie und Psychologie: »Es gibt nur eine Psychologie« 197 Menschen als Kulturwesen? Noch immer scho�en sich manche Kollegen aus den Human- und Geisteswissenscha�en gegen die Forderung, Menschen als biologisch-evolutionäres Wesen zu sehen, mit der Feststellung ab, der Mensch sei ein Kulturwesen. Die Gene seien zwar für Körperbau und -funktionen zuständig, aber die Psyche und Kulturfähigkeit hä�en damit nichts zu tun. Man kann sich u. a. nur schwer vorstellen, wie die beobachtete Vielfalt ein Produkt der Gene sein könne. Genau das zeigt aber auch die öko-ethologische Forschung. Ständig treffen Individuen auf Basis ihrer Dispositionen und endogenen Strategieempfehlungen Entscheidungen, um letztlich ihre Fitness zu optimieren (Krebs und Davies 1993). Dass also die Annahme genetischer Disponiertheit gleichbedeutend sei mit Starrheit im Verhalten und in den Sozialsystemen, ist irrig (Lo� 1992). Die große Plastizität im menschlichen Verhalten ist gerade gegen den Hintergrund der menschlichen genetischen Dispositionen nicht nur nicht verwunderlich, sondern zu erwarten. Das verurteilt uns auch nicht zu einem strikten genetischen Determinismus, einem weiteren biologisch-evolutionärem Schreckgespenst. Das besondere an der Spezies Mensch ist tatsächlich nicht der kulturelle Überbau, sondern die ständige Kopplung zwischen dem neuronalen Substrat und den von ihm geschaffenen kulturellen Inhalten. Zweifellos beschleunigte diese spiralige Kopplung die Menschwerdung beträchtlich. Und heute lebt die Mehrzahl der Menschheit in Städten, ziemlich losgelöst von den Lebensbedingungen der Steinzeit, in einer selbstdefinierten Kulturumgebung. Kühlschränke und Wohnungen, Nahrungsmi�elfabriken, Opernhäuser und Computer sind genauso zwischen Auge, Hand und Hirn entstandene Kulturprodukte, wie Idole und Feindbilder, wie Ideologien, Tempel, letztlich wahrscheinlich sogar Go� selber (Hernegger 1976). Die Kulturinhalte sind eine Frage der Traditionen und der ökologisch-ökonomischen Randbedingungen, die Antriebe zur kulturellen Betätigung aber bleiben zutiefst biologisch. Es geht um Ansehen, Einfluss, Verbündete und – letztlich – Kontrolle über Reproduktion, bzw. Informationsfluss. Und alle, o� seltsamen Verhaltensäußerungen und Sozialbeziehungen der Zivilisationsmenschen sind natürlich nicht Ergebnis irgendwelcher von Geisteswissenscha�lern postulierten Konstrukte, sondern sind konkrete Verhaltensreaktionen innerhalb der menschlichen Reaktionsnorm, auf die neuen, vorwiegend kulturbedingten Randbedingungen. Immer noch sticht das Prinzip Eigennutz den Altruismus und der Kurzzeit- den Langzeitvorteil (Eibl Eibesfeldt 1998). Wenn alte Strategiekonzepte zu gesellscha�lichen Problemen führen, wie etwa durch Konrad Lorenz in seinen »acht Todsünden« (1973) beschrieben, dann ist das zwar bedauerlich, aber nicht gleich »pathologisch«. Denn es ist evolutionär nicht unbedingt gefordert, Artgenossen nicht zu schaden, Tiere wie Menschen verhalten sich eben nicht, um »die Art« zu erhalten, sondern um ihren eigenen Vorteil gegenüber anderen zu wahren, ohne dabei gleich die Gruppen, auf die sie angewiesen sind zu sprengen. Was also Konrad Lorenz als »gesellscha�liche Pathologien« ansah, interpretieren wir heute 198 Nachwort als Folgen von evolutionär durchaus »normalen«, wenn auch nicht immer wünschenswertem Verhalten von Individuen. Dies stellt natürlich nicht nur bloß eine andere Sprachregelung dar, es begründen sich darauf unterschiedliche Lösungsansätze. Denn will man gesellscha�liche Zustände verbessern, ist eine individuenbezogene Politik in Richtung Bürgergesellscha� wesentlich wirksamer, als Bevormundung, Kollektiv und Strafgesetz. Erfolgreiche Gesellscha�s- und Sozialpolitik ist nur unter Beachtung der evolutionären Verhaltensdispositionen der Menschen möglich. Nachwort 199 Nachwort Müssen Menschen überleben – hat das Leben »Sinn«? Aus einer wertneutralen naturwissenscha�lichen Sicht wäre es nicht bedauerlich, wenn die Menschen sich selber und einen Gu�eil der Biosphäre zugrunderichten. Massenaussterben durch Meteoreinschläge, Vulkanismus, oder eben im Moment durch die Dominanz des Menschen sind genauso wichtige Triebfedern der Evolution wie die darauffolgenden neuen Artbildungen in die leergeräumten Lebensräume hinein. Das war die vergangenen 600 bis 800 Millionen Jahre so und wird wohl auch noch ein paar hundert Jahrmillionen so weitergehen. So sind bereits wesentlich mehr Arten ausgestorben, als heute auf der Erde leben. Die »Halbwertszeit« biologischer Arten beträgt einige Millionen Jahre. Früher oder später sterben alle aus. Auch die Menschen in ihrer heutigen Form entstanden bereits mit Ablaufdatum. Ob unsere Kulturfähigkeit dazu beitragen wird, dass es uns länger als andere Arten, oder aber viel, viel kürzer geben wird, ist nicht vorhersagbar. Manche Religionen betrachten den Menschen als »die Krone der Schöpfung« und als »Go�es Ebenbild«. Mag sein. Im Lichte der materiellen Weltsicht der Naturwissenscha�en besteht allerdings weder Grund, noch Rechtfertigung, Menschen eine solche Sonderstellung zuzubilligen. Und auch für die Sinnsuche ist die Evolution, sind die Naturwissenscha�en das falsche Gebiet. Dass alles einen »Sinn« haben muss, dass Individuen in ihren Gemeinscha�en, diese wiederum in Staatwesen und letztlich in einem höheren Wesen geborgen, von einem solchen gewollt sein wollen, ist eine typische Eigenscha� des menschlichen Geistes und seinem zwangha� quälendem Grübeln über das Woher und das Wohin. Die Evolution ist ein zielloser Prozess in dem der Zufall Regie spielt. Daher sind aus naturwissenscha�licher Sicht Menschen weder geplant, noch gewollt, ihre Existenz hat nicht mehr, aber auch nicht weniger »Sinn« als die von Regenwürmern. Es scheint daher unerheblich, ob wir etwas zur »Re�ung der Menschheit« beitragen oder weiterhin zynisch in Saus und Braus auf Kosten anderer und nachfolgender Generationen leben. Zumindest für einen Biologen ist es tatsächlich ein tröstlicher Gedanke, dass uns das Prinzip Informationsfluss durch das Erbmaterial, die Desoxyribonukleinsäure mit Sicherheit überdauern wird. So unwirtlich können nach dem Abtreten der Menschheit von der Erde in tausend, hunder�ausend oder vielleicht erst in zehn Millionen Jahren die Lebensbedingungen gar nicht sein, dass nicht einige Arten von Bakterien, Würmern, Insekten, vielleicht Ra�en oder andere Anpassungskünstler weiterleben werden. Die Evolution nach Darwinschen Regeln wird weitergehen, bis die Sonne erkaltet, bzw. als Supernova explodieren wird. Erdgeschichtlich sind die paar Sekunden, in denen auf der Erde menschliches Leben au�litzt genauso unerheblich wie unsere Rolle als Staubkorn im Universum. Während ich diese Zeilen schreibe, spielen Kinder und ein Hund auf der Wiese vor dem Fenster. Der Anblick wärmt das Herz. Das näherliegende sozialevolutionäre Prinzip lässt dem Gefühl des Verlorenseins in Raum und Zeit wenig Chance. Es liegt mir offenbar an meinen Kindern und Kindeskindern 200 Nachwort und deren Glück, sogar gegen die Einsicht dass wir evolutionär ein reines Zufallsprodukt sind. Nicht ich suche den Sinn, er findet mich in Form meiner sozialen Verflochtenheit. Und es macht mir nichts aus, mir vorzustellen, dass jene Moleküle, die meinen Körper au�auen nach meinem Tod wieder zunächst in den ökologischen, dann in den kosmischen Kreislauf zurückfließen werden. Auch mein Leben war ein letztlich völlig unerhebliches Au�litzen in Raum und Zeit, das Leben nach dem Tod existiert vielleicht nur in unseren Gehirnen. Und die verro�en nach unserem Tod sehr rasch. Oberflächlich betrachtet verströmt das evolutionäre Weltbild Eiseskälte, versagt Geborgenheit. Immer wieder stießen Naturwissenscha�ler die Menschen von ihren selbstgezimmerten Podesten. Kopernikus und andere nahmen der Erde ihre zentrale Stellung im Weltall und Darwin, Lorenz und Co nahmen dem menschlichen Geist seine heere Einzigartigkeit, indem sie ihn als evolutionäre Anpassung darstellten. Jeder zieht aus diesen Erkenntnissen wohl seine eigenen Schlussfolgerungen, sucht Geborgenheit entweder in der Religion oder in anderen Ideologien, oder übt sich schlicht in Zynismus. Das Wissen um unsere erblichen Verhaltensneigungen macht uns nicht zu Sklaven unserer Gene, enthebt uns nicht des verantwortlichen Handelns, das sich aus der Zugehörigkeit zur sozialen Art Homo sapiens ableitet. Unsere Verhaltensneigungen evoluierten, als unsere Vorfahren in Kleingruppen lebten und ihre Umwelt schon alleine deswegen nicht in größerem Ausmaß vernichten konnten, weil sie durch ihre geringe Zahl und bescheidenen technischen Möglichkeiten dazu gar nicht in der Lage waren. Überzogen sie die Tragekapazität ihrer Umwelt, dann zogen sie eben weiter. Schon früh ro�eten Menschen Tiere aus, etwa die südamerikanischen Mastodonten, die mediterranen Zwergelefanten, die neuseeländischen Riesenstrauße, usw. Auch den »edlen Wilden« lag eine umweltschonende Ressourcennutzung nicht einfach im Blut. »Von selbst« werden sich auch die Probleme der modernen Welt nicht lösen. Wir haben jedes Recht, bzw. die Pflicht, unser Verhalten in einer übervölkerten Welt um das Prinzip der Nachhaltigkeit zu gestalten, um unseren Nachkommen in dieser Biosphäre, sowie allen anderen Arten ein Leben in Würde zu ermöglichen, selbst wenn ich weiß, dass diese Begriffe bloß evolutionär disponierte, soziales Konstrukte darstellen. Aber ein evolutionäres Weltbild ist die einzig mögliche, weil unsere Verhaltensneigungen berücksichtigende Basis für eine humane Welt. Auf die erblichen Komponenten menschlichen Verhaltens hinzuweisen bedeutet nicht, in billigen genetischen Determinismus zu verfallen, oder gar Menschen das Recht zuzubilligen, menschliches Leben gering zu achten, Selektion an Menschen zu betreiben oder Menschen zu klonen. Diese Probleme sind im Grenzfeld zwischen evolutionärem GewordenSein, dem auch die menschliche Religiosität und Ethik entspringen (de Waal 1997) und Politik anzugehen. Und ein evolutionäres Weltbild hil�, die Rahmenbedingungen der menschlichen Freiheit zu erkennen. Biologische Einsichten, etwa dass wir 99 % des Erbmaterials mit Schimpansen und noch erhebliche Prozentwerte mit Mäusen oder sogar Taufliegen teilen, 201 oder dass die grundlegenden Prinzipien des Verhaltens für alle Organismen gelten, bieten einen durchaus rationalen Ansatz, sich als Teil des Ganzen der Natur zu sehen. Ob man dazu Go� als Begleiter braucht, oder ob die von den Naturwissenscha�en gebotenen Einsichten in evolutionäre Geschichtlichkeit der eigenen Existenz ausreicht, ist eine Frage des individuellen Glaubens und berührt das evolutionäre Weltbild nicht. Denn auch ein Absolutheitsanspruch eines transzendentalen Prinzips ist nicht zu vertreten; es existiert nur in jenen, die daran glauben. Aus evolutionärer Sicht jedenfalls ist der Mensch nicht »Krone der Schöpfung«, sondern allenfalls primus inter pares, eine von vielen Tierarten auf dieser Welt, Damit entfällt das selbstzuerkannte Recht, uns »die Erde untertan« zu machen. Respekt vor Menschen und der Natur wird neben dem Wissen um die Zusammenhänge nötig sein, um die Chancen der kommenden Generationen zu wahren. 202 Literaturverzeichnis Alcock, J. (1996): Das Verhalten der Tiere aus evolutionsbiologischer Sicht. Stu�gart: G. Fischer. Archer, J. (1988): The Behavioural Biology of Aggression. Cambridge u.a.: Cambridge University Press. Baker, R. R.; Bellis, M.A. (1993a): Human sperm competition: ejaculate adjustment by males and the function of masturbation. Anim. Behav. 46: 861–885. Baker, R. R.; Bellis, M. A. (1993b): Human sperm competition: ejaculate manipulation by females and a function for the female orgasm. Anim. Behav. 46: 887–909. Barbujani, G. (1991): What do languages tell us about human microevolution? TREE 6: 151–156. Barlow, G. W. (1989): Has sociobiology killed ethology or revitalized it? In: Batsmen, P. G. und Klopfer, P.H. (Ms.): Perspectives in Ethology. Vol. 8. Whither Ethology? New York, London: Plenum Press, pp. 1–38. Barlow, G. W. (1991): Nature-nuture and the debate surrounding ethology and sociobiology. Amer. Zool. 31: 286–296. Bateson, P. (1983): Optimal breeding In: Batsmen, P. (Ms.): Mate Choice. Cambridge, u.a.: Cambridge University Press, pp. 257–277. Bauchot, R.; Bauchot, M.; Platel, L.; Ridet, J. M. (1977): Brains of Hawaiian tropical fishes; brain size and evolution. Copeia 1/77: 42–46. Bäumer, Ä. (1990): NS-Biologie. Stu�gart: Hirzel. Becker, J. B.; Breedlove, S. M.; Crews, D. (1982): Behavioral Endocrinology. Cambridge, London: Bradford, MIT Press. Bennett, J. (1976): Linguistic Behavior. Cambridge: Cambridge University Press. Berthold, A. A. (1849): Transplantation der Hoden. Arch. Anat. Physiol. Wissensch. Med., 42–46. Berthold, P. (1993): Bird migration. Oxford u.a.: Oxford University Press. Bertram, B. C. R. (1980): Vigilance and group size in ostriches. Anim. Behav. 28, 278–286. Bezzel, E. (1993): Paschas, Paare, Partnerscha�en. Strategien der Geschlechter im Tierreich. München: Kunstmann. Birkhead, T. R.; Møller, A. P. (1992): Sperm competition in birds. Evolutionary causes and concequences. London: Academic Press. Bischof, H.-J. (1989): Neuroethologie. München: Ulmer (UTB). Bischof, N. (1985): Das Rätsel Odipus. Die biologischen Wurzeln des Urkonfliktes von Intimität und Autonomie. München: Piper. 204 Literaturverzeichnis Bischof, N. (1991): Gescheiter als all die Laffen. Ein Psychogramm von Konrad Lorenz Hamburg-Zürich: Rasch und Röhring. Black, J. M. (1996): Partnership in birds. The study of monogamy. Oxford: Oxford University Press. Blakemore, C.; Cooper, G. F. (1970): Development of the brain depends on the visual environment. Nature Lond. 228: 477–478. Bonner, J. T. (1983): Kulturevolution bei Tieren. Berlin, Hamburg: Parey. Borgerhoff Mulder, M.; Judge, D. S. (1993): Sex, statistical reasoning and other human interests. TREE 8: 6–7. Bouchard, T. J. Jr.; Lykken, D. T.; McGue, M.; Segal, N. L.; Tellegen, A. (1990): Sources of human psychological differences: The Minnesota study of twins reared apart. Science 250: 223–228. Bugnyar, T.; Kotrschal, K. (2001): Movement coordination and signalling in ravens (Corvus corax): an experimental field study. Acta Ethol. 3: 101–109. Bugnyar, T.; Kijne, M.; Kotrschal, K. (2001): Food calling in ravens: are »yells« referential signals? Anim. Behav. 61: 949–958. Bugnyar, T.; Kotrschal, K. (2002a): Scrounging tactics in free-ranging ravens, Corvus corax. Ethology 108: 993–1009. Bugnyar, T.; Kotrschal, K. (2002b): Observational learning and the raiding of food caches in ravens, Corvus corax: is it »tactical« deception? Anim. Behav. 64: 185–195. Bur�, E. H. Jr. (1984): Colour of the upper mandible: an adaptation to reduce reflectance. Anim. Behav. 32: 652–658. Buss, L. W. (1987): The Evolution of Individuality. Princeton, N. J.: Princeton University Press. Byrne, R. (1995): The thinking ape. Oxford: Oxford University Press. Carlier, M.; Roubertoux, P.; Cohen-Salmon C. (1983): Early development of mice: 1. Genotype and post-natal maternal effects. Physiol. Behav. 30: 837–844. Caro, T. (1994): Signalling between prey and predators. Abstract, ASAB Meeting, Bern. Chance, M. R. A. (Hrsg.) (1988): Social Fabrics of the Mind. Hillsdale, London: Lawrence Erlbaum Publishers. Choudhury, S.; Black, J. M. (1993): Mate selection behaviour and sampling strategies in geese. Anim. Behav. 46: 747–745. Ciompi, L. (1993): Die Hypothese der Affektlogik. Spektrum der Wissenscha� 2: 76–87. Clayton, N. (1994): Spatial memory, interference and the Hippocampus: evidence from comparative studies of food storing und non-storing birds. J. Ornithol. 135: 442. Literaturverzeichnis 205 Clu�on-Brock, T. W.; Guiness, F. E.; Albon, S. D. (1982): Red deer. Behavior and ecology of the two sexes. Chicago: The University of Chicago Press. Cooke, F.; Rockwell, R. F.; Lank, D. B. (1995): The snow geese of La Pérouse Bay. Oxford u.a.: Oxford University Press. Crawford, C. B. (1993): The future of sociobiology: Counting babies or studying proximate mechanisms. TREE 8: 183–186. Crook, J. H. (1964): The evolution of social organisation and visual communication in the weaver birds (Ploceinae). Behaviour, Suppl. 10: 1–178. Crook, J. H.; Gartlan, J. S. (1966): Evolution of primate societies. Nature, Lond. 210: 1200–1203. Daisley, J. N.; Kotrschal, K. (2003): Coping styles in Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica). Eingereicht. Daly, M.; Wilson M. (19832): Sex, Evolution and Behavior. Boston: Wilard Grant Press. Daly M.; Wilson, M. (1987): Children as homicide victims. In: Gelles, R. und Lancaster, J. (Hrsg.): Biosocial Perspectives on Child Abuse. New York: Aldine. Daly M.; Wilson M. (1999): The truth about Cinderella: A darwinian view of parental love. Darwin, C. (1859): On the origins of species by means of natural selection. London: Murray. Darwin, C. (187l): The descent of man and selection in relation to sex. London: Murray. Darwin, C. (1872): The expression of the emotions in man and animals. London: Murray . Davies, N. B. (1992): Dunnock behaviour and social evolution. Oxford, New York, Tokio: Oxford University Press. Dawkins, R. (1977): The selfish Gene. New York: Oxford University Press. Dewsbury, D. A. (19898): A brief history of the study of animal behavior in North America. In: Bateson, P. P. G. und Klopfer, P. H. (Hrsg.): Perspectives in Ethology. Whither Ethology? New York, London: Plenum Press, pp. 85–117. Drack, G.; Kotrschal, K. (1995): Aktivitätsmuster und Spiel von freilebenden Kolkraben (Corvus corax) im inneren Almtal/Oberösterreich. Monticola 77: 159–174. Dunbar, R. (1993): Coevolution and neocortical size, group size and language in humans. Behav. Brain Sci. 16, 681–735. Eibl-Eibesfeldt, I. (1975): Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung. München: Piper. Eibl-Eibesfeldt, I. (1988): Der Mensch – das riskierte Wesen. Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernun�. München: Piper. 206 Literaturverzeichnis Eibl-Eibesfeld, I. (1994): Wider die Mißtrauensgesellscha�. Streitschri� für eine bessere Zukun�. München: Piper. Eibl-Eibesfeldt, I. (19953): Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie. München: Piper. Eibl-Eibesfeldt, I. (1999 8): Grundriß der vergleichenden Verhaltensforschung. Ethologie. München, Zürich: Piper. Essler, H.; Kotrschal K. (1994): Changes of roach (Rutilus rutilus, Cyprinidae, Teleostei swim paths in response to chemical stimulation. J. Fish Biol. 45, 555–567. Essler, H.; Kotrschal, K. (1995): Fische verändern ihr Schwimmverhalten bei Wahrnehmung von Nahrungs- und Feindgeruch: Versuche an Elritzen (Phoxinus phoxinus L.). Ö. Fisch. 48: 83–89. Festetics, A. (1983): Konrad Lorenz. Aus der Welt des großen Naturforschers. München: Piper. Fischer, H. (1965): Das Triumphgeschrei der Graugans (Anser anser). Z. Tierpsychol. 22: 247–304. Fisher, R. A. (1930): The genetical theory of natural selection. Oxford: Clarendon. Fitzgibbon, C. D.; Fanshaw, J. H. (1988): Sto�ing in Thompson‘s gazelles: an honest signal of condition. Behav. Ecol. Sociobiol. 23: 69–74. Föger, B.; Taschwer, K. (2001): Die andere Seite des Spiegels. Konrad Lorenz und der Nationalsozialismus. Wien: Czernin. Frank, D. (2000): Verhaltensbiologie. Einführung in die Ethologie. Stuttgart: Thieme. Fretwell, S. D.; Lucas, H. L. Jr. (1969): On territorial behaviour and other factors influencing habitat distribution in birds. Acta biotheoretica 19: 16–36. Freud, S. (1952): Gesammelte Werke, Bd. 1–17. London: Imago. Frigerio, D.; Weiß, B.; Kotrschal, K. (2001a): Spatial proximity among adult siblings in Greylag geese (Anser anser): Evidence for female bonding? Acta Ethologica 3: 121–125. Frigerio, D.; Möstl, E.; Kotrschal, K. (2001b): Excreted metabolites of gonadal steroid hormones and corticosterone in greylag geese (Anser anser) from hatching to fledging. Gen. Comp. Endocrinol. 124: 246–255. Frigerio, D.; Weiss, B.; Kotrschal, K (eingereicht): Passive social support affects agonistic interactions and excreted corticosterone metabolites in juvenile Greylag geese (Anser anser). Fritz, J.; Kotrschal, K. (1999): Social learning in common ravens (Corvus corax). Anim.Behav. 57, 785–793. Fritz, J.; Kotrschal, K. (2000): On avian imitation: Cognitive and ethological perspectives. Invited Contribution in: (Nehaniv, C. L. and Dauterhahn, K. Hrsg.) Imitation in animals and artefacts. Boston: MIT Press. Literaturverzeichnis 207 Fritz, J.; Bisenberger, A.; Kotrschal, K. (2000): Stimulus enhancement in greylag geese: socially mediated learning of an operant task. Animal Behaviour 59, 1119–1125. Gould, S. J.; Lewontine, R. C. (1979): The spandrels of San Marco und the panglossian paradigm: a critique of the adaptionist programme. Proc. R. Soc. Lond. B 205: 581–598. Grammer K. (1988): Biologische Grundlagen des Sozialverhaltens. Darmstadt: Wissenscha�liche Buchgesellscha�. Grammer, K. (1993): Signale der Liebe. Die biologischen Gesetze der Partnerscha�. Hamburg: Hoffmann und Campe. Grammer, K. (2001): Wie modern ist Konrad Lorenz? In: K. Kotrschal, G. Müller und H. Winkler (Hrsg.): Konrad Lorenz und seine verhaltensbiologischen Konzepte aus heutiger Sicht. Fürth: Filander Verlag, pp. 139–148. Griffin, D. R. (1985): Wie Tiere denken. Ein Vorstoß ins Bewusstsein der Tiere. München, Wien u.a.: BLV Verlagsgesellscha�. Griffin, D. R. (1991): Progress toward a cognitive ethology. In: Ristau, C.A. (Hrsg.): Cognitive ethology. The minds of other animals. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 3–33. Griffin, D. R. (1992): Animal minds. Chicago und London: The University of Chicago Press. Hamilton, W. D. (1964): The genetical evolution of social behaviour. J. theor. Biol. 7: 1–52. Hare, B.; Call, J.; Tomasello, M. (2001): Do chimpanzees know what conspecifics know? Anim. Behav. 61: 139–151. Hasson, O. (1991): Pursuit-deterrent signals: Communication between prey und predator. TREE 6: 325–329. Hauser, M. (2001): Wild minds. What animals really think. London: Penguin Books. Heinroth, K. (1974): Die Geschichte der Verhaltensforschung. In: Grzimeks Tierleben, Ergänzungsband Verhaltensforschung. Zürich: Kindler, pp. 1–15. Heinroth, O. (1910): Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden. Verb. 5. Int. Ornithol-Kongr. Berlin, 589–702. Reproduziert in (1990): Urnwelt. Schri�enreihe für Ökologie und Ethologie, Wien (Verein für Ökologie und Urnweltforschung). Heinroth, O.; Heinroth, M. (1966): Die Vögel Mi�eleuropas. 4 Bde., Frankfurt, Zürich: Nachdruck Harri Deutsch. Hemetsberger, J. (2001): Die Entwicklung der Grünauer Graugansschar seit 1973. In: Kotrschal, K., Müller, G. und Winkler, H. (Hrsg.): Konrad Lorenz und seine verhaltensbiologischen Konzepte aus heutiger Sicht. Fürth: Filander Verlag, pp. 249–260 Heinrich, B. (1989): Die Seele der Raben. München, Leipzig: List. 208 Literaturverzeichnis Hennessy, M. B.; Vogt, J.; Levine, S. (1982): Strain of foster mother determines long-term effects of early handling. Evidence for maternal mediation. Physiol. Psych. 10: 153–157. Hernegger, R. (1976): Der Mensch auf der Suche nach Identität Kulturanthropologische Studien über Totemismus, Mythos, Religion. Sinn- und Identitätsverlust in unserer Zeit. Bonn: Habelt. Hermstein, R. J.; Loveland, D. H.; Cable, C. (1976): Natural concepts in pigeons. J. Exp. Psychol. Anim. Behav. Proc. 2: 285–302. Herrnstein, R. J.; Murray, C. (1994): The bell curve. Intelligence and class structure in american life. N.Y. u.a.: The Free Press. Hinde, R. A. (1966): Animal Behaviour: A synthesis of ethology and comparative psychology. New York: McGraw-Hill. Hinde, R. A. (1982): Ethology. Its nature and relations with other sciences. New York, Oxford: Oxford University Press. Hinde, R. A.; Stevenson-Hinde, J. (1986): Relating childhood relationships to individual characteristics. In: Hartrup, W. W. und Rubin, Z. (Hrsg.): Relationships and development. London: Erlbaum Associates, pp. 27–50. Hirschenhauser, K.; Möstl, E.; Kotrschal, K. (1999a): Seasonal pa�erns of sex steroids determined from feces in different social categories of Greylag geese (Anser anser). General Comp. Endocrinol. 114: 67–79. Hirschenhauser, K.; Möstl, E.; Kotrschal, K. (1999b): Testosterone-co-variation and reproductive output in Greylag geese (Anser anser). Ibis 141: 577–586. Hirschenhauser, K.; Möstl, E.; Péczely, P.; Wallner, B.; Kotrschal, K. (2000): Seasonal relationships between plasma and fecal testosterone in response to GnRH in domestic ganders. Gen. Comp. Endocrinol. 118: 262–272. Hirschenhauser, K.; Frigerio, D.; Grammer, K.; Magnusson, M. S. (2002): Monthly pa�erns of testosterone and behavior in prospective fathers. Horm. Behav. 42: 172–181. Hollard, V. D.; Delius, J. D. (1982): Rotational invariance in visual pa�ern recognition by pigeons and humans. Science 218: 804–806. Holst, von (1998): The concept of stress and it´s relevance for animal behaviour. Adv. in the Study of Behav. 27: 1–131. Holzkamp, K. (1970): Zum Problem der Relevanz psychologischer Forschung für die Praxis. Psychol. Rundschau 21: 1–22. Hunter, F. M.; Petrie, M.; Otronen, M.; Birkhead, T.; Møller, A. P. (1993): Why do females copulate repeatedly with one male? TREE 8: 21–26. Hurst, G. D. D.; Hurst, L. D.; Johnstone, R. A. (1992): Intranuclear conflict und its role in evolution. TREE 7: 373–378. Huxley, J. S. (1914): The courtship habits of the great crested grebe, Podiceps cristalus. Proc. Zool. Soc. Lond. 1914/2: 491–562. Literaturverzeichnis 209 Immelmann, K. (1969): Song development in the zebra finch und other estrildid fiches. In: Hinde, R. (Hrsg.): Bird vocalisations. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 61–81. Immelmann, K. (1982): Wörterbuch der Verhaltensforschung. Berlin, Hamburg: Parey. Immelmann, K. (1983): Einführung in die Verhaltensforschung. München: Parey. Jarman, P. J. (1974): The social organisation of antelope in relation to their ecology. Behaviour 48: 215–267. Judson, O. P. (1994): The rise of the individual-based model in ecology. TREE 9: 9–14. Jü�emann, G. (1992): Psyche und Subjekt. Für eine Psychologie jenseits von Dogma und Mythos. Reinbek: Rowohlt. Kacelnik, A. (1984): Central place foraging in starlings (Sturnus vulgaris). 1. Patch residence time. J. Anim. Ecol. 53: 283–299. Kacelnuik, A.; Krebs, J. R.; Bernstein, C. (1992): The ideal free distribution and predator-prey populations. TREE 7: 50–55. Kalas, S. (1977): Ontogenie und Funktion der Rangordnung innerhalb einer Geschwisterschar von Graugänsen (Anser anser L.). Z. Tierpsychol. 45: 174–198. Kamil, A. C. (1998): On the proper definition of cognitive ethology. In: R. P. Balda, I. M. Pepperberg und A. C. Kamil (Hrsg.): San Diego u.a.: Academic Press, pp. 1–28. Kandel, E. R.; Schwartz, J. H.; Jessell T. M. (19913): Principles of neural science. New York u. a.: Elsevier. Kenward, R. E. (1978): Hawks und doves: factors affecting success und selection in goshawk a�acks on wood-pigeons. J. Anim. Ecol. 47: 449–460. Keverne, B. (2001): Genomic imprinting and maternailism. Advances Ethol., Suppl. 36: 6. Köhler, W. (1963): Intelligenzprüfung an Menschenaffen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer (Neudruck der Ausgabe 1921). Köhler, W. (19272): The mentality of apes. London: Kegan Paul, Trench, Trubner und Co. König, O. (Hrsg.) (1988): Oskar Heinroth, Konrad Lorenz: Wozu aber hat das Vieh diesen Schnabel. Briefe aus der frühen Verhaltensforschung 1930–1940. München: Piper. Koolhaas, J. M.; Korte, S. M.; DeBoer, S. F.; VanDerVegt, B. J.; VanReenen, C. G.; Hopster, H.; DeJong, I. C.; Ruis, M. A. W.; Blokhuis, H. J. (1999): Coping styles in animals: Current status in behaviour and stress-physiology. Neurosci. Biobehav. Rev. 23: 925–935. Kotrschal, K. (1987): Evolutionary pa�erns in tropical marine reef fish feeding. Z. zool. Syst. Evolut.-Forsch. 26: 51–64. 210 Literaturverzeichnis Kotrschal, K. (1989): Trophic ecomorphology in eastern Pacific blennioid fishes: character transformation of oral jaws and associated change of their biological roles. Env. Biol. Fish. 24: 199–218. Kotrschal, K.(1991): Solitary Chemosensory Cells – taste, common chemical sense or what? Rev. Fish Biol. New Series, 1: 3–22. Kotrschal, K. (1995): Ecomorphology of solitary chemosensory cell systems in fish: a review. Env. Biol. Fish 44: 143–155. Kotrschal, K. (1996): Solitary chemosensory cells: why do primary aquatic vertebrates need another taste system? TREE 11: 110–114. Kotrschal, K. (2001): Das Rousseausche Vorurteil vom »edlen Wilden«: Die Wurzeln der Ethik von Konrad Lorenz. In: Kotrschal, K., Müller, G. und Winkler, H. (Hrsg.): Konrad Lorenz und seine verhaltensbiologischen Konzepte aus heutiger Sicht. Fürth: Filander, pp. 109–117. Kotrschal, K. (2001): Österreichische Beiträge zur Verhaltensbiologie und zum evolutionären Menschenbild. In: Acham, K. (Hrsg.): Geschichte der österreichischen Humanwissenscha�en. Bd. 3.1: Menschliches Verhalten und gesellscha�liche Institutionen: Einstellung, Sozialverhalten, Verhaltensorientierung. Wien: Passagen, pp. 51–82. Kotrschal, K.; Goldschmid, A. (1983): Food preferences, morphology and arrangement of teeth in 14 species of Adriatic blennies (Pisces, Telecostei). Thalassia Jugoslavica 19: 217–219. Kotrschal, K.; Thomson, D. A. (1986): Feeding patterns in eastern tropical Pacific blennioid fishes (Teleostei: Tripterygiidae, Labrisomidae, Chaenopsidae, Blenniidae). Oecologia (Berl.) 70: 367–378. Kotrschal, K.; Adam, H.; Brandstätter, R.; Junger, H.; Zaunreiter, M.; Goldschmid, A. (1990): Larval size constraints determine directional ontogenetic shi�s in the visual system of teleosts. A mini-review. Z. Zool. Syst. Evolut.-forsch. 28: 166–182. Kotrschal, K.; Palzenberger, M. (1991): Neuroecology of cyprinids (Cyprinidae, Teleostei): Comparative, quantitative histology reveals diverse brain patterns. Env. Biol. Fish. 33: 135–152. Kotrschal, K.; Hemetsberger, J.; Dittami, J. (1992): Vigilance in a flock of semi-tame greylag geese (Anser anser in response to approaching eagles (Haliaeetus albicilla and Aquila chrysaetos). Wildfowl 43: 215–219. Kotrschal, K.; Hemetsberger, J.; Di�ami, J. (1993): Food exploitation by a winter flock of greylag geese: Behavioral dynamics, strategies and social implications. Submi�ed: Behav. Ecol. Sociobiol. 33: 289–295. Kotrschal, K.; Van Staaden, M. J.; Huber, R. (1998): Fish brains: evolution and ecological relationships. J. Fish Biol. Fish. 8: 1–36. Kotrschal, K.; Hirschenhauser, K.; Möstl, E. (1998): The relationship between social stress and dominance is seasonal in Greylag geese. Anim. Behav. 55: 171–176. Literaturverzeichnis 211 Kotrschal, K.; Hirschenhauser, K.; Möstl, E.; Wallner, B.; Péczely, P. (2000): Effects of challenges and season on fecal testosterone and corticosterone in male domestic geese. Acta Ethologica 2: 115–122. Kotrschal, K.; Bugnyar, T.; Stöwe, M. (2001a): Kognition und Neophobie bei Raben. Charadrius 37: 127–134. Kotrschal, K.; Müller, G.; Winkler, H. (Hrsg.) (2001b): Konrad Lorenz und seine verhaltensbiologischen Konzepte aus heutiger Sicht. Fürth: Filander. Krebs, J. R.; Davies, N. B. (19974): Behavioural ecology. An evolutionary approach. London: Blackwell Scientific. Krebs, J. R.; Davies, N. B. (19933): An introduction to behavioural ecology. Oxford: Blackwell Scientific. Krebs, J. B.; Kacelnik, A. (199l3): Decision-making. In: J. R. Krebs, N. B. Davies (Hrsg.): Behavioural ecology: An evolutionary approach. Oxford: Blackwell Scientific Publications, pp. 105–136. Kuhn, T. S. (19815): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt: Suhrkamp. Kummer, H. (1992a): Weiße Affen am Roten Meer. München: Piper. Kummer, H. (1992b): Werkzeugtradition bei Makaken (Film). 13. Ethologentreffen, Prag. Kuttner, P. (1989): Leidenschaften. Eine Psychoanalyse der Gefühle. Reinbek: Rowohlt. Lamprecht, J. (1972): Verhalten. Grundlagen – Erkenntnisse – Entwicklung der Ethologie. Freiburg, Basel, Wien: Herder (Studio visuell). Lamprecht, J. (1981): Es bleiben viele Fragen offen: Sinn und Unsinn der Unterscheidung zwischen angeborenen und erworbenen Merkmalen. Bayrische Schule 34: 581–592. Lamprecht, J. (1986a): Structure und causation of the dominance hierarchy in a flock of barheaded geese (Anser indicus). Behaviour 96: 28–48. Lamprecht, J. (1986b): Social dominance und reproductive success in a goose flock (Anser indicus). Behaviour 97: 50–65. Lamprecht, J. (1987): Female reproductive strategies in barheaded geese (Anser indicus): Why are geese monogamous? Behav. Ecol. Sociobiol. 21: 297–305. Lamprecht, J. (1991): Factors influencing leadership: A study of goose families (Anser indicus). Ethology 89: 265–274. Lamprecht, J. (19992): Biologische Forschung: Von der Planung bis zur Publikation. Fürth: Filander. Lamprecht, J. (1992): Variable leadership in barheaded geese (Anser indicus): An analysis of pair und family departures. Behaviour 122: 105–120. Lamprecht, J. (1993a): Rezension zu: Zippelius, H.-M.: Die vermessene Theorie. Ethology 95: 257–259. 212 Literaturverzeichnis Lamprecht, J. (1993b): Sind die Ergebnisse von Niko Tinbergen Artefakte? Biologie in unserer Zeit 93(5): 67–69. Lehrman, D. S. (1953): A critique of Konrad Lorenz‘s theory of instinctive behaviour. Ouart. Rev. Biol. 28: 337–363. Lehrman, D. S. (1970): Semantic und conceptual issues in the nature-nuture problem. In: Aronson, L. R., Tobach, E., Lehrman, D. S. und Rosenbla�, J. S. (Hrsg.): Development and Evolution of Behavior. New York: Freeman, pp. 17–52. Leyhausen, P. (1965): Über die Funktion der relativen Stimmungshierarchie (dargestellt am Beispiel der phylogenetischen und ontogenetischen Entwicklung des Beutefangs von Raubtieren). Z. Tierpsychol. 22: 412–494. Lloyd Morgan (1894): An Introduction to Comparative Psychology. London: Sco�. Lorenz, A. (1965): Wenn der Vater mit dem Sohne. Wien: Deuticke. Lorenz, K. (1935): Der Kumpan in der Umwelt des Vogels. J. Ornithol. 83: 137–213, 289–413. Lorenz, K. (1940): Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens. Z. Angew. Psychol. Charakterkunde 59: 56–75. Lorenz, K. (1941): Vergleichende Bewegungsstudien an Anatinen. Suppl. J. Ornith. 89: 194–294. Lorenz, K. (1943): Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung. Z. Tierpsychol. 5: 235–409. Lorenz, K. (1963): Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. Wien: Borotha-Schoeler. Lorenz, K. (1966): Evolution and Modification of Behaviour. London: Methuen. Lorenz, K. (1967): Die instinktiven Grundlagen menschlicher Kultur. In: K. Lorenz, Hrsg. (1978): Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen. München: Piper, pp. 246–274. Lorenz, K. (1973a): Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. München: Piper. Lorenz, K. (1973b): Die Rückseite des Spiegels. München: Piper. Lorenz, K. (1978): Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie. Wien: Springer Verlag. Lorenz, K. (1985): My family und other animals. In: Dewsbury, D.A. (Hrsg.): Leaders in the study of animal behavior: Autobiographical perspectives. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, pp. 258–287. Lorenz, K. (1988): Hier bin ich – wo bist du? Ethologie der Graugans. München: Piper. Lorenz, K. (Hrsg. A. von Cranach) (1992): Die Naturwissenscha� vom Menschen. Eine Einführung in die vergleichende Verhaltensforschung. Das »Russische Manuskript«. München: Piper. Literaturverzeichnis 213 Lorenz, K.; Tinbergen, N. (1939): Taxis und Instinkthandlung in der Eirollbewegung der Graugans 1. Z. Tierpsychol. 2: 1–29. Lorenz, K.; Kalas, S.; Kalas, K. (1979): Das Jahr der Graugans. München: Piper. Lorenz, K.; Okawa, K.; Kotrschal, K. (Hrsg.) (1998): Non-anonymous, collective territoriality in a fish, the moorish idol (Zanclus cornutus): agonistic and appeasement behaviours (commented unpubl. manuscript of Konrad Lorenz from February 1979). Evolution and Cognition 4: 108–135. Lo�, D. F. (1991): Intraspecific variation in the social systems of wild vertebrates. Cambridge u.a.: Cambridge University Press. Manning, A.; Stamp-Dawkins, M. (1992 4): Animal behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. Marler, P. (1984): Song learning: innate species differences in the learning process. In: Marler, P. und Terrace H. S. (Hrsg.): The biology of learning. New York: Springer. Marler, P. (1994): Social cognition: are primates smarter than birds? J. Ornithol. 135: 455. Martin, P.; Bateson, P. (19932): Measuring behaviour. An introductory guide. Cambridge: Cambridge University Press. Maturana, H. R.; Varela, F. J. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern, München: Scherz. Mausz, B.; Di�ami, J.; Kotrschal, K. (1992): Triumphgeschrei und Aggression bei der Graugans (Anser anser). Ökol. Vögel 14: 165–172. Maynard Smith, J. (1974): Models in ecology. Cambridge: Cambridge University Press. Maynard Smith, J. (1976): Evolution and the theory of games. Am. Sci. 64: 41–45. McFarland, D. (1989): Biologie des Verhaltens. Evolution, Physiologie, Psychobiologie. Weinheim: VCH. McFarland, D.; Huston A. (1981): Quantitative ethology: The state space approach. Boston, London: Pitmann. Milinski, M. (1985): Stichlinge optimieren einen Kompromiß zwischen Schwarmbejagung und Feindvermeidung. In: Franck, D.: Verhaltensbiologie. Einführung in die Ethologie. Stu�gart: Thieme, pp. 258–261. Milinski, M. (1988): Games fish play: making decisions of a social forager. TREE 3: 325–330. Møller A. (1988): Female choice selects for male sexual tail ornaments in the monogamous swallow. Nature (Lond.) 332: 640–642. Møller A. (1994): Sexual selection and the barn swallow. Oxford: Oxford University Press. Munn, C. A. (1986): Birds that »cry wolf«. Nature 319: 143–145. 214 Literaturverzeichnis Musi, B.; De Acetis, L.; Alleva, E. (1993): Influence of li�er gender composition on subsequent maternal behaviour and maternal aggression in female house mice. Ethology 95: 43–53. Nelson, R. J. (2000): An introduction to behavioural endocrinology. Zweite Ausgabe. Sunderland, Mass.: Sinauer. Neumann, J. von; Morgenstern, O. (1944): Theory of games und economic behavior. Princeton, NY: Princeton University Press. Newton, I. (Hrsg.) (1989): Lifetime reproduction in birds. London u.a.: Academic Press. Oeser, E. (1992): The evolution of ethology. Evol. Cogn. 2: 101–113. Panksepp, J. (1989): The neurobiology of emotions: of animal brains und human feelings. In: Wagner, H. und Manstead, A. (Hrsg.): Handbook of social psychophysiology. Chichester: J. Wiley und Sons, pp. 5–26. Panksepp, J. (1998): Affective neuroscience. The foundations of human and animal emotions. N.Y., Oxford: Oxford University Press. Pepperberg, I. (1991): A communicative approach to animal cognition: a study of conceptual abilities of an African grey parrot. In: Ristau, C. A. (Hrsg.): Cognitive ethology. The minds of other Animals. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 153–186. Pepperberg, I. (1999): The Alex studies. Cognitive and communicative abilities of grey parrots. Cambridge u.a.: Harvard University Press. Petrie, M.; Møller A. P. (1991): Laying eggs in others‘ nests: Intraspecific brood parasitism in birds. TREE 6: 315–320. Pfeffer, K.; Fritz, J.; Kotrschal, K. (2002): Hormonal correlates of being an innovative greylag goose. Anim. Behav. 63: 687–695. Pietrewicz, A. T.; Kamil, A. C. (1981): Search images und the detection of cryptic prey: an operant approach. In: A.C. Kamil und T. D. Sargent (Hrsg.): Foraging behavior: Ecological, ethological und physiological approaches. N.Y.: Garland STPM Press, pp. 311–332. Pimm, S. L. (1991): The balance of nature. Ecological issues in the conservation of species and communities. Chicago, London: The University of Chicago Press. Pitcher, T. J. (1986): Functions of shoaling behaviour in teleosts. In: Pitcher, T. J. (Hrsg.): The behaviour of teleost fishes. London, Sydney: Croom Helm, pp. 294–337. Popper, K. R. (1974): Objective knowledge, an evolutionary approach. Oxford: Clarendon Press at the Oxford University Press. Popper, K. R. (19762): The poverty of historicism. London: Routledge and Kegan Paul. Poundstone, W. (1992): Prisoners dilemma. New York u.a.: Anchor Books, Doubleday. Literaturverzeichnis 215 Power, M. (1988): The cohesive foragers: Human and chimpanzee. In: Chance, M. R. A. (Hrsg.): Social fabrics of the mind. Hillsdale, London: Lawrence Erlbaum Publishers, pp. 75–103. Power, M. E. (1984): Depth distribution of armored catfish: predatorincreased resource avoidance? Ecology 65: 523–528. Riedl, R. (1981a): Biologie der Erkenntnis. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernun�. Berlin, Hamburg: Parey. Riedl, R. (1981b): Die Folgen des Ursachendenkens. In: WatzIawick, P. (Hrsg.): Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. München: Piper. Riedl, R. (1984): Die Strategie der Genesis. München: Piper. Ristau, C. A. (Hrsg.) (1991): Cognitive ethology. The minds of other animals. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates. Rutschke, E. (1997): Wildgänse. Lebensweise, Schutz, Nutzung. Berlin: Parey. Saal, F. S. vom (1979): Prenatal exposure to androgen influences morphology und aggressive behavior of male und female mice. Horm. Behav. 12: 1–11. Savage-Rumbaugh, E. S. (1986): Ape language: From conditioned response to symbol. N.Y.: Columbia University Press. Schiefenhövel, W.; Uher, J.; Krell, R. (1993): Im Spiegel der anderen. München: Realis. Schleidt, W. M. (1961): Reaktionen von Truthühnern auf fliegende Raubvögel und Versuche zur Analyse ihrer AAM‘s. Z. Tierpsychol. 18: 534–560. Schleidt, W. M. (1984): Wie der Computer »Miau« auf deutsch übersetzt. In: Kreuzer, F. (Hrsg.): Nichts ist schon dagewesen. München: Piper. Schleidt, W. M. (2001): Politik gegen und mit Konrad Lorenz. In: Kotrschal, K., Müller, G. und Winkler, H. (Hrsg.): Konrad Lorenz und seine verhaltensbiologischen Konzepte aus heutiger Sicht. Fürth: Filander, pp. 73–92. Science Research News Articles (1992): The evolution of the sexes. Science 257: 324–330. Schwabl, H.; Mock, D. W.; Gieg, J. A. (1997): A hormonal mechanism for parental favouritism. Nature 386: 231. Scientific American (1979): The Brain. (Scientific American Inc.) Shepherd, G. M. (1983): Neurobiology. N.Y., Oxford: Oxford University Press. Shettleworth, S. J. (1998): Cognition, evolution and behaviour. N.Y., Oxford: Oxford University Press. Skinner, B. F. (1938): The behavior of organisms. N.Y.: Appleton-Century-Cro�s. Skinner, B. F. (1971): Beyond freedom and dignity. N.Y.: Knopf. Smith, R. L. (1984): Human sperm competition. In: Smith, R. L. (Hrsg.): Sperm competition and the evolution of animal mating systems. N.Y.: Academic Press. 216 Literaturverzeichnis Sockman, K. W.; Schwabl, H. (2000): Yolk androgens reduce offspring survival. Proc. R. Soc. Lond (B) 267: 1451–1456. Staddon, J. E. R. (1989): Animal psychology: the tyranny of anthropocentrism. In: P. P. G. Bateson und P. H. Klopfer (Hrsg.): Perspectives in ethology. Bd. 8. Whither ethology? N.Y., London: Plenum Press, pp. 123–134. Stamp-Dawkins, M. (1989): The future of ethology: how many legs are we standing on? In: P. P. G. Batson und P. H. Klopfer (Hrsg.): Perspectives in ethology. Bd. 8. Whither ethology? N.Y., London: Plenum Press, pp. 47–54. Stamp-Dawkins, M. (1994): Die Entdeckung des tierischen Bewußtseins. Heidelberg u.a.: Spektrum Akademischer Verlag. Stamps, J. (1991): Why evolutionary issues are reviving interest in proximate behavioral mechanisms. Amer. Zool. 31: 338–348. Sulloway, F. J. (1996): Born to rebel. Birth order, family dynamics and creative lifes. London: Li�le, Brown and Company. Sutherlund, W. J.; Parker, S. A. (1985): Distribution of unequal competitors. In: R. M. Sibly und R. H. Smith (Hrsg.): Behavioural ecology: ecological consequences of adaptive behaviour. Oxford: Blackwell Scientific, pp. 255–274. Tembrock, G. (1962): Grundlagen der Tierpsychologie. Berlin: Akademie-Verlag. Ten Cate, C. (1989): Behavioral development: toward understunding processes. In: P. P. G. Bateson und P. H. Klopfer (Hrsg.): Perspectives in ethology. Bd. 8. Whither ethology? N.Y., London: Plenum Press, pp. 243–266. Thornhill, R.; Thornhill, N. W. (1992): The evolutionary psychology of men‘s coercive sexuality. Behavioral und Brain Sci. 15: 363–421. Tinbergen, N. (1948): Social releasers und the experimental method required for their study. Wilson Bull. 60: 6–52. Tinbergen, N. (1949): De functie van de rode vIek op de snavel van de zilvermeeuw. Bijdragen tot de Dierkunde 28: 453–465. Tinbergen, M. (1953a): The study of instinct. London: Oxford Univ. Press. Tinbergen, N. (1953b): The herring gull‘s world. A study of the social behaviour of birds. London: Collins. Deutsche Ausgabe (1979): Instinktlehre. Vergleichende Verhaltensforschung angeborenen Verhaltens. Berlin, Hamburg: Parey. Tinbergen, N. (1963): On aims and methods of ethology. Z. Tierpsychol. 20: 410–433. Tinbergen, N.; Kruyt, W. (1938): Ober die Orientierung des Bienenwolfes (Philantus triangulum Fabr.) Ill. Die Bevorzugung bestimmter Wegmarken. Z. vgl. Physiol. 25: 292–334. Tinbergen, N.; Perdeck, A. C. (1950): On the stimulus situation releasing the begging response in the newly hatched herring gull chick (Larus argentatus Pont.). Behaviour 1: 56–63. Literaturverzeichnis 217 Tintner, A.; Kotrschal, K. (2002): Early social influence on nestling development in Waldrapp ibises Geronticus eremita. Zoo Biology 21: 467–480. Tipler, F. J. (1994): Die Physik der Unsterblichkeit. München: Piper. Uexküll, J. von (1934): Streifzüge durch die Urnwelten von Tieren und Menschen. Berlin: Springer. Voland, E. (2000): Grundriß der Soziobiologie. Heidelberg, Berlin: Spektrum/ Gustav Fischer. de Waal, F. (1983): Unsere haarigen Ve�ern. München: Harnack. de Waal, F. (1997): Der gute Affe. Der Ursprung von Recht und Unrecht bei Menschen und anderen Tieren. München, Wien: Carl Hanser. Waldenberger, F.; Kotrschal, K. (1993): Das individuelle Sicherverhalten bei männlichen Graugänsen (Anser anser) ist von der Schardichte und vom sozialen Status abhängig. Ökol. Vögel 15: 193–199. Walther, C. (1980): Untersuchungen zum Futteraufahmeverhalten der Graugans (Anser anser L.). Diplomarbeit Univ. Hohenheim und Osterr. Akad. Wiss., Inst. vgl. Verhaltensforsch. Abt. 4, Tiersoziologie. Watson, P. J.; Thornhill, R. (1994): Fluctuating asymmetry und sexual selection. TREE 9: 21–25. Weigmann, C.; Larnprecht, J. (1991): Intraspecific nest parasitism in bar- headed geese, Anser indicus. Anim. Behav. 41: 677–688. Whalen, R. E. (1982): Current issues in the neurobiology of sexual differentiation. In: A. Vernadkis und P. S. Timiras (Hrsg.): Hormones in developing and ageing. N.Y.: Spectrum, pp. 273–304. Whiten, A.; Byrne, R. W. (1997): Macciavellian Intelligence II. Cambridge: Cambridge University Press. Whitman, C. O. (1898): Animal behavior. Biol. Lect. Mar. Biol. Lab. (Woods Hole, Mass.), 285–338. Whitman, C. O. (1919): The behavior of pigeons. Publ. Carnegie Inst. 257: 1–161. Wickler, W.; Seibt, U. (1977): Das Prinzip Eigennutz. Hamburg: Hoffmann und Campe. Wickler, W.; Seibt, U. (19842): Männlich – Weiblich. Der große Unterschied und seine Folgen. München: Piper. Willi, J. (1975): Die Zweierbeziehung. Spannungsursachen, Störungsmuster, Klärungsprozesse, Lösungsmodelle. Reinbek: Rowohlt. Wilson, E. O. (1975): Sociobiology: The new synthesis. Harvard: Belknap Press. Wilson, E. O. (1986): Biophilia. Harvard: Harvard University Press. Wi�e, K. (1993): Replik zum Buch »Zippelius, H.-M. (1992): Die vermessene Theorie«. Mi�eilungsbla� der Ethol. Gesellscha� e.V. 31: 9–13. 218 Literaturverzeichnis Wuketits, F. M. (1990): Konrad Lorenz. Leben und Werk eines großen Naturforschers. München: Piper. Wuketits, F. M. (1993): Verdammt zur Unmoral? Zur Naturgeschichte von Gut und Böse. München: Piper. Wynne-Edwards, V. C. (1962): Animal dispersion in relation to social behaviour. Edinburgh: Oliver and Boyd. Zahavi, A. (1984): Mate selection—a selection for a handicap. J. Theoret. Biol. 53: 205–214. Zahavi, A.; Zahavi, A. (1997): The handicap principle. Oxford: Oxford University Press. Zippelius, H.-M. (1992a): Die vermessene Theorie. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Instink�heorie von Konrad Lorenz und verhaltenskundlicher Forschungspraxis. Wiesbaden: Vieweg. Zippelius, H.-M. (1992b): Schlüsselreize – ja oder nein? Biologie Heute 51 92: 1–5. Glossar Aggression: Drohungen oder Angriffe gegen → Artgenossen zur Verteidigung von → Ressourcen oder → Status. Angriffe gegen Beute dagegen sind nicht aggressiv → motiviert. agonisch: Dominanzhierarchisch strukturierte Gesellscha�en (z. B. Schimpansen oder Menschen: Chance 1988). Entstehen auf der Basis von ungleichmäßig verteilten, verteidigbaren → Ressourcen. Siehe auch → hedonisch. Allele: Modifikationen → homologer → DNS-Sequenzen, die unterschiedliche Merkmalsausbildung kodieren. Alternative Paarungsstrategie: (bezogen auf das Hauptpaarungssystem) Zum Beispiel Beimännchen (nicht territoriale, sich Befruchtungen erschleichende Männchen) in einem System territorialer, → polygyner Männchen, oder → Seitensprünge bei → Monogamen. Altruismus: Selbstlose Hilfeleistung, Selbstaufopferung. Vermindert die eigene → Fitness. Im Rahmen der gegenwärtigen Theorie nur innerhalb von genetisch Verwandten (siehe → Nepotismus, → Verwandtenselektion). analog: Merkmale (körperliche, Verhaltens- oder physiologische), deren Ähnlichkeit nicht auf → stammesgeschichtlich oder → ontogenetisch gleicher Herkun�, sondern auf Funktionsähnlichkeit, also konvergenter → evolutionärer → Anpassung beruht. Zum Beispiel Schwanzflossen Fisch–Wal. Andostenon: Männlicher Duftstoff, ausgeschieden z. B. über die Duftdrüsen unter der Achsel. Beeinflusst offenbar in Abhängigkeit vom weiblichen Zyklus die Wahrnehmung möglicher Partner durch Frauen. Andostenongeruch wird um den Eisprung von Frauen eher positiv beurteilt, außerhalb dagegen als unangenehm empfunden (Grammer). angeboren: Innerhalb einer Art stereotyp gezeigte Verhaltensweisen gelten insbesondere dann als genetisch fixiert, wenn sie auch von → KasparHauser-Individuen gezeigt werden. Da aber keine Verhaltensweisen gänzlich ohne Einfluss der Umwelt reifen, spricht man heute eher von → »erblich«. angeborener Lehrmeister: Lorenzscher Begriff für → Lerndispositionen (stammesgeschichtlich bedingtes Interesse, Lernbereitscha�en und neuronale Substrate) zur Erklärung des Umstandes dass → Lernen die Eignung verbessert, 220 Glossar Gegenposition zur → tabula rasa der → Behavioristen. Peter Marler prägte dafür den Begriff »Instinct to learn«. Antrieb, Trieb: Stärke der → Motivation, bestimmte, meist → instinktive Verhaltensweisen zu zeigen. Appetenz: Aktives Anstreben, Aufsuchen von → Reizsituationen (z. B. Beutesuche). Siehe auch → Endhandlung. Arenabalz: Gruppen von Männchen balzen gemeinsam, Weibchen suchen sich nach bestimmten Kriterien aus der Ansammlung Männchen zur Kopulation aus, bekommen nur Gene, keine sonstigen → Ressourcen. Art (biologische): Verschiedenste Definitionen, z. B.: Innerartliche (→ genotypische und → phänotypische) Variation von Merkmalen größer als zwischenartliche. Oder: Reproduktionsgemeinscha�: innerartliche Barrieren geringer als zwischenartliche. Arterhaltungswert: Unter der heute als unzutreffend erkannten → gruppenselektionistischen → Theorie war jenes Verhalten Ergebnis der -Selektion, welches dem »Überleben der → Art« diente (z. B. ritualisiertes Kämpfen). Heute weiß man, dass Verhaltensweisen und → Strategien zur Maximierung der eigenen → Fitness → selektionierten; die »Erhaltung der Art« ist ein Sekundäreffekt. Asymmetrie, fluktuierende: Die beiden Körperseiten von bilateralsymmetrischen Organismen sind niemals exakt gleich, sondern aufgrund verschiedener (genetischer oder umweltbedingter) Stressfaktoren während der → Individualentwicklung immer mehr oder weniger asymmetrisch ausgebildet. Unter anderem: indirektes Maß für Inzucht. In einigen Fällen konnte gezeigt werden, dass symmetrische Paarungspartner bevorzugt werden. Ausbeutungskonkurrenz: Individuen monopolisieren → Ressourcen nicht (über → Aggression, bzw. → Dominanz), sondern sind unterschiedlich effizient in deren Ausbeutung. Auslese: Siehe → natürliche und → sexuelle Selektion. Auslösemechanismus (AM), angeborener Auslöser (AAM): Spezifischer Reiz, der eine bestimmte → Erbkoordination auszulösen imstande ist. Grad an Spezifität kann von Fall zu Fall stark variieren, kann erlernt oder → erblich sein, setzt sich meist aus beiden Komponenten zusammen. Siehe auch → Schlüsselreiz. Glossar 221 Bahnung: Veränderung der Durchgängigkeit → synaptischer Verbindungen zwischen Nervenzellen durch Gebrauch (Hebbsche Synapse). → Synapsen, an denen häufig → Signalübertragung sta�findet, werden strukturell verstärkt (vermehrte Einlagerung von → Rezeptormolekülen in die Membranen). Bahnung wird im Zusammenhang mit → Lernen diskutiert. Bedingter Reflex: Durch Iwan Pawlow beschriebener → Lernvorgang bei dem ein zunächst irrelevanter Reiz zum → Auslöser eines Reflexes (auch → Erbkoordination) wird (Beispiel: Speichelflussreflex des Hundes). Behavioristen (Behaviorisms): Schule US-amerikanischer Experimentalpsychologen, deren extremste Vertreter (z. B. Skinner) die → stammesgeschichtlichen (→ erblichen) Einflüsse bestri�en und behaupteten, dass alles Verhalten erlernt sei und Individuen als → tabula rasa zur Welt kämen. Biologie: Wissenscha� und Lehre vom Leben, von seinen molekularen Grundlagen über die Organismen bis zur Ausformung sozialer und kultureller Systeme, auf Basis der → Darwinschen → Evolutions→theorie. Biologismus: Vereinfachendes oder manipulatives Umlegen biologischer Prinzipien auf menschliche Sozialsysteme und Kultur. Der Vorwurf des »Biologismus« wird gelegentlich von Nicht-Biologen auch ernsthaften Versuchen entgegengehalten, menschliches Verhalten von seiner evolutionären Basis her zu erklären, wird auch dazu benutzt, Biologen von der vermeintlich geisteswissenscha�lichen Domäne der Kultur fernzuhalten. black box: Zwischen (Reiz-)Input und (Verhaltens-)Output liegender Organismus oder System, dessen interne Funktionen aber nicht Gegenstand der Untersuchung sind. Chromosom: Verpackungseinheit der → Gene im Zuge der Zellteilung. Coping style: lebenslang individuell relativ stabile Art, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen (Koolhaas u.a. 1999), s. auch → Persönlichkeit, → Temperament. Corticosteroide: Vor allem aus der Nebennierenrinde stammende → Steroidhormone (z.B. Kortisol, Kortikosteron) mit vielfältigen Wirkungen, insbesonders Aktivierung von Energie im Zusammenhang mit dem Stressgeschehen. 222 Glossar Darwinismus: Auf der Darwinschen → Evolutions→theorie beruhende Lehre der → stammesgeschichtlichen Veränderung der → Arten. Beruht auf → individuellerVariation, die wiederum gemeinsam mit zufälligen Mutationen die Basis für → Selektion und damit der Veränderung von Gen(→Allel)frequenzen über die Generationen darstellt. Deduktion: Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere. Erklärung der Phänomene der Welt auf Basis bereits bestehender → Theorien. Siehe auch → Induktion. Disposition: Veranlagung, → stammesgeschichtliches Erbe. DNS: Desoxyribonukleinsäure. Aus vier Grundbausteinen (Basen) aufgebaute Molekülkette, die in linearem Code die Information zur Synthese aller Eiweißbausteine des Lebens enthält. Der Großteil der DNS ist in den Zellkernen, meist in doppelter (diploider) Ausführung enthalten, Reifeteilung führt zur Bildung der Geschlechtszellen mit einfachem (haploidem) Chromosomensatz. Selbständige Stücke von Erbinformation finden sich aber auch in manchen Zellorganellen. Siehe auch → Symbiontentheorie. Dogmatismus: Angewandte → Deduktion. Inflexibles Festhalten an Ideologien oder Glaubenslehrsätzen, z. B. auch gegen die Ergebnisse der Naturwissenscha�en. Domestikation: Haustierwerdung durch veränderte Selektionsbedingungen. Geht mit Instinktabschwächung, besserer Handhabbarkeit und Leistung, als der Wildtyp, mit Hypersexualität und auch einem verkleinertem Vorderhirn einher. Früher wurden Haustiere oft als degenerierte Mängelwesen gesehen, die nur mehr im Hausstand überleben können. Heute betrachtet man Haustiere als an den Hausstand angepasst und m.H. des Vektors Mensch o� erstaunlich erfolgreiche Arten. Dominanz (soziale): Ermöglicht Zugang zu kritischen → Ressourcen, wird meist → aggressiv erstri�en. Siehe auch → Prestige und → Rang. Emotionen: Stimmungslagen, die maßgeblich Verhalten modulieren. Wichtige → Motivationsgrundlagen, Antriebe für (unbewusste) evolutionäre Strategien. Aufgrund ihrer → Subjektivität nur an den resultierenden Verhaltensweisen erkennbar. Grund-Emotionssysteme sind offenbar ein gemeinsames → stammesgeschichtliches Erbe der Wirbeltiere. Glossar 223 Endhandlung: Nach → Appetenz und → Reiz ausgeführtes Verhalten; o� stereotype Verhaltensweise (→ Erbkoordination, → Instinkt) Entropie: Zerfall von Ordnung unter Abgabe von Energie (→ Negentropie). Entscheidung: Der Zwang zur → Optimierung veranlasst Lebewesen ständig, Entscheidungen zwischen Alternativen zu treffen (z. B. fressen oder flüchten); dies impliziert nicht die Beteiligung höherer → kognitiver Prozesse oder des Bewusstseins. Entwicklungspsychologie: Beschäftigt sich mit den dynamischen Veränderungen von Psyche, Wahrnehmung und Verhaltensbereitscha�en des Subjekts während der → Individualentwicklung. Epigenetik: »Vererbung« von Merkmalen am Genom vorbei, etwa über mü�erliche Hormone, Erziehungsstile, usw. S. auch → mü�erlicher Einfluss. Erbkoordination: Auch → angeborene, besser aber, hochgradig → erbliche Verhaltensweise, → Instinkt. Von Lorenz u.a. als Bausteine des Verhaltens betrachtet, welches Plastizität bezüglich auslösender Reize (→ analog → bedingter Reflex) über die → Instinkt-Dressur-Verschränkung gewinnt. Erblichkeit: Ausmaß der vom → Phänotyp gezeigten Weitergabe von Merkmalen von einer Generation auf die nächste, genetische Bedingtheit. Wird sowohl vom → Genotyp, als auch von der Umwelt beeinflusst, in welcher die → individuelle Entwicklung sta�findet. S. auch → angeboren. Erfolg, evolutionärer: Wird gewöhnlich als Zahl der wieder reproduktiv aktiven Nachkommen ausgedrückt. Siehe auch → Fitness. Erkenntnisapparat: Sinnessysteme zusammen mit den Zentralen Nervensystemen (ZNS) von Tieren einschließlich → erblicher Dispositionen, welche die Wahrnehmung der Welt, sowie die Reaktion auf dieselbe beeinflussen. Naturwissenscha�lich geprägter, daher → mechanistischer, → reduktionistischer und → materialistischer Ausdruck, der die Angepasstheit des ZNS (Ergebnis der → Selektion) betonen soll und seine Zuständigkeit für sämtliche Phänomene des Verhaltens und der Psyche. Ethogramm: Gesamtheit der von einer → Art gezeigten stereotypen Verhaltensweisen (→ Erbkoordinationen, Katalog artspezifischen Verhaltens). Variiert 224 Glossar zwischenartlich stärker als innerartlich, Beleg für die → Erblichkeit von Verhalten. Ethologie: Die auf dem → Darwinismus beruhende → Verhaltensbiologie von Mensch und Tier. Früher meist Bezeichnung für die »klassische«, Lorenz-Tinbergensche Richtung, heute zumeist für das Gesamtfach (einschließlich → Öko-Ethologie und → Soziobiologie) gebraucht. Beruht auf dem Arbeitsprogramm der → »4 Tinbergenschen Ebenen« (Tinbergen 1963). Eugenik: »Rassenhygiene«. Auf unzureichenden genetischen Ergebnissen beruhende Bestrebungen im 19. und 20. Jahrhundert, durch Zuchtwahl die menschliche Erbsubstanz zu »verbessern«. Höhepunkt der grausamen Auswirkungen dieser Idee im Hitler Regime (»Ausmerzung lebensunwerten Lebens«). Zum Teil Wiederbelebung der Ideen im Zuge der Möglichkeiten durch die moderne molekulare Genetik, bis hin zum Klonen von Menschen. Evolution: Prozess und Ergebnis der → stammesgeschichtlichen Veränderung der Lebewesen im Laufe der Erdgeschichte, nach unserem heutigen Verständnis, über den → Darwinschen Mechanismus von Mutation und Selektion. Evolutionäre Erkenntnistheorie: Die von Konrad Lorenz u. Vorläufern begründete und von Rupert Riedl entwickelte Theorie, dass auch unser → Erkenntnisapparat ein in der → Evolution → selektioniertes Überlebenswerkzeug darstellt und uns jene Teile der realen Welt vermi�elt, die in der jahrmillionenlangen Menschwerdung überlebenswichtig waren. Experiment: Einziger Ansatz zum Belegen von → Kausalbeziehungen. Entsprechend einer → Hypothese wird ein einziger Parameter verändert und das Ergebnis beobachtet. Extinktion: Erlöschen, Aussterben von → Arten. Dadurch wird ökologischer Raum frei, in welchen sich neue → Arten hineinentwickeln können. Extinktion ist damit eine der wichtigsten Triebfedern der → Evolution. Feedback: Siehe → Rückkopplungen. Fitness: Maß für den → evolutionären Erfolg, gemessen in Zahl der wieder reproduktiv aktiven Nachkommen. Je ökonomischer Individuen mit den ihnen zur Verfügung stehenden → Ressourcen umgehen, je besser sie Feinde vermeiden, je sozial kompetenter sie sind, desto mehr kön- Glossar 225 nen sie in die Produktion von Nachkommen investieren, um so höher daher ihre Fitness. Gedankenlesen: Jene Fähigkeit von Tieren und Menschen, die Absichten anderer Individuen zu erkennen (etwa zwischen Räubern und Beute), ohne dass sich der (menschliche) Beobachter der damit zusammenhängenden Reize bewusst wird. Gen: Abschni� der → DNA, der genetischen → Information mit bestimmter Funktion (mit → Allelen als verschiedene Varianten davon). Genotyp: Gesamtheit der genetischen → Information eines → Individuums. genetischer Determinismus: Überholte Ansicht, dass sich der → Genotyp quasi 1 : 1 in den → Phänotyp übersetzt, bzw. dass genetische Dispositionen Strukturen, bzw. Verhalten erzwingt. Unterschätzt → Epigenetik und → Ontogenie. Gestalt: Gesamtheit der von Lebewesen bzw. Objekten ausgehenden, bzw. wahrnehmbaren → Reize. Gruppenselektion: Heute kaum mehr vertretene Ansicht, dass die Gruppe die Einheit der → Selektion sei und dass daher Gruppenmitglieder möglichst altruistisch und harmonisch miteinander auskommen sollten. Siehe auch → Individualselektion und → Arterhaltungswert. Handicaptheorie: → Theorie des → Verhaltensbiologen Amoz Zahavi (1984), wonach die Ausbildung der → sekundären Geschlechtsmerkmale der Männchen den Weibchen deswegen die Partnerqualität anzeigt, weil es sich eben nur Männchen mit gutem → Genotyp (Parasitenresistent) und gutem Zugang zu → Ressourcen leisten können, dieses Handicap extravaganter Strukturen (z. B. verlängerte Schwanzfedern) auszubilden. Ganz allgemein erhöhen diese überlebens- und (direkt) → fitnessmindernde Investitionen das → individuelle → Prestige, damit den → Partnermarktwert, damit indirekt die → Fitness. Hausverstandspsychologie: Befasst sich mit den Problemen des Alltags, auch wenn Begriffe nicht eindeutig definierbar sind. Beruht darauf, dass unserer Alltagssprache implizite und allgemein anerkannte Konventionen zugrunde liegen. hedonisch: lustbetont. Zum Beispiel Organisation egalitärer Jäger- und Sammlergesellscha�en (z. B. Schimpansen oder frühe Menschen: Chance 1988), 226 Glossar über positive soziale Interaktionen. Beruht auf gleichmäßig dünn verteilten, nicht verteidigbaren → Ressourcen. Siehe auch → agonisch. Heterotrophe: Organismen, die im Gegensatz zu den Autotrophen (die meisten Pflanzen) nicht die Baustoffe des Körpers synthetisieren können, sondern diese mit der Nahrung aufnehmen müssen. Hippocampus: Alter Teil der Hirnrinde, der mit der Bildung des Langzeitgedächtnisses, bzw. generell mit räumlicher Orientierung im Zusammenhang steht. Holismus: Ganzheitlichkeit. Anzustrebendes Ziel, aber zu meidende Methode der in ihrem Ansatz zwangsläufig → reduktionistischen Naturwissenscha�en. Hat, ähnlich wie früher der Begriff → Instinkt, einen mystischen Beiklang. homolog: → Stammesgeschichtlich herkunftsgleiche Merkmale (körperliche, Verhaltens- oder physiologische), die bei verschiedenen → Arten in unterschiedliche Funktionszusammenhänge geraten können. Zum Beispiel Grei�and der → Primaten - Flügel der Fledermäuse. Hormone: Körperinterne Botenstoffe, regulieren die Ausbildung von Merkmalen, den Stoffwechsel, unter direkter oder indirekter Kontrolle des Gehirns. Schni�stelle zwischen Nerven-und Immunsystem. Humanethologie: → Stammesgeschichtlich vergleichende Untersuchung menschlichen Verhaltens, mit der Beobachtung nichtverbalen Verhaltens als wichtigste Rolle. Fokus auf »menschlichen Universalien« (→ Erbkoordinationen) bzw. evolutionären → Strategien, Partnerwahl, usw. (Eibl Eibesfeldt 1993). Hypothese: Satz, der die → Wirklichkeit beschreibt und durch → Tests falsifiziert werden kann. Ideale freie Verteilung: → Ausbeutungskonkurrenzmodell, das Vorhersagen über die Verteilung der Konkurrenten in Abhängigkeit von der Verteilung der → Ressourcen erlaubt. Ideal: weil vorausgesetzt wird, dass → Individuen im Besitz aller Informationen sind. Frei: weil angenommen wird, dass → individuenvolle Bewegungsfreiheit haben (nicht etwa durch → Dominanzstrukturen oder Räuber eingeschränkt). Idealismus: Baut Weltbilder auf spekulativen Idealen auf, o� an der menschlichen Natur vorbei. Glossar 227 lndividualentwicklung: Ontogenie. Heranreifen des vom befruchteten Ei bis zur Geschlechtsreife in ständiger Kopplung zwischen Umwelteinflüssen, einschließlich → mü�erlichen Einflüssen und differentiellen Genexpression; der Weg vom → Genotyp zum → Phänotyp. Individualselektion: → Individuen sind die Einheit der → evolutionären → Selektion, kaum aber → Gruppen. Daher besteht die stärkste → Konkurrenz um → evolutionären Erfolg zwischen den Gruppenmitgliedern. Siehe auch → Altruismus. Individuum: Diskrete Einheit, dessen Körper aus Zellen mit gleicher Erbinformation besteht; neben den → Genen (→ Allelen) Haupteinheit der → Selektion. Definiert über Phänoptyp, der in der Individualentwicklung entsteht. Induktion: Bilden von allgemeinen Sätzen (→ Hypothesen) aus erhobenen Daten. Basisansatz der Naturwissenscha�en. Siehe auch → Deduktion. Information: Gesamtheit der verfügbaren Umweltreize. Relevanz entsteht durch → stammesgeschichtliche → Disposition, bzw. → Lernen. Siehe auch → Ritualisierung. Informationsparasitismus: Gruppenmitglieder profitieren vom Wissen anderer, meist über das Vorkommen von Ressourcen. inklusive Fitness: Förderung der eigenen → Allele, auch jener, die sich in den Verwandten befinden. Grundlage der Hilfeleistung unter Verwandten. Siehe auch → Nepotismus und → Verwandtenselektion. Instinkt: Unbewusste, innerhalb der → Art stereotype und hochgradig erbliche, evolutionär entstandene Handlungen des Individuums mit bestimmter Funktion einschließlich deren Antrieb; Strukturmerkmal wie körperliche Merkmale. O� deckungsgleich mit → Erbkoordination verwendet; läu� auf → auslösenden → Reiz und/oder bei starker → Motivation ab. Begriff von Lorenz vor allem wegen seines von den → Vitalisten stammenden, mystischen Beigeschmacks vermieden. Instinkt-Dressur-Verschränkung: Lorenz-Tinbergensche Erklärung, wie Verhalten zustande kommt: aus stereotypen Bausteinen (→ Erbkoordinationen, → Instinkte), deren Abfolge und → Reiz(→ Auslöser)Bezug durch Lernen (»Dressur«) modifiziert wird, wodurch sich Verhalten in einer für das → Individuum → adaptive Weise an eine variable Umwelt anpasst. 228 Glossar Intelligenz: generell: Paket an geistiger Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen → kognitiven Domänen (sozial, räumliche Vorstellung, usw.); rasche Kombination gespeicherter Daten, optimiert Verhaltenslösungen für ökologische und soziale Herausforderungen. Setzt stammesgeschichtlich entstanden Lernbereitschaften voraus. s. auch → angeborener Lehrmeister. Interaktionskonkurrenz: Individuen monopolisieren → Ressourcen durch → Aggression bzw. → Dominanz gegenüber ihren Konkurrenten. Inzes�abu: Barriere gegen Sexualität zwischen nahen Verwandten (Eltern-Kinder, Geschwister). Gänse beispielsweise lernen, wie Eltern und Geschwister aussehen, und verpaaren sich dann nicht mit diesen → Individuen. Vermeidet → Inzuchtdepression. Inzuchtdepression: Verlust an Vitalität, Resistenz gegen Parasiten, Fruchtbarkeit, usw. durch Verlust genetischer Variabilität im Zuge der Verpaarung nahe Verwandter. Inzuchtgrad: Ist bei Verpaarung nahe Verwandter hoch, gering dagegen nach Verpaarung Nichtverwandter. Theoretisch sollte der Inzuchtgrad von Populationen in variablen Umwelten gering sein, in stabilen Umwelten dagegen hoch, da Inzucht bewährte Genome erhält. Der Preis dafür kann aber die → Inzuchtdepression sein. Kaspar-Hauser-Versuche: testen → ontogenetische Entwicklung von → Individuen unter (spezifischem) Reizentzug. Treten bestimmte mit dem entzogenen → Reiz in Zusammenhang stehende Verhaltensweisen dennoch auf, dann müssen diese hochgradig → erblich sein. Kausalbeziehung: Direkte Ursachenbeziehung, Wenn-dann-Beziehung. Zur ergründen über → Experimente. klassische Ethologie: Lorenz-Tinbergenscher, mechanistisch und physiologisch orientierter Zweig der → Verhaltensbiologie. Kognition: Datenverarbeitungsmechanismen des Gehirns, s. auch → Intelligenz, o� im Sinne »höherer« geistiger Prozesse gebraucht. Kommunikation: Austausch von → Information. Gezielt durch → Signale des Senders an den Empfänger oder als unvermeidlicher Nebeneffekt des Glossar 229 Verhaltensflusses. Zu gegenseitigem Nutzen, oder um den Widerstand des Empfängers zu überwinden. Konflikt: Interessengegensatz zwischen Individuen. Oft als Ergebnis unterschiedlicher → evolutionärer Strategien (zwischen Paarpartnern, Eltern-Kindern usw.), die → Fitness zu maximieren. Oder auch im Zusammenhang mit → lnteraktionskonkurrenz um → Ressourcen. Konkurrenz: Vor allem zwischen → Individuen einer → Population, um begrenzte → Ressourcen. Siehe auch → Ausbeutungskonkurrenz, → Interaktionskonkurrenz. Kooperation: Zusammenarbeit zum beidseitigen Vorteil. Gewöhnlich entweder unter Verwandten, oder auf Gegenseitigkeit beruhend. Kreationismus: Lehre, wonach die Welt samt ihrem → Arteninventar in der gegenwärtigen Zusammensetzung von einem höheren Wesen erschaffen worden sei. Kreationisten lehnen gewöhnlich die Idee der → evolutionären Dynamik des → Artenwandels ab. Kybernetik: Lehre von Regelungsvorgängen in Technik, → Biologie und → Soziologie. Gebräuchlichstes Instrument zur Bildung von InputOutput-Modellen zur Erklärung des der wesentlichen Elemente von Verhalten. Leadership: Führungskompetenz in Zusammenhang mit Kenntnissen oder Fähigkeiten. Besonders bei → Primaten mit sozialem → Prestige und sozialer Kompetenz verbunden. → Dominanz muss nicht deckungsgleich mit Leadership sein. Kann mit Erfahrung zu tun haben und/oder mit Selbstsicherheit. Lernen: Aufnahme von Umweltinformation über den Filter der Sinnesorgane und des Gehirns in einen Gehirn-internen Speicher. Bildet die Assoziationsbasis und die Grundlage für Entscheidungen, um das individuelle Verhalten einer variablen Umwelt flexibel anpassen zu können. Vergessen und Neulernen können als selektive Updates der Gedächtnisinhalte gesehen werden. Viele verschiedene Arten und Ebenen des Lernens. Siehe auch → Hippocampus. Setzt Lernbereitscha�en voraus (s. auch → angeborener Lehrmeister). Masturbation: Selbstbefriedigung. Besonders die männliche Masturbation stellte funktionell ein evolutionsbiologisches Rätsel dar, weil die so abgegebenen Samenzellen keine Eier befruchten können. Könnte nach neuerem 230 Glossar Verständnis ein Verhalten zur Erhaltung der → Konkurrenzfähigkeit des Spermas sein (Losewerden überaltertem Spermas). Siehe auch → Spermakonkurrenz. Materialismus: Anspruch, wonach alle Lebenserscheinungen, also auch geistig-seelische Vorgänge auf Basis der (physiko-chemischen) Interaktionen der Materie ohne Berufung auf eine metaphysische Instanz erklärbar sein müssen. Grundlage der → Naturwissenscha�en. mechanistisch: Anspruch, wonach alle Lebenserscheinungen, also auch geistig-seelische Vorgänge auf Basis der (physiko-chemischen) Interaktionen zwischen Systemteilen, bzw. Molekülen ohne Berufung auf eine metaphysische Instanz erklärbar sein müssen. Grundlage der → Naturwissenscha�en. Mem: Kultureller Gedächtnisinhalt, Paket kultureller → Information (Dawkins 1977), analog zum → Gen. Menschenmodell: Wichtiger Teil der → individuellen Weltanschauung; grundlegende Ansicht vom Wesen des Menschen (→ kreationistisch, → evolutionär, usw.). Modell: Nachbildung realer Systeme unter Verwendung weniger essentieller Komponenten, beruhend auf einer → Hypothese. Decken sich empirische Daten und das Resultat des Modells, so wird wahrscheinlich, dass die wichtigen Parameter berücksichtigt wurden und die zugrundeliegende → Hypothese zutri�. Nicht als »harter« Test einer → Hypothese geeignet, kann aber die Basis für entsprechende → Experimente darstellen. Modulator: Reguliert Prozesse nach oben oder unten. Etwa biogene Amine in den Spalträumen des Gehirnes, die das Geschehen an bestimmten → Synapsen entweder anregen oder dämpfen. Monogamie: Kurz- bis langfristiges Paarungssystem zwischen zwei Individuen. Als → evolutionäre Strategie verschiedengeschlechtlicher → Individuen entstanden, ihren Fortpflanzungserfolg zu optimieren, meist indem sich beide Geschlechter an der Jungenfürsorge beteiligen. Motivation: Dem Verhalten zugrundeliegende (bewusste und unbewusste) Beweggründe, Stimmungen, Gestimmtheit. »Motivationsfaktoren« können auch Hormone sein. Auch: spezifische (in Bezug auf eine bestimmte → Endhandlung) Handlungsbereitscha�, Verhaltensantrieb, Glossar 231 Drang, → Trieb, von vielen äußeren und inneren Faktoren beeinflusst, nach Lorenz staubar. Siehe → psychohydraulisches Modell. Mustergenerator, zentraler: Nervennetze im Rückenmark und Gehirn, die relativ autonom ein bestimmtes (o� rhythmisches) motorisches Muster erzeugen. Substrat für → Reflexe und → Erbkoordinationen. Mü�erlicher Einfluss: auch mü�erliche Manipulation. Unmi�elbare, meist physiologische Einwirkung der Mu�er auf den → Phänotyp der Nachkommen. Zum Beispiel durch Eigröße oder frühe Steroidhormone. natürliche Selektion: Auslese, richtunggebender Prozess der → Evolution. Zwischen unterschiedlichen → Phänotypen in einer bestimmten Umwelt treten → Fitnessunterschiede auf, die im Verlauf der Generationen die → Allelfrequenzen in der → Population verschieben. Beruht selten auf unterschiedlichen Überlebensraten, meist auf unterschiedlichem Fortpflanzungserfolg. Naturwissenscha�: Versucht belebte und unbelebte Natur erklären, beruht letztlich auf der auf Aristoteles zurückgehenden hypothetiko-deduktiven Methode, hat sich auf das Mess- und Zählbare zu beschränken, kein Rekurs auf Metaphysik zulässig. Ist → mechanistisch, → reduktionistisch, → materialistisch. Negentropie: Zunahme von Ordnung unter Energieaufwand (→ Entropie). Neotenie: Erhalt juveniler Merkmale im Adultstadium. Zum Beispiel Erreichen der Geschlechtsreife bereits im Larvenstadium. Nepotismus: Begünstigung von, bzw. → Kooperation unter Verwandten. Evolutionäres Prinzip, das aus → Individualselektion und → inklusiver Fitness folgt. Siehe auch → Verwandtenselektion. Neuroethologie: Zweig der Nervenphysiologie bzw. Ethologie, welcher die kausalen Beziehungen zwischen Verhaltensweisen und der Funktion des Nervensystems erforscht. objektiv-subjektiv: Objektiviert kann durch → Quantifizierung werden, während Subjektives einer direkten Beobachtung und damit dem naturwissenscha�lichen Zugriff entzogen ist. So etwa können → Emotionen (bzw. die mit ihnen verbundenen Empfindungen) nicht direkt, sondern nur über ihre Auswirkungen auf das Verhalten erfasst werden. 232 Glossar Öko-Ethologie: Jener Zweig der → Verhaltensbiologie, welcher die → Fitnessrelevanz von Verhalten untersucht, etwa wie Tiere ihre Entscheidungen bezüglich → Ressourcennutzung, Partnerwahl, Raubfeindvermeidung usw. optimieren und was sie daran hindert, → optimal zu handeln. Östrogen: Verhaltensrelevantes, vor allem weibliches → Steroidhormon aus den Eierstöcken, welches wie auch die anderen Steroidhormone in der → Ontogenie organisierend, z.B. im Gehirn wirkt. Siehe auch → Testosteron und → Corticosteroide. Ontogenie: Siehe → Individualentwicklung. Optimalität: Da die → Individuen in → Populationen um → Fitness → konkurrieren, aber → Ressourcen und Zeitbudgets begrenzt sind, müssen sie möglichst optimale Entscheidungen treffen. Wobei es darum geht, kann je nach Lebensstadium bzw. Situation unterschiedlich sein. Häufig wird entweder der Energiegewinn maximiert, die Raubfeindgefährdung oder das Risiko zu verhungern minimiert usw. Optimalitätsmodelle können gewöhnlich zur Vorhersage von → Entscheidungen in der Nahrungs- und Partnerwahl oder Feindvermeidung genutzt werden. Orgasmus: Lustvoller weiblicher Höhepunkt beim Geschlechtsakt bei Menschen und wahrscheinlich vielen Wirbeltieren. → Evolutionsbiologische Relevanz umstritten. Belohnung und damit → Motivation für Sexualverhalten. Scheint aber eine Funktion in der Retention von Sperma des bevorzugten Partners zu haben. Siehe auch → Spermakonkurrenz. Paradigma: Musterbeispiel mit starkem Theoriebezug. Partnermarktwert: Maß der A�raktivität potentieller Partner für das andere Geschlecht. Siehe auch → Prestige. Partnerwahl: Geschlechtspartner finden sich in den seltensten Fällen zufällig, sondern wählen einander nach den verschiedensten Kriterien aus. Meist sind die Weibchen das wählerische Geschlecht, da sie in der Regel mehr in die Nachkommen investieren als Männchen. Bestimmt die → Allelkombinationen der Nachkommen und damit den Gang der Evolution. Persönlichkeit: Grundlegende, lebenslang relativ stabil bleibende Gesamtheit der Verhaltensneigungen, auf Herausforderungen der Umwelt zu reagie- Glossar 233 ren. S. auch → coping style, → Temperament, z. B. introvertiert-extrovertiert. Phänotyp: Individuelles Resultat der Interaktion des → Genotyps mit der Umwelt, in welcher die → Individualentwicklung sta�fand. Physiologie: Lehre der Körperfunktionen. Hormon-, Stoffwechsel-, Neurophysiologie etc. Polyandrie: Paarungssystem, bei dem ein Weibchen mit mehreren Männchen zusammen ist, bzw. Nachwuchs zeugt. Männchen beteiligen sich o� maßgebend an der Brutpflege. Eher selten. Polygamie: Paarungssystem, bei dem ein Partner des einen Geschlechts mit mehreren Partnern des jeweils anderen Geschlechts zusammen ist, bzw. Nachwuchs zeugt. Synchrone: gleichzeitig; sukzessive: Partner des anderen Geschlechts wechseln in mehr oder weniger rascher Folge. Siehe auch → Polyandrie, → Polygynie. Polygynie: Paarungssystem, bei dem ein Männchen mit mehreren Weibchen zusammen ist bzw. Nachkommen zeugt, die meist die Jungenfürsorge alleine leisten. Häufig. Polykausal: Mehrere Ursachen bedingen eine Wirkung, die Regel in komplexen Systemen, während → reduktionistische → Experimente der Naturwissenschaften zumeist monokausal (eine Ursache, eine Wirkung) angelegt werden müssen. Polymorphismus: Mitglieder einer → Population bilden distinkte Formen unterschiedlichen Körperbaus oder Färbung aus. Population: Von ihrer geographischen Verbreitung her und auch reproduktiv zusammenhängende Untergruppe einer → Art. Potlatch-Fest: Von manchen nordwestamerikanischen Indianerstämmen wurden Nachbarclans zu Festen eingeladen, deren Hauptzweck es war, einander durch wertvolle gegenseitige Geschenke oder durch Vernichtung wichtiger Güter zu beeindrucken und zu beschämen. Je größer der vernichtete Wert, um so größer der → Prestigegewinn. Es wurden gelegentlich sogar die eigenen Häuser abgebrannt. Siehe auch → Handicap. 234 Glossar Prägung: Rascher Lernvorgang entlang einer evolutionär disponierten Lernbereitschaft. Verschiedene Formen der Prägung: Nachfolge-, Orts-, sexuelle Prägung. Bei Nachfolgeprägung lernt ein schlüpfendes Enten oder Gänseküken, dem ersten sich bewegenden und Laute abgebenden Objekt zu folgen, dessen es ansichtig wird. In abnehmender Bedeutung sind folgende Objekteigenschaften wichtig: Laute, Bewegung, Aussehen. Nachhaltiger Lernvorgang, aber u.U. umkehrbar. Prestige: Soziales Ansehen, erhöht vor allem den männlichen → Partnermarktwert. Wird in → hedonischen Gesellscha�en durch soziale Fähigkeiten erworben, in → agonischen vor allem durch Kontrolle von → Ressourcen (Besitz). Siehe auch → Potlatchfest. Primaten: Affen. Zum Beispiel Hominide Primaten: Menschenaffen: Gibbons, Orang Utans, Gorillas, Schimpanse, Bonobo und Menschen. Promiskuität: Relativ indiskriminatives Akzeptieren vieler Sexualpartner. Meist mit starker → Spermakonkurrenz verbunden. Psychohydraulisches Modell: Lorenzsches → Triebmodell: die Vorstellung, dass die → Antriebstärke bezüglich einer gewissen → Endhandlung mit der Zeit ansteigt, wenn diese nicht ausgeführt wird, → analog zu einem aufstauenden WasserReservoir. Der Füllzustand liegt im Gleichgewicht mit der Stärke des auslösenden Reizes (im Modell als gegen ein Federventil wirkendes Gewicht dargestellt). Die Endhandlung läuft also entweder nach starkem → Triebstau oder nach starkem → Auslöserreiz ab. Siehe auch → Motivation. Psychologie: Wissenscha� vom Wesen, bzw. den geistig-seelischen Vorgängen des Menschen, welche die Auswirkungen seelisch-geistiger Vorgänge auf Verhalten sowie die Interaktionen mit der (sozialen) Umwelt untersucht. Quantifizierung: Unabdingbarer Ansatz der Naturwissenscha�en, um Objektivierung und Reproduzierbarkeit zu erreichen. Randbedingung: Schränken die (→ optimale) Handlungsfreiheit ein (etwa das durch Raubfeinddruck erzwungene Meiden reicher Nahrungsquellen, die durch die Notwendigkeit der Mineralstoffzufuhr erzwungene Aufnahme von Wasserpflanzen durch Elche, obwohl Landpflanzen energetisch günstiger wären und [als zweite Randbeding] die Nahrung saufnahmekapazität des Darmes beschränkt ist usw.). Glossar 235 Rangordnung: Meist durch → aggressive Interaktionen ausgefochtene (nicht notwendigerweise lineare) → Dominanzhierarchie innerhalb von → Individuen einer sozialen Gruppe, die um dieselben → Ressourcen konkurrieren. Darum gibt es oft getrennte Männchen- und Weibchenrangordnungen. Siehe auch → agonisch und → hedonisch. Da gewöhnlich die Hochrangigen profitieren, sind Rangordnungen Quellen → agonistischer Interaktionen, es ist daher ein Irrglaube, dass sie Gruppen stabilisieren, weil »befrieden«. rational: Bewusstes, abwägendes Überlegen als Basis für Handlungen. Im Gegensatz etwa zu → instinktiv. Reaktionen: → physiologische Vorgänge oder Verhaltensweisen, die bestimmten → Reizen folgen. Reduktionismus: Die grundlegende Untersuchungsmethode der Naturwissenscha�en, komplexe Systeme auf einfache, möglichst → monokausale UrsacheWirkzusammenhänge zu reduzieren, damit sie untersucht werden können. Reflex: In einem Nervennetz, als → Mustergenerator kodierte, unbewusste Verhaltensweise, die auf einen bestimmten → Reiz hin weitgehend unabhängig vom → Motivationshintergrund abläu�. Durch → Lernen können bedingte Reflexe gebildet werden. Reflexologie: Pawlowsche Lehre von den Reflexke�en. Auch komplexe Verhaltensweisen werden als Ketten von Reflexen gedeutet. Flexibilität entsteht durch den »bedingten Reflex«. In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts aktuell, Grundlage für die Lorenz-Tinbergensche → Ethologie. Reiz: Anlass für den Ablauf eines → Reflexes oder anderer Verhaltenselemente. Reproduktionspotential: Mögliche Nachkommenzahl (von Individuen). Wird meist zwischen den Geschlechtern innerhalb von → Arten verglichen. Ist bei jenem Geschlecht höher, welches weniger in Nachkommen investiert, meist bei den Männchen. Basis für viele evolutionär angelegte → Konflikte. Ressourcen: Für Individuen lebens- und reproduktionsnotwendige Kategorien ihrer Umwelt: Lebensraum, Nahrung, Geschlechtspartner. Gewöhnlich 236 Glossar Anlass für → Konkurrenz zwischen den Mitgliedern einer → Population und, auf ökologischer Ebene, auch zwischen Arten. Rezeptor: Kann als Rezeptorzelle jenes Sinnesorgan bedeuten, in dessen Membran der Primär- → Reiz in elektrische Potentialänderungen umgesetzt wird. Rezeptormoleküle dagegen sind meist große, o� membrangebundene Prozeine, an welchen chemische, entweder interne oder externe (im Falle der chemosensorisehen Organe) Botenstoffe gebunden werden und in Folge entweder die Öffnung eines lonenkanals und/oder den Beginn einer Second-messenger-Kaskade bewirken, die schließlich die Physiologie der Zelle bis hin zur Genexpression beeinflusst. Ritualisierung: → Evolution von Verhaltensweisen, bzw. Strukturen im Dienste der → lnformationsübertragung, meist durch Funktionswandel (z. B. aus Putzbewegung wird Balzbewegung). So entstehen → Signale, deren Redundanz und Prägnanz der Eindeutigkeit bzw. der Überwindung der »sales resistance« auf Seiten des Empfängers durch den Sender dienen. Rückkopplung: Feedback. Die Wirkung beeinflusst wiederum ihre Ursache. So wirken Hormonspiegel im Blut meist hemmend auf eine weitere Ausschü�ung desselben → Hormons. In einem anderen Beispiel steigert der Sieger einer Auseinandersetzung durch eine Erhöhung seines Selbstbewusstseins die Wahrscheinlichkeit eines Sieges bei darauffolgenden Auseinandersetzungen. Schlüsselreize: Vorstellung der → klassischen Ethologie, wonach es (erbliche) → Auslöser gäbe, die wie ein »Schlüssel« in ein »Schloss der Wahrnehmung« passen und eine → Erbkoordination auslösen. Heute weiß man, dass meist, wenn überhaupt, nur grobe Reizkonstellationen erblich → disponiert sind und sehr viel → Lernen, bzw. Lernbereitscha� im Spiel ist. Begriff wird daher heute kaum mehr verwendet. Seitensprung: Alternative → evolutive bzw. reproduktive → Strategie monogamer Paarpartner, um ihre individuellen Reproduktionserfolge zu optimieren. Männliche Seitensprünge können direkt zu einer Erhöhung der Nachkommenzahl führen, weibliche Seitensprünge dagegen zu deren Diversifizierung. Siehe auch → Reproduktionspotential. Selektion: Auslese. Siehe → natürliche und → sexuelle Selektion. sexuelle Selektion: Auslese von Merkmalen im Zusammenhang mit der → Konkurrenz in der sexuellen Vermehrung entweder innerhalb eines Geschlechtes (z. B. Kampfstärke, Körpergröße bei den Männchen) oder zwischen den Glossar 237 Geschlechtern (z. B. extravagante Merkmale der Männchen als Ergebnis der weiblichen Zuchtwahl). Die so → selektionierten Merkmale können bzw. müssen überlebenshinderlich sein (siehe → Handicap), um als verlässliches → Signal der Partnerqualität zu dienen. Siehe auch → Prestige und → Partnermarktwert. Sichern, Sicherrate: Aufmerksamkeitshaltung der meisten Wirbeltiere, bei welcher Hals und Körper nach oben durchgestreckt und alle eigenen Körperbewegungen mit Ausnahme jener der Augen und Ohren eingestellt werden. Meist im Zusammenhang mit Feindvermeidung zu beobachten. Auch als → Signal an potentielle Räuber und sogar innerhalb der Gruppe diskutiert. Signal: Im Dienste der → lnformationsübertragung → evoluiertes Merkmal (Körperbau oder Verhalten). Siehe auch → Ritualisierung. Ist dann »ehrlich«, wenn mit Kosten verbunden und daher fälschungssicher. Skinner-Box: Testkäfig, in welchem Tieren Lernaufgaben auf der Basis des → Lernens durch Versuch und Irrtum gestellt werden können. Siehe auch → Behaviorismus. Sozialdarwinismus: Begleiterscheinung des frühen → Darwinismus und eines starken → genetischen Determinismus. (Gesellscha�liche) Unterschiede wurden für »blutsbedingt« (→ erblich) und daher unabänderlich gehalten. Sehr einflussreich bis zur Mi�e des 20. Jahrhunderts. In den Köpfen vieler Leute immer noch präsent. Siehe auch → Eugenik. Soziobiologie: Vor allem auf dem Prinzip der → inklusiven Fitness beruhender, in der → Öko-Ethologie verwurzelter Zweig der → Ethologie, der sich mit den → evolutionären Strategien und der → Fitnessrelevanz sozialen Zusammenlebens beschä�igt. Soziologie: Empirisch orientierte Wissenschaft vom Zusammenleben der Menschen. Vermeidet meist vergleichende Ansätze bzw. ein evolutionäres Menschenmodell. Diese Kritik tri� auch weitgehend auf die → Psychologie zu. Spermakonkurrenz: → Konkurrenzsystem der Männchen um Nachkommen. Wenn es Männchen nicht gelingt, Geschlechtspartnerinnen zu monopolisieren (siehe → Monogamie, bzw. → Polygynie), konkurrieren sie v. a. über die Spermamenge und den Kopulationszeitpunkt um die Vaterscha�. Verbreitet, z. B. bei manchen Meerschweinchen, Hunden, Schimpansen, in abgeschwächter Form auch beim Menschen. 238 Glossar Stammesgeschichte: Rekonstruktion des durch → Evolution der → Arten im Laufe der Erdgeschichte entstandenen Gefüges der Verwandtscha�sbeziehungen und seiner historischen Entstehung. Status (sozialer): Position bzw. Einordnung eines → Individuums in ein soziales Gefüge. Zu beschreiben über Parameter wie: Alter, Geschlecht, soziale Bindungen, → Dominanz, → Rang, → Prestige usw. Meist mit maßgeblicher Auswirkung auf → Reproduktionserfolg und daher → Fitness. Steroidhormone: Gruppe von teilweise stark verhaltensrelevanten Hormonen (Sexualität, Stress), die aufgrund ihrer Fe�löslichkeit Zellmembranen gut durchdringen und zum Großteil direkt im Zellkern auf Genexpression, aber auch über Membran → rezeptoren rasch auf Verhalten wirken. Strategie: Auf → Fitnessoptimierung des → Individuums abgestimmtes Verhalten bzw. Summe → optimaler → Entscheidungen. Es wird kein höheres, → kognitiv gesteuertes Taktieren impliziert, sondern es werden eher unbewusste, auf → evolutionären Prädispositionen beruhende → Entscheidungen angenommen. Symbiontentheorie: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Zellen mit echtem Zellkern Symbiosen aus Zellen verschiedener Herkunft darstellen. So scheinen etwa Mitochondrien und Chloroplasten aus integrierten Blaualgen-ähnlichen Zellen entstanden zu sein. Synapse: Kontaktstelle der Signalweitergabe zwischen Nervenzellen oder zwischen Nerven- und Muskelzellen. An der Mehrzahl der Synapsen wird das elektrische Signal in ein chemisches (→ Transmi�er) übersetzt, welches in der nachgeschalteten Zelle wiederum zu Änderungen des Membranpotentials führt. Tabula rasa: wörtl.: »leere Tafel«. Ausdruck der Vorstellung extremer → Behavioristen (Lerntheoretiker), dass alle → Individuen als unbeschriebene Blä�er zur Welt kommen, daher unbegrenzt erzieh- und formbar wären. Gegenposition zu den → Ethologen, die Systeme evolutionär entstandener → Dispositionen nachweisen konnten. Taxis: Zielorientierung einer Bewegung entlang eines → Reiz-Gradienten. Temperament: Emotionaler Ausdruck der → Persönlichkeit. Glossar 239 Testen von Hypothesen: Voraussagen aus der → Theorie müssen durch Experimente bzw. Beobachtungen potentiell überprü�ar bzw. falsifizierbar sein, sonst sind sie nicht naturwissenscha�lich. Stark → deduktiver Ansatz, dem Konrad Lorenz als Anwalt der → Induktion misstrauisch gegenüberstand. Testosteron: Männliches → Steroidhormon, vor allem aus den Hoden, in die Ausbildung der sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale involviert, → motiviert auch → Aggression. Theorie: Eine Gruppe kohärenter → Hypothesen. Tierpsychologie: Vorläuferin der Ethologie mit Blüte um die Jahrhundertwende. Vor allem → Psychologen forschten an Fragen der → kognitiven Leistungsfähigkeit. Oftmals vermenschlichenden Interpretationen tierischen Verhaltens waren eine dem jungen Konrad Lorenz starke → Motivation für seine wissenscha�liche Arbeit. Transmi�er: Botenstoffe, die an der vorgeschalteten Zelle der → Synapse bei Ankommen eines elektrischen Signals freigesetzt werden und in der nachgeschalteten Zelle der Synapse wiederum ein elektrisches Signal bewirken. Trieb(handlung, arteigene): Siehe → Erbkoordination → Instinkt. Typus: Das (bezüglich seines Verhaltens bzw. Körperbaus etc.) Ideal einer → Art. Überbleibsel einer → kreationistischen (idealistischen) Biologie, welches angesichts der innerartlichen Variabilität, auf welcher der → Darwinsche Mechanisms der → Evolution beruht, abzulehnen ist. Sehr wohl nützlich bleibt aber beispielsweise der Vergleich von »Bauplantypen« zwischen Großgruppen. In der systematischen Biologie wird als »Typus« jenes Individuum bezeichnet, auf welchem die Erstbeschreibung einer → Art beruht. Vergleichende Verhaltensforschung: Nur der → Artvergleich ermöglicht es, wie wir seit Whitman, Heinroth und Lorenz wissen, die → evolutionäre Herkun� von Verhaltensweisen zu erkennen, um damit auch menschliches Verhalten aus der → Stammesgeschichte heraus zu erklären. Dem vergleichenden Ansatz verdanken wir die Entdeckung aller, auch für den Menschen gültigen Prinzipien der Verhaltensbiologie, z. B. → Strategien der Geschlechter, → Verwandtenselektion u. v. a. m. 240 Glossar Verhaltensforschung: Etwa deckungsgleich mit → Verhaltensbiologie, bzw. → Ethologie. Umfasst alle Richtungen der Erforschung von Verhalten unter dem → Theoriengebäude der → Evolutionsbiologie. Verhausschweinung: (des Menschen). Plakativer Ausdruck der Idee von Konrad Lorenz, dass Menschen »selbstdomestiziert« und → neotän seien. Auf den ersten Blick überzeugend, da (Zivilisations-)Menschen einige Merkmale von Haustieren, wie Fe�ansatz, schwach ausgebildetes Bindegewebe, Mopsköpfigkeit, Hypersexualität etc. aufweisen. Allerdings trifft ein zuverlässiges Merkmal für → Domestikation, ein im Vergleich zur Wildrasse verkleinertes Gehirn, gerade auf den Menschen nicht zu; auch gibt es keine haltbaren Belege für → Instinktausfall, wie er für Haustiere typisch ist. Die Idee der Verhausschweinung ist daher → naturwissenscha�lich nicht haltbar und fällt wohl in die Kategorie »rationalisiertes Vorurteil«. Verwandtenselektion: Durch Hilfeleistung unter Verwandten kommt es zu → Selektionsvorteilen für die Sippe. Siehe auch → Nepotismus. Vier Tinbergensche Ebenen: Forschungsprogramm der → Ethologie, bzw. der gesamten evolutionärorganismischen → Naturwissenscha�en. Verhalten (und jedes andere Merkmal) ist auf den Ebenen der zugrundeliegenden → Mechanismen, der → Fitnessrelevanz, der → evolutionären Geschichte und der → ontogenetischen Entstehung zu erforschen und zu erklären. Vitalismus: Richtung der frühen Verhaltensforschung, die den → Instinkt als Ausdruck des göttlichen Willens annahm, ihn daher weder einer Erklärung bedür�ig noch zugänglich hielt und sich damit außerhalb der → materialistischen Naturwissenscha�en stellte. Wahrheit: Begriff, der in den → Naturwissenscha�en fehl am Platz ist, da diese die Annäherung an die Wirklichkeit anstreben, sie aber niemals erreichen. Daher sind naturwissenscha�liche Sätze immer Wahrscheinlichkeitsaussagen und erlauben nie letzte Gewissheiten. Wahrnehmung: Durch die evolutionär entstandene Aussta�ung mit Sinnesorganen und Gehirn bedingte, subjektive Wirklichkeit von Arten und Individuen. Warnlaut: Wird von einem oder mehreren → Individuen einer Gruppe bei Annäherung eines Fressfeindes abgegeben. Vereinzelt Differenzierung nach Freßfeindtyp nachgewiesen. Funktion (cui bono?) des »Warnlautes« nicht immer klar. Oft konvergent, wird daher auch zwischenartlich verstanden. Glossar 241 Wirklichkeit: Die unabhängig von unserer Wahrnehmung existierende Welt. Solange es Menschen gibt, wird es wohl ein Thema philosophischer Diskurse bleiben, ob eine solche Welt außerhalb unserer → Wahrnehmung existiert oder nicht. Für die → Naturwissenscha�en ist dieser Diskurs wenig bedeutend, da es letztlich unmaßgeblich ist, ob unsere Forschungsergebnisse die letztliche Wirklichkeit beschreiben oder nur Ergebnis menschlicher Konventionen auf Basis unseres → Erkenntnisapparates darstellen. Wir können ohnehin nur innerhalb des Rahmens dieser → evolutionären Konventionen denken. S. auch → Wahrheit.