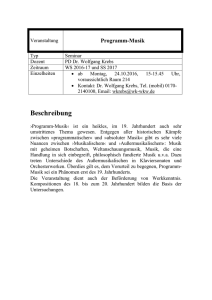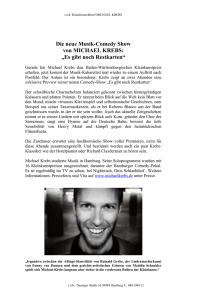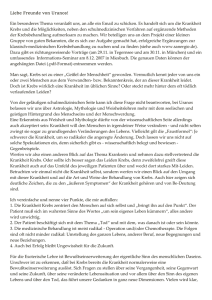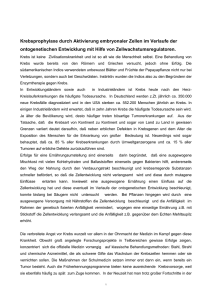Reportage Psychoonkologie
Werbung

Spezial ı Psychoonkologie »Mein Leben mit dem Krebs« Vor fünf Jahren erfuhr Petra Bugar von ihrer Tumorerkrankung – und die Prognosen sind Mehr zum thema schlecht. Heute sagt sie: »Obwohl ich unheilbar krank bin, lebe ich gerne.« Doch das war >D en Tod im Leib (S. 36) Psychoonkologen unter­ nicht immer so, wie sie Gehirn&Geist-Redakteurin Rabea Rentschler bei einem Besuch in suchen den Zusammenhang einer Freiburger Tumorklinik erzählt. zwischen Psyche und Krebs (S. 36) text: Rabea Rentschler I Fotos: Manfred Zentsch Im Einklang mit sich Anfangs fühlte sich die 53-jährige Petra Bugar ihrer Tumorerkrankung hilflos ausgeliefert. Trotz mehrerer Rückfälle hat sie im Lauf der letzten fünf Jahre gelernt, mit dem Krebs zu Gehirn&Geist / Manfred Zentsch / Mit frdl. Gen. der Sanafontis Tumorklinik, Freiburg leben. D ie Überlebensrate von Krebspatienten hat sich dank verbesserter Diagnostik und neuer Behandlungsmöglichkeiten in den letzten vier Jahrzehnten verdoppelt: In den 1970er Jahren starben drei Viertel aller Patienten innerhalb von fünf Jahren, heute ist es nur noch jeder zweite – statistisch betrachtet ein großer Erfolg. In der Realität nehmen solche Zahlen der Diagnose Krebs aber nicht den Schrecken: Als ein Onkologe Petra Bugar 2004 mitteilte, dass sich in ihrem Unterleib ein Rektumkarzinom gebildet habe, kam das für sie einem Todesurteil gleich. Heute, fünf Jahre später, ist sie 53 Jahre alt und hat so viele Klinikaufenthalte hinter sich, dass sie aufgehört hat zu zählen. Die nächste Chemotherapie in einer privaten Krebsklinik in Freiburg im Breisgau steht kurz bevor. Angst habe sie mittlerweile nicht mehr. »Mein Leben mit dem Krebs«, wie sie es nennt, »begann vor fünf Jahren.« Die Beamtin und Kommunalpolitikerin aus Magdeburg fuhr wie jedes Jahr mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern zum Skifahren. Nach einem Tag auf der Piste entdeckte sie abends Blut im Stuhl. Am folgenden Montag konsultierte sie ihren Hausarzt. Der schickte sie umgehend zu einem Spezialisten. Die 48-jährige wurde gründlich untersucht, eine Stuhlprobe an ein externes ­Labor geschickt – dann hieß es abwarten. Zwei Tage später der Anruf: Die Befunde seien da, und Petra Bugar solle in die Praxis kommen. Der Arzt hatte keine guten Nachrichten für sie: »Der Krebs ist bereits fortgeschritten, Sie müssen dringend operiert werden.« Während der Onkologe, den sie an diesem Vormittag zum zweiten Mal in ihrem Leben sah, ihr sichtlich verlegen die nächsten Therapieschritte erklärte, hatte Petra Bugar das Gefühl, ihn aufmuntern zu müssen: »Machen Sie sich keine Gedanken, Sie können ja nichts dafür.« Das Ganze dauerte kaum eine Viertelstunde. Vielen Ärzten fällt es schwer, Patienten eine schlimme Diagnose mitzuteilen. Zwar befür- worten die meisten Mediziner heute den offenen Umgang mit schlechten Nachrichten – in den 1980er Jahren galt das noch als unverantwortlich –, aber aus Angst, nicht den richtigen Ton zu treffen, weichen manche auf die Sach­ ebene aus, ohne die emotionale Verfassung ihrer Patienten zu berücksichtigen. »Das ist auch nicht verwunderlich«, sagt Monika Keller von der Universität Heidelberg, »denn kaum ein Arzt hat gelernt, wie man solche Gespräche führt.« Die Psychotherapeutin setzt sich dafür ein, dass Onkologen schon während der Facharztausbildung üben, niederschmetternde Dia­g­ nosen einfühlsam mitzuteilen. Unter ihrer ­Leitung wird seit 2008 an sieben deutschen Universitätskliniken das Trainingsprogramm KoMPASS (Kommunikative Kompetenz zur ­Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung) erprobt. Ärzte aus Leipzig, Köln, Düsseldorf, Mainz, Heidelberg, Tübingen und Nürnberg lernen in Rollenspielen, denen reale Fälle zu Grunde liegen, wie sie sich nicht nur fachlich, sondern auch psychologisch bewähren. Die Gespräche mit speziell geschulten Schauspielern, welche die Patienten mimen, werden auf Video aufgezeichnet und später analysiert. Die Unsicherheit der Ärzte »Anfangs denken viele: Oh nein, ich habe alles falsch gemacht!«, beschreibt Keller die Reaktion einiger Onkologen zu Beginn der Schulung. Doch mit der Zeit empfänden sie die Hilflosigkeit, die Gesprächspausen oder auch die emotionalen Ausbrüche ihrer Patienten als weniger belastend. Dafür spricht ebenfalls der Vergleich der 150 bislang trainierten Mediziner mit einer Kontrollgruppe – Fachärzten, die nicht an dem Kurs teilgenommen haben. Fast alle Absolventen melden zurück, dank des Trainings weniger Angst vor schwierigen Begegnungen zu haben und besser auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen zu können. 43 er Denkstil mentale Hilfestellung Von allein wäre Petra Bugar nicht auf die Idee gekommen, sich psychologische Unterstützung zu suchen. »Krebspatien­ ten kommen nur selten von sich aus auf uns zu«, sagt die Psychotherapeutin Nina Rose. »Dabei können wir helfen, mit der aktuellen Krise umzugehen.« Acht Minuten … Zeit haben Ärzte in Deutschland im Schnitt dafür, ihren Patienten eine Krebsdiagnose mitzuteilen – in anderen europäischen Ländern dauert ein solcher Patientenkontakt zwischen elf und 19 Minuten. Wenn sie wirtschaftlich arbeiten wollen, müssen Onkologen jährlich rund 4000 emotional belastende Gespräche führen. (Untersuchung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln, 2007) 44 dern und Fokussieren Vier Monate nach der Schulung findet ein Anschlussseminar statt. »Hier zeichnet sich ab, dass die meisten Onkologen – und damit indirekt auch ihre Patienten – von einer berufs­ begleitenden Supervision profitieren würden«, so Keller. »Doch dafür fehlt schlicht das Geld.« KoMPASS wird von der Deutschen Krebshilfe finanziert, die 2008 an die 100 Millionen Euro für 174 Forschungsprojekte ausgab. Doch nur ein Bruchteil der Gelder fließt in psychologische Projekte; das meiste kommt der Grundlagensowie der somatischen Therapieforschung zugute. »Das ist ja auch verständlich«, sagt Keller. Das Beste, was einem Patienten passieren kann, ist, dass er geheilt wird. Doch obwohl sich die Prognosen für viele der über 200 verschiedenen Krebsarten ständig verbessert haben, stürzt eine Tumorerkrankung praktisch jeden in eine existenzielle Krise. Damit Onkologen von Anfang an auf die damit einhergehenden emotionalen Probleme eingehen können, wollen Keller und ihr Team die KoMPASS-Daten bis Ende 2009 vollständig auswerten, um die positiven Effekte des Trainings auf das Empathievermögen, die Kommunikationsfähigkeit und die berufsbedingten Belastungen der Ärzte schwarz auf weiß prä­sen­tieren zu können, was wiederum der ganzheitlichen Behandlung von Tumorpatienten zugutekommen soll. »Dies ist ein erster Schritt dahin, dass ein Kommunikationstraining für Onkologen auch in Deutschland verpflichtend in die Facharztausbildung integriert wird. In England und der Schweiz ist das schon üblich.« Dass solche Maßnahmen nötig sind, zeigt nicht nur die Erfahrung von Petra Bugar. 2008 veröffentlichte das Wissenschaftliche Institut der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (WINHO) die Ergebnisse einer Studie, bei der über 15 000 Tumorpatienten in 145 Krebs­ kliniken und -praxen in Deutschland befragt wurden. Auf den ersten Blick klingen die Resultate ganz gut: Die meisten Patienten sind ins­ gesamt zufrieden mit ihrer ärztlichen Versorgung. Im Detail betrachtet schnitten allerdings drei Punkte relativ schlecht ab: geringe ärztliche Kompetenz bei Fragen zu alternativen Behandlungsmethoden, zu wenig Aufklärung und Mitspracherecht bei Therapieentscheidungen – und vor allem eine mangelhafte psychosoziale Betreuung, auch für die Angehörigen. Drei Punkte, die massive Konsequenzen für die Lebensqualität der Betroffenen haben können, wie eine weitere Umfrage des Instituts er­ gab: Nicht ausreichend unterrichtete und betreute Patienten fühlen sich dem Krebs stärker ausgeliefert. Sie sind unsicherer, ängstlicher und häufiger depressiv. Sowohl ihre psychischen Belastungen als auch ihre körperlichen Schmerzen oder Nebeneffekte der Therapie werden oft übersehen. Krebserkrankung zum Anlass, neu über ihr Leben nachzudenken«, bestätigt Nina Rose. Manche fühlen sich schuldig, weil sie vielleicht sterben und ihre Lieben dann ohne sie zurecht­ kommen müssen, andere verzweifeln an der Frage: Warum gerade ich? Wieder andere treffen die Entscheidung, etwas Grundlegendes zu ändern – so auch Petra Bugar. Sie verließ ihren Mann samt Eigenheim und zog in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Magdeburger Innenstadt. »Wir bewerten die Situation nicht, in der sich ein Patient befindet, sondern unterstützen ihn da, wo er gerade steht«, sagt Rose. »Dabei versuchen wir, den Partner und die Familie mit einzubeziehen, denn Krebs betrifft in den seltensten Fällen nur den Erkrankten allein.« Auch die Angehörigen seien dabei gefordert. »Oft stehen sie unter dem Druck, für den Patienten stark sein zu müssen, und bagatellisieren ihre eigenen Belastungen, um den Kranken nicht zu beunruhi- gen«, fährt die Psychologin fort. Deshalb lehnen Familienmitglieder solche Gespräche häufig ab. »Sehr viele Leute stecken Psychoonkologie in eine Schublade mit einer problemorientierten Einzel-, Familien- oder Paartherapie. Dabei wollen wir den Menschen ganz einfach helfen, mit dem Sturz aus ihrer bisherigen Wirklichkeit klarzukommen«, so Rose. Die Diagnose Krebs löst oft nicht nur ein emotionales Chaos aus, sondern auch ein organisatorisches. Vielfach kommen Geldsorgen hinzu. Psychoonkologen versuchen das Thema Krebs zu enttabuisieren und ermutigen Patienten und Angehörige, ihre Bedürfnisse auszusprechen. Scheinbar banale oder lieblose Fragen kommen zur Sprache: Sind finanzielle Engpässe zu erwarten, und wie kann man ihnen begegnen? Welche staatlichen und gemeinnützigen Hilfeleistungen gibt es? Wer kann sich um Kinder, Eltern oder Haustiere kümmern? Darf man überhaupt schon darüber nachdenken, wie es Krebs in Deutschland Jedes Jahr erkranken 436 000 Menschen in Deutschland an Krebs, 211 500 Patienten sterben jährlich daran. Experten schätzen, dass die Zahl der Tumorerkrankungen bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zunehmen wird. Der Grund: Die Lebenserwartung steigt – und Krebs ist eine Erkrankung, von der insbesondere ältere Menschen betroffen sind. Wege aus der Angst: Die Zukunft zulassen Hilflose Angehörige Auch Petra Bugar sah sich dem Krebs anfangs hilflos ausgeliefert. Verstärkt hatte dieses Ohnmachtsgefühl nicht nur die ungenügende medizinisch-psychologische Betreuung. Auch privat fand sie wenig Unterstützung. Als sie nach dem Termin beim Onkologen nach Hause kam und ihrem Mann von der Diagnose erzählte, fehlten ihm die Worte. Er wusste nicht, wie er mit der Schreckensnachricht umgehen sollte, und ignorierte fortan schlicht die Tatsache, dass seine Frau schwer krank war. Auch am Arbeitsplatz zogen sich die meisten zurück, als sie von der Krankheit ihrer Kollegin hörten. »Die Diagnose schockiert nicht nur die Betroffenen selbst, auch Freunde und enge Angehörige wissen oft nicht, wie sie sich nun verhalten sollen«, erklärt Nina Rose, Psychologin an der Freiburger Tumorklinik SanaFontis. Die Krankheit stelle Beziehungen auf die Probe; manche Paare schweiße der Krebs fester zusammen, andere zerbrechen daran. Bei Petra Bugar und ihrem Mann war Letzteres der Fall. »So schrecklich die Zeit war, rückblickend bin ich froh, dass es so gekommen ist«, sagt sie heute. Bei Gesprächen mit Psychologen merkte Petra Bugar, dass sie ihr Leben lang versucht hat, den Erwartungen anderer gerecht zu werden – ihre eigenen Bedürfnisse hatte sie hintangestellt. »Viele Patienten nehmen eine G&G 9_2009 Eine bösartige Tumorerkrankung wird von vielen Menschen als die gefährlichste aller Krankheiten angesehen, ungeachtet der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten. Mangelhaftes Wissen darüber, was sich hinter der Diagnose Krebs verbirgt – etwa die Tatsache, dass es rund 200 verschiedene Tumorarten mit jeweils unterschiedlichen Verläufen gibt –, ist eine Ursache. Hinzu kommen häufig Erfahrungen mit Krebskranken im weiteren Umfeld. Die Erinnerung kann dabei trügerisch sein: Ungünstige Krankheitsverläufe bleiben besonders in Erinnerung und prägen die eigenen Erwartungen. Wer einmal an Krebs erkrankt war, kennt die Angst vor einem Rückfall (Rezidiv). Die Gewissheit, endgültig geheilt zu sein, stellt sich auch nach einer längeren krankheitsfreien Zeit kaum ein. Ein Rest von Unsicherheit und Angst bleibt. Was kann man gegen Angst tun? Alles, was dem Gefühl von Unsicherheit entgegenwirkt oder die Bedeutung der ängstigenden Situation verringert, kann die Furcht bannen oder erträglicher machen. Dazu gehört: ó Informationen einholen. Über die Krankheit allgemein ebenso wie über erprobte Behandlungsmöglichkeiten und darüber, wie man selbst die eigene Gesundung unterstützen kann. Fragen des individuellen Krankheitsverlaufs wie auch des Risikos für ein Wiederauftreten der Krankheit sollten mit einem Arzt besprochen werden, der alle Untersuchungsbefunde kennt. ó Die Angst möglichst genau »ansehen«. Was ängstigt am meisten? Die Furcht vor Schmerzen, vor der Behandlung, www.gehirn-und-geist.de vor der Abhängigkeit von anderen oder die Angst zu sterben? Die Befürchtungen sollten zu Ende gedacht werden, denn wenn die Furcht greifbar wird, lässt sich eher Abhilfe finden. Auch Verleugnung kann in bestimmten Phasen eine sinnvolle Reaktion darstellen, wenn die Angst sonst unerträglich wäre. ó Die Angst Ausdrücken. Schreiben, malen oder mit an­ deren schöpferischen Mitteln der Furcht eine Gestalt geben, hilft oft, sie besser zu verstehen, was wiederum entlastend wirken kann. ó SICH Erinnern. An schwierige Situationen zurückdenken, die man schon erfolgreich durchgestanden hat, stärkt das Gefühl für die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten. ó Planen. Was man im Fall einer Verschlechterung konkret tun kann und wer dabei helfen könnte. Dazu gehört die Mit­ verantwortung für Behandlungsmethoden, das Ausschöpfen der Schmerztherapie, Vereinbarungen mit Familienangehörigen etwa in Form einer Vorsorgevollmacht und möglicherweise eine Patientenverfügung. ó Entspannen. Innere und äußere Verkrampfungen sind eine Begleiterscheinung der Angst. Sie lassen sich mit Entspannungsverfahren abbauen oder, soweit es die körperliche Verfassung zulässt, mit körperlicher Bewegung (spazieren gehen, Rad fahren, schwimmen oder anderer Sport). ó DEN SCHÖNEN SEITEN DES LEBENS GEWICHT GEBEN. Was ist in meinem Leben sinnvoll, wo kann ich meine besonderen Fähigkeiten einbringen, was macht mir Freude, und was sollte ich erweitern oder ausbauen? Wie kann ich mir dabei von anderen helfen lassen? 45 Krebszahlen weltweit Weltweit erkranken jedes Jahr mehr als 11 Millionen Menschen erstmals an Krebs. 7,9 Millionen sterben daran. Damit ist Krebs die zweithäufigste Todesursache überhaupt nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Jahr 2030 werden voraussichtlich 16 Millio­ nen Menschen jährlich an Krebs erkranken. weitergeht, falls der geliebte Mensch tatsächlich stirbt? »Tumorpatienten und ihre Angehörigen haben in der Regel bereits genug Belastungen, deshalb wird prinzipiell auch nicht ›aufdeckend‹ gearbeitet, also nach Defiziten aus der Kindheit gesucht«, erklärt Rose. Vielmehr wird gemeinsam besprochen, welche Ressourcen vorhanden sind und welche noch aktiviert werden können: Welche Form der Unterstützung durch Familienmitglieder oder Freunde ist sinnvoll? Was hat allen Betroffenen seit Diagnosestellung gutgetan? Wie kommt der Patient zur Ruhe? Petra Bugar entspannt sich beim Malen. Deshalb nahm sie die Einladung der Kunsttherapeu­ tin Wendy Routen-Hardy, gemeinsam kreativ zu werden, gerne an. Sie freut sich auf ihre zwei Stunden Kunsttherapie pro Woche während ihres Aufenthalts in der Freiburger Tumorklinik. Die Sitzungen basieren auf einer Methode der italienischen Psychiater Gaetano Benedetti und Maurizio Peciccia, die das »progressive therapeutische Spiegelbild (PTS)« 1986 ursprünglich im Umgang mit psychotischen Menschen erfanden. Auf Basis der PTS-Methode entwickelte Wendy Routen-Hardy eine Kunsttherapie­ form speziell für Tumorpatienten: Therapeut und Patient malen dabei gemeinsam ein Bild, wobei Letzterer das Thema vorgibt. »Die Spiegelbild-Methode«, so Wendy Routen-Hardy, »ist wie das PTS eine Art nonverbaler Kommunika­ tion, bei der der Therapeut versucht, in die Ge- fühlswelt des Patienten einzutauchen und in seinen Skizzen spiegelt oder gar verstärkt, was er in den Zeichnungen des Patienten sieht.« Ziele der Übung können sein: Emotionen, Sorgen oder Konflikte ausdrücken und verarbeiten, Entspannung erfahren sowie die Selbst- und Körperwahrnehmung verbessern. Petra und Wendy setzen sich gemeinsam vor einen weißen Bogen Papier, und die Patientin beginnt: Sie wählt blaue Kreide und malt einen großen Kreis. Wendy zeichnet einen kleinen hellblauen daneben. Danach nimmt Petra eine andere Farbe und zeichnet einen Stamm in die Mitte ihres Kreises – Wendy einen in ihren. So geht es hin und her. vorsichtige Kontaktaufnahme Die meisten Bilder von Petra Bugar dominiert ein blauer Kreis. Er symbolisiert ihre »kleine heile Welt«. Zu Beginn der Kunsttherapie spielte sich alles darin ab (links). Erst nach und nach verband sie ihren Kreis mit dem kleineren der Therapeutin (Mitte) und öffnete ihn schließlich der Außenwelt (rechts). Emotionen Gestalt geben Während sie malen, sprechen Therapeutin und Patientin nicht miteinander. Ab und zu müssen beide lachen, weil eine Figur nicht so gelingt, wie sie es sich vorstellen. Sonst sind sie ernst und konzentriert bei der Sache. Zum Schluss fragt Wendy ihre Patientin, wie sie sich beim Malen gefühlt hat, und ob sie mit dem Bild etwas Bestimmtes verbindet. Petra sagt, dass die Farben und Motive ihrer Werke immer etwas damit zu tun haben, was sie gerade beschäftigt. »Andere Patienten«, so Routen-Hardy, »verbinden nicht sofort etwas mit ihren Zeich­nungen.« In solchen Fällen versucht die Therapeutin auch nicht, eine besondere Bedeutung herauszulesen. Nach ein paar Sitzungen werden alle Bilder nochmals auf den Tisch gelegt und betrachtet. Dann erkennen viele Patienten plötz­lich doch eine tiefere Bedeutung darin: Sie entdecken Gefühle wie Angst oder Wut oder fangen an zu weinen – unterdrückte Emotionen kommen an die Oberfläche. Manchen fällt auf, dass ein Motiv plötzlich nicht mehr vorkommt oder eines im Lauf der Zeit besonders dominant geworden ist. Für Petra Bugar symbolisiert der Kreis, der sich in fast allen ihren Bildern wiederfindet, ihre »kleine heile Welt«. Anfangs platziert sie kein Motiv außerhalb der blauen Linie. Statt der zarten Pflanze, die sie meist hineinmalt, zeigen einige neuere Bilder einen starken Baum oder ein lachendes Gesicht (siehe Bilderserie oben). Für Petra spiegelt dies eine Sorge der letzten Monate: Sie fragt sich, wie sie auch außerhalb des geschützten Umfelds der Klinik mit der Tatsache klarkommen soll, dass sie nicht mehr wie früher zur Mehrheit der Gesunden in der Gesellschaft gehört. Sie möchte ihren Körper trotz seines Versagens wieder lieb gewinnen. Im Hier und Jetzt leben Hass auf den eigenen kranken Körper empfinden sehr viele Krebskranke irgendwann. »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diesen Patienten neben der Kunsttherapie auch Achtsamkeitsübungen sehr guttun«, sagt Nina Rose. Sie helfen Betroffenen, im Hier und Jetzt zu leben und sich in ihrer Verletzlichkeit zu akzeptieren, statt unablässig über die Vergangenheit zu trauern oder sich in Zukunftsängsten zu verlieren. Zwar hat die Kunsttherapie eine lange Geschichte in der Psychoonkologie, ihre Erforschung steckt aber tatsächlich noch in den Kinderschuhen. »In den letzten 25 Jahren wurden In Bildern sprechen Worte sind nicht erlaubt, wenn Kunsttherapeutin Wendy Routen-Hardy und Petra Bugar gemeinsam kreativ werden. Hingegen sind Lachen und andere Gefühlsregungen nicht nur geduldet, sondern sogar gewünscht. 46 G&G 9_2009 www.gehirn-und-geist.de unzählige Fallbeispiele beschrieben und analysiert und auch kleinere kontrollierte Studien durchgeführt«, sagt Harald Gruber, Leiter des Fachbereichs Kunst und Therapie an der Alanus Hochschule bei Bonn. So ergab eine im Januar 2009 veröffentlichte schwedische Studie von der Umeå-Universität, dass bereits eine Stunde Kunsttherapie pro Woche die Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen deutlich erhöhte. Untersucht wurden 41 zufällig ausgewählte Frauen unmittelbar vor einer Bestrahlung sowie zwei und sechs Wochen danach. Jene, die künstlerisch aktiv wurden, fühlten sich sowohl psychisch als auch körperlich besser als die 21 Patientinnen, die nicht an den Sitzungen teilgenommen hatten. Erstere hatten weniger Angst vor der Zukunft und ein positiveres Selbstbild. Eine Leipziger Studie aus demselben Jahr kam zu ähnlichen Ergebnissen. Bei dieser Untersuchung nahmen 18 Männer und Frauen mit unterschiedlichen Tumorerkrankungen an einem wöchentlichen Gestaltungskurs teil. 22 Wochen lang beschäftigten sie sich zunächst mit unterschiedlichen Maltechniken und -materialien. »In der Anfangsphase sollten sich die Patienten einfach nur mit den kreativen Gestaltungsmöglichkeiten vertraut machen«, erklärt Heide Götze von der Universität Leipzig. In einem zweiten Schritt wurden die Teilnehmer ermutigt, ein Thema ihrer Wahl künstlerisch umzusetzen. War dies gefunden, sollten sie die verbleibenden Wochen dazu nutzen, eine Art Bildband zu erstellen, in dem neben den im Kurs entstandenen Werken auch erklärende Texte einfließen konnten. In praktisch allen »Büchern« thematisierten die Patienten ihre Krebserkrankung, wobei dies nicht vorgegeben war. Die psychische Belastung der Erkrankten Die häufigsten Krebs­ erkrankungen Frauen erkranken vorrangig an Brust-, Lungen-, Magen- und Darmkrebs. Bei Männern treten vor allem Lungen-, Magen-, Leber-, Darm-, Speiseröhren- und Prostatakrebs auf. Lungen-, Magen-, Leber-, Darm- und Brustkrebs verlaufen in besonders vielen Fällen tödlich. Rauchen ist der größte Risikofaktor, der zu einer Tumorerkrankung führt. 47 abhängig, was sie beschämt und nicht selten dazu führt, dass sie sich zurückziehen und ihre Krankheit und deren Konsequenzen verdrängen. Dabei leiden Männer wahrscheinlich ähnlich stark wie Frauen unter den psychischen Folgen einer Krebserkrankung – und diese können zu einer schweren Depression oder gar zu Selbstmordgedanken führen. Vanessa Strong und Kollegen von der University of Edinburgh untersuchten 2007 über 3000 Tumorpatienten. Knapp ein Viertel von ihnen litt unter klinisch relevanten Belastungen wie Angstzuständen und Depressionen. 2008 untersuchten die Forscher eine zweite Stichprobe von mehr als 2900 Krebserkrankten. Ergebnis: Knapp acht Prozent von ihnen quälten Gedanken wie »Tot wäre ich besser dran« oder »Vielleicht tue ich mir selbst etwas an«. Zwei Faktoren korrespondierten überdurchschnittlich stark mit den Selbstmordgedanken: emotionaler Stress und chronische Schmerzen. Vergänglich, aber Schön Beim Anblick der Gänseblümchen muss Petra Bugar daran denken, wie verletzlich ihr Körper ist. Die Kunsttherapie hat ihr geholfen, ihn dennoch lieb zu haben. Krebs bei Kindern Jährlich erkranken in Deutschland ungefähr 1800 Kinder und Jugend­ liche unter 15 Jahren an Krebs. Diese Zahl ist seit vielen Jahren konstant. Die Heilungschancen liegen mittlerweile bei 80 Prozent. Die häufigsten Krebserkrankungen im Kindesalter sind Leukämien (Blutkrebs), Tumoren des Gehirns und des Rückenmarks sowie Lymphknotenkrebs. (Quelle aller statistischen Angaben: Robert Koch-Institut, 2008) 48 war im Anschluss an den Kurs wesentlich geringer als zuvor und zugleich deutlich niedriger als bei den Krebspatienten der zufällig ausgewählten Vergleichsgruppe. »Welche Künstlerische Therapieform für welchen Patienten in welchem Krankheitsstadium am besten geeignet ist, können wir derzeit noch nicht sagen«, so Gruber weiter. Er arbeitet gerade an einer vergleichenden Überblicksstudie zu den Wirkfaktoren in den Künstlerischen Therapien (Musik-, Tanz- und Kunsttherapie). Seiner Einschätzung nach scheinen soziale Herkunft und Bildungsgrad keine Rolle zu spielen. Es komme vermutlich eher auf die Charaktereigenschaften eines Menschen an. »Generell öffnen sich mehr Frauen als Männer kreativen Behandlungsmethoden«, ergänzt Gruber. Ein Umstand, der in der Psychotherapie allgemein bekannt sei. »Dass Männer eine Krebserkrankung grundsätzlich anders verarbeiten als Frauen, lässt sich daraus nicht ableiten«, betont Monika Keller. »Erfahrungsgemäß kommunizieren sie ihre mit dem Krebs verbundenen Ängste aber auf unterschiedliche Weise.« Deshalb würden emotional stark belastete Männer oft übersehen. Für sie sei es besonders wichtig zu wissen, dass sie nicht etwa deshalb Unterstützung brauchen, weil sie psychisch krank sind. »Diese Männer standen vor ihrer Erkrankung mitten im Leben und hatten alles im Griff«, so die Leiterin der psycho­ onkologischen Abteilung der Heidelberger Uniklinik. Jetzt sind sie in hohem Maß von anderen Die Angst im Nacken Auch Petra Bugar hat immer wieder starke Schmerzen und weiß, dass sie – statistisch gesehen – an ihrer Krankheit sterben wird, weil die Wahrscheinlichkeit für ein Rezidiv, eine erneute Tumorbildung, in ihrem Fall hoch ist. Drei Jahre lang zog sie von einer Kontrolluntersuchung zur anderen, immer mit der Angst im Nacken, der Krebs könnte trotz mehrerer Operationen und Chemotherapien zurückkommen. Im Sommer 2007 hatte sie die Nase voll davon. Sie erfüllte sich einen lang gehegten Wunsch und machte eine Reise durch Indien. »Krebserkrankte, die in ihrem Alltag immer nur funktioniert haben, wollen nun endlich einmal etwas nur für sich tun«, sagt Nina Rose. Viele beginnen ein neues Hobby oder planen Unternehmungen für die Zeit, wenn es ihnen wieder besser geht. Nach ihrer Heimkehr lebte Petra Bugar, als sei nie etwas gewesen – nur viel bewusster: »Ich regte mich nicht mehr wegen Kleinigkeiten auf, besuchte meine Kinder öfter und meditierte viel«, sagt sie. Zu Kontrolluntersuchungen ging sie nicht mehr. Endlich wuchsen die Haare nach, heilten die Schleimhäute, schmeckte das Essen wieder. Den Krebs schloss sie einfach aus ihrem Leben aus. »Positiv denken«, lautete ihr Motto. Wie schön, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre. Doch Anfang August 2008 erkältete sich Petra Bugar. Sie wurde immer schwächer, verdrängte aber den Gedanken an Krebs: »Alles, nur nicht wieder ins Krankenhaus.« Im Januar 2009 brach ihr Immunsystem zusammen, sie G&G 9_2009 konnte nicht mehr laufen und sehen. Der Notarzt brachte die geschwächte Frau in die Uniklinik Magdeburg. »Sie haben Metastasen im Gehirn«, teilte ihr ein Arzt mit; übermorgen werde operiert, danach Chemotherapie und Reha. »Ihr könnt mich alle mal!«, dachte Petra Bugar da. Sie wollte einfach nicht mehr. Damals fragte sie sich, ob sie womöglich nicht genug gekämpft hätte und selbst die Schuld für den Rückfall trage. »1989 und zu Beginn der 1990er Jahre sorgten ein paar Studien für Aufsehen in der Onkologie«, sagt Monika Keller. Die Untersuchungen stellten einen Zusammenhang zwischen einer optimistischen Einstellung und einem positiven Krankheitsverlauf bei Tumorpatienten fest. »Doch die Ergebnisse ließen sich nicht replizieren«, betont die Expertin. Heute gelte als gesichert, dass eine besonders kämpferische Einstellung die Krebsheilung nicht nachweisbar beeinflusse. »Dieser Mythos kursiert aber immer noch in den Köpfen der Menschen«, so Keller weiter. Problematisch daran sei nicht die Hoffnung auf Genesung, sondern der Druck, unter den Menschen geraten, wenn ihr Körper trotz guten Willens nicht auf Therapiemaßnahmen anspricht oder der Krebs erneut ausbricht. Nach Kellers Einschätzung vermittelt auch das Umfeld vielen Betroffenen, sie hätten nicht stark genug an ihre Genesung geglaubt oder sich zu sehr hängen lassen. Die Kinder von Petra Bugar machten ihrer Mutter keine derartigen Vorwürfe, sondern ermutigten sie, die Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen. »Das ist enorm wichtig, damit Betroffene nicht in Hoffnungs­ losigkeit versinken und resignieren«, sagt auch die Psychologin Rose. Dank der Unterstützung durch ihre Kinder, Therapeuten und Ärzte fasste Petra Bugar neuen Mut. Sie willigte in die erneute Operation ein. Für die Nach- und Weiterbehandlung reist sie jedes Mal in die Privatklinik nach Freiburg. Die Kosten für den Aufenthalt muss sie teilweise selbst tragen, aber sie fühlt sich hier gut aufgehoben. Es stehen mehrere Chemotherapien auf dem Plan. Das heißt pro Behandlung drei Tage lang Erbrechen und wunde Schleimhäute, meist gepaart mit Hautausschlag und Haarausfall, danach folgen elf Tage Pause. Wie oft sie diese Tortur in ihrem Leben noch aushalten muss, weiß sie nicht. »Sterben will ich so bald jedenfalls nicht.« Ÿ Ein weiter Weg Beim Interview vertraute Petra Bugar G&G-Redakteurin Rabea Rentschler viele persönliche Details an. Doch es dauerte lange, bis die 53-Jährige so offen mit einer Fremden über ihre Krebserkrankung sprechen konnte. Quellen Götze, H. et al.: Gestaltungs­ kurs für Krebspatienten in der ambulanten Nachsorge. In: Forschende Komplementär­ medizin 16(1), S. 28 – 33, 2009. Oster, I. et al.: Art Therapy Improves Experienced Qua­ lity of Life Among Women Undergoing Treatment for Breast Cancer: a Randomized Controlled Study. In: Euro­ pean Journal of Cancer Care. 18(1), S. 69 – 77, 2009. Strong V. A. et al.: Better off Dead: Suicidal Thoughts in Cancer Patients. In: Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American So­ciety of Clinical Oncology 26(29), S. 4725 – 4730, 2008. Weitere Quellen unter: www.gehirn-und-geist.de/ artikel/1002094 Weblinks Informationsseiten für Krebspatienten: www.krebsinformations dienst.de www.krebsgesellschaft.de www.frauenselbsthilfe.de www.prostatakrebs-bps.de Rabea Rentschler ist G&G-Redakteurin. Training für Ärzte: www.kompass-o.de www.gehirn-und-geist.de/audio www.gehirn-und-geist.de 49