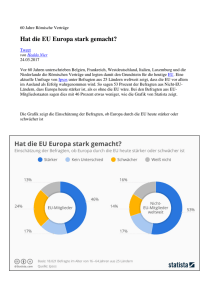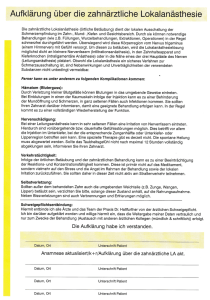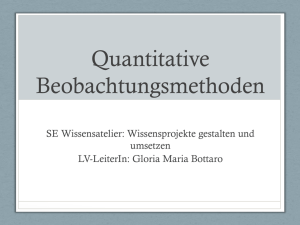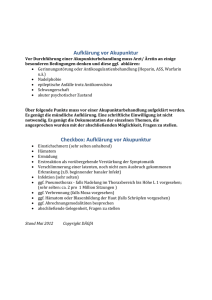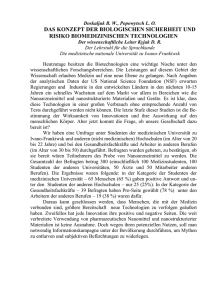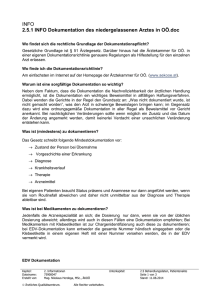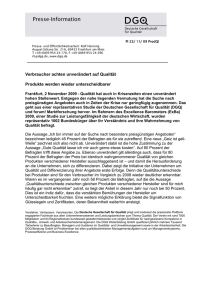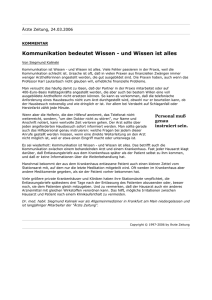PDF-Download - Zentrum für Medizinische Ethik
Werbung

EINLEITUNG Betrachtet man die Literatur zur Medizinethik, so stehen neben dem Forschungsaspekt - aktuell etwa durch die Diskussion über Gentechnik repräsentiert - vielfach Fragen zum Beginn und Ende des Lebens sowie zum Umgang mit Extremsituationen bei schweren Erkrankungen im Vordergrund. Diese Fälle decken aber nur einen relativ kleinen Teil der medizinischen Interventionen ab. In der Mehrzahl der Fälle haben es Ärzte, Therapeuten und Pfleger mit weniger spektakulären Fällen zu tun - Chirurgen etwa mit Standardoperationen, Intensivpfleger mit der relativ kurzen postoperativen Nachbetreuung von Patienten oder Internisten mit der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen. Der Umgang mit Kranken ist in der Medizinethik durch den Begriff des Informed Consent geprägt, der als anzustrebendes Ideal dargestellt wird und dessen Umsetzung sicher wünschenswert ist. Nur in wenigen Fällen aber wird der Arzt es mit medizinisch vorgebildeten Patienten zu tun haben, die sich auf eine Behandlung körperlich und geistig so vorbereiten können, wie es etwa in einem Aufsatz von Hansen [2] beschrieben ist. In vielen Fällen kommt der Patient hingegen mit akuten Schmerzen oder Krankheiten zu einem Arzt bzw. in das Krankenhaus und erwartet eine rasche medizinische Intervention. Relativ wenig Raum nimmt im Rahmen der theoretischen Diskussion das Problem der Bewältigung der Krankheit durch den Patienten ein, die zum einen eine partnerschaftlich definierte Behandlung beinhaltet und zum anderen vielfach eine Betreuung über einen langen Zeitraum verlangt. In einzelnen Bereichen, etwa der Altenbetreuung, der Sterbebegleitung oder der Psychiatrie sind dies sehr wohl Themen der Medizinethik, vielfach entsteht aber der Eindruck, daß dieser Bereich der Medizinpsychologie überlassen wird. Diese Beobachtungen waren unter anderem ein Grund dafür, daß vom Institut für Ethik in der Medizin an der Universität Wien ein Forschungsprojekt über die Ethik im Krankenhausalltag initiiert wurde, das sich primär mit diesen Fragen der „Alltagsethik“ beschäftigt. Abschnitt 1 geht kurz auf die Konzeption dieser Studie ein und stellt die behandelten Themengebiete vor. Anschließend werden exemplarisch die Ergebnisse zu Fragen der Patientenorientierung sowie der Kommunikation im zweiten und dritten Abschnitt vorgestellt. Wien und Lübeck, im Oktober 1998 Wilfried Grossmann, Giovanni Maio, Anja Weiberg ETHIK IM KRANKENHAUSALLTAG - THEORIE UND PRAXIS Grossmann, Wilfried; Maio, Giovanni; Weiberg, Anja 1 1. METHODISCHE KONZEPTION DER STUDIE Im Gegensatz zur meist fallorientierten Abhandlung von ethischen Problemen, die sich vielfach an einem abstrakten Raster orientieren, sollten im Rahmen der Studie die individuellen Handlungsmotive in konkreten Situationen durch die Betroffenen selbst beschrieben werden. Dabei wurde davon ausgegangen, daß nicht nur der Arzt eine entscheidende Rolle spielt, sondern alle heilenden Berufe einzubeziehen sind. Aus diesem Grund war eine zentrale Überlegung während der Planungsphase, daß die ethischen Probleme im Krankenhaus im individuellen, sozialen sowie institutionellen Bereich betrachtet werden müssen und hierbei alle betroffenen Berufsgruppen einzubeziehen sind. Thematische Schwerpunkte sollten daher die Beziehungen zwischen Patient und Angehörigen der heilenden Berufe, Entscheidungsprozesse (Organisation und Kommunikation) im Krankenhaus, Mittelverteilung, Patientenrechte und Verschwiegenheitspflicht sein. Diese waren durch das Personal selbst darzustellen. Da die Feststellung ethischer Probleme häufig nur durch die Beschreibung konkreter Einzelfälle deutlich wird, schien eine rein quantitative Analyse nicht zielführend. Stattdessen wurde der Versuch unternommen, sich den Problemstellungen über qualitative Methoden zu nähern. Dem qualitativen Ansatz entsprechend sollte dabei nicht das Testen von vorgefertigten Hypothesen im Vordergrund stehen, sondern das Aufdecken von Strukturen und die Identifikation von Problemfeldern, die sich im Zusammenhang mit den oben genannten medizinethischen Themen im Krankenhausalltag ergeben. Dadurch sollte sich überdies die Möglichkeit bieten, wünschenswerte Veränderungen vorzuschlagen. Um diesen Problemkreisen gerecht zu werden, erschien das auf einem Interviewleitfaden beruhende themenzentrierte Interview als Erhebungsmethode am geeignetsten. Zur detaillierten Ausformulierung eines derartigen Interviewleitfadens wurde zunächst ein Team gebildet, in dem alle Berufsgruppen vertreten waren – Ärzte, Pflegekräfte und Ausbildner, Angehörige der medizinisch-technischen Dienste, Psychologen, Seelsorger und Verwaltungsangestellte. Es wurden Gruppen gebildet, die versuchten, die ethischen Fragestellungen aus der Sicht der verschiedenen Berufsgruppen, vom Standpunkt der Organisation und der Wirtschaftlichkeit und im Zusammenhang mit der Arzt-Patienten-Beziehung zu erarbeiten. Dabei entwickelte sich ein Modell, das schematisch in Abbildung 1 dargestellt ist. 2 PATIENT Rechte Informed Consent Krankheit Befinden Verantwortung Haltungen W E R T E Kommunikation Behandlung Betreuung HANDLUNGEN ÄrztIn Kommunikation PflegerIn Kommunikation Empathie TherapeutIn Mittelverteilung Kommunikation Organisation Gesetze R E F L E X I O N Qualität NORMEN Abbildung 1: Schematische Darstellung des Systems Krankenhaus für die Studie Die Rechtecke symbolisieren die betroffenen Personengruppen: auf der einen Seite die Patienten, auf der anderen die Angehörigen der heilenden Berufe, vereinfacht als ÄrztIn, PflegerIn und TherapeutIn bezeichnet 1 . Das Verhalten und die Interaktion zwischen diesen Gruppen ist durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, die durch Kreise symbolisiert sind. Die unmittelbare Beziehung zwischen diesen Faktoren und den einzelnen Personengruppen ist durch die nicht beschrifteten Pfeile dargestellt. So sind zum Beispiel für den Patienten seine Krankheit und sein Befinden wesentlich, und in bezug auf diese Krankheit hat er auch spezielle Rechte. Die Angehörigen der heilenden Berufe sind einerseits durch Gesetze und organisatorische Rahmenbedingungen des Krankenhauses in ihrem Verhalten festgelegt, andererseits spielen Haltungen eine zentrale Rolle. Die Interaktion zwischen diesen Personengruppen ist durch die beschrifteten Pfeile symbolisiert. Das Personal steht mit den Patienten auf den drei Ebenen Behandlung, Betreuung und Kommunikation in Beziehung. Zwischen den einzelnen Gruppen der heilenden Berufe ist die Kommunikation von zentraler Bedeutung. Vom ethischen Standpunkt sind primär 1 Um eine bessere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, wird im folgenden bei den Berufsbezeichnungen bewußt auf eine geschlechtsneutrale Formulierung, wie ÄrztInnen oder PflegerIn, verzichtet. 3 jene Begriffe von Interesse, die auf der rechten Seite als Rauten symbolisiert sind. Beispielhaft wurden die Begriffe Informed Consent, Verantwortung, Empathie, Mittelverteilung und Qualität genannt. Die Handlungen der Angehörigen der heilenden Berufe sind in einem Regelkreis zu sehen, der durch die Begriffe Werte, Handlungen, Normen und Reflexion gekennzeichnet ist. Es versteht sich von selbst, daß dieses Schema eine starke Vereinfachung ist und Wechselwirkungen der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt werden. So besteht beispielsweise eine Beziehung zwischen Krankheit und Befinden oder Gesetzen und Haltungen. Als Ergebnis dieser ersten Analyse ergab sich ein Interviewleitfaden, der in die folgenden Themenkreise gegliedert war: Grundhaltungen, Kommunikation, Rechte, Organisation und Wirtschaftlichkeit. Daneben wurde auch noch eine Reihe von statistischen Fragen zur Ausbildung aufgenommen. Der Interviewleitfaden findet sich im Anhang. Aufgrund des Umfangs des Fragebogens und der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen ergab sich eine Obergrenze von etwa 170 Interviews. Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen der qualitativen Forschung wurde bei der Auswahl der Population nicht so sehr auf die Repräsentativität als auf die Angemessenheit hinsichtlich der Fragestellungen Wert gelegt [vgl. 4: 193 ff]. Um typische Fälle von Situationen zu erhalten, mit denen die Angehörigen der heilenden Berufe konfrontiert sind, war von Beginn an klar, daß nicht spezielle Krankheiten oder bestimmte Patientenklassen im Vordergrund stehen sollen, sondern das gesamte Spektrum der Fälle, mit denen sich Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte im Krankenhaus konfrontiert sehen, einbezogen werden muß. Insgesamt konnten 156 Personen befragt werden. Um mögliche Differenzierungen zu erfassen, wurden folgende Strukturmerkmale als Planungsraster verwendet: • Krankenhaustypen: Es sollten sowohl Krankenhäuser im städtischen und ländlichen Bereich als auch Universitätskliniken miteinbezogen werden. Daneben wurden auch die unterschiedlichen Rechtsformen (öffentlich oder privat) berücksichtigt. Die Auswahl fiel auf das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, das Sozialmedizinische Zentrum Ost in Wien, das Landeskrankenhaus Oberwart, das Landeskrankenhaus Scheibbs und die Universitätskliniken in Graz. • Stationstypen: Um ein breites Spektrum von Stationen zu erfassen, wurden in allen oben genannten Krankenhäusern, soweit verfügbar, folgende Stationen ausgewählt: Chirurgie, Gynäkologie, Intensivstationen, Interne Abteilungen, Kinderkliniken und Psychiatrie. • Funktionen: Auf den einzelnen Stationen wurden Primarärzte, Oberärzte, Assistenzärzte, Turnusärzte, Stationsschwestern, Diplomschwestern und Pflegehelfer befragt. Überdies interviewte man auch Oberinnen, Physiotherapeuten und Schüler. 4 Die Interviews wurden im Frühjahr 1996 gemeinsam mit dem Dr. Fessel + GfK Institut, Wien durchgeführt. Insgesamt konnten 156 Interviews realisiert werden. Die folgenden Grafiken geben eine nach Geschlechtern getrennte Darstellung der Verteilung der Befragten auf den einzelnen Funktionen und Stationen: 30 25 Anzahl 20 15 Geschlecht 10 Missing 5 weiblich 0 maennlich Oberin Dipl.Schw Pfl.Helfer Turnusarzt Stat.Schw. O.Arzt Ass.Arzt Schüler Primar Therapeut Funktion Abbildung 2: Verteilung der Interviewten nach Geschlecht und Funktion 20 Anzahl 15 10 Geschlecht 5 Missing weiblich 0 maennlich Chirurgie Intensiv Kinder Gynäkologie Interne Psychiatrie Station Abbildung 3: Verteilung der Interviewten nach Geschlecht und Station 5 Aus diesen Darstellungen wird deutlich, daß die traditionelle rollenspezifische Verteilung der Geschlechter noch immer vorherrschend ist. Lediglich im Bereich der jüngeren Ärzte (Turnusärzte und Assistenzärzte) zeigt sich ein gewisser Wandel. Entsprechend der stark hierarchischen Gliederung des Krankenhauspersonals sind auch das Alter und die Dauer im Beruf bei den einzelnen Befragten ziemlich klar vorgegeben. Die folgende schematische Darstellung der Altersverteilungen macht dies deutlich: 70 60 58 101 Alter 50 89 85 40 30 63 20 10 N= 5 Oberin 12 22 17 Dipl.Schw Pfl.Helfer 14 12 Turnusarzt Stat.Schw. Ass.Arzt 18 15 O.Arzt 7 7 Schüler Primar Therapeut Funktion Abbildung 4: Altersverteilung in den einzelnen Berufsgruppen Lediglich im Bereich der diplomierten Pflegekräfte zeigt sich ein differenzierteres Bild: Etwa 50% der Pflegenden haben eine relativ kurze Berufserfahrung (fünf Jahre), die zweite Gruppe weist eine lange Berufserfahrung mit mehr als zehn Jahren auf. Dies entspricht durchaus der Realität in den Pflegeberufen. Die Auswertung der Interviews orientierte sich im wesentlichen am Konzept der qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse, wie sie von P. Mayring [6: 91ff] und S. Lamnek [4: 191ff] dargestellt ist. Zwei Gründe waren für diese Methodenwahl ausschlaggebend: Zum einen sollte die Auswertung durch die Theorie der Medizinethik geleitet werden, zum anderen lag ein relativ umfangreiches Textmaterial vor (die durchschnittliche Länge eines Interviews beträgt 15-20 Seiten in der Transkription), das andere qualitative Analyseverfahren (wie z.B. die objektive Hermeneutik) nicht praktikabel machte. Von den drei in Mayring genannten inhaltsanalytischen Grundformen orientierte man sich primär an der Methode der Zusammenfassung, die versucht, ein überschaubares Korpus zu bilden, welches noch immer das Grund- 6 material abbildet, sowie an der Methode der Strukturierung mit dem Ziel, das Material nach bestimmten Kriterien einzuschätzen. Um der Vielschichtigkeit des Materials gerecht zu werden erfolgte die Auswertung durch eine interdisziplinären Gruppe, die sich aus acht Personen zusammensetzte: W. Grossmann (Statistiker), F. Haslinger (Theologe), B. Maier (Ärztin), G. Maio (Medizinethiker), A. Mühlgassner (Medizinjournalistin), Ch. Schmitt (Theologe), W. Schuch (Pädagoge), A. Weiberg (Philosophin). Unterstützt wurde das Team von Mitarbeitern des Fessel-Institutes. Nach der Sichtung von etwa 25 Prozent des Materials ergaben sich erste Kategorien, die anhand von Ankerbeispielen belegt wurden. In Kleingruppen erfolgte dann die Bearbeitung des gesamten Materials nach diesen anfangs entwickelten Richtlinien, wobei die einzelnen Ergebnisse immer durch gemeinsame Arbeitssitzungen diskutiert und reflektiert wurden. Da in unterschiedlichen Interviewpassagen Aussagen zu gleichen Themenbereichen aus verschiedenen Perspektiven angesprochen wurden, war eine flexible Verknüpfung der einzelnen Antworten notwendig. So gab es z. B. eine Frage nach dem Stellenwert der Verschwiegenheitspflicht und eine andere über die Weitergabe von Information an Dritte trotz der Verschwiegenheitspflicht. Im Vergleich der einzelnen Aussagen zu diesen thematisch zusammenhängenden Fragen wird das ethische Spannungsfeld im Krankenhausalltag besonders deutlich. Zur Unterstützung dieser Tätigkeit wurde mit dem Analysesystem WINMAX gearbeitet, das sich im Rahmen des Projektes sehr bewährt hat. Als besonderer Vorteil dieses Systems erwies sich die Tatsache, daß eine Auswertung durch mehrere Arbeitsgruppen technisch unterstützt wird. Entsprechend der Gliederung des Interviewleitfadens und der Zielsetzung ergaben sich die folgenden vier Themenkomplexe für die endgültige Darstellung: • Grundhaltungen: Diese betreffen nicht die Einstellung der Befragten zu unterschiedlichen Positionen der theoretischen Ethik, sondern im Sinne von H.-M. Sass [7: 217f.] zu für den medizinischen Bereich wesentlichen ethischen „Halbfertigprodukten“, die durch Begriffe wie Mitleid, Bedürftigkeit oder Motivation zur Arbeit charakterisiert sind. • Patientenorientierung: Hier steht einerseits die allgemeine Haltung der Befragten zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Patienten und seiner Krankheit im Vordergrund, andererseits die Frage, wie Patienten in die Behandlung miteinbezogen werden und wie das Personal den einzelnen Patienten bei der Bewältigung seiner Krankheit unterstützt. Ein zentraler Aspekt ist in diesem Zusammenhang auch die Schmerzbehandlung. • Organisation und Kommunikation: Dieser Punkt beschäftigt sich mit den organisatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere mit der Frage, wie Entscheidungsprozesse auf 7 den Stationen in konkreten Situationen ablaufen und wie die Kommunikation zwischen Personal und Patient sowie zwischen den Angehörigen der heilenden Berufe untereinander organisiert ist. • Rechtliche und ökonomische Fragen: Im Rahmen dieses Themenkomplexes stehen vor allem der konkrete Umgang mit Patientenrechten, das Problem der Verschwiegenheit gegenüber Dritten sowie ethische Probleme im Zusammenhang mit der Mittelverteilung im Vordergrund. Bei der Aufbereitung des Materials wurde primär die Form des zusammenfassenden Protokolls gewählt. Durch Zusammenfassung der einzelnen Kategorien zu allgemeinen, übergeordneten Kategorien war es auch möglich, deskriptive Systeme zu entwickeln. Im Bereich der Aufklärung wurden beispielsweise die Antworten auf die Frage nach umfassender Information bei schwerer Erkrankung nach dem Schema „dafür“, „dagegen“, „teilweise“, „weiß nicht“ kategorisiert. Diese Einteilung erlaubte in der Folge eine statistische Auswertung hinsichtlich der durch den Planungsraster definierten Strukturmerkmale. Auch wenn man sich bewußt sein muß, daß bei einer qualitativen Studie nicht von einer Repräsentativität im strengen statistischen Sinn gesprochen werden kann, so zeigen sich doch bei einigen Themen deutlich funktionsspezifische, stationsspezifische und krankenhausspezifische Haltungen und Vorgaben. So lautet beispielsweise ein Ergebnis der Studie, daß angesichts der Bedeutung des Themenkomplexes Ethik und Wirtschaftlichkeit sehr wohl krankenhausspezifische Unterschiede festzustellen sind. Ebenso wird bei den Antworten zu anderen Fragen deutlich, daß hinsichtlich der Grundhaltungen bei den Pflegekräften eher eine einheitliche Linie zu finden ist als bei den Ärzten. Im folgenden sollen einige Ergebnisse anhand zweier zentraler medizinethischer Themen, der Patientenorientierung und der Kommunikation, dargestellt werden. 2. ERGEBNISSE AM BEISPIEL DER PATIENTENORIENTIERUNG Als naturwissenschaftlich orientierte Disziplin, die eine qualitativ hochwertige und objektiv wirkungsvolle medizinische Behandlung für die gesamte Bevölkerung anzubieten sucht, wird vor allem der physischen Krankheit Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl Krankheit als ein Zustand anzusehen ist, der sich sowohl im körperlichen und psychischen Befinden als auch im sozialen Verhalten manifestieren kann und manifestiert. Kritische Betrachtungen dieser einseitigen Behandlung, besonders im Rahmen der Medizinethik und der Medizinpsychologie, sind bemüht, auch die beiden anderen Aspekte der Krankheit in einem wissenschaft- 8 lichen Sinn zu berücksichtigen und in die Behandlung miteinzubeziehen. Von zentraler Bedeutung sind hierbei die Interaktionen zwischen den Patienten und den Angehörigen der heilenden Berufe auf sachlicher wie auf emotionaler Ebene. Im Rahmen der Studie wurden in diesem Zusammenhang drei Aspekte näher untersucht: A Botschaft und Deutung der Krankheit: Hierbei gilt es einerseits, die Interpretation der Begriffe bei den Befragten zu erfassen, andererseits ist festzustellen, welche Haltung die Interviewten zu Botschaft und Deutung einer Krankheit einnehmen und ob sie im Umgang mit den Patienten und deren Behandlung berücksichtigt werden. B Selbstbestimmung des Patienten: Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, ob bzw. inwieweit Patienten in Entscheidungen über ihre Behandlung miteinbezogen werden und wie die Angehörigen der heilenden Berufe zum Behandlungsabbruch auf Wunsch des Patienten stehen. Diese Aussagen sind mit den Idealvorstellungen des Informed Consent zu vergleichen. Überdies wird konkret nach dem Eingehen auf Wünsche des Patienten während der Behandlung und nach der Möglichkeit des individuellen Umgangs mit Patienten bei gleicher Diagnose gefragt. C Schmerzstillung: Eine der wichtigsten Ausdrucksformen der Krankheit für den Patienten selbst ist der Schmerz. Da dem Schmerz somit eine zentrale Rolle zukommt, wird in einer gesonderten Frage die Haltung der Interviewten zur Schmerztherapie und ihre konkrete Umsetzung auf den einzelnen Stationen erfragt. A) Botschaft und Deutung der Krankheit Die Auseinandersetzung mit der Botschaft bzw. der Deutung einer Krankheit ist als Versuch anzusehen, Krankheit in einem über die Schulmedizin hinausgehenden Sinn zu interpretieren und zu verstehen. Wesentlich für die Einbeziehung von Botschaft und Deutung einer Krankheit ist die Kommunikation zwischen Angehörigen der heilenden Berufe und den Patienten. Überlegungen dieser Art sind sehr komplex und setzen ein hohes Maß an theoretischer Reflexion voraus. Folglich ist im Rahmen dieser Fragen ein im Vergleich zu anderen Fragestellungen überdurchschnittlich hoher Anteil an Antworten nicht auswertbar; auch die Interviewer waren zu einem großen Teil nicht in der Lage, den Befragten die Beantwortung durch entsprechende Gesprächsführung zu erleichtern. Von den auswertbaren Antworten sind jene der Ärzte durchgehend ausführlicher als jene des Pflegepersonals. 9 Was die Botschaft einer Krankheit betrifft, so lassen sich die Antworten im wesentlichen vier Kategorien zuordnen: • Botschaft als Hinweis auf ein Krankheitsbild: Hierbei geht es um Erkrankungen mit diffusem Krankheitsbild, wobei die Interviewten in diesem Zusammenhang häufig die Ansicht äußern, daß das naturwissenschaftlich orientierte kausale Erklärungsschema der Medizin des öfteren an seine Grenzen stoße. In den 40 Antworten (26%) werden fast immer Schmerzen genannt, die auf seelische oder andere Probleme hindeuten. Typisch sind auch regelmäßig wieder auftretende Kopf- oder Bauchschmerzen. Die Patienten kommen immer wieder in das Krankenhaus, ohne daß eine Besserung eintritt, oder die Beschwerden verlagern sich von einem Organ zum anderen. • Botschaft als Hinweis auf eine bestimmte Lebensweise der Patienten: In 35 Fällen (22%) wird auf bestimmte Streßfaktoren im Leben der Patienten hingewiesen: Zum einen Probleme der Patienten, die zu Streß führen und damit die Krankheit auslösen, zum anderen eine ungesunde Lebensweise, insbesondere Alkohol- und Nikotinkonsum. • Botschaft als Hinweis auf die psychische Situation der Patienten: Diese Aussage zielt auf ein ganzheitliches Erklärungsmuster ab und wird von 32 Befragten (20%) verwendet. Diagnostiziert werden entweder eine psychosomatische Erkrankung oder eine Depression. • Botschaft als Hinweis auf das Schicksal der Patienten: Dieses Erklärungsmuster wird nur viermal verwendet und interpretiert den Begriff der Botschaft in eher philosophischem Sinne, indem die Krankheit als Störung oder Disharmonie angesehen wird. Insgesamt lassen sich unterschiedliche Interpretationen durch Ärzte bzw. Pflegekräfte feststellen: Während die Ärzte ein psychosomatisches Erklärungsmuster bevorzugen, betonen die Pflegekräfte soziale Faktoren und individuelle Verhaltensmuster. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß die bei D. von Engelhardt [9] zitierten Begriffe über das Erleben der Krankheit durch Patienten nur zu einem geringen Teil wiederholt angesprochen werden (Schmerz, Schuld). Selten nur finden sich Argumente wie die Sicht von Krankheit als Chance oder als Herausforderung. Eine klare Stellungnahme zur Deutung findet man nur in 114 Interviews (73%). Diese lassen sich im wesentlichen in die folgenden drei Kategorien einteilen, wobei die ersten beiden nur von neun beziehungsweise zwölf Befragten verwendet werden: • Deutung als Interpretation der Symptome durch die Patienten: Hier benennt der Patient seine Symptome und versucht sie zu interpretieren. 10 • Deutung als ganzheitlich objektive Erklärung: Es werden sowohl die physischen als auch die psychischen und sozialen Probleme des Patienten berücksichtigt und die Persönlichkeit des Patienten als Einheit dieser Faktoren betrachtet. • Deutung als persönliche Interpretation durch die Patienten: Dieses zahlenmäßig am häufigsten verwendete Erklärungsmuster beinhaltet sowohl personenbezogene Diagnosen („der Patient kennt sich selbst am besten“) als auch psychische Probleme, die im Zusammenhang mit der Krankheit stehen. Auch die Verbindung von Krankheit mit Schuld wird in diesem Zusammenhang mehrmals genannt, wobei eine derartige Verbindung aber generell abgelehnt wird. Etwa zwei Drittel der Befragten stehen der Berücksichtigung einer Botschaft oder Deutung von Krankheiten positiv gegenüber. Diese Befürworter argumentieren mit der Möglichkeit, sich ein ganzheitliches Bild zu verschaffen und entsprechend auf den Patienten differenzierter eingehen zu können. Als wesentlicher Vorteil bei der Einbeziehung von Botschaft und Deutung einer Krankheit wird der Informationsgewinn über die Patienten genannt. Für den Patienten selbst wird die Auseinandersetzung mit seiner Krankheit als positiv bewertet. Vornehmlich Ärzte artikulieren hier die Bedeutung der Deutung und Botschaft einer Krankheit im Rahmen einer veränderten Einstellung zur Krankheit und deren Bewältigung. Allerdings wird auch bei diesen Befragten, die sich grundsätzlich für die Berücksichtigung einer Botschaft oder Deutung von Krankheiten aussprechen, einige Male eine gewisse Distanz deutlich, da sie verschiedene Probleme inhaltlicher wie organisatorischer Art aufwerfen kann - insbesondere im Fall von falschen Deutungen durch die Patienten. Des öfteren wird die Deutung der Krankheit durch den Patienten zwar aufgenommen, man behält sich aber die Entscheidung vor, ob man diese Deutung auch berücksichtigt oder nicht. Stark abhängig ist die Rolle, die die beiden Begriffe im Rahmen der Diagnosestellung spielen, von der Art der Krankheit: Am ehesten werden sie bei schweren oder chronischen Erkrankungen bzw. bei Erkrankungen mit diffusem Schmerzbild bedeutsam. Als Hindernisse für eine angemessene Berücksichtigung der Botschaft und Deutung von Krankheiten werden vor allem organisatorische und zeitliche Probleme genannt: Um eine ausführliche Anamnese durchführen zu können, ist eine funktionierende, oft zeitaufwendige Kommunikation zwischen den Patienten und den Angehörigen der heilenden Berufe erforderlich. Oft erlaubt es gerade der Zeitmangel aber nicht, diese Beziehung zwischen Arzt und Patient aufzubauen und damit Botschaft und Deutung einer Krankheit angemessen zu berück- 11 sichtigen. Überdies wird einige Male auch die mangelnde (psychologische) Ausbildung der Angehörigen der heilenden Berufe angesprochen. Abschließend ist festzuhalten, daß starke stationsspezifische Unterschiede bezüglich der Berücksichtigung der Botschaft und Deutung von Krankheiten vorhanden sind. Am geringsten ist die Bedeutung der beiden Begriffe auf chirurgischen und Intensivstationen, am größten auf gynäkologischen, psychiatrischen und Kinderstationen. Dennoch zeigt sich keine einheitliche Linie auf einzelnen Stationen oder in einzelnen Krankenhäusern, die Interpretation oder Berücksichtigung einer Botschaft und Deutung ist im wesentlichen von der Persönlichkeit und dem Reflexionsniveau der einzelnen Befragten abhängig. B) Selbstbestimmung der Patienten Für Konflikte im Bereich der Medizinethik sorgt seit einigen Jahrzehnten vor allem die Spannung zwischen einer traditionellen paternalistischen Haltung der Ärzte einerseits und einer immer heftiger eingeforderten Autonomie der Patienten andererseits. Grundlegende Voraussetzung für eine vom Patienten zu treffende Entscheidung ist eine umfassende Aufklärung durch den Arzt. Entsprechend wird im Rahmen der Diskussion als zentraler Begriff jener des Informed Consent geprägt, die durch ärztliche Aufklärung unterstützte, aber selbstbestimmte Einwilligung des Patienten zu einer Behandlung. Für die Angehörigen der heilenden Berufe können sich durch ein Handeln im Sinne des Informed Consent Konflikte ergeben, die ihrem Berufsziel des Heilens widersprechen, indem z.B. ein Patient eine Behandlung ablehnt, weil er entweder eine andere, vom Arzt nicht angebotene Behandlung vorzieht oder aber gar keine Behandlung in Anspruch nehmen will. Hierbei stehen die Prinzipien der Fürsorgepflicht und der Verantwortung der Angehörigen von heilenden Berufen dem Patienten gegenüber in Widerspruch zur Selbstbestimmung des Patienten. Die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit diesen Fragen wird z. B. von H. P. Wolff aufgezeigt: Beide, Selbstbestimmung und Paternalismus, geben nur Teilaspekte der ArztPatienten-Beziehung wieder und sind ihrer moralischen Natur nach ambivalent. Die ethische Problematik des Paternalismus liegt in der Vernachlässigung des Selbstbestimmungsrechtes und in dem unsicheren Vermögen des Arztes zu wissen, was jenseits der medizinischen Indikation - das Beste für den Patienten ist. Die ethische Problematik des Selbstbestimmungsanspruches beruht auf dem Verkennen des erodierenden Einflusses der Krankheit auf die Integrität und das Entscheidungsvermögen des Kranken. Er übersieht auch den hohen Rang, den die Fürsorge unter den moralischen Pflichten des Arztes einnimmt. [10:201f.] B. Schöne-Seifert hält zur Arzt-Patienten-Beziehung grundsätzlich fest, daß es bei dieser Thematik 12 zunächst weniger um spezifische Verbote oder Verpflichtungen eines Arztes in brisanten Einzelfragen geht als um grundlegende Weichenstellungen - bezüglich der Paternalismusfrage, der Reichweite ärztlicher Fürsorgepflicht und der moralischen Ermessenspielräume von Ärzten. Angesichts der großen Bedeutung, welche die moderne Medizin im Leben vieler Menschen hat oder haben kann, steht hinter dem Verständnis der Arzt- und Patientenrolle auch ein wichtiges Stück gesellschaftlichen Selbstverständnisses. [8: 594] Sie beschreibt im folgenden die drei unterschiedlichen, zur Diskussion stehenden Modelle des Arzt-Patienten-Verhältnisses: Das hippokratische Modell mit dem paternalistischen Arzt, der die Verantwortung für den Patienten übernimmt, welcher sich der Führung des Arztes anvertraut; das Vertragsmodell, in dem „der Patient vom Arzt nicht mehr und nicht weniger als kompetente fachliche Dienstleistungen“ erwartet; und schließlich das Partnerschaftsmodell, in welchem „der Arzt wieder näher an den Patienten heran(rückt), indem er als beratender Experte eine Mitverantwortung für möglichst angemessene Patientenentscheidungen trägt“ und ein „einfühlsames Miteinanderentscheiden“ die Regel ist [8: 595]. Die Vorzüge des dritten Modells aus theoretischer Sicht sind eindeutig: Aus liberaler Sicht ist dabei entscheidend, daß nur das dritte Konzept Raum für unterschiedliche Patientenbedürfnisse und -präferenzen bietet: Sollte der Patient es wünschen, kann auch hier ein Arzt anstehende Entscheidungen nach bestem eigenen Dafürhalten treffen oder sich aufs nüchterne Konstatieren von Fakten beschränken. Aber er legt sich nicht kraft seines Rollenverständnisses auf das eine oder andere fest. Um ein Vorgehen im Sinne des Informed Consent zu ermöglichen, ist die Einbeziehung des Patienten in die Festlegung der Behandlung grundlegende Voraussetzung. Die in diesem Zusammenhang gestellte Frage lautete: „Glauben Sie, sollen Patienten in Entscheidungen über ihre Behandlung respektiert werden? Warum sind Sie dieser Meinung?“ Diese Fragestellung, wie weit Patienten über ihre Behandlung selbst bestimmen können, deckt den Stellenwert auf, der dem Patienten im Krankenhausbetrieb zukommt und beleuchtet die Rolle, die er selbst dabei spielt. Im Rahmen dieser sehr allgemeinen Frage äußern sich 92% der Befragten positiv zur Selbstbestimmung des Patienten. Da im Krankenhaus die Einbeziehung des Patienten in die Behandlung zum guten Teil rechtlich geregelt ist, überrascht diese breite Zustimmung keineswegs. Es ergeben sich auch keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Funktion und den einzelnen Stationen. Betrachtet man die Antworten allerdings im Detail, so werden doch wesentliche Unterschiede innerhalb dieser generellen Zustimmung deutlich. Etwa in der Hälfte der zustimmenden Antworten verstehen die Befragten unter Einbeziehung des Patienten die einfache Informationsweitergabe und glauben, daß damit das Selbstbestimmungsrecht zur Genüge er13 füllt ist. Von der anderen Hälfte (31 Ärzte, 41 Pflegebedienstete) wird dem Patienten das grundsätzliche Recht auf Selbstbestimmung über den Körper im Krankheitsfall voll zugestanden. Bemerkenswert ist, daß nur in 13% der Antworten ausdrücklich das oben erwähnte, theoretisch zu favorisierende Partnerschaftsmodell angesprochen wird, in den anderen Fällen findet sich eine Mischung aus hippokratischem und Vertragsmodell. Es wird mehrheitlich angenommen, daß der Patient bei entsprechender Aufklärung der Behandlung ohnedies zustimmen wird, auch wenn er prinzipiell das Recht hat, diese abzulehnen. Das eigentliche ethische Dilemma wird dann deutlich, wenn es - aus welchen Gründen auch immer - nicht gelingt, gemeinsam mit dem Patienten eine von beiden Seiten als richtig erkannte Behandlung zu wählen, oder aber den Patienten wenigstens im paternalistischen Sinne von der Richtigkeit einer Behandlungsmethode zu überzeugen, denn nun wird der Arzt mit dem Patientenwunsch nach Behandlungsabbruch konfrontiert. In dieser konkreten Situation sind nur noch 55% bereit, dem Wunsch des Patienten nach Selbstbestimmung nachzukommen. Die Ärzte nehmen eine Verweigerung der Behandlung durch den Patienten nicht einfach zur Kenntnis, sondern leisten vielmehr intensive Überzeugungsarbeit und sind auch der Meinung, daß diese meist in ihrem Sinne auf den Patienten wirkt. Bezüglich der Berufsgruppen läßt sich festhalten, daß sich die Ärzte, insbesondere Primarii und Turnusärzte, etwas häufiger für die Respektierung des Patientenwunsches auf Beendigung der Behandlung aussprechen als die Pflegekräfte. Letztere beharren häufiger darauf, daß ihr Auftrag das Pflegen sei, nicht das Aufgeben. Ebenso deutlich machen die Angehörigen der Pflegeberufe auch, daß eine derartige Entscheidung über Wünsche bezüglich der Behandlung des Patienten auf jeden Fall in den Kompetenzbereich des Arztes fällt. Auch auf den Stationen zeigen sich signifikante Unterschiede: Die größte Ablehnung gegenüber einem durch den Patienten gewünschten Behandlungsabbruch findet sich auf den Intensivstationen, den Kinderstationen und in der Psychiatrie. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, daß man es auf diesen Stationen doch häufig mit Patienten zu tun hat, für die das Modell des Informed Consent nicht immer anwendbar ist. Auch die relativ hohe Ablehnungsquote auf den chirurgischen Stationen scheint im Hinblick auf eine vielfach eindeutige Behandlung verständlich. Trotz dieser stationsspezifischen Unterschiede läßt sich auch hier keine einheitliche, durch die Stationsführung vorgegebene Linie erkennen. Vielfach sind die Antworten von Angehörigen der gleichen Station diametral entgegengesetzt, und durch die Rolle des Befragten auf der Station geprägt. 14 Nur vereinzelt wird im Zusammenhang mit der Einbeziehung des Patienten in die Entscheidung über die Behandlung von Wünschen des Patienten gesprochen oder eine konkrete Form der Berücksichtigung der Individualität des Patienten bei der Behandlung genannt. Dies läßt den Schluß zu, daß bei diesen Fragen eher eine abstrakte Vorstellung im Vordergrund steht. Die Individualität des Patienten wird erst bei der konkreten Frage nach unterschiedlicher Behandlung angesprochen. Zwei Drittel der Befragten geben an, daß eine unterschiedliche Behandlung trotz gleicher Diagnose durchaus vorkomme und berufen sich hier zu einem sehr großen Teil auf die Individualität des Patienten. Auch hier scheint zwar die direkte Einflußnahme des Patienten nur gering zu sein, aber es sind - neben medizinischen - auch körperliche und psychische Faktoren, die eine individuelle Behandlung bedingen. Die Selbstbestimmung des Patienten allerdings wird nicht als Begründung für eine individuelle Behandlung angeführt. Das Argument der Individualität des Patienten fehlt in den Antworten auf die Fragen nach Selbstbestimmung des Patienten und Behandlungsabbruch völlig. Die Berücksichtigung der Individualität scheint somit erst dann von Interesse zu werden, wenn der Patient bereits zugesteht, sich einer Behandlung zu unterziehen. Wird die - tatsächliche oder vermeintliche Selbstbestimmung des Patienten thematisiert, ist es nie der einzelne Patient, sondern generell „der Patient“ als Kategorie, der betrachtet wird. Hier werden grundsätzliche Haltungen artikuliert - Haltungen, die sich einerseits mehrheitlich an den gesetzlichen Gegebenheiten orientieren, andererseits aber auch das Unbehagen angesichts einer Entscheidung des Patienten zum Ausdruck bringen, wenn diese nicht im eigenen Sinn gefällt wird. Wenn also auch von den meisten Ärzten und Pflegekräften die Selbstbestimmung des Patienten als gewährleistet betrachtet wird, so läßt sich insgesamt doch der Eindruck gewinnen, daß hier noch das klassische Bild der heilenden Berufe mit paternalistischen Vorstellungen und einer Betonung des Fürsorgeprinzips vorhanden ist. Nur in Ansätzen zeigt sich bei einigen Befragten eine konsequente Wandlung zu einem Verständnis von medizinischer Behandlung im Sinne eines Dienstleistungssystems mit dem Arzt als Berater des Patienten. Ähnlich verhält es sich mit Patientenwünschen. Prinzipiell kann der Wunschbegriff unterschiedlich gedeutet werden, etwa als Wunsch im Zusammenhang mit der Therapieplanung oder als Wunsch im Rahmen der Behandlung. Hier ist auffallend, daß fast durchgängig nur die zweite Interpretation angesprochen wird. Dies deckt sich auch mit den von D. von Engelhardt [9: 72f.] vorgestellten Ergebnissen einer Umfrage, daß der Patient hauptsächlich persönliche und Komfortwünsche äußert. Nur von 15 Befragten werden Wünsche nach Einbeziehung des Patienten in die Planung seiner Therapie erwähnt. Nicht klar ist in diesem Zu15 sammenhang, ob Wünsche dieser Art nur so selten geäußert werden, oder ob nicht auf sie eingegangen wird. Insgesamt entsteht aber auch hier der Eindruck, daß ein Handeln im Sinne des Patienten üblicher ist als ein gemeinsames Handeln mit ihm. C) Schmerzstillung Schmerz gehört für den Patienten zu den wesentlichen Ausdrucksformen seiner Krankheit. Dieser Schmerz kann nicht auf ein physiologisches Geschehen reduziert werden, sondern existiert ebenso auf der kognitiven, der sozialen sowie der emotionalen Ebene. Charakteristisch ist überdies die subjektive Wahrnehmung von Schmerz durch den Patienten eine Tatsache, die bereits bei den Fragen zur Botschaft und Deutung der Krankheit von den Interviewten am häufigsten angesprochen wurde. Im Zusammenhang damit geht es im folgenden vor allem darum, ob die Befragten die Schmerzstillung in ihrem Bereich für ausreichend erachten oder nicht. Laut einer UN-Statistik liegt der Einsatz von Medikamenten zur Schmerzbehandlung in Österreich mengenmäßig lediglich im unteren Mittelfeld der europäischen Staaten [vgl. 3: 114ff.]. Insgesamt sind 59% der Befragten der Ansicht, die Schmerzstillung in ihrem Bereich sei sehr gut, gut, oder - wie in den meisten Fällen - ausreichend. Knapp 22% äußern sich dahingehend, daß zu wenig Schmerzmittel verabreicht würden. Aus den restlichen Antworten lassen sich keine klaren Stellungnahmen eruieren. Bezüglich der stationsspezifischen Unterschiede läßt sich das negativste Bild auf den internen Stationen feststellen: hier sind nur mehr 50% der Meinung, die Schmerzstillung sei ausreichend, während über 32% über zu wenig Vergabe von Schmerzmitteln klagen. Bemerkenswert erscheint im Rahmen der Antworten auf diese Frage, daß sowohl in den positiven wie in den negativen Äußerungen häufig Probleme mit der Schmerzstillung angesprochen werden. Insgesamt 66 Personen (48,9% der auswertbaren Antworten, davon 36 Ärzte und 30 Pflegekräfte) machen Aussagen über Probleme in der Schmerzbehandlung. Die genannten Probleme lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: • Medizinische Probleme: Hier werden krankheitsbedingte Probleme (schmerzintensive Krankheitsbilder, Kontraindikationen), patientenbedingte Probleme (keine Mitteilung über Schmerzen, Schmerztherapie bei Säuglingen und Kleinkindern) sowie Behandlungsprobleme (schlechte Dosierung, fehlende Aufklärung, undifferenzierte Schmerztherapie) genannt. • Organisatorische Probleme: Den größten Anteil haben in diesem Zusammenhang traditionsbedingte Vorurteile (26 Nennungen) - eine Problematik, die vor allem von Ärzten er- 16 kannt wird und ihre Basis in der grundsätzlichen Haltung der Gesellschaft zum Schmerz haben dürfte. Probleme der Kompetenz und der Ausbildung äußern sich im unsicheren Umgang mit Analgetika, der meist zu einer Unterdosierung führt, im Konkurrenzkampf zwischen Ärzten, in Fragen nach der Zuständigkeit und in Forderungen nach Schulungen (auch für Pflegekräfte). An internen organisatorischen Problemen werden schließlich noch die mangelnde Informationsweitergabe beim Dienstwechsel, Unerreichbarkeit von Spezialisten im Notfall, Zeit- und Personalmangel genannt. Grundsätzlich läßt sich festhalten, daß die hohe Anzahl an positiven Aussagen über die Schmerzstillung nicht durch konkrete oder auch nur allgemeine Angaben über die Art und Weise, wie diese Zufriedenheit zustande kommt, gedeckt werden. Weit häufiger als konkrete Erläuterungen zur Schmerztherapie finden sich Aussagen über Probleme mit der Schmerzstillung. Besonders kritisch sind hierbei Turnusärzte eingestellt, während einige ältere Ärzte der Meinung sind, daß sich die Situation in Österreich in den letzten Jahren bereits etwas gebessert habe. Angaben über offensichtlichen Mißbrauch hingegen sind nur vereinzelt anzutreffen, geben aber in diesen wenigen Fällen Anlaß zu großen Bedenken, wenn z.B. von einer Physiotherapeutin berichtet wird, daß „Rückenpatienten“ mehr Schmerzmittel verabreicht werden, damit diese sich selbst versorgen können, um auf diesem Weg Personal und Zeit einzusparen. Lediglich von zwei Befragten (beide aus der psychiatrischen Klinik) wird die Frage der oben erwähnten ganzheitlichen Betrachtung des Schmerzes angesprochen, indem zwischen physischem und seelischem Schmerz differenziert wird. Zusammenfassung Eine gemeinsame Betrachtung der in diesem Kapitel behandelten Fragen ergibt folgendes Bild: Vorstellungen einer Botschaft bzw. einer Deutung von Krankheiten werden zu einem großen Teil sowohl von Ärzten als auch von Pflegekräften akzeptiert. Auch wird zwischen der von Ärzten wahrzunehmenden Botschaft einer Krankheit und der Deutung der Krankheit durch den Patienten differenziert. Das geringste Bewußtsein für Botschaft bzw. Deutung einer Krankheit läßt sich auf chirurgischen Stationen feststellen - dort akzeptiert man somit auch am wenigsten für den Patienten mit diesen Fragen verbundene Probleme. Generell ist aber keine einheitliche Stationslinie vorgegeben, es gibt genügend Spielraum für persönliche Entscheidungen. Bei den Ärzten sind generationsspezifische und somit meist hierarchische Unterschiede erkennbar: Primarärzte artikulieren eine andere Haltung als Turnusärzte, wobei letztere ein weniger naturwissenschaftliches Verständnis zeigen. 17 Bei Ärzten wie Pflegekräften überwiegen beispielhafte Antworten - ein konkreter Bezug zu Erfahrungen am Arbeitsplatz wird hergestellt. Erwartungsgemäß tendieren Pflegekräfte, die weit mehr Zeit mit dem Patienten verbringen, eher zu einer persönlich am Patienten orientierten Betrachtung, während Ärzte primär die Krankheit sehen und die Persönlichkeit des Patienten in diesen medizinischen Rahmen einzubinden suchen - unter Berücksichtigung psychosomatischer Phänomene. Generell ist ein Mangel in der Ausbildung zu konstatieren, wenn es darum geht, mit einem Patienten umzugehen und zu kommunizieren, der über medizinische Probleme hinausgehend persönliche Probleme artikuliert. Zunächst völlig unvorbereitet, kann der Arzt erst im Krankenhaus am einzelnen Patienten lernen; in der Organisation ist ein Umgang mit solchen Problemen nicht verankert. In diesem Zusammenhang stellt der Massenbetrieb im Krankenhausalltag sicher eine weitere Schwierigkeit dar. Des weiteren läßt sich eine Diskrepanz zwischen diesen theoretischen Aussagen und konkreten Antworten auf Fragen nach der Selbstbestimmung des Patienten bei der Behandlung, nach Patientenwünschen sowie nach der Schmerzstillung nicht übersehen: Bedingt durch die spezifische Situation im Krankenhaus haben medizinische Belange eindeutig Priorität. Psychische Belange des Patienten werden häufig als Hintergrundinformation aufgenommen, finden aber in ihren Inhalten nur nach Maßgabe von organisatorischen und zeitlichen Möglichkeiten Verwendung. Psychische und soziale Probleme werden somit von den Angehörigen der heilenden Berufe zwar wahrgenommen, scheinen aber kein zentraler Bestandteil der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu sein. Vielmehr ist das Verhalten stark von der Persönlichkeit der einzelnen Ärzte und Pflegekräfte abhängig. Auch innerhalb der Aussagen zur Selbstbestimmung des Patienten wird die Diskrepanz zwischen theoretischen Aussagen und konkreten Handlungsbeschreibungen deutlich. Die allgemeinen Antworten sind stark durch rechtliche Argumente geprägt und stehen nicht selten in direktem Widerspruch zu den danach beschriebenen konkreten Handlungen. Die tatsächliche Selbstbestimmung des Patienten ist weit reduzierter als von den Befragten zunächst artikuliert. Auch die Erfüllung von Patientenwünschen vermag diesen Eindruck nicht zu entkräften, da diese nicht mit der Selbstbestimmung des Patienten begründet wird, sondern im wesentlichen in sehr konventionellem Sinne gesehen und häufig auf körperliches Wohlbefinden und Komfort reduziert wird. Die Individualität des Patienten wird hier anläßlich kollidierender grundsätzlicher Einstellungen (Patientenautonomie versus Fürsorgepflicht) vollkommen vernachlässigt. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß Äußerungen dieser Art nicht auf jene Personen 18 beschränkt sind, die spektakuläre Fälle erwähnen (z.B. mit den Zeugen Jehovas), sondern von fast allen Befragten gemacht werden. Mit einer Behandlungsablehnung durch den Patienten beispielsweise will man sich nicht einfach abfinden, sondern man wird seine Aufklärungsarbeit intensivieren bzw. ausdrücklich Überzeugungsarbeit leisten, den Patienten zu überreden versuchen, um ihn doch noch zur Annahme der Therapie zu bewegen. So erscheint das „Ja“ der Mehrheit eher ein plakatives, vorschriftsgetreues zu sein, welches im Krankenhausalltag bewußt oder unbewußt immer wieder eingeschränkt wird. Hierbei ist auch zu bedenken, wo Patientenautonomie aufhört und Paternalismus beginnt. Denn es geht ja nicht nur um offensichtliche Fälle von Bevormundung des Patienten durch den Arzt, sondern streng genommen kann auch bereits eine nicht ganz ausgewogene Information (die z. B. die Nachteile im Fall einer Behandlungsverweigerung überbetont) oder aber auch die sogenannte „barmherzige Lüge“ im Fall von Patienten mit schlechter Diagnose als paternalistisches Verhalten angesehen werden. In diesem Zusammenhang fällt auf, daß jene theoretischen Modelle der ArztPatienten-Beziehung, wie sie die Medizinethik entwirft, von der Praxis, vom Krankenhausalltag, nicht selten weit entfernt sind. Das theoretisch zu favorisierende Partnerschaftsmodell ist als weitgehend nicht realisiert zu betrachten, stattdessen scheint eher eine Mischung des Vertrags- und des hippokratischen Modells üblich zu sein. Angesichts der Aussagen zur Schmerzstillung schließlich wird deutlich, daß nach wie vor ein gewisses Defizit in Österreich besteht. Traditionelle Vorurteile sind verbreitet, Ausbildungs- und organisatorische Probleme (insbesondere die Frage nach Zuständigkeit) verstärken die Problematik. Lediglich im postoperativen und Intensivbereich scheint die Schmerzbehandlung internationalem Standard zu entsprechen. Bei den Turnusärzten ist ein gewisser Gesinnungswandel spürbar. Generell läßt sich bei Ärzten ein größeres Bewußtsein für Mängel im Bereich der Schmerzstillung feststellen als bei Pflegekräften. 3. ERGEBNISSE AM BEISPIEL DER KOMMUNIKATION Im Krankenhaus stellt die Kommunikation einen zentralen Bereich dar - sowohl die Kommunikation mit dem Patienten als auch die Kommunikation der Angehörigen der heilenden Berufe untereinander. Der Patient hat es nicht mit einer, sondern mit einer Gruppe von Betreuungspersonen zu tun, die er überdies nicht selbst gewählt hat. Eine Bezugsperson muß somit erst gefunden werden - womit noch nicht gesichert ist, ob diese Bezugsperson dann auch berechtigt ist, mit ihm (medizinische) Gespräche zu führen bzw., ob sie über die notwendigen Kompetenzen zur Gesprächsführung verfügt. Die in den letzten Jahrzehnten immer 19 wieder geforderte ausbalancierte Partnerschaftlichkeit der Beziehung zwischen Arzt und Patient wird gerade im Krankenhausalltag häufig nicht herzustellen sein. Eine Aufhebung des Informationsgefälles zwischen Arzt und Patient scheint nicht nur in den Fällen auf Grenzen der Realisierbarkeit zu stoßen, in denen der Patient eventuell ohne Bewußtsein ist oder akute Erkrankungen ein schnelles Handeln erfordern, sondern auch dadurch, daß Ärzte häufig unter großem Zeitdruck stehen bzw. eine Kontinuität in der Patientenbetreuung nicht gegeben ist. Zweifellos hilfreich wäre in diesem Zusammenhang ein funktionierender Kommunikationsfluß zwischen Ärzten und Pflegekräften, da die Pflegekräfte, die weitaus mehr Zeit mit dem Patienten verbringen, besser über die Persönlichkeit des Patienten (z.B. seine Werthaltungen) informiert sind. Aus diesen Vorüberlegungen ergeben sich folgende drei Aspekte der Kommunikation im Krankenhaus, die wir näher untersuchen wollen: A Aufklärung des Patienten B Einbeziehung der Pflegeberufe in die Aufklärung C Supervision A) Aufklärung des Patienten Im Zusammenhang mit der Frage, welche Bedeutung Aufrichtigkeit hat und wie sie sich auf die Arbeit auswirkt, spricht die überwiegende Mehrheit der Befragten der Wahrheit am Krankenbett große Bedeutung zu. An Auswirkungen auf die Arbeit werden im wesentlichen zwei genannt: zum einen, daß Aufrichtigkeit zentraler Bestandteil des Vertrauens zwischen dem Patienten und den Angehörigen der heilenden Berufe sei, zum anderen, daß Unaufrichtigkeit häufig ein belastendes Moment sowohl für den Patienten als auch für das Personal darstelle. Auf beiden Seiten bewirkt Unaufrichtigkeit Verunsicherung - eine Verunsicherung, die enorme Auswirkungen auf Kommunikation und Beziehung zwischen dem Patienten und den Angehörigen der heilenden Berufe hat. Hat der Patient das Vertrauen in die ihn Betreuenden verloren, entsteht eine negative Atmosphäre im Krankenzimmer, die bester Nährboden für Kommunikationsprobleme, wie z.B. Mißverständnisse ist. Stark beeinträchtigt durch diese Atmosphäre ist die Arbeit von Ärzten und Pflegekräften, da das Personal einerseits sich bei der Arbeit nicht wohl fühlt, der Patient andererseits häufig die Mitarbeit verweigert. Entsprechend wird als Vorteil einer aufrichtigen Information das Vertrauen des Patienten genannt, welches sich nach Ansicht der Befragten in der Folge konkret in Form einer erleichterten Arbeit, einer besseren Kooperation des Patienten, eines positiven Einflusses auf den Umgang des Patienten mit seiner Krankheit sowie auf den Heilungsprozeß und schließlich einer persönlichen Erleichterung der Angehörigen der heilenden Berufe auswirke. Diese Vorteile gel- 20 ten auch dann, wenn der Patient die ihm mitgeteilte Diagnose zunächst nicht verkraften kann, da durch Aufrichtigkeit - so die Meinung vieler - erst die Grundvoraussetzung für eine unterstützende Intervention der Betreuenden während des Verarbeitungsprozesses gegeben ist. Die überwiegende Mehrheit der Befragten plädiert erwartungsgemäß für eine umfassende Aufklärung des Patienten (92%). Interessant sind in diesem Zusammenhang aber die Begründungsmuster, die dieser besonderen Betonung der Aufklärung zugrunde liegen: Das entscheidungsleitende Motiv ist das Wohl des Patienten, sehr viel seltener wird der Wille des Patienten thematisiert. Hier ist eine traditionelle Haltung unverkennbar, die die Aufklärung nicht etwa als Grundvoraussetzung für eine selbstbestimmte Entscheidung ansieht, sondern vielmehr als Bestandteil des Heilungsprozesses [vgl. 5]. Aufklärung dient nach Meinung einer Vielzahl der Befragten dazu, eine bessere Kooperation des Patienten zu bewirken und den Heilungsprozeß zu fördern. Entsprechend wird die Entscheidung über Aufklärung und Wahrheit am Krankenbett vor allem vom Parameter der psychischen Belastbarkeit abhängig gemacht. Entscheidungsleitendes Moment ist also nicht der in der bioethischen Diskussion so oft hervorgehobene Wille des Patienten, sondern seine - durch Arzt oder Pflegekraft definierte - psychische Belastbarkeit. Ein paternalistischer Grundtenor dieser Antworten ist bei Ärzten wie Pflegekräften nicht von der Hand zu weisen. Wenn auch in vielen Antworten auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, das Weltbild des Patienten zu erfragen, so ist dabei relativierend festzuhalten, daß hierfür nicht immer die Selbstsicht des Patienten erforderlich oder ausschlaggebend ist. Einigen Befragten (5%) erscheint durchaus auch die von den Angehörigen vermittelte Fremdsicht ausreichend. Selbst jene Interviewten, die ausdrücklich mit dem Recht des Patienten argumentieren (eine Argumentation, die vorrangig von Ärzten der oberen Hierarchieebene artikuliert wird) berufen sich nicht auf den Patientenwillen, sondern auf die rechtliche Situation. Weder wird das Recht auf Information direkt mit dem Willen des Patienten in Verbindung gebracht, noch wird die Selbstbestimmtheit der Willensäußerung je thematisiert. Vielmehr wird das Recht auf Information als legistisches Argument auch dann proklamiert, wenn es in Konflikt mit dem Patientenwillen tritt, indem man von einer Aufklärungspflicht spricht, auch wenn der Patient beispielsweise nicht informiert werden will. Hier hantieren die Befragten mit kategorischen Geboten, die das Selbstbestimmungsrecht des Kranken nicht berücksichtigen. Oft erfolgt der Rekurs auf den Patientenwillen in dem verkürzten Sinn, die Verdrängungstendenzen des (todkranken) Patienten respektieren zu müssen. Das dritthäufigste Begründungsmuster ist die geistige Aufnahmefähigkeit des Patienten. Genau dieses Argument ist Ausdruck einer traditionell paternalistischen Grundhaltung. 21 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß gerade bei älteren Menschen die geistige Aufnahmefähigkeit mehrfach grundsätzlich in Frage gestellt wird, ohne hierbei die tatsächliche Aufnahmefähigkeit zu berücksichtigen oder zu eruieren. Diese stereotype Gleichsetzung von Betagtheit und reduzierter Aufnahmefähigkeit führt einige Male dazu, daß auch bei einwilligungsfähigen älteren Patienten auf eine umfassende Aufklärung verzichtet wird. Zum Aufklärungsgespräch selbst (vor allem bei schweren Erkrankungen) wird von den meisten Befragten auf den prozessualen Charakter verwiesen sowie auf die Notwendigkeit, daß man dem Patienten nie all seine Hoffnung nehmen dürfe. Auch in diesen Antworten dominiert das Prinzip der Fürsorge: Den meisten Befragten erscheint es weniger tragisch, dem Patienten etwas zu verschweigen als ihn durch umfassende Information eventuell zu überfordern. Wie bereits im Rahmen der Patientenorientierung wird hier ein Bild der heilenden Berufe vermittelt, das eher den beschützenden und beistehenden Helfer hervorhebt als den auf Symmetrie ausgerichteten Gesprächspartner. Bemerkenswert ist der Mangel an Reflexion über die eigene Kompetenz, Aufklärungsgespräche zu führen, obwohl 18% der Befragten der Meinung sind, daß auf der jeweiligen Station keine umfassende Aufklärung betrieben würde. 40% der Befragten erklären, die Aufklärung auf der Station sei „teilweise umfassend“ und nur 30% der Befragten sind der Meinung, die Aufklärung auf der Station sei tatsächlich „umfassend“. Diese häufig beklagten Defizite werden zum überwiegenden Teil der vermeintlich fehlenden Gesprächskompetenz der jeweils anderen Berufsgruppe zugeschrieben. Die in diesem Zusammenhang am häufigsten geäußerten Kritikpunkte sind neben patientenbezogenen Gründen für Kommunikationsprobleme (wie vor allem Verdrängungsmechanismen) mangelndes Eingehen auf den unterschiedlichen Sprachcode von Ärzten und Patienten, zu schnelle und nicht am Patienten orientierte Aufklärung, Unsicherheit der Ärzte angesichts schwerer Erkrankungen sowie mangelnde Ausbildung in Kommunikationsfragen. B) Einbeziehung der Pflegeberufe in die Aufklärung Jahrhundertelang war medizinische Ethik mit ärztlicher Ethik gleichzusetzen, allmählich aber scheint der Arzt seine prominente Rolle als Entscheidungsträger zugunsten des handelnden Teams verloren zu haben. Gerade das Selbstverständnis der Pflege macht in den letzten Jahren einen enormen Wandel durch. Vor diesem Hintergrund soll im folgenden Abschnitt eruiert werden, inwieweit die Angehörigen der Pflegeberufe faktisch am Aufklärungsgespräch beteiligt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß diese Frage im wesentlichen das diplo- 22 mierte Personal betrifft, da Pflegehelfer, Oberinnen und Schüler sich zum größten Teil für die Aufklärung weder ausgebildet noch zuständig fühlen. Grundsätzlich besteht in beiden Berufsgruppen Konsens darüber, daß eine Erstaufklärung des Patienten - verstanden als Diagnosemitteilung - durch den Arzt zu erfolgen hat. Dennoch wird die Aufklärung nicht zur rein ärztlichen Domäne gemacht, vielmehr findet nach Aussage der überwiegenden Mehrheit eine Rollenaufteilung statt: der Arzt klärt auf, die Pflegekraft betreut nach. Die Nachbetreuung wird deshalb zu den Aufgaben der Pflegekräfte gezählt, da diese weitaus mehr Zeit mit dem Patienten verbringen und somit leichter eine Beziehung zum Patienten aufbauen können. Häufig hat der Patient mehr Vertrauen zu den Pflegekräften als zum Arzt. Sehr unterschiedlich sind die Aufgaben, die der Nachbetreuung zugehörig betrachtet werden. So werden allen voran menschliche Zuwendung und psychische Unterstützung genannt, doch nach Ansicht der Befragten beschränkt sich das Aufgabengebiet der Pflegekräfte keineswegs auf die rein psychische Betreuung. Eine wesentliche Funktion, die die Befragten den Pflegekräften zusprechen, ist die Vermittlung wichtiger Informationsdetails, für die das Arzt-Patienten-Gespräch entweder keinen Raum geboten hat oder die vom Patienten nicht sofort aufgenommen werden konnten. So betonen viele Befragte, daß eine Information wiederholt werden müsse, daß nach der ärztlichen Erstaufklärung weitere, detailliertere Informationen gegeben werden müßten und daß die gelegentlich für den Patienten unverständliche Sprache des Arztes in eine patientengerechte Sprache zu übersetzen sei. Immer wieder schimmert die Vorstellung durch, die der Pflegekraft die Rolle der Vermittlungsfunktion zwischen Arzt und Patient zuschreibt, eine Vermittlerrolle, die sich beispielsweise darin äußert, daß die Pflegekraft den Arzt auf etwaige Informationsdefizite hinweist. Auch wenn das Bild vom Arzt als Überbringer der „harten Diagnose“ und der Pflegekraft als vorrangig seelischem Betreuer kaum mehr der Realität entsprechen mag, als Rollenbild beherrscht es sehr wohl die Aussagen in den Interviews. Dies wird auch in den Antworten auf die Frage nach dem eigenen Gesprächsführungsstil bestätigt. Während die Pflegekräfte ihren Gesprächsstil vornehmlich als menschlich-emotional einstufen, betonen die Ärzte eher die sachliche Komponente ihrer Gesprächsführung. Dementsprechend geben die Ärzte an, im Gespräch vorwiegend an der Krankheit des Patienten orientiert zu sein, während für das Gespräch bei den Pflegekräften der Patient selbst mit seinen Bedürfnissen und Ängsten ausschlaggebend ist. Erstaunlich ist auch in diesem Zusammenhang das geringe Bewußtsein für Fragen der Kommunikation. So wird ein sachliches Gespräch überwiegend in verkürzter Weise mit einem Gespräch über die Krankheit gleichgesetzt, und unter einem emotionalen 23 Gespräch wird häufig all das undifferenziert subsumiert, was in den außermedizinischen Bereich fällt. So bleiben auch Antworten, die auf eine bewußte Auseinandersetzung der Befragten mit ihrer Gesprächsführung schließen lassen, die große Ausnahme. Während im allgemeinen bezüglich der Kommunikationsfragen keine Unterschiede zwischen den Stationen festzustellen sind, ist auf die positive Sonderstellung der Mitarbeiter der Psychiatrie hinzuweisen: Bereits bei der Frage nach der eigenen Gesprächsführung fällt auf, daß sie offensichtlich über eine wesentlich differenziertere Gesprächskultur verfügen. Überdies ist bei der Frage nach der Beteiligung der Pflegeberufe an der Aufklärung nur wenige Male ausdrücklich von einer Zusammenarbeit die Rede. Unter diesen wenigen befinden sich zu einem großen Teil Mitarbeiter der Psychiatrie. Von Ärzten wie von Pflegekräften sind die gleichen positiven Antworten zu hören; beide Seiten bringen ein großes Interesse an einer engen Zusammenarbeit zum Ausdruck, die offensichtlich auch in der Praxis immer mehr umgesetzt wird. Beispiele sind die Anwesenheit des Pflegepersonals bei Aufklärungsgesprächen, gemeinsame Fortbildungen, auf Pflegekräfte abgestimmte Vorträge in medizinischen Fragen. Allen Beteiligten scheint die große Bedeutung eines guten Informationsflusses bewußt zu sein, und man bemüht sich um die Umsetzung dieses Ideals. Betrachtet man die Gesamtheit der Befragten, so betonen zwei Drittel die Wichtigkeit eines funktionierenden Informationsflusses. Die Hälfte davon ist der Meinung, daß die Kommunikation an ihrem Arbeitsplatz gut funktioniere. Die andere Hälfte spricht in ihren Antworten davon, wie wichtig der störungsfreie Informationsfluß sein sollte. Häufig läßt sich aus den Antworten nicht eruieren, ob die Idealvorstellungen auch tatsächlich umgesetzt werden, die Formulierung „sollte“ läßt aber doch berechtigte Zweifel daran aufkommen. Kommunikationsschwierigkeiten im Krankenhaus gehen vor allem auf Kosten des Patienten. Eine der häufigsten Forderungen im Zusammenhang mit der Frage nach der Einbeziehung der Pflegeberufe ist von daher eine einheitliche Linie gegenüber dem Patienten. Interessanterweise wird dieses Argument sowohl von jenen eingebracht, die sich für eine Beteiligung der Pflegeberufe an der Aufklärung aussprechen als auch von jenen, die gegen eine Einbeziehung sind. Die Befürworter begründen ihre Ansicht damit, daß, wenn alle Betreuenden über den Patienten informiert sind, er auch von allen die gleiche Information erhalte, wodurch der Patient mit mehreren Personen sprechen oder aber sich eine Vertrauensperson seiner Wahl suchen könne. Die Gegner ihrerseits argumentieren, daß mehrere Ansprechpartner auch mehrere Meinungen äußerten, womit der Patient verunsichert werde. Deshalb habe nur derjenige den Patienten zu informieren, der auch die Verantwortung trage. 24 Bemerkenswert erscheint angesichts der Frage nach der Einbindung der Pflegekräfte in die Aufklärung die Einordnung, die die Beteiligten selbst vornehmen: Ob man die Pflegekräfte integriert sieht oder nicht, hängt zum einen davon ab, wie eng oder weit die Befragten den Aufklärungsbegriff fassen, zum anderen davon, wie man seine Beteiligung an der Aufklärung einschätzt. Etwas über die Hälfte der Interviewten sieht Aufklärung im engen Sinne als rein medizinische Aufklärung, die entsprechend den Ärzten vorbehalten bleibt. Es gibt eine strenge Unterscheidung zwischen medizinischer und pflegerischer Information und ein Beharren auf getrennten Kompetenzbereichen. Verweise auf die jeweilige (Nicht-) Zuständigkeit sowie auf die rechtliche Situation sind häufig. Von einigen Pflegekräften wird auch erklärt, daß sie nicht mehr in die Aufklärung integriert werden wollen, da sie damit auch mehr Verantwortung übernehmen müßten. In diesem Zusammenhang wird häufig die Forderung nach einer besseren medizinischen Ausbildung der Pflegekräfte als Voraussetzung für eine stärkere Einbeziehung in die Aufklärung genannt. Die andere Hälfte ist der Meinung, daß die Aufklärung mit dem Gespräch zwischen Arzt und Patient noch nicht abgeschlossen sei, sondern auch die Nachbetreuung beinhalte. Jene strikten hierarchischen und rechtlichen Grenzen, die von der anderen Gruppe gezogen werden, verschwimmen hier zugunsten einer Zusammenführung der beiden Berufsgruppen in ein gemeinsames Arbeiten und Handeln. Vorrang hat hier die Zusammenarbeit, für die ein funktionierender Informationsfluß zwischen den Berufsgruppen und zum Patienten unerläßlich ist. Hierin liegt auch der zentrale Kritikpunkt der Pflegekräfte: der Informationsfluß zwischen den Berufsgruppen erscheint einem großen Teil verbesserungswürdig. C) Supervision Die Vorfälle in der Wiener Krankenanstalt Lainz im April 1989 führten zu einer großen Diskussion über das Gesundheitswesen. Das Vertrauen in Ärzte und Pflegekräfte wurde durch die Tötung von Patienten in Lainz schwer erschüttert. Im Zuge der durch diese Tragödie eingeleiteten Reformen wurde die Supervision in Österreich gesetzlich verankert. Nachdem in den vorigen Fragen Probleme vor allem im Bereich der Kommunikation festgestellt wurden, sollte in der Studie untersucht werden, wie die Befragten zu den Lösungsmöglichkeiten durch eine Supervision eingestellt sind. Entgegen den Erwartungen im Rahmen der Vorbereitung der Studie wird Supervision offensichtlich nur in sehr geringem Ausmaß akzeptiert. Einerseits wird zwar von der Hälfte der Befragten Supervision als wichtig erachtet (die andere Hälfte ist überzeugt, Supervision nicht zu benötigen bzw. hat noch keine Erfahrung mit Supervision), andererseits ist das Bild 25 von Supervision zu einem großen Teil negativ geprägt. Häufigster Kritikpunkt ist, daß die Supervision nicht professionell durchgeführt werde. Des weiteren werden externe Supervisoren sowie eine Durchführung der Supervision außerhalb des Hauses gefordert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß sich unter jenen Befragten, die angeben, über Supervision nichts zu wissen, drei Primarii und zwei Stationsschwestern befinden, jene Personen also, in deren Zuständigkeitsbereich die Organisation von Supervisionen fällt. Nur 10% der Befragten betrachten Supervision als hilfreich. Von ihnen wird positiv bemerkt, daß Supervision dabei helfe, persönliche, patientenbezogene oder berufsgruppeninterne Probleme zu lösen, eine bessere Kommunikation zu bewirken, zu mehr Einsicht über sich selbst zu verhelfen, fachlich zu bilden und schließlich sich abzureagieren. Während die Ärzte mehr an medizinischen Problemen orientiert sind und deshalb teilweise auch ein Gespräch mit Kollegen als Supervision ansehen, geht es bei den Gesprächen der Pflegekräfte vor allem um patientenbezogene oder pflegeinterne Konflikte. So läßt sich festhalten, daß im Rahmen der Supervision ein dringender Aktualisierungs- und Professionalisierungbedarf besteht. Bereits Zweck und Ziel einer Supervision sind vielen Befragten nicht klar - Informationen hierüber erscheinen angebracht, womöglich bereits in der Ausbildungszeit. Zusammenfassung Im vorliegenden Abschnitt wird die Kommunikation im Krankenhaus am Beispiel der Aufklärung untersucht. Hierbei wird sowohl die Kommunikation zwischen den Angehörigen der heilenden Berufe und den Patienten berücksichtigt als auch die Kommunikation der Angehörigen der heilenden Berufe untereinander. Was die Aufklärung des Patienten betrifft, so spricht sich erwartungsgemäß die überwiegende Mehrheit grundsätzlich für eine umfassende Information aus. Interessanterweise werden aber nicht der Wille oder das Selbstbestimmungsrecht des Patienten als häufigste Begründung für diese Einstellung artikuliert, sondern das Wohl des Patienten. Die Aufklärung wird demnach vorrangig als Bestandteil des Heilungsprozesses betrachtet und weniger als Voraussetzung für eine autonome Entscheidung des Patienten im Sinne des Informed Consent. Als Entscheidungskriterium für das Ausmaß der Aufklärung fungiert dementsprechend weniger der Wille des Patienten als vorrangig die psychische Belastbarkeit des Patienten, die wiederum von der Beurteilung durch die Ärzte abhängig gemacht wird. Die Rollenverteilung zwischen den Ärzten als Überbringern der Diagnose und den Pflegekräften als seelischen Betreuern schimmert in den meisten Interviews noch durch. Un- 26 terschiede ergeben sich durch die Definition des Aufklärungsbegriffs: Während die eine Hälfte der Befragten die Aufklärung sehr eng als rein medizinische Aufklärung versteht und die Nachbetreuung durch die Pflegekräfte auf menschliche Zuwendung und psychische Unterstützung reduziert und entsprechend auf eine strenge Trennung der Kompetenzen beharrt, betrachtet die andere Hälfte die Nachbetreuung als der Aufklärung zugehörig und betont vermehrt die Notwendigkeit einer interprofessionellen Kooperation. Beide Haltungen werden mit dem Ziel einer einheitlichen Linie gegenüber dem Patienten begründet. Was die stationsspezifische Verteilung der Antworten angeht, so muß allgemein festgehalten werden, daß - mit Ausnahme der Mitarbeiter der Psychiatrie - auf allen Stationen ein sehr geringes Bewußtsein für verschiedene Kommunikationsebenen vorhanden ist. Eine umfassende und patientenorientierte Aufklärung verlangt eine gute Kommunikation mit dem Patienten und zwischen den Berufsgruppen. Vor allem aus den Stellungnahmen der Pflegekräfte läßt sich die Kritik an einem offenbar unbefriedigenden interprofessionellen Informationsfluß ablesen. Demgegenüber steht eine überraschend geringe Akzeptanz innerbetrieblicher Supervision, der vorwiegend mit Desinteresse, Vorurteilen und Ablehnung begegnet wird. SCHLUSSBEMERKUNGEN Betrachtet man die Antworten auf die hier vorgestellten Fragen gemeinsam, so ergibt sich folgendes Bild: Auf allgemeine Fragen werden grundsätzliche Haltungen zum Ausdruck gebracht, die vorrangig an der aktuellen Gesetzeslage orientiert sind und auf die Individualität des Patienten keine Rücksicht nehmen. Angesichts konkreter Fragen bzw. beispielhafter Schilderungen von eigenen Erfahrungen am Arbeitsplatz ergeben sich häufig Widersprüche zu den vorher artikulierten grundsätzlichen Einstellungen. Deutlich wird dies beispielsweise, wenn sich zunächst 92% der Befragten für die Selbstbestimmung des Patienten aussprechen, bei der konkreten Frage nach Behandlungsabbruch auf Wunsch des Patienten aber nur noch 55% dem Patienten in diesem Fall Selbstbestimmung zugestehen wollen. Auch das im Rahmen der Aufklärung angesprochene Recht des Patienten auf Information wird vorrangig als rein legistisches Argument verwendet. Dies zeigt sich beispielsweise an der Aufklärung. Von den meisten Befragten wird die Aufklärung zwar als wünschenswert erachtet, doch meist unter dem Gesichtspunkt eines daraus resultierenden therapeutischen Nutzens für den Patienten, etwa in dem Sinne, daß der wissende Patient den Heilungsprozeß besser fördern könne. In den seltensten Fällen nur wird das Erfordernis der Aufklärung mit der Voraussetzung für eine eigen- 27 ständige Entscheidung des Patienten begründet. Hier steht eine allgemeine Formulierung der Rechtslage, welche die Patientenautonomie besonders betont, konkreten Handlungsbeschreibungen gegenüber, die das Selbstbestimmungsrecht des Patienten weitgehend untergraben. Bei all diesen Aussagen kommt deutlich zum Ausdruck, daß das Autonomieprinzip vom Fürsorgeprinzip stark überlagert wird. Durchgängig wird weniger vom Handeln mit dem Patienten als vom Handeln im Sinne des Patienten gesprochen. Besonders deutlich wird diese Haltung, wenn bei alten Patienten die tatsächliche geistige Aufnahmefähigkeit gar nicht erst zu eruieren versucht wird, sondern von vornherein von einer reduzierten Aufnahmefähigkeit ausgegangen wird. Ebenso manifestiert sich diese Haltung, wenn das Ausmaß der Aufklärung nicht vom Willen des Patienten, sondern von seiner – vermeintlichen oder tatsächlichen – psychischen Belastbarkeit abhängig gemacht wird. Von einem theoretisch zu favorisierenden Partnerschaftsmodell jedenfalls ist man in der Praxis weit entfernt. Berufsgruppenspezifisch ist festzustellen, daß sich die Pflegekräfte bzgl. ihrer Handlungen im allgemeinen an der Persönlichkeit des Patienten orientieren, während die Ärzte den Patienten vorrangig als physisch Kranken sehen und persönliche Faktoren meist nur ergänzend berücksichtigen. Es sind vorwiegend die Pflegekräfte, die die Form der Aufklärung als mangelhaft bezeichnen. Zentrale Kritikpunkte sind hierbei eine zu rasche und nicht am Patienten orientierte Information sowie die nicht vorhandene Berücksichtigung der unterschiedlichen Sprachcodes von Arzt bzw. Patient. Dieser Umstand hat zur Folge, daß für die Pflegekräfte im Rahmen der Nachbetreuung viele Aufgaben hinzukommen, die über menschliche Zuwendung und psychische Unterstützung hinausgehen, wie beispielsweise die Erläuterung der Information in patientengerechter Sprache, die Vermittlung zusätzlicher Information oder die Vermittlung zwischen Arzt und Patient. Bemerkenswert ist das Ergebnis, daß in den Interviews sehr häufig eine mangelhafte Ausbildung für das Vorhandensein der verschiedenen Probleme verantwortlich gemacht wird: Von einigen Ärzten wie von vielen Pflegekräften wird explizit betont, daß viele Ärzte nicht darauf vorbereitet seien, mit subjektiven Äußerungen des Patienten umzugehen, die über medizinische Fragestellungen hinausgehen. Wiederholt wird auf kommunikative Defizite verwiesen, vor allem wenn es um die Aufklärung bei schweren Erkrankungen geht. Ein Defizit, das auch mit der fehlenden Verankerung geeigneter innerbetrieblicher Hilfestellungen in Verbindung gebracht wird, wenn man von der Supervision absieht. Doch die Supervision als einzige Möglichkeit, sich mit solchen Problemen an professionelle Hilfe zu wenden, scheint bei den Befragten bislang nicht allgemein akzeptiert zu sein. 28 Diese negative Bewertung der Supervision könnte auf den Umstand zurückzuführen sein, daß die Befragten nur zu einem äußerst geringen Teil über ein Bewußtsein für den eigenen Mangel an kommunikativer Kompetenz verfügen und stattdessen für vorhandene Kommunikationsdefizite meist Kollegen oder Angehörige der anderen Berufsgruppe verantwortlich machen. Somit bleibt das Verhalten in konkreten Situationen vorrangig von der Persönlichkeit und dem Reflexionsniveau des einzelnen Arztes bzw. der einzelnen Pflegekraft abhängig. 29 ANHANG: INTERVIEWLEITFADEN I. Ausbildung Beginnen wir mit dem Thema Ausbildung: 1 Fühlen Sie sich für die PatientInnenbetreuung ausreichend geschult? 2 Stellt das Wissen aus der Schulung eine Unterstützung der täglichen Arbeit dar? 3 Sind Sie ausreichend geschult worden im Hinblick auf Mitarbeiterführung? Wenn nein: Was würden Sie sich da wünschen? 4 Wurden Sie bei Ihrem Dienstantritt auf Ihre Verschwiegenheitspflicht aufmerksam gemacht? Wurden Sie in Ihrer Ausbildung auch mit Problemen der Finanzierung des Gesundheitswesens konfrontiert? 5 Wurden Sie in Ihrer Ausbildung über die Gesundheitsvorsorge anderer Länder unterrichtet? 6 Sind Sie in Ihrer Grundausbildung mit dem ethischen Thema „Wahrheit am Krankenbett“ konfrontiert worden? Wenn ja: In welchem Ausbildungsabschnitt und in welcher Form wurden Sie mit der Führung von Aufklärungsgesprächen von Arzt zu Patient und deren Wahrheitsproblematik vertraut gemacht? II. Grundhaltungen 1 Sprechen wir zunächst einmal über das Wohlbefinden des Patienten. Was verstehen Sie unter diesem Schlagwort? 2 Welche Rolle spielt das für Sie? Und welche Rolle spielt das ? Gibt es da Zusammenhänge? Werden diese in der täglichen Arbeit berücksichtigt? 3 Kommt es vor, daß Patienten, die ähnliche oder gleiche Diagnosen erhalten, unterschiedlich behandelt werden? Welche Fälle sind Ihnen bekannt? Was sind Ihrer Erfahrung nach die Ursachen dafür? 4 Sprechen wir nun über Mitleid - hat ein solcher Begriff in Ihrer Arbeit Platz? Wie und unter welchen Umständen hat Mitleid in Ihrer Arbeit Platz? 5 Welche Art von Patienten betrachten Sie als die Bedürftigsten unter allen Patienten? 6 Wie werden die Wünsche von Patienten in Ihrem Arbeitsbereich berücksichtigt? 7 Glauben Sie, sollen Patienten in Entscheidungen über Ihre Behandlung respektiert werden? Warum sind Sie dieser Meinung? 8 Halten Sie die Schmerzstillung der Patienten in Ihrem Arbeitsgebiet für ausreichend oder gibt es da Probleme? 9 Unter welchen Voraussetzungen würden Sie mit der Behandlung aufhören? 10 Könnten Sie sich vorstellen, dem Wunsch des Patienten nach Beendigung der Behandlung zu entsprechen? Wie weit geht für Sie die Wunscherfüllung des Patienten? Wo sehen Sie die Grenzen? 11 Kommt es in Ihrer täglichen Arbeit auch vor, daß die Botschaft einer Krankheit - ihr Sinn berücksichtigt wird? Hat dies einen Einfluß auf den Umgang mit dem Patienten? 30 12 Unter welchen Umständen und bei welcher Art von Krankheit fällt es Ihnen leicht, eine Botschaft der Krankheit bzw. der Symptome zu erkennen (nicht nur medizinisch)? 13 Unter welchen Umständen messen Sie einem persönlichen Deutungsmuster von Patienten über ihre Krankheit Bedeutung zu? Können Sie sich vorstellen, diese auch anamnestisch zu erheben? 14 In welchem Ausmaß betrachten Sie Krankheiten als selbstverschuldet? Welche Krankheiten sind Ihrer Meinung nach vom Patienten selbstverschuldet? Welche Bedeutung sollte man diesem Aspekt überhaupt einräumen? Wie sprechen Sie mit dem Patienten darüber und welche Folgen hat das auf Ihre Beziehung zum Patienten und für die Behandlung? 15 Was motiviert Sie zu Ihrer Arbeit und woher beziehen Sie Ihre Kraft? Spielt die Entlohnung eine Rolle? III. Kommunikation 1 Welche Gespräche führen Sie üblicherweise mit Patienten? Über welche Themen, eher sachlich-informativ oder emotional-menschlich? 2 Glauben Sie, sollen Patienten bei schweren Erkrankungen umfassend informiert werden? Wird das bei Ihnen im Haus so gemacht? Wenn ja, wer vom Personal führt diese Gespräche? 3 Welche Möglichkeiten haben die Pflegeberufe, an der Aufklärung der Patienten mitzuwirken? 4 Welche Bedeutung hat Aufrichtigkeit dem Patienten gegenüber für Sie und für das Arbeitsteam? Wie wirkt sich die Wahrheit am Krankenbett auf Ihre Arbeit aus bzw. welche Auswirkungen gibt es, wenn ein Patient nicht über seinen Krankheitszustand aufgeklärt ist? 5 Führen Sie selbst Aufklärungsgespräche mit Patienten? Wenn ja, können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Sie vom Patienten im Rahmen eines Aufklärungsgespräches nicht verstanden worden sind? Wie haben Sie diesen Umstand entdeckt? 6 Welche Bedeutung hat Supervision für Sie? Wird sie bei Ihnen angeboten? Wie sinnvoll ist diese? Was denken Sie darüber? 7 Welcher Art ist die Kommunikation zwischen stationärem und nicht-stationärem Personal? Sind Personen, die nicht ständig auf der Station arbeiten, eingegliedert - welche Personen und in welcher Form besteht Kontakt? Welche Qualität hat dieser Kontakt? 8 Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit von interdisziplinärer Zusammenarbeit? 9 Waren Sie schon einmal in klinische Forschung involviert? Sehen Sie darin ethische Probleme? Welche? IV. Rechte 1 Was halten Sie vom Thema Patientenrechte? Welche Patientenrechte halten Sie für besonders wichtig? 2 Gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Patienten auf Selbstbestimmung und der Realität, wenn ja, inwiefern? 31 3 Sprechen wir jetzt noch über die Verschwiegenheitspflicht. Welchen Stellenwert hat die Verschwiegenheitspflicht? Wem gegenüber hat sie Gültigkeit? Wie weit wird Ihrer Erfahrung nach die Diskretion gegenüber Dritten gewahrt? 4 Haben Sie selbst schon Probleme mit der Schweigepflicht bzw. mit der Entbindung von dieser gehabt? Wenn ja, welche? 5 Halten Sie es für wichtig, trotz der Verpflichtung zur Verschwiegenheit, Informationen an andere Berufsgruppen weiterzugeben? Wenn ja, an welche Berufsgruppen geben Sie welche Informationen weiter? V. Organisation 1 Ich möchte jetzt mit Ihnen über die Organisation im Arbeitsbereich Krankenhaus sprechen. Wer kontrolliert Sie in welchen Bereichen? Wen kontrollieren Sie in welchen Bereichen? Gibt es eine festgelegte Anweisungs- und Kontrollstruktur? Wo hätten Sie gerne mehr Befugnisse? Wo wird Ihre Eigeninitiative eingeschränkt? 2 Welche Erwartungshaltung wird von Seiten des Krankenhauses im Hinblick auf Ihre Arbeit an Sie herangetragen? Wer hat von Seiten des Krankenhauses Interesse daran, daß Sie hinsichtlich Qualität und Quantität gute Leistungen erbringen, also gut und viel arbeiten? 3 Sprechen wir jetzt über Entscheidungsprozesse. Wie sehen die Entscheidungsprozesse auf der Station aus? Wie kommen Entscheidungen zustande? Wie werden andere Berufsgruppen über diese Entscheidungen informiert? 4 Wie kommen Entscheidungen über die Behandlung von Patienten zustande? 5 Wie sollten idealerweise Entscheidungen über die Behandlung von Patienten Ihrer Meinung nach getroffen werden? 6 Wann wird für Sie in diesem Zusammenhang etwas zu einem ethischen Problem? Und wie treffen Sie da Ihre Entscheidungen? Gibt es in Ihrem Krankenhaus/Ihrer Klinik Einrichtungen, die für die Lösung ethischer Probleme zuständig sind? Gibt es einen vorgesehenen Rahmen zur Lösung solcher Probleme? 7 Halten Sie es für wichtig, daß Angehörige nichtärztlicher Berufsgruppen für die Ausführung ärztlicher Anordnungen Eigenverantwortung übernehmen, oder sollten Ärzte für alles allein verantwortlich bleiben? Haben andere Berufsgruppen einen eigenverantwortlichen Bereich, in dem sie ohne ärztliche Anordnung tätig werden dürfen? Wenn ja, welchen? 8 Gibt es Probleme bei der Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche? 9 Werden andere Berufsgruppen in Entscheidungsprozesse miteinbezogen? Wenn ja, welche und wie? 10 Werden andere Berufsgruppen über die von Ärzten getroffenen Entscheidungen informiert? Wenn ja: welche und wie? 11 Sind die Arbeitsabläufe klar festgelegt, d.h. ist festgelegt, in welcher Art und Weise sie abzuwickeln sind? Wie ist es festgelegt? 12 Ist „Ethik und Wirtschaftlichkeit“ ein Thema bei Ihnen im Krankenhaus? Wenn ja: in welcher Form wird es thematisiert und bei welchen Anlässen? 13 Welche Rolle spielen ökonomische und hierarchische Abhängigkeiten? Welche Abhängigkeiten und Zwänge erleben Sie in Ihrer täglichen Arbeit? 32 VI. Kosten 1 Was sind Ihrer Meinung nach die brennendsten Fragen bezüglich der Kosten im Gesundheitsbereich (Vorsorge, Akutbetreuung, Rehabilitation, Forschung, Altenbetreuung, Ausbildung, Intensiv, Behinderten und Langzeitbetreuung)? 2 Würden Sie bei Einsparungen qualitative Verluste in Kauf nehmen und in welchen Bereichen? 3 In welchen Bereichen könnte und sollte Ihrer Meinung nach eingespart werden, wenn Sie konkret an Ihren Arbeitsbereich denken? Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um Kosten zu sparen? 4 Nennen Sie Interventionen, die Sie persönlich als sinnlos erachten (Salben, Schlafmittel, Handschuhe). VII. Statistik 1 Alter 2 Geschlecht 3 Nationalität 4 Funktion 5 Dienstverhältnis 6 Dienstvertrag 7 Wie lange üben Sie Ihren derzeitigen Beruf schon aus? 8 Haben Sie schon einmal ernstlich daran gedacht, Ihren Beruf zu wechseln? Wenn ja, warum wollen/wollten Sie wechseln und welches Berufsziel hatten Sie? 33 LITERATURVERZEICHNIS 1 Cassell, E. J. (1986): The Changing Concept of ideal physician. Daedalus 115: 185-208. 2 Hansen, K.-J. (1997): Elemente ethischer Leitlinien im Dasein als Patient (Erwartungen und Tugenden). In: D. v. Engelhardt (Hg.): Ethik im Alltag der Medizin. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser: 295-304. 3 Kuhlmann, A. (1995): Sterbehilfe. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, rororo special. 4 Lamnek, S. (1995): Qualitative Sozialforschung. 2 Bde. München: Beltz. 5 Maio, G. (1998): Ethische Aspekte der Aufklärung des Patienten. Ärzteblatt BadenWürttemberg. Heft 9. Sonderbeilage Nr. 65. 6 Mayring, P. (1996): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union. 7 Sass, H.-M. (1991): Medizin, Krankheit, Gesundheit. In: K. Bayertz (Hg.): Praktische Philosophie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt: 210-242. 8 Schöne-Seifert, B. (1996): Medizinethik. In: J. Nida-Rümelin (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Stuttgart: Alfred Kröner: 552-648. 9 von Engelhardt, D. (1986): Mit der Krankheit leben. Grundlagen und Perspektiven der Copingstruktur des Patienten. Heidelberg: Verlag für Medizin Dr. Ewald Fischer. 10 Wolff, Hanns P. (1989): Arzt und Patient. In: H.-M. Sass (Hg.): Medizin und Ethik. Stuttgart: Reclam: 184-211. 34 Heft 120 ETHIK IM KRANKENHAUSALLTAG - THEORIE UND PRAXIS Wilfried Grossmann Giovanni Maio Anja Weiberg Oktober 1998 35 Prof. Dr. Wilfried Grossmann, Institut für Statistik, OR und Computerverfahren, Universität Wien, Dr. Giovanni Maio, Institut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte, Universität zu Lübeck, Dr. Anja Weiberg, Institut für Philosophie, Universität Wien. Inhalt: Seite Einleitung 1. Methodische Konzeption der Studie 2. Ergebnisse am Beispiel der Patientenorientierung 3. Ergebnisse am Beispiel der Kommunikation Schlußbemerkungen Anhang: Interviewleitfaden Literaturverzeichnis 1 2 9 20 29 31 35 Herausgeber: Prof. Dr. phil. Hans-Martin Sass Prof. Dr. med. Herbert Viefhues Prof. Dr. med. Michael Zenz Zentrum für Medizinische Ethik Bochum Ruhr-Universität Gebäude GA 3/53 44780 Bochum TEL (0234) 700-2750/49 FAX +49 234 7094-288 Email: [email protected] Internet: http://www.ruhr-uni-bochum.de/zme/ Der Inhalt der veröffentlichten Beiträge deckt sich nicht immer mit der Auffassung des ZENTRUMS FÜR MEDIZINISCHE ETHIK BOCHUM. Er wird allein von den Autoren verantwortet. Schutzgebühr: Bankverbindung: DM 10,00 Sparkasse Bochum Kto.Nr. 133 189 035 BLZ: 430 500 01 ISBN 3-931993-01-9 36 ZUSAMMENFASSUNG Die Autoren präsentieren eine Studie in österreichischen Kliniken zu Fragen der Ethik im Krankenhausalltag und betrachten das Verhältnis von Selbstbestimmung des Patienten und ärztlicher Fürsorge. Zentrale medizinethische Themen sind Patientenorientiertheit als Botschaft und Deutung der Krankheit, Selbstbestimmung und Schmerzbehandlung und Kommunikation in Form der Aufklärung des Patienten, die Einbeziehung der Pflegeberufe und Supervision. Die Studie basiert auf Interviews. ABSTRACT The authors present a Study in hospitals in Austria about questions of ethics in everyday clinical situations and focus on the relation of autonomy and care by physicians. Main topics in this study are orientation regarding patients and communication. The study is based on interviews. ISBN 3-931993-01-9 37 Zentrum für Medizinische Ethik Medizinethische Materialien Eine vollständige Hefteliste schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. Heft 99: Vollmann, Jochen: Fürsorgen und Anteilnehmen: Ethics of Care. April 1995. Heft 100: Hinrichsen, Klaus V.; Sass, Hans-Martin: 10 Jahre Zentrum für Medizinische Ethik. Juni 1996. Heft 101: Schreiber, Hans-Ludwig: Die Todesgrenze als juristisches Problem -Wann darf ein Organ entnommen werden?. Juli 1995. Heft 102: Hartmann, Fritz: Lebens- und Hilfeleistungen im Sterben. 2. Aufl. Februar 1995. Heft 103: Kielstein, Rita Hg.: Ethische Aspekte in der Nephrologie. 2. Aufl. Februar 1995. Heft 104: Bernat, Erwin: Antezipierte Erklärungen und das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Januar 1996. Heft 105: Richter, Gerd; Schmid, Roland M.: Ethische Perspektiven der Gentherapie 1995. Januar 1996. Heft 106 Bauer, Axel: Braucht die Medizin Werte? Gedanken über die methodologischen Probleme einer „Bioethik“. März 1996. Heft 107: Tausch, Reinhard: Empirische Untersuchungen zu Sinn-Erfahrungen und Wertauffassungen. Juli 1996. Heft 108: Sass, Hans-Martin: Ethik-Unterricht im Medizinstudium; Methoden, Modelle und Ziele der Integration von Medizinethik in die medizinische Aus- und Fortbildung. August 1996. Heft 109: Meyer, Frank P.: Salus aegroti suprema lex; Probleme klinischer Studien aus der Sicht eines Mitgliedes einer Ethikkommission - Schwerpunkt Onkologie. August 1996. Heft 110: Sass, Hans-Martin: Reform von Gesundheitswesen und Krankenhäusern in verantwortungsethischer Perspektive. August 1996. Heft 111: Sass, Hans-Martin, Kielstein, Rita: Die medizinische Betreuungsverfügung in der Praxis. Vorbereitungsmaterial, Modell einer Betreuungsverfügung, Hinweise für Ärzte, Bevollmächtigte, Geistliche und Anwälte. 4. Auflagen September 1998. Heft 112: Spittler, Johann F.: Sterbeprozeß und Todeszeitpunkt - Die biologischen Phänomene und ihre Beurteilung aus medizinischer Sicht. August 1996. Heft 113: May, Arnd; Gawrich, Stefan; Stiegel, Katja: Empirische Erfahrungen mit wertanamnestischen Betreuungsverfügungen. 2. Auflage Juli 1997. Heft 114: Biller, Nikola: Der Personbegriff in der Reproduktionsmedizin. September 1997. Heft 115: Kaminsky, Carmen: Gesagt, gemeint, verstanden? Zur Problematik der Validität vorsorglicher Patientenverfügungen. Oktober 1997. Heft 116: Baumann, Eva: Gesellschaftliche Konsensfindung und Humangenetik. Oktober 1997. Heft 117: May, Arnd: Betreuungsrecht und Selbstbestimmung am Lebensende. September 1998. Heft 118: Zülicke, Freddy: Chancen und Risiken von Gentechnik und Reproduktionsmedizin. September 1998. Heft 119: Meyer, Frank P.; Sass, Hans-Martin: Klinische Forschung 2000. Oktober 1998. Heft 120: Grossmann, Wilfried; Maio, Giovanni, Weiberg, Anja: Ethik im Krankenhausalltag - Theorie und Praxis. Oktober 1998. 38