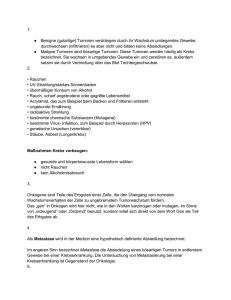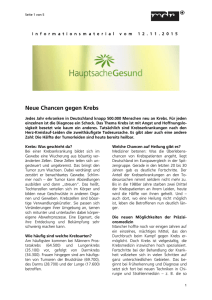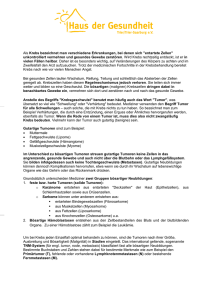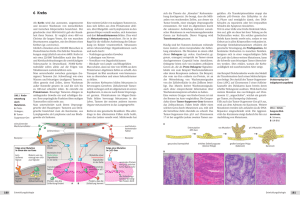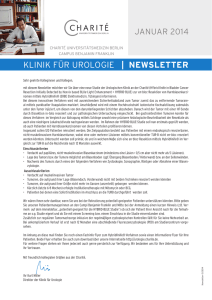Leben mit Krebs
Werbung

Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema Leben mit Krebs Neue Perspektiven durch Genomforschung Seite 4 Alternative Therapieansätze Seite 7 Zielgerichtet: Personalisierte Krebsmedizin Seite 8 Schmerztherapien verbessern Lebensqualität Seite 15 März 2013 Eine Publikation des Reflex Verlages Leben mit Krebs Eine Publikation der Reflex Verlag GmbH am 6. März 2013 im Handelsblatt. Der Reflex Verlag und die Verlagsgruppe Handelsblatt sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. I N H A LT Komplexität als Herausforderung 3 Hoffnungsträger Forschung 4 Der Blick auf das große Ganze 4 So kommt mehr Klarheit ins Dunkel 6 Schulmedizin reicht allein oft nicht aus 7 Zielgerichtet den Krebs in Schach halten 8 Verdrängungsschmerz 9 Geballte Ladung gegen den Tumor 10 Hoffnung auf Heilung beim Krebs im Kopf 11 Keine reine Frauensache 12 Rauchen verursacht nicht nur Lungenkrebs 13 Nicht immer tödlich 14 Lebensqualität mit der richtigen Begleitung 15 I M P R E S S U M Projektmanager Linda Guddat, [email protected] Redaktion Mike Paßmann, Julia Borchert, Nadine Effert, Tobias Lemser, Otmar Rheinhold, Astrid Schwamberger, Lena Winther Produktion/Layout Ann-Kathrin Gallheber, [email protected] Fotos Thinkstock / Getty Images Druck BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH Am Wasserwerk 11, 10365 Berlin Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktpräsentationen, Interviews, Anzeigen sowie Gastbeiträgen geben die Meinung der beteiligten Unternehmen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen. V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte: Mike Paßmann, [email protected] Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Sascha Bogatzki, [email protected] Reflex Verlag GmbH Hackescher Markt 2–3 D-10178 Berlin T 030 / 200 89 49-0 www.reflex-media.net Der Reflex Verlag hat sich auf themenbezogene Publikationen in deutschen, niederländischen und Schweizer Tageszeitungen spezialisiert. Diese liegen unter anderem der Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), dem Handelsblatt, dem Tagesspiegel und der Süddeutschen Zeitung bei. So kombiniert der Reflex Verlag den thematischen Fokus der Fachpublikationen mit der Reichweite der Tagespresse. Der Verlag zeichnet sich durch eine unabhängige Redaktion sowie die Trennung zwischen redaktionellen Artikeln und Kundenbeiträgen aus. Mehr Informationen unter www.reflex-media.net Gebändigter Begleiter W er in alten Büchern blättert, die sich in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts mit der Zukunft der Menschheit beschäftigten, wird immer wieder auf eine Vorhersage treffen: Spätestens zu Beginn des 21. Jahrhunderts werde der Krebs endgültig besiegt sein. Wir alle wissen: Soweit ist es noch nicht. Dennoch hat der Krebs viel von seinem Schrecken verloren. Das liegt auch daran, dass die Medizin inzwischen viel besser versteht, was Krebs eigentlich ist. Und weiß: Den Krebs gibt es nicht. Durchbrüche in der Genetik und der Molekularbiologie haben uns gelehrt, dass Tumoren eine enorme genetische und molekulare Vielfalt aufweisen. Die Genomanalyse eines Tumors ist mittlerweile oft der erste Schritt einer Therapie. So wird ermittelt, welche Maßnahmen bei diesem speziellen Karzinom überhaupt greifen. Mit der Folge, dass vielen Patienten unwirksame Therapien erspart bleiben, wirksame Methoden rechtzeitig zur Anwendung kommen – und die Überlebenschancen der Betroffenen rapide steigen. Zielgerichtete Therapien, personalisierte Medizin lauten die Schlagworte dieses Vorgehens, das eine Krebserkrankung als individuelles Phänomen begreift. Doch auch die klassischen Methoden der Therapie unterliegen stetigem Fortschritt. Chemotherapien können heute differenzierter und oft mit weniger Nebenwirkungen eingesetzt werden. Der Nuklearmedizin stehen immer präzisere und gesundes Gewebe schonende Instrumente zur Verfügung. Auch die Diagnostik macht weiter Fortschritte. Neben den erwähnten Möglichkeiten der genetischen Analyse spielen bildgebende Verfahren weiterhin eine wichtige Rolle. Sie spüren zum Beispiel heute Krebszellen anhand von Stoffwechselvorgängen auf molekularer Ebene auf. Noch ein weiterer Unterschied besteht zwischen unserer Zeit und den Zukunftsträumen vergangener Zeiten. Damals konzentrierte sich die Onkologie vor allem auf die Entfernung des Krebses. Seltener wurde darüber nachgedacht, wie er zu verhindern sei. Was auch daran lag, dass man Krebs als von außen kommendes Schicksal begriff. Heute ist klar: Auf sehr viele Risikofaktoren haben wir Einfluss. Niemand ist moralisch „schuld“ an seiner Krebserkrankung. Aber wer nicht raucht, Alkohol meidet oder nur in Maßen zu sich nimmt, auf seine Ernährung achtet und sich ab und zu bewegt – kurz, wer einem „gesundheitsfördernden Lebensstil“ folgt, der verringert erheblich die Gefahr, an Krebs zu erkranken. Der Schwerpunkt nicht nur der Medizin, sondern auch ihrer Aufklärungskampagnen liegt deshalb inzwischen auf Prävention, also auf der Verhinderung der Erkrankung – und auf der Früherkennung. Viele Krebsarten müssten nicht tödlich verlaufen, würden sie nur rechtzeitig festgestellt. Bekanntes Beispiel ist der Darmkrebs, der in seinem Frühstadium mit grandiosen Aussichten behandelt werden kann. Auch gibt es mittlerweile statistisches Material, das eine positive Wirkung von Brustscreenings nahelegt. Krebs ist nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für sein Umfeld und die Gesellschaft als Ganzes eine Belastung. Umso beruhigender ist es da, einen Wandel im Umgang mit der Krankheit zu beobachten. Galt Krebs früher als die böse Geißel der Menschheit, wird heute zunehmend klar, dass bösartige Tumoren vielleicht einfach Teil des menschlichen Lebens sind. Das soll das persönliche Leid nicht verharmlosen. Aber wer Krebs so betrachtet, muss auch die Betroffenen nicht mehr aus dem Leben ausschließen und sie als bereits aus der Gemeinschaft Ausgeschiedene brandmarken, wie es früher durchaus geschah. Heute geht es der Onkologie oft darum, ein gutes Leben mit dem Krebs zu ermöglichen, auch wenn eine endgültige Heilung nicht mehr möglich sein sollte. Und eben vor diesem Hintergrund verliert der Krebs tatsächlich viel von seinem Schrecken. Selbst wenn die alten Bücher vielleicht nie Recht behalten werden und der Krebs nie ganz „besiegt“ werden wird: Die Behandlungsmöglichkeiten werden nach wie vor mit jedem Jahr besser. Krebs, das sollten alle wissen, ist schon längst kein Todesurteil mehr. Mike Paßmann Chefredakteur PARTNER Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen. Eine Publikation des Reflex Verlages LEBEN MIT KREBS 3 LEITARTIKEL Komplexität als Herausforderung Krebs ist auf dem Vormarsch. Doch die Wissenschaft hält mit. Immer wichtiger ist die personalisierte Therapie. VON OTMAR RHEINHOLD J edes Jahr sterben allein in Deutschland 215.000 Menschen an Krebs. Tendenz steigend. Damit ist Krebs die zweithäufigste Todesart in unserem Land. Und nicht nur hierzulande bestimmt Krebs – nur überholt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – die Statistiken. Experten sprechen von einer weltweiten Krebsepidemie und gehen davon aus, dass spätestens ab 2030 weltweit jedes Jahr bei rund 26 Millionen Menschen Krebs diagnostiziert wird, 17 Millionen Menschen an einem bösartigen Tumor sterben. Vieles legt nahe, dass unser moderner Lebensstil daran schuld ist. Lungenkrebs etwa ist weltweit auf dem Vormarsch, denn es gibt – im globalen Maßstab – immer mehr Raucher. Andere Krebsarten treten deutlich häufiger in industrialisierten Ländern auf – etwa Blasenkrebs. Auch er wird zu gut 50 Prozent vom Tabakrauchen verursacht. Komplexes Tumorgeschehen Vor welchen Herausforderungen steht also die Onkologie, die Lehre von der Diagnose und der Therapie von Krebs heute? Neben der steigenden Zahl der Neuerkrankungen, die ein schlichtes Mengenproblem in medizinischer, wirtschaftlicher und menschlicher Hinsicht darstellen, zählt auch das fortschreitende Verständnis für Ursachen und Wirkprinzipien zu den großen Herausforderungen, auch wenn das zunächst widersprüchlich klingt. Doch die wachsende Einsicht in die GASTBEITRAG Komplexität des Tumorgeschehens führt zu ebenso komplexen Lösungen in der Diagnose und Behandlung. Lange Zeit galt in der Krebstherapie der Dreiklang von Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Diese Kombination ist nach wie vor in vielen Fällen erfolgsversprechend. Doch auch hier tut sich Neues. Beispiel Bestrahlung: Allein aus psychologischen Gründen fürchten sich viele Menschen vor dieser Therapieform. Doch von Jahr zu Jahr wachsen die Möglichkeiten, Strahlen genauer und gewebeschonender einzusetzen. Wo früher ganze Körperregionen großflächig bestrahlt wurden, können heute selbst kleine Tumoren zielgenau, mit großer Intensität und geringen Kollateralschäden getroffen werden. Doch das große neue Paradigma auch in der Krebstherapie ist die personalisierte Medizin, in der Praxis oft im Zusammenhang mit zielgerichteten Therapien genannt. Dahinter steckt der Wunsch, Tumorzellen ganz spezifisch anzugreifen – auf Basis individueller Merkmale des Tumors und des Betroffenen – statt im Rundumschlag der Chemotherapie zwar viele Krebszellen, aber auch viele gesunde Zellen zu zerstören. Den Krebs gibt es nicht Das ist nur möglich durch Fortschritte in der Genetik und der Molekularbiologie. Sie ermöglichen einerseits eine bessere Diagnostik. Andererseits eröffnen sie neue Wege der Therapie. Heute wissen wir zum Beispiel, dass bösartige Tumoren eine riesige Viel- Heute wissen wir, dass bösartige Tumoren eine riesige Vielfalt aufweisen. Den einen Krebs gibt es nicht. falt aufweisen. Den einen Magenkrebs etwa gibt es nicht. Sie sind verschieden. Und das bedeutet: Was gegen den einen funktioniert, muss gegen den anderen nicht klappen. Deshalb kann heute bei manchen Krebsarten – Magenkrebs etwa, oder Brustkrebs – vor einer Therapie getestet werden, ob der Tumor überhaupt auf eine bestimmte Therapie anspricht. Zielgerichtete, personalisierte Krebsmedikamente basieren zum Beispiel unter anderem darauf, Krebszellen für bestimmte im Körper vorhandene Wachstumshormone blind zu machen. Antikörper besetzen dann bestimmte Rezeptoren auf der Oberfläche der Krebszelle, deren Wachstum dadurch gestoppt wird. Ob aber die Rezeptoren der Krebszelle und des Medikaments überhaupt zusammenpassen, muss zuvor durch eine Analyse geklärt werden. Zugleich mit der Entwicklung spezialisierter Therapien geht der Trend aber auch in die andere Richtung. Wo die personalisierte und zielgerichtete Therapie ihr Augenmerk auf Detailvorgänge in der einzelnen Zelle richtet, betrachten systembiologische und ganzheitliche Ansätze den ganzen Menschen. Getrieben von der Einsicht, dass eine Krebserkrankung kein isoliertes Phänomen ist, sondern Folge einer Störung des gesamten, hochkomplexen Systems unseres Körpers. Vielleicht hilft dieser Ansatz, die drohende „Krebsepidemie“ in die Schranken zu verweisen. n Therapieentscheidung Welche Therapie ist die richtige? Entscheidend sind die Tumorgene Neue Wege in der Molekularpathologie. M it der Entschlüsselung des menschlichen Genoms wurden auch die Weichen für eine präzisere und gezieltere Krebsdiagnostik und -therapie gestellt. Heute geht die Arbeit von Pathologen in der Tumor­ diagnostik weit über das hinaus, was vor wenigen Jahren möglich war: So liefert der Pathologe heute durch die Kombination von klassisch pathologischer Diagnostik und molekularpathologischen Verfahren die Basis vieler gezielt auf den Patienten abgestimmter Therapien. Schon lange ist bekannt, dass Tumorerkrankungen sehr unterschiedlich verlaufen können, auch wenn die Tumoren anscheinend sehr ähnlich sind. Die Vermutung lag nahe, dass man hier auch unterschiedlich hätte therapieren sollen. Aber erst seit wenigen Jahren ist dies möglich. Die Molekularpathologie kann die entscheidenden Unterschiede für die Therapie vor der Therapie klar darstellen. Analysiert werden Genveränderungen, die für die Wirksamkeit von zielgerichteten Medikamenten von entscheidender Bedeutung sind, zurzeit insbesondere beim Darmkrebs, Lungenkrebs oder Hautkrebs. Auch für Brustkrebspatientinnen wurden genomische Mutationen identifiziert, die die individuelle Prognose präzise beschreiben können. Mithilfe eines Tests, zum Beispiel des EndoPredicts, lässt sich bestimmen, ob eine Patientin tatsächlich eine Chemotherapie benötigt. Die Einführung des Tests in deutschen pathologischen Instituten stellt einen wichtigen Schritt zur personalisierten Brustkrebs­Therapie dar. Die Analysen geben eine fundierte Entscheidungshilfe bei der Frage, ob eine Chemotherapie nötig ist oder nicht. Häufig kann auf eine Chemotherapie verzichtet werden. Für viele Patientinnen bedeutet dies einen Gewinn an Lebensqualität bei ebenso wirksamer Therapie. n Autor: Prof. Dr. med. Werner Schlake, Präsident Bundesverband Deutscher Pathologen e.V. 4 LEBEN MIT KREBS Eine Publikation des Reflex Verlages ARTIKEL Neue Perspektiven in der Krebsforschung Hoffnungsträger Forschung Perspektivenwechsel in der onkologischen Forschung ebnen neue Wege, damit Patienten mit der Diagnose Krebs besser leben können. führt werden. Stichwort: klinische Forschung. VON NADINE EFFERT M it welchem Verfahren kann Eierstockkrebs frühzeitig erkannt werden? Welches ist der künftige Beitrag der Medizin für eine möglichst schonende Behandlung von Brustkrebspatientinnen? Wie können die Nebenwirkungen einer Chemotherapie reduziert werden? Antworten auf derartige Fragen versucht die Krebsforschung zu finden. Antworten, auf die Patienten der heimtückischen Krankheit Krebs hoffen. Rund um den Globus haben Forscher in der Vergangenheit viele, zum Teil bahnbrechende Fortschritte erzielt – auch in Deutschland. Mit Erkenntnissen in der Molekularbiologie und Genomforschung wächst das Wissen über die Entstehung von Tumoren. Ohne Forschung kein Wissen, und ohne Wissen kein Fortschritt im Kampf gegen den Krebs. Neues aus der Forschung So haben beispielsweise Heidelberger Wissenschaftler herausgefunden, dass das RNA­Molekül MALAT1 in Krebszellen Gene aktiviert, die Metastasen Prostatakrebs: Klinische Großstudie gestartet Ohne Forschung kein Fortschritt. eines Lungentumors begünstigen und dass es durch kleine NukleinsäureSchnipsel blockiert werden kann. Einen bislang unerkannten Mechanismus der Krebstherapie haben jüngst Forscher an der Tübinger Uniklinik entdeckt: Das Immunsystem ist in der Lage, Krebszellen in einen Dauerschlaf zu versetzen. Durch eine bestimmte Kombination zweier Signalstoffe – Interferon und Tumor Nektrose Faktor – kann Krebs domestiziert werden, indem die Krebszellen wieder zu einem normalen Verhalten gebracht werden. Dies wurde experimen- tell bei einem Krebs der Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse gezeigt. Auch wenn die Krankheit Krebs oft nicht heilbar ist, so ist es doch der Forschung zu verdanken, dass es durch neue Diagnosemethoden, innovative Krebstherapien und eine individualisierte Behandlung für einige Krebsarten bereits gelungen ist, aus einem Todesurteil eine chronische Krankheit werden zu lassen. Grundsätzlich müssen auch künftig die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung so schnell wie möglich in einen Nutzen für den Patienten über- Rund 7.600 Patienten, 1.000 Urologen und Strahlentherapeuten sowie 90 Prüfzentren werden sich an der „PREFERE­Studie“ beteiligen, für die im Januar der Startschuss fiel. Damit zählt das Forschungsprojekt zur Bekämpfung von Prostatakrebs in Deutschland zu einem der größten in der Onkologie. Dazu Professor Dr. Thomas Wiegel, Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des Universitätsklinikums Ulm: „Jede der drei Therapieformen Strahlentherapie, Brachytherapie, also die Behandlung des Tumors mittels vieler kleiner, dauerhaft in der Prostata platzierter Strahlenquellen, und die aktive Überwachung wird im Vergleich mit der Radikaloperation auf ihre Effektivität überprüft.“ Bis zum Jahr 2030 finanzieren die Deutsche Krebshilfe sowie die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen das Projekt mit rund 25 Millionen Euro. n ARTIKEL Systembiologische Ansätze Der Blick auf das große Ganze Warum die relativ neue Disziplin der Systembiologie der Krebsforschung einen neuen Schub verleihen kann. VON NADINE EFFERT W ie funktionieren molekulare Netzwerke in gesunden Zellen und Krebszellen? Wie interagieren verschiedene Moleküle bei der Entstehung von Krebs? Wie werden Gene reguliert? Die Antworten auf diese Fragen sind von äußerst komplexer Natur. Die klassische biologische Vorgehensweise stößt dabei oftmals an ihre Grenzen. Nur ein Ansatz, der die Dynamik eines biologischen Systems als Ganzes versteht, kann Lösungen liefern. Diesem Anspruch gerecht wird die Systembiologie, einer der jüngsten Disziplinen der Lebenswissenschaften. Modernste experimentelle Methoden der Biologie werden hierzu interdisziplinär mit Wissen und Technik aus Mathematik, Informatik, Physik und Ingenieurswissenschaften verknüpft. Kompetenz durch interdisziplinäre Synergie Heute weiß man, dass Krebs aus einer Veränderung des Erbguts (Mutationen) resultiert. In Verbindung mit neuen Hochdurchsatz­Technologien zur Ana- lyse von Struktur und Funktion des Genoms und Epigenoms haben systembiologische Ansätze das Potenzial einer spezifischeren Diagnostik, die eine frühe Erkennung von Krebserkrankungen sowie eine Einschätzung zu deren Aktivität und Entwicklung erlaubt. Den immensen Fortschritten in der Genomforschung und der Molekularbiologie ist das Wissen zu verdanken, dass die grundlegenden Vorgänge im Leben einer Zelle von komplexen Netzwerken miteinander in Wechselwirkung stehender Proteine und anderer Moleküle gesteuert werden. Störungen können zu unkontrollierter Zellvermehrung und einer Krebserkrankung führen. Um die Dynamik dieser komplizierten Prozesse zu verstehen, bedarf es vor allem Rechenpower, um den großen Datenmengen Herr zu werden. Dank Computermodellen können aus dem Datengewirr relevante Informationen herausgefiltert und beispielsweise die Interaktion verschiedener Moleküle in der Krebsentstehung (Signalwege) beschrieben werden. Neben der Simulation ist somit gleichzeitig auch die Vorhersage krankheitsrelevanter Prozesse möglich. Potenzial, das es zu nutzen gilt. Bund fördert Systembiologie in der Krebsforschung Am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg etwa wurden im vergangenen Jahr drei systembiologische Forschungsverbünde eingerichtet, die bis 2015 mit neun Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt werden. So untersuchen Forscher zum Beispiel die molekularen Mechanismen, die Krebszellen kindlicher Hirntumoren widerstandsfähig gegen Chemo­ oder Strahlentherapie machen. Oder welche Wechselwirkungen zwischen Erbinformation und dessen „Verpackung“ (Epigenom) für die Entstehung und Bekämpfung der chronischen lymphatischen Leukämie entscheidend sind. Mit Lungenkrebs beschäftigt sich ein weiteres Forscherteam – genauer gesagt mit dem Einfluss auf das Tumorwachstum durch ein Medikament, das im Rahmen einer Chemotherapie zur Ankurbelung roter Blutkörperchen verabreicht wird. n WERBEBEITRAG Klinikpräsentation Prostatakarzinom: Individualisierte Therapie Prognostische Medizin kann Operationen vermeiden. ährlich erkranken in Deutschland über 60.000 Männer neu an Pros­ tatakrebs. Damit ist das Prostatakar­ zinom die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Dank der vermehrten Teilnahme an Vorsorgeuntersu­ chungen werden immer mehr Pro­ statakarzinome in frühen, heilbaren Stadien diagnostiziert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass viele dieser früh entdeckten Tumoren auch unbe­ handelt niemals Beschwerden verursa­ chen, oder gar zum Tode führen. Daher gewinnen zurückhaltende Strategien Test ermittelte CCP­Score erlaubt eine spezifische Aussage zum Fortschrei­ ten der Erkrankung und zur Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten. Damit liefert der CCP­Score in jeder Phase der Erkrankung eine neue Entscheidungsgrundlage für die Wahl des für jeden Patienten besten therapeutischen Vorgehens. Die Aggressivität eines Tumors ist as­ soziiert mit spezifischen molekularen Eigenschaften der Tumorzellen. In ag­ gressiven Tumorzellen sind bestimmte Moleküle (RNAs) die die Aktivität Tumorgewebe Prostata-Biopsie oder operative Entfernung von Tumorgewebe Aufarbeitung der Tumorzellen Tumor RNA Vergleichende Analyse der Genexpression Molekulare Signatur Tumor cDNA Micro Array Hohes Risiko Geringes Risiko 31 Gene, die die Zellteilung regulieren, 15 Kontrollgene Der neue prognostische CCP-Score beim Prostatakrebs wurde entwickelt, um Ärzte bei der Vorhersage der Aggressivität eines Prostata-Tumors zu unterstützen. wie die „aktive Überwachung“ immer mehr an Bedeutung. Aber wie kann entschieden werden, wie aggressiv ein Tumor wirklich ist? Eine Frage, die auch nach der operativen Entfernung der Prostata für die weitere Therapie entscheidend sein kann. Neuer Test ermöglicht genauere Prognosen Bei vielen Männern wächst ein Pros­ tatakrebs sehr langsam und in diesen Fällen ist es oft sinnvoll, die Erkran­ kung zunächst aktiv zu überwachen. Das heißt, den Tumor durch regel­ mäßige Kontrolluntersuchungen zu beobachten und erst einmal keine definitive Therapie wie Operation oder Bestrahlung durchzuführen. In anderen Fällen wächst der Tumor sehr schnell und eine aggressive Behand­ lung ist unumgänglich. Um für jeden Patienten die für ihn am besten geeignete Behandlungsstrategie festzulegen, ist es entscheidend, die zukünftige Entwicklung des Tumors möglichst genau einzuschätzen. Wie verschie­ dene wissenschaftliche Studien gezeigt haben, kann ein neuartiger Test den Verlauf einer Prostatakrebserkran­ kung sehr genau vorhersagen. Der im einzelner Gene abbilden in höherer Konzentration vorhanden, als in we­ niger aggressiven Tumorzellen. Der prognostische Test misst die Aktivität der Gene, die das Tumorwachstum beeinflussen und kann, zusammen mit weiteren klinischen Parametern, eine Aussage über die Aggressivität des Tumors treffen. Klinische Studien bestätigen den Nutzen des Tests Dieser neue Test, der nach einer Bi­ opsie oder nach einer Operation an Tumorgewebe durchgeführt werden kann, gibt wichtige Informationen zur Biologie des Tumors. Diese gehen über den Informationsgehalt bislang zur Verfügung stehender klinischer und pathologischer Variablen hinaus. Diese einzigartige zusätzliche Information ermöglicht, mit anderen klinischen Faktoren kombiniert, eine sehr genaue Vorhersage der Krebsentwicklung. Der klinische Nutzen des Tests wurde in vier verschiedenen Studien an über 1.400 unbehandelten als auch an bereits behandelten Patienten nachgewiesen. · Zwei Studien (366 Patienten und 413 Patienten), welche die Rückfall­ rate nach operativer Entfernung der Prostata (radikale Prostatektomie) voraussagten (Cuzick et al. 2011, Schlomm et al. 2013). · Zwei Studien (337 Patienten und 349 Patienten), die das Sterblichkeitsri­ siko nach zehn Jahren aktiver Über­ wachung vorhersagten (Cuzick et al. 2011, Cuzick et al. 2012). In der jüngsten Studie wurde der CCP­Score an einem typischen Pati­ entenkollektiv aus Deutschland an­ gewendet. Alle Patienten wurden im Jahr 2006 in der auf die Behandlung des Prostatakarzinoms hochspezia­ lisierten Martini-Klinik in Hamburg operiert (Schlomm et al. 2013). Ziel der Studie war es, möglichst genau alle wichtigen Faktoren, die für ein aggressives Tumorwachstum ver­ antwortlich sind, an winzigen Gewe­ bebiopsien (Prostatastanzbiopsien) vorherzusagen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die im Test ermit­ telten prognostischen Marker sehr zuverlässig bereits vor Therapie an diagnostischen Biopsien Informatio­ nen zur tatsächlichen Ausbreitungstendenz des Tumors geben können. Der CCP­Score kann dem betroffenen Patienten wertvolle Zusatzinformati­ onen zur Therapieentscheidung – ob zum Beispiel eine sofortige Operation oder Bestrahlung sinnvoll ist – geben. Die Martini­Klinik am Universitäts­ klinikum Hamburg­Eppendorf ist das weltweit führende Zentrum für Pros­ tatakrebsoperationen. Die Spezialisten der Martini-Klinik behandeln über 5.000 Prostatakarzinompatienten pro Jahr, von denen über 2.000 operiert werden. Die Entscheidung eine Ope­ ration durchzuführen ist jedoch im­ mer sehr individuell und richtet sich hauptsächlich nach der Aggressivität des Tumors und dem allgemeinen Ge­ sundheitszustand des Patienten. Die Experten der Martini-Klinik empfehlen häufig, den Tumor erst einmal zu beobachten (beobachtendes Abwarten = active surveillance). So beteiligt sich die Martini-Klinik zum Beispiel an der größten Europäischen active sur­ veillance Studie (PRIAS). Im Alltag Sterberisiko in 10 Jahren (%) J stellt es sich jedoch so dar, dass viele Patienten unsicher sind und deshalb das beobachtende Abwarten ablehnen oder nur sehr kurz durchführen las­ sen. Die Experten erwarten, mithilfe des neuen prognostischen CCP­Score mehr Patienten die Sicherheit geben zu können, ein beobachtendes Abwarten anzunehmen. Chancen durch personalisierte Medizin Der CCP­Score, der für die Entschei­ dungsfindung zur individualisierten Behandlung des Prostatakarzinoms jetzt zur Verfügung steht, bietet viele Chancen: Patienten, die aufgrund ihres Risikoprofils für eine aktive Überwa­ chung infrage kommen bietet der Test wertvolle Zusatzinformationen zur Ge­ fährlichkeit ihrer Krebserkrankung. Ein Patient mit niedrigem CCP­Score profitiert von zusätzlicher Sicherheit, die ihm die oft schwere Entscheidung zur Durchführung des beobachten­ den Abwartens erleichtert. Bei hohem CCP­Score können hingegen schnell entsprechende Therapiemaßnahmen eingeleitet werden. Auch nach Entfernung der Prostata liefert der CCP­ Score wichtige Informationen, die zum Beispiel die Entscheidung für oder ge­ gen eine Bestrahlung erleichtern können. Letztendlich kann der Patient von einer personalisierten Therapie profitieren, und unnötige Ausgaben in der Patientenversorgung können besser vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter www. prolaristest.com. Das Unternehmen Myriad, das eine Vielzahl von molekularen Diagnosti­ ken für eine Reihe von Krankheiten anbietet, führte den Test im März 2012 in den USA ein. Inzwischen ist der Test über das Myriad Labor bei München auch in Deutschland verfügbar und wird in einigen Kompetenz­Zentren angeboten. Mit einer Mail an info@ myriadgenetics.de können Sie erfahren, welche Kliniken den Test aktuell anbieten. n Autor: Prof. Dr. med Thorsten Schlomm Leitender Arzt Martini-Klinik am UKE GmbH 20 15 10 CCP Score = 0.76 Sterberisiko 4% 5 0 -2 -1 wenig aggressives Prostatakarzinom 0 2 1 stark aggressives Prostatakarzinom Ergebnis des neuen molekularen Tests: Der CCP-Score (Risiko Score) 3 6 LEBEN MIT KREBS Eine Publikation des Reflex Verlages ARTIKEL Krebsregister So kommt mehr Klarheit ins Dunkel Krebsregister beinhalten ein umfassendes Spektrum an Krebsdaten. Diese tragen dazu bei, Krebs gezielter zu behandeln. VON TOBIAS LEMSER I n Deutschland leben rund 1,4 Millionen Menschen, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre mit der Diagnose Krebs konfrontiert wurden. Tendenz steigend. Prostata­ und Brustkrebs gehören mit mehr als 63.000 beziehungsweise 71.000 Neuerkrankungen pro Jahr hierzulande zu den häufigsten Krebsarten. Datenflut für verbesserte Krebsmedizin Entscheidend, um diese und ein immenses Spektrum weiterer Daten und Zahlen bestimmen zu können, sind Krebsregister. Sie geben nicht nur Antworten auf Fragen, wie häufig bestimmte Krebsarten auftreten, sondern auch, welche Therapien Krebspatienten bekommen und wie ihre Erkrankung verläuft. Ebenso sind sie dabei behilflich, die Qualität verschiedener Behandlungsansätze zu sichern und zu vergleichen – Informationen von denen neben Patienten, Ärzten und Wissenschaftlern auch die Gesundheitspolitik profitieren kann. Nicht zuletzt sind Krebsregister unverzichtbar, um die Ursache von Krebs ausfindig zu machen, sowie um Aussagen zu Überlebensaussichten etwa als Planungsgrundlage für die onkologische Versorgung treffen zu können. Generell wird in Deutschland zwischen zwei verschiedenen Krebsregisterarten unterschieden, dem epidemiologischen und dem klinischen Register. Während klinische Krebsregister in erster Linie dazu dienen, die Qualitätssicherung in der Versorgung krebskranker Menschen zu gewährleisten, steht bei den epidemiologischen Krebsregistern die bevölkerungsbezogene Analyse im Fokus. Sie dokumentieren anonymisierte Informationen über den Krebspatienten sowie über die Tumorart, deren Ausbreitung sowie über das Erkrankungsstadium zum Zeitpunkt der Diagnose. Auf die Datenqualität kommt es an Wesentlich, um mit verlässlichen Zahlen umgehen zu können, sind Qualitätskriterien. Diese geben unter anderem vor, die Daten vertrauenswürdig, vereinheitlicht und nicht redundant zu erheben. „Deshalb wird die Mel- Geschätzte jährliche Krebsneuerkrankungen und durch Krebs verursachte Todesfälle in Deutschland (Stand: Februrar 2012) 50000 0 30000 0 490000 10000 0 0 218000 Neuerkrankungen mit Krebs Todesfälle durch Krebs Quelle: Deutsche Krebshilfe e.V., Krebsstatistik für Deutschland 2010 Werbebeitrag dequalität zumeist doppelt überprüft. Auf diese Weise wird auch erkennbar, ob die Daten, die zum Beispiel der Pathologe oder der Kliniker übermittelt, konsistent sind“, so Dr. Johannes Bruns, Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft. Wie Krebsregister letztlich verwaltet werden, ist Sache der einzelnen Bundesländer. Sie selbst bilden die Organisationsstrukturen, allerdings unter der Vorgabe, einheitliche Datensätze anzulegen. Bleibt die Frage der Finanzierung: Hier finden die Bundesländer Unterstützung in der Deutschen Krebshilfe, die den Löwenanteil der Investitionskosten klinischer Krebsregister übernimmt. Fakt ist: Zwar sind die Analysen der Krebsregister für Patienten nicht unmittelbar von Nutzen, langfristig kann jedoch jeder davon profitieren. So können nicht nur Entscheidungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung getroffen werden. Auch bringen die Register Risikofaktoren ans Tageslicht und helfen, Früherkennungsangebote zu verbessern. n Unternehmenspräsentation Beratung für Krebspatienten Angebote der Landeskrebsgesellschaften. K rebspatienten und ihre Angehörigen haben einen besonderen Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Die Konfrontation mit Krebs verlangt von den Betroffenen eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und mit der Bedrohung durch Leiden. In den letzten 25 Jahren ist die ambulante Krebsberatung daher zu einem Hauptschwerpunkt der Arbeit der 16 gemeinnützigen Landeskrebsgesellschaften in Deutschland geworden. Weitere Schwerpunkte sind Forschungsförderung, Aufklärung, gesundheitspolitische Initiativen und Prävention. Als Teil der Deutschen Krebsgesellschaft können die Landesgesellschaften die Verbindungen zur Wissenschaft und Klinik für ihre vielfältigen Aufgaben nutzen. Die Beratungsstellen Krebserkrankte sind durch die Krankheit und die Therapien in ihrer körperlichen Gesundheit zumindest vorübergehend stark beeinträchtigt. Daraus ergeben sich erhebliche psychische und soziale Probleme. Die Krebsberatungsstellen der Landeskrebsgesellschaften erfüllen mit ihren interdisziplinären Teams (Sozialpädagogen, Psychologen und Ärzten) wichtige Aufgaben in der Versorgung krebskranker Menschen. Das Beratungsangebot wird für Ratsuchende kostenfrei zur Verfügung gestellt. Informationen zur Krankheit Die behandelnden Ärzte sind für ihre Patienten die wichtigsten Ratgeber für das Verständnis der Erkrankung und die Entscheidung für eine Therapie. Nicht immer ist dafür ausreichend Zeit vorhanden. Viele Patienten informieren sich unabhängig von ihrem Arzt und nutzen dafür zunehmend das Internet. Das Fehlen von medizinischen Kenntnissen kann jedoch zu Missverständnissen führen. In den Beratungsstellen versuchen Mitarbeiter medizinische Sachverhalte leicht verständlich zu erklären und solide Informationen weiterzugeben. Hilfe für die Psyche Ängste, depressive Stimmungen und Gefühle der Hilflosigkeit bestimmen häufig das Leben von Krebspatienten. Die Beratungsstellen helfen mit Gesprächen und Begleitung während der Behandlung und beim Wiedereintritt in Alltag und Beruf und vermitteln psychotherapeutische und psychopharmakologische Behandlungen. Auch Angehörige von Krebspatienten können in gleichem Maße belastet sein und erhalten entsprechende Unterstützung. Neben der Einzel- und Familienberatung stehen Gruppenangebote wie Kunst­ und Musiktherapie sowie Bewegungs- und Ernährungskurse. Zuwendungen muss langfristig durch eine Regelfinanzierung abgelöst werden. Es gibt Hoffnung, dass die Umsetzung der Ziele des Nationalen Krebsplans zukünftig allen Krebspatienten und Angehörigen in Deutschland Zugang zu einer qualifizierten Beratung eröffnet. n Soziale Beratung Krebspatienten leiden oft unter sozialen Problemen. Die Mitarbeiter in Krebsberatungsstellen sind damit vertraut und geben Orientierungshilfe im Gesundheits­ und Sozialsystem, unterstützen bei Anträgen und Widersprüchen, bei akuten Notlagen und bei der Anpassung an veränderte Lebensumstände mit Auswirkungen auf den Arbeitsplatz, die Familie und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Landeskrebsgesellschaften bieten Krebspatienten und Angehörigen in ihren 29 Beratungsstellen und 67 Zweigstellen Informationen zur Krankheit, psychologische Unterstützung und Hilfe bei sozialen Problemen. Es gibt allerdings in Deutschland noch viel zu wenige Beratungsstellen. Die Finanzierung über Spenden und befristete Dagmar Kürschner, Geschäftsführerin der Hamburger Krebsgesellschaft e.V. Eine Publikation des Reflex Verlages LEBEN MIT KREBS 7 ARTIKEL Alternative Ansätze in der Onkologie Schulmedizin reicht allein oft nicht aus Komplementäre und alternative Krebstherapien sind zunehmend im Kommen und machen Standardtherapien Konkurrenz. VON TOBIAS LEMSER D ie Anzahl der Krebserkrankungen nimmt weiter zu. Wissenschaftler gehen für das vergangene Jahr von rund 486.000 Neuerkrankungen aus. Verstarben vor dem Jahr 1980 noch mehr als zwei Drittel aller Krebspatienten an ihrer Erkrankung, kann heute mittlerweile über die Hälfte auf dauerhafte Heilung hoffen. Trotz verbesserter Heilungschancen wollen sich viele Krebspatienten aber nicht allein und teilweise gar nicht mehr auf schulmedizinische Therapien wie etwa Strahlen­ oder Chemotherapie verlassen. Oft bleibt im Einzelfall zunächst unsicher, ob überhaupt eine Heilung erreicht werden kann oder nicht. Gerade deshalb, aber auch weil Standardtherapien oftmals mit starken Nebenwirkungen einhergehen, entscheiden sie sich dafür, nach zusätzlichen begleitenden oder anderen unkonventionellen Wegen zu suchen. Komplementärmedizin vermehrt gefragt Von immer mehr Medizinern anerkannt sind die Möglichkeiten der Komplementärmedizin. Diese basiert auf den Grundlagen der wissenschaftlichen Medizin und nutzt zudem Erkenntnisse aus der Erfahrungsheilkunde. Die am häufigsten in Deutschland angewandte komple- mentärmedizinische Maßnahme in der Onkologie ist die Misteltherapie. Mehr als zwei Drittel aller Patienten werden begleitend zu Krebsstandardtherapien in der Nachsorgephase mit Mistelextrakten der anthroposophischen Therapierichtung oder mit phytotherapeutischen Extrakten behandelt. Anwendung finden zudem die Enzymtherapie oder die sogenannte Orthomolekulare Therapie. Alternative Methoden auf dem Vormarsch Einen Schritt weiter als die Komplementärmedizin gehen alternative Krebstherapien. Diese komplett neuen Ansätze unterscheiden sich erheblich von komplementären Verfahren und werden größtenteils von der Schulmedizin abgelehnt. Während der konventionelle Markt seinen Fokus auf sekundäre und tertiäre Prävention setzt, gehen alternative Methoden immer wieder neue Wege und versuchen, den Krebs innovativ zu bekämpfen – was nicht selten zu erheblichen Spannungen zwischen bei- den Seiten führt. So scheiterte etwa der Kanadier Rick Simpson damit, vor den kanadischen Gesundheitsbehörden sein Hanföl für die Krebsbekämpfung zuzulassen – obwohl er beweisen konnte, viele Krebspatienten mit dem Öl geheilt zu haben. Besser erging es da Jack Andraka aus Crownsville in den USA. Der 15­jährige Schüler revolutionierte die Krebsmedizin mit einem effektiven Verfahren zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsen­, Lungen­ und Eierstockkrebs. Er entwickelte einen Teststreifen, der das Protein Mesothelin erkennt. Es kommt bei einer entsprechenden Erkrankung im Blut und im Urin vor. Fakt ist: Krebs ist ein immer akutes und umstrittenes Thema und die Erkenntnisse der nächsten Jahre werden dazu beitragen, die Richtung weiter zu bestimmen. Ziel aller Bestrebungen sollte sein, sowohl den Ursachen von Krebs entgegenzuwirken als auch die Heilungschancen und Lebensqualität von Krebspatienten zu erhöhen. n Werbebeitrag Interview „Krebs kann ein Weg zur Selbstheilung sein“ Herr Dr. Doepp, Sie sind Energiemediziner am TimeWaver-Gesundheitszentrum in Bichwil in der Schweiz. Zudem sind Sie seit 40 Jahren Nuklearmediziner. Was empfehlen Sie Krebspatienten, um den für sich optimalen Behandlungsweg zu finden? Wir stimmen zumeist einer Operation zu. Denn die Tumormasse sollte verringert werden, damit der Körper besser mit restlichen Tumorzellen umgehen kann. Zu einer Chemo­ oder Strahlentherapie raten wir nicht. Allerdings hat der freie Wille oberste Priorität. Anschließend erfolgt unsere ganzheitliche Therapie. Welche Bedeutung messen Sie Integralen und Interaktiven Krebstherapien bei? Das ist unser Weg im TimeWaver­Gesundheitszentrum. Integral bedeutet ein umfassendes Spektrum auf allen Ebenen, wie etwa biochemische (GcMAF, Amanita phall., Ozon, etc.), energetische und informatorische Methoden. Interaktiv heißt, dass der Patient immer an der Therapie beteiligt ist, indem der Körper getestet wird, was ihm wirklich hilft. Es gibt bei uns kein „Schema F“ und keine Vermutungen wie in der konventionellen Krebstherapie. Ist das der entscheidende Unterschied zu konventionellen Methoden? Solche Therapien berücksichtigen nicht die Selbstheilungskräfte des Körpers. Bei uns sind diese Kräfte dagegen der Hauptfaktor. Auch spielt die Psyche des Patienten eine große Rolle. Es geht primär darum, den Krebs anzunehmen und die Verantwortung für ihn zu übernehmen. Wir gehen über die personalisierte Krebstherapie hinaus, indem wir eine individualisierte Therapie anbieten. Dabei wird der Körper des Patienten mithilfe eines Medikamententests befragt. Wir behandeln nicht lokal oder symptomatisch, sondern auf der Ursachenebene. Sie plädieren für eine ganzheitliche Betrachtung des Körpers. Wie kann diese aussehen? Der Körper ist eine Ganzheit. Wenn man den Krebs nur lokal betrachtet, lässt man entscheidende Systeme wie das Immunsystem, das vegetative Nervensystem oder das Lymphsystem außen vor. Zur Tiefentherapie haben wir den TimeWaver in seinen beiden Variationen: das TimeWaver Med­ und das TimeWaver Frequency­System. Sie sind die Basis unserer Behandlungen. Wie funktioniert der TimeWaver? Er ist eine Synthese aus Energiemedizin und Informationsfeld­Medizin. Jeder Krebspatient bekommt jeden Tag vier Stunden TimeWaver­Diagnostik und ­Therapie. Der TimeWaver arbeitet mit dem Informationsfeld. Die zugrundeliegende Theorie besagt, dass alles, was im Körper passiert, und alle Krankheiten im Informationsfeld gespeichert sind. Mittels gekoppelter Rauschdioden und einem Kozyrev­Spiegel kontaktieren wir die Speicherfelder. Dies ermöglicht es uns, aus dem Informationsfeld zum einen die nötigen Informationen abzurufen und zum anderen vice versa über das Informationsfeld zu behandeln. Auf diesem Gebiet ist der TimeWaver einzigartig. Wir haben damit gute Erfolge und halten es für die Heilkunde der Zukunft. n Dr. Manfred Doepp, Energiemediziner Weitere Informationen TimeWaver GesundheitsZentrum AG Dr. med. Manfred Doepp Dorfstrasse 28 CH-9248 Bichwil T +41 (0)848 64 64 64 [email protected] www.timewaver-gesundheitszentrum.ch 8 LEBEN MIT KREBS Eine Publikation des Reflex Verlages ARTIKEL Personalisierte Krebsmedizin Zielgerichtet den Krebs in Schach halten In der Onkologie setzen sich individuelle Therapien sukzessive durch. Sie sind imstande, punktgenau Tumoren anzugreifen. aum ein Krebskongress in jüngster Vergangenheit in Deutschland, aber auch weltweit, bei dem personalisierte Krebsmedizin nicht das vorherrschende Thema war. Egal, wie die Therapien benannt werden – ob individualisiert, maßgeschneidert, zielgerichtet oder eben personalisiert – in der Onkologie beschreiben diese Begriffe alle das gleiche, nämlich eine Therapie, die direkt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten zugeschnitten ist. Chemotherapie auch heute noch als eine relativ ungezielte Therapie, da sie nicht nur Krebszellen, sondern auch gesundes Gewebe schädigen kann. Nachdem lange unklar war, warum Krebserkrankungen so unterschiedlich verlaufen können und bestimmte Therapien nicht bei jedem Patienten Wirkung zeigen, sind die Gründe dafür heute zumeist bekannt, sodass maßgeschneiderte Krebstherapien entwickelt werden können. Dank der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts lassen sich Veränderungen der Erbinformation identifizieren. Chemotherapie nicht mehr alternativlos Genetische Analysen weisen den Weg VON TOBIAS LEMSER K Bis vor wenigen Jahren galten Chemo­ und Hormontherapie als nahezu einzige Therapiemöglichkeiten, um fortgeschrittene Krebserkrankungen aufzuhalten. Zwar hatten Onkologen auch schon in der Vergangenheit jeden einzelnen Krebspatienten im Blick und unterschieden je nach Geschlecht, Alter, Tumortyp sowie Zustand des Erkrankten, dennoch erweist sich die INTERVIEW Die zielgerichtete Therapie orientiert sich vor allem an den spezifischen molekularen, genetischen Eigenschaften eines Tumors. Dabei basiert die Behandlung nicht nur weiterhin auf pathohistologischen Untersuchungen, sondern auch auf zahlreichen Analysen. Beispielhaft hierfür sind das immunhistochemische Profil sowie genetische Untersuchungen am Tu- Blutuntersuchung auf Tumorzellen „Personalisierte Therapie“ Dr. Pachmann, wie bedeutend ist die Erfolgskontrolle von Chemotherapien für die Lebensdauer und Lebensqualität bei Krebserkrankungen? Es ist eine der wichtigsten Maßnahmen. Der Pathologe prüft die Schnittränder auf Tumorfreiheit, der Onkologe kontrolliert die Größe von Tumorknoten. Die Tumorzellen im Blut überwachen wir. Genau diese Zellen können Metastasen auslösen. Die Vernichtung der zirkulierenden Tumorzellen heißt: Patient geheilt – Sieg fürs Leben! Vermehren sie sich trotzdem, kann frühzeitig gemeinsam nachjustiert werden. Wie relevant für Diagnose und Behandlung sind die im Blut zirkulierenden Tumorzellen im Verhältnis zum Tumor? Krebs beginnt mit einer ersten unsichtbaren Zelle. Bildlich darstellbar wird ein Tumor ab etwa einem Zentimeter Durchmesser – rund eine Milliarde Zellen. Der Chirurg kann oft 99 Prozent entfernen. Bereits ab einem Millimeter gewinnt der Tumor Anschluss an die Blutversorgung. Je größer er ist, desto mehr Tumorzel- len sind im Blut. Verbleibende Zellen sollen mit adjuvanter Chemotherapie vernichtet werden. Inwieweit spielt es eine Rolle, individuelle Therapien nach ihrer Wirksamkeit auszusuchen? Der Verlauf der Zellzahl, Wachstums­ oder Hormonrezeptoren, die blockiert werden könnten, Aggressivität und „Schläfrigkeit“ sowie Genfaktoren und das Testen der Wirkung bereits vor der Anwendung an den Tumorzellen des Patienten sind die wichtigsten Faktoren, damit die Therapie so erfolgreich wie möglich verläuft. n Dr. med. Ulrich Pachmann, Transfusionsmedizin, Prüfarzt, Humangenetische Diagnostik und Beratung Transfusionsmedizinisches Zentrum Bayreuth (TZB) Onkologie – Entwicklungspipeline nach Wirkstofftyp in Deutschland 2011 in Prozent Zellbasiert 2% Natürliche Wirkstoffe 2% Peptide 9% RNA / DNA 14% Rekombinate Proteine 17% Niedermolekulare Wirkstoffe 27% Monoklonale Antikörper 29% Quelle: Ernest & Young - Deutscher Biotechnologie-Report 2012 mormaterial. So können Onkologen an den Tumorzellen bestimmter Tumoren erkennen, welche Therapie voraussichtlich anschlägt oder nicht. Gerade für die Früherkennung von Krebs sind bestimmte Biomarker sehr wertvoll. An erster Stelle stehen dabei in den Genen verankerte lebenslange Neigungen. Diese Marker mahnen lebenslang zu erhöhter Aufmerksamkeit, selbst wenn noch kein Tumor entstanden ist. Biomarker sind in der Lage, exakt vorherzusagen, ob eine bestimmte Behandlungsmethode wirkt und damit eingesetzt werden kann. Das senkt nicht nur Kosten, sondern erspart Patienten auch unwirksame Behandlungen mit zahlreichen Nebenwirkungen. Erfolge im Kampf gegen Brustkrebs Erfolgreich angewandt wurde die personalisierte Krebsmedizin bisher sowohl bei Dickdarmkrebs als auch beim Schwarzen Hautkrebs. Mittlerweile sind mehrere Medikamente mit molekularer Treffsicherheit bekannt. Bei Lungenkrebs etwa kann jede fünfte Erkrankung bereits recht gezielt behandelt werden. Experten rechnen damit, in den nächsten Jahren sogar bis zu jeden dritten Lungenkrebs treffsicherer behandeln zu können. Aber auch Brustkrebspatientinnen, deren Tumoren verstärkt den HER­ 2­neu­Rezeptor ausbilden, können vermehrt von zielgerichteten Therapien profitieren. Insbesondere da, wo Chemotherapie allein bislang kaum wirksam war, setzen Onkologen verstärkt auf den HER-2-Antikörper Trastuzumab. Der im Labor hergestellte Eiweißkörper ist imstande – durch Blockade dieses Rezeptors – den Chemotherapieeffekt erheblich zu steigern. Als Infusion verabreicht kommt er sowohl bei Frauen mit fortgeschrittenem Brustkrebs als auch in der vorbeugenden sogenannten adjuvanten Therapie mit guten Heilungschancen zum Einsatz. Dadurch, dass der Antikörper so an den HER­2­neu­Rezeptor andockt, dass tumorfördernde Wachstumsfaktoren verdrängt werden, sind die gefährlichen Zellen nicht mehr in der Lage, zu wachsen und sich zu teilen. Signale innerhalb der Zelle stören Nicht an der Zelloberfläche, sondern im Inneren der Zelle wirken sogenannte Tyrosinkinase­Hemmer. Diese als „Small Molecules“ bezeichneten Stoffe können direkt in die Zelle eindringen und dort den inneren Teil der Rezeptoren, die Tyrosinkinasen, blockieren. So wird innerhalb der Zelle das Teilungssignal gestört. Als vorteilhaft erweisen sich Tyrosinkinase­ Hemmer, da sie in Tablettenform verabreicht werden können. Auch wenn mithilfe dieser zielgerichtet wirkenden Krebsmedikamente vielen Patienten geholfen werden kann, lässt es sich nicht immer verhindern, dass Tumoren sich ausbreiten beziehungsweise wachsen. Zuversicht weckt allerdings die Forschung: Denn nicht nur das Signalnetz der spezifischen Aktivierung von Genen wird weiter intensiv erforscht, auch werden zunehmend spezifische Hemmstoffe mit modernsten chemischen Methoden passgenau hergestellt. n Weitere Informationen Hamburger Krebsgesellschaft www.krebshamburg.de Eine Publikation des Reflex Verlages LEBEN MIT KREBS 9 ARTIKEL Spinale Tumoren Verdrängungsschmerz Tumoren an der Wirbelsäule sind relativ selten, können aber bis zur Lähmung führen. VON OTMAR RHEINHOLD T umoren der Wirbelsäule, sogenannte spinale Tumoren, sind relativ selten – lediglich ein bis zwei Fälle kommen auf 100.000 Menschen. Dennoch sind sie in der Bevölkerung durchaus bekannt, nämlich als Metas­ tase, also der Streuung eines Karzinoms, das anderswo im Körper sitzt. Vor allem Lungen­, Brust­, Nieren­, und Prostatakrebs streuen häufig in die Wirbelsäule. Rund 80 Prozent dieser als extradural (außerhalb der Rückenmarkshaut gelegen) bezeichneten, spinalen Tumoren sind solche Metas­ tasen. Meist betreffen extradurale verdrängen sie das Rückenmark und schränken es in seiner Funktion ein, was unbehandelt letztendlich zu einer Querschnittslähmung führt. Ähnliches gilt für Wirbelkörperkarzinome: Sie zerstören letztendlich den Knochen, destabilisieren die Wirbelsäule und beeinträchtigen beziehungsweise schädigen so das Rückenmark. Spinale Tumoren äußern sich zunächst durch Schmerzen an der Wirbelsäule. Das macht eine Diagnose schwierig, denn Rückenschmerzen können vielfältige Ursachen haben. Zudem wachsen die Tumoren meist langsam und machen sich lange Zeit kaum bemerkbar. Spinale Tumoren werden deshalb Dank moderner mikrochirurgischer Verfahren können OP-Schäden am Rückenmark immer besser vermieden werden Tumoren die Wirbelknochen selbst. Daneben treten spinale Tumoren auch innerhalb der das eigentliche Rückenmark umgebenden Rückenmarkshaut auf. Dann handelt es sich um intradurale Tumoren. Häufig sind das Tumoren der Rückenmarkshaut selbst oder einer Nervenwurzel. Und schließlich kann auch das Rückenmark an sich von einem Tumor befallen sein. Erstes Symptom: Rückenschmerzen Handelt es sich nicht um die Metastase eines Karzinoms, sind spinale Tumoren meist gutartige Geschwulste. Dennoch stellen sie für die Betroffenen eine große Gefahr dar. Durch ihr Wachstum INTERVIEW oft erst spät entdeckt. Im späteren Verlauf kommt es, je nach Lage des Tumors, zu Kraft­, Bewegungs­ oder Empfindungsstörungen an Armen oder Beinen, Funktionsstörungen im Verdauungstrakt oder der sexuellen Leistungsfähigkeit. Manche Symptome wie leichte Gangstörungen fallen allerdings oft zunächst der Umwelt auf. Für die Abklärung eines Verdachts dient eine MRT-Aufnahme zur Darstellung des Nervengewebes, vor allem des Rückenmarks, und sonstiger Weichteilstrukturen. Röntgen­ oder CT­Bilder zeigen den Zustand der Wirbelknochen. In der Regel werden spinale Tumoren operativ behandelt. Sind Wirbelknochen befallen, werden sie je nach Schweregrad ganz oder teilweise entfernt. Anschließend wird die betreffende Stelle mit Stützimplantaten aus Titan stabilisiert. Handelt es sich um einen bösartigen Tumor, erfolgt nach der Operation meist noch eine Bestrahlung. Gute Heilungschancen Auch Tumoren, die nicht die Wirbelknochen betreffen, werden durch operative Maßnahmen behandelt, allerdings ist eine Bestrahlung meist nicht sinnvoll – auch, weil das Rückenmark auf eine Bestrahlung sehr empfindlich reagiert. Gutartige Tumoren zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie angrenzendes Gewebe „nur“ verdrängen, aber nicht infiltrieren. Deshalb sind viele spinale Tumoren sehr gut behandelbar, denn sie können in der Regel komplett entfernt werden. Herausforderungen ergeben sich aus dem Umfeld der Operation. Zum einen birgt die Nähe zum Rückenmark besondere Risiken. Zum anderen können sich selbst gutartige, eigentlich in sich abgeschlossene Tumoren als schwer trennbar vom Rückenmarksgewebe zeigen. Im Falle eines bösartigen, also infiltrierenden Tumors gilt das umso mehr. Oft kann dann nur ein Teil der Geschwulst entfernt werden. Dank moderner mikrochirurgischer Verfahren können Schäden am Rückenmark aber immer besser vermieden werden. Zusätzlich gibt es immer bessere Verfahren, die Funktionsfähigkeit des Rückenmarks während der Operation zu überwachen. Das bietet dem Operateur – und den Patienten – zusätzliche Spinale Tumoren sind meist gutartige Geschwulste. Sicherheit. Vor allem Patienten, denen ein gutartiger spinaler Tumor entfernt wurde, haben hervorragende Heilungsaussichten. Neurologische Beschwerden sind oft innerhalb kürzester Zeit verschwunden. Waren schon starke neurologische Einschränkungen bis hin zu einer Querschnittslähmung aufgetreten, ist nach der Operation meist eine Rehabilitationstherapie nötig. n Operative Versorgung „Stabilisierung der Wirbelsäule schenkt Lebensqualität“ Wie äußern sich Wirbelsäulentumore? Es gibt den primären Tumor, der aus der Wirbelsäule selbst entsteht und eher selten auftritt. Viel häufiger entstehen Wirbelsäulentumoren aufgrund von Metastasen. Oftmals ist der Bruch der Wirbelsäule das erste Symptom. Die Patienten haben große Schmerzen, fallen hin und können nicht mehr laufen. Patienten kommen aber auch oft mit neurologischen Ausfällen, wie etwa Probleme beim Wasserlassen oder Teillähmungen bis hin zu Komplettlähmungen. Was bedeuten diese gravierenden Symptome? Liegen erst mal ein Wirbelsäulenbruch oder eine neurologische Störung vor, verschlechtern sich die Prognose und die Lebenserwartung dramatisch. Die Erkenntnis, zusätzlich zum Krebs auch noch querschnittsgelähmt zu sein, ist eine Katastrophe. Die Metastasen in der Wirbelsäule können oft nicht mehr ganz entfernt werden, aber die Stabilisierung der Wirbelsäule kann die Lebensqualität erheblich verbessern. Wie sieht diese Stabilisierung aus? Zunächst wird eine sogenannte Laminektomie durchgeführt: Der hintere Wirbelbogen wird entfernt, um dem Rückenmark mehr Platz zu geben, wenn der Tumor quasi von vorne nach hinten wächst. Zusätzlich wird die Wirbelsäule durch Implantate stabilisiert. Wird ein Tumor früh erkannt, können sogar mehrere Wirbelkörper entfernt und durch spezielle Implantate ersetzt werden. Was ist mit Chemotherapie und Bestrahlung? Sie sind ebenfalls wichtige Elemente. Leider werden oftmals die Metastasen zunächst sehr lange medikamentös behandelt oder bestrahlt. Der Bruchgefahr der Knochen wird zu wenig Beachtung geschenkt. Was also höchste Priorität haben sollte ist die frühzeitige Stabilisierung der Wirbelkörper, damit auf gar keinen Fall ein Bruch entsteht. n Prof. Dr. med. Christoph Josten, Direktor der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und Plastische Chirurgie am Universitätsklinikum Leipzig 10 LEBEN MIT KREBS Eine Publikation des Reflex Verlages ARTIKEL Bestrahlung Geballte Ladung gegen den Tumor Moderne Strahlentherapien arbeiten zielgerichtet. So gibt es mehr Heilerfolge und weniger Nebenwirkungen. VON LENA WINTHER M it Strahlen gegen den Krebs – neben der medikamentösen Behandlung und operativen Eingriffen ist diese Methode die wichtigste Maßnahme gegen bösartige Tumoren. Durch zahlreiche Innovationen und Verfeinerungen hat diese „dritte Säule“ der Krebstherapie in jüngster Zeit an Effektivität gewonnen: Bestrahlungen wirken zielgerichteter und Nebenwirkungen sind sehr viel wie Computer­ oder Kernspintomografie liegt die Behandlung immer einem Bestrahlungsplan zugrunde, der unter großem Aufwand in 3D­Technik erstellt wird, um möglichst exakt zu arbeiten und gesundes angrenzendes Gewebe zu schützen. Die Photonentherapie erfolgt zumeist ambulant und Nebenwirkungen treten durch die verfeinerte Technik weniger stark auf als früher. Typische Beschwerden, die mit einer Strahlenbehandlung assoziiert werden, sind Erschöpfung, Bisher wird die Protonentherapie bei seltenen Krebserkrankungen angewendet weniger gravierend. Bei 40 Prozent aller Krebsheilungen war auch eine Strahlentherapie beteiligt. Die gängigste Methode ist die Behandlung mit ultraharten Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen aus dem Linearbeschleuniger: die Photonentherapie. Die Strahlen dringen aus verschiedenen Richtungen in den Körper ein und töten die Tumorzellen ab. Mithilfe bildgebender Verfahren Schleimhautreizungen, Appetit­ und Geschmacksverlust, Haarausfall und Berührungsempfindlichkeit. Damit noch zielgerichteter gearbeitet werden kann, ist die IMRT (Intensitäts­ modulierte Strahlentherapie) entwickelt worden, die dann eingesetzt wird, wenn sich unmittelbar neben dem Tumor wichtige Organe befinden, die nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen. Das funktioniert, indem die Strahlung in Einzelfelder zerlegt wird und den Tumor quasi aus allen möglichen Richtungen gleichzeitig attackieren kann. Dadurch kann auch die Dosis erhöht werden. Protonen könnten die Zukunft sein Neben der noch jungen IMRT ist auch die Protonen­Schwerionen­Bestrahlung eine besondere Innovation. Dabei handelt es sich um kleine Teilchen, die beim Auftreffen krebszerstörend strahlen und ganz gezielt und auf den jeweiligen Tumor geleitet werden. Bisher wird die Protonentherapie noch bei eher seltenen Krebserkrankungen angewendet, wie etwa bei Tumoren an der Schädelbasis oder der Wirbelsäule, oder auch beim Aderhaut­Melanom, einem Augentumor. Obwohl die Protonentherapie äußerst kostspielig und noch nicht genügend erforscht ist, wird ihr großes Potenzial vorausgesagt in der Behandlung von Lungenkrebs im Frühstadium sowie bei gewissen Tumoren im Gehirn und im Magen. Ein weiteres Feld ist die pädiatrische Onkologie, wo sie bereits zum Einsatz Werbebeitrag kommt. Recht speziell ist die sogenannte Nano­Therapie, eine ebenfalls erst wenige Jahre alte Bestrahlungsmethode. Dabei werden Strahlung abgebende Substanzen an Nano­Partikel gebunden und damit in Organe, in die Blutbahn oder bestimmte Gewebe eingelagert. Erfolge wurden etwa bei der Behandlung von Lebermetastasen erzielt. Überhaupt wird unermüdlich daran gearbeitet, Verfahren zu entwickeln, bei denen die Bestrahlung „vor Ort“ und so kleinflächig wie möglich wirkt. Bei inoperablem Gebärmutterkrebs werden mitunter radioaktive, strahlende Goldstäbchen (Goldseeds) operativ in den Tumor gebracht. Beim sogenannten Afterloading­Verfahren werden über einen im Tumor platzierten feinen Draht oder Schlauch Strahlungsdosen computergesteuert verabreicht.Die Strategie bei allen modernen Bestrahlungsmethoden ist also immer die gleiche: Sie sind zielgenau, präzise und konzentriert – und gehen so mit geballter Ladung gegen den Krebs vor. n Klinikpräsentation Radioonkologie: erfolgreicher und sicherer K urz gefasst hat die Radioonkologie zwei Ziele: Die erfolgreiche Bekämpfung des Tumors und zugleich die Verringerung radiogener Nebenwirkungen für die Patienten. Dank des ständigen technischen Fortschritts, jahrzehntelanger strahlenbiologischer Grundlagenforschung und klinischer Studien kommt die Strahlentherapie diesen Zielen heute immer näher. Das Universitätsklinikum Münster (UKM) setzt dabei auf eine fachübergreifende Kooperation aller an der Behandlung von Krebspatienten beteiligten Experten. „Wir arbeiten nicht nur innerhalb der Klinik für Radioonkologie eng zusammen, sondern stehen auch im ständigen Austausch mit unseren Kollegen aus anderen medizinischen Fachbereichen“, erläutert Professor Hans Theodor Eich, Direktor der Klinik für Strahlentherapie am UKM und Medizinischer Direktor des dortigen Zentrums für Krebsmedizin (Comprehensive Cancer Center Münster – CCCM). Die neuen technischen Entwicklungen bieten aus Sicht des Mediziners eine Reihe von Vorteilen: Sie ermöglichen zum Beispiel „Intensitätsmodulationen“, das heißt die Intensität der Bestrahlung kann während einer Sitzung verändert werden. Dabei kommen nicht nur stehende, sondern immer häufiger auch rotierende Bestrahlungsfelder zum Einsatz – mit dem Ziel, die Strahlenbelastung für das angrenzende gesunde Gewebe möglichst gering zu halten. Realisiert werden können derartige Techniken mit Linearbeschleunigern der neuen Generation oder mit Spezialgeräten, wie der Tomotherapie, die am Universitätsklinikum Münster verfügbar sind. Ein weiterer Vorteil der neuen Techniken ist eine deutlich kürzere Behandlungszeit. In vielen Situationen reicht heute die Bestrahlung in einer einzigen oder nur wenigen Sitzungen aus, während sonst eine „fraktionierte“ Strahlenbehandlung über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen üblich ist. Diese Form der Strahlentherapie nennt sich „Radiochirurgie“ und sie kommt bisher vor allem bei Hirntumoren, Lebermetastasen oder Lungentumoren zum Einsatz, sodass eine operative Therapie nicht notwendig ist. „Unser Ziel ist, diese Methode in Zukunft noch breiter anwenden zu können. Denn eine kürzere Behandlungszeit bedeutet für die Patienten eine deutlich geringere Belastung“, erklärt Professor Uwe Prof. Uwe Haverkamp (l.) und Prof. Hans Theodor Eich mit dem Linearbeschleuniger, an den zur dreidimensionalen Lagerungskontrolle auch ein CT angedockt werden kann. Haverkamp, Leitender Physiker der Klinik für Strahlentherapie am UKM. Da die Bestrahlung bei der Radiochirurgie sehr hoch dosiert ist, setzt sie höchste Präzision voraus. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Einbindung der Bildgebung vor, während und nach der Therapie. Bisher wurden vor der Bestrahlung lediglich zweidimensionale Aufnahmen gemacht. Die am UKM eingesetzten Beschleuniger verfügen über ein sogenanntes „Onboard­Imaging“, das heißt ein inte­ grierter Computertomograf vermag vor der eigentlichen Bestrahlung eine dreidimensionale Lagerungskontrolle vorzunehmen, sodass die Position des Patienten noch modifiziert und die Bestrahlung exakt appliziert werden kann. Die Anwendung dieser neuen Möglichkeiten ist ein Zusammenspiel der medizinischen Anforderungen, der technischen Möglichkeiten und der strahlenbiologischen Grundlagen. Dabei steht die Sicherheit der Patienten im Vordergrund. n Eine Publikation des Reflex Verlages LEBEN MIT KREBS 11 ARTIKEL Gehirntumore Hoffnung auf Heilung beim Krebs im Kopf Gehirntumoren machen jährlich nur zwei Prozent aller neuen Krebserkrankungen aus. VON LENA WINTHER E s ist und bleibt die Schaltzentrale unseres Körpers: unser Gehirn. Umso beängstigender, wenn gerade dieses so fundamental wichtige Organ von einem Tumor befallen ist. Doch wer bei einer solchen Diagnose gleich an ein sicheres Todesurteil denkt, liegt falsch: Zwei Drittel aller Tumorerkrankungen im Gehirn sind gutartig. Rund 7.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an einem primären Rückenmarks­ oder Hirntumor – das macht etwa zwei Prozent aller Krebsneuerkrankungen pro Jahr aus. Tatsächlich kommen bösartige Hirntumoren also verhältnismäßig selten vor. Meist sind Kinder oder auch ältere Menschen betroffen. Gehirntumoren bei Kindern treten am häufigsten im Alter von drei bis zwölf Jahren auf, bei Erwachsenen zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr. Bei Erwachsenen ist aber zu bemerken, dass die Tumoren meist sekundär sind, also durch Metas­ tasenbildung von bereits vorhandenen Krebserkrankungen entstehen. Diagnose des Tumors Die Tumoren können aus verschiedenen Arealen des Gehirns erwachsen: den Hirnhäuten, dem Nervenstützgewebe, aus der Hirnanhangdrüse oder auch den Nerven. Zu den bösartigen Gehirntumoren gehört etwa das Glioblastom. Sie gehören zur Gruppe der Gliome, zu denen obendrein auch Oligoendrogliome, Ependymome und Astrozytome zählen. Der gefährlichste Typ der Astrozytome sind die Glioblastome. Das Tückische an der Krankheit ist besonders die Tatsache, dass der Tumor fest eingebettet im Schädel liegt und nur wenig Platz den sind jedoch Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen und Nervenausfälle, Sehstörungen, Schwindel, häufiges Erbrechen, Persönlichkeits- hat. So übt jedes Wachsen des Tumors Druck aus auf das empfindliche Gehirngewebe, und selbst ein gutartiger Tumor kann lebensgefährlich werden, da er dem Gehirn buchstäblich den Platz weg nimmt. Die Ursachen sind wissenschaftlich bislang ungeklärt, sind sie doch – anders als bei anderen Krebsleiden – nicht auf ungesunde Lebensgewohnheiten wie überhöhten Alkoholkonsum oder Rauchen zurückzuführen. Es kann einige Zeit vergehen, bis eine Geschwulst im Gehirn überhaupt entdeckt wird. Die typischen Beschwer- veränderungen, Vergesslichkeit oder epileptische Anfälle. Die Symptome hängen individuell von der Größe und der Lage des Tumors ab und sind oftmals unspezifisch oder denen anderer Krankheitsbilder nicht unähnlich. Für die Diagnose wird zu bildgebenden Verfahren gegriffen: Computertomografie (CT) oder Kernspintomografie (MRT). Behandlung durch alle „drei Säulen“ Die Therapiemöglichkeiten stützen sich auf die drei Säulen der Krebs- Werbebeitrag behandlung: chirurgischer Eingriff, Chemotherapie und Bestrahlung. Die Operation ist bei Hirntumoren tatsächlich die häufigste Maßnahme. Doch es kann auch passieren, dass ein Tumor inoperabel ist, also weder vollständig noch in Teilen entfernt werden kann. Als inoperabel gilt er dann, wenn er an lebenswichtige Bereiche, etwa die Atemfunktion, angrenzt. Der Chirurg entscheidet, ob mit Komplikationen zu rechnen ist. Die bildgebenden Techniken werden auf diesem Gebiet immer ausgefeilter. Sie können den Tumor und deren Ausbreitung punktgenau lokalisieren und so sind sehr präzise Operationen möglich. Die Strahlentherapie ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Hirntumor­ therapie, als Nachbehandlung einer OP ebenso wie als alleinige Maßnahme. Der Patient erhält über mehrere Wochen täglich gezielte Einzeldosen der Bestrahlung. Auch die Radiochirurgie wird angewandt, wobei gebündelte Gamma­Strahlen direkt auf den Tumor zielen, ihn zerstören, aber das umliegende Gewebe schonen. Die Chemotherapie ist eine eher seltene Behandlungsart bei Hirngeschwulsten, doch wurden auf diesem Gebiet durchaus auch Erfolge erzielt, beispielsweise bei bestimmten Typen von Gliomen und Glioblastomen. Generell erfolgt bei Gehirntumoren eine kombinierte Behandlung aus Operation und nachfolgender Strahlen­ oder Chemotherapie. Den tückischen Geschwulsten im Gehirn stehen also zahlreiche starke Waffen gegenüber. n Klinikpräsentation Die sanfte Revolution der Neurochirurgie Radikal und doch schonend gegen Hirntumore: die navigierte transkranielle Magnetstimulation (nTMS). D iagnose Hirntumor – ein schwerer Schock für Patienten und ihre Angehörigen. Denn selbst bei einer Heilung stellt sich die Frage: Mit welchen Einschränkungen und Behinderungen ist zu rechnen? Schließlich sind Funktionen wie Sprache und Bewegung Leistungen des menschlichen Gehirns, die auf der Verknüpfung eines Netzwerkes mehrerer Millionen Nervenzellen beruhen. Keine Gehirnarchitektur gleicht der anderen, und die Verteilung dieser sogenannten eloquenten Areale ist daher höchst individuell. Ein neues Verfahren erlaubt jetzt die genaue Lokalisierung jener Zentren: Durch die nTMS (navigierte transkranielle Magnetstimulation) lässt sich vor der Operation eines Hirntumors oder einer Metastase punktgenau bestimmen, wo sich Sprachzentrum und Bewegungsregion befinden. „Die Anatomiebücher gaben uns bisher eine ungefähre Idee. Doch dies ist eine Revolution in unserem Fachgebiet. Und zwar eine sanfte“, erklärt Professorin Terttu Pietilä, Chefärztin der Klinik für Neurochirurgie in Bethel. Die Untersuchung ist tatsächlich schmerzfrei und bedarf nur weniger Vorbereitungen. Wird jetzt ein Eingriff vorgenommen, kann auf Wachoperationen oder großflächige Schädelöffnungen verzichtet werden. Einen wesent­ lichen Grundsatz erfüllt diese sanfte Methode dennoch: So radikal wie nötig und so schonend wie möglich. Die Technik, die im Evangelischen Punktgenaue Bestimmung des Sprachzentrums und der Bewegungsregion vor der Operation durch nTMS. Krankenhaus Bielefeld bereits zur klinischen Routine gehört, wird nun in mehreren Forschungsprojekten optimiert und auf neue Anwendungsbereiche geprüft. n Weitere Informationen Evangelisches Krankenhaus Bielefeld Klinik für Neurochirurgie www.evkb.de/neurochirurgie 12 LEBEN MIT KREBS Eine Publikation des Reflex Verlages ARTIKEL Brustkrebs Keine reine Frauensache Brustkrebs ist die häufigste Tumorart bei Frauen. Doch auch Männer sind betroffen. Früherkennung ist das A und O. und unter dem Mikroskop untersucht wird. Über Chancen und Risiken der einzelnen Methoden zur Früherkennung will das Leitlinienprogramm Onkologie mit der Broschüre „Früherkennung von Brustkrebs“ aufklären. VON ASTRID SCHWAMBERGER N ur wer hinschaut, findet auch etwas – in der Medizin kann diese Binsenweisheit Leben retten. So hat sich einerseits die Zahl der Brustkrebspatientinnen etwa durch die Einführung des Mammografie­ Screenings im Laufe der Jahre enorm vergrößert. Die Sterblichkeitsrate ist dank Früherkennung und effizienterer Therapiemöglichkeiten aber deutlich zurückgegangen. Schätzungen des Robert Koch­Instituts zufolge wurden im vergangenen Jahr rund 74.500 Frauen erstmals mit der schockierenden Diagnose konfrontiert. Das Mammakarzinom ist somit in Deutschland die mit Abstand häufigste Tumorerkrankung bei Frauen. Doch nicht nur sie sind betroffen. Das Krebsregister rechnet für das Jahr 2012 mit zirka 600 Erstdiagnosen bei Männern. Früherkennung tut nicht weh Die Schlüsselrolle im Kampf gegen Brustkrebs spielt die Früherkennung. Im Rahmen der gesetzlichen Kranken- Dem Krebs an den Kragen Für Männer fehlt bislang ein Frühwarnsystem versicherung haben Frauen bereits ab dem 30. Lebensjahr ein Recht darauf, sich einmal jährlich untersuchen zu lassen. Bei der medizinischen Tastuntersuchung achtet der Frauenarzt auf Veränderungen wie etwa Knoten, Schwellungen und Entzündungen in Brust und Achselhöhle, gerötete Haut oder eingezogene Brustwarzen. Frauen sollten deshalb nicht warten, bis sie selbst etwas Verdächtiges entdecken. Für Männer indes fehlt bislang ein entsprechendes Frühwarnsystem. Viele schieben, oft aus Unwissenheit, den Arztbesuch auf. So wird ein Karzinom oft erst spät entdeckt, weil es zum Bei- spiel für einen harmlosen Pickel gehalten wurde. Das „Netzwerk Männer mit Brustkrebs“ informiert und bietet eine Anlaufstelle für Betroffene. Dem Tumor auf der Spur Die Tastuntersuchung hat keinerlei Nebenwirkungen, manche Tumoren sind jedoch nicht tastbar. Der Arzt verschafft sich dann mithilfe einer Ultraschalluntersuchung, der Mammografie oder der Magnetresonanztomografie ein Bild des Brustgewebes. Ob ein Befund bösartig ist, findet er heraus, indem er eine Biopsie durchführt – ein Eingriff, bei dem Gewebe entnommen Wird Brustkrebs diagnostiziert, kommt bei Frauen und Männern eine Reihe von Therapien – von der Operation über die Behandlung mit Hormonen, Strahlen oder Medikamenten bis hin zur Immuntherapie – infrage. Je nach Stadium und Eigenschaften des Tumors werden die Maßnahmen geplant und kombiniert. So fortschrittlich die Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs bereits sind, so sehr tappen die Forscher bei den Ursachen jedoch noch im Dunkeln. Viele Fragen seien noch offen, heißt es beim Deutschen Krebsforschungszentrum. Das Risiko ließe sich aber senken, wenn Mütter ihre Babys stillen, Frauen in den Wechseljahren auf eine Hormonersatztherapie verzichten und auf ihr Gewicht achten. n Anzeige Forschung ist die stärkste Waffe im Kampf gegen den Krebs – ohne sie gibt es keinen Fortschritt. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt zahlreiche Projekte renommierter Wissenschaftler. Ihre Forschung bringt die Krebsmedizin in Deutschland langfristig voran. Denn nur so erhalten die Patienten die bestmögliche Behandlung. Mehr Informationen und Beratung erhalten Sie auch unter (02 28) 7 29 90-0. Gemeinsam mit Prof. Dr. Rita Schmutzler und Prof. Dr. Christian Reinhardt für das Leben. Beide forschen gegen den Krebs. Eine Publikation des Reflex Verlages LEBEN MIT KREBS 13 ARTIKEL Risikofaktoren Rauchen verursacht nicht nur Lungenkrebs Blasenkrebs ist relativ häufig. Über die Hauptursache sind sich viele nicht klar. Früh erkannt, bestehen gute Heilungschancen. VON OTMAR RHEINHOLD B lasenkrebs ist insgesamt gesehen die fünfthäufigste bösartige Tumorerkrankung in Deutschland. Damit ist die Krebsart insgesamt die fünfthäufigste bösartige Tumorerkrankung. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Für Männer ist das Risiko einer Erkrankung gut dreimal so hoch wie für Frauen. Blasenkarzinome zählen zu den Krebsarten, die vor allem im Alter auftreten. Erkrankungen bei Menschen unter 50 Jahren sind sehr selten, die meisten Betroffenen sind zwischen 65 und 70 Jahren, wenn sie die Diagnose trifft. Blasenkarzinome sind Schleimhautkarzinome, die zunächst an der Oberfläche der Blaseninnenwand auftreten, oft an mehreren Stellen. In diesem Stadium sind sie gut operativ zu entfernen. Später dringen sie in tiefere Schichten bis in den Blasenmuskel ein oder wachsen gar in Organe und Gewebe der Umgebung. Über die Blutbahn können auch Blasenkarzinome Metastasen bilden. Alarmzeichen: Blut im Urin Blasenkarzinome sind zunächst schmerzfrei und äußern sich meist zuerst durch Blut im Urin. Der nächste Diagnoseschritt ist dann in der Regel eine Blasenspiegelung zur optischen Kontrolle und eine Gewebeentnahme (Biopsie). Zur Abklärung – vor allem auch der Frage, inwieweit der Tumor schon anderes Gewebes durchdringt – kommen zudem oft bildgebende Ver- GASTBEITRAG fahren wie die Computertomografie (CT) oder die Magnetresonanztomografie (MRT) zum Einsatz. Auch Aufnahmen mit Kontrastmitteln helfen, Blase, Nieren und Harnleiter zu untersuchen. Je nach Schweregrad wird auch im Rest des Körpers nach Metastasen gesucht. Bei der Erstdiagnose wird in gut drei Viertel aller Fälle ein oberflächliches Karzinom gefunden. Nur in 20 Prozent der Fälle ist es bereits invasiv, also tiefer in die Blase oder die Umgebung gewachsen, und in fünf Prozent der Fälle liegen schon Metastasen vor. Das bedeutet: Betroffene haben gute Heilungschancen, wenn das Karzinom früh erkannt wird. Treten Blutbeimengungen im Urin auf, sollte also bald ein Arzt aufgesucht werden. Hauptrisikofaktor Rauchen Neben der Früherkennung zählt auch beim Blasenkrebs die Vorbeugung. Die Erkrankung ist zwar schon seit Ende des 19. Jahrhunderts eine offizielle Berufskrankheit, und bis heute sind etwa Automechaniker, Arbeiter in der Lederindustrie, aber auch Zahntechniker oder Frisöre einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Der größte Risikofaktor ist aber ganz klar das Rauchen. Eine wenig bekannte Tatsache, und doch gelten laut eine aktuellen Studie die Stoffe im Tabakqualm bei Männern für 50 Prozent und bei Frauen für 52 Prozent aller Blasenkrebserkrankungen verantwortlich. Aktive Raucher haben nach dieser Studie ein viermal so hohes, ehemalige Raucher immerhin ein mehr als doppelt so hohes Für Männer ist das Risiko einer Erkrankung gut dreimal so hoch wie für Frauen. Risiko zu erkranken. Daneben sind auch chronische Entzündungen oder Bestrahlungen im Beckenbereich die Ursache von Blasenkarzinomen. Süßstoffe hingegen, oft in der Diskussion, wurden als Ursache beim Menschen noch nicht klar nachgewiesen. Totalentfernung versus Strahlentherapie Im frühen, oberflächlichen Stadium wird ein Blasenkarzinom operativ entfernt, oft verbunden mit einer örtlichen Chemotherapie – in der Regel mit guten Heilungsaussichten. Bei fortgeschrittenen, also invasiven Tumoren hingegen erfolgt häufig eine Totalentfernung der Blase und eventuell befallener weiterer Organe. Dazu kann auch der Harnleiter gehören. Als therapeutisch ähnlich erfolgreich im Hinblick auf die Überlebensraten gilt daneben eine Strahlentherapie, unter Umständen in Kombination mit einer speziellen Chemotherapie, die die Wirkung der Strahlen erhöht. Hierbei bleibt in gut 70 Prozent der Fälle die Blase erhalten. Wird die Blase entfernt und konnte bei der Operation der Blasenschließmuskel erhalten werden, kann man aus Teilen des Dickdarmes eine neue Blase aufbauen und an Harnleiter und Harnröhre anschließen. Ansonsten wird der Urin über den Dickdarm abgeleitet oder fließt durch die Bauchdecke in einen Urinbeutel. Damit kann man leben. Noch besser ist es, mit dem Rauchen aufzuhören und beim ersten Alarmzeichen zum Arzt zu gehen. n Blasenkrebs Bessere Diagnostik – gezieltere Therapie Die Ersttherapie ist entscheidend für den weiteren Krankheitsverlauf. I n Deutschland werden pro Jahr über 23.000 neue Fälle von Blasenkrebs diagnostiziert. Über 6.000 Patienten versterben jährlich an dieser Erkrankung. Eine frühzeitige Diagnose und gezielte Ersttherapie sind entscheidend. „Da sich die meisten Tumoren bei Erstdiagnose nur auf die inneren Schichten der Harnblase beschränken, sind diese in der Regel durch kleine endoskopische Operationen, sogenannte Blasenresektionen (TURB) gut behandelbar“, betont Professor Dr. H. Leyh, Chefarzt am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Durch eine komplette Entfernung der Tumoren kann das Risiko eines Wiederauftre- tens oder sogar einer Ausweitung in tiefere Blasenschichten minimiert werden. Es können größere Operationen wie eine komplette Blasenentfernung vermieden werden. Heutzutage können Tumoren durch eine Blaulicht­Diagnostik (PDD) mittels eines zuvor in die Blase eingebrachten flüssigen Diagnostikums während der Operation besser sichtbar gemacht werden. Insbesondere können Tumoren aufgedeckt werden, die bei einer normalen Blasenspiegelung nicht erkennbar sind. Dies führt zu einer deutlichen qualitativen Verbesserung der Blasenoperation mit einer Senkung des Rezidivrisikos. Der Behandlungs- Blasenbefund während der Operation (TURB) ohne (links) und mit (rechts) Blaulicht -Diagnostik. Die Tumoren leuchten pink. Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Professor Dirk Zaak, Klinikum Traunstein ansatz, auch Blaulicht­Resektion genannt, wird von den Leitlinien empfohlen und inzwischen flächendeckend an vielen führenden urologischen Kliniken in Deutschland durchgeführt. Bei der Erstoperation und „insbesondere bei Verdacht auf manche besonders aggressive Tumorformen (CIS) sollte eine Blaulicht­Diagnostik durchgeführt werden“, so Professor Dr. H. Leyh. n Autor: Dr. Bryan Qvick, Facharzt für Urologie / Medical Manager, Ipsen Pharma GmbH 14 LEBEN MIT KREBS Eine Publikation des Reflex Verlages ARTIKEL Prostatakrebs Nicht immer tödlich Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern. Doch nicht immer ist eine OP nötig. VON OTMAR RHEINHOLD B ei jedem sechsten Mann über 50 Jahren wird sie diagnostiziert. Allerdings kann der Verlauf der Erkrankung sehr unterschiedlich ausfallen. Während beim einen eine mehr oder weniger radikale Operation oder eine Bestrahlung nötig ist, lebt der andere weitgehend unbeeinträchtigt mit dem Karzinom und nimmt es sogar mit ins Grab. Wichtige Faktoren sind die Aggressivität des Tumors, in welchem Stadium er festgestellt wird und welches Alter der Betroffene hat. Entsprechend breit gefächert sind die Diagnose­ und Therapieverfahren. Auf jeden Fall sollten Männer die von den gesetzlichen Kassen ab dem 45. Lebensjahr finanzierte jährliche Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen. Dabei wird die Prostata durch Abtasten untersucht. Wird eine Veränderung festgestellt, folgen weitere Diagnoseschritte. Grundsätzlich geht es bei der Abklärung eines Verdachtes und erst recht nach der Feststellung eines Karzinoms um die Frage, wie groß der Tumor ist, ob er in umliegendes Gewebe eingewachsen ist oder schon in andere Körperregionen gestreut hat. Von großer Wussten sie schon … ? Das Wort „Prostata“ entstammt dem griechischen „Prostátes“, welches auf Deutsch „Vorsteher“ bedeutet. Die Prostata wird also auch als Vorsteherdrüse bezeichnet und hat etwa die Größe einer Walnuss. Sie wiegt ungefähr 20 Gramm und ist in etwa drei Zentimeter lang und vier Zentimeter breit. Neben Lungen- und Darmkrebs ist das Prostatakarzinom die dritthäufigste Todesursache bei Männern. 80 Prozent der Patienten sind bei Diagnosestellung über 60 Jahre alt. Die Sterberate ist in einigen Industrieländern dank besserer Erkennung, Vorsorge und Behandlung jedoch rückläufig. Rund 40 Prozent der deutschen Männer leiden an einer vergrößerten Prostata. Im Alter vergrößert sich das Organ automatisch und bedeutet noch keineswegs eine zukünftige Krebserkrankung. Eine vergrößerte Prostata führt häufig zu häufigem Harndrang und Blasenproblemen. 70 bis 80 Prozent der Patienten bleiben nach einer vollständigen Entfernung der Prostata potent und 95 Prozent kontinent. Entscheidend ist immer das Können des Chirurgs. In Deutschland sterben drei von 100 Männern an Prostatakrebs. Pro Jahr gibt es über 58.000 Neuerkrankungen. Über 15.000 Patienten sterben an der Erkrankung. Weltweit leben rund 680.000 Männer mit Prostatakrebs. Bedeutung ist auch die Wachstumsrate des Tumors. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, können Betroffene zusammen mit ihrem Arzt eine informierte Entscheidung über Behandlungsmöglichkeiten treffen. Biopsie verschafft Gewissheit Liegt ein Anfangsverdacht vor, wird in der Regel der PSA­Wert (Prostataspezifisches Antigen) gemessen. Dieser Wert an sich ist kein alleiniger Indikator für das Vorliegen eines Prostatakarzinoms, sondern einer von möglichen Hinweisen. Wichtig ist die regelmäßige Untersuchung des Wertes und die Beobachtung seiner Dynamik. Anders ausgedrückt: Weniger der absolute PSA­Wert, sondern wie schnell und wie stark er sich verändert, ist von Bedeutung. Weitere Diagnosemöglichkeiten sind bildgebende Verfahren wie Ultraschall, CT oder MRT. Endgültige Gewissheit verschafft aber erst eine Biopsie, also eine Gewebeentnahme und deren Untersuchung. Eine operative Entfernung des Tumors empfiehlt sich bei Betroffenen mit noch relativ hoher Lebenserwartung und einem aggressiv wachsenden Tumor. Allerdings ist das Risiko von Impotenz und Inkontinenz bei einer Operation trotz immer besserer Methoden und Verfahren immer noch hoch und manchmal unvermeidlich. Das gleiche gilt für die Bestrahlung, die zusätzlich oft eine große körperliche Belastung darstellt. Bei Männern, die voraussichtlich noch weniger als zehn Jahre zu leben haben oder bei besonders langsam wachsenden Tumoren, kann deshalb die beste Lösung sein, schlicht abzuwarten und dabei die Entwicklung des Karzinoms engmaschig zu beobachten. Die Lebensqualität beeinträchtigende Nebenwirkungen einer Behandlung werden so vermieden, zugleich kann bei Verschlechterungen schnell eingegriffen werden. Das kann sich aber gerade bei älteren Männern als unnötig erweisen. Dann gilt der Satz: Sie sterben nicht an, sondern mit ihrem Krebs. n Bei der Krebsvorsorge müssen deutsche Männer noch viel lernen: Nur jeder vierte lässt sich regelmäßig auf Tumoren untersuchen. Der Grund: Viele Männer fürchten die rektale Untersuchung beim Urologen. Denn: Männer neigen eher dazu als Frauen, das Thema Krankheiten zu verdrängen. Werbebeitrag Interview „Quantensprünge dank Hightech“ Die von Professor Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wirth geleitete Klinik für Urologie am Dresdner Uniklinikum ist eines der größten urologischen Zentren in Deutschland. Seit dem Umzug in einen Neubau verfügt die Klinik über ein Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wirth Facharzt für Urologie, Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus hochmodernes Umfeld und konnte sein Angebot an wegweisenden Methoden zur Diagnostik und Therapie urologischer Tumoren weiter ausbauen. Herr Professor Wirth, ihre Klinik verfügt mit dem Da Vinci über einen OP-Roboter der neuesten Generation. Inwiefern profitieren Ihre Prostatakrebspatienten davon? Der Da Vinci stellt eine konsequente Weiterentwicklung der laparoskopischen Operationstechnik dar, die viele Schwachpunkte und Nachteile der konventionellen Laparoskopie beseitigt. Die große Präzision des Robotersystems trägt dazu bei, so nervschonend wie möglich zu operieren. Dennoch ist die Erfahrung der Operateure entscheidend – die Klinik nahm bereits mit dem Vorgänger­Modell des Da Vinci mehr als 400 Operationen vor. Ist Hightech auf den OP beschränkt? Keinesfalls. Gerade in der Diagnostik hat sich sehr viel getan. Die Urologie des Dresdner Uniklinikums steht diesen Verfahren offen gegenüber, sofern sie für den Patienten wirklichen Nutzen bringen. Ein noch sehr neues Untersuchungsverfahren ist das Histoscanning: Bei einem verdächtigen PSA-Wert untersuchen wir im Rahmen einer Studie die Prostata mit einem speziellen Ultraschallgerät und einer neuen Auswertungssoftware. Da Krebsgewebe ganz besondere, am Bildschirm allerdings nicht erkennbare Strukturen aufweist, wertet eine spezielle Software die Bilder aus. Trotz aller Innovationen sind dem Ultraschall Grenzen gesetzt. Lassen sich diese Defizite in der Bildgebung ausgleichen? Wir nutzen seit einem Jahr die MRTUltraschall­Fusion, um bei der Entnahme von Gewebeproben aus der Prostata so präzise wie möglich vorzugehen. Dazu werden Bilder aus dem MRT in das Ultraschallgerät eingegeben. Die Vereinigung der Tomografieaufnahmen mit den während der Punktion gemachten Ultraschallbildern lenkt den Arzt zu den besonders auffälligen Bereichen der Prostata, in denen wir den Tumor vermuten. n www.uniklinikum-dresden.de/uro Eine Publikation des Reflex Verlages LEBEN MIT KREBS 15 ARTIKEL Schmerztherapie Lebensqualität mit der richtigen Begleitung Krebspatienten haben oft mit schlimmen Schmerzen zu kämpfen – das muss nicht sein. VON LENA WINTHER W er die Diagnose Krebs bekommt, bei dem kommt existenzielle Angst auf. Sie ist der Beginn eines Überlebenskampfes, und jeder Betroffene weiß, dass ihm eine Menge Leid bevorsteht. Besonders groß ist die Angst vor Schmerzen. Diese können mitunter sogar so demoralisierend wirken, dass sie eine Verschlechterung des Zustands zur Folge haben. Körper, Geist und Seele gehören eben zusammen und daher ist es wichtig, alle zu stärken. Dazu gehört unter anderem eine angemessene und individuelle Schmerztherapie. Was tun, wenn es wehtut? Eigentlich haben Schmerzen durchaus ihren „Sinn“. Unsere Schmerzrezeptoren dienen unserem Körper als eine Art Warnsystem gegen Gefahren. Über das Rückenmark wird der Schmerzreiz ins Gehirn transportiert. Dabei ist die Schmerzempfindung bei jedem Menschen einzigartig, allein schon, weil die Verarbeitung über das Rückenmark unterschiedlich programmiert GASTBEITRAG ist. Krebspatienten haben oft durch den eigentlichen Tumor Schmerzen, etwa, wenn Knochenmetastasen entstanden sind. Auch können Schmerzen im betroffenen Organ oder in den Nerven entstehen. Hinzu kommen Folgeerscheinungen von Medikamenten und Operationen oder Überempfindlichkeiten durch Strahlentherapien. Egal, welche Ursache die Schmerzen haben, sollten sie nie heruntergespielt, sondern angemessen therapiert werden. Das geht vor allem durch die Dokumentation des Schmerzes und den offenen Dialog zwischen Arzt und Patient. Über Fachorganisationen und Krankenkassen können auch Schmerztagebücher bezogen werden, was dem Arzt eine Behandlung oder gegebenenfalls Überweisung erleichtert. Neurologische Untersuchungen können die Ursachen abklären – dann ist durchaus eine Verabreichung von morphinhaltigen Medikamenten sowie von Präparaten, die bei plötzlichen Schmerzschüben helfen, zu erwägen. Sehr wichtig ist auch das Einbeziehen der Angehörigen. Ihnen fällt es zwar schwer zu akzeptieren, dass der ge- liebte Mensch Schmerzen hat, doch schlimmer leiden sie, wenn sie nicht aufgeklärt sind. Der Schmerz muss nicht ertragen werden Bei Krebspatienten kommt allerdings oft auch die Psyche ins Spiel: Sie empfinden große Angst, und diese erzeugt oder verstärkt oftmals den Schmerz. So können regelrechte Phantomschmerzen entstehen, die völlig unnötig sind. Umso wichtiger sind auch hier Transparenz und Aufklärung. Psychothera- peutische Gespräche, etwa mit einem speziell ausgebildeten Psychoonkologen, können Ängste lösen und Hoffnung schaffen. Aber ganz egal, ob psychische oder körperliche Faktoren die Beschwerden auslösen, gilt die Formel: Schmerzen sollten frühzeitig bekämpft werden. Der Patient leidet schließlich schon genug unter seiner Erkrankung, daher ist eine medikamentöse wie auch psychologische Schmerzbegleitung dringend notwendig – und das am besten, sobald die Schmerzen auftreten. n Schmerzen müssen angemessen therapiert werden. Tumorschmerzen Besser leben mit Krebs B is zu 80 Prozent der Krebspatienten leiden an Schmerzen. In der Regel können diese mit Schmerzmedikamenten gelindert werden. Bei vielen Patienten treten aber zusätzlich Schmerzspitzen auf. Damit diese richtig erkannt und wirksam behandelt werden können, ist ein guter Informationsfluss zwischen Patient und Arzt notwendig. Mit besonders schnell und kurz wirkenden, starken Schmerzmitteln (Opioiden) können Schmerzspitzen heute gut kontrolliert werden. Die Lebensqualität der Betroffenen verbessert sich dadurch erheblich. Trotz gut behandelter Grundschmerzen leiden Krebspatienten häufig unter Schmerzattacken. Im Durchschnitt vier Mal täglich treten diese plötzlich und oft ohne erkennbaren Grund auf. Sie erreichen innerhalb weniger Minuten ihre maximale Stärke und klingen im Durchschnitt nach einer halben Stunde wieder ab. Mit einer höher dosierten Gabe der Basis-Schmerzmittel lassen sich diese Schmerzspitzen oft nur ungenügend und unter dem Risiko vermehrter Nebenwirkungen abfangen. Daher ist die Lebensqualität von Krebspatienten durch Schmerzspitzen oft sehr beeinträchtigt. Effektive Behandlung von Schmerzspitzen bei Krebspatienten Wenn der Patient unter plötzlich auftretenden Schmerzattacken leidet, sollte er zusätzlich zu seinem normalen Schmerzmittel ein Medikament gegen diese Schmerzspitzen einnehmen. In der Regel erhalten Krebspatienten gegen ihre Schmerzen lang wirksame Opioide. Um die Situation zu verbessern, sollten Patienten solche Schmerzen beim behandelnden Arzt offen ansprechen. „Je genauer Patienten ihre Symptome im Gespräch mit dem Arzt beschreiben, desto einfacher fällt die Diagnose von Schmerzspitzen“, bestätigt Professor Dr. Frank Elsner, kommissarischer Direktor der Klinik für Palliativmedizin an der Uniklinik Aachen. Nützliches Schmerztagebuch Für eine genaue Beschreibung der Schmerzen ist ein Schmerztagebuch hilfreich. Darin notiert der Patient den zeitlichen Verlauf, die Stärke, die be- troffene Körperstelle und die Art der Schmerzen. Darüber hinaus kann man darin die Medikamenteneinnahme, Schlafgewohnheiten, Beweglichkeit, Verdauung, Stimmung, das Allgemeinbefinden sowie weitere Beschwerden festhalten. So kann der Arzt sich ein genaues Bild von der Gesamtsituation seines Krebspatienten verschaffen. Sind die Schmerzspitzen erst einmal erkannt, können sie gezielt behandelt werden. Damit erhält der Patient ein Stück seiner Lebensqualität zurück.n Autor: Christiane Weber, Apothekerin und Fachjournalistin Für die Schmerzspitzen gibt es spezielle Opioide, die direkt über die Mundschleimhaut resorbiert werden („Express-Opioid“). So gelangt der Wirkstoff besonders rasch in den Blutkreislauf und wirkt bereits ab fünf Minuten nach der Einnahme. Die stärkste Wirkung stellt sich bei den meisten Patienten nach maximal 30 Minuten ein. Anschließend klingt sie schnell wieder ab. Auf diese Weise wird der zeitliche Verlauf der Schmerzspitzen von Krebspatienten genau abgedeckt. Durch den schnellen Wirkeintritt und die hohe Wirksamkeit können plötzliche Schmerzen effektiv gelindert werden. Das Express-Opioid ist ausschließlich für die Behandlung von Schmerzspitzen bei Krebspatienten mit Basis-Schmerztherapie zugelassen und muss vom behandelnden Arzt verordnet werden. Prostata Center im Bildgebende Institut für DIAGNOSTIK Bei Prostatakrebs: Behandlung ohne Impotenz und Inkontinenz. Warum die Prostata entfernen, wenn es möglich ist, die Krebsherde in der Prostata zu lokalisieren und gezielt zu zerstören? Und dabei Nebenwirkungen wie Impotenz und Inkontinez zu vermeiden. Step 1: Präzise Diagnostik Nachweis und Lokalistaion der Krebsherde erfolgen nicht-invasiv mit Magnetresonanz-Tomographie (MRT) und –Spektroskopie (MRS), mit hoher Treffsicherheit und Ortsauflösung. Gewebecharakterisierung (Gleason Score) und Therapieplanung basieren auf 3D-Mapping mit MRT-gesteuerter und transperinaler Biopsie – schmerzfrei und ohne Infektionsrisiko. Step 2: Fokale Therapie Gezielte Zerstörung der Karzinomherde mit dem NanoKnife® (Irreversible Electroporation) - mit minimaler Schädigung der gesunden Prostataanteile. Im Gegensatz zu anderen Behandlungsverfahren werden Zellen selektiv zerstört - wichtige Gewebeanteile wie Gefäße und Nerven bleiben erhalten. Impotenz und Inkontinenz werden vermieden, ebenso wie Wundschmerzen und Narbenbildung. Die Behandlung ist in der Regel innerhalb von 24h abgeschlossen. Rehaund Nachsorgebehandlungen sind nicht erforderlich. Fragen Sie die Experten im ProstataCenter. Wir beraten Sie gerne, auch in Bezug auf alle anderen Diagnose- und Behandlungsverfahren bei Prostatakrebs – unverbindlich und objektiv. Prostata-Center: Innovativ – interdisziplinär – international Leitung: Prof. Dr.mult. M. K. Stehling Adjunct Associate Professor of Radiology Boston University School of Medicine Privatdozent an der LMU München im Alpha-Haus Strahlenberger Straße 110 63067 Frankfurt am Main – Offenbach Telefon +49 (0) 69 / 50 50 00 90 Internet www.prostata-center.de E-Mail [email protected] Nebenwirkungen, u.a. Impotenz und Inkontinenz, sind abhängig von individuellen Faktoren des Patienten, u.a. des Stadiums des Prostatakarzinoms. Vor jeder Behandlung sollten Sie sich deshalb ausführlich beraten lassen, auch in Bezug auf die S3 Leitlinie Prostatakarzinom.