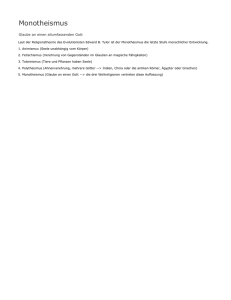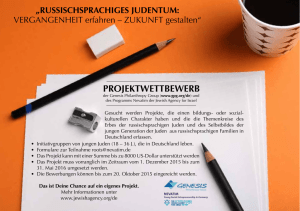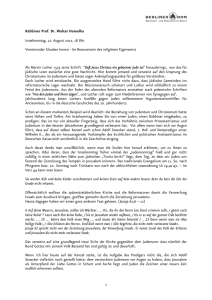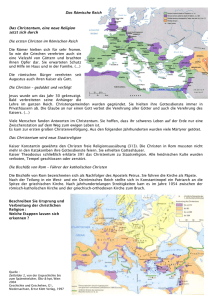Trinitarischer Gott und jüdischer Monotheismus - RPI
Werbung

Bernhard Grümme Trinitarischer Gott und jüdischer Monotheismus. Stolpersteine gegenseitigen Verstehens in Theologie und Religionspädagogik? „Die Welt mit Religion zu füllen, jedenfalls mit Religionen abrahamitischer Art, ist so als würde man die Straßen mit geladenen Waffen übersähen. So darf man nicht überrascht sein, wenn sie benutzt werden“.1 Wer so formuliert, der darf gewiss sein, nicht lediglich eine Privatmeinung zu äußern. Wer so formuliert, ist dazu angetan, seine Thesen in Massenauflage publizieren zu können und seine Bücher selbst in Bahnhofsbuchhandlungen ausgelegt zu finden. Richard Dawkins, von dem hier die Rede ist, trifft mit seinen Thesen den Geist der Zeit. Mag er selber sich inzwischen in seinem Kampf gegen die Windmühlen des Gottesglaubens, der Theologie und der Metaphysik aus dem Geiste einer naturalistisch enggeführten Soziobiologie heraus so weit verrannt haben, dass seine Entlarvung jeder Religiosität als Gotteswahn selber quasi metaphysische Züge trägt, mag sein radikalisierter Naturalismus entgegen der eigenen Intention selber einen Welterklärungsanspruch erheben,2 so sind seine Thesen Teil eines neu aufflammenden Atheismus geworden. Dieser nimmt seinen Ausgangspunkt weniger bei der Leidensfrage oder der Theodizeeproblematik. Hierzu hatte bereits Karl Rahner, einer der profiliertesten Theologen des 20. Jahrhunderts festgehalten, dass es sich dabei wohl um die einzig legitime und begründete Form der Gottesleugnung handele, von der auch die Christen für ihren eigenen Glauben und für ihr eigenes religiöses Selbstverständnis immer wieder neu lernen könnten.3 Nein, dieser neue Atheismus nimmt seinen Ausgangspunkt neben dem erwähnten Naturalismus vor allem bei der Gewaltfrage. „Der Herr ist kein Hirte. Wie Religion die Welt vergiftet“: mit solchen provokativen Äußerungen kommt nun auch Christopher Hitchens Dawkins zur Hilfe, um zusammen mit ihm Religion und vor allem den theistischen Gottesgedanken von Grund auf als inhuman, intolerant, gewaltfördernd und entfremdend abzulehnen.4 Es ist wohl weniger die luzide, feinsinnige Argumentation, die für die große Publizität solcher Thesen verantwortlich zeichnet. Vielmehr treffen diese Autoren ins Herz vieler Zeitgenossen. Nach neuesten Forschungen neigen „weit über die Hälfte aller Deutschen“ diesen Thesen zu.5 Auch subtile Analysen von Gewalt als Bestandteil der Moderne stellen sich in diese Richtung. Jan Philipp Reemstma, bekanntermaßen ein vehementer Vertreter der Säkularisierungsthese, unterscheidet in seinem neuesten, beeindruckenden Werk zum Zusammenhang von Vertrauen und Gewalt als einer besonderen Konstellation der Moderne sehr wohl zwischen den Desperados des islamistischen Terrors und den 1 Richard Dawkins, zit. nach Klaus Müller, Der Monotheismus im philosophischen Diskurs der Gegenwart; in: Thomas Söding (Hg.), Ist der Glaube Feind der Freiheit? Die neue Debatte um den Monotheismus, Freiburg i. Br. 2003, 176-213; hier: 176. 2 Vgl. Richard Dawkins, Der Gotteswahn, Berlin, 2007; Peter Strasser, Warum überhaupt Religion? Der Gott, der Richard Dawkins schuf, München 2008 3 Vgl. Rahner, Warum lässt der gute Gott uns leiden; in: ders., Schriften XIV, Einsiedeln 1980, 450-467. 4 Vgl. Christopher Hitchens, Der Herr ist kein Hirte : wie Religion die Welt vergiftet, München, 2007. 5 Hans G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, Bonn 2008, 9. 1 verfassten Religionen, ohne diesen nicht doch eine solche Tendenz zur Exklusion und Gewaltneigung zu unterstellen.6 Er stellt sich damit in eine Tradition so divergierender Denker wie Thomas Hobbes, David Hume, Friedrich Nietzsche bis hin zu Peter Sloterdijk. Immer ist es zu einem ganz entscheidenden Punkt der Monotheismus, der Religion gefährlich macht, weil in ihm das gewaltförmige Potential liegt. Sloterdijks philosophischer Monotheismuskritik beispielsweise gelten alle Monotheismen mit ihrer Unterscheidung von wahr und falsch, von Wirklichkeit und Meinung, von Sein und Schein als „Halbarchaische Konfliktfolklore“, als „primitiv(er) und präkomplex(er) ... Fundamentalismus“.7 Der Ägyptologe Jan Assmann hat hierzu bekanntlich die religionsgeschichtlichen Wurzeln freigelegt. Dem Reformversuch Echnatons in Ägypten war daran gelegen, die ägyptischen Gottheiten durch den einen Sonnengott Re zu ersetzen. Dies hätte aus dem von ihm so genannten Kosmotheismus, in dem in einer Art Eingottglaube der eine Kosmos Ordnung und Wohnstatt unterschiedlicher Götter und Göttinnen war, einen anderen, gänzlich verwandelten Eingottglauben gemacht: einen machtförmigen, ausschließenden exklusiven Monotheismus. Doch während sich dieser schließlich in Ägypten nicht durchzusetzen vermochte, gelang dies in Israel. Die Religion Israels unter Federführung des Mose bringe die mosaische Unterscheidung ein und mit der Entdeckung der Sünde die Differenz zwischen wahr und falsch, gut und böse. Ein toleranter, offener Gottesglaube wich einem intoleranten wie exklusiven Eingottglauben, wenn im Buch Exodus festgehalten wird: „ Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben“ (Ex 20, 2). Diese „Gegenreligion“ des Mose kannte nur die wahre im Gegensatz zur falschen Gottesverehrung. Der Raum, so Assmann, „der durch diese Unterscheidung ‚getrennt oder gespalten’ und dadurch aller erst geschaffen wird, ist der Raum des jüdisch-christlich-islamischen Monotheismus. Es handelt sich um einen geistigen oder kulturellen Raum, der durch diese Unterscheidung konstruiert und von Europäern nunmehr seit fast zwei Jahrtausenden bewohnt wird“. Damit hebe sich der Monotheismus von allen Polytheismen der Antike ab, denen der Begriff einer unwahren Religion nicht bekannt gewesen sei. 8 Wir können nun nicht die weitverzweigte Debatte hier nachzeichnen. Wir können nicht prüfen, inwiefern die weit ambitionierten Thesen exegetischen wie religionsgeschichtlichen oder historischen Prüfungen überhaupt standhalten. Für Peter Schäfer baut Assmann lediglich einen „Popanz“ auf, den es historisch nie gegeben hat. Vielmehr habe ein durchaus offener und duldsamer Monotheismus der Juden das friedliche Zusammenleben zwischen Nichtjuden und Juden in den religiös höchst pluralen 6 Vgl. Jan Philipp Reemstma, Muss man Religiosität respektieren?; in: Gerhard Besier, Hermann Lübbe (Hg.), Politische Religion und Religionspolitik. Zwischen Totalitarismus und Bürgerfreiheit, Göttingen 2005, 391-406; ders., Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne, Hamburg 2009, 520ff. 7 Peter Sloterdijk, Tau von Bermudas. Über einige Regime der Einbildungskraft, Frankfurt a.M. 2001, 11f. 8 Jan Assmann, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, München Wien 1998, 18; vgl. a.a.O., 246ff.280ff; Hans G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, Bonn 2008, 17ff; Klaus Müller, Der Monotheismus im philosophischen Diskurs der Gegenwart; in: Thomas Söding (Hg.), Ist der Glaube Feind der Freiheit? Die neue Debatte um den Monotheismus, Freiburg i. Br. 2003, 190ff. 2 antiken Städten begründet.9 Hans Kippenberg gewinnt aus religionswissenschaftlicher Perspektive ein durchaus differenziertes Bild. Während Assmann in dieser Mosaischen Unterscheidung vor allem den Glaubensabtrünnigen, den Apostaten, nicht aber den Ungläubigen in den Fokus der Gewalt gerückt sieht, arbeitet Kippenberg heraus, dass Religion noch weitere Quellen und Bezugspunkte von Gewalt kenne. Da ist zum einen der Partikularismus, ein theologisches Knappheitsdenken, eine göttliche Parteilichkeit, die den einen das Land, das Heil, die Erwählung zuspricht, den anderen nicht. Da ist zum anderen die Gewalt zum Zwecke der Verteidigung gegen religiöse wie gesellschaftlich-politische und ökonomische Fremdherrschaft. Diese Momente arbeitet Kippenberg als Momente des Judentums, aber auf die jeweilige Art auch des Christentums wie des Islam heraus. Am Ende gelangt er zu folgendem Fazit: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen Monotheismus und Gewalt; jedoch muss man ihn kontingent nennen: Er ist weder notwendig, noch ist er unmöglich. Er hängt von der Situation ab, in der eine religiöse Gemeinschaft sich befindet“.10 Jetzt könnte man gewiss auf die Idee kommen, als kritische Absetzung davon mit Odo Marquard oder Peter Sloterdijk das Lob des Polytheismus zu singen. Doch hatte bereits Arnold Angenendt die von Jan Assmann vollzogene Annahme eines durch sich selber bereits toleranten antiken Polytheismus als nachträgliche wie zeitgenössische Idealisierung entlarvt,11 so lehrt nach Kippenberg sowohl der zeitgenössische Hinduismus als auch zu seiner besonderen Verwunderung angesichts dessen eigenen Gewaltlosigkeitspostulats der Buddhismus die Existenz eines solchen kontingenten Zusammenhangs von Religion und Gewalt.12 Mitten in dieser Debatte steht nun der Konflikt zwischen Judentum und Christentum, zwischen Israel und Kirche. Dieser Konflikt hat im zentralen Maße mit einer christlichen Schuldgeschichte zu tun, mit einer Vergegnungsgeschichte (Martin Buber), die nicht allein auf theologischen Motiven beruht. Insofern Kippenberg die religiöse Gewalt als „Teil eines komplexen Dramas“ zu verstehen versucht,13 wird auch religionswissenschaftlich deutlich, dass diese Konfliktgeschichte zu komplex ist, würde sie allein auf die Frage einer Theologie des Volkes Gottes, des Bundes oder die der Messianität und Gottessohnschaft Jesu zurückgeführt. Die Geschichte des Antijudaismus wie des Antisemitismus in deren gegenseitiger Durchdringung würde reduktionistisch beschreiben, wer sie allein theologisch und nicht ebenso in soziologischen, kulturhistorischen, politischen oder ökonomischen Kategorien zu fassen versuchte. Und doch liegt gerade in der Frage der Dreifaltigkeit Gottes, des christlichen Trinitätsglaubens der alles entscheidende theologische Dissens. Es war wohl auch dieser Dissens, angeschärft durch den Gottesmordvorwurf, der christliche Gewaltaktionen gegen Juden immer wieder motivierte. Ob umgekehrt der sog. Ketzersegen, der als Zusatz zum jüdischen Achtzehnbittengesetz sich von den Häretikern und Verleumdern absetzte und diese verfluchte, tatsächlich antichristlich intendiert war oder eben nicht, wie dies jedenfalls neuere judaistische Forschungen herausstellen: ein 9 Peter Schäfer, zit. nach Hans G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, Bonn 2008, 21. 10 Hans G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, Bonn 2008, 22. 11 Vgl. Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert, Münster 2007, 88-99. 12 Vgl. Hans G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, Bonn 2008, 22f. 13 Hans G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, Bonn 2008, 27 3 Blick auf die Literatur der Kirchenväter zeigt, dass den Juden zumindest unterstellt wurde, aufgrund solcher zunehmend begrifflich ausformulierter theologischer Differenzen täglich im Synagogengottesdienst die Christen zu verfluchen.14 Doch so sehr es historisch unbestreitbar ist, so sehr obliegt es theologischer Klärung, ob und inwiefern der Trinitätsglaube auch inhaltlich jenen Sprengstoff bietet, der das Verhältnis zwischen Juden und Christen so nachhaltig belastet. Stellen also der christliche Glaube an den Trinitarischen Gott und der jüdische Monotheismus Stolpersteine gegenseitigen Verstehens dar? Um in dieser Problematik weiterzukommen, bietet es sich an, jenseits eines religionswissenschaftlichen Zugangs eine systematisch-theologische Perspektive einzunehmen und in sechs Schritten vorzugehen: 1. Zunächst sollen die Vorwürfe des Judentums gegen den christlichen Trinitätsglauben erhoben, erläutert und 2. in exemplarischer Auseinandersetzung mit maßgeblichen Vertretern christlicher Theologie kritisch geprüft werden; 3. gilt es zu untersuchen, welche Annäherungsmöglichkeiten, welche strukturellen und inhaltlichen Ähnlichkeiten, aber auch welche Unterschiede im Gottesdenken und Gottesglauben bestehen, um sodann 4. das Verhältnis zwischen Juden und Christen begrifflich präzise in seiner Einzigartigkeit auch gegenüber anderen Beziehungen in der sogenannten abrahamitischen Ökumene zu profilieren, um dies dann 5. in religionspädagogischer Blickrichtung fruchtbar werden zu lassen. Denn möglicherweise liegt hier in der Rede vom Judentum im RU der öffentlichen Schule einer der entscheidenden Orte, an denen Vorurteile verlernt werden können. Von den erwähnten naturalistischen wie gewalttheoretischen Atheismen gewissermaßen zur Negationsmasse einer fortschreitenden Moderne vereinigt, gilt es schließlich 6. zu prüfen, ob Juden und Christen nicht aus einer Koalition des Vertrauens in den je größeren Gott sich kritisch wie produktiv in diesen Gegenwartskontext einbringen könnten. 1. Jüdische Kritik am Dreifaltigkeitsglauben Mit dem Begriff der Dreifaltigkeit beziehungsweise der Trinität meint man gemeinhin den Glauben daran, dass sich der Gott Israels in Jesus, dem Juden aus Nazareth, in unüberbietbarer Weise gezeigt hat und dies im Heiligen Geist den Menschen von innen her eröffnet hat. Gott ist ein in sich lebendiger Gott, der sich durch den Sohn im Heiligen Geist den Menschen erschließt. Dabei ist es für den christlichen Glauben entscheidend, dass Gott sich auf unterschiedliche Weise in Jesus und im Heiligen Geist zeigt und damit zugleich deutlich wird, dass Gott in sich selber diese Differenzen aufweist. Im Neuen Testament gibt es keine entfaltete Trinititätstheologie. Diese entsteht erst ab dem 2. Jahrhundert und findet ihren ersten Niederschlag in den Konzilien von Nicäa, von Konstantinopel und von Chalcedon. Dort wurde die Göttlichkeit des Heiligen Geistes wie die Menschwerdung Gottes in Jesus als verbindliche Glaubenslehre kirchenamtlich niedergelegt. Tertullian hat im 3. Jahrhundert die Formel entwickelt „una substantia, tres personae“, um dieses Geheimnis auszusagen. Das Konzil von Konstantinopel hat dies später im Jahr 381 aufgenommen und davon gesprochen, dass Gott als ein 14 Vgl. Clemens Thoma, Das Messiasprojekt : Theologie jüdisch-christlicher Begegnung, Augsburg, 1994, 339-352. 4 Wesen in drei Personen existiert. Auf dieser Basis wurde das nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis formuliert, in dem der Dreifaltigkeitsglaube eindrucksvoll wie normativ seinen Niederschlag findet. In Gott sind alle eins, so im 15. Jahrhundert das Konzil von Florenz, wo nicht ein Gegensatz der Beziehung besteht.15 Allerdings kann man auch nicht sagen, dass der Trinitätsglaube dem Neuen Testament und dem Alten Testament völlig wesensfremd wäre. Es gibt im NT sogenannte Triadische Formeln, Glaubensbekenntnisse und Katechesen, die darauf hindeuten, dass bereits die ganz frühen Christen Gott in seiner Dreifaltigkeit wahrnahmen. Dafür spricht der Taufbefehl des Matthäus: „Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe“ (Mt 28, 19f). Oder bei Paulus, dem frommen Juden aus Tarsus, heißt es zum Abschluss seines 2. Briefes an die Korinther: „Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch“ (2 Kor 13,13). Gewiss arbeiten diese Formeln noch keine Theologie der dreifaltigen Selbstoffenbarung aus. Vater, Sohn und Geist stehen hier eher nebeneinander. Deren Beziehung, vor allem aber deren innergöttliche Relationen bleiben unreflektiert. Man darf aber insbesondere im matthäischen Taufbefehl eine Verdichtung katechetischer Glaubensreflexionen und Glaubensvollzüge sehen, insofern dieses Bekenntnis den Katechumenen als Abschluss ihrer Glaubensunterweisung abverlangt war. Hier verdichtet sich also der Glaube an Gott.16 Der christliche Glaube ist wesentlich trinitarisch. Und die trinitarische Theologie will diesem Gott in seiner Einheit, seiner Lebendigkeit, seiner übersprudelnden Fülle, die als Liebe sich in die Geschichte und in die Herzen des Menschen mitteilen will, nachdenken. Woran aber stoßen sich jüdische Ohren, wenn sie mit diesem Dreifaltigkeitsglauben konfrontiert werden? Immerhin liegt hier keine Nebensächlichkeit vor. Wir haben es hier mit prononciertesten und leidenschaftlichen Zeugnis des jüdisch-christlichen Gegeneinanders zu tun, das bis heute nicht verstummt ist. Es sind vor allem vier Argumentationslinien zu nennen:17 1. Gott neigt sich nach jüdischem Glauben zwar den Menschen zu, neigt sich herab. Aber er ist nicht Mensch geworden, ja er könne dies auch nicht, weil dies seine Göttlichkeit aufheben würde. So genau man auch die jüdische Tradition daraufhin befragen würde, dazu gibt sie keine Antwort. Außerdem hat die von den Christen behauptete Menschwerdung schlechte Früchte hervorgebracht. Immerhin wurden doch im Namen der Menschwerdung Gottes Pogrome und Zwangstaufen durchgeführt. Juden wurden zur Preisgabe ihres Glaubens gezwungen. Das widerlegt aber die Behauptung, die Christen hätten Anteil am Volk und an der Wahrheit Gottes. 2. Der Trinitätsglaube hat die wahre Gottesoffenbarung am Sinai des einen und einzigen Gottes mit hellenistischen und heidnischen Zusätzen verbunden und so die monotheistische und monolatrische 15 Vgl. Erwin Dirscherl, Gottes Wort im Menschenwort. Die Frage nach Jesus Christus und die Herausforderung des jüdischchristlichen Dialogs in der Gottrede; in: Magnus Striet (Hg.), Monotheismus Israels und christlicher Trinitätsglaube, Freiburg i.Br. 2004, 11-32; hier: 24. 16 Vgl. Jürgen Werbick, Trinität; in: Theodor Schneider (Hg), Handbuch der Dogmatik, Bd. 2, Düsseldorf 1992, 488ff. 17 Vgl. zum Folgenden: Clemens Thoma, Art.: Dreifaltigkeit; in: Jakob J. Petuchowski, Clemens Thoma, Lexikon der jüdisch-christlichen Begegnung, Freiburg i. Br. 1989, 90-93. 5 Gottesverehrung des Judentums verfälscht. Vor allem die rabbinischen Traditionen haben vor der Gefahr einer Abschwächung der reinen monotheistischen Gottesverehrung durch die Vermischung von Wahrem und Falschem, Widergöttlichen gewarnt. Diese Warnung vor dem Abfall in die Mischverehrung wird shittuf genannt. Sie ist eine Warnung an die Juden selber und durchzieht die ganze jüdische Geschichte, nicht abzulassen vom Glauben an den Einen Gott. Immerhin wird der Glaube an die Einzigkeit Gottes in seinem Wesen und in seiner Herrschaft als die wichtigste und kostbarste jüdische Glaubenstradition angesehen, für die viele jüdische Gläubige wie Rabbi Akiba im Jahr 135 nach Christus den Martyrertod auf sich zu nehmen bereit waren.18 Allerdings wird auch gesagt, dass man den Nichtjuden wegen dieser shittuf-Verehrung keinen Vorwurf machen könne. Immerhin waren sie nicht dabei, als Gott seine Gebote am Sinai gegeben habe. 3. Das Christentum hat durch die Trinitätstheologie, insbesondere durch die Theologie der Inkarnation, der Menschwerdung, eine physische, körperliche Komponente in den Gottesgedanken eingetragen. Dadurch aber würde der rein geistige, freie, unabhängige Gott beschränkt. Denn Körperlichkeit schließt eben Veränderung, Beschränktheit und Vielheit ein. Ein solcher Gott wäre nicht mehr der wirkmächtige Gott der hebräischen Bibel. Dies führte in den zunehmend kämpferischer werdenden Auseinandersetzungen gelegentlich zu der jüdischen Polemik, den Sohn Gottes als Verführer und den Heiligen Geist als Geist der Unreinheit zu verhöhnen. 4. Gott ist ein Gott der Geschichte, wie er sich besonders im Exodus und am Sinai gezeigt hat. Diese Geschichte des göttlichen Wirkens läuft darauf hinaus, dass Gott sich am Ende der Geschichte „unverfälscht und unverstellt“ als der eine und einzige Gott Israels offenbaren wird. Jüdische Tradition hat gegen gnostische Gottesspekulationen festgehalten, dass ohne eine Selbstoffenbarung Gottes nichts von Gott gesagt werden kann. Bei den Rabbinen heißt es, dass Gott nach seinen Taten genannt werde. Jehuda Hallevi schreibt: „Du darfst es überhaupt nicht für unwahrscheinlich halten, dass erhabene göttliche Spuren in dieser niederen Welt sichtbar werden, wenn diese Stoffe imstande sind, sie aufzunehmen. Hier ist die Wurzel des Glaubens und des Unglaubens“.19 Denn Unglaube liegt dort vor, wo der Mensch sich in Spekulationen über Gottes inneres Wesen ergeht. Dies aber liege auch im christlichen Trinitätsglauben vor. Diese Vorwürfe lassen den tiefen Dissens deutlich werden, der zwischen Juden und Christen besteht. Sagen wir es deutlich und auf den Punkt gebracht: Aus dieser Perspektive heraus ist das christliche Bekenntnis zum dreieinen Gott eine Absage an den einen und einzigen Gott, wie er sich am Sinai gezeigt hat. Die Christen haben damit die Grundlage verlassen, nein, sie haben sie konterkariert und verleugnet, wenn sie sich zum drei-einen Gott bekennen. Für manche Juden ist damit das Christentum schlicht Regression in Gnosis und Heidentum. 18 Vgl. Clemens Thoma, Theologische Beziehungen zwischen Christentum und Judentum, Darmstadt 19892, 113ff. Zit. nach Clemens Thoma, Art.: Dreifaltigkeit; in: Jakob J. Petuchowski, Clemens Thoma, Lexikon der jüdisch-christlichen Begegnung, Freiburg i. Br. 1989, 93. 19 6 Doch trifft diese Diagnose den Dreifaltigkeitsglauben wirklich? Oder baut diese massive Kritik ein Zerrbild auf, um sich selber leichter seiner eigenen Identität zu versichern? Ich will dies in einer Auseinandersetzung mit einem der wohl maßgeblichsten trinitätstheologischen Entwürfe prüfen: mit der Trinitätstheologie Hans Urs von Balthasars. 2. Ein interpersonales Drama in Gott? Züge der Trinitätstheologie Es ist hier nicht der Ort, die verzwickten Debatten trinitätstheologischer Theoriebildung im einzelnen nachzuzeichnen. Es gibt Gelehrte wie Alois Grillmaier, der sein ganzes Leben etwa darauf verwendet hat, christologische Formen zu verstehen und in deren geschichtliche Verwurzelungen zurückzuführen. Was für uns Heutige wie ein abgehobenes Theoretisieren anmutet, als ein Glasperlenspiel im welt- und erfahrungsabgeschotteten Elfenbeinturm, war doch für diejenigen, die sich daran beteiligten, gewissermaßen ein theoretisches Ringen auf Leben und Tod. In den Auseinandersetzungen um die Göttlichkeit und Sohnschaft Jesu, um die Göttlichkeit des Heiligen Geistes, um die Zuordnung von Vater, Sohn und Geist wurde nicht ein Spiel zum theoretischästhetischen Vergnügen gespielt. Hier ging es darum, in der jeweiligen Sprache und mit den jeweiligen Denkinstrumentarien der jeweiligen Gegenwart zum Ausdruck zu bringen, was die Menschen erfahren hatten, was im Neuen Testament niedergelegt worden war und was die Menschen in ihrer Gegenwart auch noch erfahren konnten: dass Gott ein lebendiges Gegenüber ist, eine Liebe, die sich klein macht, um andere groß zu machen und sich so in unterschiedlicher Weise den Menschen schenkt. Eine Trinitätstheologie, die dem nicht gerecht wird, kann dies nicht angemessen fassen. Damit aber würde Gott selber verfehlt und der Glaube verfälscht. Vor allem aber wären die erlösende, befreiende und vergebende Selbstzusage Gottes in Jesus nicht gegenwärtig. Wenn Jesus nur zum Schein Mensch war, wenn er also nicht so war wie Du und ich, dann sind die Menschen nicht erlöst. Dies war die gefährliche Tendenz des Doketismus. Wenn umgekehrt Jesus ganz Mensch war, aber der Logos in ihm nur das höchste, vornehmste Geschöpf war, dann ist Gott wiederum nicht bei den Menschen ganz und unverbrüchlich angekommen. Wiederum lässt sich so Erlösung nicht denken. Das war die Gefahr beim Arianismus, einer Tendenz, die mit dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 ihr vorläufiges Ende gefunden hat. Vorläufig deshalb, weil diese Tendenz unter unseren Vorfahren, den Franken, wieder sehr verbreitet war und - so könnten wir sagen – in einer gewissen Stoßrichtung auch in den Jesulogien der Aufklärungsphilosophie und der Gegenwart eine Rolle spielen. Jesus ist dort ein Vorbild gelingenden tugendhaften Lebens, nicht aber die Gegenwart des einen und einzigen Gottes. Das alles erklärt die Dramatik des Ringens um Formulierungen, das erklärt die teilweise heftigen, aggressiven Auseinandersetzungen, an deren Ende oft ein Anathema, ein Ausschluss aus der Gemeinde der Gläubigen stand; das alles erklärt die Unabgeschlossenheit jeder Theologie. Nicht umsonst bezeichnet Karl Rahner in einer berühmten Formulierung das Ergebnis des Konzils von Chalcedon, in dem Jesus als ganz Mensch und ganz Gott bezeichnet wird, in dem Gott und Mensch 7 ungetrennt und unvermischt zusammenkommen, als „Ende und Anfang“. Gute Theologie hält sich angesichts des Geheimnisses Gottes auf diese Unendlichkeit hin offen. 20 Natürlich war den Menschen die Brisanz eines christologischen wie pneumatologischen Bekenntnisses für den Monotheismus deutlich. Wer von Jesus als Sohn Gottes spricht, wer ihn für die eschatologische Gegenwart Gottes hält, wer den Heiligen Geist für die Gegenwart Gottes im Menschen hält, der muss klären, wie er dies mit dem Monotheismus in Einklang bringen möchte – und dies aus zweierlei Gründen. Zum einen war es vor dem Hintergrundannahmen der damals beinahe unbestrittenen Seinslehre der Griechen undenkbar, nicht ein letztes Prinzip anzunehmen. Alles Viele verweist auf das Eine, gründet im Einen. Wo das Göttliche nicht das Eine und Einzige wäre, wäre es nicht göttlich. Ein Dreigötterglaube, ein Tritheismus wäre also schon allein philosophisch undenkbar. Wichtiger noch war für die frühen Christen der jüdische Monotheismus als der Glaube Jesu und als ihr eigener Glaube. Ein Tritheismus hätte bedeutet, mit ihm zu brechen, und war deshalb unbedingt zu vermeiden. Bekanntermaßen hat auch dieser Monotheismus seine Entwicklung. Das AT gibt ein beredtes Zeugnis davon. Erst allmählich bildet sich der Ein-Gottglaube in dogmatischer und bekenntnishafter Hinsicht heraus. Am Anfang wird durchaus die Existenz anderer Götter eingeräumt, daraus entwickelt sich das Gebot der Alleinverehrung, der Monolatrie. Aufbauend auf den Propheten im 7. Jahrhundert vor Christus und der sog. Jahwe-Allein-Bewegung kann man wohl erst nachexilisch von einem jüdischen Monotheismus im begrifflich präzisen Sinne sprechen.21 Um an diesem Bekenntnis zum einen und einzigen Gott festzuhalten, deshalb dieses Ringen darum, wie denn Vater, Sohn und Geist zueinander stehen. Waren Sohn und Geist lediglich Erscheinungsweisen des Vaters? Das war die Position des Modalismus. Doch wie soll das noch die jeweilige Gotteserfahrung in ihrer Spezifizität würdigen? Sind Sohn und Geist nicht Gott eher untergeordnet? Ein solcher Subordinatianismus würde die tritheistische Gefahr vollends verhindern, aber auch die Göttlichkeit Jesu und des Hl. Geistes nicht würdigen und damit den erlösungstheologischen Rang Jesu unterschlagen. In der Geschichte der Trinitätstheologie haben sich zwei gegenläufige Traditionen herausgebildet. Die griechische Tradition geht vom einen Gott aus, der sich selber in dreifacher Weise vollzieht: als Vater insofern er der jenige ist, der sich stets behält und Urgrund des Selbstvollzugs ist, der Sohn, der als ewiger Erkenntnisvollzug und der Geist, der als Willensvollzug zu denken ist. Als solcher ist Gott ein und derselbe, nur unterschieden in diesen unterschiedlichen Relationen von Vater, Sohn und Geist. Augustinus hat Verstehensanalogien zu uns Menschen hergestellt. Denn wenn der Mensch Gottes Ebenbild ist, dann muss man an ihm auch etwas über Gottes innere und geschichtliche Lebendigkeit und Erfahrbarkeit ablesen können. So wie der menschliche Geist immer aus Gedächtnis (memoria), Erkennen (intelligentia) und Wille (voluntas) besteht und sich als solcher vollzieht, so in analoger Weise auch Gott. Deshalb heißt diese Trinitätslehre psychologische Trinitätslehre. Erkennbar steht 20 Vgl. insgesamt Karl-Heinz Menke, Jesus ist Gott der Sohn. Denkformen und Brennpunkte der Christologie, Regensburg 2008. 21 Vgl. Marie-Theres Wacker, Der biblische Monotheismus zwischen Bestreitung und Re-Vision; in: Concilium 4 (2009) 399-409. 8 hier die Einheit Gottes im Vordergrund. Der Personbegriff, wie er von Tertullian überkommen war, spielte hier „keine Schlüsselrolle“. 22 Anders in der Trinitätslehre in lateinischer Tradition. Hier wird Gott als ewige Liebesgemeinschaft gedacht, als eine Gemeinschaft, die sich als Liebe zwischen dem Liebenden, dem Geliebten und dem Mitgeliebten vollzieht. Der Vater ist hier der Liebende, der Sohn der Geliebte, der Geist der Mitgeliebte und derjenige, der beide vereinigt. Im Gefolge der Theologie des Richard von St. Viktor aus dem 12. Jahrhundert ist Gott also als ein innergöttliches Liebesgeschehen zwischen den drei Personen zu denken. Gott ist dreipersönlich. Der Personenbegriff spielt eine zentrale Rolle. Der erwähnte Hans Urs von Balthasar stellt sich ausdrücklich in diese Gedankenlinie. Aber er radikalisiert sie noch, indem er die Trinitätstheologie im kategorialen Rahmen seiner Theodramatik einstellt. Diese arbeitet stark mit der traditionellen Theologie des stellvertretenden Sühnetodes Jesu am Kreuz. Das Charakteristische für ihn ist nun jedoch nicht, dass sich in der Geschichte und am Kreuz ein Drama zwischen Mensch und Gott abspielt, wie es radikaler nicht sein könnte. Das Spezifische für Balthasar ist der Umstand, dass sich dieses Drama je schon vor aller Zeit in Gottes Ewigkeit selber abspielt. Balthasar will das Kreuz vor dem Hintergrund eines auf dem „Schlachtfeld“ der Offenbarung exakt herausgearbeiteten Stellvertretungsbegriffs in das ewige trinitarische Geschehen in Gott als Bedingung seiner Möglichkeit zurückgründen.23 Unter Aufnahme kenotischer Theorien versteht er die immanente Trinität, also die Dreifaltigkeit Gottes, wie sie in sich selber vor aller Geschichte und Offenbarung ist, als dramatische, liebende „Urkenose“ des sich hingebenden Vaters zu dem so unendlich getrennten, sich ihm eucharistisch gehorsam zurückschenkenden Sohn. Deshalb ist alle Zerrissenheit, jedwedes mögliche Drama zwischen Gott und Mensch „immer schon miteinbeschlossen und überholt (...), da jede Welt nur innerhalb der vom Heiligen Geist sowohl offengehaltenen wie überbrückten Differenz von Vater und Sohn ihren Ort haben kann“.24 Im diesem unendlichen Hiatus steht das Kreuz, stehen alle Leiden der Welt, steht auch Auschwitz. Das Kreuz ist nicht ein senkrecht vom Himmel fallendes Ereignis, sondern der Höhepunkt einer theodramatischen Bundesgeschichte mit der Menschheit. Deshalb ist alles geschichtliche Leid, all das, was sich an Gottes Gericht zugetragen hat, nur Widerschein des unendlich viel Furchtbareren des Karfreitags. Obzwar Gott versöhnungsbereite Liebe ist, müssen Gottes „Eifer und Zorn dennoch versöhnt werden“,25 um das an sich ausweglose Drama eschatologisch zu lösen. In dieser Logik ist es angelegt, „dass ein Gericht ergehen, eine Sühne geleistet werden muss -und dass Gnade siegt, auch durch das Gericht und mitten in ihm, damit der Bund ursprünglich und endgültig wiederhergestellt werde“.26 Indem am Kreuz sich Gottes Zorngericht über den vom Vater dahingegebenen und verlassenen, stellvertretend leidenden Sohn entlädt, „ihn anstelle der Unzähligen trifft“, in die hinein 22 Herbert Vorgrimler, Art.: Trinität; in: NThWb 2000, 636-640; hier: 638f. Hans Urs von Balthasar, Theodramatik III, Einsiedeln 1980, 12; vgl. a.a.O. 296ff 24 A.a.O., 304. 25 A.a.O., 211. 26 A.a.O. 219. 23 9 er ihn „zerspaltet (...) wie einen Blitzstrahl“,27 und sich im gehorsam hingebenden Sohn das Ja der Menschen realisiert, wird der Neue Bund gestiftet. Das Nein zu Gott wird an seinem Ort bis in seine gottfernste Radikalität hinein transfiguriert von der göttlichen Liebe, die fortan die eschatologisch befreite Freiheit des Menschen unterfasst. Theologisch sind hier eine Menge Fragen zu stellen: wo bleibt die Offenheit der Theodizeefrage, wo bleibt die menschliche Freiheit, wo bleibt der in seiner Gerechtigkeit barmherzige Gott des AT und des NT, wo bleibt die menschliche Geschichte? Aus jüdischer Sicht könnte man dies alles aufnehmen und noch weiter zuspitzen. Hier erkennen wir doch genau jene unselige Tradition trinitarischen Denkens, die letztlich auf Tritheismus hinausläuft und sich kaum vor dem Verdacht schützen kann, sich vorlaut ins Hl. Geheimnis Gottes zurückzutasten. Hier stehen drei innergöttliche Personen in einem innergöttlichen Drama von Ewigkeit her, dass geschichtlich nur noch zur Aufführung gelangt. Man sage nun nicht, dies sei eine Einzelmeinung. Es ließen sich mühelos aus katholischer Sicht etwa Gisbert Greshake oder Walter Kasper, aus evangelischer Sicht Wolfhart Pannenberg hinzuziehen, die wenn auch nicht in dieser gnostisch anmutenden Verve, aber doch ähnlich ambitioniert die Dreipersönlichkeit denken und Gott als Liebesgeschehen zwischen drei Personen verstehen, als innergöttliche Communio, als ewiges Kommunikationsgeschehen. Wenn christliche Trinitätstheologie so denken würde, schienen alle Einwände des Judentums berechtigt. Eine solche Trinitätstheologie käme in allerhöchste Begründungs- und Legitimierungsnöte. Gleichwohl gibt es innerhalb der christlichen Trinitätstheologie eine Alternative, das Geheimnis der Trinität auszusagen, ohne den Monotheismus latent zu relativieren. Wir haben sie bereits eingangs erwähnt. Andererseits finden sich auch im jüdischen Denken Punkte, von denen ein Gespräch über die Gottesfrage zwischen Juden und Christen ausgehen könnte. Deshalb muss von Beidem jetzt die Rede sein. 3. Annäherungen und Anschlussmöglichkeiten Als besonders verhängnisvoll erweist sich gleichermaßen trinitätstheologisch wie für das Gespräch mit den Juden die ungebrochene Übernahme des Personbegriffs. Dabei wird der semantische Wandel dieses Begriffs von der Antike bis heute unterschlagen. Das, was bei den Griechen Hypostase, dann bei den Lateinern Person ausdrücken soll, ist eben gerade nicht das, was wir modernen Menschen unter Person verstehen. Im antiken Theater war persona die Maske, die ein Schauspieler trägt, um eine Wirklichkeit darzustellen. So konnte man ausdrücken, dass Gott in sich Lebendigkeit ist und sich als Sohn in Geschichte und als Geist in den Herzen der Menschen schenkt und dabei immer ein und derselbe bleibt. Der Monotheismus war dabei nicht angetastet. Anders wenn der Personbegriff sich verändert, wie dies in der Neuzeit geschehen ist. Dann wurde Person mit Individualität, mit Subjektivität verbunden, mit Ichbewusstsein, mit Erkenntnis und freiem Willen. Von drei Personen in Gott zu sprechen wird dann gefährlich, wenn man die Grundregel theologischer Hermeneutik außer 27 A.a.O., 324ff. 10 Acht lässt, wie sie das 4. Laterankonzil festgelegt hatte: Nur analog, nur bei je größerer Unähnlichkeiten könne man Ähnlichkeiten zwischen Gott und Mensch aussagen, nur also wenn man alle Aussagen über Gott letztlich von einer negativen Theologie durchwirken lässt in der Hoffnung auf den größeren Gott. Bei Balthasar scheint diese Regel in den Hintergrund getreten zu sein. Hier handeln das Wort Gottes und der Geist Gottes eigenständig gegenüber dem Vater, hier werden sie begriffen als eigene Subjekte, die jeweils auf eigene Art eigenständig Gott zum Sprechen bringen. Man wird sagen können, dass an dieser Stelle der jüdische Einwand nur allzu berechtigt ist. Hier ist die tritheistische Gefahr nicht zu übersehen, auch wenn man nicht sagen kann, dass die genannten Autoren dem bereits erlegen sind. Gleichwohl bietet die andere, die griechische Tradition des Trinitätsdenkens eine Möglichkeit, wie Herbert Vorgrimler meint, „jüdische und muslimische Missverständnisse, als bekenne sich das Christentum zu drei Gottheiten, zu beheben“.28 Diese Theologie beginnt nicht bei Spekulationen über das innere Leben Gottes, sondern bei geschichtlichen Erfahrungen. Gott teilt sich selber mit, zeigt also nicht nur etwas Äußeres von sich in der Geschichte, also in Jesus und im Geist. Da im NT Gott (ó theos) immer den Vater meint, kann man sagen, das sich der Vater durch den Sohn im Hl. Geist mitteilt. Wenn er aber sich selber mitteilt, dann müssen diese geschichtlichen Selbstmitteilungen auch etwas für Gottes Lebendigkeit selber bedeuten. Wenn wir hinreichend die absolute Geheimnishaftigkeit Gottes sowie das Gesetz der analogen Gottesrede berücksichtigen, kann man sagen, dass eine Rede über die unterschiedlichen Erfahrungen Gottes etwas über Gottes inneres Leben selber besagt und umgekehrt. So formuliert Rahner: „Insofern Gott in seiner Selbstmitteilung immer das heilige unfassbare Geheimnis bleibt, sich verschenkend seine Göttlichkeit nicht verliert, nennen wir ihn den Vater. Insofern Gott uns sich selbst als unser eigentlichstes, ewig gültiges Leben mitteilt in der vergöttlichenden Gnade im Grunde unseres Daseins, nennen wir ihn Heiligen Geist. Insofern er als die eigentliche Wahrheit unseres Daseins im Gottmenschen geschichtlich erscheint, nennen wir ihn das Wort und den Sohn Gottes“. 29 Modalismus wäre dies nur dann, wenn diese geschichtlich erfahrbare Dreifaltigkeit nicht Gott an sich zukommen würde, und zwar bereits unabhängig von dessen Selbstmitteilung. In Gott ist alles eins, außer was die unterschiedlichen Relationen zwischen Vater und Sohn, zwischen Sohn und Geist und zwischen Vater und Geist angeht. Was ist damit für das Gespräch mit dem Judentum erreicht: 1. Ein solches Konzept wahrt die absolute Hoheit und Geheimnishaftigkeit Gottes. Man spekuliert nicht gnostisch in Gott hinein und versucht „Gott auf den Hintergedanken zu kommen“ (Hans Blumenberg). Man geht von geschichtlichen Erfahrungen des Menschen aus. 2. Rahners Konzept kann zeigen, dass man eine Trinitätstheologie jenseits der Aporien des Personbegriffs formulieren kann. Er kann durch diese terminologische Reserve, vor allem aber durch den Ansatz beim Vater einen kommunitären Personalismus verhindern, der die 28 Herbert Vorgrimler, Art.: Trinität; in: NThWb 2000, 636-640; hier: 639. Karl Rahner, Die Forderung nach einer ‚Kurzformel’ des christlichen Glaubens; in: ders. Schriften zur Theologie VIII, Einsiedeln 1967, 162. Vgl. grundlegend ders., Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes im Gespräch mit dem Islam; in: ders. Schriften zur Theologie XIII, Einsiedeln 1978, 129-147. 29 11 Trinität als Liebesgemeinschaft freier Subjekte denkt, aber damit den Monotheismus zu unterlaufen droht. Rahner entwickelt stattdessen eine Theozentrik, die der Anlage des NT und der christlichen Liturgie entspricht. Jesus betet hier zu seinem Vater, um in der paulinischen Vision am Ende alles dem Vater zu übergeben, der dann alles in allem sein wird (1 Kor 15,28). Hier ist die Gesprächsmöglichkeit mit den Juden offenkundig. In einem kürzlich erschienenen aufsehenerregenden Buch hat der Paderborner Bibelwissenschaftler Hubertus Frankemölle diese Theozentrik noch einmal stark herausgestellt und im Lichte dessen das NT insgesamt als ein zutiefst jüdisches Buch gelesen.30 Und auch eine sensible Liturgiewissenschaft hat herausgearbeitet, dass im Geiste des AT und des NT christliche Liturgie immer im Hl. Geist durch den Sohn letztlich zum Vater betet.31 3. Ein solches Konzept denkt die Trinität im Rahmen eines ganz bestimmten Monotheistischen Gottesgedankens. Es ist nicht der Monotheismus abstrakter Rationalität, ein Monotheismus der Philosophie, die alles auf ein letztes Prinzip zurückführt, es ist kein ethischer Monotheismus. Eine solche Trinitätstheologie steht im Rahmen eines heilsgeschichtlich konkreten Monotheismus. Dieser geht von einem Gott aus, der überquellende Liebe ist, der sich als solcher in der Heilsgeschichte erfahrbar gemacht hat und dem brennend an seinen Geschöpfen gelegen ist. Ein solcher Gott schenkt sich als Liebe an seine Geschöpfe, die er zu Mitliebenden befreien will. Damit aber unterliegt diesem Gottesgedanken bereits eine inkarnatorische Tendenz. Gott will bei seinen Geschöpfen wohnen, will bei ihnen sein. So gesehen wäre der Trinitätsglaube eine Radikalisierung dieser inkarnatorischen Tendenz. 4. Das Interessante für unsere Frage ist nun, das Rahner allen drei monotheistischen Religionen, also dem Judentum, dem Christentum wie dem Islam eine solche „inkarnatorische Eigentümlichkeit“ attestiert, weil „die Konkretheit des in der Geschichte handelnden Gottes ihn ja gerade in seiner einzigen wirklichen Göttlichkeit“ in einem Bund, in einem Menschen oder in einem heiligen Buch selber anwesend sein lassen soll.32 5. Ob das dem Islam wirklich gerecht wird, mag dahingestellt sein. Aber eine solche These verweist auf das Besondere des Verhältnisses von Juden und Christen und macht auf eine strukturelle und inhaltliche Parallelität wie auf die Divergenz zwischen Judentum und Christentum aufmerksam. Jüdischer Glaube und jüdisches Denken geht von einer inneren Lebendigkeit Gottes aus sowie von Gottes heilsgeschichtlich erfahrbarem Willen, bei seinen Geschöpfen zu sein. Der jüdische Gott ist ein symphatisierender, empathischer, dialogischer, geschichtlich treuer Gott. Die göttliche Weisheit, die Scheckina, dies sind sicherlich keine 30 Vgl. Hubertus Frankemölle, Das jüdische Neue Testament und der christliche Glaube. Grundlagenwissen für den jüdischchristlichen Dialog, Stuttgart 2009. 31 Vgl. Klemens Richter, Per Christum ad Deum. Der Adressat in den Präsidialgebeten der erneuerten Liturgie; in: Matthias Lutz-Bachmann, Und dennoch ist von Gott zu reden, Freiburg i.Br. 1994, 277-295. 32 Karl Rahner, Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes im Gespräch mit dem Islam; in: ders. Schriften zur Theologie XIII, Einsiedeln 1978, 133. 12 gottwesensgleichen Wirklichkeiten, wie wir dies für Sohn und Geist unterstellen. Aber sie sind göttliche präexistente Wirklichkeiten, die nach der alttestamentlichen Weisheitstheologie bei der Schöpfung anwesend waren, die sich auf Menschen legen oder die wie die Scheckina in der Geschichte liebend und befreiend mit den Menschen unterwegs ist. Gott neigt sich in ihr herab, wohnt den Menschen inne, erniedrigt sich, ohne sich vollends seiner Gottheit zu entkleiden. Die Scheckina ist in rabbinischer Theologie mitten unter den Menschen, wo sie die Tora lesen. Sie ist der Vollzug der Kondeszenz Gottes. Sie geht mit dem jüdischen Volk ins Exil, ja geht, wie dies in der Holocausttheologie gedacht wird – mit ihnen in die Gaskammern.33 Damit zeigt sich das, was für Rahner inkarnatorische Eigentümlichkeit oder was für die jüdische Seite inkarnatorische Tendenz bedeutet. Michael Wyschogrod sieht in dieser inkarnatorischen Tendenz eine zentrale Pointe des Judentums. Der Gott Israels ist „ein Gott, der in die Welt des Menschen eintritt und der, indem er das tut, die Parameter der menschlichen Existenz, einschließlich der Räumlichkeit, nicht scheut. Es stimmt, das Judentum vergisst nie das Dialektische, den transzendenten Gott (...). Doch diese Transzendenz bleibt in dialektischer Spannung mit dem Gott, der bei Israel in seiner Unreinheit wohnt (Lev 16,16), der der vertraute Gefährte des Juden ist, ob im Salomonischen Tempel oder in den Tausenden von kleinen Gebetsräumen (...). Das Judentum ist daher inkarnatorisch – wenn wir unter diesem Begriff die Vorstellung verstehen, dass Gott in die Welt des Menschen eintritt, dass er an bestimmten Orten erscheint und dort wohnt, so dass sie dadurch heilig werden“.34 Damit besteht eine tiefe Strukturgleichheit zwischen Judentum und Christentum. Der Unterschied liegt freilich auf der Hand. Nach Wyschogrod sei es für jüdische Traditionen nicht vorstellbar, dass Gott sich in einem bestimmten Menschen inkarniere. „Wenn wir die Hebräische Bibel ernst nehmen, kann es keinen Einzelnen geben, so bedeutend und prominent er auch sein mag, dessen Gottesbeziehung einseitig ist, so dass dabei das Volk Israel nicht der entscheidende Zweck wäre, dem diese Beziehung dient“. Denn im jüdischen Glauben ist das Volk als ganzes erwählt, würde demnach Gott sich im ganzen Volk inkarnieren, indem er ihm innewohnt und dieses in Dienst nimmt.35 An dieser Stelle unterscheiden sich Christen und Juden maßgeblich. Christen gehen davon aus, dass Gott sich in dem Juden Jesus von Nazareth in einmaliger und geschichtlich unüberbietbarer Weise selbst als Liebe den Menschen geschenkt hat. Hier liegt der bleibende Unterschied begründet – unbeschadet aller Strukturähnlichkeiten im Denken. 6. Freilich würden alle jüdischen Ängste bestätigt, würde die Inkarnation Gottes als Vermischung Gottes mit dem Menschen Jesus verstanden, als wäre Jesus so eine Art Zwischenwesen, ein heilsgeschichtlicher Zwitter. Das wäre allenfalls eine gnostische Figur, würde aber gerade diese inkarnatorische Tendenz, die eben Gott und Geschichte, Gott und 33 Vgl. Clemens Thoma, Das Messiasprojekt : Theologie jüdisch-christlicher Begegnung, Augsburg, 1994, 78-83. Michael Wyschogrod, Inkarnation aus jüdischer Sicht; in: EvTh 55 (1955), 13-28; hier:22f. 35 A.a.O., 24f. 34 13 Mensch ernst nimmt, unterlaufen. Man kann die massiven jüdischen Vorbehalte als kritische Mahnung an die Christologie sehen, für die wir Christen dankbar sein sollten. Wenn wir unser eigenes Erbe ernst nehmen, wenn wir die Christologie von Chalcedon des ungetrennten und unvermischten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch in Jesus uns neu aneignen würden, bestünde eine Möglichkeit, die Inkarnation zu denken, ohne dem Blasphemievorwurf zu verfallen. Dies markiert die Dringlichkeit, Jesus in seiner wahren Menschheit (vere homo) und in seiner wahren Göttlichkeit (vere deus) zur Geltung zur bringen. 36. Dann könnte Inkarnation als Judewerdung verstanden werden. Denn Gott wurde nicht in einem abstrakten ontologisierenden Sinne Mensch. Gott wurde Mensch in dem konkreten Jeschua aus Nazareth. 4. Die „jüdische Messiaserwartung ist nicht vergeblich“ (Päpstliche Bibelkommission 2001). Für ein erneuertes Verhältnis zwischen Juden und Christen Nicht zuletzt aufgrund dieser Strukturgleichheit im Denken zeigt sich die Besonderheit des Verhältnisses zwischen Juden und Christen. Christen haben zu den Juden ein ganz einzigartiges Verhältnis wie zu keiner anderen Religion, auch nicht zum Islam. In der Entdeckung dieser Einzigartigkeit liegt wohl das, was man einen Paradigmenwechsel im Verhältnis zwischen Christentum und Judentum nennt. Hinter ihn sollte nicht mehr zurückgegangen werden, auch wenn die unsäglichen Vorgänge um die Karfreitagsfürbitte und die Piusbbrüder das Gegenteil lehren. Für Papst Johannes Paul II. entdeckt die Kirche ihre Bindung zum Judentum. „Die jüdische Religion ist für uns nicht etwas Äußerliches, sondern gehört in gewisser Weise zum Inneren unserer Religion. Zu ihr haben wir somit Beziehungen wie zu keiner anderen Religion. Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder“.37 In dieser berühmten Rede wird nicht nur jegliche Kollektivschuld der Juden und damit der geschichtlich so fürchterlich wirksame Gottesmordvorwurf zurückgewiesen. Der Papst stellt mit Bezug auf Röm 11,28 fest, dass die Juden „weiterhin von Gott geliebt werden“, der sie mit einer „unwiderruflichen Berufung“ erwählt hat. Zwischen Juden und Christen besteht somit eine konstitutionelle Asymmetrie. Die Christen sind abhängig von den Verheißungen Gottes. Israel besitzt den heilsgeschichtlichen Primat. Erst in Jesus Christus haben, so Paulus im berühmten Ölbaumgleichnis in Röm 9-11, wir Nicht-Juden Anteil an dieser Bundesgeschichte Gottes. Das Judentum ist nicht etwa durch das Christentum heilsgeschichtlich überholt, wie es ein verhängnisvoll wirksames Substitutions- oder auch bestimmtes Typologiemodell gedacht haben. Das Judentum ist vielmehr ein von Gott gewollter Heilsweg neben dem Christentum. Damit kann sich das Christentum jene Verhältnisbestimmung von jüdischer und christlicher Gotteserwartung zu eigen machen, wie sie Franz Rosenzweig für sich gewinnt, um in den erregten Konvertierungsdebatten seines Umfeldes dennoch Jude zu bleiben und sich nicht zu assimilieren: „Es kommt niemand zum Vater denn durch ihn. Es kommt niemand zum Vater – anders aber wenn einer 36 37 Vgl. grundlegend Hans-Hermann Henrix, Judentum und Christentum: Gemeinschaft wider Willen, Regensburg 2004. Zit. nach Hans-Hermann Henrix, Judentum und Christentum: Gemeinschaft wider Willen, Regensburg 2004, 117f. 14 nicht mehr zum Vater zu kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und dies ist nun der Fall des Volkes Israel“.38 Es besteht eine messianische Weg- und Lerngemeinschaft von Juden und Christen, wobei sich die Juden auf die Tora und die Christen eben auf Jesus Christus stützen. Juden markieren die bleibende Unerlöstheit der Welt. Die Christen hoffen darauf, dass der (wieder)-kommende Messias das Antlitz Jesu trägt. Beide haben auf ihre jeweilige Weise Anteil an der sich von Gott her als Gotteswahrheit schenkenden Wahrheit, jeder auf seine Weise, beide aufeinander angewiesen, beide dienen Gott „Schulter an Schulter (Zef 3,9), beide warten gemeinsam und doch auf je eigene Weise auf Gottes endgültiges Kommen: die einen darauf, dass Gott endgültig alles in allem sein und sein Reich aufrichten wird, die anderen darauf, dass das Antlitz des kommenden Gottes das Antlitz Jesu tragen wird. 5. Religionspädagogischer Seitenblick Es versteht sich angesichts des Rahmens, die diesen Überlegungen gestellt sind, dass hier nur ein ganz kurzer Blick auf religionspädagogische Implikationen geworfen werden kann. Man muss hinsichtlich des Themas Judentum im RU von einer doppelten Schwierigkeit sprechen. Ohnehin gehört es wahrscheinlich zu dem schwierigsten Unterfangen in der öffentlichen Schule von Gott zu sprechen, Heranwachsende sprachsensibel und wahrnehmungsfähig für religiöse Zugänge zu machen und sie zu konfrontieren mit einem unbedingten Wahrheitsanspruch, wie er im Christentum begegnet. Das macht sozusagen Größe und Elend des konkreten RU in seinem Alltagsgeschäft aus. Diese Schwierigkeit jedoch erhöht sich noch, wenn man das Judentum thematisiert, eine Religion die aufgrund kultureller Differenzen und weitgehend fehlender realer Begegnungsmöglichkeiten in noch weitere Ferne gerückt ist. Man könnte hier von einer doppelten Fremdheit sprechen, die durch die herkömmliche Korrelationsdidaktik des RU kaum zu bewältigen ist.39 Umso wichtiger ist dieses Thema gerade für das christliche Selbstverständnis und gerade für die Beschäftigung mit der christlichen Schuldgeschichte. Ich will hier drei kurze Blicke werfen: 1. Analytische Perspektive Man wird sagen können, dass grobe antijudaistische Thesen und Bilder nicht mehr in Katechese, im RU, in Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien vorkommen. Gleichwohl gibt es bis in die jüngste Gegenwart Tendenzen, die Einzigartigkeit des jüdisch-christlichen Verhältnisses einzuebnen. Man wird dem eben nicht gerecht, wenn man wie in den Kirchlichen Richtlinien für die Bildungspläne der Grundschule im Jahr 2006 Judentum und Islam streng parallelisiert und so das Judentum subsummiert unter Nichtchristliche Religionen.40 Hier gilt es weiter sensibel zu sein. 38 Zit. nach Bernhard Grümme, „Noch ist die Träne nicht weggewischt von jeglichem Angesicht“. Überlegungen zur Rede von Erlösung bei Karl Rahner und Franz Rosenzweig,. Münster 1996, 642. 39 Vgl. Bernhard Grümme, Vom Anderen eröffnete Erfahrung. Zur Neubestimmung des Erfahrungsbegriffs in der Religionsdidaktik, Freiburg, 2007. 40 Vgl. Bernhard Grümme, Entzauberung einer Zauberformel? Ein Kommentar zu den Kirchlichen Richtlinien zu Bildungsstandards für den Religionsunterricht in der Grundschule; in: KatBl 4 (2007) 279-283. 15 2. Methodische Perspektive Aus dem weiten Spektrum des Interreligiösen Lernens sind für das Thema Judentum besonders zwei Methoden interessant: das anamnetische und das ästhetische Lernen. Anamnetisches Lernen greift auf Erzählungen über Feiern und Gedenktage im Judentum, Betrachtung und Meditation von Bildern vom Sederabend, vom Chanukkafest und weiteren memorativen Tagen zurück, inititiert Begegnungen mit Zeitzeugen der Shoah und Besuche von Denkmälern, Museen und vergleichbaren Orten der Erinnerung und schöpferische Verarbeitung der Eindrücke, greift auf Filme und Bilder zurück. Ästhetische Zugänge eröffnen eine Begehung einer Synagoge nach dem Muster der Kirchenraumpädagogik, initiieren ein Gespräch mit einem Rabbiner oder einem Vorsänger im Gottesdienst, vergleichen Synagoge und Kirche, jüdische und christliche Gebete auf Ähnlichkeiten und Unterschiede auch des Gottesglaubens, reflektieren Geschichte der Synagoge, Aufbau, Liturgie.41 3. Inhaltliche Perspektive Hier käme es darauf an, den jüdischen und christlichen Gottesglauben sachgerecht darzustellen. Vor allem die Tatsache des Juden Jesu, der eben an seinem jüdischen Gott festhielt, dessen Glaube eben nicht das Judentum sprengte, wäre wichtig. Man müsste zeigen, dass der Gott des NT eben der Gott des AT ist und damit alle verhängnisvollen Verzeichnungen aufklären, die einen Gegensatz zwischen einem angeblichen Gott der Rache, der Kälte, der Gesetzeshärte vom Gott der Frohen Botschaft und der Menschenfreundlichkeit herstellen will. So könnte dann das Spezifische des jeweiligen Gottesglaubens deutlich werden. Erst mit diesen drei Perspektiven würden die Heranwachsenden in diesem Bereich religiöse Kompetenz erlangen. Erst so könnte der RU sich als Teil zur Bildung der Schülerinnen und Schüler in den Bildungsauftrag der öffentlichen Schule einschalten. 6. Für eine Allianz der Monotheisten. AusblickKommen wir auf unseren Ausgangspunkt zurück. Ja, in der Tat stellt der Trinitätsglaube des Christentums im Verhältnis zwischen Christen und Juden einen erheblichen Stolperstein dar. Die Christen sind, dies sollte deutlich geworden sein, in diesem Glauben auch in der Hinsicht auf ihre älteren Geschwister angewiesen. Die jüdische Kritik bleibt „als Korrektiv gegen stets latentes Abgleiten in philosophische oder unhistorische-spekulative Aussagen über ein ohnehin nicht fassbares Innenleben Gottes (...) für den Christen unentbehrlich.“42 Andererseits haben wir doch erhebliche Strukturähnlichkeiten und Anschlussmöglichkeiten freigelegt. Beiden, Juden wie Christen ist die Hoffnung auf einen Gott gemeinsam, der leidenschaftlich an ihnen interessiert ist, der sich ihnen schenken, der ihren Herzen innewohnen und sich in der Geschichte erfahrbar machen will. In all dem bleibt er der größere Gott, bleibt das Hl. Geheimnis, auf dessen endgültiges Kommen beide gemeinsam und doch auf je eigene Weise hoffen. Beiden ist also eine 41 Vgl. Stefan Leimgruber, Interreligiöses Lernen, München 2007, 115-170. Clemens Thoma, Art.: Dreifaltigkeit; in: Jakob J. Petuchowski, Clemens Thoma, Lexikon der jüdisch-christlichen Begegnung, Freiburg i. Br. 1989, 89-96; hier: 90. 42 16 tätige Hoffnung im eschatologischen Vorbehalt gemeinsam, beiden die Struktur negativer Theologie eingetragen. Wenn beide dies beherzigen, wenn beide sich dies zu eigen machen, dann hätten sie auch dem gewalttheoretischen Atheismus unserer Tage etwas entgegenzusetzen. Die Geschichte von Judentum und Christentum zeigt auf vielfältige Weise die latente Versuchung, in einer schlechten Politisierung die Durchsetzung der eigenen Macht mit der geschichtlichen Durchsetzung Gottes zu verwechseln oder gar zu identifizieren. Würden Juden und Christen sich aber auf ihr eigenes Erbe besinnen, ließe sich dies konterkarieren. Sie könnten je auf ihre Weise zeigen, dass der Gottesglaube sich selbst missversteht, wo er sich im Besitz letzter unbedingter Wahrheit wähnt und aus der so gewonnenen Gottesperspektive Welt und Geschichte definiert. Beide stehen jeweils im Horizont einer Hoffnung auf eine Wahrheit der Liebe, die in einer Praxis der Liebe geschichtlich bezeugt und so wahrgemacht werden will. Nicht der Ausweg in ein Abschliefen der eigenen Wahrheitsansprüche oder im Falle des Christentums das Aufbrechen des Monotheismus in polytheisierende Tendenzen, wie dies der postmoderne Kontext einzuflüstern droht, sondern das Geltendmachen der eigenen Wahrheit als einer Wahrheit der dienenden Liebe wäre hier gefragt. Durch diese tiefe Gemeinsamkeit von Judentum und Christentum erhält dann schließlich jene abrahamitische Ökumene mit dem Islam erst Profil und Gewicht, um dem Gegenwartsdiskurs, der wie Jan Philipp Reemtsma jüngst gezeigt hat, stets in Gefahr ist, in ein Vertrauen in Gewalt abzurutschen, eine gegenläufige Perspektive zu eröffnen. Tg-Monotheismus/Grümme-Trin-Gott, 15.11.09 17