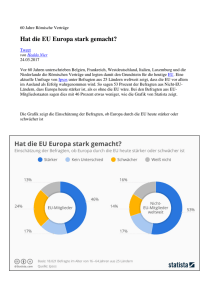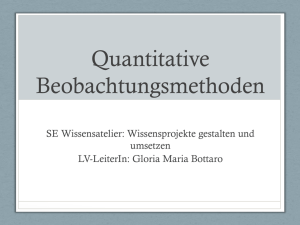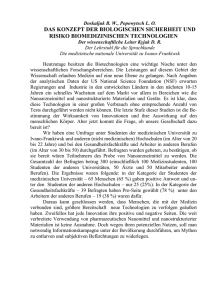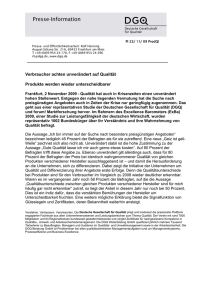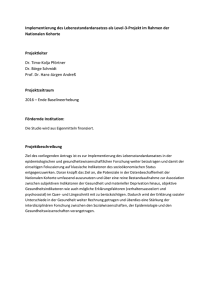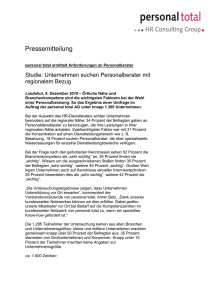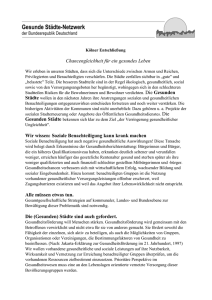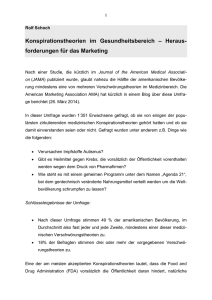Vollständige Studie
Werbung

Jan Böcken, Bernard Braun, Rüdiger Meierjürgen (Hrsg.) Gesundheitsmonitor 2015 Bürgerorientierung im Gesundheitswesen Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung und der BARMER GEK Gesundheit – ein käufliches Produkt? ­Meinungen und Erfahrungen der Bevölkerung Bernard Braun, Gerd Marstedt Ausgangslage Seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten nehmen Mahnungen, sich »gesund« zu verhalten, Anreize zu einer »gesunden Lebensweise« und Versprechungen von erwünschten Wirkungen stetig zu und sind mittlerweile unüberschaubar. In den Medien häufen sich Schlagzeilen über gewonnene oder auch verlorene Lebensjahre, über Lebensqualität als Folge allein des individuellen Risikoverhaltens. Auf Pressemitteilungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder des Krebsforschungszentrums wird dabei ebenso Bezug genommen wie auf wissenschaftliche Forschungsberichte. Unlängst standen Ergebnisse der sogenannten EPIC-Studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) im Fokus: »Ungesunde Lebensweise kostet Männer 17 Jahre«, titelte die »Berliner Zeitung« (Harmsen 2014): »Kurz zusammengefasst sollte man: nicht rauchen, nur in Maßen Alkohol trinken, wenig rotes Fleisch essen und körperlich aktiv sein.« »Die Welt« (Meinert 2014) hatte dieselben Informationen, baute die Meldung aber positiver auf: »Wie Sie bis zu 17 Jahre länger leben«. Die Zeiten, da solche Verhaltenstipps direkt verschränkt waren mit Forderungen zur finanziellen Sanktionierung von »Gesundheitssündern« (etwa Forum Gesundheitspolitik 2008) durch höhere Krankenkassenbeiträge, schienen in den letzten Jahren zwar überwunden; doch nun meldete die »Süddeutsche Zeitung« im November 2014: »Als erster großer Versicherer in Europa setzt die Generali-Gruppe künftig auf die elektronische Kontrolle von Fitness, Ernährung und Lebensstil. Kunden werden Gutscheine und Rabatte bei Prämien gewährt, wenn sie gesund leben. Dazu übermitteln sie der Generali 98 über eine App regelmäßig Daten zum Lebensstil. Das Kalkül dabei: Wer gesund lebt, kostet die Krankenversicherer weniger Geld. Im Gegenzug erhalten willige Verbraucher Vergünstigungen« (Gröger 2014). Eine gesunde Lebensweise im Sinne der traditionellen Risikofaktorentheorie (mit den zentralen Merkmalen Nichtrauchen, wenig Alkohol, gesunde Ernährung, viel körperliche Bewegung) als ganzheitliches Konzept, also unter Berücksichtigung aller Postulate und nicht nur eines einzigen Merkmals, ist für die Bevölkerungsmehrheit derzeit gar nicht oder nur begrenzt umsetzbar – nach der zitierten EPIC-Studie schafften dies in einem etwa zehnjährigen Beobachtungszeitraum nur 21 Prozent der Männer und 39 Prozent der Frauen. Gleichwohl oder vielleicht gerade deshalb haben Firmen der Gesundheitswirtschaft seit einigen Jahren »Gesundheit« als zugkräftiges Label und Werbeversprechen für eine Vielzahl von Produkten entdeckt. Der Ernährungssektor zeigte sich dabei besonders kreativ. Hersteller von Wohlfühljoghurts und Fitnessdrinks, Biomüsliriegeln und Reformmargarinen, Vitaminpillen und Ballaststoffen überboten sich zuletzt gegenseitig mit Gesundheits- und Fitnessverheißungen, in TV-Werbespots wurde die Stärkung von Abwehrkräften versprochen oder der Schutz vor Erkältungen, die Immunsystemstärkung oder auch die Senkung des Cholesterinspiegels. »Die gefährliche Illusion vom Essen, das gesund macht« (Dowideit 2011) bescherte Lebensmittelproduzenten indes kräftige Umsatzzahlen und Gewinne. So betrug der Umsatz von Functional Food in Deutschland in den letzten Jahren nach diversen Schätzungen (Fleige 2014) über fünf Milliarden Euro jährlich. Angesichts dieser vielgestaltigen Entwicklung gewinnt die bereits vor 25 Jahren in der Medizinsoziologie diskutierte (etwa Friedrich et al. 1990) These, Gesundheit sei immer mehr eine Art gesellschaftlicher Zwang oder eine individuelle Verhaltensnorm und Pflicht zur Selbstoptimierung, an empirischer Plausibilität und Evidenz. Ob diese Entwicklung auch weiterhin anhält, bleibt abzuwarten. Denn widersprüchliche Informationen in diesem Kontext erschweren eine zuverlässige Prognose. Einerseits dürfen Lebensmittelhersteller seit dem Jahr 2012 nur noch mit solchen gesundheitsbezogenen Angaben für ihre Produkte werben, die zuvor ein strenges Zulassungsverfahren durchlaufen haben (Health-Claims-Verord99 nung, HCV) – aktuell gibt es etwa 250 solcher explizit erlaubten Angaben. Andererseits haben die Verbraucherzentralen unlängst bundesweit Lebensmittel mit Gesundheitsversprechen auf dem Etikett untersucht. Ergebnis war: »Knapp die Hälfte (43 %) der 46 begutachteten Produkte wirbt mit Health Claims, die aus Sicht der Verbraucherzentralen nicht zugelassen sind« (VZBV 2015). Wie es scheint, nutzen viele Hersteller Schlupflöcher der Verordnung, andere beachten die rechtlichen Vorgaben nicht oder interpretieren sie in ihrem Sinn. In einer früheren Befragung des Gesundheitsmonitors gab knapp die Hälfte der Bevölkerung an, in den letzten zwölf Monaten auf eigene Kosten Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine oder Mineralien gekauft zu haben (Koch und Waltering 2012). Jeder vierte deutsche Internetnutzer verwendete nach einer Umfrage des IPSOS-Instituts (2011) Functional-Food-Produkte sogar einmal wöchentlich oder öfter. Der Konsum von Vitaminpräparaten, Nahrungsergänzungsmitteln und Functional Food ist jedoch nicht der einzige Verhaltensbereich, der zunehmend mit dem Gesundheitsversprechen vermarktet wird. Vor knapp zehn Jahren lieferte die Zeitschrift »Focus« umfangreiche Übersichten über den »Markt der Gesundheit« (Focus 2007), vor drei Jahren präsentierte die Managementzeitschrift »Reviermanager« (2012) eine zehn­teilige Serie mit dem Titel »Gesundheit als Konsumgut«. »Functional Food« und »Functional Clothing«, »Gesundes Wohnen« und »Gesundheitstourismus« waren einige der Kapitel, in denen über die Funktionalisierung des Gesundheitsbegriffs für die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen berichtet wurde. Der folgende Beitrag soll einige Aspekte dieses vergleichsweise neuen Trends etwas erhellen, allerdings aus der Verbraucher- und Konsumentenperspektive. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob sich der Konsum »gesunder« Lebensmittel oder die Nutzung gesundheits- und wellnessorientierter Freizeitangebote als konsistentes Syndrom von Verhaltenstendenzen und Überzeugungen charakterisieren lassen, das man als Gesundheitskonsumismus bezeichnen kann. Es gilt auch zu analysieren, welche Motive dahinterstehen und bei welchen Bevölkerungsgruppen man dieses Merkmal gehäuft findet. Folgende Fragestellungen sind damit verbunden: •• Wie verbreitet sind Verhaltensweisen, die sich als Merkmale von Gesundheitskonsumismus interpretieren lassen, und aus wel100 •• •• chen Motiven heraus entstehen diese? Soll damit eine ungesunde Lebensweise kompensiert werden oder stellt dies ganz im Gegenteil noch eine Steigerung gesundheitsbewussten Alltagsverhaltens dar? Lässt sich bei einzelnen Bevölkerungsgruppen, definiert über sozialstatistische oder gesundheitliche Merkmale, eine überdurchschnittlich stark ausgeprägte gesundheitskonsumistische Orientierung finden? Sind chronisch Erkrankte hier häufiger zu finden oder im Gegenteil kerngesunde Fitnessanhänger? Welche anderen Verhaltensmuster wie Risikoverhalten, Informationsinteressen zu Gesundheitsthemen, Inanspruchnahme medizinischer Versorgung, Vertrauen in Ärzte und Medizin sind damit verknüpft? Und schließlich: Welche subjektiven Konzepte herrschen in dieser Gruppe vor, welche Annahmen gibt es über relevante und eher irrelevante Einflussfaktoren für die Gesundheit? Empirische Basis der im Folgenden dargestellten Befunde sind Erhebungen des Gesundheitsmonitors mit repräsentativen Bevölkerungsstichproben aus den Jahren 2011 und 2014. Teilgenommen haben ­jeweils etwa 1.750 Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren. Mögliche Indikatoren gesundheitskonsumistischer Orientierung Eine gesundheitskonsumistische Orientierung liegt nach unserer Auffassung nicht bereits dann vor, wenn jemand zur Vorbeugung oder bei leichteren Erkrankungen zu Mitteln greift, deren Wirksamkeit in wissenschaftlichen Studien bislang nicht belegt oder sogar widerlegt ist, wie Vitamin C bei Erkältung, »Umckaloabo« bei Atemwegsinfektionen oder Ginkgo zur Demenzprävention. Auch ist die konsequente Anwendung einer gesunden Lebensweise (nicht rauchen, nur mäßig Alkohol, viel Sport und Bewegung, gesunde Ernährung) nicht in eins zu setzen mit unserem Konstrukt des Gesundheitskonsumismus. Dabei handelt es sich auch nicht um die mit dem englischen Begriff des »consumerism« positiv assoziierte Unterstützung des Konsumenten bei Kaufentscheidungen durch Informationen oder Regulative. 101 Vielmehr sollten hier zwei Voraussetzungen erfüllt sein: •• Grundlegend ist zunächst der häufigere, nicht nur einmalige oder auf Ausnahmesituationen beschränkte sowie breit gefächerte (Motto »viel hilft viel«) Konsum von Produkten, die der Zielsetzung »Verbesserung oder Erhalt der Gesundheit« dienen, •• und dass dies über (käufliche) Produkte erfolgt, die anders als die meisten der verordnungspflichtigen Produkte explizit und plakativ mit dem Label Gesundheit vermarktet und beworben werden, selbst wenn gesundheitliche Effekte unter anderem aus Rücksicht auf gesetzliche Vorschriften wie der HCV nur indirekt behauptet werden (etwa durch Prädikate wie »bekömmlich«, »Steigerung des Wohlbefindens«, »zurück ins Leben«) oder die Behauptung eines solchen Effekts sich in wissenschaftlichen Studien als unhaltbar oder fragwürdig herausgestellt hat. Die Frage, ob diese Voraussetzungen hinreichend für die Charakterisierung von Gesundheitskonsumismus und vor allem auch valide ­erfassbar sind, stellt sich weniger bei der ersten als bei der zweiten Voraussetzung. Da nur eine Minderheit der Bevölkerung wissenschaftliche Studien kennen beziehungsweise verstehen dürfte und professionell erstellte Werbeversprechen dekodieren kann, gehört fehlendes oder lückenhaftes gesundheitsbezogenes Wissen zu den wesentlichen Bedingungen gesundheitskonsumistischen Verhaltens. Gesundheitskonsumismus ist nach Annahme der Autoren auch kein Verhaltensmodus (etwa wie beim Hochleistungssportler), der in der Bevölkerung bei bestimmten Gruppen sehr intensiv ausgebildet ist und bei vielen anderen Gruppen gar nicht. Zwar gibt es nach persönlicher Erfahrung durchaus auch idealtypische und konsequente Gesundheitskonsumisten; relevanter erscheint hier jedoch, dass Tendenzen zu diesem Verhaltensmuster sich mehr oder weniger stark ausgeprägt bei einem Großteil der Bevölkerung zeigen. Auch fällt eine eindeutige und klare Charakterisierung bisweilen schwer, etwa wenn jemand sich gesund ernährt – nach Maßgabe der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit wenig rotem Fleisch, viel Obst und Gemüse, wenig Zucker und Salz –, zusätzlich aber noch regelmäßig Probiotika, Vitaminpillen oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Geht man zunächst einmal von den genannten Prämissen aus, dann wird aus der Befragung deutlich (Abbildung 1), dass einzelne konsumismusverdächtige Verhaltensweisen recht unterschiedlich verbreitet sind. 102 Abbildung 1: Verbreitung ausgewählter, mit Gesundheitsmotiven zusammenhängender Verhaltensweisen Kauf spezieller Nahrungsmittel (z.B. Probiotika) 88 Nutzung gesundheitsoder wellnessorientierter Freizeitangebote 69 Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen, Mineralien 13 52 Kauf spezieller rezeptfreier Arzneimittel gelegentlich 8 52 20 40 60 7 29 40 39 0 6 30 58 Kauf von Sportartikeln, -ausrüstung für den eigenen Gebrauch 1 25 63 Besuch von Fitnesscentern, Aktivität im Sportverein nie 11 9 80 100 regelmäßig n = 1.700 bis 1.710 Angaben in Prozent der Befragten Am seltensten zu finden ist nach unseren Daten der Kauf spezieller Nahrungsmittel wie Probiotika oder anderer Nahrungsmittel (Functional Food), die mit Zusätzen wie Mikroorganismen, Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen angereichert sind. Insgesamt nur etwa zwölf Prozent der Bevölkerung kaufen diese Produkte gelegentlich oder regelmäßig. Bei Nahrungsergänzungsmitteln als alleinigem Produkt (und nicht als Beimengung zu Lebensmitteln) liegt der Prozentanteil bereits deutlich höher. Mehr als jeder 103 dritte Befragte (37 %) kauft diese Artikel zumindest gelegentlich. Knapp ein Drittel gibt an, sich zumindest gelegentlich Freizeitangebote zu gönnen, die wellness- oder gesundheitsorientiert sind. Der höchste Prozentwert in diesem Kontext zeigt sich für den Kauf spezieller rezeptfreier Arzneimittel, der für fast die Hälfte beziehungsweise fast zwei Drittel in der Bevölkerung zutrifft (rund 62 % gelegentlicher oder regelmäßiger Erwerb). Allerdings bleiben Motive und Anlässe dafür unklar: Der Kauf könnte aus einem durchaus sinnvollen Motiv der Selbstmedikation erfolgen, um den Weg in die Arztpraxis und die Verschreibung eines rezeptpflichtigen Medikaments zu vermeiden. Abbildung 2: Motive für gesundheitsbezogene und selbst bezahlte Verhaltensmuster gesundheitliche Beschwerden lindern 67 gesund bleiben, Krankheiten verhüten 62 körperlich fit bleiben 49 mein Wohlbefinden steigern 39 geistig fit bleiben 24 meine Leistungsfähigkeit steigern 23 besser schlafen oder abschalten können 15 möglichst lange leben 15 Spaß haben, guter Stimmung sein 15 gesundheitliche »Sünden« ausgleichen 10 mit netten Menschen zusammen sein 8 besser aussehen 7 0 10 20 n = 1.563 Anteile der Antwortkategorie »trifft zu« in Prozent; Mehrfachangaben möglich (maximal drei Antworten) 104 30 40 50 60 70 80 Daher werden auch die in der Befragung genannten Motive für diese Verhaltensmuster betrachtet. Auf die Frage: »Was möchten Sie erreichen, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen für Ihre Gesundheit in Anspruch nehmen und aus eigener Tasche bezahlen? Bitte nennen Sie uns nur die drei wichtigsten Gründe« zeigt sich eine klare qualitative Hierarchie der Motive: Am häufigsten genannt (von 67 bzw. 62 %) werden zwei Ziele, bei denen es entweder um eine Linderung vorhandener Gesundheitsbeschwerden oder eine Verhütung von Erkrankungen geht. Zwischen 15 und 49 Prozent der Nennungen betreffen den Erhalt oder die Verbesserung der eigenen unspezifischen psychophysischen Voraussetzungen: körperliche und geistige Fitness, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Schlaf. Den sehr langfristigen Effekt dieser Voraussetzungen, nämlich eine möglichst hohe Lebenserwartung, nennen nur etwa 15 Prozent. Am unteren Ende der Häufigkeitsskala (7 bis 15 %) rangieren eher soziale als gesundheit­ liche Aspekte wie ein besseres Aussehen, Geselligkeit oder Spaß. Eine Betrachtung möglicher Indikatoren für eine gesundheitskonsumistische Orientierung muss natürlich auch den persönlichen Umgang mit Lebensmitteln einschließen. Wie wird die zu Anfang des Beitrags beschriebene Funktionalisierung von Lebensmitteln unter dem Gesundheitsetikett von Verbrauchern erlebt? Dazu wurde danach gefragt, ob man Werbebotschaften für Lebensmittel (wie­ »… stärkt das Immunsystem« oder »… senkt den Cholesterinspiegel«) erstens gezielt sucht und beachtet, zweitens bevorzugt kauft und drittens für zutreffend hält. Tabelle 1: Verhaltensweisen in Bezug auf Lebensmittel, die den Aspekt der Gesundheitsförderlichkeit betonen selten oder nie manchmal immer oder fast immer gezieltes Suchen oder Beachten gesundheitsförderlicher Lebensmittel 66 30 4 bevorzugter Kauf solcher Produkte 69 27 4 Einschätzung der Hersteller­ informationen als zutreffend 64 34 3 Angaben in Prozent der Befragten, n = 1.711 bis 1.713 Etwa zwei Drittel der Befragten zeigen eher skeptische Einstellungen. Umgekehrt zeigt sich ein dauerhaftes und konsistentes Verhal105 tensmuster, das auf gesundheitsförderliche Lebensmittel fixiert ist, bei weniger als fünf Prozent der Bevölkerung (Tabelle 1). Unklar bleibt, wie jene Gruppe von knapp einem Drittel der Bevölkerung einzuschätzen ist, die hier mit »manchmal« antwortet. Gilt diese Bewertung nur für bestimmte Lebenssituationen, etwa bei Gesundheitsbeschwerden oder »wenn man sich etwas Gutes tun möchte«, oder nur für bestimmte Produkte? Und: Liegen hier Steigerungspotenziale verborgen, die man in der Lebensmittelindustrie und den zugehörigen Werbeagenturen zukünftig zu erschließen versucht? In jedem Fall festzuhalten ist, dass die nicht selten irreführenden oder falschen Versprechungen der Lebensmittelindustrie bei jedem dritten Verbraucher zumindest gelegentlich verfangen. Und wahrscheinlich ist dieser Anteil noch höher, wenn man nicht nur das Suchen und Finden expliziter Hinweise auf gesundheitliche Wirkungen berücksichtigen würde, sondern auch die verhaltenswirksame Rezeption mittelbarer Hinweise auf Gesundheitsförderlichkeit. So hat eine aktuelle experimentelle Studie (Zühlsdorf und Spiller 2014) unter anderem an der Wirkung des Bildes einer joggenden Frau nachgewiesen, dass auch »weitere Aufmachungselemente (etwa Produktname, Bildelemente, unspezifische Angaben) dazu beitragen, dass ein Produkt als gesundheitsfördernd wahrgenommen wird« (ebd.: 20). Hinzu kommt, dass ein missverständlicher optischer Eindruck von »gesund« »nicht durch zutreffende Angaben auf der Rückseite ›geradegerückt werden‹« kann (ebd.: 29). Die gerade angesprochenen Steigerungspotenziale sind also längst Wirklichkeit geworden, wozu die Göttinger Studie noch zahlreiche weitere Beispiele liefert. Gesundheitskonsumismus – was verbirgt sich dahinter? Eine standardisierte Befragung kann nur erste und keineswegs vollständige Tendenzen zu einer Einstellung und Verhaltensorientierung erfassen, wie sie mit dem Konzept des Gesundheitskonsumismus beschrieben sind. Mit einigen bereits dargestellten Fragen wurde dazu eine Skala konstruiert, wobei nur Aspekte des Verhaltens berücksichtigt wurden, keine Einstellungen oder Meinungen. Berücksichtigt wurden erstens der Kauf spezieller Nahrungsmittel, zweitens von Nahrungsergänzungsmitteln, drittens die Nutzung gesundheitsoder wellnessorientierter Freizeitangebote sowie viertens der Kauf 106 spezieller rezeptfreier Arzneimittel. Letzteres wurde nur dann einbezogen, wenn nicht die Linderung gesundheitlicher Beschwerden und Selbstmedikation bei Erkrankung der Anlass waren, sondern andere Gründe. Für die Antwort »gelegentlich« wurde ein Punkt vergeben, für »regelmäßig« drei Punkte. Die Addition der Punkte ergab dann den Gesamtwert für die Skala »gesundheitlicher Konsumismus«. Im Ergebnis zeigt sich: Ein Anteil von rund 40 Prozent der Befragten gibt bei allen vier Indikatoren an, dass dies »niemals« auf sie zutrifft. Etwas weniger als 30 Prozent erreichen den Gesamtwert von einem Punkt und etwa ein Drittel der Befragten kommt auf zwei oder mehr Punkte. Diese letzte Gruppe wird bei den folgenden Analysen genauer betrachtet. Zeigen sich die hier vorliegenden gesundheitskonsumistischen Tendenzen bei bestimmten Bevölkerungs­gruppen (definiert über sozialstatistische Merkmale oder Morbiditätsaspekte) häufiger? Als Ergebnis einer bivariaten Analyse lässt sich zusammenfassen, dass •• gesundheitskonsumistische Verhaltenstendenzen deutlich häufiger zu finden sind bei Befragten mit höherer Schulbildung, höherem Einkommen und höherem sozioökonomischen Status – Indikatoren, die sehr hoch miteinander korrelieren. Um ein Beispiel zu nennen: Einen hohen Konsumismusskalenwert erreichen 41 Prozent der Oberschicht-, aber nur 25 Prozent der Unterschichtangehörigen. Bei Schulbildung und Einkommen ist die Differenz ähnlich groß. •• Ein zweites hervorstechendes Merkmal ist die Intensität der Arztbesuche. Befragte mit einer hohen Anzahl an Facharztbesuchen weisen auch hohe Werte auf der Gesundheitskonsumismusskala auf: 38 Prozent derjenigen mit fünf oder mehr Besuchen in den letzten zwölf Monaten weisen hohe Tendenzen zum Gesundheitskonsumismus auf; bei denjenigen mit keinem Facharztbesuch sind es nur 25 Prozent. Ähnliche, wenngleich nicht ganz so große Differenzen zeigen sich für die Variable »Zahl der Hausarztbesuche«. •• Diese unterschiedlich starke Inanspruchnahme von Ärzten ist deshalb bemerkenswert, weil Indikatoren zur Morbidität dies nicht erklären können. Einen hohen Wert auf der Konsumismusskala erreichen bei ausgezeichnetem oder sehr gutem Gesundheitszustand 31 Prozent, bei weniger gutem oder schlechtem 29 Prozent, bei chronisch Erkrankten 29 Prozent, bei nicht chro107 nisch Erkrankten 32 Prozent, bei Behinderten 32 Prozent, bei Nichtbehinderten 31 Prozent. Hier deutet sich an, dass Gesundheitskonsumismus nicht aus einem höheren Grad gesundheitlicher Beeinträchtigungen resultiert beziehungsweise damit zusammenhängt, sondern einhergeht mit einer größeren Besorgtheit um die eigene Gesundheit und niedrigerer Symptomtoleranz. Unter Umständen liegt hier auch eine höhere »Klagsamkeit« oder Besorgtheit vor, eine ängstlich-überbesorgte Einstellung gegenüber Krankheitsrisiken. Dies führt dann dazu, dass sowohl der Gang in die ärztliche Sprechstunde als auch der Griff zur Vitaminpille eher oder häufiger erfolgt als bei anderen. Um eine fundiertere Einschätzung zu bekommen, mit welchen soziodemographischen Merkmalen und Morbiditätsaspekten gesundheitskonsumistische Verhaltensorientierungen einhergehen, wurde mit wesentlichen Indikatoren zusätzlich eine multivariate Analyse (logistische Regression) durchgeführt. Zwar ist es auch auf diese Weise nicht möglich, Kausalzusammenhänge nachzuweisen, doch diese statistische Methode erlaubt es, simultan den Einfluss mehrerer Variablen zu überprüfen und dabei auch verdeckte oder sich überlappende Zusammenhänge zu erkennen. Einbezogen in diese Analyse wurden die unabhängigen Variablen Lebensalter, Geschlecht, soziale Schicht (als zusammenfassender ­Indikator aus Schulbildung, Einkommen und Stellung im Beruf), ­Erwerbsstatus, Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes, chronische Erkrankung, Vorliegen einer Behinderung, Zahl der Facharztbesuche und der Hausarztbesuche in den letzten zwölf Monaten. •• Als Ergebnis zeigt sich zunächst wie schon bei den bivariaten Analysen, dass sämtliche Indikatoren zum Gesundheitszustand (Selbsteinschätzung, chronische Erkrankung, Behinderung) keinen signifikanten Einfluss auf das Vorliegen gesundheitskon­ sumistischer Tendenzen haben. •• Einflussreich ist hingegen auch hier ein Merkmal medizinischer Versorgung, nämlich die Zahl der Facharztbesuche in den letzten zwölf Monaten. Das Odds-Ratio hierfür beträgt in der Gruppe mit vielen Kontakten 1,88, p ≤ 0,001 (Vergleichsgruppe: 0 Facharztkontakte). •• Weiterhin von Bedeutung sind das Lebensalter (Odds-Ratio für Jüngere bis 39 Jahre: 1,51, p ≤ 0,01; Vergleichsgruppe: Ältere ab 108 60 Jahren) und die Schichtzugehörigkeit (Odds-Ratio für Oberschichtangehörige: 2,06, p ≤ 0,001; Vergleichsgruppe: Unterschichtangehörige). Für Angehörige der oberen Mittelschicht zeigen sich ähnliche Befunde nur geringfügig niedrigerer Odds-Ratios. Zusammenfassend heißt dies, dass gesundheitskonsumistische Tendenzen sich typischerweise bei jüngeren Angehörigen der Oberschicht und der oberen Mittelschicht finden und dass in dieser Gruppe auch häufige Kontakte zu Fachärzten charakteristisch sind, obwohl akute oder chronische Gesundheitsbeschwerden nicht häufiger vorliegen als bei anderen. Eine bivariate Analyse liefert folgende quantitativen Unterschiede: In der Gruppe älterer Unterschichtangehöriger weisen 25 Prozent hohe Werte auf der Gesundheitskonsumismusskala auf, bei jüngeren Oberschichtangehörigen sind dies 56 Prozent, also mehr als doppelt so viele. Kompensation für gesundheitsriskantes Alltagsverhalten? Wie sieht es nun mit dem gesundheitlichen Risikoverhalten aus: Ist Gesundheitskonsumismus eine Orientierung, um eigene Verhaltensrisiken zu kompensieren? Oder zeigt sich genau umgekehrt, dass gesundheitlicher Konsumismus eine Steigerung oder zumindest Ergänzung eines gesundheitsbewussten Alltagsverhaltens ist? Tabelle 2 weist für einige zentrale Indikatoren des Gesundheitsverhaltens Unterschiede aus, die sich bei Befragten mit eher hohen und eher niedrigen Werten für Gesundheitskonsumismus zeigen. Wie man sieht, fallen die Differenzen teils sehr deutlich, teils eher moderat aus und bei einigen Aspekten zeigen sich keinerlei signifikante Differenzen. Deutliche Zusammenhänge zeigen sich zum einen, was Informationsinteressen und Wissensaspekte betrifft: bei der Teilnahme an Gesundheitskursen und den Informationsinteressen hinsichtlich Gesundheitsthemen. Zum anderen sind präventive Aktivitäten oder Maßnahmen hervorzuheben, die in gewisser Weise eine Komplettierung von Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika und weiteren ähnlichen Mitteln darstellen: die Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, die Nutzung homöopathischer Mittel zur Abwehrstärkung 109 Tabelle 2: Zusammenhänge zwischen Gesundheitskonsumismus und diversen Indikatoren des Gesundheitsverhaltens Anteil Befragter mit hohem Wert auf der Gesundheitskonsumismus-Skala Teilnahme an Gesundheitskursen Selbsteinschätzung: Achten auf Gesundheit Informationsinteressen zu Gesundheitsthemen Rauchen Signifikanz ja: 48 % nein: 27 % *** eher stark: 40 % eher wenig: 24 % *** hoch: 38 % niedrig: 21 % *** Nichtraucher: 33 % Raucher: 24 % ** Sport und Bewegung eher viel: 35 % eher wenig: 27 % *** gesunde Ernährung eher gesund: 33 % eher ungesund: 28 % n. s. Alkoholkonsum eher selten: 32 % eher häufig: 30 % n. s. Schlaf und Erholung Bewertung des eigenen Gesundheitsverhaltens eher ausreichend: 31 % eher zu wenig: 34 % n. s. eher positiv: 33 % eher negativ: 30 % n. s. Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen ja: 35 % nein: 25 % *** Nutzung homöopathischer Mittel zur Abwehrstärkung ja: 49 % nein: 27 % *** Nutzung von Massagen, KneippAnwendungen ja: 40 % nein: 27 % *** n = 1.710; Signifikanzniveau: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001, n. s. = nicht signifikant Lesebeispiel: In der Gruppe, die schon an Gesundheitskursen teilgenommen hat, haben 48 Prozent auch einen hohen Wert auf der Gesundheitskonsumismus-Skala. In der Gruppe ohne solche Erfahrungen liegt dieser Anteil deutlich niedriger, nämlich bei 27 Prozent. sowie die Nutzung von Massagen und Kneipp-Anwendungen. Von den Personen, die an Präventionsmaßnahmen im Bereich von Ernährung, Alkoholkonsum, Schlaf und Erholung, Rauchen, Sport und Bewegung teilgenommen haben, ist der Anteil mit einem hohen Wert auf der Gesundheitskonsumismus-Skala durchweg kleiner (bei Sport und Bewegung mit 35 % bei viel und 27 % bei wenig Sport) als beispielsweise dann, wenn es um die Teilnahme an Gesundheitskursen geht (48 und 27 %), oder die Zusammenhänge sind nicht signifikant. Während sich für die Selbsteinschätzung, ob man auf die eigene Gesundheit achtet, deutliche Zusammenhänge finden, unterscheidet sich der Anteil von Personen mit hohem Gesundheitskonsumismus110 wert bei denjenigen, die ihren eigenen Gesundheitszustand – also im weitesten Sinn den Outcome des Achtens auf Gesundheit – eher positiv oder negativ bewerten, auf relativ niedrigem Niveau kaum beziehungsweise haben diese Art von Selbstbewertung und Konsumismus nichts miteinander zu tun. Wie sind diese Befunde zu interpretieren? Gesundheitskonsumistische Verhaltensorientierungen sind offensichtlich nicht vom selbst wahrgenommenen konkreten Risikoverhalten bestimmt, sondern unabhängig davon: Man findet sie bei Rauchern ebenso wie bei Nichtrauchern, bei sportlichen wie bewegungsfaulen Personen. Und auch das Schlaf- und Erholungsverhalten, der Ernährungsstil und Alkoholkonsum stellen keine signifikanten Triebkräfte für ein hohes oder niedriges Niveau des Gesundheitskonsumismus dar. Viel Gesundheitskonsumismus dient also nicht primär der Kompensation von riskanten Verhaltensgewohnheiten, sondern taucht auch genauso häufig bei Personen auf, die sich ungesund ernähren oder wenig bewegen. Und ebenso gilt umgekehrt: Gesundheitskonsumismus ist keine Komplettierung oder Ergänzung einer besonders gesundheitsbewussten Lebensweise. Die sehr engen Zusammenhänge mit gesundheitsbezogenen Lern- und Wissensaspekten einerseits und die Nähe zu präventiven Verhaltensweisen andererseits ­deuten vielmehr an, dass hier ein vorrangig nicht verhaltens- und erfahrungsbasiertes, sondern vorrangig kognitiv vermitteltes Präventionsmotiv im Vordergrund steht und das Wissen über Gesundheit und Gesundheitsrisiken von Bedeutung ist. Dies korrespondiert auch mit der bereits genannten Tatsache, dass vor allem jüngere und eher gesunde Angehörige der Mittel- und Oberschicht ausgeprägt gesundheitskonsumistisch orientiert sind. Annahmen über relevante Einflussfaktoren für die Gesundheit Die schon beschriebenen sehr geringen, teilweise fehlenden Zusammenhänge zwischen gesundheitskonsumistischer Orientierung und gesundheitlichem Risikoverhalten (Tabelle 2) lassen noch offen, welche Verhaltensweisen denn nun stattdessen als gesundheitsförderlich bewertet werden. Hierzu wurden bereits in der Befragung des Gesundheitsmonitors von 2011 insgesamt 14 Verhaltensmerkmale vorgegeben. Zu jeder Vorgabe sollte auf einer fünfstufigen Skala (von 111 »überhaupt nicht wichtig« bis »sehr wichtig«) eingestuft werden, für wie wichtig man diese für die Gesundheit hält. Das zentrale Befragungsergebnis wurde seinerzeit von Koch und Waltering (2012) so zusammengefasst: »Alle Faktoren wurden von der Mehrheit der Befragten als ›eher wichtig‹ oder ›sehr wichtig‹ beurteilt, der Anteil lag je nach Aspekt zwischen 51 und 92 Prozent.« In einer Sekundärauswertung dieser Daten wurde jetzt geprüft, ob diese Bewertungen auch variieren, je nachdem wie stark die gesundheitskonsumistischen Tendenzen einer Person sind und wie stark diese Orientierung mit der Bewertung der Gesundheitsrelevanz einzelner Verhaltensweisen korreliert. Dabei wird beispielsweise der Einflussfaktor »gute Informationen zu Nutzen und Risiken von Untersuchungen und Therapien« von 66 Prozent der Befragten mit hohen Werten auf der Konsumismusskala als »eher wichtig« oder »sehr wichtig« bewertet. Bei niedrigen Konsumismuswerten kommt diese Einschätzung nur von 53 Prozent der Befragten. »Regelmäßige Arztbesuche« erscheinen für 61 Prozent der Gesundheitskonsumisten »eher wichtig« oder »sehr wichtig«, bei den übrigen Befragten sind dies lediglich 48 Prozent. Diese Daten zeigen recht deutlich, worin sich Personen mit stark gesundheitskonsumistischer Tendenz von anderen unterscheiden, zumindest in Bezug auf ihre Laienvorstellungen hinsichtlich der positiven oder negativen Einflüsse auf die Gesundheit. Deutlich werden eine sehr starke Wertschätzung medizinischen Wissens und eine eigene Kompetenz in medizinischen und gesundheitlichen Fragen. Im Mittelfeld rangieren die gängigen Risikofaktoren im Bereich des individuellen Gesundheitsverhaltens: Ernährung, Schlaf, Bewegung, Rauchen. Und ganz unten liegen die eher sozialen und beruflichen Einflussfaktoren für das gesundheitliche Wohlergehen. Zusammenfassung und gesundheitspolitische Diskussion Wenn man den nicht nur gelegentlichen oder seltenen Konsum einer Vielzahl spezieller Lebensmittel (Functional Food) oder Nahrungsergänzungsmittel, die Nutzung gesundheits- oder wellnessorientierter Freizeitangebote und den Kauf spezieller rezeptfreier Arzneimittel (ohne akute Erkrankungen oder Beschwerden) als Indikatoren gesundheitskonsumistischer Orientierung definiert, dann lässt sich 112 etwa ein Drittel unserer Befragten in diese Gruppe einordnen. Diese Verhaltensorientierung, so zeigen die Analysen, ist weitgehend unabhängig vom alltäglichen Gesundheitsverhalten, sie findet sich bei Rauchern ebenso wie bei Nichtrauchern, bei sportlichen wie bewegungsfaulen Personen. Auch Schlaf- und Erholungsverhalten, Ernährungsstil und Alkoholkonsum sind hier ohne Einfluss. Gesundheitskonsumismus dient also nicht primär der Kompensation riskanter Gewohnheiten. Aber auch umgekehrt ist damit keine Ergänzung oder Vervollkommnung einer besonders gesundheitsbewussten Lebensweise beschrieben. Jüngere Angehörige der Oberschicht und der oberen Mittelschicht finden sich in dieser Gruppe besonders oft. Zugleich sind häufige Kontakte zu Fachärzten charakteristisch, obwohl nicht mehr akute oder chronische Gesundheitsbeschwerden vorliegen als bei anderen. Auch findet man eine sehr starke Wertschätzung der Medizin und die eigene Laienkompetenz bei Fragen zu Prävention wie Kuration wird betont. Subjektiv relevant erscheinen Informationen zu Nutzen und Risiken von Untersuchungen und Therapiemethoden, regelmäßige Arztbesuche und die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Diese sehr engen Zusammenhänge mit gesundheitsbezogenen Lern- und Wissensaspekten und die Nähe zu präventiven Verhaltensmerkmalen deuten an, dass hier ein kognitiv vermitteltes und statusbetontes Präventionsmotiv eine Rolle spielt. Gesundheitskonsumismus ist insofern aber auch (wenngleich nicht allein) ein Verhaltensmerkmal, das der sozialen Unterscheidung und Habitusdemonstration im Sinne der von Bourdieu (1982) beschriebenen »feinen Unterschiede« dient. Angehörige dieser Gruppe wollen sich selbst und ihrer sozialen Umgebung zeigen, dass sie über den Erhalt von Gesundheit sehr viel umfassender und fundierter Bescheid wissen als ihre Nachbarn, Freunde oder Kollegen. Gesundheitspolitisch problematisch sind solche Orientierungen insofern, als für eine Vielzahl der erworbenen Produkte oder Dienstleistungen jegliche Evidenz für ihren gesundheitlichen Nutzen fehlt und in manchen Fällen sogar ganz im Gegenteil schädliche, bisweilen sogar tödliche Effekte beobachtet worden sind (Bjelakovic et al. 2012). Die Vitamin-D-Einnahme zur Risikosenkung der kardiovaskulären Morbidität, Magnesium zum Schutz vor Muskelkrämpfen älte113 rer Personen und Schwangerer, antioxidative Nahrungsergänzungsmittel als Schutz vor Krebs, Vitamin C zur generellen Prävention von Erkältungen – dies sind nur einige wenige Beispiele (als Überblick: Forum Gesundheitspolitik o. J.) für falsche Versprechungen mit gesundheitskonsumistischer Prägung. Zwar wurde mit der sogenannten Health-Claims-Verordnung der Europäischen Union der Versuch unternommen, Verbraucher vor irreführenden, wissenschaftlich nicht belegten Werbebotschaften zu schützen, die gesundheitsfördernde oder krankheitsverhindernde Eigenschaften von Lebensmitteln betonen. Wie eingangs des Beitrags angedeutet, wird diese Verordnung jedoch nach einer Studie der Verbraucherzentralen von vielen Herstellern missachtet. Immer wieder kommt es daher über unterschiedliche Gerichtsinstanzen und jahrelange Zeiträume hinweg zu Prozessen, in denen weiterhin mit falschen oder irreführenden gesundheitsbezogenen Versprechungen geworben wird und Konsumenten diesen qua Kaufentscheidung Glauben schenken. Eine frühere Befragung des Gesundheitsmonitors hat deutlich gemacht, dass Bemühungen um eine gesunde Lebensweise bislang nur begrenzt erfolgreich sind, selbst wenn man jeweils nur einen einzelnen Aspekt betrachtet. Von Befragten mit den Verhaltensrisiken Rauchen, Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung schaffte es nur jeder Dritte oder Vierte, diese Laster dauerhaft aufzugeben (Marstedt und Rosenbrock 2009). »Es besteht also wohl eine Kluft zwischen Risikowarnungen und Ratschlägen zu Änderungen des Gesundheitsverhaltens einerseits und praktikablen Konzepten und Informationen, wie dies zu bewerkstelligen ist, andererseits«, fassen die Autoren ihre Befunde daher zusammen. Unter diesen Voraussetzungen erscheinen Botschaften wie »… stärkt das Immunsystem« oder »… senkt den Cholesterinspiegel« vielen Bürgern natürlich als segensreiche Argumente – nun kann man die nicht nur in der Grillsaison wenig begeisternde Forderung nach »5 am Tag« (fünf Portionen Obst oder Gemüse täglich, neuerdings werden »7 am Tag« als besser erachtet) mit dem Hintergedanken beiseiteschieben, man tue ja im Rahmen der Lebensmitteleinkäufe schon genug für eine gesunde Ernährung. Mit anderen Worten und sehr vergröbert: Werbebotschaften, die gesundheitskonsumistische Tendenzen fördern oder verfestigen, konterkarieren nachhaltig die Bemühungen verschiedenster Einrichtungen (von 114 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über Selbsthilfeeinrichtungen und gemeinnützige Stiftungen bis hin zu Krankenkassen) zur Prävention und zum Abbau individueller Verhaltensrisiken. Als erste Konsequenz hieraus ist natürlich ein noch entschiedener zu handhabendes Verbot unbelegter Gesundheitsaussagen durch die nach der Health-Claims-Verordnung zuständigen exekutiven und judikativen Akteure zu nennen und im selben Atemzug eine peniblere Kontrolle dieser Vorgaben. Wenn – wie bereits eingangs dargestellt – fast die Hälfte der vom VZBV kontrollierten Produkte beanstandet wird, macht dies deutlich, wie wenig konsequent auf eine Einhaltung der EU-Verordnung geachtet wird. Darüber hinausgehend erscheinen jedoch die Maßnahmen und gesetzlichen Vorgaben zur Information mündiger Bürger über sinnvolle und sinnlose, wenn nicht sogar riskante gesundheitliche Konsum­ ausgaben verbesserungswürdig. Schon die »Nationale Verzehrstudie« hatte massive Wissenslücken der Bevölkerung zum Thema »Ernährung und Gesundheit« gezeigt. Und obwohl wissenschaftliche Studien mehrfach belegt haben, dass bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln eine Kombination von Ampelfarben und Text für Verbraucher am verständlichsten ist, um gesunde von weniger gesunden Produkten (etwa zu salzhaltig, zu hoher Zuckergehalt) zu unterscheiden, wurde die Ampelkennzeichnung vom EU-Parlament abgelehnt. »Doch nun hat sich die Lebensmittelindustrie durchgesetzt«, kommentierte »Spiegel online« (2010). »Die Lobbyvertreter der Branche sind seit gut zwei Jahren aktiv, um die EU-Parlamentarier von ihren eigenen Vorschlägen zu überzeugen. Dabei machten die Konzerne immer wieder klar, dass sie eine Lebensmittel-Ampel ablehnen – nun hatten sie Erfolg.« Erst kürzlich hat jedoch eine Untersuchung deutlich gemacht, in wie starkem Maße Verbraucher gesundheitsbezogene Aussagen (z. B. »ohne Zuckerzusatz«, »ungesüßt«) auf Lebensmittelverpackungen falsch interpretieren (»kalorienarm«, »geeignet für eine bewusste ausgewogene Ernährung«) und wie wenig sie die meist klein gedruckten, umfangreichen Informationen auf der Rückseite von Produkten für ihre Kaufentscheidung berücksichtigen (VZBV 2015; Zühlsdorf und Spiller 2014). Zu bedenken ist in diesem Kontext aber auch, dass falsche gesundheitliche Versprechungen nicht nur im Lebensmittelsupermarkt 115 lauern, sondern überall dort, wo Verbraucher, Versicherte und Konsumenten mit den Themen »Gesundheit« und »Krankheit« in Kontakt kommen. Es wäre auch für Ärzteverbände durchaus ehrbar, das Verzeichnis Individueller Gesundheitsleistungen (IGeL) systematischer nach medizinischen Leistungen und Produkten zu durchforsten, die überwiegend gesundheitskonsumistische Orientierungen bedienen, aber keinen oder nur in Ausnahmefällen einen nachweisbaren medizinischen Effekt zeigen. Zwar findet der mündige Patient im Internet den »IGeL-Monitor«. Aber noch traut sich nur eine Minderheit von etwa 30 Prozent der Patienten, in der ärztlichen Sprechstunde eine vom Arzt direkt und persönlich empfohlene Leistung abzulehnen (WIdO 2013). Für den Erwerb von Gesundheitskompetenz folgt daraus, dass große Teile der Bevölkerung ein gründlicheres und situationsadäquates Orientierungswissen für die Notwendigkeit, die Inanspruchnahme und den Nutzen gesundheitlicher beziehungsweise gesundheitsbezogener Leistungen benötigen. Dazu gehört, das anbieter- oder angebotsinduzierte Paradigma beziehungsweise die Erwartungshaltung des »viel hilft viel« grundlegend zu erschüttern oder zu destruieren – und hinzuwechseln zu einem durch Konzepte wie »less is more« (siehe auch die in der Fachzeitschrift »JAMA Internal Medicine« erschienenen 173 Beiträge, Stand 24.3.2015), »choosing wisely« (ABIM) oder »watchful waiting« charakterisierten alternativen Paradigma. Begleitet werden muss ein solcher Paradigmenwechsel mit sehr viel mehr Informationsangeboten als derzeit verfügbar und mit Informationen, die für sehr unterschiedlich gebildete und auch in Gesundheitsfragen unterschiedlich vorgebildete Bürger verständlich sind. Diskussionsbedürftig bleibt hier, ob man den als Tweet auf ihrem Twitter-Account oder ausführlicher in einem Beitrag für »Zeit Online« im Januar 2015 verbreiteten Hilferuf der Kölner Gymnasiastin Naina (»Ich bin fast 18 und hab’ keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen.«) um das Thema »Gesundheit« ergänzen und der Schule noch ein Unterrichtspäckchen aufbürden sollte. Dass es an fundierten Informationen zu diesem Thema mangelt, sodass Werbeversprechungen gefolgt wird, welche die Wirksamkeit gesundheitlicher ­Prävention konterkarieren, haben unsere Befragungsergebnisse jedenfalls deutlich gezeigt. 116 Literatur ABIM – American Board of Internal Medicine. o. J. www.choosing wisely.org/. Bjelakovic, G., D. Nikolova, L. L. Gluud, R. G. Simonetti und C. Gluud. »Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases«. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3 2012. Bourdieu, P. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main 1982. DKV-Report. »Wie gesund lebt Deutschland?« Kurzvorstellung der Ergebnisse – Pressekonferenz am 10. August 2010. www.ergo.com/~/ media/ERGOcom/PDF/Studien/DKV/20100810-DKV-ReportKurzvorstellung-Ergebnisse.pdf (Download 17.2.2015). Dowideit, A. »Die gefährliche Illusion vom Essen, das gesund macht«. Die Welt 17.7.2011. www.welt.de/wirtschaft/article13491513/Diegefaehrliche-Illusion-vom-Essen-das-gesund-macht.html (Download 17.2.2015). Fleige, C. »Warum essen wir noch?«. taz.de 24.1.2014. www.taz. de/!131656/ (Download 17.2.2015). Focus (Hrsg.). Der Markt der Gesundheit. München 2007. Forum Gesundheitspolitik. »Raucherpfennig für Nikotinsünder, Speck-Steuer für Adipöse: Werden die alten Malus-Vorschläge der 90er Jahre jetzt Realität?«. 8.9.2008. www.forum-gesundheitspolitik. de/artikel/artikel.pl?artikel=1341 (Download 18.2.2015). Forum Gesundheitspolitik. Gesundheitswirtschaft. o. J. www.forumgesundheitspolitik.de/artikel/artikel.pl?rubrik=2071 (Download 17.2.2015). Friedrich, H., U. Mergner, E. Mönkeberg-Tun und G. Ziegeler (Hrsg.). »Gesundheit als gesellschaftlicher Zwang?« psychosozial (13) 42 1990, Heft II. Gröger, A.-C. »Generali erfindet den elektronischen Patienten«. Süddeutsche Zeitung 21.11.2014. Harmsen, T. »Ungesunde Lebensweise kostet Männer 17 Jahre«. Berliner Zeitung 19.8.2014. www.berliner-zeitung.de/wissen/krebsforschungungesunde-lebensweise-kostet-maenner-17-jahre,10808894,28156958. html (Download 17.2.2015). IPSOS. »Deutsche interessiert an Functional Food«. Pressemitteilung. 29.3.2011. www.ipsos.de/publikationen-und-presse/pressemittei 117 lungen/2011/deutsche-interessiert-an-functional-food (Download 17.2.2015). JAMA Internal Medicine. Collections »Less is more«. o. J. http://ar chinte.jamanetwork.com/collection.aspx?categoryid=6017 (Download 24.3.2015). Koch, K., und A. Waltering. »Was wir in unsere Gesundheit investieren und mit welchen Motiven wir es tun«. Gesundheitsmonitor Newsletter 1 2012. Marstedt, G., und R. Rosenbrock. »Verhaltensprävention: Guter Wille allein reicht nicht«. Gesundheitsmonitor 2009. Gesundheitsversorgung und Gestaltungsoptionen aus der Perspektive der Bevölkerung. Hrsg. J. Böcken, B. Braun und J. Landmann. Gütersloh 2009. 12–37. Meinert, J. »Wie Sie bis zu 17 Jahre länger leben«. Die Welt 18.8.2014. www.welt.de/gesundheit/article131330196/Wie-Sie-bis-zu-17-Jahrelaenger-leben.html (Download 17.2.2014). Naina K. »Uff. Und was machen wir jetzt?« Zeit online 16.1.2015. www. zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-01/twitter-nainablablaschule-diskussion (Download 24.3.2015). Reviermanager (Hrsg.). »Gesundheitsmarkt« – Serie in 12 Teilen (Januar–Dezember). Essen 2012. Spiegel online. »Kennzeichnung für Verbraucher: EU-Parlament stoppt Lebensmittel-Ampel«. Spiegel online 16.6.2010. www.spiegel. de/wirtschaft/unternehmen/kennzeichnung-fuer-verbraucher-euparlament-stoppt-lebensmittel-ampel-a-701062.html (Download 17.2.2015). VZBV – Verbraucherzentrale Bundesverband. »Hersteller tricksen mit Gesundheitsversprechen«. Pressemitteilung. 14.1.2015. www.vzbv. de/pressemeldung/hersteller-tricksen-mit-gesundheitsversprechen (Download 17.2.2015). WIdO – Wissenschaftliches Institut der AOK. »Private Zusatzleistungen in der Arztpraxis. Ergebnisse einer Repräsentativ-Umfrage«. WIdO-Monitor 1 2013. www.wido.de/fileadmin/wido/downloads/ pdf_wido_monitor/wido_mon_ausg1-2013_0313.pdf (Download 17.2.2015). Zühlsdorf, A., und A. Spiller (2014): Verbraucherwahrnehmung von ­Lebensmittelverpackungen. Ergebnisbericht des Projekts »Repräsentative Verbraucherbefragungen im Rahmen des Projektes Lebensmittelklarheit 2.0«. Göttingen 2014. 118