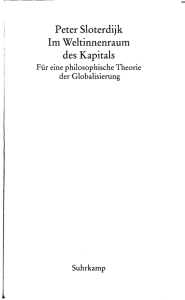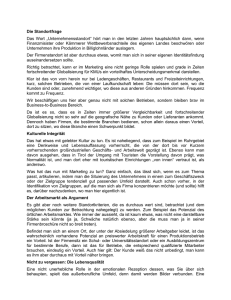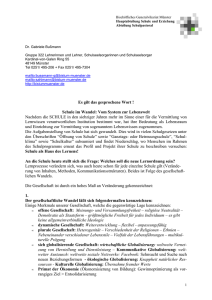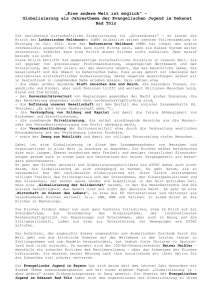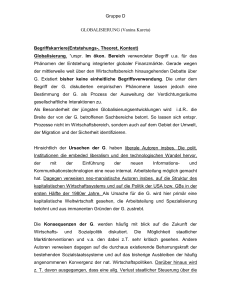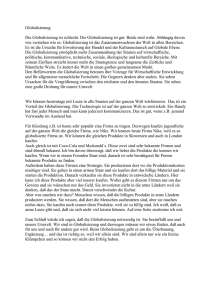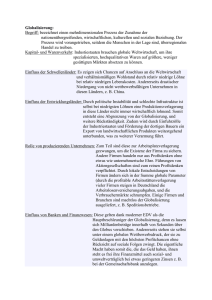Globalisierung und Sozialstaat gehören zusammen.
Werbung

Globalisierung und Sozialstaat gehören zusammen. Von Bert Rürup Deutschland gilt als der große Gewinner der Globalisierung. Glaubt man jüngsten Prognosen des Ifo-Instituts, so wird Deutschland in diesem Jahr China als Land mit dem weltgrößten Exportüberschuss ablösen. Sollte dieses Institut Recht behalten, so wird die Kritik am Geschäftsmodell der Deutschland AG bald wieder aufflammen: Deutschland bereichere sich auf Kosten anderer. Dieses Argument sei nicht ganz falsch, schrieb Marcel Fratzscher, der Präsident des DIW, jüngst im Handelsblatt. Tatsächlich sind Außenhandel und internationale Arbeitsteilung keine Nullsummenspiele. Sie machen die Menschheit insgesamt reicher, allerdings profitieren keineswegs alle Länder gleichermaßen davon. Und auch in den einzelnen Ländern kommen nicht alle Menschen in den Genuss dieser die Außenhandelsgewinne. Es gibt also keineswegs nur Gewinner; die Globalisierung hat auch viele Verlierer. Eine Politik, die freien Welthandel und offene Finanzmärkte fordert und fördert, ist deshalb gut beraten, die Verlierer der Globalisierung zu kompensieren. Sonst verliert sie den Rückhalt in der Bevölkerung; was derzeit in vielenwestlichen Industriestaaten zu beobachten ist. Nehmen wir als Beispiel einen ehemals gutbezahlten Monteur in einem deutschen Automobilwerk, der entlassen wurde, weil sein Arbeitgeber die arbeitskostenintensive Kabelbaumfertigung, in der er beschäftigt war, ins kostengünstigere Ausland verlagert hat. Er mag eine neue Stelle im Dienstleistungssektor gefunden haben, doch nur zu einem deutlich geringeren Lohn. Dieser Arbeitnehmer wird wenig Trost darin finden, dass sein ehemaliger Arbeitgeber den verbliebenen Beschäftigten gute Löhne zahlt und zudem seinen Gewinn und weltweiten Marktanteil steigert. Und es macht ihn auch nicht zufriedener, dass durch die Verlagerung der Fertigung dieser Komponenten Menschen in Osteuropa besser bezahlte Arbeitsplätze bekommen haben. Auch dass die Globalisierung insgesamt Hunger und Armut in den Schwellenländern reduziert hat und bei uns die Preise für Fernsehgeräte oder Mobiltelefone gesunken sind, kompensiert ihn nicht für seine Einkommenseinbußen. Gut 1 möglich, dass er zum Globalisierungsgegner geworden ist und Forderungen nach Handelsrestriktionen unterstützt. Das, was heute als Globalisierung bezeichnet wird, ist zu einem Teil die Folge der Öffnung zuvor abgeschotteter Märkte nach dem Kollaps des Ostblocks Ende der 1980er Jahre. Nicht weniger wichtig war allerdings, dass eine Dekade zuvor das bis dahin weltweit dominierende Konzept der keynesianischen Nachfragesteuerung durch den Monetarismus abgelöst wurde. Monetarismus steht neben dem Primat der Geldwertstabilität für eine Entstaatlichung von Industrien, die Deregulierung von Güter- und Finanzmärkten, den Abbau von Handelshemmnissen sowie eine Rückführung von Subventionen, Steuern und Sozialleistungen. Seit Beginn der 1980er Jahre wurden solche Maßnahmen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Entwicklungs- und Schwellenländern als Voraussetzung für eine Gewährung von Krediten durchgedrückt. Und in den entwickelten Staaten wurde die Nachfragesteuerung durch das Konzept der Angebotspolitik ersetzt. Dieser Regimewechsel erfolgte teils radikal wie in den USA mit den Reaganomics und in Großbritannien mit dem Thatcherismus. Oder er vollzog sich Schritt für Schritt wie in Deutschland und in den Niederlanden. Grundgedanke des Konzepts ist, das gute und stabile Gewinnerwartungen der Unternehmen die entscheidende Voraussetzung für hohe Beschäftigung und kräftiges Wirtschaftswachstum seien. Deshalb sollten die Arbeitsmärkte möglichst flexibel sein, die Löhne langsamer als die Produktivität wachsen, geringe Einkommen- und Gewinnsteuern die Leistungs- und Investitionsbereitschaft fördern und die Staatshaushalte ausgeglichen sein. Ohne diesen oft als Neoliberalismus verschrienen Paradigmenwechsel hin zur Angebotspolitik wäre es wohl nicht zu dem gekommen, was heute als Globalisierung bezeichnet wird: Die enge Einbindung einer zunehmenden Anzahl von Volkswirtschaften in die internationale Arbeitsteilung und die Liberalisierung der Finanzmärkte. Hans-Werner Sinn hat in seinem jüngst im Handelsblatt veröffentlichten Essay „Lob der Globalisierung“ aus weltwirtschaftlicher Sicht zweifellos recht: Die Entgrenzung der Güterund Finanzmärkte hat in den vergangenen 35 Jahren „die Ungleichheit auf der Welt nicht erhöht, sondern dramatisch verringert“. In der Tat ist der Anteil der Weltbevölkerung, der in existenzieller Armut lebt, in diesem Zeitraum von fast 45 Prozent auf derzeit etwa zwölf Prozent zurückgegangen. Aus Sicht eines wohlmeinenden Weltherrschers ist dies sicher ein grandioser Erfolg. Allerdings hat sich in der realen Welt in den entwickelten Industriestaaten ein tiefes Misstrauen in großen Bevölkerungskreisen gegenüber der Globalisierung breitgemacht. Dieses Unbehagen mag man als akademischer Ökonom angesichts der theoretisch unbestrittenen gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtseffekte freier Märkte und dem 2 offenkundigen Rückgang der existenziellen Armut auf der Welt als vernachlässigbar abtun, zumal zudem aus ökonomischer Sicht die für die gesamtwirtschaftliche Produktion stimulierenden Impulse im reifen Industriestaat Deutschland für die Globalisierung sprechen. Die politische Realität zeigt jedoch, dass breite Teile der Bevölkerungen wenig für eine solch ökonomische Sicht übrig haben. Demokratie steht für eine durch freie Wahlen legitimierte Herrschaft auf Zeit. Daher müssen Parteien und Regierungen in demokratischen Staaten Wahlen gewinnen, um gestalten zu können. Sie müssen konkrete Antworten sowohl auf tatsächliche, als auch auf gefühlte individuelle Wohlfahrtsverluste ihrer potenziellen Wähler geben. Denn in vielen etablierten Industriestaaten ist eine zunehmende Lohnspreizung zu beobachten, die mit stagnierenden, ja sinkenden Reallöhnen der Mittelschicht und unsicheren Arbeitsplätzen einhergeht - in Deutschland zum Glück bislang weniger als in anderen Ländern. Gleichzeitig verliert dauerhafte Vollzeitbeschäftigung an Bedeutung, während Unternehmens- und Vermögenseinkommen im Vergleich zu den Lohneinkommen überproportional ansteigen. So ist in Deutschland der Anteil der Lohneinkommen am gesamten Volkseinkommen von etwa 75 Prozent Mitte der 1980er Jahre auf derzeit gut 67 Prozent zurückgegangen. Dies alles kann nicht durch einen Verweis auf die Verringerung der Armut in den Entwicklungs- und Schwellenländern kompensiert werden. Der Aufstieg von Politikern wie Marine Le Pen, Donald Trump, Geert Wilders oder Victor Orban ist zu einem großen Teil Folge dieses Unbehagens, das in Abstiegsängsten der Mittelschicht mündet. Diese Ängste sind letztlich eine Folge des Versagens der nationalstaatlichen Sozialpolitik und womöglich auch einer der Gründe dafür, warum die Globalisierungsdynamik in der letzten Zeit deutlich abgenommen hat. Der Wirtschaftshistoriker Anthony B. Atkinson plädiert in seinem neuesten Buch „Ungleichheit. Was wir dagegen tun können“ für eine massive Umverteilungspolitik von oben nach unten. Dabei nennt er 15 konkrete staatliche Maßnahmen, die sich nicht in einer Erhöhung der Umverteilungseffizienz des Steuer- und Sozialsystems erschöpfen. Vielmehr fordert er Maßnahmen, die auch auf eine Verringerung der Einkommens- und Vermögensungleichheit bereits der Bruttowerte abzielen. Dazu schlägt er ein Grundeinkommen für alle vor. Außerdem fordert er, dass jeder, der volljährig wird, eine aus einer hohen Steuer auf bestehende Vermögen finanzierte Erbschaft erhält. Allerdings versäumt es Atkinson, die Frage zu beantworten, wie die „Reichen“ vor dem Hintergrund ihres großen politischen und medialen Einflusses dazu gebracht werden können, solch eine massive Umverteilungspolitik nicht zu blockieren oder sich ihr einfach durch Wegzug zu entziehen. 3 Hans-Werner Sinn hat vor gut 30 Jahren einen klügeren Weg aufgezeigt, wie mit den Risiken für die Einzelnen umzugehen ist, die zwingend aus wirtschaftlichen Innovationen oder einem wachstumsfördernden Strukturwandel erwachsen. In seiner Münchner Antrittsvorlesung „Risiko als Produktivitätsfaktor“ im Sommer 1985 arbeitete er in vorbildlicher Klarheit heraus, dass die Wachstumschancen einer Volkswirtschaft umso größer sind, je ausgeprägter die Fähigkeit der Bevölkerung ist, Risiken einzugehen, die die gesamtwirtschaftliche Produktivität steigern. Sein plastisches Beispiel: Erst als im 14. Jahrhundert in Venedig die Seeversicherung erfunden wurde, durch die das Risiko des Verlustes eines Schiffs auf viele Schultern verteilt werden konnte, wagten zahlreiche Kaufleute und Schiffseigner eine Beteiligung an dem sehr lukrativen Fernhandel. Die Folge war ein zuvor ungeahnter Wohlstand. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schiffe verloren gehen, wurde zwar nicht kleiner; durch die Verteilung dieser Risiken auf sehr viele Kaufleute und Reeder, verringerte sich jedoch das individuelle Risiko deutlich. Daraus folgerte Sinn damals: Staatliche Sozialversicherungen seien „nicht ausschließlich als Instrument zur Schaffung von Sicherheit, sondern ebenso als Instrument zur Vermehrung des knappen Produktionsfaktors Risiko zu sehen“. Wer also in Sozialabgaben oder in steuerfinanzierten Sozialleistungen nur einen Kostenblock für die Unternehmen sieht, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet und daher abgebaut werden sollte, der übersieht, dass ein effizienter und leistungsfähiger Sozialstaat ein Standortvorteil für die Wirtschaft sein kann. Nur wenn der Staat der Bevölkerung die Angst vor den Folgen von Globalisierung und Strukturwandel nimmt, können die Unternehmen die sich bietenden Möglichkeiten der Globalisierung und auch der Digitalisierung nutzen. Und nur dann kann die Volkswirtschaft von ihrem gegenwärtig verhaltenen Tempo wieder auf einen höheren Wachstumspfad gelangen. Wer die seit einigen Jahren zu konstatierende Globalisierungspause überwinden und die Chancen offener Güterund Finanzmärkte nutzen will, muss in einer Demokratie auf einen zielgerichteten Ausbau des Sozialstaats setzen - und nicht auf einen pauschalen Rückbau zur vermeintlichen Verbesserung der Standortbedingungen. 4