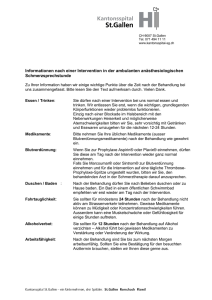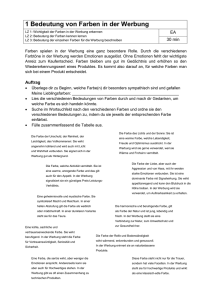Psychologie Zusammenfassung
Werbung
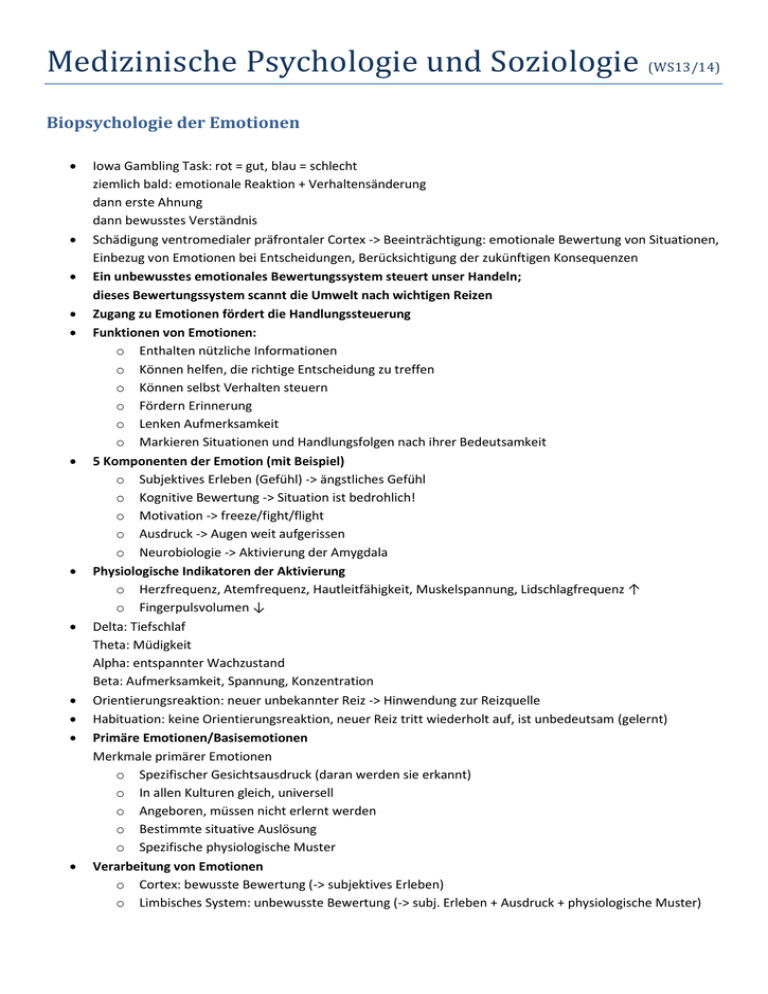
Medizinische Psychologie und Soziologie (WS13/14) Biopsychologie der Emotionen Iowa Gambling Task: rot = gut, blau = schlecht ziemlich bald: emotionale Reaktion + Verhaltensänderung dann erste Ahnung dann bewusstes Verständnis Schädigung ventromedialer präfrontaler Cortex -> Beeinträchtigung: emotionale Bewertung von Situationen, Einbezug von Emotionen bei Entscheidungen, Berücksichtigung der zukünftigen Konsequenzen Ein unbewusstes emotionales Bewertungssystem steuert unser Handeln; dieses Bewertungssystem scannt die Umwelt nach wichtigen Reizen Zugang zu Emotionen fördert die Handlungssteuerung Funktionen von Emotionen: o Enthalten nützliche Informationen o Können helfen, die richtige Entscheidung zu treffen o Können selbst Verhalten steuern o Fördern Erinnerung o Lenken Aufmerksamkeit o Markieren Situationen und Handlungsfolgen nach ihrer Bedeutsamkeit 5 Komponenten der Emotion (mit Beispiel) o Subjektives Erleben (Gefühl) -> ängstliches Gefühl o Kognitive Bewertung -> Situation ist bedrohlich! o Motivation -> freeze/fight/flight o Ausdruck -> Augen weit aufgerissen o Neurobiologie -> Aktivierung der Amygdala Physiologische Indikatoren der Aktivierung o Herzfrequenz, Atemfrequenz, Hautleitfähigkeit, Muskelspannung, Lidschlagfrequenz ↑ o Fingerpulsvolumen ↓ Delta: Tiefschlaf Theta: Müdigkeit Alpha: entspannter Wachzustand Beta: Aufmerksamkeit, Spannung, Konzentration Orientierungsreaktion: neuer unbekannter Reiz -> Hinwendung zur Reizquelle Habituation: keine Orientierungsreaktion, neuer Reiz tritt wiederholt auf, ist unbedeutsam (gelernt) Primäre Emotionen/Basisemotionen Merkmale primärer Emotionen o Spezifischer Gesichtsausdruck (daran werden sie erkannt) o In allen Kulturen gleich, universell o Angeboren, müssen nicht erlernt werden o Bestimmte situative Auslösung o Spezifische physiologische Muster Verarbeitung von Emotionen o Cortex: bewusste Bewertung (-> subjektives Erleben) o Limbisches System: unbewusste Bewertung (-> subj. Erleben + Ausdruck + physiologische Muster) Amygdala (Mandelkern) Funktionen o Erleben von Emotionen (insb. Angst!!) o Wahrnehmung des Gesichtsausdrucks bei anderen Menschen o Furchtkonditionierung o Implizite Erinnerungen o Markieren von deklarativen (episodischen) Erinnerungen o Aufmerksamkeitslenkung Gesichtswahrnehmung o automatische Beurteilung von Eigenschaften (vertrauenswürdig?, kompetent?, attraktiv? etc.) o erfolgt schnell o Beurteilungen treffen nicht unbedingt zu o Haben Verhaltenskonsequenzen o Primäre Emotionen haben Einfluss (Freude -> Vertrauenswürdig) o Je niedriger die Vertrauenswürdigkeit, desto höher die Amygdala-Aktivität Emotionsregulation: Limbisches System Schaltkreis Amygdala – anteriorer cingulärer Cortex negativer Feedback-Schaltkreis zwischen Amygdala + ACC -> Resonanz in Beziehung, Ängstlichkeit, Depressionsrisiko Emotionsregulation: Cortex Schaltkreis Amygdala – präfrontaler Cortex um Emotionen zu benennen -> reduziert Amygdala-Aktivität PFC reguliert Emotionen, zeigt erhöhte Aktivität beim Gefühle benennen, vermindert Amygdala-Aktivierung Ebenen der Emotionsverarbeitung Krankheitsbewältigung und Lebensqualität Wichtige Begriffe: o Krankheitsbewältigung (Krankheitsverarbeitung; engl. Coping): = Reaktion des Kranken auf die Belastungen, die mit einer Erkrankung einhergehen o Mortalität = bevölkerungsbezogene Sterblichkeit o Letalität = Anteil der Erkrankten, der an dieser Krankheit stirbt o Morbidität = Häufigkeit einer Krankheit o Komorbidität = Vorliegen mehrerer Krankheiten bei einem Patienten o Rezidiv = Rückfall im Heilungsprozess Ebenen der Krankheitsbewältigung o Kognitive Ebene: subjektive Krankheitstheorie -> ich bin krank durchs Rauchen o Emotionale Ebene: Krankheitserleben -> ich fühle mich ausgelaugt, die Krankheit mach mich traurig o Handlungsebene: Krankheitsverhalten -> Patient beteiligt sich aktiv an Behandlung Belastungen bei Krebskranken o Konfrontation mit Tod und Sterben o Unsicherheit des Verlaufs o Einschränkungen von Alltagsaktivitäten o Infragestellung sozialer Rollen in Beruf und Familie o Abhängigkeit von anderen o Kommunikations-Tabus o Beeinträchtigung der körperlichen Integrität, Veränderung des Körperbilds Verleugnung = Notfallreaktion gegen nicht bewältigbare Emotionen; wechselt in Ausprägung (kein Alles-oder-nichts-Phänomen), Schutz vor nicht bewältigbaren Emotionen Kausale Zusammenhänge: 1 Merkmal beeinfluss Merkmal 2 (Ursache -> Wirkung) Bsp: Depression beeinträchtigt Immunantwort auf Krebszellen; Depressive Patienten lehnen wirksame Behandlungsmaßnahmen ab; -> Mortalität Nicht-kausale Zusammenhänge: Merkmal 1 beeinflusst Merkmal 2 nicht, aber enthält Information über M2, so dass es M2 vorhersagt Bsp: schlechter körperlicher Zustand, Wissen des Patienten über schlechte Prognose -> begünstigt Entstehung einer Depression Tumor = 3. Variable, Confounder hier Tumor: wirkt kausal auch Depressiong und Mortalität Depression enthält Info über Prognose, beeinflusst sie aber nicht Risikofaktoren/prognostische Faktoren o … die die Entstehung einer Krankheit kausal beeinflussen = kausale Risikofaktoren … die deren Prognose oder die Mortalität kausal beeinflussen = kausale prognost. Faktoren o … die die Entstehung einer Krankheit vorhersagen, aber nicht kausal beeinflussen = Risikoindikatoren (risk markers) … die deren Prognose oder die Mortalität vorhersagen, aber nicht kausal beeinflussen = prognostische Indikatoren (prognostic markers) o Ist Variabel kausal oder Indikator? -> Interventionsstudie Will man die Kausalität überprüfen -> randomisierte kontrolliere Interventionsstudie Dimensionen sozialer Unterstützung o Emotionale Unterstützung (Zuhören, Trost) o Instrumentelle Unterstützung (praktische Hilfe) o Informative Unterstützung (Gabe von Informationen) o Bewertungsunterstützung (gemeinsame Werte) Wirkungsmodelle sozialer Unterstützung o Unterstützung hat generell eine günstige Wirkung o Unterstützung mildert Stresseffekte ab Gesundheitsbezogene Lebensqualität = subjektive Wahrnehmung des eigenen Gesundheitszustands Kerndimensionen der Lebensqualität o Körperliche Beschwerden o Psychisches Befinden o Funktionsfähigkeit o Soziale Rollen Subjektive Lebensqualität und Schwere der Erkrankung müssen nicht übereinstimmen Response shift = Verschiebung des Beurteilungsmaßstabs Symptomwahrnehmung und Somatisierung Prävalenz = Häufigkeit einer Krankheit in einer bestimmen Population in einem bestimmten Zeitraum Inzidenz = Häufigkeit von Neuerkrankungen in diesem Zeitraum Insgesamt haben 96% der deutschen Allgemeinbevölkerung irgendein Symptom Gesundheit ≠ Beschwerdefreiheit! -> haben alle Symptome, sind deswegen aber nicht alle ernsthaft krank Meist findet man keine organische Ursache für neu aufgetretene Beschwerden 80% der Beschwerden bessern sich nach 2 Wochen wieder, nach 3 Monaten bessern sich nochmal 60% Meist gute Prognose, also keine schwere Krankheit Depression = Beispiel für Beschwerde Symptome einer Depression o Interesse-/Freudlosigkeit o Antriebsstörung, Energieverlust o Todes-/Suizidgedanken o Verlust von Selbstvertrauen, übertriebene Schulgefühle o Psychomotorische Unruhe oder Gehemmtsein o Entscheidungsunfähigkeit Körperliche Beschwerden einer Depression o Konzentrationsstörung o Motorische Hemmung o Müdigkeit, Schlafstörung o Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme o Kopf/Muskel/Bauchschmerzen Ursachen der Unterdiagnose und –behandlung o Betroffene interpretieren Beschwerden nicht als Krankheitszeichen o Betroffene präsentieren körperliche statt psychische Symptome o Ärzte fragen nicht detailliert genug nach o Ärzte fühlen sich nicht kompetent oder zuständig o Behandlungsmöglichkeiten nicht ausreichend bekannt (Psychotherapie, Pharmakotherapie) o Schwierigkeiten der Behandlung werden nicht berücksichtigt (verzögerter Wirkungseintritt bei Pharmakotherapie) Folgen unerkannter Depression bei körperlich Kranken o Mangelnde Mitarbeit bei der Behandlung, Therapieabbruch o Unzufriedenheit mit der ärztlichen Behandlung o Zusätzliche Arztbesuche, Notaufnahmen o Längere Krankenhausaufenthalte o Schlechtere Krankheitsverläufe Screening-Fragen für Depression o Nach Stimmung fragen: Wie ist Ihre Stimmung? Sind sie manchmal niedergeschlagen, hoffnungslos? o Nach Lebensfreude fragen: Gibt es Dinge, die Ihnen Freude machen? Genetischer Risikofaktor der Depression Serotonin reguliert Stimmung, Schlaf, Appetit, u.a. reduzierte Aktivität des serotonergen Systems -> Depression Serotonin-Transporter-Gen bei unzureichender Entwicklung: verminderte Sensitivität für Serotonin -> höhere Disposition für Ängstlichkeit, höhere Aktivität der Amygdala in angstauslösender Situation Umweltrisikofaktor der Depression belastende Lebensereignisse lösen Depression aus stärkste Belastung: Tod eines nahen Angehörigen (Kind > Partner > Eltern) Interaktionseffekt: die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen wird durch eine dritte Variable (Moderatorvariable) beeinflusst Interaktion! Allein passiert nix! Deterministische Aussage: Ursache -> 100%ige Wirkung -> Folge Probabilistische Aussage: Umwelt und Zufall beeinflusst Verhalten Körperliche Beschwerden bei einem Angstanfall o Herzklopfen, Herzrasen o Brustschmerzen o Atemnot o Schwindel o Benommenheit o Schweißausbruch o Zittern o Übelkeit o Taubheitsgefühl o Hitze- oder Kältegefühle Somatisierung = körperliche Beschwerden ohne organischen Befund oder bei psychischen Stress Divergenz von subjektiven Befinden und objektivem Befund Häufige Somatisierungssymptome: o Schmerzen (Rücken, Kopf, Muskeln) o Müdigkeit, Schlafstörungen o Nervosität, Konzentrationsstörungen o Schwindel, Ohnmachtsgefühl o Appetitlosigkeit, Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung o Brustschmerzen, Herzstolpern, Atemnot o Menstruationsbeschwerden o !! typisch: viele und wechselnde Symptome Gesprächsführung: beruhigen, keine Pseudo-Diagnosen, nach Problemen fragen, regelmäßig einbestellen, psychosomatische Zusammenhänge erklären (Stress -> Beschwerdenwahrnehmung), zu Entspannungsverfahren motivieren Persönlichkeitspsychologie und Testdiagnostik Persönlichkeitseigenschaften: o beschreiben interindividuelle Unterschiede o = theoretische Konstrukte, die sich im Verhalten äußern (Verhaltensbeobachtung, Selbsteinschätzung (Test, Fragebogen)) o Besitzen eine hohe zeitliche Stabilität (über Jahre, Kontinuität, langfristig auch Veränderung mgl.) o Erklären die transsituative Konsistenz des Verhaltens o Beschreiben zeitlich stabile und transsituativ konsistente interindividuelle Unterschiede! Korrelation = Zusammenhang zwischen zwei Variablen !!BIG FIVE: Fünf-Faktoren-Modell o Extraversion (vs. Introversion) gesellig, aktiv, durchsetzungsfähig, offen (vs. still, schüchtern, zurückgezogen) o Neurotizismus (emotionale Labilität vs. emotionale Stabilität) o Verträglichkeit ängstlich, angespannt, impulsiv, nervös, verletzlich, unzufrieden (vs. stabil, ruhig, zufrieden) gutmütig, bescheiden, mitfühlend, herzlich, großzügig, vertrauensvoll, hilfsbereit (vs. unfreundlich, streitsüchtig, undankbar) o Gewissenhaftigkeit o Offenheit für Erfahrungen sorgfältig, verantwortungsvoll, zuverlässig, besonnen (vs. sorglos, unordentlich, leichtsinnig, unzuverlässig) vielfältig interessiert, einfallsreich, phantasievoll, wissbegierig, kreativ (vs. wenig Interesse an kulturellen Dingen, einfach, oberflächlich) Mediator-Variable: Vermittelt Zusammenhang; Bsp: Gesundheitsverhalten ist Mediator-Variable, die den Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Mortalität vermittelt (Wirkmechanismus) Korrelation ≠ Kausalität -> Korrelation ist Zusammenhang, keine einseitige Richtung, „gleichberechtigt“ Erblichkeit psychischer Merkmale von vielen Genen beeinflusst; es gibt nicht das Gen für Intelligenz, Depression, etc.; Jedes einzelne Gen hat nur einen kleinen Einfluss, es erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines bestimmten psychischen Merkmals; kein Determinismus; probabilistisch Umwelteinflüsse o Geteilte Umwelt: Umwelterfahrungen, die von allen Mitgliedern einer Familie geteilt werden -> machen Familienmitglieder einander ähnlicher o Nicht-geteilte Umwelt: Umwelterfahrungen, die für ein Individuum spezifisch sind -> machen Familienmitglieder einander unähnlicher o Gene machen je den größten Teil aus, nicht-geteilte Umwelt hat auch einen großen Einfluss, geteilte Umwelt hat bei Kindern auch Einfluss (wie nicht-geteilte), bei Erwachsenen nicht mehr Persönlichkeitseigenschaften entstehen unter dem Einfluss von Genen und (nicht-geteilten) Umwelterfahrungen Lerntheorien am Beispiel von Angststörungen (Dr. Richard) Klassische Konditionierung: Pawlow’scher Hund: Essen -> Sabber; Essen + Ton -> Sabber; Ton -> Sabber Angsterleben: Schreck -> Angst; Schreck + Kaufhaus -> Angst; Kaufhaus -> Angst o Reiz-Ersetzungslernen o Gleichzeitigkeit (Kontingenz) o Körperlicher Reflex o Gelerntes = gleiche Reaktion auf neuen Reiz Operante Konditionierung: Skinner-Box: Tastendruck -> Futter -> Glücklich -> häufigeres Betätigen der Taste; Positive Verstärkung der Aktion Angst -> Wegrennen -> Angst reduziert -> unglücklich -> rennt häufiger weg Negative Verstärkung der Aktion o Lernen durch Konsequenzen o Keine Gleichzeitigkeit o Regelmäßigkeit o Konsequenz verstärkt bzw. schwächt die Reaktion o Gelerntes = neue Verhaltensweise o Verschiedene Arten von Verstärkung Arten von Verstärkung Anwendung 1: Verhaltensänderung und Lernen durch gezielte Gestaltung dessen, was vor und nach einem Verhalten passiert. Hinweis/Aufforderung -> Verhalten -> Konsequenz Schrittweise Annäherungen an das gewünschte Ziel Verstärker: Essbares, Materiell, Sprachlich, Sozial (Schulterklopfen) Generalisierung: Neues Verhalten wird auch in anderen Kontexten gezeigt Anwendung 2: 2-Faktoren-Modell (Mowrer): Auslösende + Aufrechterhaltende Faktoren (Schreckliches Ereignis + Vermeidungsverhalten/kognitive Verzerrung) Löschung der Angstreaktion durch Exposition: - Klassische Konditionierung: Gleichzeitigkeit von Stimulus + Angst unterbrechen; Stimulus bei Entspannung - Operante Konditionierung: negative Verstärkung verhindern, positive Konsequenzen herbeiführen; Vermeidung unterbrechen, in Angst-Situation bleiben bis Angst weg Vorgehensweise der Exposition: o Flooding/Habituaion 1) Aufsuchen der Angstsituation und Verhinderung von Flucht/Vermeidung 2) so lang bleiben, bis Angstreaktion nachlässt 3) wiederholen und üben -> Rkt geht schneller weg o Systematische Desensibilisierung: 1) Angst-Hierarchie erstellen 2) Einübung von Entspannung 3) stufenweises Darbieten des Stimulus in entspanntem Zustand Stress und Krankheit Stress = Reaktion auf belastende Situation (Stressor), die die Bewältigungsmöglichkeiten beansprucht oder übersteigt Kognitiv-transaktionales Stressmodell (Lazarus) o Primäre Bewertung: Herausforderung? Bedrohung? o Sekundäre Bewertung: bewältigbar? o Neubewertung: erfolgreich bewältigt? Empfindlichkeit für sozialen Stress hängt vom Serotonin-Transporter-Gen ab: erhöhte Cortisolsekretion Warum tut Trennung weh? Beim Trennungs-Distress ist selbe Hirnregion wie bei körperlichem Schmerz aktiviert = cinculärer Cortex Neurotransmitter, die Schmerz und Trennungsdistress abmildern: endogene Opioide + Oxytocin Wirkung von Oxytocin o Wahrnehmung von Emotionen im Gesichtsausdruck o Erinnerung an Gesichter, Vertrautheit von Gesichtern o Vertrauen in sozialen Beziehungen, Kooperationsbereitschaft o Positive Kommunikation mit Partner o Verminderte Stressreaktion o Geringere Angst Arbeitsstress o Gratifikationskrisen-Modell o Anforderungs-Kontroll-Modell Soziale Schicht = sozioökonomischer Status 3 Indikatoren: Bildung + Beruf + Einkommen Höhere Morbidität und Mortalität in unteren Schichten -> sozialer Gradient Erklärung: soziale Selektion (Drift-Hypothese); Abstieg nach Krankheit; Bsp.: Schizophrenie soz. Verursachung; Krankheit durch niedrige Schicht; Bsp.: Lebens/Arbeitsbed., Gesundheitsverhalten, Stress Stress in Medizin; Belastungsquellen: o Strukturelle Arbeitsbedingungen (wenig Zeit für Patienten, Bürokratie, hohe Arbeitsbelastung) o Eingeschränkte Autonomie (z.B. durch kostendämpfende Maßnahmen) o Teamkonflikte (schlechtes Arbeitsklima, fehlende Anerkennung) o Konflikte mit Patienten und Angehörigen (fordernd, aggressiv, uneinsichtig) o Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten (bei chron. und letalen Krankheiten, Palliativmedizin) o Eingeschränktes Privatleben, schlechte Vereinbarkeit Beruf + Familie (Schicht, Überstunden, Nacht) 4 Typen der Bewältigung von Arbeitsbelastungen o Gesundheitstyp: Typ G kein exzessives Ausmaß an Engagement; Widerstandskraft und Bewältigungskompetenz, zufrieden o Schontyp: Typ S geringes Engagement, geringe Bedeutsamkeit der Arbeit, Distanzierungsfähigkeit, relativ zufrieden o Überforderungstyp: Typ A Exzessive Verausgabung, eingeschränkt distanzierungsfähig, vermindert widerstandsfähig, n. zufr. o Burnout-Typ: Typ B wenig Engagement, wenig distanzierungsfähig, wenig widerstandsfähig, hohe emotionale Beeinträ. Burn out: Symptome: o Emotionale Erschöpfung (niedergeschlagen, leer, reizbar) o Negative Gedanken (Pessimismus, Sinnlosigkeit) o Körperliche Beschwerden (erschöpft, Schlafstörung, verspannt) o Problematisches berufliches Verhalten (reduzierte Leistungsfähigkeit) o Wenig erholsames Freizeitverhalten (weniger soziale Kontakte, Streit) Burn out: Was tun? o Frühwarnsignale erkennen (Freunde fragen) o Belastungsquellen identifizieren (äußere und innere) o Arbeitszeiten und –abläufe ändern (weniger Überstunden, mehr Pausen) o Gesprächskultur im Team verbessern (Balintgruppe, Unterstützung einholen) o Eigene Leistungsansprüche überprüfen (Perfektionismus) o Freizeitbereich stärken Arzt-Patient-Beziehung Modelle der Arzt-Patient-Beziehung Arzt paternalistisch autonom A weiß, was für P gut und entscheidet im besten Interesse konsumentenorientiert Dienstleister A liefert Infos und führt gewünschte Behandlung aus kooperativ aktive Partizipation A informiert über Behandlungsoptionen, gibt Empfehlungen Patient passiv P tut, was A sagt autonom P weiß, was er will; ihm fehlen nur die nötigen Infos, um zu entscheiden aktive Partizipation P bringt eigene Werte und Ziele ein; Gemeinsame Entscheidung 80-95% der Patienten wollen auch bei schweren Krankheiten vollständig informiert werden Hindernisse der Partizipation: o Seitens des Patienten: Partizipationsbedürfnis abhängig von Alter und Bildungsstand Schwerkranke haben eventuell Angst, etwas falsch zu machen fehlende Gesprächskompetenz verständliche Information fehlt o Seitens des Arztes: Informationsbedürfnis des P wird unterschätzt Partizipationsbedürfnis wird unter – oder überschätzt Vorbehalte, Unsicherheit, Überforderung (schwierige P) fehlende Gesprächskompetenz keine Zeit Kontinuum der Entscheidungsfindung kein alles oder nichts! Empowerment = den Patienten dazu befähigen, bei medizinischen Entscheidungen gleichberechtigt mitzuwirken. Wie? -> 6 Schritte der gemeinsamen Entscheidung 1) Partizipationsbedürfnis des Patienten erfragen 2) Erwartungen und Befürchtungen des Patienten explorieren 3) Behandlungsoptionen vorstellen 4) Vor- und Nachteile besprechen 5) Gemeinsame Entscheidung treffen 6) Handlungsplan vereinbare 4 Schritte der emotionalen Unterstützung 1) Zuhören 2) Auf Gefühle des P achten Aktiv zuhören 3) Gefühle des P ansprechen 4) Krankheits- und Behandlungsvorstellungen des P explorieren 3 Basismerkmale hilfreicher Gesprächsführung o Einfühlung (Empathie) o Wertschätzung/Akzeptieren o Echtheit (Kongruenz) Einführung in die Forschungsmethodik Fragestellung: Vermindert eine psychologische Intervention (Behandlungsmaßnahme) die psychische Belastung bei z.B. Herzinfarktpatienten? Variable = Merkmal, das in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen kann: o Unabhängige Variable (Ursache: Intervention) o Abhängige Variable (Folge: psychische Belastung) Moderatorvariable: verändert einen Effekt (z.B. Geschlecht, bei Frauen mehr Erfolg) Mediatorvariable: vermittelt einen Effekt (krank -> Bewegung -> senkt Mortalität) Confounder (Störvariable): erzeugt einen Zusammenhang (Alkohol + Rauchen = assoziiert; Alkohol -> Krebs) Operationalisierung: Auswahl eines Messverfahrens, z.B. standardisierter Fragebogen Wirksamkeit: o Forschungshypothese/Alternativhypothese: Intervention hilft o Nullhypothese: Intervention hilft nicht o Mit welcher Sicherheit lässt sich ein Effekt kausal auf die Intervention zurückführen? o Validität einer Studie = Aussagekraft o Prä-Post-Studie nicht gut -> neben der Intervention können auch unspez. Faktoren Einfluss nehmen Differenz = Brutto-Effekt der Intervention + der unspez. Einflussfaktoren Veränderung kann nicht mit Sicherheit auf Intervention zurückgeführt werden o Randomisierte kontrollierte Studie: Einführung Kontrollgruppe zur Kontrolle unspez. Einflussfaktoren Sie wirken in Interventions- und Kontrollgruppen gleichermaßen -> Differenz im Ergebnis zwischen IG und KG entspricht Nettoeffekt der Intervention Vorbedingung jeder Studie: Prüfung der ethischen Unbedenklichkeit + informierte Einwilligung Randomisierung = zufällige Zuweisung der Studienteilnehmer zur Experimentalgruppe oder zu KG Zweck der Randomisierung: o Äquivalenz von EG und KG sicherstellen (gleiche Zusammensetzung hinsichtlich Studienteilnehmer) o Kontrolle des Einflusses personenbezogener Faktoren auf Studienergebnis o Studienergebnis wird nicht durch unterschiedliche Verteilung personenbezogener Einflussfaktoren zwischen EG und KG verzertt Parallelisierung/Matching: EG und KG gleich in Alter, Geschlecht, Krankheitsstand, Motivation, bekannte F. Randomisieren: + unbekannte Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können Auswertung RCT: o Nach Intervention: Vergleich IG und KG o In beiden Gruppen: wie groß ist Ausprägung der abhängigen Variable o Ist Unterschied zwischen beiden Gruppen signifikant? o Wenn ja, wird Nullhypothese angenommen o Wie groß ist Unterschied zwischen beiden Gruppen? -> Effektstärke Signifikant wenn kleiner 5%, kein Zufall! Effektstärke: 2 Maße o Bei kontinuierlichen Variablen: z.B. Depressionsskala Cohens d = (Mittelwerte EG – KG) / Standartabweichung o Bei dichotomen Variablen: z.B. Mortalität: verstorben vs. nicht verstorben Number needed to treat (NNT): Wie viel Patienten müssen behandelt werden, um bei einem einzigen ein unerwünschtes Ereignis (z.B. Tod) zu verhindern? Evidenzbasierte Medizin = Anwendung von Intervention, für deren Wirksamkeit empir. Evidenz existiert Evidenz = Nachweise für die Wirksamkeit einer Intervention Hierarchie der Evidenz = Rangreihe der Aussagekraft von Studientypen für den Wirksamkeitsnachweis Querschnitt-Studie < Ein-Gruppen-Prä-Post-Studie < Fall-Kontroll-Studie < Kohorten-Studie < RCT Querschnitt: Erhebung aller Daten zu einem einzigen Zeitpunkt Prä-Post: Messung vor und nach einer Intervention in 1 Gruppe Fall-Kontroll: Vergleich von Fällen einer Krankheit und Kontrollpersonen Kohorten/Längsschnitt: Beobachtung der Studienteilnehmer im zeitlichen Längsschnitt Internet Validität = Aussagekraft der Studie Externe Validität = Generalisierbarkeit des Ergebnisses (auf andere Patienten + Behandlungen) !! Keine externe Validität ohne interne Validität Psychosoziale Aspekte des Essverhaltens (Dr. Schowalter) Was bestimmt unser Essverhalten?: o innere Signale: Hunger, Emotionen (Essen -> positive Gefühle), Stressreduktion, Trösten o äußere Reize: Essgewohnheiten/regeln, Optik (Verkaufspsychologie), Größe des Tellers o kognitive Steuerung: BMI, Körperbild Risikofaktoren für Essstörung: Emotionales Essen, attraktive Nahrung, hohes Schlankheitsideal, Akzeptanz von Diäten Zunehmender BMI: Anorexia nervosa < Bulimia nervosa < Binge Eating Störung < Adipositas Bulimia nervosa: 1% der Frauen o Häufige Episoden von Fressattacken o Wiederholte kompensatorische Maßnahmen gegen Gewichtszunahme (Erbrechen etc.) o Fressattacken + kompensatorische Maßnahmen mind. 2x die Woche über 3 Monate) o Selbstbewertung ist übermäßig von Figur und Gewicht abhängig Anorexia nervosa: 0,3% der Frauen o BMI < 17,5 kg/m2 o Gewichtsverlust durch Vermeidung hochkalorischer Speisen o Eine folgender Mglk: Selbstinduziertes Erbrechen oder Abführen, übertriegene körperl. Aktivität, Appetitzügler oder Diuretika o Selbstwahrnehmung als zu fett, Furcht dick zu werden Binge eating Störung: o Wiederholte Episoden von Fressanfällen (Kontrollverlust) o Leiden wegen Fressanfälle o Seit 6 Monaten an min. 2 Tagen der Woche o Mind. 3 der folgenden Symptome: schnelleres Essen, Essen bis unangenehmes Völlegefühl, Essen ohne Hunger, Alleine Essen wegen Schamgefühlen, Ekel gegenüber sich selbst, Schuldgefühle Bis zu 13% der Frauen haben irgendeine Essstörung Therapieerfolg: o Anorexie: 30% ganz gut, 35% schwerer, aber nicht optimal, 25% chronisch, 15% Mortalität o Bulimie: 50% symptopmfrei, aber hohe Rückfallquote -> langfristig nur 30%